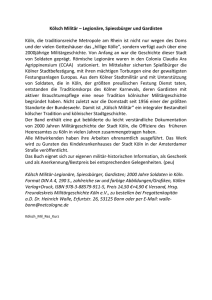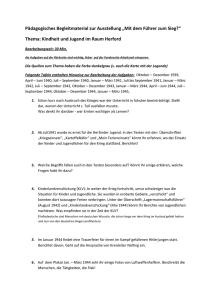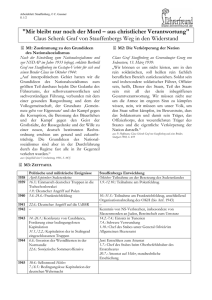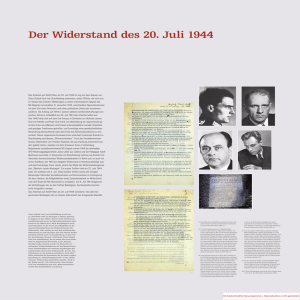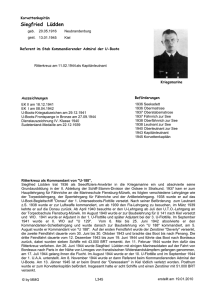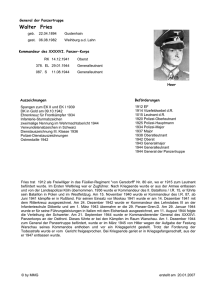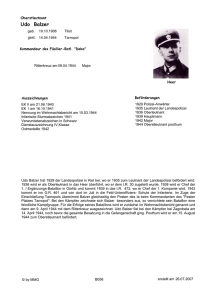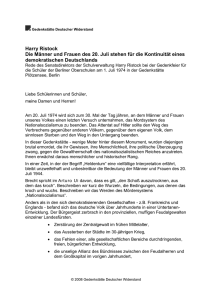MGFA Widerstand in Uniform Festung Wülzburg Kampf um Tsingtau
Werbung

Zeitschrift für historische Bildung C 21234 ISSN 0940 – 4163 Heft 2/2004 Militärgeschichte Militärgeschichte im Bild: Truppenfahnen für die Bundeswehr Widerstand in Uniform Festung Wülzburg Kampf um Tsingtau 1914 Militärgeschichtliches Forschungsamt MGFA IMPRESSUM Zeitschrift für historische Bildung Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt durch Kapitän z.S. Dr. Jörg Duppler und Oberst i.G. Dr. Hans Ehlert (V.i.S.d.P.) Produktionsredakteur der aktuellen Ausgabe: Major Heiner Bröckermann M.A. Redaktion: Major Heiner Bröckermann M.A. (hb) Oberleutnant Agilolf Keßelring M.A. (aak) Bildredaktion: Dipl.-Phil. Marina Sandig Redaktionsassistenz: Richard Göbelt, Stud. Phil. Lektorat: Dr. Aleksandar-S. Vuletić Layout/Grafik: Maurice Woynoski Karten: Dipl.-Ing. Bernd Nogli Anschrift der Redaktion: Redaktion »Militärgeschichte« Militärgeschichtliches Forschungsamt Postfach 60 11 22, 14411 Potsdam Telefon: (03 31) 97 14 -569 Telefax: (03 31) 97 14 -507 Homepage: www. mgfa.de Technische Herstellung: MGFA, Schriftleitung Editorial W as nützt uns die Tradition des 20. Juli 1944? Müssen wir sie heute noch pflegen, wo doch aktuelle Krisen unsere Aufmerksamkeit in andere Regionen lenken? Foto: MGFA, Modell und Foto der »Wolfsschanze« 1944 Militärgeschichte Der erste Bundespräsident Theodor Heuss hatte 1954 anlässlich des 10. Jahrestages des Staatsstreichs von 1944 in seiner Rede »Dank und Bekenntnis« mahnend festgestellt: »Das Vermächtnis ist noch in Wirksamkeit, die Verpflichtung noch nicht eingelöst.« Im Fußball war man damals gerade Weltmeister geworden, im Bewältigen der Vergangenheit tat man sich schwerer. Die vielfältigen Lasten von Wiederaufbau, Vertreibung und Besatzung lenkten das Interesse der Bevölkerung lange Zeit verstärkt auf das eigene Schicksal und Leiden hin. Die Mehrheit der Gesellschaft hatte bekanntlich keinen Widerstand geleistet. Und die Angst stand im Raum, durch die Pflege einer Tradition des 20. Juli 1944 die Erinnerung an den »ehrenvoll kämpfenden Soldaten« abwertend in den Hintergrund zu rücken. Bundespräsident Heuss schaffte die Gratwanderung und verband auch mit Blick auf seine eigene Biografie die damals scheinbar unvereinbaren Seiten. Die weitere Geschichte der Bundesrepublik bewies, dass man tatsächlich den festen Willen hatte, aus der Vergangenheit zu lernen und deren Fehler in einer modernen Demokratie nicht zu wiederholen. Manuskripte für die Militärgeschichte werden an diese Anschrift erbeten. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht gehaftet. Durch Annahme eines Manuskriptes erwirkt der Herausgeber auch das Recht zur Veröffentlichung, Übersetzung usw. Honorarabrechnung erfolgt jeweils nach Veröffentlichung. Die Redaktion behält sich Kürzungen eingereichter Beiträge vor. Nachdrucke, auch auszugsweise, fotomechanische Wiedergabe und Übersetzung sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Redaktion und mit Quellenangaben erlaubt. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Vervielfältigungen auf CD-ROM. Die Redaktion hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte derjenigen Seiten, auf die in dieser Zeitschrift durch Angabe eines Link verwiesen wird. Deshalb übernimmt die Redaktion keine Verantwortung für die Inhalte aller durch Angabe einer Linkadresse in dieser Zeitschrift genannten Seiten und deren Unterseiten. Dieses gilt für alle ausgewählten und angebotenen Links und für alle Seiteninhalte, zu denen Links oder Banner führen. Das Beispiel des Widerstandes vom 20. Juli 1944 hält für uns kein Patentrezept zur Bekämpfung von Terrorismus und gegen internationale Krisen parat. Es bietet uns jedoch eine Orientierung, die in einem Feldlager in Afghanistan ebenso gültig ist wie in einer Kaserne in Deutschland. Denn unser soldatischer Gehorsam ist an das Recht, die Menschenwürde und das persönliche Gewissen gebunden. Wer Freiheit verteidigt, muss auch in Freiheit dienen können. Als Bürger und Soldat Zivilcourage zu zeigen, heißt schließlich, seine eigene Meinung auch in Anbetracht persönlicher Nachteile zu vertreten und damit die Konsequenzen seines Handelns zu tragen. © 2004 für alle Beiträge beim Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA) Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen Insofern sind Stauffenberg, Tresckow und andere Widerstandskämpfer keine fernen Helden, sondern Vorbilder für unser heutiges rechtsstaatliches Denken und Handeln in Uniform, dem Vermächtnis des deutschen Widerstandes. Ein Symbol dieser Rechtstaatlichkeit in den Streitkräften ist auch unsere Truppenfahne, die unsere aktuelle Zeitschrift als Titelbild und Schlussartikel quasi einrahmt. Diese Ausgabe der Militärgeschichte zeigt Facetten des Widerstandes in Uniform an Personen wie Caesar von Hofacker und den Brüdern von Boeselager auf. Der geplante Artikel zur Atombewaffnung ist zugunsten eines Beitrages zur Festungsgeschichte entfallen und wird später nachgeholt. Unsere Serie zum Ersten Weltkrieg setzen wir mit einem Artikel zum Kampf um Tsingtau 1914 fort. Sollten nicht in allen Fällen die Rechteinhaber ermittelt worden sein, bitten wir ggf. um Mitteilung. Druck: SKN Druck und Verlag GmbH & Co., Norden ISSN 0940-4163 Heiner Bröckermann M.A. Major D i e A u t o r e n Inhalt • Soldaten für den Staatsstreich 4 • Caesar von Hofacker und der militärische Widerstand 8 Die Heeresgruppe Mitte und der 20. Juli 1944 Thomas Reuther M.A., geboren 1973 in Mannheim, Oberleutnant und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am MGFA, Potsdam • Die Festung Wülzburg 12 • Auf verlorenem Posten Der Kampf um das deutsche Pachtgebiet Kiautschou im Ersten Weltkrieg Dr. Eberhard Birk, geboren 1967 in Heilbronn, Dozent für Militärgeschichte an der Offizierschule der Luftwaffe, Fürstenfeldbruck Dr. Dorothee Reimann, geboren 1947 in Jena, Redakteurin bei MONUMENTE, dem Förderermagazin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Lars Nebelung M.A., geboren 1971 in Bonn-Bad Godesberg, Archivreferendar beim Landesarchiv Berlin • Service 16 22 Das historische Stichwort: Vor 60 Jahren: Die alliierte Invasion in der Normandie am 6. Juni 1944 22 Medien online / digital 24 Lesetipp 26 Ausstellungen 28 Geschichte kompakt 30 • Militärgeschichte im Bild Truppenfahnen für die Bundeswehr Fahnenübergabe am 7. Januar 1965 an das Wachbatallion durch Bundespräsident Heinrich Lübke. Foto: bpa/Ludwig Wegmann Weitere Mitarbeiter dieser Ausgabe: Oberstleutnant Dr. Gerhard P. Groß, MGFA; Oberst Dr. Winfried Heinemann, MGFA; Hauptmann Clemens Heitmann M.A., MGFA; Oberstleutnant Dr. Burkhard Köster, BMVg Bonn; Fregattenkapitän Herbert Kraus M.A., MHM Dresden; Dr. Andreas Kunz M.A., Bundesarchiv/Außenstelle Ludwigsburg; Dr. Gerhard Wiechmann, Oldenburg 31 Widerstand in Uniform Soldaten für den Staatsstreich Die Heeresgruppe Mitte und der 20. Juli 1944 O berst i.G. (im Generalstab) Henning von Tresckow arbeitete im Spätsommer 1943 zusammen mit Oberstleutnant i.G. Claus Schenk Graf von Stauffenberg und Major i.G. Hans-Ulrich von Oertzen die Pläne für den Sturz des NS-Regimes aus. Zwei Phasen lassen sich unterscheiden: Zunächst sollte das Militär zeitgleich mit der Verhaftung von Gestapobeamten und Parteifunktionären die vollziehende Gewalt übernehmen. Unabdingbare Voraussetzung und somit Auftakt der gesamten Erhebung war die Tötung Hitlers durch ein Attentat. Zuverlässige Truppen mit gewachsenem Zusammenhalt, die unter der Führung eingeweihter Offiziere eingesetzt werden konnten, gab es im Großraum Berlin nicht. Die Planung des Staatsstreiches beruhte auf der möglichst lange aufrecht zu erhaltenden Fiktion eines Putsches von SS und Parteikreisen, den es niederzuschlagen galt. In der zweiten Phase sollte eine neue politische Führung die Regierungsgeschäfte übernehmen. Dabei sollte Tresckow als neuer »Chef der Deutschen Polizei« den Staatsstreich mit vollenden und die neue Regierung absichern. Abgesehen vom Scheitern sahen die Verschwörer in einem Bürgerkrieg gegen regimetreue Truppen oder im Zusammenbruch von Frontabschnitten im Osten die größten Gefahren des Unternehmens. Als designierter »Chef der deutschen Polizei« und seit dem 1. Dezember als Generalstabschef der 2. Armee sah sich Tresckow im Falle des Staatsstreiches mit beiden Gefahren konfrontiert. Die 2. Armee gehörte zur Heeresgruppe Mitte, in deren Stab Tresckow bereits 4 1941 als 1. Generalstabsoffizier einen Verschwörerkreis um sich gebildet hatte. Im Februar 1943 hatte er zudem die Organisation der Aufstellung des »Reiterverbandes Boeselager«, dem späteren Kavallerieregiment Mitte unter der Führung von Oberstleutnant Georg Freiherr von Boeselager, übernommen. Die Schwadronen [Kompanien der Kavallerie] dieser Neuaufstellung waren einsatzerfahren, und ein kleiner Teil des Offizierkorps wurde in die Verschwörung eingeweiht. Aber noch im selben Jahr verlor die Verschwörung innerhalb der Heeresgruppe Mitte durch Personalveränderungen ihre aktive Rolle im Widerstand. Im Stab der 2. Armee hatte Tresckow geringere Wirkungsmöglichkeiten für den Widerstand als im Stab der Heeresgruppe. Als Vertrauter war dort anfangs nur Oberleutnant der Reserve Fabian von Schlabrendorff. Es gelang Tresckow aber, dass die durch Kämpfe aufgeriebene Kavallerie bei der 2. Armee neu und in größerem Umfang aufgestellt wurde. Aus dem Kavallerieregiment Mitte wurde so die 3. Kavalleriebrigade, die mit neuer Bewaffnung und einer Stärke von 16 348 Mann zum 1. Juli 1944 ihre Einsatzbereitschaft meldete. Tresckow holte außerdem zwei enge Vertraute und Freunde zu sich, Oertzen und Georg von Boeselager. Letzterer war verwundet worden und befand sich ohne Kommando im Armeestab. Es war beabsichtigt, ihn später mit der Führung der 3. Kav.Brigade zu beauftragen. Ab dem 22. Juni 1944 zerschlugen die sowjetischen Streitkräfte drei der vier Armeen der Heeresgruppe Mitte. Die 2. Armee war nicht angegriffen worden. Sie musste eine neue Front aufbauen, an der sie verlustreich nach Westen gedrängt wurde. Die Armeeführung befand sich dabei in einem sich zuspitzenden Gegensatz zur Heeresgruppenführung, die möglichst bald eine Haltelinie gegen den weit überlegenen Angreifer erzwingen wollte. Der Gestaltungsraum des Armeeoberkommandos wurde eingeengt. Dies war im Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 Juli 1944 der Handlungsrahmen des zum Generalmajor beförderten Tresckow bei der 2. Armee, der seine Maßnahmen im Sinne der Verschwörung grundsätzlich mit militärfachlichen Argumenten verschleiern musste. Am 14. Juni hatte er Stauffenberg seinen dringenden Rat zum Staatsstreich übermitteln lassen. Am 1. Juli erhielt er eine Antwort des frisch beförderten Oberst i.G., die baldiges Handeln ankündigte. Unabhängig davon entsandte Tresckow Georg von Boeselager nach Paris, um den Sturz des NS-Regimes möglicherweise durch ein Zusammenwirken mit den Westalliierten zu erreichen. Boeselager fand jedoch am 7. Juli beim Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Günther von Kluge, keine Bereitschaft zum Handeln und kehrte an die Ostfront zurück. Am 8. Juli ließ Tresckow Oertzen von der Front holen. Mit einem Flugzeug wurde er nach Warschau geflogen, um von dort in einem Nachtzug nach Berlin zu fahren. Ab dem folgenden Tag stand er der Verschwörung dort zur Verfügung. Tresckow informierte zudem die Verschwörer in seinem Umfeld über den bevorstehenden Staatsstreich, so zum Beispiel den Generalstabschef der südlich benachbarten 4. Panzerarmee, Oberst i.G. Georg Schulze-Büttger, am 10. Juli. Ein Anruf aus Berlin am 12. Juli orientierte ihn über das unmittelbare Bevorstehen des Attentats. Zu dieser Zeit teilte er auch Major Philipp Freiherr von Boeselager bei einem Frontbesuch mit: »Passen Sie auf sich auf! Wir brauchen Sie bald!« Dem Abteilungskommandeur in der 3. Kav.Brigade war klar, was gemeint war, denn sein Bruder Georg hatte ihn Wochen zuvor über den beabsichtigen Einsatz von Fronteinheiten in Berlin informiert. akg-images akg-images ullstein-bild Der militärische Widerstand W ar es ein »Aufstand des Gewissens« oder ein Militärputsch? Oberst i.G. Claus Graf von Stauffenberg war einer der brillantesten Generalstabsoffiziere seiner Generation – können es da nur ethisch-moralische Antriebe gewesen sein, die ihn dazu trieben, den Umsturz des NS-Regimes zu planen? Am Anfang des militärischen Widerstandes, schon 1938, standen durchaus militärischfachliche Überlegungen. General Ludwig Beck, der Chef des Generalstabs des Heeres, lehnte Hitlers Kriegspolitik nicht etwa deshalb ab, weil ihm Krieg an sich zuwider war, sondern weil nach seiner Lagebeurteilung ein Krieg gegen die Tschechoslowakei ein Eingreifen Frankreichs und damit unausweichlich die deutsche Niederlage nach sich ziehen musste. In diesen Zusammenhang gehören seine Sätze: »Es stehen hier letzte Entscheidungen für den Bestand der Nation auf dem Spiel; die Geschichte wird diese Führer mit einer Blutschuld belasten, wenn sie nicht nach ihrem fachlichen und staatspolitischen Wissen und Gewissen handeln. Ihr soldatischer Gehorsam hat dort eine Grenze, wo ihr Wissen, ihr Gewissen und ihre Verantwortung die Ausführung eines Befehls verbietet.« Als Hitler nicht einlenkte, zog Beck die letzte ihm damals denkbar erscheinende Konsequenz – er trat zurück. Die Widerstandsgruppe an der Ostfront, die sich im Kern bereits 1941 gebildet hatte, bezog ihre Motivation vor allem aus den vielen Verbrechen, deren Zeuge die Offiziere geworden waren. Das zentrale Verbrechen aber beging für sie Hitler an der Wehrmacht, vor allem am Heer: Die dilettantische Kriegführung, etwa die unsinnige Aufsplitterung der Angriffsrichtung 1941, oder, ebenfalls im Winter 1941/42, der Transport der europäischen Juden in Ghettos im Bereich der Heeresgruppe Mitte statt der dringend benötigten Munition an die Front: das alles kostete in den Augen dieser Offiziere unnötig deutsche Menschenleben. Dass Hitler verboten hatte, jenen Russen entgegen zu kommen, die in den Deutschen zunächst die Befreier vom Bolschewismus gesehen hatte, trieb die Menschen in den verwüsteten Landschaften ohne Not den Partisanen in die Arme – auch hierin sahen der Kopf der Verschwörer, Oberst i.G. Henning von Tresckow, und andere ein Verbrechen. Der Feindlageoffizier schrieb ins Kriegstagebuch: »Die Erschießungen werden als eine Verletzung der Ehre 5Henning von Tresckow 5Ludwig Beck der Deutschen Armee, in Sonderheit des Deutschen Offizierkorps betrachtet.« – verletzt war vor allem die »Ehre« ! Aber zunehmend wurde solchen traditionell, auch streng religiös erzogenen Offizieren die moralische Dimension ihres Tuns bewusst; Hauptmann Axel von dem Bussche etwa schloss sich der Opposition an, nachdem er Zeuge eines Massakers in der Ukraine geworden war. Generalmajor Helmuth Stieff schrieb an seine Frau: »Wir alle haben so viel Schuld auf uns geladen – denn wir sind ja mitverantwortlich –, daß ich in diesem angehenden Strafgericht nur eine gerechte Sühne für alle die Schandtaten sehe, die wir Deutschen in den letzten Jahren begangen bzw. geduldet haben.« Der Major i.G. Claus Graf von Stauffenberg von der Organisationsabteilung des Oberkommandos des Heeres pflegte Vorträge über die Kriegsspitzengliederung des Reiches mit der Bemerkung einzuleiten: »die Kriegsspitzengliederung der deutschen Wehrmacht sei noch blöder, als die befähigsten Generalstabsoffiziere sie erfinden könnten, wenn sie den Auftrag bekämen, die unsinnigste Kriegsspitzengliederung zu erfinden« . Hinter dieser flapsigen Formulierung steckte durchaus Sprengstoff, ging es doch darum, dass Hitler zugleich Staatsoberhaupt, Regierungschef, Oberbefehlshaber der Wehrmacht und seit 1941 auch Oberbefehlshaber des Heeres war, ohne vom Geschäft des militärischen Führers Ahnung zu haben. Hitlers wahnwitzige, unverantwortliche Führung kritisierten auch andere. Sarkastisch beginnt das letzte Flugblatt der Münchener Studenten, die sich unter dem Namen »Weiße Rose« zusammengefunden hatten: »Dreihundertdreißigtausend deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. Führer, wir danken dir!« Und der Kopf des zivilen Widerstands, Carl Goerdeler, hatte sich für seinen ersten Aufruf 5 Claus Schenk Graf von Stauffenberg – fast wortgleich – notiert: »Wer einen Stiefel besohlen will, muß es gelernt haben. Wer ein Millionenheer führen will, muß die Fähigkeit dazu auf den verschiedenen Stufenleitern harten militärischen Dienstes erlernt und bewiesen haben. [...] Hunderttausende braver Soldaten büßten für Vermessenheit und Eitelkeit eines einzelnen mit Leben, Gesundheit oder Verlust der Freiheit.« Das Ziel militärischen Widerstandes war es, diesem sinnlosen Morden ein Ende zu setzen und den aussichtslos gewordenen Krieg zu beenden. Je mehr aber mit dem Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte und dem bevorstehenden Ausbruch der Westalliierten aus den Brückenköpfen in der Normandie die vollständige deutsche Niederlage unausweichlich schien, je geringer der Spielraum für eine Umsturzregierung wurde, um so deutlicher trat die grundsätzlich moralische Begründung für den Aufstand hervor. In diese Zeit fällt der Satz Tresckows: »Das Attentat auf Hitler muß erfolgen, coûte que coûte [koste es, was es wolle]. Sollte es nicht gelingen, so muß trotzdem der Staatsstreich versucht werden. Denn es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, daß die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte unter Einsatz des Lebens den entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles andere ist daneben gleichgültig.« Und, ebenfalls kurz vor dem 20. Juli, Berthold Graf von Stauffenberg, der Bruder des Attentäters: »Das Furchtbarste ist, zu wissen, daß es nicht gelingen kann und daß man es dennoch für unser Land und unsere Kinder tun muß.« Der 20. Juli 1944 ist zunächst der Aufstand des militärischen Sachverstandes gegen den verbrecherischen Wahnsinn des nationalsozialistischen Krieges. Dahinter aber wird jener Aufstand des Gewissens sichtbar, der auch dann noch zum Handeln anspornte, als konkrete Vorteile kaum mehr zu erwarten waren. Winfried Heinemann Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 5 Widerstand in Uniform Im südlichen Teil der Armeefront, im Raum Pinsk, war im Rahmen des XX. Armeekorps die 3. Kav.Brigade eingesetzt. Es war Tresckow darauf angekommen, eine Abgabe oder einen frühzeitigen Einsatz gegen die vorrückenden sowjetischen Verbände zu verhindern. Dies war gelungen. Dem XX. Armeekorps hatte er bereits am 6. Juli den beabsichtigten Einsatz mitgeteilt: »Die Kav.Brigade soll vorn verzögern und dann durch die Front nach hinten durchgezogen werden.« Dort sollte sie, ihrer Eignung als bewegliche Reserve entsprechend, der Armee unmittelbar unterstellt werden, was aber zugleich auch die Verfügbarkeit für den Staatsstreich sicherstellte. Am 11. Juli begannen im Raum Pinsk die sowjetischen Angriffe. Die Ausweichbewegung des XX. Armeekorps wurde hauptsächlich durch die 3. Kav.Brigade gedeckt. Georg von Boeselager erkundete am 15. Juli an der mittleren Armeefront den voraussichtlichen Einsatzraum der Kav.Brigade. Wie sich sein Bruder erinnert, eröffnete Georg ihm kurz zuvor den Auftrag für den Staatsstreich. Da das Attentat unmittelbar bevorstünde, sollte Philipp aus dem Reiterregiment 31 sechs Schwadronen mit etwa 1200 Mann zu einem Sammelpunkt führen. Die Soldaten sollten von dort nach gelungenem Attentat per Lkw zu einem Feldflugplatz transportiert und anschließend nach Berlin geflogen werden. Am Flughafen Berlin-Tempelhof wollte Georg mit anderen eingeflogenen Einheiten warten, um die Führung zu übernehmen. Philipp von Boeselager erhielt Karten von Berlin, auf denen 6 die ersten Ziele eingezeichnet waren. Falls er seinen Bruder mit dessen Truppen in Berlin nicht antraf, sollte er selbständig mit seinen Einheiten zwei Standorte des Reichssicherheitshauptamtes und das Propagandaministerium besetzen und Propagandaminister Joseph Goebbels sowie Pressechef Otto Dietrich verhaften. Weitere Informationen, etwa über eine Verbindungsaufnahme mit den Berliner Verschwörern, erhielt er nicht. Am 15. Juli zog er bereits eine Schwadron aus dem unmittelbaren Kampfgeschehen. Es lässt sich nicht mehr feststellen, ob Stauffenberg über all dies nähere Informationen durch Oertzen erhalten hatte oder ob er diesen Einsatz in Berlin einplante. Es ist allerdings anzunehmen, dass Tresckow als neuer »Chef der Deutschen Polizei« mit dem Einsatz dieser Soldaten in der Reichshauptstadt gerechnet hat. Eine offene Frage ist dabei, wie er sich die Bereitstellung des Transportraums vorstellte. Im Normalfall wäre die Anforderung der Transportmaschinen durch die Heeresgruppe Mitte erfolgt. Eine Aussage darüber, ob dieser Hintergrund bei Tresckows Absicht, am 13. und am 20. Juli zur Heeresgruppe zu fliegen, eine Rolle spielte, ist nicht möglich. Transportkapazität war jedenfalls vorhanden. Allein die Luftflotte 6 verfügte am 20. Juli über 77 einsatzbereite Transportmaschinen. Unter den gegebenen Umständen war mit einem Lufttransport frühestens in der zweiten Phase des Staatsstreiches zu rechnen – also etwa 24 Stunden nach dem Attentat. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 Am 17. Juli ließ Oertzen in Berlin Tresckow informieren, dass nach zwei Versuchen (11. und 15. Juli) ein dritter Anlauf zum Attentat vorgesehen sei; einen Tag nannte er nicht. Am selben Tage besprach Tresckow mit dem XX. Armeekorps die Aufnahme der Kav.Brigade für den 18. Juli in der »C«Linie, in der zeitlich begrenzt verteidigt werden sollte. Der Armeeoberbefehlshaber Generaloberst Walter Weiß hatte dem Korps bereits am Tage zuvor die Abgabe der Brigade angekündigt. Deren Aufnahme und Marsch zum Verfügungsraum südlich Kobryn erfolgten planmäßig am 18. Juli. Trotz erster Anzeichen von Erschöpfung begann noch am selben Tage die Vorbereitung für den Folgeauftrag. Ein gegnerischer Durchbruch bot Tresckow die Gelegenheit, der 3. Kav.Brigade einen Auftrag westlich von Brest-Litovsk zu erteilen, der gleichermaßen für die Gefechtsführung und die Verschwörung zweckmäßig erschien. Die Brigade wurde dem Festungskommandanten von Brest unterstellt, obwohl der künftige Einsatzraum mit Masse außerhalb des Festungsbereiches lag. Diese Unterstellung bedeutete, dass die Kav.Brigade mit Eintreffen im Einsatzraum am 20. Juli auf sich allein gestellt war, ohne jedoch im Sinne einer Armeereserve für die übergeordnete Führung verfügbar zu sein. Je nach Gesprächspartner in seinem militärischen Umfeld stellte Tresckow den Sachverhalt unterschiedlich dar. Damit wurden die Rahmenbedingungen für die Verfügbarkeit von Teilen der 3. Kav.Brigade für den Staatsstreich geschaffen. Philipp von Boeselager verfügte weder über das eben skizzierte Lagebild, noch kannte er die von Tresckow und vermutlich auch seinem Bruder geschaffenen Rahmenbedingungen. Aus seiner Sicht fand die beabsichtigte Marschbewegung der sechs Schwadronen – weg von der Front nach Westen – außerhalb der militärischen Normalität als Teil des Staatsstreiches statt. Er weihte nur die Rittmeister d.R. Wilhelm König, Chef der 1. Schwadron, und Jan Hidding, Chef der 3. Schwadron, ein. Beide erhielten jeweils eine Berlin-Karte mit Einzeichnungen. Die Schwadronen waren unter dem Gesichtspunkt der Befähigung der Chefs und des Zusammenhaltes ausgewählt. Bei der Ausgabe des Marschbefehls begründete Philipp von Boeselager die Bewegung mit einem dringenden Einsatz gegen Partisanen. Das Marschziel befand sich auf halber Strecke zwischen den Feldflughäfen Biała-Podlaska und Terespol. Am 19. Juli rückten die sechs Schwadronen nach Westen ab. Die übrigen Teile der Brigade marschierten am selben Tage ebenfalls westlich zum Einsatzraum am Bug. Bei der Marschüberwachung der in zwei Marschgruppen weit auseinandergezogenen sechs Schwadronen war Philipp von Boeselager auf sich allein gestellt. Bei Brest, das als Festung unbedingt zu verteidigen war, rechnete er mit dem Versuch, die Schwadronen zur Verteidigung festzuhalten. Aufgrund der genannten Rahmenbedingungen gab es aber keinen derartigen Versuch, und Georg von Boeselager kontrollierte dort die Marschbewegung. Hinter Brest ritt Hidding auf eine von Partisanen verlegte Mine und war auf der Stelle tot. Philipp von Boeselager konnte dem befreundeten Rittmeister noch rechtzeitig vor Entdeckung die Karte von Berlin abnehmen. Die ersten Schwadronen erreichten am 20. Juli früh den Verfügungsraum. Die restlichen Teile trafen dort im Verlauf des Tages ein. In Vorbereitung auf den Lkw-Transport wurden die Pferde gesammelt, und die Soldaten erwarteten mit persönlicher Ausrüstung und Handwaffen das Weitere. Am 19. Juli hatte Tresckow Major i.G. Joachim Kuhn, 1. Generalstabsoffizier einer Division an der schwer angeschlagenen nördlichen Armeefront, als Letzten der Verschwörer informiert. An der Front sollte auf das Ergebnis des Attentats und auf neue Befehle der Verschwörer aus Berlin gewartet werden. Am 19. Juli hatte er auch für den folgenden Tag einen Flug zur Heeresgruppe geplant. Der Gegensatz zur Heeresgruppenführung über die Art der Gefechtsführung hatte sich weiter zugespitzt. Nach einem Gespräch mit seinem Oberbefehlshaber wurde das Vorhaben jedoch bis auf weiteres zurückgestellt. Tresckow schickte am 20. Juli Schlabrendorff als Überbringer einer militärischen Lagebeurteilung zur Heeresgruppenführung. Jener tauschte sich mit den dortigen Verschwörern aus, ohne etwas von der Bereitschaft der sechs Schwadronen zu wissen. Am Nachmittag des 20. Juli befand sich Schlabrendorff wieder bei der 2. Armee, als Oberst i.G. Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim aus Berlin bei den Verschwörern im Stab der Heeresgruppe anrief. Er teilte mit, das Attentat auf Hitler sei geglückt und Schlabrendorff solle unverzüglich nach Berlin kommen – wohl in seiner Eigenschaft als Ordonnanzoffizier Tresckows. Bald danach, um 17:42 Uhr, gab der Rundfunk bekannt, auf Hitler sei ein Attentat verübt worden, er sei aber nur leicht verletzt. Georg von Boeselager schickte daraufhin einen Melder zu seinem Bruder. Die Worte »Alles in die alten Löcher« galten als Nachricht für »Attentat nicht ausgeführt«. Alle Maßnahmen im Verfügungsraum wurden rückgängig gemacht, und Philipp von Boeselager führte die sechs Schwadronen in der Nacht zum Einsatzraum der 3. Kav.Brigade. Georg und Philipp von Boeselager rechneten nach dem 20. Juli mit ihrer Verhaftung, blieben jedoch unentdeckt. Am 21. Juli wurde die 3. Kav.Brigade wieder dem XX. Armeekorps unterstellt. Am Vormittag desselben Tages fuhr Tresckow abermals zu Kuhn an die Front. In Erwartung seiner Verhaftung durch die Gestapo wollte er sich dort selbst das Leben nehmen, und Kuhn sollte den Tod als Folge eines Partisanenüberfalls darstellen. Tresckow tötete sich mit einer Gewehrgranate, genau wie Oertzen einen Tag später in Berlin. Georg von Boeselager fiel am 27. August 1944 als Kommandeur der 3. Kav.Brigade an der Ostfront. Sein Bruder Philipp war bei Kriegsende Kommandeur des Reiterregimentes 31. Er lebt heute im Ahrtal. n Thomas Reuther Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 7 »Ein gefährlicher Staatsfeind, aber ein ganzer Kerl« Caesar von Hofacker und der militärische Widerstand E inige Offiziere des Attentats auf Hitler vom 20. Juli 1944, wie Oberst Claus Graf von Stauffenberg, Generaloberst Ludwig Beck oder Generalmajor Henning von Tresckow, sind jedem militärgeschichtlich Interessierten wohl bekannt. Selbst die Mehrzahl der zivilen Widerstandskreise in allen ihren Facetten (Weiße Rose, Kreisauer Kreis, Goerdeler-Kreis u.a.) können auf einen großen Grad an Bekanntheit verweisen, was Personen, Motive und Taten anbelangt. Merkwürdig ausgegrenzt – da nahezu unbekannt – bleibt Caesar von Hofacker, der im Zusammenhang mit Stauffenberg genannt und als dessen »Mann in Paris« tituliert wird. So wie der NS-Staat und der Zweite Weltkrieg ohne die Wehrmacht undenkbar sind, so war umgekehrt kein Erfolg der Gesamtheit des deutschen Widerstandes gegen Hitler und das NSRegime ohne militärischen Widerstand möglich. Auch wenn die Widerstandskämpfer aufgrund ihrer unterschiedlichen gesellschaftlichen und beruflichen Hintergründe verschiedene Ziele verfolgten, stimmten die militärischen und zivilen Verschwörer des 20. Juli 1944 im Sturz der verbrecherischen Hitler-Diktatur, der Beendigung des Krieges, der Ermöglichung von Politik und der »Wiederherstellung der Majestät des Rechts« überein. Durch die Erfahrungen des »RöhmPutsches« (1934), den damit zusammenhängenden Aufstieg der SS, vor allem aber durch die Vereidigung der Soldaten der Wehrmacht auf Adolf 8 Gedenkstätte Deutscher Widerstand Widerstand in Uniform Hitler war es unbedingt notwendig geworden, den Diktator zu beseitigen, um das NS-Regime insgesamt zu stürzen. Der Erfolg des zum Staatsstreich umgearbeiteten »Walküre«-Plans, der die Übernahme der Staatsgewalt durch die Wehrmacht vorsah, hing entscheidend hiervon ab. Andererseits erschien den Befürwortern des militärischen Widerstandes, der sich bereits lange vor dem 20. Juli 1944 formiert hatte, ein Attentat auf Hitler ohne einen darauf folgenden Staatsstreich sowohl sinnlos als auch unmoralisch. Wenn auch in diesem Jahr zum 60. Jahrestag des Attentats auf Hitler wieder die herausragenden zivilen und militärischen Repräsentanten des Widerstandes geehrt werden, gilt es den Blick auch auf die oft zu Unrecht in die zweite Reihe geratenen Personen des Widerstandes zu richten. Caesar von Hofacker wurde am 11. März 1896 in Ludwigsburg geboren. Sein Vater war der württembergische Generalleutnant Eberhard von Hofacker – Rommel hatte unter ihm im Ersten Weltkrieg gedient. Caesar von Hofackers Mutter war eine geborene Gräfin von Üxküll-Gyllenband – eine Urenkelin des preußischen Heeresreformers August Neidhardt von Gneisenau; genauso wie ihre Schwester, die 1904 den württembergischen Hofmarschall Graf von Stauffenberg heiratete: Caesar von Hofacker und Claus Graf von Stauffenberg waren Cousins und Nachkommen Gneisenaus. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 5 Caesar von Hofacker (1896–1944) Nach Abitur und Studienaufenthalten in Frankreich und Großbritannien meldete sich Hofacker im August 1914 freiwillig zum Militärdienst beim württembergischen Ulanen-Regiment Nr. 20, in dem sein Vater Kommandeur gewesen war. Seine ersten Feldverwendungen waren die Durchführung von Spähtrupps und Kampfeinsätzen an der Westfront, wo sein Bruder Alfred am 10. März 1917 vor Verdun fiel. Nach der Beförderung zum Reserveoffizier im März 1916 und Dienst in einem Divisionsstab meldete sich Caesar von Hofacker aufgrund eingeschränkter Verwendungs- und Einsatzmöglichkeiten der Kavallerie zur Fliegertruppe, wo er ab Mai 1916 als Flugzeugführer u.a. auch in Mazedonien in Aufklärungsund Jagdstaffeln eingesetzt war. Nach kurzer Verwendung beim Ulanen-Regiment König Wilhelm I. (2. Württembergisches) Nr. 20 erfolgte noch im Juni 1918 eine Versetzung zur Fliegertruppe der deutschen Militärmission im Osmanischen Reich. Ende Oktober 1918 geriet Hofacker in Bulgarien in französische Gefangenschaft, aus der er erst am 14. März 1920 entlassen wurde, als in Berlin der Kapp-Lüttwitz-Putsch an den Grundfesten der 3 Attentat auf Hitler Me 110 über Paris, akg-images Foto, um 1940. neuen, von großen Teilen der Reichswehr abgelehnten Republik rüttelte. Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft nahm Hofacker sein juristisches und staatswissenschaftliches Studium auf, das ihn an die Universitäten Tübingen und Göttingen führte; 1924 beendete er sein Studium mit der Promotion. Sein Einstieg in das Berufsleben nahm allerdings eine andere Richtung. Nach Tätigkeiten bei der Handelskammer Reutlingen und beim Verein Deutscher Seidenwebereien in Krefeld wechselte er 1927 zu den Vereinigten Stahlwerken, dem größten Montan-Konzern Europas in der Zwischenkriegszeit, in dem er bis zum Prokuristen aufstieg. Dennoch war Hofacker kein »WirtschaftsMann«, im Gegenteil: Er interessierte sich mehr für das öffentliche Leben und die Außenpolitik. Mehrmals unternahm er den Versuch, in diplomatische Dienste zu gelangen, was jedoch abgelehnt wurde. Seine Bindung an die Streitkräfte verlor er hingegen nicht. Von 1934 bis 1938 absolvierte Hofacker mehrere Wehrübungen bei Fliegerschulen und Aufklärungstruppen und wurde 1937 zum Hauptmann der Reserve befördert. Bei Kriegsbeginn 1939 wurde Hofacker deshalb als erfahrener Flieger reaktiviert und im Polen-Feldzug als FliegerVerbindungsoffizier eingesetzt. Während des »Sitzkrieges« im Westen gegen Frankreich, dem »drôle de guerre«, von Oktober 1939 bis Mitte Februar 1940, war Hofacker Staffelkapitän, und nach dem Erfolg des »Blitzkrieges« im Juni 1940 kam er zum Stab des Militärbefehlshabers von Frankreich, der in Paris im Hotel Majestic residierte. Aufgrund seiner leitenden Funktion in den Ver- einigten Stahlwerken lag es nahe, ihn mit der Führung des Referates »Eisenschaffende Industrie und Gießereien« zu betrauen. Während seiner Studentenzeit hatte Hofacker zu den Gründern des Deutschen Hochschulrings gehört, unter dessen Dach sich verschiedene nationalkonservative und völkische Organisationen verbanden. In seinen ersten Reden als Studentenführer konzentrierte er sich auf die damals aktuellen innenpolitischen Themenfelder. Wie so viele kam er mit der Niederlage des Kaiserreiches und deren politischen Folgen nicht zurecht. Auch antisemitische Reflexe waren in einer Rede Ende April 1921 an der österreichischen Universität Graz unüberhörbar. Hofacker war in jenen Jahren ein bekennender Gegner der Weimarer Republik. Sie verstand er als eine feindliche Herrschaftsform, deren angeblich formaldemokratische Verfassung er genauso ablehnte wie eine Anlehnung an die Bewegungen und Parteien der politischen Rechten. Von seinen innenpolitischen Ordnungsvorstellungen der frühen 20er Jahre verabschiedete er sich nach und nach. Außenpolitische Erwägungen drängten die emotionsgeladenen Reden der Studentenzeit ins Abseits. Bereits im Juni 1929 plädierte Hofacker in einem Brief an einen Pariser Professor für einen Nationalismus der »weisen Mäßigung« – dabei lag er auf der Linie des deutschen Außenministers Gustav Stresemann (1923–1929). Hofackers Motivation zum Widerstand entwickelte sich wie bei vielen Vertretern der Militäropposition sukzessive von einer die Realitäten der Besatzung in Kauf nehmenden Mitarbeit, wenn auch aus einer anderen Perspektive, über die systemimmanenten Handlungsoptionen der Verweigerung und Umsteuerung hin zu einem systemsprengenden Bestreben. Seine Auf- Viele Angehörige des nationalkonservativen Widerstands konnten sich nur schwer dazu durchringen, dass der Umsturz, eben die Wiedererrichtung der »Majestäts des Rechts«, mit einem »Mord« beginnen sollte. Lange favorisierte etwa Carl Goerdeler, der zivile Kopf des Widerstands, die Verhaftung und Aburteilung Hitlers statt eines Attentats. 4 Claus Schenk akg-images Messerschmitt Graf von Stauffenberg, Porträt um 1930 Bei realistischer Betrachtung, und Stauffenberg, Tresckow und Hofacker waren Realisten, musste aber deutlich werden, dass ein Vorgehen des Heeres gegen einen lebenden Hitler nicht zu erwarten war. Zu sehr würden sich Offiziere und Soldaten durch den auf die Person des »Führers« geleisteten Eid gebunden fühlen. Zu lange waren vor allem die jüngeren Offiziere im Führerkult erzogen worden. Ein militärischer Umsturz setzte zwingend das erfolgreiche Attentat voraus – das Attentat wiederum ließ sich nur aus dieser Notwendigkeit heraus moralisch rechtfertigen. Wie sehr Stauffenberg und seine Mitverschworenen mit dieser Einschätzung Recht hatten, erwies sich dann am 20. Juli 1944 selbst – Hitler war nicht tot, und das Heer folgte ihm weiterhin. Nichts sagt es drastischer als Kluges zitierter Ausspruch: »Ja, wenn das Schwein tot wäre. Aber so...« Winfried Heinemann gabe in der Militärverwaltung war es, die französische industrielle Leistungskraft der deutschen Kriegführung nutzbar zu machen. Aufgrund eigener Sympathien für Frankreich wollte er diesem Land durchaus eigene Entwicklungsmöglichkeiten einräumen, um es unter Umständen als möglichen Verbündeten zu gewinnen. Mit diesem Ansatz geriet er von Beginn an in Widerspruch zur offiziellen Politik. Dieser Gegensatz Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 9 Gedenkstätte Deutscher Widerstand ullstein-bild Widerstand in Uniform 3 General der Infanterie, Carl-Heinrich von Stülpnagel (1886–1944), Militärbefehlshaber in Frankreich 1942–1944 3 Die NS-Justiz praktizierte mit den Verschwörern des 20. Juli 1944 die so genannte Sippenhaft. Ausgehend von biologistischen Rechtstheorien sollte die ganze »Sippe« für die Taten des Familienoberhauptes büßen (Hausarrest, Gefängnis, auch Androhung der Todesstrafe). Das Foto zeigt die Familie Hofacker in glücklicheren Tagen. verschärfte sich, als Rüstungsminister Speer Hofacker im September 1942 die »Außenstelle zentrale Planung« übertrug. Nach einem Jahr ließ Hofacker sich von diesem Dienstposten entbinden und war fortan Stabsoffizier z.b.V. im Stab des Militärbefehlshabers in Frankreich, General der Infanterie CarlHeinrich von Stülpnagel. Es besteht kein Zweifel daran, dass Hofacker bei Stülpnagel und dessen Stab jenen Rückhalt besaß, der ihm die Handlungsspielräume öffnete, die er für sein Vorhaben, die Vorbereitung und Durchführung des Staatsstreichs in Paris, benötigte. Spätestens 1941 hatte sich ihm der verbrecherische Charakter des NSRegimes offenbart. Aus den Briefen an seine Frau Ilse-Lotte wird deutlich, dass er in der Lage war, französische Geiseln vor der Hinrichtung zu retten, und dass er die nationalsozialistische Judenverfolgung anprangerte: »Morgen werden wieder 100 Geiseln erschossen und 1500 Juden nach Osten deportiert [...] Es ist zum Verzweifeln.« In Hofacker reifte der Entschluss zum aktiven Widerstand, der auch vor dem Tyrannenmord nicht zurückschreckte. Ohne dass ein exakter Zeitpunkt dafür fixiert werden kann, wird man seinen Entschluss zu »Systemwechsel und Führerbeseitigung« spätestens für Ende 1942 mit der heraufziehenden Niederlage von Stalingrad datieren dürfen. 10 Mit seinem Cousin Stauffenberg verband Hofacker trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten »das Gefühl einer gemeinsamen Verschworenheit«, wie er später bei seinen GestapoVerhören bekannte. Deshalb lag die Gestapo mit ihrem Bericht vom 28. Juli 1944 vollkommen richtig, in dem Hofacker als »Kopf der am 20. Juli 1944 in Paris abgelaufenen Putschmaßnahmen« bezeichnet wurde. Wenige Tage vor dem Attentat schrieb Hofacker in einem Brief an seine Frau: »Heute wäre jedes unnütze Verstreichenlassen auch nur weniger Stunden eine Sünde wider den Heiligen Geist.« Das ständige Warten auf den »psychologisch richtigen Zeitpunkt« – ein Argument, mit dem sich viele Offiziere ihrer Verantwortung entzogen – konnte nicht immer beliebig weitergehen. Nach der Alarmierung am Nachmittag gegen 14 Uhr gelang es den Widerständlern in Paris bis zum späten Abend des 20. Juli ungefähr 1200 Mann von SS und SD, insbesondere deren Führungspersonal, festzusetzen. Kurz bevor die Stoßtrupps gegen 23 Uhr zur Verhaftung schritten, obwohl die Nachricht vom Überleben Hitlers schon längst bekannt geworden war, traf Stülpnagel mit Generalfeldmarschall von Kluge, dem Oberbefehlshaber West, zusammen. Stülpnagel erteilte gleich zu Beginn der Unterredung Hofacker das Wort, der den Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 Generalfeldmarschall eindringlich beschwor, die begonnene Aktion selbst nach dem Scheitern des Attentats weiterlaufen zu lassen. Kluge indes ordnete die Aufhebung der Verhaftungsbefehle an und enthob Stülpnagel seines Kommandos. Als Hofacker und Stülpnagel zuletzt noch einmal auf Kluge einredeten, meinte dieser resigniert: »Ja, wenn das Schwein tot wäre!« Stülpnagel hob die Verhaftung jedoch noch nicht auf. Mit Hofacker und Oberst Finckh besprach er die Möglichkeit einer raschen Exekution der Gefangenen SS- und SD-Führer um Kluge in den Umsturzplan hineinzuzwingen. Die Erschießungen waren bereits im Hof der École Militaire vorbereitet, Juristen hatten die Anklagepunkte formuliert : Judendeportationen, Sprengung der Pariser Synagogen und die Aneignung »reichsfeindlichen Vermögens«. Letztlich verwarf Stülpnagel jedoch diese Option und ordnete die Freilassung der Gefangenen an. In der Nacht zum 21. Juli wurde zwischen Wehrmacht, SS und SD eine »Sprachregelung« ausgearbeitet, die auf die Anregung des Generals Günther Blumentritt, Chef des Stabes beim Oberbefehlshaber West, zurückging und von »Irrtum« und »Alarmübung« sprach. Insbesondere SS und SD hatten ein Interesse daran, ihre Hofackers Bekenntnis zum Widerstand und zur Beteiligung am Staatsstreich führte dazu, dass ihn Hermann Göring am 11. August 1944 aus der Luftwaffe ausstieß. Der Ausschluss aus den Streitkräften, und damit die Verhinderung der Anwendung der Militärgerichtsbarkeit, war die Voraussetzung für die Überführung der Verschwörer an den sogenannten Volksgerichtshof Freislers. Am 29. August 1944 war der Tag der Verhandlung gegen Hofacker. Er blieb trotz aller Einschüchterungsversuche standhaft und hielt Freisler entgegen, dass er es bedauere, nicht selbst als Attentäter bestimmt gewesen zu sein; ein Scheitern wäre dann aus seiner Sicht unmöglich gewesen. Auf die regelmäßigen Unterbrechungen Freislers hin fiel Hofacker diesem ins Wort und rief ihm entgegen: »Sie schweigen jetzt, Herr Freisler! Denn heute geht es um meinen Kopf. In einem Jahr geht es um Ihren Kopf!« Am Tag darauf wurde Hofacker zusammen mit General Carl-Heinrich von Stülpnagel, Oberst Hans-Otfried von Linstow und Oberst Eberhard Finckh zum Tode verurteilt. Im Gegensatz zu so vielen am Umsturzversuch Beteiligten wurde Hofacker jedoch nicht sofort exekutiert. Dies deutet darauf hin, dass er, wie aus den geheimen Akten des Reichsicherheitshauptamtes hervorgeht, als die »treibende Kraft des Widerstandes« in Paris eingestuft wurde. Von ihm erhoffte man sich die Preisgabe weiterer Zusammenhänge und die Nennung von weiteren Mitwissern und Beteiligten. Am 20. Dezember 1944 wurde Caesar von Hofacker in der Haftanstalt Berlin-Plötzensee hingerichtet. Seine Familie befand sich zu diesem Zeitpunkt schon längst in »Sippenhaft«. Nach Ansicht des mitverschworenen Chef des Stabes der Heeresgruppe B, Generalleutnant Dr. Hans Speidel, war Hofacker »ein ausgesprochen politischer Kopf, eine schwungvolle Persönlichkeit von starker Überzeugungskraft.« Speidel war es auch, der die letzten Informationen über Hofacker vor dessen Hinrichtung zu überliefern wusste: »In ungebeugter Haltung begegnete er mir das letzte Mal am 19. Dezember auf dem Flur des GestapoKellers der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin. Nur mit den Augen konnten wir uns grüßen.« Für die durchweg positive Würdigung Hofackers durch Speidel mag auch ausschlaggebend gewesen sein, dass er, bei einer mehrstündigen Gegenüberstellung mit dem bereits zum Tode verurteilten Hofacker, von jenem – wahrheitswidrig – als von den Staatsstreichplänen nicht informiert bezeichnet wurde. Dies rettete Speidel ohne Frage das Leben. Volksgerichtshof Aber auch nach Aussagen anderer wurde Hofacker ähnlich wie sein Cousin Stauffenberg als eine faszinierende Persönlichkeit beschrieben, die durch mitreißende Energie, schwungvollen Elan und feste Überzeugungen Personen für sich sowie für den Widerstand gewinnen konnte. Dabei war seine Biographie, wie bei fast allen Beteiligten aus dem militärischen und konservativen Widerstand, keineswegs ohne Brüche. Hofacker hatte wie viele militärische Widerstandskämpfer nach und nach den Weg von nationalkonservativen, zu Teilen gar völkischen Denkmustern zu einem politisch und ethisch-moralisch begründeten Widerstand gefunden. Eine Würdigung, die er selbst aus den Worten seines ersten Vernehmenden, des Höheren SS- und Polizeiführers in Paris, SS-Obergruppenführer Oberg, erfuhr, charakterisiert ihn – berücksichtigt man die Perspektive – wohl am besten: »Ein gefährlicher Staatsfeind, aber ein ganzer Kerl.« Seit August 1942 war Roland Freisler (1893–1945) Präsident des Volksgerichtshofes (Foto). Ihm übertrug Adolf Hitler die Aufgabe, beschleunigte Prozesse gegen die Verschwörer durchzuführen. So sollten schnell abschreckende Todesurteile erreicht werden. Bei den Verfahren handelte es sich nicht um ordentliche Gerichtsverfahren, da die Urteile zumeist schon vor der Verhandlung feststanden, und den Angeklagten keine Wahlverteidiger zur Seite standen – die Pflichtverteidiger arbeiteten der Anklage eindeutig zu. Freislers Mordprozesse dienten von Anfang an der Vernichtung der Gegner Hitlers und nicht der Rechtsfindung. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit begannen am 7. August 1944 die Prozesse. Der große Saal des Kammergerichtsgebäudes in Berlin war mit einer Hitlerbüste und Hakenkreuzfahnen dekoriert. Bei den »Vernehmungen« wurden die Angeklagten dauernd unterbrochen und ihre Ausführungen mit Hohn und beißendem Spott kommentiert. Freisler beschimpfte die Angeklagten in herabwürdigender Form. Die meisten Angeklagten trugen Spuren von Haft und Misshandlungen, hinzu kamen seelische Erniedrigungen. Die Hinrichtungen erfolgten auf Verfügung Hitlers durch Erhängen statt durch Erschießen. Hierdurch sollte den »Verurteilten« noch im Moment des Todes die Ehre genommen werden. Im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Attentat vom 20. Juli wurden fast 200 Menschen ermordet. aak Als eigenständiger politischer Kopf, wenn auch in früherer Zeit zeitbedingten Strömungen huldigend, erkannte Hofacker schließlich die politische und moralische Verpflichtung zu einem aktiven Widerstand der Tat; er wurde zum Widerstandskämpfer aus Passion und opferte dafür sein Leben. n Eberhard Birk Nachdem Hitler das Attentat Stauffenbergs vom 20. Juli 1944 nur leicht verletzt überlebt hatte, wollte er mit seinen Gegnern sogleich »kurzen Prozess« machen – sie sollten »sofort hängen, ohne jedes Erbarmen«. Der Prozess sollte den Offizieren daher nicht durch Militärgerichte, sondern durch den so genannten Volksgerichtshof gemacht werden. Dieser war von den nationalsozialistischen Machthabern eingerichtet worden und ab 1934 für Fälle des Hoch- und Landesverrates zuständig. Nach dem 20. Juli 1944 wurde die Zuständigkeit dahingehend ausgedehnt, dass der Volksgerichtshof nun für alle politischen Straftaten, auch von Soldaten, zuständig war. akg-images Überrumpelung durch Wehrmachtseinheiten zu überspielen. So scheiterte aufgrund der Ereignisse im Reich und des gescheiterten Attentats auf Hitler der Umsturzversuch, obwohl in Paris die Operation »Walküre« erfolgreich durchgeführt worden war. Hofacker wurde am 25. Juli in Paris verhaftet – Flucht oder Untertauchen schloss er aus, zu offensichtlich war seine Beteiligung am Widerstand. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 11 Festung Wülzburg Die Festung Wülzburg »Arme Zitadellen – sie haben lange ausgedient! Arme Besitzer von Zitadellen – was machen sie mit ihrer kostspieligen Bausubstanz? Glückliche Freunde von Zitadellen, die Freude haben an dieser wertvollen Bausubstanz.« Prof. Dr.-Ing. Bernd Hillemeier, Technische Universität Berlin, 2001 S eit es Menschen gibt, schützen sie sich und die ihren vor Naturgewalten und vor Eindringlingen, die ihr Leben oder ihr Hab und Gut bedrohen. Höhlen, Zäune, Palisaden, aber auch Pfahlbauten boten ersten wirksamen Schutz. Später sicherte man Siedlungen und Herrschaftsbereiche durch Wälle und Wassergräben, errichtete Mauern, erfand Tore und Zugbrücken. Befestigte Städte und Burgen waren gleichzeitig Wehr- und Wohnbauten. Doch diese Anstrengungen genügten nur bis zur Einführung des Pulvergeschützes. Strategie und Taktik, Angriff und Verteidigung mussten danach völlig neu definiert werden. Deshalb begann man ab etwa 1500 mit dem Bau von Festungen. Grundrisse und Profile solcher Wehrbauten waren so angelegt, dass die Kugeln der Angreifer ihnen nichts anhaben und die Verteidiger mit ihren Geschützen und Handfeuerwaffen den Außenbereich vollständig abdecken konnten, also keine toten Winkel entstanden. Festungen dienten vorwiegend der militärischen Nutzung. In ihnen waren Kasernen, Arsenale, Speicher für Lebensmittel und andere für die Versorgung der Besatzung notwendige Einrichtungen untergebracht. Aber auch Städte wurden in dieser Zeit häufig den neuen Anforderungen entsprechend zu 12 Festungen ausgebaut – anschauliche Beispiele sind Nürnberg und Dömitz an der Elbe. Die Bauweise der Festungen blieb bis ins 19. Jahrhundert hinein ähnlich, doch zog jede Innovation auf der Seite der Waffen eine Antwort im Festungsbau nach sich. Wobei sich das Gewicht der Kräfte meist zugunsten der Feuerwaffen verschob, da der Wehrbau in seiner Schwerfälligkeit mit den artilleristischen und pyrotechnischen Neuerungen nicht Schritt halten konnte. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden zunehmend die neuen Materialien Beton und Stahlbeton eingesetzt. Westwall und Atlantikwall stehen im 20. Jahrhundert für die letzten Versuche, sich mit Hilfe von Festungsbauten zu verteidigen. Ein Beispiel einer frühen neuzeitlichen Festung aus der Zeit um 1600 ist die Wülzburg, die sich über dem mittelfränkischen Weißenburg erhebt. Sie zeichnet sich auch durch eine weitere Besonderheit aus, ist sie doch eine der ganz wenigen Bauten aus der Frühen Neuzeit, die auf einem Berg neu errichtet wurden. Denn die meisten der bis ins frühe 19. Jahrhundert entstandenen Festungen haben als Kern eine mittelalterliche Burg. Mit vorgelagerten Bastionen und Wallmauern verstärkt, Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 5 Blick von der Bastion Jungfrau zum Renaissance-Portal der Festung. Der Graben um die Wallmauer wurde tief in den Felsen getrieben und hat eine Breite bis 29 Meter. wurden sie der modernen Kriegstechnik angepasst – wie die Festung Rosenberg über Kronach und die Festung Königstein bei Dresden. Anderenorts bildeten die Zitadellen den Kern einer befestigten Stadt – wie in Jülich – und dienten so auch als Rückzugsort für die Bevölkerung. Die Zitadelle in BerlinSpandau dagegen ist von Wasser umgeben wie ehedem die Wasserburgen. Die Wülzburg, auf der mit 630 Metern höchsten Erhebung der südlichen Frankenalb gelegen, sollte – ähnlich wie früher eine Burg – das Territorium des Landesherrn sichern und seine Macht repräsentieren. Markgraf Georg Friedrich d. Ä. von Brandenburg-Ansbach und Kulmbach ließ die gewaltige Zitadelle 1588–1610 errichten. Zuvor hatte es hier oben lediglich ein Benediktinerkloster gegeben, das nach der Säkularisation 1537 in markgräflichen Besitz übergegangen war. In der Freien Reichsstadt Weißenburg am Fuße der Wülzburg herrschte wegen des Festungsbaus große Aufregung. Bei einem Probeschießen 1595 gingen die Geschosse in den Obstgär- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bastion Jungfrau Bastion Krebs Bastion Rossmühle Bastion Kaltes Eck Bastion Hauptwache Schloss Burgschänke Ludwigszisterne Kurtine Flanke Kavalier Scharwachthäuschen großer Waffenplatz (unvollendeter Ravelin) 14 Gedeckter Weg um den Graben 15 Glacis Im Luftbild ist die riesige Anlage mit einem Umfang von 970 Metern gut zu erkennen: Von den von Lynar geplanten fünf Schlossflügeln entlang der Mauern wurden nur der Westflügel und ein Teil des Südflügels realisiert. Beim Südflügel befindet sich auch der Eingang zur Festung. Die drei Bastionen im Vordergrund – Jungfrau, Krebs und Rossmühle genannt (v. l. n. r.) – sind stärker ausgebaut als das »Kalte Eck« und die »Hauptwache« oberhalb des Steilhanges. ten vor der Stadt nieder, eines schlug sogar mitten in der Stadt neben einer tanzenden Hochzeitsgesellschaft ein. Auch die anderen Nachbarn Weißenburgs fühlten sich durch den Festungsbau bedroht: das katholische Fürstbistum Eichstätt ebenso wie die protestantische Grafschaft Pappenheim und der Deutsche Orden mit Sitz in Ellingen. Doch die Klagen beim Reichskammergericht blieben erfolglos. Baumeister der Festung war zunächst Blasius Berwart d. Ä., der auch für den Wiederaufbau der Kulmbacher Plassenburg und den Umbau des Ansbacher Schlosses verantwortlich war. Nach dessen Tod 1589 entwickelte der im kurbrandenburgischen Dienst stehende italienische Militärbaumeister Rochus Guerini Graf zu Lynar das Festungskonzept weiter. Lynar war gleichzeitig mit der Vollendung der Spandauer Zitadelle und anderer brandenburgischer Bauten beschäftigt. Zu seiner Zeit erhielten die Bastionen aufwändige Flankenstellungen auf drei Ebenen, die für je zwei Kanonen angelegt waren. Nach seinem Tod 1596 Kavaliere, Kurtinen und Kasematten Mit den neuzeitlichen Festungen fanden einige Fremdwörter italienischen oder französischen Ursprungs Eingang in die deutsche Sprache. Mit Zitadelle – von italienisch »cittadella« für »kleine Stadt« oder »Stadtfestung« – bezeichnet man den inneren Teil einer Befestigungsanlage, der oft ein regelmäßiges Vieleck bildet. Am gebräuchlichsten sind Quadrate wie bei den Zitadellen Jülich und Berlin-Spandau sowie Fünfecke, wie wir sie bei der Zitadelle Dömitz und auch bei der Wülzburg nahezu perfekt vorfinden. Die Ecken einer Zitadelle werden von Bastionen gebildet, die meist eigene Namen haben und die als kräftige Bollwerke zur Aufstellung der Geschütze dienen. Zum Feind hin bilden die Bastionen Stirnseiten oder Facen, zu den eigenen Mauern hin Flanken. Auch in den Flanken wurden Geschütze postiert, welche die Mauern sichern, d.h. flankieren sollten. Die Gewölbe in den Bastionen – Kasematten genannt – dienten als Schutzräume, aber auch als Lagerplatz für Geschütze und Munition. Häufig wurden hier auch Gefangene untergebracht. Auf den Bastionsplattformen wurden so genannte Kavaliere errichtet – erhöhte Plätze, die eine weite Schussbahn ermöglichen. Scharwachthäuschen auf der vorderen Spitze der Bastionen dienten zur Beobachtung des Geländes. Die Mauern zwischen den Bastionen werden Kurtinen – aus dem Französischen für »Zwischenfassaden« – oder Wallmauern genannt. Nach außen hin ist die Zitadelle meist von einem Graben umgeben. Diesem vorgelagert sind dreieckige Vorschanzen oder Ravelins, die zum Schutz der Mauern oder auch als Waffenplatz dienten. Jenseits des Grabens verläuft ein sogenannter Gedeckter Weg, vor feindlichem Feuer geschützt durch einen Wall, der durch die Aufschüttung des umgebenden Geländes entstanden ist. Dieses eingeebnete und von Wald befreite Gelände (genannt Glacis) sollte dem Feind die Annäherung erschweren und freies Schussfeld bieten. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 13 Festung Wülzburg 5 Blick auf das Schloss im Innenhof der Festung. übernahm der Sohn des ersten Baumeisters, Blasius Berwart d. J., die Bauleitung. Auf den Rat des böhmischen Zeug- und Baumeisters Albrecht von Haberland hin wurden die bereits fertig gestellten Bastionen verändert, um sie gegen Angriffe widerstandsfähiger zu machen. Die Flankenstellungen wurden zugemauert, die Kavaliere mit Erdaufschüttungen verdeckt. Auch das von Lynar vorgesehene Schlosskonzept wurde nicht verwirklicht – man errichtete nur zwei der geplanten fünf Flügel entlang der Wallmauern. Davor die klassizistische Ludwigszisterne mit einem Fassungsvermögen von 1,35 Millionen Litern. 5 Das Renaissance-Portal der Festung. Über dem Eingang links das Wappen des Bauherrn, Markgraf Georg Friedrich, rechts das seiner zweiten Gemahlin, Sophie von BraunschweigLüneburg. Um 1600 entsprach die Festung mit den fünf mächtigen Bastionen den modernsten Anforderungen der Verteidigungskunst, doch hat sie ihren Zweck eigentlich niemals erfüllt. Und man kann allein wegen ihrer Lage auf einem an sich schwer einnehmbarem Berg annehmen, dass der Markgraf mit dem Bau der Zitadelle eher auf Repräsentation aus war als auf notwendige Verteidigung. Die weitere Geschichte der Wülzburg mag dieser Vermutung recht geben. Ohne Kampf wurde sie 1631 im Dreißigjährigen Krieg an den kaiserlichen Feldherrn Tzerklas Graf von Tilly übergeben, nachdem dieser gedroht hatte, anderenfalls die Residenzstadt Ansbach niederzubrennen. Danach versuchten die Schweden zwar die Festung einzunehmen, vermieden aber eine Belagerung, da sie zu viel an Truppen und Material gebunden hätte. Zu den einzigen Zerstörungen in der Festung kam es 1634 – aber nicht durch Beschuss, sondern durch ein Feuer in der Küche, das beide Schlossflügel in Schutt und Asche legte. Doch die Kasematten in den Bastionen und die Räume in den Kurtinen boten weiterhin ausreichend Raum für die Besatzung der Festung. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder in ansbachischem Besitz, verlor die Festung an militärischer Bedeutung. Sie diente fortan als Kaserne und als Staatsgefängnis. 5 Die eingebrochenen Gewölbe der Bastion Krebs. Im Vordergrund eine Kanonenrampe, auf der die Geschütze auf die Plattform geschoben wurden. Die Tritte dienten dazu, dass die Soldaten nicht wegrutschten. 14 Mit dem Ende der ansbachischen Linie der Hohenzollern 1791 fiel die Markgrafschaft an den preußischen König. 1806 zwang Napoleon Preußen, alle Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 fränkischen Territorien an das Königreich Bayern abzutreten. Da die bayerische Landesfestung Ingolstadt in Trümmern lag, kam der Wülzburg nun größere Bedeutung zu. Das führte dazu, dass die Festung nicht nur renoviert wurde, sondern dass man sich vor allem der Wasserversorgung annahm. Denn der Tiefe Brunnen im Westflügel des Schlosses – mit einst etwa 150 Metern einer der tiefsten Mitteleuropas – reichte für eine größere Besatzung nicht aus. Deshalb errichtete man ein ganzes System von unterirdischen Wasserspeichern, Zisternen, deren größte – die Ludwigszisterne – sich noch heute im Innenhof befindet. Doch die Kriegstechnik schritt im 19. Jahrhundert derart voran, dass viele Festungen bedeutungslos wurden. Die Entwicklung der Artillerie hatte zur Folge, dass die kleinen Festungen nicht mehr gegen Beschuss zu sichern waren. Im Krieg um die Vorherrschaft in Deutschland von 1866 wurde die Wülzburg letztmalig in den Kriegszustand versetzt. Ironie der Geschichte: Die Verschlüsse der gerade gelieferten hochmodernen Geschütze trafen erst nach Friedensschluss ein. 1867 wurde die Wülzburg dann endgültig aufgegeben. Ihre Zukunft war ungewiss; wie viele andere Festungen drohte sie als Steinbruch zu enden. Doch ausgerechnet die Stadt Weißenburg, die seinerzeit so vehement gegen den Bau eingetreten war, verhinderte die Zerstörung und erwarb die riesige Immobilie 1882 für 20 000 Reichsmark – nur ein Flügel des Schlosses ist bis heute im Besitz des Freistaates Bayern. Im Innenhof wurden zahlreiche Gebäude abgerissen, Bäume wurden gepflanzt, auf dem Berg wuchs immer mehr Wald. Die Weißenburger nutzen ihn bis heute für ihre Sonntagsausflüge. 1870/71 und in den beiden Weltkriegen diente die Festung als Gefangenen- und Internierungslager. Der wohl berühmteste Gefangene war 1918 der junge französische Offizier und spätere Staatspräsident Charles de Gaulle, der nach einem Fluchtversuch erst im Zug zwischen Würzburg und Aschaffenburg aufgegriffen wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren für einige Jahre Flüchtlinge auf der Wülzburg Deutsche Stiftung Denkmalschutz – »Damit Vergangenheit Zukunft hat« Mit der Idee, in Deutschland eine private Institution für die Bewahrung und Pflege des kulturellen Erbes zu etablieren, nahm 1985 die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) ihre Arbeit auf. Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten ist sie inzwischen zu einer der größten Bürgerinitiativen für den Denkmalschutz geworden. Mehr als 3000 Denkmale wurden von der Stiftung bisher mit über 310 Millionen Euro unterstützt. Dazu zählen Stadt- und Dorfkirchen, Schlösser und Burgen, Bürgerhäuser, öffentliche Bauten, Bauerngehöfte und Industriedenkmale ebenso wie Parks, Friedhöfe, Stadttore und Stadtmauern oder archäologische Grabungen. Ermöglicht wird die Arbeit der Stiftung aus Mitteln der Lotterie GlücksSpirale, zeitweisen öffentlichen Zuschüssen und durch private Spenden. Um eine noch breitere Unterstützung für den Denkmalschutz zu finden, koordiniert die Stiftung seit 1993 in Deutschland den »Tag des offenen Denkmals«. Durch ihre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die Zeitschrift MONUMENTE informiert die Stiftung über ihre Arbeit und allgemeine Denkmalschutzthemen. Mit Ausstellungen, Vorträgen, Reisen und Publikationen fördert die Stiftung das Wissen um das bauliche Erbe. Denkmalpflege bedeutet neben der akuten Rettungsarbeit insbesondere auch kontinuierliche Pflege. Daher sucht die DSD Stifter, die für ein Denkmal ihrer Wahl ein Stiftungskapital für die notwendige Pflege und Erhaltung dieses Kulturgutes zur Verfügung zu stellen. Wohl eine Million Einzeldenkmale bedürfen der Restaurierung und konstanten Pflege, um die Zeugnisse der Vergangenheit weiterhin als Quelle des Verständnisses der Gegenwart und damit für die Gestaltung der Zukunft zu nutzen. 5 Blick ins Land von der Bastion Kaltes Eck Wenn Sie mehr über die Arbeit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz wissen wollen, wenden Sie sich an: Deutsche Stiftung Denkmalschutz Koblenzer Str. 75, 53177 Bonn Tel.: 0228 – 95 73 80 4www.denkmalschutz.de untergebracht. Heute wird das Schloss von den Rummelsberger Anstalten e.V. genutzt, die hier junge Leute in Altenund Kinderpflegeberufen ausbilden. Über die Jahrhunderte haben Bastionen und Wallmauern der bis heute vollständig erhaltenen Festung sehr gelitten. Teilweise ist Wasser eingedrungen, Gewölbe sind eingebrochen. Seit den 1960er Jahren bemüht sich die Stadt Weißenburg, die Wülzburg instand zu setzen und so das gesamte Ausmaß dieser Renaissance-Zitadelle für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen. Unterstützung für das als Denkmal von nationalem Rang eingestufte Projekt gab es vom Bund, vom Freistaat Bayern, vom Regierungsbezirk Mittelfranken und vom Kreis WeißenburgGunzenhausen. Vor ein paar Jahren hat sich der Bund aus der Finanzierung zurückgezogen, deshalb hilft die Deutsche Stiftung Denkmalschutz seit 2001 mit bisher rund 270 000 Euro bei der Sanierung der am meisten zerstörten Bastion Krebs. Die früh-neuzeitliche Festung Wülzburg, die denen in Jülich und BerlinSpandau in nichts nachsteht, ist immer noch ein Geheimtipp. Deshalb gibt es hier – mitten in Franken – für Festungsfreunde noch viel zu entdecken! 5 Blick in den Festungsgraben zur Bastion Jungfrau, rechts im Vordergrund die Mauer der Bastion Krebs n Dorothee Reimann Führungen: 1. Mai bis Mitte Oktober: Sa. 13.00 bis 17.00 Uhr, So. und feiertags 11.00 bis 17.00 Uhr. Während der Pfingst- und Sommerferien in Bayern zusätzlich Mo. – Fr. 13.00 bis 17.00 Uhr. Letzte Führung jeweils 16.00 Uhr. Alle Fotos des Beitrages © DSD/M.L. Preiss Literaturtipp: Daniel Burger, Weißenburg in Bayern – Festung Wülzburg (= Burgen, Schlösser und Wehrbauten, Bd. 10), Regensburg 2002. ISBN 3-7954-1475-X; 64 S., 6,50 Hartwig Neumann, Festungsbau-Kunst und -Technik. Deutsche Wehrbauarchitektur vom XV. bis XX. Jahrhundert, Koblenz 1988. 5 ISBN 3-7637-5839-9; ca. 40,00 Kasematten der Bastion Krebs Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 15 G Marineschule Mürwik Kampf um Tsingtau 1914 roße Unruhe kam bei der deutschen Bevölkerung Tsingtaus nicht auf, als die Nachricht vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges am 3. August 1914 in der Hafenstadt am Gelben Meer eintraf. Zu weit entfernt wähnte man sich im von China gepachteten deutschen Gebiet Kiautschou von den Kampfhandlungen in der fernen Heimat. Zudem fühlte man sich in Tsingtau gut gerüstet: Seit 1898 war die Küstenlinie der Stadt durch eine Reihe von Geschützbatterien befestigt worden, die stark genug waren, um einer Beschießung durch Schiffsartillerie oder einem Landungsversuch standzuhalten. Insgesamt verteilten sich 21 Geschütze mit Kalibern zwischen 8,8 und 28 cm auf fünf verschiedene Küstenbatterien, die die äußere Kiautschou-Bucht und die Einfahrt zum Hafen sicherten. Auf verlorenem Posten Der Kampf um das deutsche Pachtgebiet Kiautschou im Ersten Weltkrieg Ein Angriff von der Landseite her wurde hingegen aufgrund des unwegsamen Geländes im einige Kilometer hinter der Stadt aufragenden LauschanGebirge von vornherein für wenig wahrscheinlich gehalten. Dafür wären große Truppenkontingente nötig gewesen, die nach deutscher Einschätzung keine der feindlichen europäischen Mächte in Ostasien aufbieten konnte. So waren nach dem Boxeraufstand im Jahr 1900 zum Schutz vor weiteren chinesischen Unruhen lediglich fünf leichte Befestigungsanlagen im Hinterland Tsingtaus angelegt worden, die mit vier bis zehn Maschinengewehren sowie einer Anzahl von Minenwerfern ausgestattet waren. In Verbindung mit einem durchgehenden, 15 Meter tiefen Stacheldrahthindernis mit Grabenansatz und Mauer sicherten diese so genannten Infanteriewerke den an dieser Stelle 5 1⁄2 Kilometer breiten Zugang zur Stadt, die auf einer Halbinsel lag. Zusätzlich bestand zur Landseite hin eine Reihe von mehr oder weniger gegen feindlichen Beschuss gesicherte Geschützstellungen, deren Kalibergrö- 16 ßen aber zum Teil wesentlich kleiner waren als die der Küstenartillerie. Das unmittelbar angrenzende China hatte indessen ohnehin schon kurz nach Kriegsausbruch seine Neutralität erklärt. So war der deutsche Gouverneur des Pachtgebietes Kiautschou, Kapitän zur See Alfred Meyer-Waldeck, zuversichtlich, den möglichen Angriff eines europäischen Feindes so lange abwehren zu können, bis die Kriegsentscheidung in Europa gefallen sein würde. Nach den Kalkulationen aus der Vorkriegszeit wurde diese innerhalb von wenigen Monaten erwartet. Bald trat jedoch ein Gegner auf den Plan, den die deutsche Seite zunächst nicht in die Überlegungen einbezogen hatte: Japan. Noch in den ersten Tagen des Monats August hatte der japanische Außenminister Kato mehrfach öffentlich die Absicht seines Landes erklärt, neutral zu bleiben, und in japanischen Zeitungen waren Freundschaftsbekundungen an Deutschland Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 zu lesen gewesen. Als allerdings die britischen Verbündeten anfragten, ob mit japanischer Hilfe gegen Deutschland zu rechnen sei, sah man in Tokio eine günstige Gelegenheit gekommen, die eigene Macht in Ostasien auszuweiten. Mit einem Krieg gegen Deutschland bot sich immerhin nicht nur die Chance, den deutschen Konkurrenten in China ein für alle Mal auszuschalten, sondern auch dessen Besitzungen auf dem chinesischen Festland und im Pazifik zu übernehmen. Folgerichtig wurde dem deutschen Botschafter in Tokio am 16. August 1914 ein japanisches Ultimatum überreicht, in dem die Entfernung oder Abrüstung aller im Tsingtauer Hafen und in Ostasien befindlichen deutschen Kriegsschiffe sowie die Übergabe des Kiautschougebiets bis zum 15. September gefordert wurden. Eine Antwort wurde bis zum 23. August erwartet, ansonsten werde die japanische Kriegserklärung erfolgen. Im deutschen Pachtgebiet dachte man hingegen nicht an Aufgabe. Bereits seit 5 Öffentliche Aushänge informierten die deutsche Bevölkerung von Tsingtau Foto: Marineschule Mürwik 3 Bismarckberg, Japanische Soldaten vor von der deutschen Geschützbedienung gesprengter Panzerkuppel einer 28-cm-Haubitze Anfang August waren deutsche Reservisten aus allen Teilen Ostasiens nach Tsingtau einberufen worden. Zusammen mit zahlreichen Freiwilligen sowie dem aus rund 500 Marineinfanteristen bestehenden Ostasiatischen Marinedetachement, das zuvor die deutschen Handelsniederlassungen in Peking und Tientsin geschützt hatte, erhöhte sich die Stärke der Tsingtauer Garnison, die sich im Frieden aus Soldaten des Cuxhavener III. Seebataillons sowie der Matrosenartillerieabteilung Kiautschou zusammensetzte, von ursprünglich 2625 schließlich auf ungefähr 4700 Mann. Auf der Werft bemühte man sich derweil, die im Hafen ankernden Handelsschiffe zu Hilfskriegsschiffen umzurüsten und einige im Dock liegende Kriegsschiffe so schnell wie möglich wieder einsatzfähig zu machen. Von den in Tsingtau befindlichen Schiffen konnten letztlich aber nur drei, das Kanonenboot »Jaguar«, das Torpedoboot »S 90« und der österreichische Kreuzer »Kaiserin Elisabeth«, an den späteren Kämpfen teilnehmen. Bereits am 31. Juli war der Kleine Kreuzer »Emden« aus dem Tsingtauer Hafen, der auch als Kohlenstation für das Ostasiatische Kreuzergeschwader diente, in Richtung Japanisches Meer ausgelaufen und eine Woche später mit dem in der Koreastraße gekaperten russischen Dampfer »Rjazan« zurückgekehrt. Kurz darauf verließ die »Emden« erneut die Kiautschou-Bucht und führte einige Monate lang, ganz auf sich allein gestellt, den Kreuzerkrieg im Indischen Ozean, in dessen Verlauf sie bis zu ihrer eigenen Zerstörung am 9. November 1914 rund 70 000 Bruttoregistertonnen an feindlichem Schiffsraum versenkte. Die Landbefestigungen des Pachtgebietes wurden inzwischen durch zusätzliche Schützengräben und Draht- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 17 Kampf um Tsingtau 1914 3 Gouvernementsgebäude, Sitz der deutschen verhaue verstärkt, während die Hafeneinfahrt mit zahlreichen Minensperren gegen feindliche Schiffe gesichert wurde. Zusätzlich versahen »Jaguar« und »S 90« einen regelmäßigen Patrouillendienst in der Kiautschou-Bucht. Schon beim Bekanntwerden des Kriegsausbruchs war es in Tsingtau zu einer regelrechten Panik unter der chinesischen Bevölkerung des Pachtgebiets gekommen. Nachdem jedoch ein sofortiger Angriff ausgeblieben war und die Löhne aufgrund der verstärkten Armierungsarbeiten deutlich angestiegen waren, kehrten viele zunächst geflüchtete Chinesen nach Tsingtau zurück. Nach der Veröffentlichung des japanischen Ultimatums verließen nun vor allem wohlhabendere Chinesen und hohe chinesische Beamte die Stadt. Die meisten deutschen Frauen und Kinder wurden per Dampfer und Eisenbahn evakuiert. Die letzten japanischen Einwohner Tsingtaus hingegen wurden am 20. August von der deutschen Verwaltung ausgewiesen. Nachdem die kaiserliche Reichsregierung die Aufforderung Japans nach Übergabe des Kiautschougebietes unbeantwortet gelassen hatte, erfolgte die japanische Kriegserklärung am 23. August 1914. Kurz vorher hatte der deutsche Gouverneur in Tsingtau seiner Haltung zu den bevorstehenden Ereignissen in einem knappen Telegramm an Kaiser Wilhelm II. Ausdruck verliehen: »Einstehe für Pflichterfüllung bis zum äußersten.« Zu ersten Kampfhandlungen war es bereits am 22. August gekommen, als der britische Zerstörer »Kennet« vor der Kiautschou-Bucht von dem deutschen Torpedoboot »S 90« schwer 18 Marineschule Mürwik Marineschule Mürwik Kolonialverwaltung, mit Geschosstreffer beschädigt und zum Abdrehen gezwungen worden war. Am 27. August erschien ein japanisches Geschwader vor Tsingtau, das aus neun Kriegsschiffen bestand und die Seeblockade der Stadt eröffnete. Schon nach drei Tagen lief jedoch einer der japanischen Zerstörer in einem Sturm auf Grund und wurde durch das Kanonenboot »Jaguar« endgültig versenkt. Anfang September stieß noch der britische Zerstörer »Triumph« zur Blockadeflotte, der fortan von der chinesischen Bevölkerung Tsingtaus »Kuliaufseher« genannt wurde, wobei mit »Kulis« zu dieser Zeit im Allgemeinen Asiaten gemeint waren. In der Folgezeit waren die Kriegsschiffe hauptsächlich mit Minenräumungen beschäftigt, was aber durch das stürmische Wetter stark behindert wurde. Seit Anfang September erfolgten zudem fast tägliche Aufklärungsflüge japanischer Militärflugzeuge, die bisweilen auch einzelne Bomben auf die Stadt warfen, ohne dabei allerdings größeren Schaden anzurichten. Diese Maßnahmen von der Seeseite her dienten jedoch nur zur Vorbereitung eines anderen, weit größeren Vorhabens: Am 2. September landeten starke japanische Truppenverbände mit 26 Transportschiffen, die von 36 Kriegsschiffen geschützt wurden, im Norden der Halbinsel Schantung, etwa 180 Kilometer vom deutschen Pachtgebiet Kiautschou entfernt. Das chinesische Einverständnis dazu hatten die Japaner vorausgesetzt, und tatsächlich blieb der chinesischen Regierung nur übrig, die geschaffenen Fakten anzuerkennen und den östlichen Teil der Provinz Schantung einen Tag später zur »Kriegszone« zu erklären, da dort die chinesische Neutralität nicht gewährleistet werden könne. Innerhalb kurzer Zeit besetz- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 ten japanischen Truppen die deutschen Bergwerke und Eisenbahnlinien in Schantung, was heftige, aber wirkungslose Proteste der Chinesen zur Folge hatte. Die Deutschen hatten nach dem Bekanntwerden der Landung der Japaner damit begonnen, die Eisenbahnverbindung Tsingtaus mit dem Hinterland durch Zerstörung von Brücken und Weichen sowie durch die Aufnahme von Schienen unbrauchbar zu machen, um den japanischen Vormarsch zu erschweren. Viel mehr wurde dieser allerdings gehemmt durch die seit Ende August immer stärker wütenden Unwetter, die die unbefestigten Wege im Hinterland morastig gemacht und die sonst seichten Flüsse in reißende Ströme verwandelt hatten. Auch die zusätzlichen deutschen Landbefestigungen vor Tsingtau, die seit Kriegsausbruch angelegt worden waren, hatten unter den heftigen Regenfällen zu leiden. Erst am 12. September wurde das Wetter wieder besser. An diesem Tag begannen auch die Aufklärungsflüge des einzigen einsatzfähigen deutschen Flugzeuges in der Stadt zur Beobachtung des japanischen Vormarsches auf das Kiautschougebiet. Die Japaner kamen nun besser voran und lieferten sich bald die ersten kleineren Gefechte mit deutschen Patrouillen. Nach und nach wurden Belagerungsartillerie und weitere Truppenverstärkungen herangeführt, unter anderem auch 1200 britische und indische Soldaten. Zu diesem Zweck war in der Lauschan-Bucht unweit der Grenzen des deutschen Pachtgebietes eine Nachschubbasis für den bevorstehenden Angriff eingerichtet worden, die ständig von See her versorgt wurde. Die deutschen Truppen zogen sich indessen allmählich kämpfend auf ihre vorbereiteten Verteidigungsstellungen zurück. Dabei griffen die in der KiautschouBucht liegenden deutschen Kriegsschiffe mit ihren Bordgeschützen in die Landgefechte ein und behinderten das japanische Vorrücken zum Teil erheblich. Nun begannen die Deutschen allmählich damit, die für die Verteidigung nicht benötigten Schiffe in der Bucht zu versenken, um sie nicht dem Feind in die Hände fallen zu lassen. Die Hafeneinfahrt wurde auf diese Weise mit drei großen Dampfern versperrt. Das Torpedoboot »S 90« unternahm hingegen am 17. Oktober einen wagemutigen Angriff auf das kräftemäßig weit überlegene Blockadegeschwader. Dabei versenkte es durch drei Torpedotreffer den japanischen Kreuzer »Takachiho« mit 284 Mann Besatzung, von denen lediglich 13 den Angriff überlebten. Da »S 90« wegen seiner zu geringen Geschwindigkeit den feindlichen Schiffen, die sofort die Verfolgung aufnahmen, nicht entkommen konnte, wurde es südlich von Tsingtau auf Grund gesetzt und von seiner Besatzung gesprengt. Die Mannschaft konnte sich ins Landesinnere retten und wurde schließlich von den Chinesen bis zum Kriegsende in Nanking interniert. Schon wenige Tage zuvor war die Blockadeflotte empfindlich geschwächt worden, als der britische Kreuzer »Triumph« durch einen Volltreffer der deutschen Küstenbatterien Das deutsche Schutzgebiet Kiautschou Die Ermordung von zwei deutschen Missionaren am 1. November 1897 in der chinesischen Provinz Schantung gab dem Deutschen Reich den Anlass, dort als »Sühnemaßnahme« eine bereits einige Jahre vorher vom Oberkommando der Marine ins Auge gefasste Meeresbucht mit dem dazugehörigen Küstenstreifen am 14. November 1897 durch deutsche Marinetruppen kampflos zu besetzen. Durch einen am 6. März 1898 unter deutschem Druck abgeschlossenen deutsch-chinesischen Vertrag pachtete Deutschland das nach einer in der Nähe gelegenen Stadt »Kiautschougebiet« genannte Territorium für eine Dauer von 99 Jahren. Außerdem wurde eine daran angrenzende, 50 Kilometer tiefe neutrale Zone eingerichtet und dem Deutschen Reich der Betrieb von Bergwerken und Eisenbahnen in der chinesischen Provinz Schantung gestattet. Das deutsche Pachtgebiet unterschied sich in mehrfacher Hinsicht von den übrigen deutschen Kolonien: Da es von Anfang an nicht als Rohstofflieferant oder Siedlungskolonie, sondern als Marine- und Handelsstützpunkt gedacht war, wurde es dem Reichsmarineamt und nicht wie die übrigen Kolonien der Kolonialabteilung im Auswärtigen Amt, bpk Der Druck auf die deutsche Festung nahm dennoch unaufhaltsam zu. Während die Japaner bis in den Oktober hinein mehr und mehr Truppen sowie Artilleriegeschütze für den Sturm auf Tsingtau herbeischafften, wurde die Beschießung der Stadt und der deutschen Geschützstellungen an der Küste durch die Blockadeflotte immer stärker. Auch die japanischen Fliegerangriffe häuften sich. Die deutschen Verteidiger bemühten sich, durch Erwiderung des Feuers vor allem die Aufstellung der feindlichen Artillerie auf der Landseite zu stören, wobei das einzige Flugzeug Tsingtaus als Beobachter fungierte. Die vollständige Einschließung der Stadt am 28. September war jedoch nicht zu verhindern. Am 2. Oktober unternahm das Ostasiatische Marinedetachement noch einmal einen Ausfall aus der Festung, um den Japanern die ungebrochene Verteidigungsfähigkeit der deutschen Besatzung Tsingtaus zu demonstrieren und sie von einer vor den deutschen Befestigungen gelegenen Höhe zu vertreiben, was unter einigen Verlusten auch gelang. 5 Werftanlage in Tsingtau, Fotopostkarte um 1910 dem späteren Reichskolonialamt, unterstellt. Mit der Verwaltung des Gebietes waren folglich keine kaiserlichen Beamten, sondern Marineoffiziere betraut. Innerhalb von einem Jahrzehnt wurde die Stadt Tsingtau gebaut, die in ein europäisches und ein chinesisches Wohnviertel unterteilt war. Das Wohngebiet für die Europäer war ganz nach deutschen Vorbildern errichtet worden und bot alle aus Deutschland gewohnten Annehmlichkeiten, unter anderem auch ein Seebad, einen Stadtpark und eine Pferderennbahn. Neben zahlreichen Handelsfirmen und Industriebetrieben verfügte Tsingtau über umfangreiche Hafenanlagen, die auch für die damals größten Schiffe ausreichten, und war durch die neu gebaute »Schantung-Eisenbahn« mit dem chinesischen Hinterland verbunden. Es gab mehrere Schulen, eine deutsch-chinesische Universität und ein Krankenhaus. 1914 wohnten etwa 195 000 Menschen im Kiautschougebiet, die meisten in der Stadt Tsingtau. Jedoch waren nur etwa 5000 Europäer darunter, einschließlich der rund 2600 Mann starken deutschen Garnison. Heute hat Tsingtau (Qingdao) etwa 1,3 Millionen Einwohner. Es wird 2008 einer der Austragungsorte der Olympischen Spiele sein. so schwer beschädigt wurde, dass er nach Japan zur Reparatur gebracht werden musste. Diese Erfolge hatten die Stimmung in der eingeschlossenen Stadt enorm verbessert, ebenso wie die zur gleichen Zeit über Funk empfangene Nachricht von der Eroberung Antwerpens durch deutsche Truppen. Nachdem das Unterseekabel nach Schang- hai Mitte August von dem britischen Kabeldampfer »Patrol« unterbrochen worden war, stellte der Funk die letzte Verbindung des Kiautschougebietes zur Außenwelt dar. Obwohl bereits am 12. August zwei britische Kreuzer die Funkstation auf der deutschen Südseeinsel Jap durch Artilleriebeschuss zerstört hatten, konnte der Funkverkehr durch den in Schanghai liegenden deutschen Dampfer »Sikiang« sicher- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 19 bpk Kampf um Tsingtau 1914 3 »Die Helden von Tsingtau im japanischen Gefangenenlager«, Propaganda-Postkarte um 1917 Besetzung der Innenstadt und der Wohngebiete durch die japanischen Truppen verhindern wollte, wurde um 6 Uhr 30 am Morgen des 7. November 1914 die weiße Fahne gehisst. gestellt werden, der die aus Tsingtau herausgehenden Funksprüche auffing und weiterleitete. Auf umgekehrtem Wege erreichte Ende Oktober auch ein Telegramm Kaiser Wilhelms II. die Verteidiger, das mit großer Begeisterung aufgenommen wurde: »Mit Mir blickt das gesamte deutsche Vaterland mit Stolz auf die Helden von Tsingtau, die getreu dem Worte ihres Gouverneurs ihre Pflicht erfüllen. Seien Sie alle Meines Dankes gewiss. Wilhelm I. R.« Nichtsdestoweniger wurde die Lage für die Eingeschlossenen immer auswegloser: Seit dem 26. Oktober verstärkte sich die Beschießung von der Seeseite her noch einmal merklich, und seit dem 31. Oktober, dem Geburtstag des japanischen Kaisers, belegte auch die Belagerungsartillerie die deutsche Festung mit heftigem und lang anhaltendem Feuer. Der Beschuss hatte nachhaltige Folgen. Die deutschen Geschützstellungen und Infanteriebefestigungen wurden mehr und mehr in Mitleidenschaft gezogen, und auch bei der deutschen Besatzung zeigten sich durch das andauernde Artilleriefeuer erste Zermürbungserscheinungen. Über der Stadt lagen jetzt die Rauchsäulen der brennenden Petroleumtanks am Hafen. In der Nacht vom 1. auf den 2. November wurde der österreichische Kreuzer »Kaiserin Elisabeth«, auf dem die Munition ausgegangen war, von seiner Mannschaft an einer tiefen Stelle der Kiautschou-Bucht versenkt. Auch mehrere deutsche Artilleriestellungen waren in den ersten Novembertagen durch das 20 feindliche Bombardement zerstört oder nach dem Verschuss der letzten Munition gesprengt worden. Der Sturm auf die Stadt stand nun unmittelbar bevor. In dieser Situation erhielt der Pilot des deutschen Beobachtungsflugzeuges, Oberleutnant zur See Gunter Plüschow, den Befehl zum Flug nach China, da für ihn in der Festung keine Verwendung mehr bestand. Schon seit Anfang des Monats waren immer wieder japanische Sturmangriffe abgewehrt worden, doch als am 6. November erneut heftiges Artilleriefeuer eine massive japanische Attacke auf die Verteidigungsstellungen begleitete, hatten die wenigen verbliebenen deutschen Geschütze mit ihren zur Neige gehenden Munitionsvorräten nicht mehr viel entgegenzusetzen. Nach erbitterten Kämpfen gelang der japanischen Infanterie in der Nacht der Durchbruch durch die deutschen Linien; zahlreiche deutsche Soldaten wurden gefangen genommen. Da die Lage nun aussichtslos geworden war, wurden die letzten Artilleriebatterien und Verteidigungsanlagen durch die Deutschen gesprengt. Die Funkstation von Tsingtau, die nach der Zerstörung des Elektrizitätswerks der Stadt am 3. November ohnehin nicht mehr senden konnte, sondern lediglich noch die eingehenden Funksprüche des Dampfers »Sikiang« aus Schanghai abgehört hatte, wurde in Brand gesetzt. Die Besatzung des Kanonenboots »Jaguar«, das sich bis zuletzt an den Kämpfen beteiligt hatte, versenkte ihr Schiff in der Kiautschou-Bucht. Auf Befehl des Gouverneurs, der die gewaltsame Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 In den Tagen nach der Kapitulation vollzog sich die Übergabe der Verwaltung und der militärischen Einrichtungen an die Sieger. Bei den Verhandlungen wurde den Deutschen von den Japanern große Achtung für ihre militärischen Leistungen entgegengebracht. Am 9. November fand eine Trauerfeier für die bei den letzten Gefechten um Tsingtau gefallenen Deutschen statt, die für die Beteiligten zugleich den Charakter einer Abschiedsfeier vom deutschen Pachtgebiet hatte. Am nächsten Tag begann der Abtransport der Kriegsgefangenen nach Japan; nur wenige deutsche Männer durften in der Stadt bleiben. Am 16. November zogen die siegreichen japanischen Truppen mit einer Parade in Tsingtau ein. Bei der Belagerung der Stadt hatten sich sehr ungleiche Kräfte gegenübergestanden. Während die deutsche Festungsbesatzung aus ungefähr 4700 Mann bestanden hatte, liegen die Angaben zur Gesamtstärke des japanischen Belagerungsheeres zwischen 20 000 und 63 000 Mann, wobei teilweise die Besatzungstruppen in Schantung mit eingerechnet wurden. Die deutschen Verluste beliefen sich auf 224 Gefallene und rund 400 Verwundete; für die japanische Seite gibt es sehr widersprüchliche Zahlen. Die amtlichen japanischen Berichte verzeichneten 1303 Tote, andere Quellen schätzen die Verluste auf bis zu 12 000 Gefallene und Verwundete. Letztlich zahlten sich diese Opfer für Japan nur für kurze Zeit aus. Zwar wurde im Versailler Vertrag von 1919 der gesamte ehemals deutsche Staatsund Privatbesitz im Kiautschougebiet und in der chinesischen Provinz Schantung an Japan übertragen. Die japanische Regierung plante nun, Tsingtau als Ausgangsbasis für eine weitere Expansion ins chinesische Hinterland zu nutzen. Aber die weltpolitische Lage In Deutschland hatte der ungleiche Kampf um Tsingtau zumindest zu Beginn des Krieges für großes Aufsehen gesorgt. In vielen Zeitungen und zahlreichen Büchern wurde der »deutsche Heldenkampf« ausgiebig geschildert und glorifiziert. Besonders der Erlebnisbericht von Gunter Plüschow, des sogenannten »Fliegers von Tsingtau«, dem nicht nur der Flug aus der belagerten Stadt, sondern auch die Rückkehr nach Deutschland gelungen war, fand reißenden Absatz. Das Buch, in dem Plüschow seine abenteuerliche Flucht durch China, Amerika und das feindliche England beschreibt, erschien noch während des Krieges und wurde bis in die 1940er Jahre in millionenfacher Auflage nachgedruckt. Die Vorkriegsüberlegungen der deutschen Marine zu Tsingtau waren im Verlauf der Kämpfe eindrucksvoll bestätigt worden. Das Reichsmarineamt hatte sich beim militärischen Ausbau des Kiautschougebietes seit 1898 vor allem ein Ziel gesetzt: es für so lange verteidigungsfähig zu machen, bis ein möglicher Krieg zwischen den europäischen Mächten in Europa entschieden sein würde, laut der vor 1914 weitverbreiteten Meinung von Militärexperten nach drei Monaten. Und tatsächlich waren, ganz im Sinne dieser Kalkulation, überall in Europa im Oktober 1914, drei Monate nach Kriegsausbruch, die Munitionsvorräte der Vorkriegszeit verschossen. So war auch die Zuversicht des deutschen Gouverneurs des Kiautschougebiets, Kapitän zur See Meyer-Waldeck, aus den frühen Tagen des August 1914 nicht unbegründet gewesen, das Pachtgebiet bis zum vermeintlichen Kriegsende halten zu können. Die Verteidiger der Stadt Tsingtau hatten sich sogar noch bis in den November der feind- lichen Streitmacht erwehren können. Insofern waren die militärischen Planungen für das Kiautschougebiet voll aufgegangen. An anderer Stelle hatten sich die Strategen jedoch gründlich verschätzt: Der Krieg in Europa sollte entgegen der Vorkriegskalkulationen noch weitere vier Jahre andauern. An seinem Ende stand die Niederlage des Deutschen Reiches und seiner Verbündeten und nicht zuletzt der Verlust aller deutschen kolonialen Besitzungen in Übersee. n Lars Nebelung Das deutsche Kolonialreich Wehrgeschichtliches Museum Rastatt hatte sich verändert: China nahm die permanenten Versuche ausländischer Einflussnahme nicht mehr ohne weiteres hin, und auch Großbritannien und die USA wollten dem japanischen Vordringen in Ostasien Einhalt gebieten. So drängten sie Japan Ende 1921 zu Verhandlungen mit China, an deren Ende die Rückgabe des Kiautschougebietes und der Schantung-Eisenbahnlinie an China gegen eine Entschädigung stand. Nach dem Sieg im deutsch-französischen Krieg 1870/71 und der Schaffung eines einheitlichen deutschen Nationalstaates mit der Gründung des Deutschen Reiches wurde von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in Deutschland auch die Erwerbung von Kolonien gefordert. Diese sollten vor allem als Absatzmärkte für deutsche Waren, als Rohstofflieferanten und als Siedlungsgebiete für deutsche Auswanderer dienen. Außerdem wollte man mit dem Besitz von Kolonien die gestiegene Macht und Bedeutung Deutschlands in der Welt zum Ausdruck bringen. Vor allem Großbritannien und Frankreich, aber auch Portugal, Spanien und andere Staaten hatten jedoch die meisten Gebiete der Welt schon unter sich aufgeteilt, sodass 5 nur noch einige wenige Landstriche Erinnerungsbild des Gefreiten Albert Kist übrig geblieben waren. Bismarck sträubte zu seiner Dienstzeit bei der 1. Kompanie/ sich zudem lange gegen den Erwerb III. Seebataillon 1908–1911. Das von Kolonien, weil er dadurch politi- Flaggenmotiv ist auf die internationale sche Schwierigkeiten mit anderen euro- Bekämpfung des Boxeraufstands 1900/01 päischen Mächten befürchtete. Private zurückzuführen. Initiativen führten dennoch seit 1884 dazu, dass einige Gebiete in Afrika und in der Südsee unter den politischen und militärischen Schutz des Deutschen Reiches gestellt wurden. Zu diesen »Schutzgebieten« zählten zunächst Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) und DeutschOstafrika (heute Tansania, Ruanda und Burundi) sowie Deutsch-Neuguinea und mehrere Inselgruppen im Pazifischen Ozean. Die ursprüngliche Absicht Bismarcks, die Verwaltung dieser Territorien nach Möglichkeit privaten Handelsgesellschaften zu überlassen, musste unter anderem wegen deren schlechter finanzieller Ausstattung allerdings schnell revidiert werden. Schon bald wurden die Schutzgebiete in unmittelbare Reichsverwaltung überführt. Um die Jahrhundertwende vergrößerte Deutschland noch einmal seinen überseeischen Besitz, getragen von einer in allen europäischen Mächten dominierenden imperialistischen Großmachtpolitik: Das Kiautschougebiet in China, weitere Inselgruppen in der Südsee und ein Teil von Samoa kamen hinzu. Die notwendige wirtschaftliche Erschließung der Kolonien durch den Bau von Siedlungen, Straßen und Eisenbahnlinien machte sie allerdings zu einem Zuschussgeschäft für das Reich. Erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg konnten in einigen Kolonien wirtschaftliche Überschüsse durch die Lieferung von Rohstoffen erzielt werden. Abgesichert wurde die deutsche Kolonialherrschaft in den meisten Gebieten durch die Aufstellung von militärischen »Schutztruppen« oder Polizeieinheiten, die zum Teil aus Einheimischen bestanden und wiederholt gegen Aufstände der alteingesessenen Bevölkerung eingesetzt werden mussten. Im Ersten Weltkrieg wurde die Mehrzahl der deutschen Kolonialgebiete rasch von den zahlenmäßig überlegenen feindlichen Truppen erobert. Nur in Deutsch-Ostafrika konnten sich die deutschen Verteidiger unter dem Befehl von Paul von Lettow-Vorbeck bis 1917 halten, danach in Mozambik und Rhodesien bis zum Kriegsende 1918. Im Versailler Vertrag von 1919 musste das Deutsche Reich auf seine Kolonien verzichten, die als so genannte Mandatsgebiete des Völkerbundes unter den Siegermächten aufgeteilt wurden. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 21 Service Das historische Stichwort 3 US-Truppen beim Verlassen eines Landungsbootes, 6. Juni 1944 akg-images Vor 60 Jahren: Die alliierte Invasion in der Normandie am 6. Juni 1944 S eit sich Roosevelt und Churchill auf der Washingtoner Konferenz 1941/42 auf die militärische Niederringung Deutschlands als vorrangiges gemeinsames strategisches Ziel geeinigt hatten, nahm die Landung an der französischen Kanalküste in den englisch-amerikanischen Überlegungen einen zentralen Platz ein. Allerdings sollte die Errichtung der Zweiten Front noch länger auf sich warten lassen. Das im Januar 1943 in Casablanca verkündete Kriegsziel der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands war auch an den sowjetischen Kriegspartner gerichtet, der, von der Wehrmacht hart bedrängt, Entlastung forderte. In den frühen Morgenstunden des 6. Juni 1944 gingen schließlich die verbündeten amerikanischen, britischen und kanadischen Streitkräfte unter dem von Eisenhower geführten alliierten Oberkommando in der französischen Normandie an Land. In der Nacht waren unbemerkt von der Kriegsmarine Minengassen für die alliierte Armada von über 4000 Landungsbooten und mehr als 1000 Kriegsschiffen aller Art geräumt worden. Parallel 22 dazu sollten Luftlandeoperationen die Flanken des Landungsraums sichern. Eine überwältigende Luftstreitmacht und das Feuer von Schiffsartillerie und Raketenbooten zerstörten viele der Küstenhindernisse und schalteten die deutschen Stellungen, darunter auch die Küstenbatterien, aus. Bis zum Ende des Tages gelang es den Alliierten, in jedem der fünf Landungsabschnitte Fuß zu fassen und die Verbindung zu den Luftlandetruppen herzustellen. Eine ernsthafte Krise entwickelte sich nur im amerikanischen Landungsabschnitt »Omaha«, wo eine deutsche Infanteriedivision, die von der alliierten Aufklärung kurz zuvor noch im Landesinneren lokalisiert worden war, ausgerechnet zum Zeitpunkt der Landung eine küstennahe Übung begonnen hatte, ohne dass dies von den Alliierten bemerkt worden war. Das eigentliche Tagesziel, die Einnahme von Caen, wurde gleichwohl nicht erreicht; der Zugang zum panzergünstigen Gelände südlich der Stadt blieb damit zunächst versperrt. Der fehlende Angriffsschwung des vom Briten Montgomery geführten linken Flügels erlaubte es den Verteidigern in Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 den Nachmittagsstunden, Teile einer nahegelegenen Panzerdivision in den Kampf zu werfen. Dieser einzige bedeutendere Gegenangriff des Tages drang zunächst bis zum Meer durch, musste aber bald zur Verteidigung übergehen. Alle sonst vorhandenen taktischen Reserven der Deutschen erwiesen sich als zu schwach. Und größere motorisierte Verbände lagen zu weit im Landesinneren, um zu einem früheren Zeitpunkt eingreifen zu können. Den Alliierten gelang der taktische Überraschungserfolg. Nicht zuletzt wegen der Erschütterungen des militärischen Nachrichtennetzes war sich die deutsche Seite erst am Abend sicher, dass man es in der Normandie mit der eigentlichen Invasion und nicht mit einem Ablenkungsmanöver zu tun hatte. Insgesamt war das Ereignis seit langem erwartet worden. Mit seiner Weisung Nr. 51 vom November 1943 hatte sich Hitler zur Defensive im Osten durchgerungen und die Verhinderung einer alliierten Landung im Westen zur kriegsentscheidenden Sache erklärt. Schon im August 1942 hatte Hitler den Bau des ›Atlantikwalls‹ angeordnet. Von der Propaganda zum waffenstarrenden Bollwerk stilisiert, handelt es sich dabei um ein militärisches Hindernis von bestenfalls zeitlich begrenzter Wirkung. Monatelang war in der deutschen Führung über den operativen Ansatz der Verteidigung diskutiert worden. Das Ergebnis sah vor, dass, nachdem der eigentliche Angriffsschwerpunkt der Alliierten festgestellt würde, die im Landesinneren stehenden motorisierten Verbände heranzuführen seien, um die Angreifer ins Meer zurückzuwerfen. Bis dahin sollten die vor Ort befindlichen Verbände im Schutz der Küstenbefestigungen die Alliierten daran hindern, aus dem Brückenkopf auszubrechen. Ein Drittel der insgesamt 60 deutschen Divisionen, die Anfang Juni 1944 in Westeuropa disloziert waren, bestand aus weitgehend unbeweglichen Infanteriedivisionen. Gering war die Zahl kampfkräftiger Panzer- und motorisierter Divisionen. 4 Blick aus einer deutschen Geschützstellung auf alliierte Eine ausreichende Reservenbildung war angesichts des Kräfteverschleißes auf den anderen Kriegsschauplätzen nicht möglich. Zu Jahresbeginn 1944 schätzte die Wehrmacht die Stärke des Ostheeres auf weniger als die Hälfte der an der sowjetischen Europafront eingesetzten oder in Reserve gehaltenen Kräfte der Roten Armee. Das Besatzungsregime auf dem Balkan, in Skandinavien und die Rückzugskämpfe in Italien banden weitere Kräfte. akg-images / Tony Vaccaro Kriegsschiffe, Juni 1944 Die wenigen an der Kanalküste eingesetzten Einheiten der Kriegsmarine vermochten angesichts der absoluten alliierten Luftherrschaft kaum tagsüber ihre von Flak geschützten Häfen zu verlassen. Auch die im Invasionsraum stehenden deutschen Luftstreitkräfte fielen praktisch nicht ins Gewicht. Verstärkungen blieben aus, weil der im Frühjahr 1944 erheblich gesteigerte strategische Luftkrieg gegen das kriegswirtschaftliche Rückgrat des »Dritten Reichs« die Kräfte der Luftwaffe förmlich zerrieb. Luftwaffe und Kriegsmarine konnten nicht verhindern, dass der alliierte Brückenkopf pausenlos verstärkt wurde, während sich die deutschen Kräfte allmählich abnutzten. Angesichts der bis weit in das französische Hinterland reichenden Luftbedrohung waren Truppenverlegungen nur in der Dunkelheit möglich, überdies behindert durch systematische Zerstörungen des Verkehrsnetzes. Den Alliierten gelang es, ungeachtet der Reibungsverluste einer multinational zusammengesetzten Streitmacht, alle drei Teilstreitkräfte wirkungsvoll in die Kampfführung zu integrieren. Das Feuer der alliierten Schiffsgeschütze, Flugzeuge und Artillerie verursachte einen Großteil der deutschen Verluste. Herangeführte Verbände mussten bereits auf dem Weg zur Front mehr oder minder starke Verluste hinnehmen. Im Kampfraum angekommen, wurden sie oft verzettelt eingesetzt, um die gerade entstandenen Krisensituationen zu bereinigen. Allerdings begünstigten das Wetter und die bewegungshemmende Knick- und Heckenlandschaft der Normandie den deutschen Widerstand. Dieser konnte indes nicht verhindern, dass die Alliierten die Verbindung zwischen den Brückenköpfen herstellten und den Landungsraum ausdehnten. Der Druck zweier parallel laufender Angriffsoperationen wurde schließlich zu stark: In den letzten Julitagen gab der linke deutsche Flügel nach und erlaubte den Amerikanern den Durchbruch. Bereits vier Wochen später überschritten die Verbündeten die Seine und drangen in Paris ein. Zu diesem Zeitpunkt musste die deutsche Führung ihr Augenmerk allerdings auf den östlichen Kriegsschauplatz richten. Am 22. Juni, dem dritten Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, zertrümmerte die Sommeroffensive gegen die Heeresgruppe Mitte die deutsche Ostfront. Die Ereignisse wuchsen sich aus zur größten Niederlage in der deutschen Militärgeschichte. Zu Dutzenden wurden Divisionen vernichtet oder mussten aufgelöst werden. Die Offensive öffnete der Roten Armee den Weg sowohl zur Rigaer Bucht und nach Ostpreußen als auch zur mittleren Weichsel und nach Warschau. Anschlussoffensiven führten zum Zusammenbruch der Heeresgruppe Süd-Ukraine und leiteten das Ausscheiden von Rumänien und Bulgarien aus dem Krieg ein. Im Baltikum wurde die Heeresgruppe Nord abgeschnitten. In den Monaten Juni bis August starben fast 750 000 deutsche Soldaten. Trotz des nun unmittelbar das Reichsgebiet bedrohenden Zweifrontenkrieges, den das »Dritte Reich« aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden strategischen Kräftepotentiale nicht länger erfolgreich durchstehen konnte, zog die Spitze des NS-Regimes keine Konsequenzen. Einzig die für den westlichen Kriegsschauplatz verantwortlichen Feldmarschälle Rommel und Kluge forderten Hitler Mitte August in Briefen dazu auf, den Krieg zu beenden. Kein verantwortlicher Militär griff dem Steuermann Hitler auf seinem zielstrebigen Kurs in den nationalstaatlichen Untergang ins Ruder. Die Ereignisse desillusionierten zunächst auch diejenigen Angehörigen der nationalkonservativen Opposition, die noch 1944 gehofft hatten, durch einen Umsturz die Substanz des Deutschen Reiches wenigstens in Teilen erhalten zu können. In dieser Situation überzeugte Generalmajor Henning von Tresckow die zum Widerstand Bereiten, dass ein Attentat um seiner selbst willen geschehen und damit ein Zeichen vor der Welt und der Geschichte gesetzt werden müsse. Der Diktator überlebte das Attentat vom 20. Juli 1944, der Umsturz scheiterte. Andreas Kunz Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 23 Service Medien online/digital Bombenkrieg online A m Abend des 13. Februar läuten jedes Jahr in Dresden die Glocken. Zum Gedenken an die Luftangriffe vor 60 Jahren und als Mahnung zum Frieden zugleich. 2005 werden auch die Glocken der wieder errichteten Frauenkirche akustisch an die Ereignisse von 1945 erinnern. Während der Begriff »Bombe« zu den ältesten Wörtern der Militärgeschichte gehört, verbinden wir mit dem Wort »Bombenkrieg« heute den Luftkrieg seit dem Ersten Weltkrieg und dessen zunehmende Bedeutung in militärischen Konflikten. Im Angesicht aktueller Ereignisse scheint die Verbindung des Bombenkrieges vor allem mit dem Zweiten Weltkrieg in Frage gestellt zu sein. Mit den bevorstehenden Gedenktagen anlässlich der Angriffe auf deutsche Großstädte in der Endphase des Zweiten Weltkrieges wird jedoch erneut unser Interesse auf die alliierten strategischen Bomberoffensiven gegen das Deutsche Reich und seine Bevölkerung gelenkt. Essen, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Nürnberg und Dresden stehen dabei als Beispiele der zerstörerischen Entwicklung des Luftkrieges vor der Einführung der Atombombe. Das Internet bietet verschiedene Möglichkeiten, sich über den Bombenkrieg zu informieren. Aber oft ist das Thema nur Inhalt von allgemein gehaltenen Seiten über den Zweiten Weltkrieg. Durch die Veröffentlichung des Buches »Der Brand« von Jörg Friedrich (siehe Lesetipp in Militärgeschichte 1/2003) rückte die Beschäftigung mit dem Bombenkrieg und seinen Opfern vor kurzem verstärkt in die historischen Debatten. Um dem Fachpublikum, aber auch dem historisch interessierten Leser ein Forum zu diesem Thema zu bieten, hat der Historiker Ralf Blank vom Historischen Centrum Hagen im Netzwerk historicum.net ein thematisches 24 5 Zeichnung des zwölfjährigen Wilhelm Bloß, Schüler der Volksschule Fürther Straße 352– 354. Entstanden Ende 1946. Quelle: Stadtarchiv Nürnberg Portal zum Bombenkrieg eingerichtet. Die Seite unter der Adresse 4www. bombenkrieg.historicum.net wird durchaus den gestellten Zielen gerecht und »bietet mit ausgewählten Beiträgen, Materialien und Dokumentationen einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung und Diskussion. Dabei gilt der Blick nicht nur den alliierten Bombardierungen deutscher Städte, sondern auch den deutschen Luftangriffen und ihren Auswirkungen.« hb Dass die Beschäftigung mit der Geschichte des Bombenkrieges vor allem aus Sicht der Bevölkerung noch nicht abgeschlossen ist, zeigen zahlreiche Aufrufe von örtlichen Archiven und Zeitungen anlässlich der kommenden Gedenktage. Das Stadtarchiv Nürnberg ruft zur Mitarbeit an seinem Forschungsprojekt »Luftkrieg in Nürnberg 1942–1945« unter 4 w w w. s t a d t a rc h i v. nuernberg.de/Luftkrieg. htm auf und zeigt mit der Abbildung der Zeichnung eines Kindes von 1946 die traumatisierenden Wirkungen des Krieges auf einen zweifellos unschuldigen Teil der deutschen Bevölkerung. Das was unsere Kinder heute nach »Erleben« im Fernsehen zeichnen oder die Kinder in den Einsatzgebieten der Bundeswehr im Ausland malen, die Parallelen werden in der historischen Betrachtung klar. hb Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 20. Juli 1944 Stauffenberg nicht nur als Spielfilm, sondern auch auf der Bühne. Zum 60. Jahrestag des Attentats wurde unter der Schirmherrschaft des ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske ein Theaterprojekt mit dem Titel »Stauffenberg – Die Tragödie des 20. Juli 1944« nach der Vorlage von David Sternbach ins Leben gerufen. Das Stück, das vor allem die innere Auseinandersetzung Stauffenbergs mit »Gut und Böse, Gott und Teufel« zeigt, hatte am 30. Mai dieses Jahres im Berliner Schiller-Theater seine Uraufführung. Die künftigen Aufführungen finden auch an historischen Schauplätzen des »Dritten Reiches«, wie 5www. stauffenberg-heute.de/index2.htm der »Wolfsschanze« in Polen statt. Wer sich über das Projekt, die Reaktionen und Hintergründe informieren will, dem steht unter 4www.stauffenbergheute.de eine ausführliche Webseite zur Verfügung. hb Detlef Michelers, Claus Graf von Stauffenberg – Widerstand in Uniform. Hamburg 2004. 55 Min.; ISBN 3-455-32022-8; 17,90 € D as fast einstündige Feature, eine Produktion von NDR/ Radio Bremen und Deutschlandradio Berlin beschränkt sich nicht nur auf die Darstellung der Rolle des bekannten Hitler-Attentäters. Christian Brückner erzählt den Werdegang Stauffenbergs. Dabei wird die Geschichte des militärischen Widerstandes im Kontext der Zeitumstände mit Originaltonaufnahmen, Nacherzählungen und Erinnerungen von Zeitzeugen wieder lebendig gemacht. So kommen in einer sehr dichten Darstellung neben Angehörigen der Familie Stauffenberg auch mitverschworene und unbeteiligte Zeitzeugen zu Wort. Auch wenn man sich doch etwas mehr Zeit bei der Beschreibung einzelner Lebensabschnitte und vereinzelt genauere Angaben zu den Zeitzeugen und ihren Funktionen gewünscht hätte, kann das Hörbuch insgesamt als eine gelungene Geschichtsstunde empfohlen werden. hb Philipp von Boeselager, ehemaliger Offizier der Wehrmacht und ebenso wie sein 1944 gefallener Bruder Georg Mitverschwörer des Kreises um Generalmajor von Tresckow, beschreibt in einem fast zweistündigen Gespräch mit dem Programmbereichsleiter im Hessischen Rundfunk Hans Sarkowicz bemerkenswert detailgetreu seine Sicht des Widerstandes, besonders aus der Perspektive seiner Dienststellung als Ordonnanzoffizier in der Heeresgruppe Mitte. Fragt man nach Motiven Philipp von Boeselagers und seines Bruders Georg für den Widerstand, so bietet der Blick auf die Kindheit der Brüder und ihre Erziehung in der Familie schon einige Antworten. Die katholische Schule, die besonders enge Bindung der Brüder, die schulische und militärische Ausbildung werden genauso lebendig geschildert wie spätere Kriegserinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg. digital Philipp Freiherr von Boeselager, Der 20. Juli 1944. Gespräch mit Hans Sarkowicz Freiburg i.Br. 2004. 2 CD, 103 Min.; ISBN 3-89964-046-2; 22,90 Z eitzeugen, die unmittelbar am Staatsstreich des 20. Juli 1944 beteiligt waren, sind heute rar. In einer Zeit, in der die Obergefreiten des Zweiten Weltkrieges schon allenthalben als wertvolle Zeugen bemüht und zum Teil zur Erklärung historischer Sachverhalte überstrapaziert werden, fällt diese Hörbuch-Produktion des Hessischen Rundfunks besonders positiv auf. Man gewinnt schnell den Eindruck, so etwas hätte man doch schon längst machen müssen. Aus seiner genauen Sicht als Ordonnanzoffizier des Generalfeldmarschalls von Kluge schildert Boeselager auch Ursachen für das angeblich fehlende Durchsetzungsvermögen der Generale gegenüber Hitler, die besondere Rolle des Widerstandskämpfers Henning von Tresckow und die Wahrnehmung der Verbrechen der deutschen Besatzungsmacht in Russland. »Und hier habe ich plötzlich gemerkt, das ich einem Regime diene, was Verbrechen begeht, hinter meinem Rücken Verbrechen; was eine schreckliche Situation war.« Ein großer Teil der Darstellung widmet sich dem Widerstand in der Heeresgruppe Mitte und den besonderen Begleitumständen des Staatsstreichs vom 20. Juli 1944 im Osten, die auch als der »Boeselager-Ritt« bekannt geworden sind. Nach seinen Erinnerungen an die Zeit des Attentates und das Ende des »Dritten Reiches«, geht Boeselager zum Schluss in einer sehr persönlichen Schilderung auch auf den Aufbau der Bundeswehr und ihre Rolle im wiedervereinigten Deutschland ein. Im Februar 2004 ernannte der französische Staatspräsident Jacques Chirac Philipp von Boeselager zum Offizier der französischen Ehrenlegion. Eine persönliche Ehrung für den 86-Jährigen, aber sicher auch Ausdruck der Anerkennung der deutschen Widerstandsbewegung zum 60. Jahrestag des Attentates vom 20. Juli 1944. Die CD-Produktion hat das Verdienst, die Erinnerung an eine besondere Persönlichkeit unserer Geschichte zu bewahren. hb Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 25 Service Lesetipp Der Erste Weltkrieg Österreich zur See 90 A Jahre nach Kriegsausbruch des Ersten Weltkriegs haben viele in- und ausländische Historiker Publikationen zur »Urkatastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts« vorgelegt, die sich jedoch mit Masse an die Fachwissenschaft richten. Das vorzustellende Buch ist anders. Entstanden als Begleitband zu einer Fernsehserie des BBC richtet es sich bewusst an den historisch interessierten Leser. Hew Strachan, einer der ausgewiesensten britischen Kenner des Ersten Weltkrieges, versteht es dabei anschaulich, durch diesen weltumspannenden Konflikt zu führen. Er bricht die hierzulande immer noch anzutreffende Verengung auf den deutschen Krieg auf und erweitert den Blick auf den ersten industrialisierten, globalen und totalen Krieg des letzten Jahrhunderts. Die Kriegführung aller Beteiligten wird unter Einbindung des Kriegsalltages in der Heimat und an der Front ausführlich dargestellt, ohne die Ursachen des Weltkrieges und die Friedensschlüsse mit ihren Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung auszublenden. Ausgewogen im Urteil lässt uns Strachan, in seinem reich bebilderten Buch – erstmals mit bisher unbekannten Farbaufnahmen – so einen Blick auf einen wichtigen Zeitabschnitt des »Zeitalters der Weltkriege« werfen. Zu kritisieren ist einzig die Kartenausstattung, die die geografische Einordnung des Kriegsgeschehens nur schwer ermöglicht. Hew Strachan, Der Erste Weltkrieg. Eine neue illustrierte Geschichte, München 2004. ISBN 3-570-00777-4; 448 S., 24,90 € Zu empfehlen bleibt damit ein Buch, welches dem militärgeschichtlich Interessierten einen sehr guten Überblick über Ursachen, Verlauf und Folgen des Ersten Weltkrieges bietet. Gerhard P. Groß 26 m 31. Oktober 1918 verschwand die kaiserliche und königliche österreichisch-ungarische Flagge von den Meeren, doch bildet dies im heutigen Binnenland Österreich kein Hindernis für eine breite Forschungsund Publikationstätigkeit, die mit diesem Standardwerk einen Höhepunkt erreicht hat. Wladimir Aichelburg, Register der k.(u.)k. Kriegsschiffe. Von Abbondanza bis Zrinyi, Wien/Graz 2002. ISBN 3-7083-0052-1; 736 S., 98 € Der ausgewiesene Marinehistoriker Wladimir Aichelburg hat ein Werk vorgelegt, das, bis auf mangelndes Kartenmaterial, keinen Wunsch offen lässt. Auf 544 Textseiten und einem gesonderten Bildteil mit 384 zum Teil gestochen scharfen Abbildungen (Fotos, Gemälden, Skizzen und Zeichnungen) wird die k.u.k. Marinegeschichte von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis 1918 en détail anhand ihrer Schiffseinheiten dargestellt. Und nicht nur das: der Umfang des Buches resultiert auch daraus, dass nicht nur Schiffe, sondern auch schwimmende Einheiten wie Docks und Kohlenprähme erfasst sind. Unabhängig von dieser Detailverliebtheit bietet das Werk nicht nur für österreichische, sondern auch für deutsche Leser eine Fülle von politischen, militärischen und marinespezifischen Details: Von den Befreiungskriegen 1813 über die Revolution von 1848 bis zu gemeinsamen Operationen der deutschen Kaiserlichen und der österreichisch-ungarischen Marine im Ersten Weltkrieg. Dass eine Korvette (Baujahr 1869) und ein sogenannter Rapidkreuzer (Baujahr 1914) den reichlich norddeutschen Namen »Helgoland« trugen, kommt auch nicht von ungefähr, sondern resultiert aus dem gemeinsamen Kampf österreichischer und preußischer Einheiten in der Seeschlacht vor Helgoland am 9. Mai 1864 gegen die Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 dänische Flotte während des DeutschDänischen Krieges. Hinzu kommt ein Komplex, den man heute mit Österreich wohl am wenigsten verbindet: Übersee. Denn die Korvetten, Fregatten, Kreuzer und Kanonenboote Kaiser Franz Josephs I. operierten rund um den Globus, und nicht immer ohne Risiko. Am 10. August 1896 wurden vier Matrosen und ein Kadett des Kanonenboots S.M.S. »Albatros« zusammen mit dem Chefgeologen der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften auf der Südseeinsel Guadalcanal während einer wissenschaftlichen Expedition von Eingeborenen überfallen und niedergemetzelt; die Leichen konnten nicht geborgen werden. Und in China fielen zehn Mann des Kreuzers »Kaiserin Elisabeth« bei der Verteidigung der deutschen Festung Tsingtau im Herbst 1914; der Kreuzer wurde am 2. November 1914 vor dem Hafen von Tsingtau selbst versenkt, als der Sturm der Japaner auf die deutsche Kolonie absehbar war. So gibt Aichelburg anhand von Schiffsgeschichten einen umfassenden Überblick über die politische, diplomatische und militärische Geschichte vorzugsweise des Mittelmeerraumes im 19. Jahrhundert. Gerhard Wiechmann 20. Juli 1944 P rofessor Dr. Guido Knopp hat wieder eine Fernsehserie produziert und dazu einen Begleitband vorgelegt. Sein Verlag C. Bertelsmann führt von ihm zur Zeit 16 Titel, die meisten über die Zeit des »Dritten Reiches«. Die neueste Serie aus der ZDFRedaktion Zeitgeschichte wurde im Zuge eines »Wettrennens« mit dem ARD-Spielfilm »Stauffenberg« schon im Frühjahr 2004 ausgestrahlt und erreichte mit jeweils 3,5 Millionen Zuschauern ein großes Publikum. Dass Knopp dabei längst nicht nur Geschichte für Deutsche darstellt, beweist der internationale Verkauf der Serie »Hitlers Helfer« in 42 Länder. Das Begleitbuch kann aber auch ohne die Serie bestehen. Gut aufgemacht, lädt es durch viele Abbildungen und herausgehobene Zitate zunächst zum Guido Knopp in Zusammenarbeit mit Alexander Berkel, Anja Greulich, Sönke Neitzel und Annette Tewes, Sie wollten Hitler töten, München 2004. ISBN 3-570-00664-6; langen Arm des MfS. 1976 erschoss ein Stasi-Sonderkommando den aus der DDR-Haft freigekauften Michael Gartenschläger, als dieser an der Grenze einen Selbstschussautomaten demontieren wollte. Weitere Attentatsversuche (z.B. auf den saarländischen Ministerpräsidenten im Jahre 1955), ungeklärte Todesfälle (z.B. der des ge- 350 S., 24,90 € Jens Gieseke, Blättern ein. Sein Schwerpunkt ist eindeutig der militärische Widerstand. Nur der erste Abschnitt »Der einsame Held« über den Attentäter Georg Elser scheint da nicht zu passen. Bei näherer Betrachtung ist aber der hervorragend bebilderte Beitrag über den Einzeltäter gerade im Kontrast zum generalstabsmäßigen Widerstand und der dabei geschilderten Person Stauffenbergs eine wertvolle Ergänzung. Wohl bedingt durch die Vorgabe der Fernsehserie wirken die einzelnen Kapitel etwas zusammenhanglos. Trotzdem ist es ein Buch, das sich »gut liest«. Wer sich über die bloße Beschreibung hinaus mit dem Widerstand weiter vertiefend befassen will, dem bieten die knappen Literaturhinweise zu den Kapiteln auch brauchbare Orientierung in einem inzwischen unüberschaubaren Literaturangebot. hb Die Stasi E rich Mielke und Markus Wolf, der Kanzleramtsspion Günther Guillaume und der NATO-Mitarbeiter Rainer Rupp (alias »Topas«), hunderttausend »Informelle Mitarbeiter« (IM) und das (un-)heimliche Firmennetz des Obersten Schalck-Golodkowski – sie alle stehen heute sinnbildlich für die »Staatssicherheit« der DDR. Diese war wohl einer der am meisten gefürchteten Geheimdienste der Welt. Doch was an diesem Urteil ist Legende und was Wirklichkeit? Tatsächlich war das Geschäft der Staatssicherheit todernst. Oppositionelle im eigenen Land wurden nicht nur überwacht, drangsaliert und inhaftiert, sondern bisweilen sogar umgebracht oder in den Tod getrieben. Und auch im Westen waren Regimegegner nicht sicher vor dem Mielke-Konzern. Die Geschichte der Stasi 1945–1990, Stuttgart/ mögliches Engagement des Bündnisses im Irak; politische Verstimmungen und Irritationen in der über ein halbes Jahrhundert gewachsenen transatlantischen Partner- und Freundschaft; gesellschaftspolitische Diskussionen über die Reichweite staatlicher Prävention gegenüber terroristischen Bedrohungen. Ausgangspunkt dieser Entwicklung war jener spätsommerliche Tag mit seinem strahlend blauen Himmel an der Ostküste der Vereinigten Staaten, an dem religiös motivierter Terror sich zum Massenmord an 3000 Menschen steigerte und der zivilisierten Welt den Krieg erklärte. München 2001. ISBN 3-421-05481-9; 287 S., 18,90 € flüchteten DDR-Profifußballers Lutz Eigendorf 1983) oder die Unterstützung der RAF-Terroristen belegen dies. Im Kriegsfall gar sollten Stasikommandos hinter der Front eingesetzt werden, wozu Waffen versteckt und Partisanen ausgebildet wurden und die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) in der Bundesrepublik Unterstützung leistete. Um diese Pläne vor westlichen Geheimdiensten geheim zu halten, machte die Stasi mit Verrätern aus den eigenen Reihen kurzen Prozess: Noch im Jahr 1981 starb der StasiOffizier Werner Teske durch einen Schuss in den Hinterkopf. Jens Gieseke erzählt auf knappen zweihundert Seiten die Geschichte des ostdeutschen Geheimdienstes, beschreibt, wieso das MfS teilweise beachtliche Erfolge hatte, letztlich aber doch nur begrenzt Einfluss nehmen konnte. Das Buch liest sich wie ein Spionagethriller, ist aber nüchterne deutsch-deutsche Geschichte. Clemens Heitmann Terrorismus D ie Welt hat sich verändert seit dem 11. September 2001: BundeswehrEinsatz in Afghanistan; Sicherung der Schiffahrtswege am Horn von Afrika und in der Meerenge von Gibraltar durch die Deutsche Marine; Diskussionen innerhalb der NATO über ein Stefan Aust und Cordt Schnibben (Hrsg.), 11. September. Geschichte eines Terrorangriffs, München 2003. ISBN 3-423-34026-6; 288 S., 12,50 € Es wird, so ist zu vermuten, noch lange dauern bis das in den Archiven verwahrte Material zu diesem Ereignis für Historiker und Interessierte zugänglich sein wird. Derweil sprießen Spekulationen, Legenden und obskure Verschwörungstheorien in die Luft. Davon hebt sich dieses Buch deutlich ab. In bester Manier des investigativen Journalismus hat mehr als ein Dutzend Reporter des Nachrichtenmagazins »Der Spiegel« in aufwendiger Recherche die zugänglichen Fakten zu sammengetragen. Entstanden ist daraus eine spannende und zugleich aufwühlende Geschichte dieses bisher Aufsehen erregendsten Terroraktes in der Geschichte, die das Schicksalsgeflecht des 11. September 2001 entwirrt und von Tätern und Opfern, von Rettern und Geretteten erzählt. Andreas Kunz Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 27 Ausstellungen Service •Berlin Blockade Leningrads 1941–1944. Dossiers Deutsch-Russisches Museum Zwieseler Straße 4 / Ecke Rheinsteinstraße 10318 Berlin Telefon: (0 30) 50 15 08 10 e-mail: [email protected] www.museum-karlshorst.de Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt frei. 15. Mai bis 5. September 2004 Verkehrsanbindungen: S-Bahn: S3 bis S-Bahnhof »Karlshorst«; U-Bahnlinie 5: Station »Tierpark«, im Anschluss Bus 396 •Celle Deutsche Jüdische Soldaten. Von der Epoche der Emanzipation bis zum Zeitalter der Weltkriege Alte Exerzierhalle Helmuth-Hörstmann-Weg 1 29221 Celle Telefon: (0 51 41) 9 36 00 11 Täglich von 10.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr 16. Juli bis 29. August 2004 • F ü r s te n fe l d b r u c k Aufstand des Gewissens. Militärischer Widerstand gegen das NS-Regime 1933–1945 Offizierschule der Luftwaffe Udetstr. 351–354 82242 Fürstenfeldbruck Telefon: (0 81 41) 53 60 12 11 Täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr 28. Juli bis 14. September 2004 28 • Höchstädt/ Donau Die Schlacht von Höchstädt – Brennpunkt Europas 1704 Schloss Höchstädt an der Donau Herzogin-Anna-Straße 52 89420 Höchstädt/Donau Telefon: (0 90 74) 9 58 57 00 Telefax: (0 90 74) 9 58 57 91 www.europa1704.de Dienstag bis Sonntag 9.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 6,00 € ermäßigt: 5,00 € 1. Juli bis 7. November 2004 Verkehrsverbindungen: Anfahrt über die B 16. In der Umgebung des Schlosses stehen Pkw-Parkplätze in ausreichender Zahl zur Verfügung •Ingolstadt Das Bayerische 17. Reiterregiment und seine Beziehungen zum militärischen Widerstand Reduit Tilly Paradestraße 4 85049 Ingolstadt Telefon: (08 41) 9 37 70 Telefax: (08 41) 9 37 72 00 www.bayerischesarmeemuseum.de e-mail: [email protected] Dienstag bis Sonntag 8.45 bis 16.30 Uhr 20. Juli 2004 bis 6. Januar 2005 Verkehrsverbindungen: ð Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 Nächstgelegene Bushaltestellen: »Roßmühlstraße/ Paradeplatz« oder »Rathausplatz« •Kappeln Germania auf dem Meere – Deutsche Marinegeschichte 24376 Kappeln Telefon: (0 46 42) 1 71 28 90 Täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr 4. bis 9. August 2004 Verkehrsverbindung: Von Eckernförde auf B 203, Richtung Stützpunkt Olpenitz, auf rechter Seite gelegen •Köln Marinestützpunkt Olpenitz Soldatenheim der ev. Militärseelsorge Albatros Hafenstraße 1 ð Namibia – Deutschland: eine geteilte Geschichte. »Widerstand – Gewalt – Erinnerung« Rautenstrauch - Joest Museum für Völkerkunde Ubierring 45 50678 Köln Telefon: (02 21) 3 36 94 13 Telefax: (02 21) 3 36 94 10 Eintritt: 2,60 € ermäßigt: 1,30 € ð Dienstag bis Freitag 10.00 bis 16.00 Uhr Samstag und Sonntag 11.00 bis 16.00 Uhr 7. März bis 3. Oktober 2004 Verkehrsanbindungen: Ab Hauptbahnhof mit U 16 bis Haltestelle »Ubierring« • Königstein bei Dresden Die sächsische Bastille Das Staatsgefängnis auf der Festung Königstein von 1591 bis 1922 Museum Festung Königsstein / Torhaus 01824 Königstein Telefon: (03 50 21) 6 46 07 Telefax: (03 50 21) 6 46 09 www.festung-koenigstein.de e-mail: [email protected] Täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr (April – September) 10.00 bis 17.00 Uhr (Oktober – März) Eintritt: 5,00 € ermäßigt: 3,00 € 1. April 2004 bis 02. Januar 2005 Verkehrsanbindungen: PKW: B 172 Richtung Bad Schandau; S-Bahn: Linie 241.1 (Dresden-Königstein-Schöna); Bus: Linie 241 Richtung Pirna-Königstein (Haltestelle Abzweig »Festung« oder »Thürmsdorf/Vogelstein«) •Oldenburg Heinrich Vogeler im Krieg. Arbeiten 1914–1918 Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg – Augusteum Elisabethstraße 1 26135 Oldenburg Telefon: (04 41) 2 20 73 00 Telefax: (04 41) 2 20 73 09 e-mail: [email protected] ð Dienstag, Mittwoch und Freitag 9.00 bis 17.00 Uhr Donnerstag 9.00 bis 20.00 Uhr Samstag und Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr Eintritt: 3,00 € 29. April bis 12. September 2004 Verkehrsanbindungen: unweit des Bahnhofs gelegen 23. April bis 3. Oktober 2004 Verkehrsanbindungen: Vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn bis zur Haltestelle »Charlottenplatz« Am Hochkamp 20 45731 Waltrop Telefon: (0 23 09) 7 42 21 • To r g a u Glaube & Macht – Sachsen im Europa der Reformationszeit •Rottenburg– Deutsche Jüdische Soldaten Gedenkstätte Synagoge Obere Gasse 12 72108 Rottenburg am Neckar Telefon: (0 74 72) 16 53 10 e-mail: [email protected] 6. September bis 4. Oktober 2004 e-mail: [email protected] Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr Samstag 15.00 bis 18.00 Uhr 22. September bis 24. Oktober 2004 Verkehrsanbindungen: Abfahrt A 2 Dortmund Mengede, direkt im Krankenhaus St. Lorenzius Stift •Stuttgart • Wilhelmshaven Baisingen Zerreißprobe Frieden – Baden-Württemberg und der NATO-Doppelbeschluss Haus der Geschichte Baden-Württemberg Konrad-Adenauer-Straße 16 70173 Stuttgart Telefon: (07 11) 2 12 39 89 e-mail: [email protected] Täglich (außer Montag) 10.00 bis 18.00 Uhr Donnerstag 10.00 bis 21.00 Uhr Eintritt: 2,50 € ermäßigt: 1,50 € ð Schloß Hartenfels Schloßstraße 27 04860 Torgau Telefon: (0 18 05) 15 47 00 www.Landesaustellung.sachsen.de e-mail: [email protected] Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 5,00 € ermäßigt: 4,00 € 24. Mai bis 10. Oktober 2004 Verkehrsanbindungen: A 14 Ausfahrt Mutzschen Richtung Torgau / Parkplätze direkt im Stadtzentrum an der B 87 (Straße der Jugend) • Wa l t ro p Aufstand des Gewissens. Militärischer Widerstand gegen das NS-Regime 1933–1945 Kulturforum – Kapelle Waltrop ð Das Eiserne Kreuz – Zur Geschichte einer Auszeichnung Stiftung Deutsches Marinemuseum Südstrand 125 26382 Wilhelmshaven Telefon: (0 44 21) 4 10 61 Telefax: (0 44 21) 4 10 63 www.marinemuseum.de e-mail: [email protected] Täglich von 9.30 bis 18.30 Uhr 23. April bis 31. Oktober 2004 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 29 Manfred Wörner verstarb im Alter von 59 Jahren nach schwerer Krankheit. Als 30-Jähriger in den Bundestag gewählt, hatte er rasch über sein erstes parlamentarisches Betätigungsfeld, die Entwicklungspolitik, einen Zugang zu dem Gebiet gefunden, das seinen Interessen und Begabungen besonders lag: die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Seit 1976 Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, erwarb sich der Reserveoffizier und Jet-Pilot international den Ruf eines kompetenten Sicherheitspolitikers und überzeugten Transatlantikers. Als Verteidigungsminister hatte er ab 1982 harte Auseinandersetzungen unter den Vorzeichen des Ost-West-Konfliktes zu bestehen. Sie betrafen die Durchsetzung des NATO-Doppelbeschlusses mit der Stationierung und Modernisierung von Nuklearwaffen, aber auch die Verhandlungen zur Rüstungskontrolle und Abrüstung zwischen NATO und Warschauer Pakt. Personalstärkegesetz und die Diskussion um die Wehrdienstdauer sind Schlagwörter, die für seine weiteren politischen Themenfelder stehen. Überschattet wurde Wörners Amtszeit 1984 von der Affäre um die falschen Vorwürfe gegen General Günter Kießling. 1988 wechselte Manfred Wörner nach Brüssel, um als erster Deutscher und zugleich jüngster Amtsinhaber das Amt des NATO-Generalsekretärs zu übernehmen. Schon kurze Zeit später stand er vor der Aufgabe, das erfolgreiche Bündnis einer völlig veränderten Zeit anzupassen. Mit Energie und Weitsicht stellte er die Weichen für die Entscheidung der NATO, den ehemaligen Gegnern aus den Ländern Mittel- und Osteuropas Freundschaft und Zusammenarbeit anzubieten. Den Stabilitätstransfer gestaltete er durch das Angebot auf Mitgliedschaft im »NATO-Kooperationsrat« sowie das Programm »Partnerschaft für den Frieden« (PfP), dessen Gelingen er noch kurz vor seinem Tod mit der Aufnahme von 22 Mitgliedsstaaten erleben durfte. In der Rückschau ebnete PfP für viele dieser Länder den Weg in die NATO. Der von Wörner selbst als Präzedenzfall bezeichnete Einsatz der NATO außerhalb des Bündnisgebietes im ehemaligen Jugoslawien beantwortete für ihn die Frage, ob die neue NATO die Kraft aufbringen würde, einen Aggressor wirksam abzuschrecken. Dass die NATO diese Kraft aufbrachte und sich damit gleichzeitig auch zu einem Verteidigungsund Interventionsbündnis wandelte, war das entscheidende Verdienst Manfred Wörners. Burkhard Köster MGFA/Entwurf des deutschen EVG-Emblems 30. August 1954 Das Scheitern der EVG Es war ausgerechnet die französische Idee einer supranationalen Europa-Armee von 1950, deren Verwirklichung Ende August 1954 vom französischen Parlament zunichte gemacht wurde. Der nach dem Vorbild der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl entworfene Plan des Ministerpräsidenten René Pleven vom Oktober 1950 zielte gegen die angloamerikanischen Pläne, ein nationales westdeutsches Kontingent der NATO aufzustellen. Stattdessen sollten deutsche Streitkräfte bereits auf Bataillonsebene in eine multinationale europäische Streitkraft integriert werden. So sollte der Beitritt der Bundesrepublik zur NATO vermieden und ein unkontrolliertes Anwachsen einer neuen deutschen Armee verhindert werden. Die Verhandlungen bis zur Unterzeichnung des EVG-Vertrages zogen sich hin. Dabei konnte die Bundesregierung allerdings die Integration erst auf der Divisionsebene, ein westdeutsches Verteidigungsministerium und die nationale Rekrutierung durchsetzen. Aber nach Unterzeichnung des EVG-Vertrages am 27. Mai 1952 wurde deutlich, dass die französische Öffentlichkeit den Plan ablehnte und die Nationalversammlung immer weniger zur Ratifizierung des Abkommens bereit war, da Großbritannien der EVG fern blieb, die eigene Souveränität gefährdet schien und die verbindliche Zusage Washingtons zur dauerhaften Stationierung von US-Truppen in Europa nicht erreicht werden konnte. Es war dann ein sehr unspektakulärer Akt, der sich damals in der französischen Nationalversammlung abspielte. Der Abgeordnete Herriot beantragte am 30. August 1954 die Absetzung des Themas EVG von der Tagesordnung. Mit 319 Ja- gegen 264 Nein-Stimmen wurden so eine Debatte und Abstimmung über die EVG verhindert und danach nie wieder aufgenommen. Die deutsche Enttäuschung wich schnell, denn die Ablehnung vom 30. August machte den Weg frei zum Beitritt zu Westeuropäischer Union (WEU) und NATO. hb 30 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 Militärgeschichte Zeitschrift für historische Bildung Ü Vorschau Wenn neue Waffensysteme entstehen sollen, spielen politische Gründe eine gewichtige Rolle. Vor allem wenn es sich um Rüstungsgüter für ein Land handelt, das von seinen Nachbarn so misstrauisch beobachtet wird, wie die junge Bundesrepublik Deutschland Anfang der fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. In der Entstehungszeit der Bundeswehr galt es von einem demilitarisierten Land nur zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges hohe Anstrengungen einer Wiederaufrüstung zu verlangen. Hierbei BMVg, IP-Stab, Bonn/Fotografische Sammlung MHM Dresden Tod von NATO-Generalsekretär Manfred Wörner Heft 3/2004 13. August 1994 Geschichte kompakt MHM, Dresden Service 5 Schützenpanzer HS 30 wurde von der Bundesregierung erstmals der europäische Weg beschritten und versucht über nationale Grenzen hinaus zu einer Art von Kooperation zu gelangen. So erhielt die Schweizer Firma Hispano Suiza den Zuschlag für den neuen Schützenpanzer HS 30. Die Produktion lief in Großbritannien und der Bundesrepublik, die Gewinne blieben aber in Genf. Schon der Prototyp wurde von den Prüfern mit wenig schmeichelhaften Wertungen belegt: Fahrzeug zu hoch, Kampfraum zu kurz, Besatzung ohne ausreichenden Platz, Heckausstieg fehlt und Getriebe und Motor zu schwach und nicht geeignet. Die Zeitschrift »Kampftruppen« schrieb im Jahr 1968 mit Blick auf die Entwicklung des deutschen Projekts MARDER: »Sicherlich hat [...] der Schatten des HS 30 über der Entwicklung des Schützenpanzers [...] gelegen und das war in diesem Falle vielleicht ganz gut so.« Was war mit dem »Schatten des HS 30« gemeint? Die nächste Ausgabe der Militärgeschichte wird sich mit dem Schützenpanzer HS 30 von den Anfängen bis zum Scheitern des fertigen Projekts – einem spannenden Thema der Rüstungswirtschaft – beschäftigen. hb »A ls äußeres Zeichen gemeinsamer Pflichterfüllung im Dienst für Volk und Staat stifte ich für Bataillone und entsprechende Verbände Truppenfahnen in den Farben schwarz-rot-gold mit Bundesadler.« So beginnt die am 18. September 1964 erlassene »Anordnung über die Stiftung der Truppenfahnen für die Bundeswehr«. Erst beinahe zehn Jahre nach Gründung der Bundeswehr erhielten die Verbände ihre offiziellen Truppenfahnen. 40 Jahre nach deren Stiftung sind diese im militärischen Zeremoniell zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Bei der Aufstellung der Bundeswehr war jedoch bewusst auf Truppenfahnen verzichtet worden. So sollte – im deutlichen Gegensatz zum »Dritten Reich« – auf »militärisches Gepränge«, wie Paraden, Wachaufzüge und Flaggenparaden, verzichtet werden. Denn man wollte sowohl bei den Bündnispartnern als auch bei den politischen Gegnern der Wiederbewaffnung Erinnerungen an die Wehrmacht vermeiden. Eine offizielle Enthaltsamkeit der Streitkräfte von traditionellen Formen und Symbolen brachte jedoch auch gewisse Gefahren mit sich. So hatte die Weimarer Republik die Ausstrahlungskraft von militärischen Symbolen verkannt. Dies führte dazu, dass die Soldaten der Reichswehr auf die Truppenfahnen aus monarchischer Zeit zurückgriffen. Dadurch wurde jedes militärische Zeremoniell zu einer Demonstration der alten (vordemokratischen) Ordnung. Auch in der jungen Bundeswehr behalf man sich bei feierlichen Anlässen mit Fahnen der Alten Armee aus der Zeit vor November 1918 oder mit improvisierten Eigenkreatio- nen. Durch die Stiftung eigener Truppenfahnen sollte diesem »Wildwuchs« Einhalt geboten werden. Im Jahr 1964 erreichte die Bundeswehr die NATOSollstärke von 12 Divisionen. Die innere Verfassung der Truppe wurde jedoch durch den Wehrbeauftragten des Bundestags, Vizeadmiral a.D. Hellmuth Heye, kritisiert. Die Stiftung der Truppenfahnen fand also in einem Umfeld statt, dass einerseits durch den Abschluss der Aufbauphase der Bundeswehr, andererseits aber auch durch die Suche nach dem »richtigen Geist der Truppe« bestimmt war. Die Bundeswehr und ihre Einheiten sollten nun über ein Symbol verfügen, dass mit den Werten der Bundesrepublik Deutschland in Einklang stand. Daher stehen die gestifteten Truppenfahnen für die demokratische rechtsstaatliche Hoheit und Autorität der Bundesrepublik Deutschland, die Freiheit, die soldatischen Tugenden, insbesondere des treuen Dienens und der Tapferkeit, sowie für die Verbundenheit mit dem deutschen Volk und die Kameradschaft innerhalb der Verbände. Nachdem am 18. September 1964 die Truppenfahnen durch den Bundespräsidenten Heinrich Lübke gestiftet worden waren, übergab dieser am 7. Januar 1965 die erste Truppenfahne stellvertretend für die gesamte Bundeswehr an das Wachbataillon in Bonn. Der erste Fahnenträger der Truppenfahne war Feldwebel Alfred Kreuser. Am 24. April 1965 wurden die Truppenfahnen durch den damaligen Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Ulrich de Maizière, in Münster an Abordnungen der 319 Bataillone des Heeres übergeben. Während die Übergabezeremo- bpa/Ludwig Wegmann Truppenfahnen für die Bundeswehr 5 Übergabezeremonien: Übergabe von 19 Truppenfahnen an die Marine in Plön (oben). Ausmarsch der ersten Truppenfahne der Bundeswehr am 7. Januar 1965 in Bonn (unten). nie für Heer und Luftwaffe gemeinsam erfolgte, wurden die Truppenfahnen der Marine auf dem Gelände der Marineunteroffizierschule in Plön übergeben. In der Woche vom 26. April bis zum 3. Mai fanden die Übergaben an die Bataillone statt. Die erste Truppenfahne der Bundeswehr ist längst ausgemustert. Sie befindet sich heute in den Beständen des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung in Berlin. Als Symbol für die Integration der militärischen Macht in das Staatsgefüge und deren Verpflichtung zum treuen Dienen im Sinne der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist die ein Quadratmeter große schwarzrot-goldene Truppenfahne mit dem gestickten Bundesadler und dem Eisernen Kreuz im Eichenlaubkranz an der Spitze des Fahnenstockes Bestandteil der eigenen Tradition der Bundeswehr. aak Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2004 31 BMVg/SKA/IM2 Militärgeschichte im Bild NEUE PUBLIKATIONEN DES MGFA Themenfelder des Bandes: Blockbildung und Blockkonfrontation. Die DDR und ihr Militär im Kalten Krieg Sicherheitsarchitektur und Streitkräfte. Die DDR im Spannungsfeld zwischen Fremd- und Selbstbestimmung Im Auftrag der Partei. Militär, Staat und Gesellschaft in der DDR Forschungsfelder, Ergebnisse, Perspektiven Das Militär als Mittel der Herrschaftssicherung im SED-Staat Armee des Volkes? Schnittflächen zwischen militärischer und ziviler Gesellschaft in der DDR Soldatsein im Sozialismus. Lebenswelt und militärischer Alltag in der NVA Kirche und Militär in der DDR. Militär und Film in der DDR. Vom Ende der Armee zum Neuanfang für die Soldaten. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes herausgegeben von Hans Ehlert und Matthias Rogg, Berlin: Ch. Links Verlag 2004, X, 740 S. (= Militärgeschichte der DDR, 8) 34,80 ISBN: 3-86153-329-4