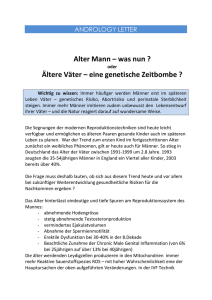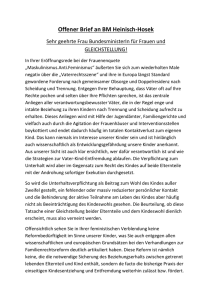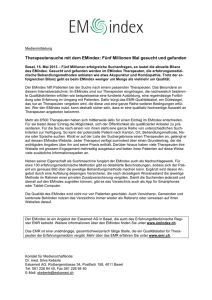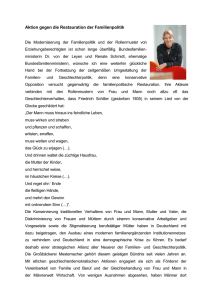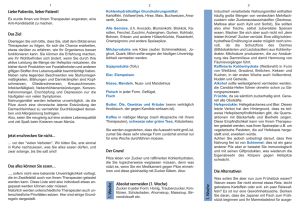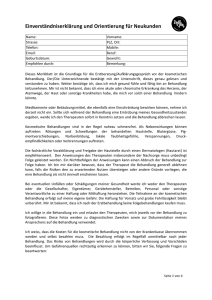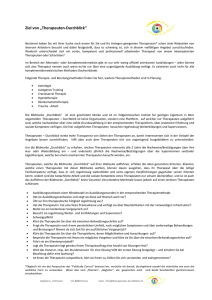Musterseiten 024-028
Werbung

24 Der Dritte im Bunde? ihre Reihung angeht, so hätten wir auch die Möglichkeit gehabt, sie z.B. nach theoretischen Paradigmen, dem jeweils gewählten Setting oder nach diagnostischen Merkmalen der Klienten zu ordnen. Uns hat aber Günther Bittners Text mit seinem Hinweis auf Urängste von (angehenden) Vätern zu einer anderen Abfolge animiert: Wir eröffnen sie mit drei Beiträgen zur Frage, was uns an „Vater“ und „Väterlichkeit“ begegnet, wenn wir in die Geschichte von Mythen blicken (Bittner), wenn wir einen analytischen Gruppenprozess verfolgen (Gfäller) und wenn wir Therapeuten bei ihrer Erinnerungsarbeit zuhören (Aigner). Die drei folgenden Texte (von Arnold, Hauser/Salamander/Schmid-Arnold und Göttken/von Klitzing) machen deutlich, wie Väter in unterschiedlichen Settings auf ihre Rolle als „Dritte im Bunde“ vorbereitet oder darin bestärkt werden. In zwei weiteren Beiträgen geht es darum, wie der fehlende Dritte für eine Übergangszeit durch den Therapeuten repräsentiert (Schambeck) oder an den aufgegebenen bzw. verloren gegangenen Platz in der Familie zurückgeholt werden kann (Rufer). Die beiden abschließenden Darstellungen nehmen Freuds Auffassung vom „körperlichen Ich“ ernst und demonstrieren zum einen, wie analytische Arbeit, verbunden mit der Beobachtung von Körpersignalen, zur Annahme einer zunächst abgewehrten Vaterrolle führen kann (Hochauf), zum anderen, wie sich durch die „körperliche Mitsprache“ des Therapeuten Erfahrungen mit gestörten Triangulierungen aufarbeiten lassen (Heisterkamp). Die Texte in Kurzfassungen Günther Bittner bringt von seinem psychoanalytischen Standpunkt aus die sinkenden Geburtenraten in den westlichen Ländern mit einer Verweigerung von Männern in Verbindung, die mit der „Schwellensituation“ des Vaterwerdens und den damit assoziierten existenziellen Ängsten nicht fertig werden. Für den von ihm postulierten Zusammenhang von Zeugungswunsch und Zeugungsangst findet er in der Wissenschaft weniger Hinweise (s. seine Kritik an Erik Erikson) als in der Dichtung. So macht sich in Goethes „Faust“ Mephisto über den Helden lustig: Für Faust sei der Gang in des Liebchens Kammer wohl so etwas wie ein Gang aufs Schafott. Bittners Schlussfolgerung: Zeugung impliziert, dass wir die Endlichkeit unseres Lebens zur Kenntnis nehmen. Von hier aus wird die Entscheidung für oder gegen Kinder zu einer Risikoabschätzung, die mit familienpolitischen Maßnahmen nicht zu überspielen ist. Drei mythische Figuren illustrieren für ihn Varianten dieser Ängste: Wer ein Kind (einen Sohn) zeugt, hat allen Grund, sich um seine Macht und um sein Leben zu sorgen (Lajos); wer ein Kind zeugt, muss fürchten, ein Monster in die Welt zu setzen (Minos); wessen Frau ein Kind zur Welt bringt, der kann nicht sicher sein, dass er der Vater ist (Josef). Wie akut „archaische“ Ängste dieser Art sein können, illustriert Bittner anhand von drei Fallvignetten. Sie unterstützen seine These, dass das Vaterwerden ein bio-psychisches Geschehen ist, das an die eigene Endlichkeit, wenn nicht gar Vernichtung denken lässt. Helmwart Hierdeis und Heinz Walter 25 In den von Georg R. Gfäller beschriebenen gruppenanalytischen Prozessen steht der Vater nicht von vorneherein im Fokus. Bedingt durch die Entstehungsbedingungen der Gruppe in der ambulanten Praxis, ihre inhomogene Zusammensetzung hinsichtlich Alter, Geschlecht und Störung und die assoziative, d.h. thematisch ungebundene Kommunikation kommt die Vater-Thematik, wie das einleitende Beispiel zeigt, nur dann ins Spiel, wenn sie Teilnehmern wichtig erscheint, und sie bleibt so lange Gegenstand der gemeinsamen Arbeit, wie sich die Gruppe damit befassen möchte. Der Gruppenleiter sieht seine Aufgabe darin, ein angstfreies Klima herzustellen, Resonanz zu bieten, seine Gegenübertragung im Auge zu behalten, Teilnehmer zu stützen und zu schützen, Widerstände zu analysieren, Vertiefungen anzuregen und darauf zu achten, dass die erarbeiteten Einsichten in Zusammenhänge – hier hinsichtlich Männlichkeit, Vaterrolle, Väterlichkeit – nicht verloren gehen. Hilfreich sind für ihn dabei die fünf von Foulkes entwickelten Kommunikationsebenen der Öffentlichkeit, der Übertragung, der Projektionen, der Körperlichkeit und die sog. Primordinale Ebene (Rituale, Sitzordnung, kulturell geprägte Bilder von Väterlichkeit usw.). Aus verschiedenen Gesprächsfacetten kristallisieren sich für Gfäller als bedeutsame Eigenschaften von Vätern heraus, dass sie einerseits ihren Kindern Sicherheit bieten und Resonanz geben, andererseits den Müttern gegenüber ihre männliche Identität und damit den erotischen Charakter der Beziehung wahren. Der Beitrag des Psychoanalytikers Josef Christian Aigner passt auf den ersten Blick nicht in das vorgelegte Spektrum, weil er keine Therapieausschnitte vorstellt, in denen „reale“ und „innere“ Väter zur Sprache kommen. Auf den zweiten Blick ist das genaue Gegenteil der Fall: Aigner hat schon vor ein paar Jahren bemerkt, dass das Vater-Thema in der Psychotherapie kaum Beachtung findet, und die Vermutung geäußert, dieser Mangel könne sein Gegenstück in der fehlenden Präsenz des eigenen Vaters im Bewusstsein der Therapierenden haben. Dieser Verdacht verstärkte sich für ihn in mehreren Psychotherapie-Seminaren, in denen es eigentlich um Erfahrungen mit dem Vater-Thema in Therapien hätte gehen sollen, in denen aber durchgängig die persönlichen Vatererfahrungen der Teilnehmer dominierten – so als ob die Betreffenden noch nie die Gelegenheit gehabt hätten, ihre Vatergeschichten loszuwerden. Dass die Angesprochenen bis auf wenige Ausnahmen fünfzig Jahre und älter waren und ihre Väter damit der Kriegsgeneration, d.h. einer durch besondere Erfahrungen geprägten autoritären Epoche angehört hatten, wirft für Aigner nicht nur ein Licht auf ein spezielles Generationenverhältnis, sondern ist für ihn ein weiterer Anhaltspunkt dafür, dass der Vater allzu leicht „vergessen“ wird – in der Therapie ebenso wie in der Selbstreflexion der Therapeuten. Männern, die ihre Vaterschaft konflikthaft erleben, gilt das Interesse von Stefan Arnold, einem Vertreter psychodynamischer, psychoanalytischer und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie. Die Besonderheit dieses Therapiekonzepts sieht er darin, dass sie auf relativ kurze Behandlungszeiten Wert legt, Symptomreduktion anzubahnen versucht und sich auf fokale Konflikte konzentriert. Sie setzt damit eine schon bei Freud angelegte Konflikttheorie (Ambivalenz von Liebe 26 Der Dritte im Bunde? und Hass) fort, in der psychische Symptome unzulängliche Bewältigungsversuche darstellen. Die analytischen Bemühungen richten sich infolgedessen, wie der Autor im Anschluss an Stavros Mentzos und Léon Wurmser postuliert, auf die Minderung pathogener Konflikte. Ausführlich diskutiert Arnold unter dieser Leitlinie drei höchst unterschiedliche Konfliktsituationen: 1. Ein Mann kämpft darum, von Frau und Kindern als guter Vater angesehen zu werden. 2. Ein Mann sieht sich mit der Homosexualität seines Sohnes konfrontiert. 3. Ein Mann entdeckt sein Burnout im Beruf als Verschiebung eines Konflikts mit seiner Tochter. Ausgehend von der Hypothese, dass Konflikte in frühen (dyadischen/triadischen) Beziehungen verinnerlicht werden und die Gestaltung künftiger Beziehungen beeinflussen, entdeckt der Verfasser als gemeinsames Strukturschicksal in allen drei Fällen eine unzureichende Präsenz der eigenen Väter und damit eine frühe Störung der ElternKind-Triade mit weitreichenden Folgen. Im Rahmen der Babyambulanz der Münchner Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse (MAP) arbeiten die Autorinnen Susanne Hauser, Catharina Salamander und Viktoria Schmid-Arnold in der analytischen Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie mit den Vätern. Sie beziehen sich dabei auf psychoanalytische Konzepte der Präsenz des „realen“ sowie des „inneren“ Vaters. Anhand von mehreren Fallvignetten zeigen die Autorinnen, wie im Behandlungsverlauf trotz schwieriger Voraussetzungen triadische Prozesse zwischen Vater, Mutter und Kind angestoßen werden. Therapieziel ist es, die Väter als die „Dritten“ zu gewinnen, auch um die symbiotische Beziehung des Kindes zur Mutter zu öffnen. Vor allem bei mütterlicher Depression kann der Vater als eine primäre Bindungsfigur eine wichtige Stütze sein. Das kann leichter geschehen, wenn sich schon während der Schwangerschaft triadische Vorstellungen im Elternpaar entwickeln können. Ausgehend von den Arbeiten Margaret Mahlers zum Bindungsverhalten von Kindern und zum Vater als konstantes und verlässliches „drittes Objekt“ stellt Tanja Göttken zusammen mit Kai von Klitzing die „Psychoanalytische Kurzzeittherapie für Kinder mit emotionalen Symptomen und affektiven Störungen“ (PaKT) dar. Das Konzept sieht vor, die Väter mit ihrem Beziehungspotenzial möglichst in die Behandlung einzubeziehen. Die sog. „triadische Kompetenz“ wird als die Fähigkeit von Müttern und Vätern verstanden, das Kind auf der Ebene der Vorstellung und faktisch in die eigene Beziehungswelt zu integrieren. Um herauszufinden, wie es um diese Kompetenz steht, haben die Autoren das „Triadeninterview“ entwickelt, das fünf Dimensionen erschließen soll: die Qualität der elterlichen Objektbeziehung, die Flexibilität der elterlichen Vorstellungen vom Kind, das trianguläre Niveau dieser Vorstellungen, die Qualität des elterlichen Dialogs und die Stimmigkeit der elterlichen Erzählungen über die Erfahrungen mit den eigenen Eltern. Die Autoren richten in drei von ihnen dokumentierten Fällen ihr Augenmerk darauf, den Vätern und Müttern bewusst zu machen, dass die Symptome ihrer Kinder mit Beziehungsdefiziten in der Triade zu tun haben. Insonderheit die Väter sollen erkennen, wie wichtig sie für die Entwicklung der Autonomie ihrer Kinder sind und was sie tun können, um sich stärker ins Spiel zu bringen. Helmwart Hierdeis und Heinz Walter 27 Als analytischer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut blickt Franz Schambeck zunächst auf die Rolle des Vaters in der Entwicklung des Kindes, insbesondere auf seine sozialisationsbedingten Erfahrungen, die zur Ausprägung von Männlichkeit und Vatersein, von Individuierung und triadischen Fähigkeiten geführt haben. Gerade sie sieht er als notwendig an, damit der Vater von Anfang an im triangulären Raum seine spezifischen Qualitäten als ein „Anderer“ ins Spiel bringen kann, der die Mutter-Kind-Dyade relativiert und damit beim Kind eine Entwicklung zur Autonomie in Gang bringt. Am Beispiel eines ausführlich dokumentierten Therapieprozesses mit einem achtjährigen Jungen macht er deutlich, was geschehen kann, wenn der „Vater im Innern“ nicht genügend Gestalt annehmen konnte: Das Kind trägt seine ganze archaische innere Welt in die therapeutische Beziehung, es externalisiert seine Aggressionen, sexuellen Fantasien, Omnipotenzgefühle und Zerfallsängste und richtet seine Beziehungswünsche auf den Therapeuten als idealisierten Quasi-Vater. Schambeck gelingt es, den Jungen nicht nur auszuhalten, sondern so zu halten, dass er an Symbolisierungsfähigkeit und Objektkonstanz gewinnt und seine Beschränkung auf den dualen Beziehungsmodus überwindet. Dazu trägt auch die begleitende Arbeit des Therapeuten mit beiden Eltern bei. Martin Rufer richtet als systemisch orientierter Therapeut seine Aufmerksamkeit auf den sozialen Kontext von psychischen Störungen und damit auf die Interaktion zwischen Familienmitgliedern unter den Bedingungen ihres Umfelds. Er kennt zwar die Angst von Vätern davor, in ihrer Rat- und Hilflosigkeit enttarnt und als „Patienten“ stigmatisiert zu werden, aber er will sie soweit wie möglich mit ihren wichtigen Funktionen für die Kinder als Spielpartner, Herausforderer, Lehrer und mit der ihnen eigenen Art, Selbstvertrauen zu verstärken, Emotionen zu regulieren und Bindungen zu halten, für das System Familie (zurück)gewinnen. Wie er an Fallbeispielen eindrucksvoll zeigen kann, besteht für ihn die Rolle des Therapeuten darin, Anwalt für gemeinsame Entwicklungen, nicht aber Vertreter von einzelnen Betroffenen zu sein. In diesem Sinne sucht er insbesondere die Väter hereinzuholen und sie ihre Rolle im System finden zu lassen. Das erfordert Systemkompetenz und den Mut, Konflikte anzugehen, Eigenschaften, die Rufer bei manchem Therapeuten vermisst. Renate Hochaufs Darstellung der analytisch-körperorientierten Therapie eines in der frühen Kindheit traumatisierten Mannes trifft auf ein doppeltes Defizit der Therapieforschung: das geringe Wissen über die strukturbildenden Einflüsse des Vaters auf das Kind und den entsprechend dünnen Kenntnisstand im Hinblick darauf, wie sich strukturelle Verletzungen und Defizite von Vätern auf ihre Kinder auswirken. Am Beispiel eines Patienten, der seine Beziehungen zu Frauen immer wieder abgebrochen hatte, wenn sie für ihn verbindlich zu werden drohten, und der nun erstmalig mit der Schwangerschaft seiner gegenwärtigen Partnerin und mit der Geburt des Kindes konfrontiert ist, zeigt die Autorin, wie sich ein frühes Schicksal (Kind aus einer Vergewaltigung, dramatische Geburtssituation, Missbrauch durch den Stiefvater) mithilfe von traumaorientierten Interventionen bearbeiten lässt. Das geschieht auf der Grundlage eines analytischen Prozesses, der 28 Der Dritte im Bunde? sowohl neuere Erkenntnisse der neurobiologischen Forschung als auch eine darauf aufbauende Wahl des für die Traumabearbeitung geeigneten Mediums einschließt. Die von der Therapeutin praktizierten Interventionen verbinden analytische Kategorien und Methoden mit der Beobachtung und Reflexion von Körperwahrnehmungen und Imaginationen des Patienten. Insbesondere an der Rekonstruktion des Geburtstraumas lässt sich ablesen, wie sich durch die Parallelisierung von früheren mit heutigen Wahrnehmungen erstarrte Traumaszenen lösen und in eine befreiende Sprache überführen lassen. Günter Heisterkamp sieht in analytisch-körpertherapeutischen Interventionen basale Möglichkeiten, die Dimensionen des Wahrnehmens, Begreifens, Durcharbeitens und Verstehens zu bereichern. Der Therapeut übernimmt damit für den Patienten wichtige Funktionen eines Selbst- und Entwicklungsobjekts. An mehreren Fallbeispielen mit „realen“ und „imaginierten“ Vätern, in denen er den sich herausbildenden Bewegungsmustern besondere Beachtung schenkt, deckt er Störungen der Triangulierung auf und entdeckt zugleich behandlungsmethodische Anregungen. Was (noch) nicht in Worte gefasst werden kann, drückt unter Umständen der Körper aus. Dafür findet der Autor Belege nicht nur in Therapien mit anderen, sondern auch in seiner eigenen Therapieerfahrung. Die interaktive Teilhabe an der Bewegung von Patienten, der Heisterkamp die eigentliche therapeutische Wirkung zuschreibt, wirkt allerdings nicht aus sich allein, sondern muss analytisch nachbearbeitet werden. Unter den vom Autor entwickelten vier Arbeitsprinzipien sticht die Fähigkeit heraus, zwischen dem eigenen Erleben und dem des Patienten unterscheiden zu können, weil sie mit darüber entscheidet, ob der Therapeut trotz der körperlichen Nähe zu ihm die Grenze zwischen ihnen wahren kann. Wir danken den Autorinnen und Autoren für ihre engagierte, kompetente und geduldige Mitwirkung an diesem Band und hoffen, dass er nicht nur zu einer Intensivierung der therapeutischen Arbeit mit Vätern beiträgt, sondern auch Väter in Konfliktsituationen ermutigt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, damit sie als „Dritte im Bunde“ wieder präsent sein können. Literatur Abelin EL. The role of the father in the separation-individuation process. In: McDevitt JB, Settlage CF (eds). Separation-Individuation. New York: International Universities Press 1971; 229–52. Abelin EL. Some further observations and comments on the earliest role of the father. Int J Psychoanal 1975; 56: 293–302. Aegerter C. Gemeinsam statt einsam. Warum es sich lohnt, vom ersten Tag an aktiv Vater zu sein. In: Walter H, Eickhorst A (Hrsg). Das Väter-Handbuch. Theorie, Forschung, Praxis. Gießen: Psychosozial 2012; 531–46. Aigner J, Rohrmann T (Hrsg). Elementar – Männer in der pädagogischen Arbeit mit Kindern. Opladen: Budrich 2012.