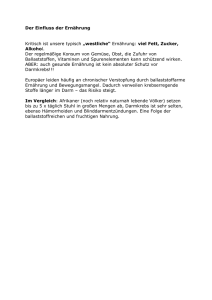Chemoprävention mit ASS und Vi tamin D – Sekt und Selters
Werbung

VI SET AN BLUTPROTEINEN Mit Bluttests in die Zukunft des Screenings? Bisher gibt es als Screening-Alternative zur Koloskopie nur Stuhltests, die von vielen Patienten abgelehnt werden. Ärzte wünschen sich daher dringend Alternativen. Die Hoffnungen richten sich seit einiger Zeit auf Bluttests, die beispielsweise Nukleosomen, Proteine und verschiedene RNA- und DNA-Fraktionen messen. Allerdings stehen einem Einsatz noch Probleme im Weg, wie Professor Dr. Hans Jørgen Nielsen, Kopenhagen, in einer großen Untersuchungsreihe zeigen konnte. Zusammen mit privaten Labors sammelte er über Jahre hinweg Blutproben von Patienten mit Krebs, Adenomen und anderen Darmerkrankungen, um die Bluttests zu prüfen. Dabei zeigte sich, dass deren Leistungsfähigkeit von vielen Faktoren abhing, darunter von der Lokalisation und dem Stadium der Neoplasien sowie von Komorbiditäten. Bluttests könnte daher die Zukunft gehören, aber das richtige Verfahren ist noch nicht gefunden. An der Suche beteiligt sich auch die Applied Proteomics Inc. (API) in San Diego. Das Unternehmen setzt auf ein Set an Blutproteinen, die bei der Entwicklung eines Kolorektalkarzinoms eine Rolle spielen. „Ziel ist es, den kontinuierlichen Dialog dieser Proteine im Organismus zu überwachen und so eine Krebserkrankung früher als bisher zu entdecken“, sagte Dr. John Blume, Chief Science Officer von API. In bisherigen Forschungen habe man eine Kombination aus 13 Proteinen identifiziert, die Neoplasien über alle Stadien und Lokalisationen hinweg mit großer Zuverlässigkeit nachwies. Mit der Markteinführung des Tests wird im Laufe des kommenden Jahres gerechnet. (gl) Verlag und Redaktion: Springer Medizin, Ärzte Zeitung Verlags-GmbH, Neu-Isenburg Ein Unternehmen der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media GmbH Geschäftsführung: Joachim Krieger, Fabian Kaufmann Chefredakteur: Wolfgang van den Bergh Beilagenredaktion: Dr. Marlinde Lehmann (verantwortlich), Günter Löffelmann (gl), Dr. Angela Speth Sonderberichte: Günter Löffelmann (verantwortlich) Herstellung: Frank Nikolaczek (verantw.), Michael Eiles Ladungsfähige Anschrift für Verlag und Redaktion: Ärzte Zeitung Verlags-GmbH, Am Forsthaus Gravenbruch 5, 63263 Neu-Isenburg, Telefon: 0 61 02 / 506-0, Telefax: 0 61 02 / 50 6 123; E-Mail: [email protected], www.aerztezeitung.de Postanschrift: Ärzte Zeitung, Postfach 2131, 63243 Neu-Isenburg Druck, Versand: ColdsetInnovation Fulda GmbH & Co. KG, Am Eichenzeller Weg 8, 36124 Eichenzell Gerichtsstand und Erfüllungsort: Offenbach am Main. Der Verlag haftet nicht für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos. Nachrichten werden nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr veröffentlicht. Urheberrechtsvorbehalt: Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Außer in den gesetzlich ausdrücklich zugelassenen Fällen ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages rechtswidrig. Der Verlag behält sich das ausschließliche Recht der Verbreitung, Übersetzung und jeglicher Wiedergabe auch von Teilen dieser Zeitung durch Nachdruck, auch auszugsweise oder in anderen Zeitungen und Informationsblättern, durch Fotokopie, Mikrofilm, Funk- und Fernsehaufzeichnung, EDVEinspeicherung, Aufnahme in und Gestattung des Zugriffs auf elektronische Datenbanken (online und offline) und die Vervielfältigung und Verbreitung auf CD-ROM und anderen Datenträgern vor. Rechtseinräumung durch Autoren: Mit der Einsendung eines Manuskripts zur Veröffentlichung überträgt der Verfasser dem Verlag für den Fall der Annahme das Recht, das Manuskript geändert oder unverändert ganz oder teilweise in der Ärzte Zeitung und in anderen Publikationen ihrer Fachverlagsgruppe, in den zugehörigen Onlinediensten, in Onlinedatenbanken Dritter und, soweit vereinbart, gegen Nachhonorar in Sonderdrucken für Industriekunden zu nutzen. Innovations-Workshop im DKFZ Mittwoch, 18. Juni 2014 Nr. 67 Mittwoch, 18. Juni 2014 Nr. 67 Innovations-Workshop im DKFZ VII Chemoprävention mit ASS und Vitamin D – Sekt und Selters Risikoreduktion im linken Kolon führen“, schloss Arber. Bei koronarvaskulären Erkrankungen sind es Ärzte längst gewohnt, Medikamente zur Prävention einzusetzen. Warum also nicht auch beim Kolorektalkarzinom? Vor allem der Einsatz von ASS scheint – zumindest in Risikokollektiven – sinnvoll zu sein. Vitamin D: Enttäuschende Studien VON GÜNTER LÖFFELMANN Hinweise auf den protektiven Effekt nichtsteroidaler Antirheumatika (NSAR) auf Darmpolypen gab es bereits in den 1990er Jahren. Damals konnte bei Patienten mit familiärer adenomatöser Polyposis (FAP) gezeigt werden, dass Sulindac die Zahl und die Größe kolorektaler Adenome im Vergleich zu Placebos signifikant reduziert. Die antineoplastische Wirkung von NSAR wird vermutlich über eine Hemmung der ProstaglandinE2(PGE2)-Synthese vermittelt. Bei ASS könnten weitere Mechanismen eine Rolle spielen, darunter eine Suppression des EGFR-Signalwegs. Es gilt daher als besonders interessanter Kandidat für die Chemoprävention von Darmkrebs. In Studien reduzierte ASS das Darmkrebsrisiko und das Wiederauftreten von Adenomen bei ein- bis vierjähriger Einnahme von 80 bis 325 mg pro Tag um bis zu 40 Prozent. Ein positiver Effekt auf das Langzeitüberleben zeigte sich nach zehn Jahren. Bei Trägern des Lynch-Syndroms verhinderte die Behandlung mit 600 mg ASS pro Tag in vielen Fällen das Auftreten von Karzinomen. Weitere positive Effekte sind für das krebsbezogene Überleben (Risikoreduktion 29 Prozent) und das Gesamtüberleben (Risikoreduktion 21 Prozent) nachgewiesen . Vor allem der Einsatz von ASS scheint – zumindest in Risikokollektiven – sinnvoll zu sein. © JUPITERIMAGES / THINKSTOCK Risikoadaptierte Chemoprävention Diesem protektiven Potenzial stehen allerdings die bekannten Nebenwirkungen von ASS gegenüber. Professor Dr. Nadir Arber, Tel Aviv, empfahl daher, ASS nur nach einer genauen Nutzen-Risikoabwägung einzusetzen. Potenzielle Kandidaten seien in jedem Fall Personen mit FAP und HNPCC, deren Lebenszeitrisiko für ein Kolorektalkarzinom bei 80 bis 100 Prozent liege. Auch bei Personen mit familiärer Vorbelastung, deren Risiko für diese Krebserkrankung zwei- bis vierfach erhöht ist, würde er zur Chemoprävention raten – zumindest dann, wenn ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Es ist sinnvoll, eine Chemoprävention mit ASS mit Koloskopien zu verbinden. Professor Dr. Nadir Arber, Tel Aviv weitere Risikofaktoren vorliegen. Für die Allgemeinbevölkerung mit einem Lebenszeitrisiko von 5 bis 6 Prozent sieht er hingegen in erster Linie Lebensstilanpassungen und ScreeningMaßnahmen als Mittel der Wahl. „Möglicherweise sollten wir aber versuchen, unter ihnen Subgruppen zu identifizieren, deren Darmkrebsrisiko durch weitere Faktoren wie höheres Alter, Nikotin- und Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und Übergewicht zusätzlich erhöht ist“. Darüber hinaus könnten künftig auch das genetische Profil und Eigenschaften des Tumors zur Risikostratifikation beitragen. So wisse man heute schon, dass bestimmte Mutationen im Tumorsupressor-Gen APC das Risiko für ein Kolorektalkarzinom deutlich erhöhten. Weiter sei ASS nur in Adenomen wirksam, die COX-2 positiv sind, die hohe Spiegel an Prostaglandin-Metaboliten haben, und die den BRAFWildtyp sowie eine PIK3CA-Mutation aufweisen. Und was die Inzidenzreduktion von Karzinomen angehe, sei ASS in erster Linie in proximalen Darmabschnitten effektiv. „Es ist daher sinnvoll, eine Chemoprävention mit ASS mit Koloskopien zu verbinden, da diese vor allem zu einer ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Die Evidenz für einen Nutzen von Vitamin D ist nicht so gut, wie gedacht. Professor Dr. Cornelia Ulrich, Heidelberg Auch Vitamin D schien eine Zeit lang ein vielversprechender Kandidat für die Chemoprävention des Darmkrebses zu sein. „In präklinischen Studien zeigte es antiproliferative und antiangiogenetische Wirkungen und förderte die Apoptose“, sagte Professor Dr. Cornelia Ulrich, Heidelberg. Tatsächlich waren in einer Metaanalyse prospektiver Studien die Vitamin-D-Aufnahme und insbesondere ein 25(OH)-Vitamin-D-Spiegel im Serum invers mit der Häufigkeit des Kolorektalkarzinoms assoziiert. In der Women’s Health Study hatte die Einnahme von 400 IU Vitamin D pro Tag dagegen keinen Vorteil gegenüber Placebo. „Die Ergebnisse aus dieser Studie sind allerdings nur begrenzt aussagekräftig, unter anderem, weil die Studiendauer von acht Jahren nicht ausreicht, um Effekte auf die Karzinominzidenz nachzuweisen“, sagte Ulrich. Einen Ausweg aus diesem Dilemma stellen Adenome als Surrogatendpunkte dar. „Adenome sind Vorläufer von drei Viertel aller Kolorektalkarzinome, sie haben mit ihnen verschiedene molekulare Eigenschaften und Risikofaktoren gemein, und ein Effekt kann schneller nachgewiesen werden“, sagte Ulrich. In der Vitamin D/Calcium Polyp Prevention Study wurde daher geprüft, ob Vitamin D3 (1.000 IU pro Tag) und Kalzium (1200 mg pro Tag) alleine oder in Kombination das Adenomrisiko senken können. Trotz einer guten Compliance der Teilnehmer und eines signifikanten Anstiegs der 25(OH)-Vitamin-DSerumspiegel hatte Vitamin D keinen Effekt auf die Adenominzidenz. Selbst in Subgruppen ließ sich keine signifikante Risikoreduktion nachweisen. „Zum jetzigen Zeitpunkt muss man daher schlussfolgern, dass die Evidenz für einen Nutzen von Vitamin D nicht so gut ist, wie gedacht“, so Ulrich. SCREENING-VERFAHREN INTERVIEW INTERVIEW Darmkrebs im Bilde „Das Präventionspotenzial nutzen!“ Impfung gegen Krebs rückt in greifbare Nähe Professor Dr. Christof von Kalle, Heidelberg, zieht sein persönliches Fazit aus dem Innovations-Workshop zur Früherkennung und Prävention des Kolorektal-Ca. Professor Dr. Hans-Georg Rammensee aus Tübingen versucht, tumorspezifische Antigene für eine Impfung zu nutzen. In einer Phase-IIStudie mit Nierenkrebs-Patienten ließ sich so das Überleben deutlich verlängern. Als sensitive bildgebende Alternativen zur Koloskopie konkurrieren gegenwärtig CT- und MR-Kolonografie sowie die Kapselendoskopie miteinander. Sind sie reif für den Einsatz im Screening? Scheuen Patienten die Vorsorgekoloskopie, stehen neben nichtinvasiven Tests auf okkultes Blut im Stuhl drei unterschiedliche bildgebende Verfahren zur Verfügung. Sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Was Sensitivität und Evidenz der Studienlage anbetrifft, liegt die CT-Kolonografie gegenwärtig am besten im Rennen. „In Screening-Studien wurden fast alle fortgeschrittenen Neoplasien erkannt: 80 bis 90 Prozent der Adenome ab 6 mm und über 90 Prozent der Adenome ab 10 mm“, sagte Professor Dr. Frank Kolligs, München. Sehr gute Werte also, wäre da nicht die Strahlenbelastung, die ihrerseits Krebs induzieren kann. In einer Studie kamen die Autoren zum Schluss, dass pro 24 bis 35 verhinderten Karzinomen mit einem strahleninduzierten Karzinom gerechnet werden muss. Das ist für die Verwendung als bevölkerungsbezogene Früherkennungsmaßnahme kaum vertret- bar, weshalb sie hierfür auch nicht empfohlen wird. Das Schadenspotenzial der Untersuchung müsse man vor allem bei jüngeren Personen berücksichtigen, kommentierte Kolligs. Eine weitere Alternative ist die Kolonkapsel. Geräte der zweiten Generation sind Kolligs zufolge mit zwei Kameras ausgestattet und erreichen damit einen Bildwinkel von 172 Grad. „Damit wird eine Detektionsrate von 60 bis 70 Prozent erreicht.“ Auch die MR-Kolonografie schneidet bei der Sensitivität im Vergleich mit den anderen bildgebenden Verfahren inzwischen gut ab. In einer eigenen Studie ermittelten Kolligs und seine Kollegen Detektionsraten von 90 Prozent für Adenome ab 10 mm Größe beziehungsweise von 78 Prozent für Adenome ab 6 mm. Weitgehend ungeklärt ist bislang, welchen Platz diese Verfahren in einer zukünftigen Screening-Strategie einnehmen können. Denkbar ist, dass sie in bestimmten Fällen als der Koloskopie vorgeschaltete Untersuchungsmethoden Verwendung finden. Dazu müsste für die Untersucher aber klar sein, bei welchen Befunden sie Patienten zur Abklärung zur Koloskopie überweisen sollten. Und nicht zuletzt muss bei CT- und MR-Kolonografie geklärt werden, wie mit extrakolonischen Befunden umzugehen ist. (gl) ÄRZTE ZEITUNG: Herr Professor von Kalle, welche Inhalte des Innovations-Workshops haben Sie am meisten beeindruckt? VON KALLE: Das waren vor allem die überzeugenden Daten zur Validität der Screening-Untersuchungen sowie die Fortschritte in der Bildgebung. Darüber hinaus scheinen wir mit ASS einen Wirkstoff zu haben, der bei Risikopersonen der Krebsentstehung vorbeugen kann. Und schließlich eröffnen sich etwa mit der Immuntherapie neue Optionen der adjuvanten medikamentösen Therapie. Das sind sehr beeindruckende Entwicklungen. Neben dem immunologischen Stuhltest wurden weitere Verfahren der nichtinvasiven Früherkennung vorgestellt, darunter Tests zum Nachweis von anderen Stuhl- oder von Blutmarkern. Welche davon sind Ihrer Ansicht nach als ScreeningTool am besten geeignet? Für eine populationsbasierte Früherkennung sind das im Moment die im- Professor Dr. Christof von Kalle, Leiter der Abteilung für Translationale Onkologie am DKFZ Heidelberg.© PHILIPP BENJAMIN, MEDIENZENTRUM DES UNIKLINIKUMS HEIDELBERG munologischen Stuhltests. Es scheint mir verfrüht, von den anderen Testverfahren welche hervorzuheben. Dazu fehlen noch wichtige Daten. Gibt es so etwas wie eine Botschaft, die von dem Workshop ausgeht? Ich glaube, wir haben das Potenzial, das in den jetzt schon verfügbaren Verfahren der Früherkennung und Prävention des Kolorektalkarzinoms steckt, noch längst nicht ausgeschöpft. Die Botschaft ist daher, dass sich nicht nur Wissenschaftler, sondern auch die an der Versorgung beteiligten Ärzte mit dem Thema näher befassen und dann intensiv mit den Patienten darüber reden. ÄRZTE ZEITUNG: Herr Professor Ram- mensee, welche Strukturen von Tumorzellen eignen sich besonders als Ziele für eine Impfung. RAMMENSEE: Die besten Antigene sind mutierte Peptide, die nur von den Tumorzellen exprimiert werden. Denn nur dann ist die Immunantwort spezifisch gegen den Tumor gerichtet. Bei gewebespezifischen Antigenen oder bei Antigenen, die in Tumoren nur häufiger exprimiert werden als in normalen Zellen, wird auch gesundes Gewebe attackiert. Das ist bei nicht lebenswichtigen Organen wie der Prostata vielleicht noch vertretbar, einen Patienten mit Darmkrebs kann man so aber nicht behandeln. Wie erfolgt die Impfung und welche Erfahrungen gibt es bereits? In klinischen Studien verabreichen wir, das heißt, bisher die Universitäts- aktivierte T-Zellen zirkulierende Tumorzellen ausgeschaltet haben und so diesen Überlebenseffekt herbeiführten. Professor Dr. Hans-Georg Rammensee ist Leiter der Abteilung für Immunologie an der Universität Tübingen. © UNIVERSITÄT TÜBINGEN ausgründungen immatics biotechnologies und CureVac GmbH, den Impfstoff – entweder die Peptide selbst oder die entsprechende mRNA – als intradermale Injektion; in den ersten beiden Wochen jeweils mehrmals, danach jede Woche einmal, solange bis beispielsweise zwölf Injektionen erreicht sind. Die induzierten T-ZellAntworten sind jahrelang nachweisbar, allerdings insgesamt noch schwach ausgeprägt. In einer Phase-II-Studie konnte eine Vakzine gegen überexprimierte Antigene beim Nierenzellkarzinom zwar das Tumorwachstum nicht aufhalten, aber die Patienten lebten deutlich länger. Wir vermuten, dass Welche Studien führen Sie durch? Zurzeit entwickeln wir Impfungen gegen gewebespezifische Antigene beim Prostatakarzinom sowie gegen überexprimierte Antigene beim Ovarialkarzinom. Für weitere Studien, in denen wir Impfungen gegen mutierte Antigene beim Gliom und beim Leberkrebs testen wollen, etablieren wir derzeit die Methoden. Denn in diesen Fällen muss für jeden Patienten ein individueller Impfstoff hergestellt werden. Parallel dazu arbeiten wir daran, die Wirksamkeit der Impfungen zu verbessern, beispielsweise indem wir die Vakzinen mit besseren Adjuvantien versehen und sie zusammen mit anderen Therapieverfahren anwenden. Wo hätte die Impfung ihren Platz in der therapeutischen Gesamtstrategie? Unmittelbar im Anschluss an eine chirurgische Reduktion der Tumorlast. Ich sehe eine realistische Chance, dass damit ein weiteres Krebswachstum verhindert und vielleicht später einmal sogar eine Heilung erreicht werden kann. Wie entsteht Darmkrebs? Um diese Frage zu beantworten, nehmen Forscher auch die Bakterien der Darmflora unter die Lupe. © MANUEL SCHÄFER / FOTOLIA.COM We are what we eat Studien zeigen, dass die Zusammensetzung der Darmflora das Karzinomrisiko im Darm beeinflusst. Die Darmflora verändert sich ihrerseits mit der Art der Ernährung. Essgewohnheiten können daher zur präventiven Maßnahme gegen Darmkrebs werden. Der menschliche Darm ist zweifellos der am dichtesten besiedelte Ort der Welt. „Zwischen 10 und 100 Billionen Bakterien leben dort und formen mit der Gesamtheit ihrer Genome das so genannte Mikrobiom“, sagte Dr. Meredith Hullar, Seattle. Es ist zurzeit Gegenstand intensiver Forschungen. Die Zusammensetzung der Darmflora und deren Rolle bei der Entstehung von Darmkrebs lässt sich über Analysen der prokaryotischen ribosomalen 16S rRNA untersuchen. Hullar zufolge können Bakterien das Risiko für Adenome und Darmkrebs auf verschiedene Weise beeinflussen: direkt, indem sie Infektionen oder Entzündungen hervorrufen, die Barrierefunktion der Mukosa regulieren, oder in Signalwege der Zellproliferation und –apoptose eingreifen; indirekt, indem sie chemopräventive Wirkstoffe metabolisieren und artspezifische Stoffwechselprodukte ausscheiden. Je nachdem, welche Bakterien die Darmflora dominieren, würden diese Einflüsse das Krebsrisiko fördern oder senken. Vergleich von Mikrobiomen Professor Dr. Jiyoung Ahn, New York, stellte eine US-Studie vor, in der die Mikrobiome von Darmkrebspatienten mit denen einer nicht an Krebs erkrankten Kontrollgruppe verglichen wurden. Dabei zeigte sich, dass die Mikrobiome der Patienten eine deutlich reduzierte bakterielle Artenvielfalt aufwiesen. Darüber hinaus unterschieden sich die Mikrobiome hinsichtlich der dominierenden Arten. „Bei den Darmkrebspatienten war der Anteil proinflammatorischer Fusobakterien gegenüber der Kontrollgruppe deutlich erhöht“, sagte Ahn. Dies passe zu Ergebnissen aus anderen Studien, die bei der Untersuchung von Darmkrebsgewebe eine Vermehrung des Fusobakterienanteils fanden. Ein weiterer Befund der Studie war, dass die Darmflora der Krebspatienten signifikant weniger Clostridia-Bakterien enthielt. Diese metabolisieren Ballaststoffe zu Butyrat, das einen antikarzinogenen Effekt hat. Umgekehrt fördern Ballaststoffe die Dominanz von Clostridia. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum eine ballaststoffreiche Ernährung das Krebsrisiko senkt. 50 Gramm Ballaststoffe pro Tag Wie rasch die Ernährung wichtige Biomarker für ein erhöhtes Darmkrebsrisiko beeinflussen kann, zeigt eine aktuelle Studie. Darin tauschten städtische Afroamerikaner, die häufiger als weiße Amerikaner an Darmkrebs erkranken, und ländlich lebende südafrikanische Zulus, bei denen Darmkrebs nahezu unbekannt ist, ihre gewohnte Ernährung für zwei Wochen: die Zulus aßen statt ihrer kohlenhydratbasierten, ballaststoffreichen Kost hauptsächlich Fleisch, während die Afroamerikaner von Big Mac und Pommes zu Hirse und Co. wechselten. „Zum Studienbeginn hatten die Zulus einen hohen Anteil an Butyrat-produzierenden Bakterien und hohe Butyratspiegel im Stuhl“, berichtete der medizinische Studienleiter Dr. Stephen O’Keefe, Pittsburgh. „Im Gegensatz dazu fand sich bei den Afroamerikanern ein hoher Anteil an Bakterien, die krebsfördernde sekundäre Gallensäuren produzierten, und entsprechend hohe Gallensäurespiegel.“ Nach der zweiwöchigen Ernährungsumstellung waren die Verhältnisse nahezu auf den Kopf gestellt. Bei den Zulus führte der Kostwechsel dazu, dass der Anteil der Butyratproduzenten und die Butyratspiegel sanken und der Anteil der Gallensäureproduzenten und die Gallensäurespiegel stiegen; bei den Afroamerikanern war die Entwicklung gegenläufig. Dies galt auch für diverse Biomarker, die das Darmkrebsrisiko beeinflussen: So stieg bei den Zulus die Zahl der Ki67+/CD3+ und CD86+ Zellen an, bei den Afroamerikanern hingegen sank sie. Sämtliche diätbedingte Veränderungen waren signifikant. „Eine unausgewogene Ernährung verändert also innerhalb kurzer Zeit die Darmflora und führt zu einer Konzentration proinflammatorischer und proliferativer Stoffwechselprodukte, die das Krebsrisiko erhöhen“, resümierte O’Keefe. Er empfahl, den Anteil von Fleisch und Fett in der westlichen Diät zu halbieren und mindestens 50 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu sich zu nehmen. Man könne dies als Beleg dafür sehen, dass die menschliche Darmflora über eine genetische Ausstattung verfüge, die nach einer ausgewogenen Ernährung verlange, und dass die Umstellung westlicher Ernährungsgewohnheiten auf eine ballaststoffreiche Diät eine schnelle Wirkung zeigen könne. Dies sind erste Anhaltspunkte für die Bedeutung, die die Darmflora für die Entwicklung von Darmkrebs und für neue Präventionskonzepte haben könnte. (gl)