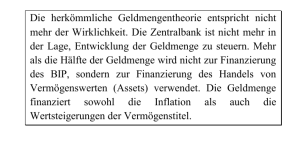iv geld- und fiskalpolitik (ii): monetarismus
Werbung

IV GELD- UND FISKALPOLITIK (II): MONETARISMUS 1 WÄHRUNG, ZENTRALBANK UND GELDPOLITIK 1.1 WÄHRUNG UND GELD n der Wirtschaftspolitik, so hatten wir gesehen, lassen sich vereinfacht zwei Hauptschulen unterscheiden: Interventionismus und Liberalismus. Die keynesianische Wirtschaftspolitik lebt von der Vorstellung, daß die Märkte zwar immer ein Gleichgewicht finden, nicht aber ein Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung. Daraus resultiert die Aufgabe der wirtschaftspolitischen Intervention des Staates. Der Monetarismus, der als zentrales wirtschaftspolitisches Leitbild in den 70er Jahren den Keynesianismus weitgehend verdrängt hat, ist durchaus auch eine interventionistische Konzeption. Allerdings beschränkt sich hier die staatliche Intervention ausschließlich auf die Steuerung der Geldmenge durch die Zentralbank. Radikale neoliberale Theoretiker, wie Ludwig von Mises oder Friedrich A. Hayek, vertraten deshalb die These, daß eine Steuerung der Geldmenge, wie sie der Monetarismus vertritt, prinzipiell schädlich und der Grund für vielfältige Störungen des Wirtschaftsprozesses ist. Für den radikalen Neoliberalismus ist bereits die Schaffung eines Zentralbankensystems die Quelle des Interventionismus. F. Ludwig von Mises Friedrich A. von Hayek A. von Hayek fordert deshalb eine »Abschaffung 1881-1973 1899-1992 des Geldmonopols der Regierung«1. Hayek schlug vor, die nationale Einheitswährung durch konkurrierende private Währungen zu ersetzen. »Dies würde bedeuten, daß jegliche Art von Devisenkontrolle oder Regulierung von Geldströmen (...) abgeschafft würde und daß hinsichtlich des Gebrauchs jeder dieser Währungen bei Abschluß von Verträgen oder im Rechnungswesen volle Freiheit herrschte.«2 Grundsätzlich stehen sich hier zwei gegensätzliche Geldtheorien gegenüber. Die Anhänger der Tauschtheorie des Geldes sagen, daß Geld nur im Marktprozeß geschaffen wird, als ein Ergebnis von Tauschprozessen zur Senkung der Transaktionskosten. Diese Theorie geht auf Adam Smith zurück und wurde ausdrücklich von Carl Menger so formuliert. Die Gegenthese - die wir im Zusammenhang mit der Keynesschen Theorie bereits erwähnt haben - besagt, daß Geld »ein Geschöpf der Rechtsordnung« (F. Knapp) ist. Keynesianismus und Monetarismus sind sich in dieser Auffassung sehr ähnlich. Die rein liberalen Autoren dagegen lehnen I 1 F. A. von Hayek, Entnationalisierung des Geldes, Tübingen 1977, S. 126. F. A. von Hayek, Entnationalisierung a.a.O., S. 1. Es wäre interessant zu fragen, ob die neuen Geldformen (electronic cash) nicht faktisch schrittweise diese von Hayek aufgestellte Forderung erfüllen - wie einige seiner jüngeren Anhänger im Internet verlauten lassen -, eine Frage, die wir hier nicht verfolgen können. 2 120 IV Monetarismus diese Auffassung ab, und F. A. von Hayek hat bis in die jüngste Zeit mit Nachdruck gegen eine Zentralbankpolitik argumentiert. Ein wichtiges Argument für die Markttheorie ist die Tatsache, daß beim internationalen Tausch naturgemäß eine Zentralbank zur Steuerung der Währung fehlt, so daß das Gold noch in den 60er Jahren eine wichtige Rolle spielte. Erst in den letzten rund 25 Jahren hat sich ein System reinen Floatens von nationalen Währungen herausgebildet, allerdings mit der Einschränkung, daß stets eine (US $) bzw. mehrere Währungen (DM, ¥) eine dominierende Rolle spielten. Der Versuch allerdings, für die gesamte Weltwirtschaft fixe Wechselkurse und damit eigentlich einen einheitlichen Wertmaßstab zu installieren (Bretton Woods System), ist gescheitert. Es ist - wie wir noch sehen werden - ein Kernsatz des Monetarismus, daß die Steuerung der Geldmenge von der Zentralbank nach einem Mechanismus, einer starren Regel erfolgen sollte, damit die Wirtschaftssubjekte die Geldmengenentwicklung vorhersehen und sich darauf einstellen können. Genau dies wird von Mises und Hayek für praktisch unmöglich oder undurchführbar gehalten. Kurz gesagt machen die liberalen Theoretiker einen deutlichen Unterschied zwischen Währung und Geld. Eine Währung erfüllt Geldfunktionen, aber die Geldfunktionen selbst erwachsen aus einem - wie sie glauben - undurchschaubaren Marktprozeß. Deshalb ist eine Zentralwährung für eine Nation eher von Nachteil, denn sie ist durch staatliche Eingriffe von den Geldfunktionen beim Gütertausch abgekoppelt und beständig der Gefahr ausgesetzt, zu fiskalischen Zwecken mißbraucht zu werden. Ludwig von Mises über Währungspolitik: „Man hat zur politischen und moralischen Rechtfertigung der währungspolitischen Eingriffe die Lehre aufgestellt, daß die Obrigkeit das Geld schaffe und daß das Geld ›ein Geschöpf der Rechtsordnung‹ sei. Das Geld wird jedoch vom Marktverkehr geschaffen und nicht von der Obrigkeit.2 „Die Geschichte der obrigkeitlichen Betätigung auf dem Gebiete des Geldwesen ist jedoch (...) eine Geschichte mißglückter preispolitischer Eingriffe zur Sicherung heimlicher fiskalischer Ausnützung des ausschließlichen Prägerechts, das die Obrigkeiten sich beigelegt haben.“3 Friedrich August von Hayek über Währungspolitik: „Es ist kein automatischer Mechanismus bekannt, durch den sich das Gesamtangebot an Geld genau in der erwünschten Weise anpassen wird, und zugunsten eines Mechanismus (oder eines durch feste Regeln bestimmten Handelns) kann höchstens gesagt werden, daß es zweifelhaft ist, ob in der Praxis irgend eine bewußte Lenkung besser wäre.“4 Die These des extremen Neoliberalismus beruht also auf einer prinzipiellen Skepsis gegenüber dem staatlichen Handeln: Der Versuch, die Währung in ihrer Geldfunktion zu fiskalischen Zwecken zu mißbrauchen, gilt als Hauptursache wirtschaftlicher Fehlentwicklungen. Der Staat mißbraucht die Marktfunktion des Geldes durch sein Währungsmonopol so der Gedanke. Dieses Argument kann sicherlich nicht grundsätzlich bestritten werden. Es verschweigt dennoch einen zentralen Punkt: Nicht nur der Staat, auch die »Privaten« - allen voran die 3 L. von Mises, Nationalökonomie, Genf 1940, S. 680f. F. A. von Hayek, Die Verfassung der Freiheit, Tübingen 19913, S. 420; vgl. auch Hayek, Entnationalisierung a.a.O., das Kapitel XVIII mit der Überschrift: »Währungspolitik weder wünschenswert noch möglich«. 4 IV Monetarismus 121 Spekulanten - »mißbrauchen die Geldfunktion« der Währungen. Während ein staatlicher Mißbrauch in demokratischen Verfassungen aber immerhin noch einer Kontrolle durch die Wähler unterworfen ist, gibt es (bislang) keine Institution, die weltweite Spekulationsprozesse kontrolliert. Es ergibt sich damit eher das Gegenteil der neoliberalen Position: Ein staatlicher Mißbrauch der Währung, wiewohl keineswegs auszuschließen, unterliegt einer demokratischen Kontrolle; ein privater Mißbrauch durch die Spekulation dagegen führt vermutlich noch zu größeren Wohlfahrtsverlusten und ist nicht kontrollierbar. Diese Blindheit für die Fehlfunktionen der Marktprozesse und die weltweiten Kosten der Spekulation ist ein Charakteristikum für die währungspolitischen Thesen des radikalen Neoliberalismus. Wir werden uns nachfolgend auf den Monetarismus beschränken, der - wiewohl wirtschaftspolitisch meist der neoliberalen Schule zuzurechen - in Währungsfragen eine andere Position vertritt. Vorgreifend wollen wir kurz die gegensätzlichen Hauptpositionen der Geldpolitik zusammenfassen: Der Monetarismus nimmt wirtschaftspolitisch eine Zwischenstellung ein. Während Keynes den »fiskalischen Mißbrauch« ausdrücklich nicht nur erkannte, sondern auch befürwortete, lehnen liberale Autoren jede Wirtschaftspolitik zur Lenkung der Wirtschaft ab, während die Monetaristen nur die Fiskalpolitik ablehnen. Die Fiskalpolitik hat im Monetarismus keine steuernde Aufgabe; Ziel ist nur die Steuerung der Geldmenge, um die Stabilität der Währung zu sichern. Während der Keynesianismus das Beschäftigungsziel als das primäre Ziel der Wirtschaftspolitik ansieht, ist für den Monetarismus die Stabilität des Preisniveaus das primäre Ziel. An die Stelle diskretionärer Eingriffe (d. h. Eingriffe in Abhängigkeit von der Beschäftigungssituation) tritt beim Monetarismus die Formulierung von festen Regeln (wir werden sie gleich kennenlernen), denen sich die Zentralbanken in ihrer Geldmengensteuerung unterwerfen sollen (»Regelbindung«). Gemeinsam ist dem Keynesianismus und dem Monetarismus die Auffassung, daß die Währung ein »Geschöpf der Rechtsordnung« sei und deshalb der staatlichen Steuerung bedürfe. (Bezüglich der Geldfunktionen allerdings bestehen unterschiedliche Auffassungen.) Darin ist auch die These enthalten, daß der Staat bzw. die Zentralbanken fähig sind, die Geldmenge zu steuern. Dies wird von den liberalen Autoren bestritten. Sie sehen bereits in der Zentralisierung des Geldwesens einen Eingriff in die Stabilität des privaten Sektors und eine Störung der Wirtschaftsprozesse. Sie lehnen deshalb sowohl die Geld- wie die Fiskalpolitik ab und kritisieren auch den Monetarismus.5 Praktisch durchgesetzt hat sich im 20. Jahrhundert (die Geldsysteme des 19. Jahrhunderts entsprachen vielfach dem Ideal konkurrierender Banknoten6 und 5 »Worin ich mich von der Mehrheit der heutigen ›Monetaristen‹ und insbesondere von dem führenden Vertreter dieser Schule, Professor Milton Friedman, unterscheide, ist, daß ich die naive Quantitätstheorie des Geldes, selbst in Situationen, in denen in einem bestimmten Territorium nur eine Art von Geld in Gebrauch ist, für nicht mehr als ein nützliche, grobe Annäherung an eine wirklich ausreichende Erklärung halte, die jedoch völlig unbrauchbar wird, wenn mehrere konkurrierende Geldarten in demselben Territorium gleichzeitig in Gebrauch sind.« Für Hayek gibt es nicht »so etwas wie die Geldmenge«; Hayek, Entnationalisierung a.a.O., S. 70f. 6 »Banknoten« sind Geldscheine, die jede Bank ausstellen kann als »Zertifikat« für bestimmte Einlagen, die bei dieser Bank getätigt wurden (z. B. in Gold). Erst mit der Gründung von Zentralbanken wurde den Geschäftsbanken dieses Recht entzogen; heute liegt das Monopol der Ausgabe von Banknoten ausschließlich bei der Zentralbank. 122 IV Monetarismus einem dezentralisierten Geldsystem) zunächst der Monetarismus (20er Jahre), er wurde nach der Weltwirtschaftskrise 1929 und in der Großen Depression der 30er Jahre vom Keynesianismus verdrängt, um nach dem Zusammenbruch des Weltwährungssystems 1973 in einer neuen Form wieder an die Stelle des Keynesianismus zu treten. In der Gegenwart ist wieder ein neues Interesse am Keynesianismus erkennbar, dessen Erklärungsmuster vor allem für die Asien-Krise und die Bedeutung der Spekulation größere Realitätsnähe zu besitzen scheinen. Halten wir fest: Es lassen sich in der Geldpolitik drei Positionen unterscheiden: & & & Der reine Liberalismus (L. von Mises, F. A. von Hayek) lehnt jede Form der Geldpolitik ab, bis hin zu der Forderung, eine nationale Einheitswährung durch den Wettbewerb von Banknoten zu ersetzen. Voraussetzung des Liberalismus ist das »klassische Dogma«, daß Marktprozesse das beste Ergebnis erbringen, während staatliche Eingriffe zur Manipulation von Marktprozessen eine Verschlechterung bedeuten. Der Keynesianismus als strikte Gegenposition behauptet eine prinzipielle Instabilität des privaten Sektors und eine stete Tendenz zur Arbeitslosigkeit. Er erkennt, daß Geld- und Fiskalpolitik vielfach wechselseitig abhängig sind und befürwortet, daß beide Formen der Wirtschaftspolitik zur Lenkung der Wirtschaft eingesetzt werden sollen. Das primäre Ziel des Keynesianismus ist das Beschäftigungsziel. Spekulative Prozesse gelten als Störung des Wirtschaftsablaufs. Der Monetarismus lehnt die Fiskalpolitik zur Konjunktursteuerung ab, befürwortet aber eine strikte Geldpolitik. Voraussetzung des Monetarismus ist die klassische These, daß der private Sektor stabil ist und eine Instrumentalisierung der Währungspolitik für fiskalpolitische Zwecke zu einer Störung des Wirtschaftsprozesses führt. Das primäre Ziel des Monetarismus ist die Stabilität des Preisniveaus. Die Spekulation wird insgesamt positiv beurteilt. 1.2 GRUNDLAGEN UND VORAUSSETZUNGEN DES MONETARISMUS it der Herausbildung der modernen Nationalstaaten im 19. Jahrhundert wurde das System konkurrierender Währungen innerhalb einer Nation schrittweise beseitigt durch eine Zentralisierung des Banksystems mit einer Einheitswährung. »Unter den großen Staaten haben die Vereinigten Staaten am längsten gebraucht, um ihr Banknotenwesen zu zentralisieFederal Reserve Board, Washington ren«.7 1913 erhielten schließlich auch die Vereinigten Staaten durch den Federal Reserve Act eine Zentralbank. Damit war in den wichtigsten Staaten Geld und Geldwert zu einem wirtschaftspolitischen Ziel geworden. M 7 K. E. Born, Geld und Banken im 19. und 20 Jahrhundert, Stuttgart 1977, S. 39. IV Monetarismus 123 1.2.1 Goldstandard und klassische Quantitätstheorie ie Geldmenge - die Banknoten - wurde der Kontrolle der Märkte durch staatliches Papiergeld entzogen. Das Gold verlor seine Funktion als Wertmaßstab, wie dies zur Zeit des Goldstandards der Fall war. Gold ist eine Ware, deren Produktion und Knappheit wie die jeder anderen Ware von vielen Bedingungen abhängig ist. Die Funktion des Goldes als Geld kommt zu den anderen Funktion des Goldes als Ware hinzu (industrielle Anwendung, Schmuck etc.). Geld- und Güterfunktion waren beim Gold eng verknüpft. Ist Gold der numéraire aller anderen Waren, so werden die relativen Preise in Gold sinken oder steigen, wenn Gold reichlich oder weniger reichlich verfügbar ist. Fließt z. B. einem Land Gold zu, so werden die Güterpreise in Gold steigen, weil Gold weniger knapp wird. Fließt Gold ab oder wird es vermehrt für andere als Tauschzwecke verwendet, so sinken die Güterpreise. Aus dieser Beobachtung hat bereits im 18. Jahrhundert der schottische Philosoph David Hume eine einfache Quantitätstheorie des Geldes entwickelt. Seine Theorie war für den Goldund Silberstandard formuliert (er spricht von »gelben und weißen Stücken« = Münzen). Hume hat auch darauf hingewiesen - und damit in gewisser Weise auch hier die neue Quantitätstheorie vorweggenommen -, daß dieser Prozeß der Preisanpassung nicht reibungslos vonstatten geht. Der notwendige Anpassungsprozeß der Preise, so David Hume, benötigt Zeit. Darüber hinaus hat Hume - anders als der neue Monetarismus - daran den Gedanken geknüpft, daß eine Ausweitung der Geldmenge der allgemeinen Wirtschaftstätigkeit förderlich ist, während eine Einschränkung sie hemmt (vgl. Kapitel 1.2.2, Teil IV). D David Hume über Geldmenge und Preise: „Eine größere Menge an Hartgeld im Königreich (...) erhöht den Preis von Waren und zwingt damit jeden, eine größere Anzahl von diesen kleinen gelben oder weißen Stücken für alles zu bezahlen, was er kauft. (...) Aus der Gesamtheit dieser Argumentation können wir schließen, daß es in Hinsicht auf das innere Glück eines Staates völlig belanglos ist, ob die Geldmenge größer oder kleiner ist.“ Es gibt aber vorübergehend reale Wirkungen, „wenn wir bedenken, daß Veränderungen in der Geldmenge zur einen oder anderen Seite nicht unmittelbar von Veränderungen in den Preisen für Waren begleitet werden. Es vergeht immer etwas Zeit, bevor die Dinge sich der neuen Situation angepaßt haben. Dieses Intervall ist für den Fleiß ebenso schädlich, wenn Gold und Silber abnehmen, wie er nützlich ist, wenn diese Metalle zunehmen.“8 Die Schaffung des Federal Reserve Systems in den USA stellt den letzten Markstein der Entwicklung zu einer vom Gold unabhängigen, staatlicher Kontrolle unterworfenen nationalen Währung dar. Bis zur Weltwirtschaftskrise 1929 spielte allerdings das Gold noch beim internationalen Warenverkehr die Rolle eines universellen Wertmaßes (»Goldstandard«). Während liberale Theoretiker dies als Anfang einer Verstaatlichung der Wirtschaft betrachteten, sahen die meisten Ökonomen darin eine Möglichkeit, durch eine Steuerung der Geldmenge Einfluß auf den Wirtschaftsprozeß zu nehmen. Vor allem Irving Fisher hat für das neue Geld- 8 D. Hume, Politische und ökonomische Essays, Teilband 2, Hamburg 1988, S. 209-211. David Hume 1711-1776 124 IV Monetarismus system eine Theorie des Geldwerts und des Preisindex geschaffen, das dieser Situation entsprach. Seine Quantitätstheorie des Geldes, ausgedrückt in der Verkehrsgleichung M V = P Y, die wir bereits kennengelernt haben, begann sich in den Zwanziger Jahren durchzusetzen. Diese ursprüngliche Form des Monetarismus ging - mehr oder minder stillschweigend - davon aus, daß sich durch das (in den USA) neue Instrument der Zentralbankpolitik die wirtschaftliche Entwicklung geldpolitisch steuern lassen könne. In der Zinstheorie, die eng mit der Geldtheorie verknüpft ist, folgte Fisher der europäischen Tradition, wie sie vor allem von der österreichischen Schule der Kapitaltheorie vertreten wurde. Ehe wir uns den Prinzipien des Monetarismus zuwenden, müssen wir deshalb noch einmal einen vertieften Blick auf die vorkeynesianische Zinstheorie werfen (vgl. auch Kapitel 3.1, Teil III). 1.2.2 Der Zusammenhang zwischen Nominal- und Realzinssatz nut Wicksell, ein schwedischer Nationalökonomen und Vertreter der österreichischen Schule der Geld- und Zinstheorie, ging von zwei unterschiedlichen Größen aus. Er unterschied zwischen nominalen und reale Zinsen. Weicht der reale vom nominalen Zinssatz ab, so ist dies geldpolitisch unerwünscht. Da die Zentralbank durch geldpolitische Maßnahmen den Nominalzins steuern kann, kann sie dadurch zugleich Einfluß auf die Preisentwicklung nehmen. Daraus leitete man eine gesamtwirtschaftliche Verantwortung der Geldpolitik ab. Der reale Zinssatz r, der heute meist »natürlicher Zinssatz« genannt wird, ist nach der Auffassung von Knut Wicksell - Irving Fisher und die neueren Monetaristen folgen dieser Auffassung - durch reale Daten der Wirtschaft (die Zeitpräferenzrate und die Produktivität der Investitionen) gegeben, kann also nicht geldpolitisch verändert werden.9 Wicksell hatte an den Unterschied zwischen Nominal- und Realzins eine monetäre Konjunkturtheorie geknüpft.10 Sinkt nach seiner Auffassung der Geldzinssatz unter den Realzinssatz, so veranlaßt dies neue Investitionen. Da aber Vollbeschäftigung unterstellt ist, führt diese zusätzliche Nachfrage nach Maschinen zu Preisänderungen und Fehlallokationen. Bei einem sinkenden Zinssatz, so Wicksell, werden die Konsumenten weniger sparen und mehr konsumieren; ferner werden die Investoren mehr Güter nachfragen. Die Folge ist ein Preisanstieg. Dieser Preisanstieg würde aber die Nachfrage nach Geld erhöhen, damit die zusätzlichen Geldmittel, die zur Senkung des J. G. Knut Wicksell 1851-1926 Zinssatzes notwendig waren, kompensieren. In der Folge würde also der Nominalzins wieder auf das alte Niveau steigen. Wollten die Zentralbanken den Nominalzins dauerhaft durch eine Ausweitung der Geldmenge unter den Realzinssatz drücken, so wäre die Folge eine weitere, wiederholte Ausweitung der Geldmenge, also eine Inflation. Dieses Ergebnis von Wicksell steht auf den ersten Blick zu empirischen Beobachtungen in Widerspruch, wonach langfristig steigende Preise auch zu höheren Nominalzinssätzen führen. Irving Fisher definierte den langfristigen Realzinssatz r als Nominalzins i abzüglich K 9 In seinem frühen Werk »Geldzins und Güterpreise« spricht Wicksell von »natürlichem Kapitalzins«. »Die Höhe dieses Zinses würde zunächst durch ›Angebot und Nachfrage‹ nach Kapital bestimmt werden.« K. Wicksell, Geldzins und Güterpreise, Jena 1898, S. 95. Vgl. dazu die Kritik von Keynes Kapitel 3.1, Teil III. 10 Vgl. K. Wicksell, Vorlesungen über Nationalökonomie, Band 2, Jena 1922, S. 224-226. IV Monetarismus 125 der Inflationsrate : r = i - . Kurzfristig führt eine Zinssenkung zu vermehrter Wirtschaftsaktivität. Bei Vollbeschäftigung bedeutet dies aber einen Anstieg der Inflationsrate. Als langfristige Wirkung dieses Anstiegs wird dann diese Inflationsrate bei allen nominalen Werten einberechnet und führt auch zu höheren Nominalzinssätzen, so Irving Fisher. Irving Fisher über Zins- und Preisentwicklung: „Within limits, a fall in the rate of interest may and often does produce a rise in prices and in business activity almost immediately. This effect may be continued for many month until increased prices again become dominant and pull the interest rate up again. In so far as the rate of interest is cause and the price movements are effect, the correspondence is just the opposite of that which occurs in so far as the price movements are cause and the interest movements effect.“11 Allerdings bleiben Unstimmigkeiten zwischen der empirischen Beobachtung einer positiven Korrelation und der Annahme, sinkende Zinssätze würden (kurzfristig) zu einem Preisanstieg führen, die auch bis heute nicht befriedigend gelöst wurden. Der Hauptgrund liegt darin, daß die Wirkung sinkender Zinssätze keineswegs immer und notwendig zu steigenden Preisen führen muß. Bei Unterbeschäftigung, wie Keynes sie voraussetzte, ist das offenkundig. Keynes war deshalb bezüglich einer Unterscheidung zwischen Nominal- und Realzinssatz sehr skeptisch, auch aufgrund der Tatsache, daß der Preisindex zur Ermittlung des Realzinssatzes unklar definiert ist (welcher Index käme in Frage: der Preisindex der Lebenshaltung? der Kapitalgüter? oder des BIP?) 1.2.3 Geld und Wirtschaftswachstum s läßt sich aber noch ein weitaus wichtigerer Einwand vorbringen, und dieser Einwand hat eine lange Tradition; er geht auf David Hume zurück. Hume sagt über eine Ausweitung der Geldmenge: »Entsprechend stellen wir fest, daß in jedem Königreich, in das mehr Geld fließt als zuvor, alles ein neues Gesicht bekommt, Arbeit und Gewerbe sich beleben, Kaufleute unternehmungslustiger, Manufakturisten fleißiger und geschickter werden und sogar der Farmer seinem Pflug mit mehr Eifer und Aufmerksamkeit folgt.«12 Hume spricht - in der Sprache seiner Zeit - von einer Wirkung der rein nominalen Geldmengenausweitung auf den Innovationsprozeß. Es wird viel zu wenig beachtet, daß sinkende Zinssätze auch Investitionen stimulieren, die jeweils technischen Fortschritt ermöglichen oder »verkörpern«. Steigt aber die gesamtwirtschaftliche Produktivität als Folge der Investitionen, dann steigt auch das Angebotsvolumen es besteht damit kein Grund für einen Preisanstieg. Dieser Zusammenhang wird von der traditionellen Theorie (Monetarismus und Keynesianismus) nicht gesehen. Neben Josef A. Schumpeter, der eine vergleichbare Wirkung des Kredits postulierte, findet sich in der Literatur dieser Gedanke sehr klar bei dem deutschen Nationalökonomen L. Albert Hahn formuliert. Er nennt diesen Effekt »Mengenkonjunktur« und schreibt: »Eine Mengenkonjunk- E 11 12 I. Fisher, The Theory of Interest, New York 1930, S. 444. D. Hume, Politische und ökonomische Essays a.a.O., S. 209. 126 IV Monetarismus tur wird dadurch ermöglicht, daß während der Kreditinflation eine preissenkend wirkende Veränderung der Technik eintritt, die die preissteigernde Tendenz der Kreditinflation kompensiert.«13 Während nach Fisher und Wicksell eine Ausweitung des Kreditvolumens durch Zinssenkungen immer inflationär wirkt, trifft dies in der Keynesschen Theorie nur bei Vollbeschäftigung zu. Die dritte Möglichkeit wird von beiden Schulen übersehen.14 Hahn formuliert folgende Regel für die Geldpolitik: L. Albert Hahn zur Geldpolitik (1930): „So lange technischer Fortschritt eine Produktionskostenverbilligung ermöglicht, kann und wird der Volkswirtschaft inflatorischer Kredit, der nicht preissteigernd wirkt, zugeführt werden. Tritt eine Pause im technischen Fortschritt ein, so erfolgt keine Vermehrung inflatorischen Kredites“.15 Diese bereits aus dem Jahre 1930 stammende Einsicht wurde bislang in der internationalen Literatur zur Geldpolitik fast vollständig ignoriert, obgleich die Schumpetersche Kredittheorie ganz ähnliche Schlußfolgerungen nahelegt, gleichwohl aber kaum rezipiert wird. Die Schlußfolgerungen sind aber gravierend. Unabhängig von der Frage der Beschäftigungssituation kann ein hoher Zinssatz Innovationen verhindern und damit zur säkularen Stagnation oder zur Verlangsamung des Wirtschaftswachstums beitragen. Dasselbe gilt bezüglich einer moderaten Inflationsrate: Sehr niedrige Inflationsraten oder sogar eine Deflation begünstigen Geldhorte, reine Finanzanlagen bzw. spekulative Prozesse, nicht aber Investitionen in Realkapital oder Innovationen. (Die Aktienkurse reagieren in aller Regel auf steigende Inflationsraten negativ.) Dies ist im Rahmen der monetaristischen Theorie nicht zu erfassen. Keynes hat sich daSilvio Gesell 1862-1930 gegen positiv auf die Arbeiten von Silvio Gesell bezogen hat16, der eine permanente Entwertung des Geldes vorschlug, um Geldhorte zu vermeiden und die Wirtschaft zu stimulieren.17 Auch Irving Fisher hat sich in der Großen Depression der 30er Jahre der Auffassung von Silvio Gesell angeschlossen und selbst eine Art selbstentwertendes Geld (stamp script) vorgeschlagen.18 Derartige Vorschläge blieben auf die praktische Geldpolitik jedoch durch die eine verkürzte Rezeption der Keynesschen Theorie ohne Einfluß und spielen in der Gegenwart kaum mehr eine Rolle - zu unrecht, wie der Verfasser dieser Zeilen glaubt. 13 L. A. Hahn, Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits, Tübingen 19303, S. 148. Keynes hat allerdings immerhin die Möglichkeit eingeräumt, beschränkte sich aber - was in der Depression der 30er Jahre verständlich ist - vorwiegend auf eine kurzfristige Lösung des Beschäftigungsproblems. Vgl. zu dieser Frage näher: K.-H. Brodbeck, Erfolgsfaktor Kreativität, Darmstadt 1996, Kapitel 17; ders., Kreativität und Unsicherheit. Zur Synthese der Theorien von Schumpeter und Keynes, praxis-perspektiven 1 (1996), S. 107-112. 15 Hahn, a.a.O., S. 150. 16 J. M. Keynes, General Theory a.a.O., S. 353-358. 17 S. Gesell, Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld, Hochheim 1931 (7. Auflage). 18 I. Fisher, Stamp Scrip, New York 1933. 14 IV Monetarismus 127 James Tobin hat ein Wachstums-Modell entwickelt hat, aus dem sich ein positiver Einfluß der Geldmenge auf die Kapitalakkumulation ergibt.19 Tobins Gedanke ist folgender: Ersparnisse können entweder zum Aufbau von Realkasse in Geld oder für Realinvestitionen verwendet werden. Die Zusammensetzung des Portefeuilles aus Geld und Realkapital ist aber abhängig von der Inflationsrate. Bei niedrigen Inflationsraten oder bei Deflation wird die Geldhaltung starkt präferiert und senkt damit die realen Investitionen. Einige Autoren - wie H. G. Johnson, D. Levhari und D. Patinkin - versuchten, Geld als Argument in die makroökonomische Produktionsfunktion zu implementieren oder veränderte Nachfragefunktionen zu konstruieren und daraus einen positiven Effekt der Geldverwendung auf das Wachstum abzuleiten. Der Hauptgedanke hierbei war, daß Geld die Transaktionskosten des Tauschs senkt und insofern gesamtwirtschaftlich produktiv ist. Diese Versuche, den empirischen Hinweis auf eine positive Wirkung moderater Inflationsraten, theoretisch zu begründen, konnten allerdings wenig Einfluß gewinnen und beruhen theoretisch auf sehr einseitigen neoklassischen Voraussetzungen. Vor allem wird die Innovation als zentraler Wachstumsfaktor ausgeklammert. Wir kehren zu dieser Frage im Teil V im Rahmen der Wachstumspolitik zurück. 1.2.4 Die Entwicklung des modernen Monetarismus ür die praktische Geldpolitik erwies sich die Wicksellsche Theorie schon deshalb als unbrauchbar, weil der »natürliche« Zinssatz r unbekannt ist und deshalb nicht als Determinante der Geldpolitik dienen kann - sieht man von der Keynesschen Kritik an der Vollbeschäftigungsannahme ab. Irving Fisher schlug wohl nicht zuletzt deshalb eine Steuerung der Geldmenge vor. Er knüpfte an die Quantitätstheorie an, die ohne das Bindeglied »Zins« einen direkten Zusammenhang zwischen Geldmenge und Zinssatz herstellt. Der Monetarismus der 20er Jahre, der an Fisher anknüpfte, glaubte aber wie Wicksell, daß durch eine Steuerung der Geldmenge auch die Konjunktur gelenkt werden könnte. Die (vor allem in den USA) genährten Hoffnungen zur Steuerung der Wirtschaft durch geldpolitische Maßnahmen wurden auch von Politikern geteilt. Sie wurden gründlich zerstört, als in der großen Weltwirtschaftskrise das gesamte Banksystem in der Folge des Crashs von 1929 erschüttert wurde. Milton Friedman drückt diese Situation so aus: »Es vollzog sich ein Meinungsumschwung in das andere Extrem: Man könne die Geldpolitik mit einem Gängelband vergleichen. Man könne daran ziehen, um die Inflation zu bremsen, aber man könne keinen Druck ausüben, um die Rezession zum Stillstand zu bringen. Man könne zwar ein Pferd zum Wasser führen, aber man könne es nicht zum Trinken zwingen. Eine solche aphoristische Theorie wurde bald durch Keynes´ rigorose und differenzierte Analyse ersetzt.«20 Die Erfahrung der Geldpolitik war, daß man zwar im Falle einer Inflation durch geldpolitische Maßnahmen durch Einschränkung der Geldmenge die Preissteigerungen reduzieren konnte (»Ziehen an der Schnur«), nicht aber bei einer Deflation (negatives ) die Wirtschaft so ankurbeln kann, daß die Deflation gestoppt wird (»Anschieben mittels einer Schnur«) F 19 J. Tobin, Money and Economic Growth, Econometrica 33 (1965), S. 671-684. M. Friedman, Die Rolle der Geldpolitik, in: Brunner/Monissen/Neumann (Hrsg.), Geldtheorie, Köln 1974, S. 314 (Original: »The Role of Monetary Policy, American Economic Review 58 (1968), S. 1-17). 20 128 IV Monetarismus Das Bild von den Pferden, die man zur Tränke führen, sie aber nicht »zum Saufen« (Karl Schiller) zwingen könne, war auch noch in der Wirtschaftspolitik der 60er Jahre gegenwärtig. Keynes, wie wir gesehen haben, bot dafür eine Erklärung an: Die Theorie der »Liquiditätsfalle«. Bei niedrigen Zinssätzen führt eine Ausweitung der Geldmenge (des Geldangebots) zu keiner weiteren Zinssenkung, so daß kein realer Effekt auf die Wirtschaft ausgeht. Ferner kann bei einer Geldmengenexpansion auch Geld in die Spekulationskasse fließen und somit einen realen Effekt verhindern. Die Geldpolitik wird wirkungslos. Eben aus diesem Grund hatte Keynes die Fiskalpolitik als ergänzendes Instrument befürwortet. Im Keynesianismus verschob sich das wirtschaftspolitische Leitziel auf die Beschäftigung. Der frühe Monetarismus scheiterte an der Unmöglichkeit, bei einer Deflation durch geldpolitische Maßnahmen die Nachfrage nach Geld (vor allem nach Krediten für Investitionszwecke) anzuregen. Der Keynesianismus neigte allerdings dazu, auf dem »anderen Auge« - der Preisstabilität - blind zu bleiben. Die moderaten Inflationsraten der 60er Milton Friedman Jahre machten die Betonung dieses Punktes auch politisch nicht erforder*1912 lich. Im Instrument der Phillips-Kurve sahen viele Keynesianer die Möglichkeit, das wirtschaftspolitische Instrumentarium um eine »Speisekarte« von Wahlmöglichkeiten zwischen Inflationsrate und Arbeitslosigkeit zu bereichern und somit eine vollständige Konzeption der Geld- und Fiskalpolitik zu formulieren. Es standen nun zwei wirtschaftspolitische Instrumente zur Verfügung, die es erlauben sollten, die beiden Ziele »Preisstabilität« und »Beschäftigung« zu steuern. Da allerdings beide Ziele in einem Zielkonflikt stehen die Phillips-Kurve ist negativ geneigt -, wird der Handlungsspielraum wirtschaftspolitischer Entscheidungen auf eine Bewegung entlang der Phillips-Kurve beschränkt. Dieses scheinbar vollständige Bild einer einheitlichen wirtschaftspolitischen Konzeption der Geld- und Fiskalpolitik zur Steuerung von Preisniveau und Beschäftigung im Rahmen der durch die Phillips-Kurve gesteckten Möglichkeiten wurde, wie schon ausgeführt, durch den Ölpreisschock und die »Stagflation« grundlegend erschüttert. Es zeigte sich, daß das Bindeglied zwischen Beschäftigung und Preisniveau sich als Illusion erwiesen hat. Eine langfristig stabile Phillips-Kurve als Grundlage der Wirtschaftspolitik existiert nicht. Der einsetzende Inflationsprozeß der 70er Jahre mit zum Teil zweistelligen Inflationsraten in den wichtigsten Industriestaaten rückte das Ziel der Preisniveaustabilität unabdrängbar in den Vordergrund. Der gleichzeitig einsetzende Anstieg der Arbeitslosigkeit wurde dagegen als Ziel zweiten Ranges eingestuft. Politisch war dieser Übergang doppelt erkennbar: Einmal übernahmen die Zentralbanken nun fast durchweg monetaristische Positionen (denen wir uns gleich näher zuwenden werden), zum anderen wurden in wichtigen Ländern (USA, England, Deutschland, Frankreich) konservative Regierungen gewählt (»Wende«), die staatliche Aktivitäten zurück- IV Monetarismus 129 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 1967 1965 1963 1961 drängen und den Einfluß der Gewerkschaften auf die Lohnbildung einschränken oder sogar wie im Vereinigten Königreich und den USA - weitgehend beseitigen wollten. Ein wesentlicher Grund für die politische Wende waren die in der Folge einer exzessiven Anwendung »keynesianischer« Fiskalpolitik angestiegenen Staatsschulden. (Wir haben auf die Probleme der Staatsverschuldung bereits hingewiesen.) Steigende Staatsverschuldung bei hohen Nominalzinssätzen bedeutete einen wachsenInflationsraten w ichtiger Industrieländer den Zinsdienst der Staats30% haushalte und damit viel25% fältige Budget-Probleme. Da man diesen Anstieg 20% der Staatsverschuldung als ein Resultat des Keynesia15% nismus ansah, begünstigte 10% auch dies die Wende zur monetaristischen Position, 5% die eine Fiskalpolitik zum 0% Zwecke der Konjunktursteuerung gänzlich ablehnt. Es waren also die BRD (w est) Japan USA F GB wirtschaftlichen Verhältnisse, die eine Abkehr von Ölpreisschock in der 70er Jahren (Quelle: OECD) der Konjunktursteuerung durch fiskalpolitische Maßnahmen bei steigender Staatsverschuldung praktisch erzwangen und aufgrund der hohen Inflationsraten einen Übergang zur Steuerung der Geldmenge mit dem ausschließlichen Ziel der Preisstabilität begünstigten. Die ökonomische Theorie und das wirtschaftspolitische Konzept für diese alternative Politik lieferte der neue Monetarismus, wie er ganz besonders von Milton Friedman formuliert wurde. 130 IV Monetarismus 2 BAUSTEINE MONETARISTISCHER WIRTSCHAFTSPOLITIK Geben wir zunächst einen Überblick über die wichtigsten Bausteine und Thesen der monetaristischen Wirtschaftstheorie und -politik: Kernaussagen des monetaristischen Modells (1) Durch den Arbeitsmarkt sind die Beschäftigung, das Sozialprodukt und der Reallohn determiniert und damit die »natürliche Arbeitslosigkeit«. Durch Spar- und Investitionsentscheidungen sind der »natürliche Zinssatz«, die Investition und die Ersparnis jeweils real bestimmt. (2) Die Quantitätsgleichung bestimmt das Preisniveau der Güter. Mikroökonomisch wird die Wirtschaft durch das Walrassche Totalmodell beschrieben. (3) Die Höhe des Einkommens wird kurzfristig auf dem Arbeitsmarkt bei gegebenem Kapitalbestand und langfristig durch die Investitionen, d. h. durch die Ersparnis und Kapitalakkumulation bestimmt. Es gilt das Saysche Gesetz: Das Angebot bestimmt die Nachfrage. (4) Der Konsum wird in jeder Periode mit C = Y - S durch die Ersparnis, damit durch den Zinssatz und die »Zeitpräferenz« determiniert. Y ist angebotseitig gegeben (Vollbeschäftigung aller Produktionsfaktoren). (5) Wirtschaftspolitische Eingriffe beschränken sich auf die Geldpolitik. Die Währungsbehörde soll eine stetige und regelgebundene Kontrolle der Geldmenge vornehmen. Die Fiskalpolitik soll sich diskretionärer Eingriffe enthalten und gleichfalls ihre Ausgaben verstetigen. 2.1 DIE KRITIK DES KONZEPTS DER PHILLIPS-KURVE in wichtiger Faktor für den theoretischen Erfolg des Monetarismus war der Vorschlag von Milton Friedman zur Erklärung für das Scheitern der Phillips-Kurven-Konzeption. Betrachten wir hier nochmals das von Samuelson und Solow entwickelte modifizierte Diagramm der Phillips-Kurve. Friedman knüpfte - wie bereits bemerkt - an die Vor stellungen von Böhm-Bawerk und Wicksell an, daß es so etwas wie einen natürlichen Zinssatz gebe. Er erweiterte diesen Gedanken um die Vorstellung, daß auch auf dem Arbeitsmarkt eine natürliche Arbeitslosenrate existiert. Diese natürliche Arbeitslosigkeit 0 u identifiziert Friedman mit dem Wert u* in u* der modifizierten Phillips-Kurve. Es ist jene Rate, bei der Preisstabilität herrscht. - Friedman unterstellt nicht, daß die natürliche Arbeitslosigkeit konstant ist, sie ist Modifizierte Phillips-Kurve aber - seiner Vorstellung nach - unabhängig von der Wirtschaftspolitik und im langfristigen Trend durch die Märkte selbst determiniert. Friedman kehrt damit zur Grundlegung seiner wirtschaftspolitischen Konzeption zur neoklassischen Theorie zurück - modifiziert um E IV Monetarismus 131 einige neue Theoriebausteine wie Informationskosten oder Entscheidungen unter Unsicherheit. Im Kern ist das zugleich die Rückkehr zu der klassischen Vorstellung, daß die Märkte eine natürliche Ordnung besitzen. Man kennt diesen Gedanken auch als »These von der Stabilität des privaten Sektors«. Es gibt, mit einem Wort, für den Monetarismus überhaupt keine keynesianische Arbeitslosigkeit, keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit wie im Keynesschen Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung. Milton Friedman über »natürliche Arbeitslosigkeit« (I): Wir haben Wicksells Überlegungen nur um einen Kniff erweitert - nämlich um die von Irving Fisher stammende Unterscheidung zwischen Nominal- und Realzins. (...) Diese Analyse findet ihr unmittelbares Gegenstück auf dem Arbeitsmarkt. In jedem Augenblick gibt es ein gewisses Unterbeschäftigungsniveau, das die Eigenschaft besitzt, mit dem Gleichgewicht in der Struktur der Reallohnsätze konsistent zu sein. Bei diesem Unterbeschäftigungsniveau tendieren die Lohnsätze im Durchschnitt dazu, mit einer »normalen« säkularen Rate zu wachsen, d. h. mit einer Wachstumsrate, die unbegrenzt aufrechterhalten werden kann, solange Kapitalbildung, technischer Fortschritt etc. ihre langfristigen Trends beibehalten. (...) Das »natürliche Unterbeschäftigungsniveau« ist mit anderen Worten jenes, das sich aus dem Walrasianischen Gleichgewichtssystem ergeben würde, vorausgesetzt, die aktuellen Strukturcharakteristika der Arbeits- und Gütermärkte sind eingebaut, und zwar einschließlich Marktunvollkommenheiten, Zufallsvariabilität von Angebot und Nachfrage, Kosten der Informationsbeschaffung über freie Stellen und Arbeitsreserven, Mobilitätskosten.21 Wenn nun u* die durch wirtschaftspolitische Maßnahmen langfristig nicht beeinflußbare natürliche Arbeitslosenrate ist, dann kann eine Politik des leichten Geldes zwar kurzfristig die Arbeitslosigkeit unter das Niveau von u* senken, langfristig führt aber die Inflationspolitik zu einer Veränderung der Erwartungen bezüglich der Inflationsrate. Friedman interpretiert also in nebenstender Abbildung den Wert als Erwartungsgröße. Die Wirt schaftssubjekte erwarten eine bestimmte Preissteigerungsrate. Wird nun bei gegebenen Erwartungen durch eine nominelle Steigerung der Löhne die Arbeitslosenrate u unter den Wert u* gedrückt (u´ < u*), so Verschiebung der Phillips-Kurve hat dies kurzfristig einen Effekt, weil die Wirtschaftssubjekte noch von einer unveränderten Inflationsrate ausgehen. Nach einiger Zeit lernen sie aber, daß die tatsächliche Inflationsrate höher ist. Durch diesen »Lernprozeß« (= adaptive Erwar- 21 M. Friedman, Die optimale Geldmenge, Frankfurt/M. 1976, S. 144. 132 IV Monetarismus tungen) verschiebt sich aber mit den Inflationserwartungen auch die gesamte Phillips-Kurve nach oben - solange, bis wieder die natürliche Arbeitslosenrate hergestellt ist. Wir wollen dies etwas genauer betrachten. In der obigen Abbildung haben wir den Fall mit zwei Phillips-Kurven eingezeichnet, der leicht erklärt werden kann: Im Ausgangspunkt wird Preisstabilität auf dem Niveau = 0 erwartet. Nun unterstellen wir steigende Nominallöhne (und in der Folge eine steigende Inflationsrate). Unter dieser Voraussetzung erscheinen Nominallohnänderung als realer Einkommensanstieg; die zusätzliche Nachfrage veranlaßt die Produzenten, mehr Arbeitskräfte einzustellen, die Arbeitslosenrate sinkt von u* auf u´. Doch nach einer gewissen Zeit lernen die Wirtschaftssubjekte, daß es sich hier nur um ein rein nominales Phänomen handelte, das die realen Daten gar nicht verändert hat. Sie lernen mit anderen Worten, daß die Inflationsrate nicht mehr wie bisher = 0, sondern vielmehr = * beträgt. Diese Gewöhnung an die nun positive (oder höhere) Inflationsrate verschiebt die Phillips-Kurve P0 nach oben (P1), und die Arbeitslosigkeit steigt wieder auf ihre natürliche Rate u*. Damit war eine mögliche Erklärung gefunden, weshalb steigende Inflationsraten und eine steigende Arbeitslosigkeit (»Stagflation«) kein Widerspruch sein müssen. Wird die Arbeitslosigkeit um den Preis eines Anstiegs der Inflationsrate gesenkt, so wird die Arbeitslosigkeit dann wieder zunehmen, wenn die Wirtschaftssubjekte »diesen Trick« durchschaut haben und erkennen, daß sich nur die nominalen Größen, nicht aber die realen Größen verändert haben. Das Problem ist nun allerdings, daß die Wirtschaftssubjekte sich an höhere Inflationsraten »gewöhnt« haben. Wenn man die hohen Inflationsraten nun wieder senken will, so tritt der exakt umgekehrte Effekt ein. Senkt man im obigen Beispiel durch geldpolitische Maßnahmen die Inflationsrate wieder von = * auf = 0, so bewegt sich die Wirtschaft kurzfristig wieder entlang der neuen, oberen Phillips-Kurve P1. Die Arbeitslosenrate wird nun über ihren natürlichen Wert steigen (auf u´´) - solange, bis die Wirtschaftssubjekte ihre Inflationserwartungen auf das neue Niveau gesenkt haben und wieder der Wert u* erreicht wird. Daraus leiten monetaristische Autoren die Prognose ab, daß bei einer Senkung der Inflationsraten die Arbeitslosigkeit zunächst immer steigen muß. Langfristig soll aber - bei einem dann erreichten stabilem Preisniveau - die Arbeitslosigkeit wieder auf ihr »natürliches Niveau« sinken wird. Die Phillips-Kurve wird damit als Analyse-Instrument nicht einfach verworfen, sie wird anders interpretiert, und zwar als kurzfristiges Instrument zu Erklärung von Schwankungen der Arbeitslosigkeit um die natürliche Rate u*. Langfristig hängt die Lage der Phillips-Kurve ab von den Inflationserwartungen. 2.2 VERSTETIGUNG: DAS ZIEL DER GELDPOLITIK elche geldpolitischen Folgerungen sind nun daraus zu ziehen? Nach Milton Friedman sind die Versuche, durch die Inkaufnahme von Inflation die Arbeitslosigkeit auf Dauer zu senken, zum Scheitern verurteilt. Sobald die Wirtschaftssubjekte durchschauen, daß sich die Preise nur nominal verändert haben, werden sie ihre Pläne korrigieren und somit das natürliche Beschäftigungs- und das natürliche Zinsniveau wieder herbeiführen. Während des Übergangs, während der Anpassung der Inflationsraten nach oben oder unten entstehen aber gesamtwirtschaftlich erheblich Anpassungskosten (»Kosten der Inflation«, »Kosten der Deflation«). Inflationäre Prozesse belasten die Gläubiger von Krediten und begünstigen die Kreditnehmer, weil die vereinbarte Tilgung der Kreditsumme real bei steigenden Preisen weniger wert ist. Zwar kann eine bekannte Inflationsrate in Kreditver- W IV Monetarismus 133 träge mit aufgenommen werden, wirtschaftspolitische Maßnahmen funktionieren aber nur so sagen die Monetaristen -, wenn die tatsächliche Inflationsrate von der erwarteten abweicht. Bei einer Rückführung der Inflationsrate gilt das umgekehrte Verhältnis, zusätzlich entstehen noch die Kosten einer erhöhten Arbeitslosigkeit über das natürliche Unterbeschäftigungsniveau hinaus. Daraus zieht der Monetarismus die generelle Schlußfolgerung, daß Schwankungen im Preisniveau grundsätzlich zu vermeiden sind. Nun ergibt sich aber eine praktische Schwierigkeit. Die Währungsbehörden müßten ihre Geldpolitik »eigentlich« an der natürlichen Arbeitslosenrate orientieren. Die »natürliche« Rate der Arbeitslosigkeit ist aber nicht nur unbekannt (wie der »natürliche« Zinssatz), sie ist auch nicht konstant, wie Friedman mit großer Klarheit und ausdrücklich betont. Milton Friedman über »natürliche Arbeitslosigkeit« (II): „Was geschieht jedoch, wenn die Währungsbehörde die »natürliche« Rate - des Zinses oder der Unterbeschäftigung - zur Zielgröße wählt? Das Problem liegt zum einen darin, daß sie nicht erkennen kann, welches die »natürliche« Rate ist. Leider haben wir bis jetzt noch kein Verfahren erfunden, um exakt und ohne Komplikationen das natürliche Niveau sowohl des Zinses als auch der Unterbeschäftigung zu schätzen. Zudem wird auch die natürliche Rate selbst von Zeit zu Zeit schwanken. Das Grundproblem besteht allerdings darin, daß selbst wenn der Währungsbehörde die natürliche Rate bekannt wäre und sie die Marktrate auf diesem Niveau zu stabilisieren versuchte, dies nicht auf eine definitive Politik hinausliefe. Die »Markt«-Rate wird von der natürlichen Rate aus allen möglichen - und zwar nicht geldpolitischen - Gründen abweichen.“22 Was sollte die Geldpolitik in diesem Dilemma tun? Friedman schlägt in dieser Situation vor, daß die Währungsbehörden das Geldangebot verstetigen und an bestimmte, jedermann bekannte Regeln - die auch als Ziele veröffentlich werden - binden soll. Insbesondere soll die Geldpolitik sich am Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts orientieren. Diese Forderung ist leicht aus der von Friedman - was hier nicht vertieft werden soll - mit neuer Begründung abgeleiteten Quantitätstheorie des Geldes erkennbar. Gehen wir aus von Fishers Verkehrsgleichung in der Form MV = pY und betrachten Veränderungen (wir leiten diese Gleichung also nach der Zeit ab), so ergibt sich nach kleineren Umformungen für die entsprechenden Wachstumsraten:23 M V p Y . (1) Die Wachstumsrate der Geldmenge plus die Wachstumsrate der Umlaufgeschwindigkeit ist gleich der Wachstumsrate des Preisniveaus plus der Wachstumsrate des realen BIP. Nun war es ein Hauptergebnis der empirischen Untersuchungen von Milton Friedman, daß die 22 M. Friedman, Die optimale Geldmenge, Frankfurt/M. 1976, S. 147. Das totale Differential ergibt: dMV+MdV=dpY+pdY. Dividiert man diese Gleichung durch MV bzw. durch pY (beide Werte sind ja gleich), so erhält man (dM/M)+(dV/V)=(dp/p)+(dY/Y), wenn man die entsprechenden Werte heraus kürzt. Mit der Definition von Wachstumsraten für eine Größe X: X = (dX/X) erhält man das angegebene Ergebnis. 23 134 IV Monetarismus Umlaufgeschwindigkeit des Geldes langfristig leicht sinkt; die Wachstumrate der Umlaufgeschwindigkeit weist einen relativ kleinen negativen Wert auf. Wir können für unsere Betrachtung von einer konstanten Umlaufgeschwindigkeit ausgehen.24 Nun ist p die Inflationsrate . Als Ziel der Geldpolitik wird langfristig ein stabiles Preisniveau gefordert, das heißt = 0. Gehen wir in erster Näherung von einer konstanten Umlaufgeschwindigkeit aus und fügen die Zielsetzung eines konstanten Preisniveaus hinzu, so erhalten wir die auch als »Friedman-Regel« bekannte Leitvorstellung der monetaristischen Geldpolitik: M Y . (2) Friedman schlug eine konstante Expansionsrate der effektiven Geldmenge von etwa 3 bis 5% vor. Als zweite, ergänzende Forderung betont Friedman, daß sich die Währungsbehörde auf Größen beziehen sollte, die sie »in den Griff bekommt, nicht aber von solchen, die sich ihrer Kontrolle entziehen«.25 Dieser Einwand bezieht sich vor allem darauf, die Geldpolitik nicht zur Stabilisierung des Außenwertes einer Währung einzusetzen, wie dies im System fixer Wechselkurse unabdingbar war. Das freie Floaten nach 1973 war nicht zuletzt auch eine Forderung des Monetarismus. Schließlich wird auch gefordert, daß der Staat alle anderen Ausgaben (»Fiskalpolitik«) langfristig plant und sein Ausgabeverhalten verstetigt. Halten wir fest: Die monetaristischen Empfehlungen zur Geldpolitik basieren auf der Annahme, daß es für jede Volkswirtschaft eine »natürliche« Rate der Arbeitslosigkeit und des Realzinssatzes gibt, die zwar schwanken, nicht aber durch wirtschaftspolitische Maßnahmen exogen verändert werden können. Da diese »natürlichen« Raten der Arbeitslosigkeit und des Realzinses sowohl veränderlich wie unbekannt sind, können sie nicht die Basis der Geldpolitik bilden. Daraus ergeben sich für den Monetarismus folgende Ziele der Geldpolitik: & & & & 24 Die geldpolitischen Ziele sollen an feste, jedermann bekannte Regeln gebunden werden. Die wichtigste Regel lautet, daß Expansion der Geldmenge stetig und zwar gleich der langfristigen Wachstumsrate des realen Sozialprodukts erfolgen soll (3 - 5%). Die Geldpolitik soll sich ausschließlich auf das Ziel der Stabilisierung des Binnenpreisniveaus konzentrieren; Währungspolitische Eingriffe werden abgelehnt. Auch die Fiskalpolitik soll verstetigt werden, um einen allgemein stabilen Rahmen für private Entscheidungen zu schaffen. Die Währungsbehörden sollen dem Druck der Öffentlichkeit oder der Regierung, im Falle eines Beschäftigungsrückganges von der Regelbindung abzugehen, nicht nachgeben. Milton Friedman führte zusammen mit Anna J. Schwartz im Rahmen des National Bureau of Economic Research eine empirische Untersuchung durch, in der sie eine langfristige Abnahme der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes beobachteten. Die Rate der Änderung ist jedoch weitgehend konstant, so daß bei einer konstant sinkenden Rate der Umlaufgeschwindigkeit die Expansion der Geldmenge etwas geringer als die reale Wachstumsrate des Sozialprodukts sein müßte. Die Deutsche Bundesbank berücksichtigt dies in ihren Geldmengenberechnungen. 25 M. Friedman, a.a.O., S. 153. IV Monetarismus 135 2.3 STAATSVERSCHULDUNG UND DEFIZIT 2.3.1 Finanzierungsform des Defizits und Inflation ie Klassiker der Ökonomie, die - wie Keynes sagt - stillschweigend von einer vollbeschäftigten Wirtschaft ausgingen, betonten stets, daß die Ausgabe von Staatspapieren keinen unmittelbaren Effekt auf die Wirtschaft haben wird. Es handelt sich formal nur um eine Änderung von Eigentumsrechten, die allerdings - da Staatsausgaben von der Klassik als unproduktiv betrachtet wurden - potentiell eine Einschränkung des Realkapitals zur Folge haben können. Die Monetaristen haben in die Diskussion um die Staatsverschuldung diesen Gedanken wieder aufgegriffen und an eine wichtige Unterscheidung erinnert, auf die wir bereits im Zusammenhang unserer Diskussion der Staatsverschuldung im IS-LM-Modell eingegangen sind. D Jean Baptist Say über die Neutralität der Staatsanleihen: „Allein, wenn, beim Verkaufe der Staatspapiere, das Capital Dessen, welcher verkauft, frei wird, so wird dafür das Capital Dessen, welcher einkauft, gebunden. Es ist dies nichts Anderes als ein Unterschieben vom einen Staatsgläubiger an die Stelle des anderen; und die Wiederholung einer solchen Operation vervielfacht blos die Unkosten, womit jede Einzelne derselben verknüpft ist.“26 Die Politik des deficit spending im Keynesianismus läßt es offen, wie ein Defizit finanziert wird. Die Wirkung auf die Geldmenge wird dabei ausgeklammert. Der Grund liegt darin, daß in der traditionellen keynesianischen Wirtschaftspolitik von einer Politik der Zinsstabilisierung ausgegangen wird, nicht vom Ziel der Geldmengenstabilisierung. Wenn der Zinssatz stabilisiert wird, muß die Geldmenge diesem Ziel angepaßt bzw. eine Anpassung in Kauf genommen werden. Unter dieser Voraussetzung ist es gleichgültig, ob sich der Staat direkt durch Geldschöpfung oder durch Kreditaufnahme finanziert. Eine Geldschöpfung bei konstanten Zinssätzen erhöht die effektive Nachfrage, hat aber keine unmittelbare Wirkung auf dem Geldmarkt. Es gibt, mit anderen Worten, in dieser Situation kein crowding out. Gibt der Staat Bonds aus oder finanziert er das Defizit über den Kreditmarkt, so führt dies zwar ceteris paribus zu steigenden Zinssätzen, die Zentralbank wird jedoch bei einer Stabilisierung des Zinsniveaus die Geldmenge ausweiten. Der Effekt ist derselbe. Wird dagegen, wie der Monetarismus fordert, die Geldmenge als Ziel der Geldpolitik betrachtet, so ergibt sich ein wichtiger Unterschied in der Finanzierung. Betrachten wir die Budgetrestriktion des Staates bei den beiden Finanzierungsformen: (1) eine Erhöhung der Staatsschuld durch die Ausgabe von Staatspapieren, oder (2) durch Geldschöpfung. Die Staatsverschuldung B wird bei einer Ausgabe von Bonds um ûB erhöht, alternativ kann die Geldmenge um ûM/p real ausgeweitet werden zur Finanzierung einer Haushaltslücke. Mit G für die Staatsausgaben und T für das Steueraufkommen ergibt sich bei einem Geldzinssatz von i folgende Budgetgleichung des Staates: 26 J. B. Say, Nationalökonomie, 3. Band, Heidelberg 1833, S. 172. 136 IV Monetarismus ûB ûM p G T iB . (3) In ihrer Nachfragewirkung auf dem Gütermarkt unterscheiden sich die beiden Finanzierungsformen (Bonds versus Geldschöpfung) nicht; der Nettoeffekt auf die effektive Nachfrage hängt ab von G und T. Wenn T Verbrauchssteuern sind, ergibt sich eine Nettonachfrage von G - cT (vgl. Kapitel 2.5.2, Teil III). Damit ist bei gegebener Staatsschuld B und gegebenem Zinssatz i die rechte Seite der Budgetgleichung bestimmt. Die linke Seite dagegen beinhaltet eine Substitutionsmöglichkeit zwischen einer Erhöhung der Staatsverschuldung ûB und der realen Geldschöpfung ûM/p. Die Monetaristen betonen nun, daß die Wirkung dieser beiden Finanzierungsformen völlig unterschiedlich ist. Weshalb? Wenn der Staat Kredit bei der Privatwirtschaft aufnimmt oder Staatspapiere verkauft, findet - wenn wir auf die Geldzahlungen achten - nur ein Wechsel beim Eigentümer des Geldes statt. Wenn ein Haushalt in Form von Bundesschatzbriefen spart, gibt er dem Staat Geld und erhält dafür Rentenpapiere. Dasselbe gilt bei einer Kreditaufnahme beim privaten Bankensystem. Auch hier wird Liquidität aus privaten Händen entzogen und gelangt in die Hände des Staates. Die Summe der Liquidität - des Geldes - bleibt von dieser Transaktion unberührt. Wenn allerdings der Staat Münzen ausgibt (»Seigniorage« = Gewinn aus dem Recht, Münzen prägen und ausgeben zu dürfen) oder die Zentralbank den Bundesbankgewinn bzw. einen Kredit an die Staatskasse transferiert, dann erhöht sich die Geldmenge.27 United States Germany 03 20 01 20 99 19 97 19 95 19 93 19 91 19 89 19 19 19 85 2,0 1,0 0,0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0 -6,0 -7,0 -8,0 87 Defizitquoten in v.H. des nominalen BIP Japan Quelle: OECD; eigene Berechnungen Damit führt nach monetaristischer Auffassung eine Erhöhung der Staatsverschuldung nicht zu Inflation, wohl aber eine Finanzierung über Geldschöpfung. Es gibt, so können wir als These formulieren, keinen Zusammenhang zwischen der Nettoneuverschuldung durch 27 Das gilt auch, wenn Devisen- oder Goldreserven der Bundesbank höher bewertet werden. IV Monetarismus 137 Kreditaufnahme und der Höhe der Inflationsrate, wenn diese Verschuldung überwiegend durch die Ausgabe von Bonds, durch eine Erhöhung der Staatsverschuldung geschieht. Dieser Punkt ist wirtschaftspolitisch vor allem deshalb von Interesse, weil im Zuge der Vorbereitung der europäischen Währungsunion die Einhaltung einer Defizitquote (Nettoneuverschuldung pro Bruttoinlandsprodukt) als Garant für Preisstabilität betrachtet wurde und wird. Es gibt überzeugende empirische Hinweise darauf, dass zwischen Defizitquote und Inflationsrate kein signifikanter Zusammenhang besteht.28 Das ist ein gewichtiges Argument für die Richtigkeit der monetaristischen »FinanzierungsThese«. Es ist erstaunlich, daß die Deutsche Bundesbank trotz ihrer Berufung auf den Monetarismus als theoretischer Leitlinie bezüglich der Maastricht-Kriterien die These unterstützte, die eben von solch einem Zusammenhang ausging. Auch im Keynesschen System wird behauptet, daß von einer Defizitfinanzierung keine inflationäre Wirkung ausgeht. Allerdings hatte Keynes dies im Fall der Unterbeschäftigung auch für reine Geldschöpfung behauptet. Man kann deshalb sagen: Bezüglich der Preiswirkung einer des Haushaltsdefizits durch eine Erhöhung der Staatsverschuldung besteht zwischen Keynesianern und Monetaristen keine Meinungsverschiedenheit, wohl aber bezüglich einer Geldschöpfung. Herrscht »keynesianische Unterbeschäftigung«, so hat Geldschöpfung keine nominale Wirkung auf die Preise. Der Streitpunkt besteht also in der Frage: Gibt es überhaupt so etwas wie »keynesianische Unterbeschäftigung«, oder gibt es nur vorübergehende Abweichungen von einer »natürlichen« Arbeitslosigkeit, wie der Monetarismus behauptet. Halten wir fest: Bei einer Verfolgung des Geldmengenzieles (langfristige Stabilisierung der Geldmenge), wie dies vom Monetarismus gefordert wird, besteht in der Finanzierung eines Staatsdefizits ein wesentlicher Unterschied: Die Kreditfinanzierung (Erhöhung der Staatsverschuldung) hat keinen Einfluß auf die Geldmenge und deshalb bei Gültigkeit der Quantitätstheorie des Geldes auch keinen Einfluß auf das Preisniveau (Inflationsrate). Eine Geldschöpfung dagegen erhöht die Geldmenge. Erst bezüglich der Wirkungen einer erhöhten Geldmenge unterscheiden sich die monetaristische und die keynesianische Position. 2.3.2 Neutralität der Staatsverschuldung? inen einflußreichen Beitrag zur Wirkung der Staatsverschuldung hat Robert J. Barro formuliert. Es ging als »Neutralitätstheorem« oder als »ricardianisches Paradigma« in die Literatur und Diskussion ein. David Ricardo hatte - in Anlehnung an Say - argumentiert, daß zwischen Staatsverschuldung und Steuern kein Unterschied bestehe, weil die Wirtschaftssubjekte erhöhte Staatsausgaben heute sofort mit künftigen Steuereinnahmen gleichsetzen. E 28 Betrachtet man auf der Grundlage von OECD-Daten die Defizitquote (Nettoneuverschuldung des Staates pro BIP) und die Inflationsrate in den alten Bundesländern 1970-1993, so zeigt sich, daß hier tatsächlich kein signifikanter Zusammenhang vorliegt (der Korrelationskoeffizient ist praktisch Null). Derselbe Zusammenhang ergibt sich, wenn wir Querschnittsdaten betrachten, d. h. die Inflationsrate und die Defizitquote verschiedener Länder in einem Jahr heranziehen. Für 12 wichtige OECD-Länder im Jahre 1996 ergibt sich im Querschnittsvergleich ebenfalls kein Zusammenhang zwischen Inflationsrate und Defizit; vgl. die Daten in der zweiten Auflage dieses Skripts S. 164. Die exakte Diskussion geht allerdings über den Rahmen der hier vorliegenden Fragestellungen hinaus, weshalb diese Frage hier nur gestreift wurde. 138 IV Monetarismus Jean Baptist Say: „Womit bezahlt nun aber der Staat die Zinsen seiner Schuld? Mit dem Teil eines anderen Einkommens, welchen er, aus der Hand eines Steuerpflichtigen, auf den Rentner überträgt.“29 David Ricardo: „Ein Land verelendet also nicht infolge der Zinszahlung für die Staatsschuld, noch kann ihm durch die Befreiung von dieser Zahlung geholfen werden. Nur durch Ersparnisse aus dem Einkommen und durch Einschränkungen der Ausgaben kann das nationale Kapital vergrößert werden, und durch die Aufhebung der Staatsschuld wird weder das Einkommen erhöht, noch werden die Ausgaben verringert.“30 Betrachten wir dies näher.31 Wenn durch ein Defizit in der Gegenwart (t=0) Staatsausgaben finanziert werden, so muß die dadurch entstehende Staatsschuld in der Zukunft (t=1) durch Steuern wieder abgebaut werden. Wenn also in der Gegenwart das Budget nicht ausgeglichen ist mit G0 > T0, so muß in der Zukunft das Umgekehrte gelten: G1 < T1. Nun ist aber noch zu berücksichtigen, daß zukünftige Steuern bzw. Ausgaben bezogen auf die Gegenwart abdiskontiert werden müssen, da die Staatsschuld verzinst wird. Daraus können wir für zwei Perioden (Gegenwart und Zukunft) die zusammengefaßte Budgetrestriktion des Staates wie folgt formulieren: G1 T T0 1 . G0 (4) 1i 1i Dem stellen wir die Budgetrestriktion der Privathaushalte gegenüber (wir vernachlässigen den Unternehmenssektor aus Gründen der vereinfachten Darstellung; dies bedeutet für das Argument jedoch keine Einschränkung). Die Haushalte können auch in der Gegenwart Kredite aufnehmen, um sie in der Zukunft zurückzubezahlen (dann sind die Konsumausgaben größer als das verfügbare Einkommen): C > Y - T, oder sie können in der Gegenwart sparen (Regelfall), um in der Zukunft daraus zu konsumieren (z. B. bei der Altervorsorge). Wir erhalten als Budgetrestriktion der Haushalte entsprechend: C0 C1 1i Y0 T0 Y1 T1 . 1i (5) Wenn wir die Budgetrestriktion der Privathaushalte und des Staates addieren, erhalten wir: C0 29 C1 1i Y0 G0 Y1 G1 . 1r (6) J. B. Say, Nationalökonomie a.a.O., S. 166. D. Ricardo, Über die Grunsätze der Politischen Ökonomie und der Besteuerung, Berlin 1959, S. 237. 31 Vgl. R. J. Barro, Are Government Bonds Net Wealth, Journal of Political Economy 82 (1974), S. 1095-1117 und zur folgenden Darstellung M. C. Burda, C. Wyplosz, Makroökonomik, München 1994, S. 83f. 30 IV Monetarismus 139 Das ist die konsolidierte Budgetrestriktion der Gesamtwirtschaft. Wie man leicht erkennen kann, spielt die Verteilung der Steuern auf Gegenwart und Zukunft keine Rolle. Bei gegebenen Ausgaben des Staates in Gegenwart und Zukunft erhalten wir stets dieselbe Budgetrestriktion. Was heißt das? Das heißt, daß die zeitliche Verteilung der Steuererhebung zwischen Gegenwart und Zukunft keinen Effekt hat. Wenn also in der Gegenwart zu wenig Steuern erhoben werden (= Staatsverschuldung), so müssen dafür in der Zukunft höhere Steuern angesetzt werden, sonst wird die intertemporale Budgetrestriktion verletzt. Es ergibt sich deshalb keine Wirkung der Staatsverschuldung auf den Konsum. Es besteht kein Unterschied zwischen den durch Steuern und den durch Kreditaufnahme finanzierten Staatsausgaben. Diese »Ricardo-Äquivalenz« genannte These der Neutralität der Staatsverschuldung beruht allerdings auf Voraussetzungen, die fragwürdig sind. Wir wollen diese Punkte hier nur kurz anreißen; eine tiefere Diskussion kann in diesem Rahmen nicht geführt werden: & Erstens wird bei dieser Überlegung vorausgesetzt, daß das Einkommen in jeder Periode gegeben und unabhängig von den Staatsausgaben und der Steuerbelastung ist. Es wird, mit anderen Worten, Vollbeschäftigung unterstellt. Nun beruht aber die zentrale Voraussetzung der keynesianischen Wirtschaftspolitik darin, daß Staatsverschuldung nur zu konjunkturellen Zielen eingesetzt werden sollte. Wird also durch eine Verschuldung in der Gegenwart das Realeinkommen dauerhaft erhöht, so steht auch in der nächsten Periode ein höheres Einkommen zur Tilgung der Staatsschuld zur Verfügung. Die »RicardoÄquivalenz« ist damit außer Kraft gesetzt (vgl. Kapitel 4.5.2, Teil III). & Zweitens wird vergessen, daß die Bevölkerung nicht aus einer »homogenen Masse« gleichaltriger Personen besteht, sondern aus unterschiedlichen Generationen. Es gibt also immer gleichzeitig Personen, die für die Altervorsorge sparen, und solche, die von der Altersvorsorge leben (besonders erkennbar beim sog. »Generationenvertrag«). Diesem Umstand trägt ein Modell Rechnung, das Paul Anthony Samuelson entwickelt hat und das Gleichgewichtsbedingungen zwischen den Generationen und ihre ökonomischen Konsequenzen untersucht (Modell der »überlappenden Generationen«).32 In zahlreichen Arbeiten wurde dieses Modell ergänzt und auch zur Analyse der Staatsverschuldung herangezogen.33 Selbst bei Vollbeschäftigung (neoklassischer Fall) ergeben sich hier reale Effekte der Staatsverschuldung, weil es zu intergenerationeller Umverteilung und crowding out kommen kann. Ferner kann die Staatsverschuldung zu einer Veränderung der Einkommensverteilung führen; dies hat in einem Modell mit überlappenden Generationen Wirkungen auf den Zinssatz und damit auf reale Faktoren.34 32 P. A. Samuelson, An Exact Consumption-Loan Model of Interest With oder Without the Social Contrivance of Money, Journal of Political Economy 66 (1958), S. 467-482. Samuelson betrachtet allerdings nur einen Fall ohne Vererbung von Vermögen an nachfolgende Generationen. Vgl. zur Diskussion des Samuelson-Modells und zur Literatur K.-H. Brodbeck, Stabilität und Effizienz multipler Gleichgewichte in Modellen mit überlappenden Generationen, Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge Nr. 85-09, München 1985. 33 Vgl. P. Diamond, National Debt In A Neoclassical Growth Model, American Evonomic Review 60 (1965), S. 1126-1150. 34 Vgl. K.-H. Brodbeck, Two Class Economies With Overlapping Generations And Heritable Capital Stock, Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) 143 (1987), S. 648, wo gezeigt wird, wie bei unterschiedlicher Vererbung die Einkommensverteilung und damit der Realzinssatz (bei Vollbeschäftigung) beeinflußt wird. Eine Erhöhung der Erbschaftssteuer würde z. B. zu einem Anstieg des Realzinssatzes führen. 140 IV Monetarismus Halten wir fest: Die »Äquivalenz-These« (ricardianische Äquivalenz) behauptet, daß in der realen Wirkung kein Unterschied zwischen kredit- und steuerfinanzierten Staatsausgaben besteht. Diese These hängt auf kritische Weise ab vom Verhältnis zwischen den Generationen, wie es in den Modellen mit »überlappenden Generationen« diskutiert wird. Wird dies berücksichtigt, so läßt sich in der Regel ein Einfluß der Besteuerung auf reale Größen nicht leugnen. Bezieht man Fälle keynesianischer Unterbeschäftigung mit ein, so wird die RicardoÄquivalenz gleichfalls ungültig. 3 ZUR KRITIK DES MONETARISMUS er Monetarismus hat sich in der praktischen Geldpolitik Ende der 70er und in den 80er Jahren weltweit zur herrschenden wirtschaftspolitischen Konzeption entwickelt.35 Gleichwohl stehen sowohl seine theoretischen wie seine empirischen Voraussetzungen auf »wackeligen Füßen«. Wie wir schon bei der kritischen Untersuchung der Politik der Deutschen Bundesbank - die als Modell für die Europäische Zentralbank gilt sehen mußten, sind hier zahlreiche Einwände vorzubringen.36 Die These, daß eine Rückführung der Inflationsraten nur vorübergehend die Arbeitslosigkeit erhöhen, mittelfristig dagegen senken müsse (auf das Niveau der »natürlichlichen Arbeitslosigkeit«), hat sich in den 80er und 90er Jahren in Europa nicht bestätigen lassen. Es ist deshalb sinnvoll, alternative theoretische Ansätze zum Monetarismus kurz zu beleuchten. Man kann hier zwei Hauptlinien der Kritik beobachten: Die Theorie der rationalen Erwartungen kommt zu einer Verschärfung zentraler Aussagen des Monetarismus, während die keynesianische Kritik die Grundlagen des Monetarismus selbst in Zweifel zieht. D 3.1 ADAPTIVE VERSUS RATIONALE ERWARTUNGEN37 an kann den traditionellen vom neueren Monetarismus durch zwei Punkte unterscheiden: Erstens lehnt der neuere Monetarismus eine diskretionäre Geldpolitik ab und befürwortet statt dessen eine Regelbindung, zweitens verwenden die Autoren des neueren Monetarismus einen Schlüsselbegriff, den Keynes in die ökonomische Theorie eingeführt hat: den Begriff der Erwartungen. Keynes geht davon aus, daß die Erwartungen prinzipiell auf Ungewißheit basieren. Es sind also echte (im Sinne der Psychologie) Erwartungen, die nicht auf objektive Daten reduziert werden können. Die Erwartungen stellen bei Keynes eine eigenständige Größe im Wirtschaftsprozeß dar. Dagegen kehrt der Monetarismus zur neoklassischen Auffassung zurück. Erwartungen passen sich an reale Daten an, sie sind keine eigenständige Größe zur Erklärung des Wirtschaftsprozesses. Nun stellt sich allerdings die Frage, wie sich die Erwartungen an reale Daten anpassen. Hier ergibt sich ein Unterschied zwischen verschiedenen theoretischen und wirtschaftspolitischen Konzeptionen. Im Monetarismus geht man allgemein von adaptiven M 35 Nikolaus Piper schreibt am 3./4. Januar 1998 in der Süddeutschen Zeitung: »Friedmans These ist heute längst zur neuen Doktrin geworden. Wer noch bezweifelt, daß Preisstabilität die Voraussetzung für Vollbeschäftigung ist, gilt als Ketzer«; N. Piper, Der Traum, wählen zu können, SZ Nr. 2 (1998), S. 23. 36 Vgl. auch den Abschnitt 2.3 für eine praktisch vorgeführte Kritik am Beispiel der Deutschen Bundesbank. 37 Vgl. zu diesem Abschnitt J. L. Stein, Monetarist, Keynesian & New Classical Economics, Oxford 1982. IV Monetarismus 141 Erwartungen aus. Erwarten die Wirtschaftssubjekte eine Inflationsrate von * und ergibt sich aufgrund einer Expansion der Geldmenge eine vorübergehende Senkung der Arbeitslosenrate u unter ihr »natürliches« Niveau u*, so herrscht zunächst Geldillusion, d. h. die neu eingestellten Arbeitskräfte und ihre Ausgaben führen scheinbar zu einem höheren Einkommen. Lernen nun die Wirtschaftssubjekte, daß dieser Effekt nur durch eine Erhöhung der Inflationsrate auf den Wert ** > * erkauft wurde, so passen sie in den folgenden Perioden ihre Erwartungen an die neue Situation ** an; die Arbeitslosenrate wird wieder auf ihr »natürliches« Niveau u* steigen. Allerdings befindet sich die Wirtschaft nun auf einem höheren Inflationsniveau. Dieses »Lernen« stellt eine schrittweise Adaption an tatsächliche Verhältnisse an. Die Wirtschaftssubjekte lernen erst durch die Erfahrung aus den tatsächlichen Änderungen der Preise. Diese Annahme wird von den Anhängern der Theorie der rationalen Erwartungen bestritten. John F. Muth hatte bereits 1961 in einem Aufsatz eine alternative These für Preisbewegungen vorgestellt.38 Dieser Aufsatz wurde zunächst wenig beachtet. Erst als diese These von Robert E. Lucas, dem späteren Nobelpreisträger, aufgegriffen und auf die Geld- und Wirtschaftspolitik im allgemeinen angewendet wurde, entwickelte sich eine neue ökonomische Schule: Die »Theorie der rationalen Erwartungen«, auch »Neue Klassische Ökonomie« genannt (mit der traditionellen Neo-Klassik eng verwandt, aber nicht mit ihr zu verwechseln). Der Grundgedanke dieser Theorie läßt sich relativ einfach skizzieren. Preise bilden sich in einem walrasianischen Totalmodell, ergänzt um die Quantitätstheorie des Geldes, aufgrund der realen Daten (Präferenzen, Marktstruktur, Knappheit der Ressourcen, Produktionstechnologie, Geldmenge, Staatsausgaben etc.). Was der Markt faktisch als »Rechenleistung« vollbringt (die Lösung eines walrasianischen Totalmodells), das drückt sich bei den Wirtschaftssubjekten in ihrer Erfahrung aus. Da sie, aus rationalem Robert E. Lucas Egoismus, jede Gewinnchance nutzen, gibt es keine nützliche Informa*1937 tion, die nicht verwertet würde. Das heißt aber, daß die Spekulanten, die Preisdifferenzen bei Veränderungen ausnutzen, auch zum Verschwinden dieser Preisdifferenzen beitragen. Gerade die »hohe Rationalität« der Arbitrage-Jäger - so die These - sorge dafür, daß sich Anpassungsprozesse sehr rasch vollziehen, besonders leicht an den Wertpapier- oder an den Devisenmärkten erkennbar. Kurz: Die Wirtschaftssubjekte nutzen jede verfügbare Information sofort, um eine mögliche Preisänderung spekulativ zu nutzen. Das führt aber dazu, daß sich eine Datenänderung fast sofort sich in Preisänderungen niederschlägt. Kündigt die Zentralbank eine Ausweitung der Geldmenge an, so hat dies sofort einen Effekt auf die Aktienmärkte usw. Man kann dies auch so ausdrücken: Die mikroökonomische Theorie beschreibt die Preisbildung aufgrund gegebener Informationen. Diese Theorie ist - praktisch gesprochen »in den Köpfen« der Entscheidungsträger als Erfahrung gegenwärtig. Zudem könnte jemand, der über theoretische Kenntnisse verfügt, Prognosen verkaufen und damit Entscheidungen induzieren, die genau den Vorhersagen der Theorie entsprechen. 38 J. F. Muth, Rational expectations and the theory of price movements, Econometrica 29 (1961), S. 315-335. 142 IV Monetarismus John F. Muth über rationale Erwartungen: „If the predictions of the theory were substantially better than the expectations of the firms, then there would be opportunities for the insider to profit from the knowledge by inventory speculation if possible, by operating a firm, or by selling a price forecasting service to firms. The profit opprotunities would no longer exist if the aggregate expectation of the firms is the same as the prediction of the theory.“39 Was folgt daraus für die Wirtschaftspolitik? Daraus folgt, daß wirtschaftspolitische Maßnahmen, die auf einer vorübergehenden »Täuschung« der Wirtschaftssubjekte beruhen, indem z. B. die Geldmenge manipuliert wird, um eine Abweichung von der »natürlichen« Arbeitslosenrate zu erreichen, wirkungslos sind. Sowohl Keynes wie Friedman gehen davon aus, daß die Wirtschaftssubjekte erst im Laufe der Zeit ihre Erwartungen anpassen. Die Theorie der rationalen Erwartungen behauptet das Gegenteil: Sie geht davon aus, daß sofort bei Bekanntwerden einer wirtschaftspolitischen Entscheidung entsprechende Änderungen in den Dispositionen der Privaten vorgenommen werden, so daß die Maßnahme der Geld- oder Fiskalpolitik wirkungslos bleibt. Die Wirtschaftssubjekte sind so rational, daß sie den Geldschleier sofort durchschauen und entsprechende Anpassungen vornehmen. Erhöht also die Zentralbank die Geldmenge um z. B. 3% über die Wachstumsrate des realen BIP hinaus, so wissen die Wirtschaftssubjekte sofort, daß dies die bestehende Inflationsrate um 3% erhöhen wird. Bildlich gesprochen, kann man Keynesianismus, Monetarismus und die Theorie der rationalen Erwartungen so umschreiben: Wenn der Zentralbankrat am Donnerstag eine Erhöhung der Geldmenge um 3% über die realen Erfordernisse hinaus beschließt, so behaupten die Anhänger der Theorie der rationalen Erwartungen, daß am nächsten Montag morgen alle Preise um 3% erhöht werden. Die Monetaristen würden sagen, daß die Ausweitung der Geldmenge zunächst den Nominalzinssatz senken würde, daraufhin reale Effekt auslöste, die aber nach etwa einem oder zwei Jahren wieder rückgängig gemacht würden, weil die Wirtschaftssubjekte dann gelernt hätten, daß sich nur die nominalen Preise verändert haben. Die Keynesianer würden der Argumentation der Monetaristen weitgehend folgen aber nur für eine Situation der Vollbeschäftigung. Bei Unterbeschäftigung würde die Produktionsmengen angepaßt werden; nennenswerte Preiserhöhungen blieben aus. Die Theorie der rationalen Erwartungen konstruiert ein Bild des Wirtschaftssubjekts, das vollständig mit einem Modell dieses Wirtschaftssubjekts identisch ist. Während Friedman immerhin noch ein Lernverhalten unterstellt, wird bei Robert Lucas der Entscheidungsträger zum Roboter, der vollständig berechenbar ist. Selbst wenn dieses Menschenbild zutreffend wäre, bliebe immer noch die Frage, nach welchem Programm die Entscheidungsträger programmiert werden. Es wurde den Anhängern der Theorie rationaler Erwartungen vielfach und zurecht die einfache, aber unbeantwortet gebliebene Frage gestellt: Wodurch ist sichergestellt, daß die Wirtschaftssubjekte durch ein neoklassisches Vollbeschäftigungsmodell »programmiert« sind, nicht aber durch ein keynesianisches Modell? Gingen alle Wirtschaftssubjekte »rational« von einer Situation keynesianischer Unterbeschäftigung aus, so müßten sie gerade reale Effekte der Geld- und Fiskalpolitik annehmen und damit in ihre Handlungen einbeziehen. Der einzige Unterschied zum traditionellen Keynesianismus bestünde dann 39 John F. Muth, Rational Expectations a.a.O., S.318. IV Monetarismus 143 darin, daß es keine Wirkungsverzögerungen (lags) der Geld- und Fiskalpolitik mehr geben würde. Robert Lucas´ »Robotertheorie«: „Wir programmieren Roboterimitationen von Menschen, und daraus lassen sich nur begrenzte Einsichten gewinnen.“40 In der praktischen Wirtschaftspolitik hat die Theorie der rationalen Erwartungen neben dem Monetarismus kaum einen großen Einfluß gehabt, mit gewissen Ausnahmen in den USA. Teile der Begründung der »Reagonomics« könnte man in diesem Sinne deuten; doch die praktische Budgetpolitik Reagens folgte - ganz entgegen seinen Ankündigungen - weit eher einem pragmatischen Keynesianismus. Anstatt die Staatsverschuldung zu reduzieren, wurde die Staatstätigkeit in dieser Periode erheblich ausgeweitet und die Staatsverschuldung erhöht, mit den von den Keynesianern postulierten positiven Beschäftigungseffekten. Wir müssen noch eine andere These von Lucas kurz diskutieren, die nicht unmittelbar mit der Theorie der rationalen Erwartungen zusammenhängt: Lucas bestreitet, daß man überhaupt eine sinnvolle ökonometrische Basis für wirtschaftspolitische Entscheidungen finden kann. Diese »Lucas-Kritik«, wie sie in der Literatur auch genannt wird, beruht auf folgendem Gedanken: Wenn ein staatlicher Eingriff anhand von geschätzten Zusammenhängen zwischen wirtschaftlichen Variablen erfolgt, so setzten derartige ökonometrische Schätzungen bestimmte Parameter voraus, in denen sich das Verhalten von Wirtschaftssubjekten spiegeln soll (z.B. die marginale Konsumneigung oder die Investitionsneigung). Wenn aber die Wirtschaftssubjekte in ihre Entscheidungen die Maßnahmen des Staates mit einbeziehen, dann entsteht ein »Zirkel«: Jene Größen und Zusammenhänge, auf die sich der Staat bezieht, um bestimmte wirtschaftspolitische Maßnahmen zu ergreifen, hängen selbst von diesen (erwarteten) Maßnahmen ab.41 Daraus ergibt sich: Die Daten und Zusammenhänge als Basis wirtschaftspolitischer Maßnahmen und Entscheidungen - besonders in der Geld- und Fiskalpolitik - sind selbst ein Ergebnis solcher Maßnahmen und Entscheidungen, sie verändern sich also durch die Wirtschaftspolitik. Goodhart hat diesen Gedanken noch verschärft. Man nennt dies auch »Goodhart´s Law«, das besagt, »that any observed statistical regularity will tend to collapse once pressure is placed upon it for control purposes«.42 Daraus ergibt sich, daß die Wirtschaftspolitik sich nicht auf eine »objektive«, unabhängige Wirtschaft bezieht und dort lenkend oder formend eingreift. Vielmehr sind Wirtschaft und Politik interdependente Systeme, die nicht getrennt analysiert werden können (vgl. Kapitel 4.3, Teil I). Die Folgerung der »Theorie der rationalen Erwartungen«, daß deshalb jede Form wirtschaftspolitischer Eingriffe wirkungslos bleiben müsse, ist allerdings wenig überzeugend. Man kann aus dieser Einsicht - der »LucasKritik« - nur zu dem Schluß gelangen, daß zentrale Größen der Wirtschaft nicht gesteuert 40 R. Lucas; in: A. Klamer, Conversations With Economists, Savage/Maryland 1983; deutsch in: Wirtschaftswoche 43/19.10.1995, S. 54. 41 Vgl. R. Lucas, Econometric Policy Evaluation: a Critique; in: K. Brunner, A. Meltzer (Hrsg.), The Phillips Curve and Labour Markets, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1, Amsterdam 1976, S. 19-46; siehe auch: C. A. E. Goodhart, Money, Information and Uncertainty, Cambridge/Mass. 19912, S. 349ff. 42 Goodhart, Money a.a.O., S. 100. 144 IV Monetarismus werden können, wie man ein Auto oder ein Schiff steuert. Es folgt daraus keineswegs, daß die Wirtschaft auf staatliche Eingriffe verzichten kann. Eher schon zeigt sich eine wechselseitige Abhängigkeit zweier Systeme - Wirtschaft und Politik -, die ohne das je andere gar nicht funktionieren könnten. 3.2 KEYNESIANISCHE KRITIK DES MONETARISMUS er Monetarismus ist, von differenzierteren Begründungen abgesehen, eine Rückkehr zu neoklassischen Positionen. Die These, daß es so etwas wie eine nicht beeinflußbare »natürliche« Arbeitslosigkeit und einen »natürlichen« Zinssatz gebe - die auch, wie sich zeigte, von der Deutschen Bundesbank übernommen wurde -, entspricht der vorkeynesianischen Ökonomie. Keynes hat nicht bestritten, daß es so etwas wie eine nicht durch Wirtschaftspolitik beeinflußbare Arbeitslosigkeit gibt; er nennt dies die »freiwillige« Arbeitslosigkeit. Dieser Begriff trifft auf den freiwilligen Wechsel des Arbeitsplatzes oder eines Wohnungswechsels zwischen verschiedenen Städten zu; er umfaßt aber auch strukturelle Komponenten, etwa Arbeitslosigkeit in der Folge technischer Änderungen, wenn ein Produktionszweig schließen muß und in anderen Sektoren neue Industriezweige entstehen. Darüber hinaus behauptete Keynes aber eine unfreiwillige Arbeitslosigkeit aufgrund einer unzureichenden Nachfrage im Wechselspiel mit den Einflüssen des Geldmarktes auf den realen Wirtschaftsprozeß. Milton Friedman hat ausdrücklich betont (siehe Zitate oben), daß die »natürliche Arbeitslosenrate« nicht meßbar ist. Sie ist auch nicht unveränderlich, ja, Friedman sagt sogar, sie sei auch von wirtschaftspolitischen Maßnahmen beeinflußt. (Die »Lucas-Kritik« verschärft diesen Einwand noch.) Wenn aber Friedman selbst sagt, daß viele das Niveau der »natürlichen Arbeitslosenrate« »bestimmenden Marktcharakteristika Menschenwerk und Ergebnis der Wirtschaftspolitik«43 sind, dann verwickelt er sich im entscheidenden Punkt seiner Theorie in einen unentwirrbaren Zirkel: Wenn die Wirtschaftspolitik, mit welchen Maßnahmen auch immer, das »natürliche« Niveau der Arbeitslosenrate beeinflußt, dann ist die Forderung, fiskalpolitische Maßnahmen zu unterlassen und die Geldpolitik an strikte Regeln zu binden, nicht mehr einsichtig zu machen. Friedman dachte vielleicht daran, daß viele wirtschaftspolitische Maßnahmen in ihrer Wirkung nicht vorhergesehen werden können, doch das ist noch kein prinzipielles Argument gegen die Möglichkeiten diskretionärer Maßnahmen. Es deutet nur darauf hin, daß eine »kybernetische Steuerung« der Wirtschaft nicht möglich ist. Die Frage lautet deshalb nicht, ob bestimmte Ziele exakt erreicht werden können, die Frage lautet, ob es nicht wirtschaftspolitische Maßnahmen gibt, die wenigstens die Richtung einer Veränderung (z. B. die Senkung der Arbeitslosenrate) beeinflussen können. Und daran, wie Friedman implizit zugesteht, kann kaum gezweifelt werden. Damit reduziert sich aber die Differenz zwischen Keynesianern und Monetaristen weniger auf die prinzipielle Frage der Beeinflußbarkeit, viel eher auf die Diskussion über die Wirksamkeit einzelner wirtschaftspolitischer Maßnahmen. Die Kritik von Lucas ist an diesem Punkt einschneidender, denn sie bestreitet auch die Möglichkeit einer statistisch zu begründenden Geldmengensteuerung (»Goodhart´s Law«). D 43 M. Friedman, Die optimale Geldmenge a.a.O., S. 146. IV Monetarismus 145 Es gibt aber noch einen weit wichtigeren Einwand gegen die Konzeption »natürlicher« Preise in der Wirtschaft. In der Diskussion bei der Ausarbeitung der »General Theory« war ein Team von Ökonomen um Keynes beteiligt, zu dem auch Piero Sraffa gehörte. Sraffa diskutiere in den 30er Jahren mit der damaligen Auffassung von Friedrich A. von Hayek, die im wesentlichen mit der Theorie vom »natürlichen Zinssatz« von Wicksell übereinstimmt, jene Theorie, auf die sich Friedman ausdrücklich berief. Sraffas Einwand gegen Hayek (damit gegen die später vom Monetarismus wieder aufgegriffene These) wurde von Keynes übernommen und zu einer Voraussetzung der »General Theory«.44 Piero Sraffa zum Konzept des »natürlichen Zinssatzes«: „But in times of expansion of production, due to additions to savings, there is no such thing as an equilibrium (or unique natural) rate of interest, so that the money rate can neither be equal to, nor lower than it: the »neutral« rate of interest on producers´ goods, the demand for which has relatively increased, is higher than the »natural« rate of consumers´ goods, the demand for which has realtively fallen.“45 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 Sraffa sagte: Nur in einer statischen Wirtschaft gibt einen Zinssatz. In einer dynamischen Wirtschaft sind die Kapitalerträge in den Wirtschaftszweigen verschieden. Zudem verändern sich diese Erträge mit dem Wirtschaftsprozeß unaufhörlich. Es ist deshalb logisch unmöglich, die Geldpolitik am »natürlichen« Zinssatz zu orientieren: Solch einen Zinssatz gibt es nicht, es gibt nur eine Vielfalt höchst veränderlicher interner Zinssätze unterschiedlicher Investitionsprojekte. Also nicht die Geldpolitik paßt den nominalen Zinssatz an den natürlichen an, umgekehrt, die Investoren passen sich in der Berechnung ihrer Investitionsprojekte an den Geldzinssatz an - das war die Weiterentwicklung dieses Gedankens von Keynes. Reale Daten passen sich an monetäre Daten an, nicht umgekehrt. Wirft man einen Blick auf den säkularen Anstieg der Arbeitslosenraten der vergangenen Jahrzehnte in den meist en OECD-Staaten, so ist es nicht 0,08 ganz unangebracht, die Rede 0,07 von einer »natürlichen Arbeits0,06 losenrate« als Schutzbehaup0,05 tung, nicht aber als theoretisch 0,04 bündiges Konzept anzusehen. 0,03 Der eindeutige Trend im An0,02 stieg der Arbeitslosenrate in 0,01 Deutschland (und vielen ande0 ren europäischen Ländern) seit der Mitte der 70er Jahre kann kaum als Ausdruck eines »na1960-73 1974-93 türlichen Anstiegs« gedeutet Arithmetisch ( 1974-93) Arithmetisch ( 1960-73) werden. Entwicklung der Arbeitslosenrate in Deutschland 1960-1993 44 45 J. M. Keynes, General Theory a.a.O., S. 223 Note. P. Sraffa, Dr. Hayek on Money and Capital, Economic Journal 42 (1932), S. 51. 146 IV Monetarismus Auch die These, daß die Stabilisierung des Preisniveaus nur temporär einen Anstieg der Arbeitslosigkeit nach sich ziehen, langfristig aber zu einem Rückgang der Arbeitslosenrate auf ihr »natürliches Niveau« führen würde, ist aus den Daten jedenfalls nicht erkennbar. Der Rückgang der Inflationsrate in den 80er Jahren hat eher noch den Trend der Arbeitslosenrate nach oben verschoben. Nimmt man die Verkündigung des Geldmengenziels 1974 als Zäsur für den schrittweisen Übergang von keynesianischen zu monetaristischen Positionen, so ist ein Trendbruch genau mit diesem Datum nicht von der Hand zu weisen. Jedenfalls sprechen die Daten nicht für die These, daß 20 Jahre monetaristischer Geldpolitik den Arbeitsmarkt stabilisiert hätte. Eher ist in der Zeit 1960-1973 ein stabiles Niveau der Arbeitslosenrate zu beobachten. Die Gründe hierfür sind vielfältig und sicherlich nicht einfach auf den Wechsel in den wirtschaftspolitischen Leitbildern zu reduzieren - dies hieße den Einfluß der Wirtschaftspolitik zu überschätzen. Gleichwohl gibt es keine Evidenz für die Wirksamkeit der monetaristischen Geldpolitik in dem Sinn, daß ein »natürliches« Arbeitlosenniveau stabilisiert würde. Auch die Überlegung zur Phillips-Kurve hat eher gezeigt, daß sich nicht eine konstante Phillips-Kurve verschiebt, viel eher trifft zu, daß es so etwas wie eine in der Phillips-Kurve behauptete Beziehung langfristig gar nicht gibt. Wir werden uns im nächsten Kapitel ausführlich dem Arbeitsmarkt und den Lohnbildungsprozessen zuwenden. Ferner gibt es keinen überzeugenden Hinweis, daß das Ziel der Geldmengenstabilisierung tatsächlich volkswirtschaftlich einen Vorteil bedeutet. Die durch die Geldmengenstabilisierung erzeugte Volatilität (= Schwankungsintensität) der Zinssätze führt vielmehr vermutlich zu allgemeinen Wohlfahrtsverlusten durch häufige Umschichtungen der Portefeuilles der Anleger, verunsichert Investoren und führt ceteris paribus zu Wohlfahrtsverlusten - nicht zuletzt zu erhöhten sozialen Kosten erhöhter Arbeitslosigkeit.46 Wirtschaftspolitische Leitbilder werden jedoch nur in langen Zeiträumen verändert und sind in aller Regel relativ immun gegen widersprechende Tatsachen. In nicht übertroffener Deutlichkeit schließt Keynes sein Hauptwerk mit den Sätzen ab: »Madman in authority (...) are destiling their frenzy from some academic scribbler of a few years back. I am sure that the power of vested interests is vastly exaggerated compared with the gradual encroachment of ideals. (...) (I)n the field of economic and political philosophy there are not many who are influenced by new theories after they are twenty-five oder thirty years of age, so that the ideas which civil servants and politicians an even agitators apply to current events are not likely to be the newest.«47 46 47 Vgl. die bereits zitierte Analyse von Charles T. Carlstrom, Timothy S. Fuerst, a.a.O. J. M. Keynes, The General Theory a.a.O., S. 383f.