Skript über alle Veranstaltungen der Vorlesung
Werbung
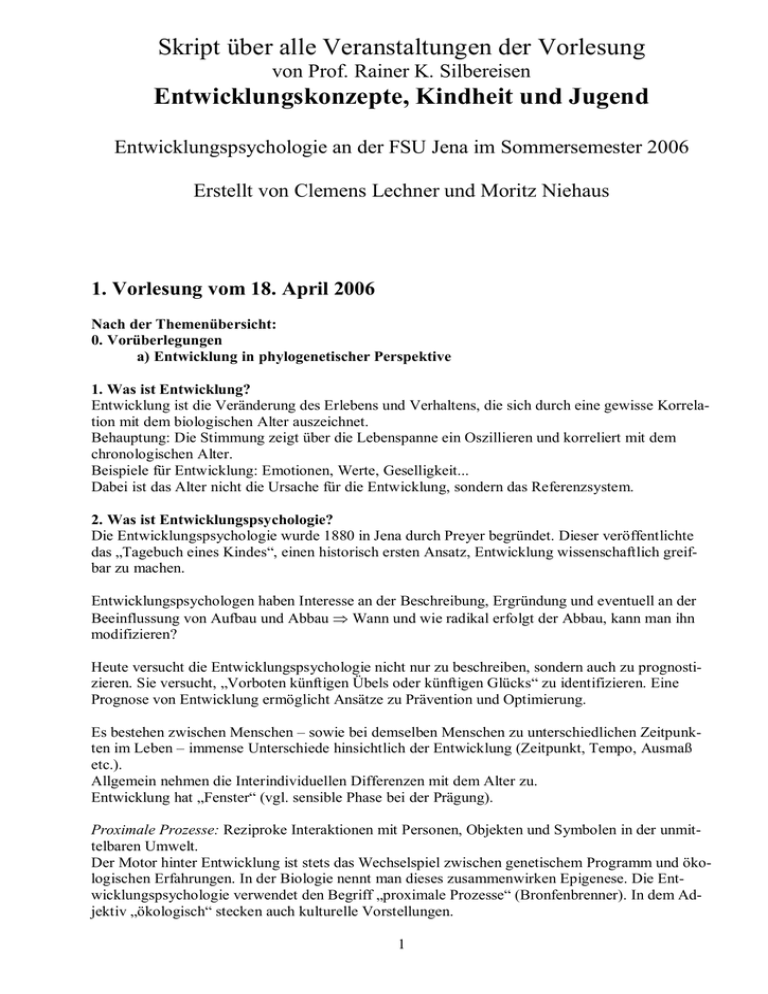
Skript über alle Veranstaltungen der Vorlesung von Prof. Rainer K. Silbereisen Entwicklungskonzepte, Kindheit und Jugend Entwicklungspsychologie an der FSU Jena im Sommersemester 2006 Erstellt von Clemens Lechner und Moritz Niehaus 1. Vorlesung vom 18. April 2006 Nach der Themenübersicht: 0. Vorüberlegungen a) Entwicklung in phylogenetischer Perspektive 1. Was ist Entwicklung? Entwicklung ist die Veränderung des Erlebens und Verhaltens, die sich durch eine gewisse Korrelation mit dem biologischen Alter auszeichnet. Behauptung: Die Stimmung zeigt über die Lebenspanne ein Oszillieren und korreliert mit dem chronologischen Alter. Beispiele für Entwicklung: Emotionen, Werte, Geselligkeit... Dabei ist das Alter nicht die Ursache für die Entwicklung, sondern das Referenzsystem. 2. Was ist Entwicklungspsychologie? Die Entwicklungspsychologie wurde 1880 in Jena durch Preyer begründet. Dieser veröffentlichte das „Tagebuch eines Kindes“, einen historisch ersten Ansatz, Entwicklung wissenschaftlich greifbar zu machen. Entwicklungspsychologen haben Interesse an der Beschreibung, Ergründung und eventuell an der Beeinflussung von Aufbau und Abbau ⇒ Wann und wie radikal erfolgt der Abbau, kann man ihn modifizieren? Heute versucht die Entwicklungspsychologie nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu prognostizieren. Sie versucht, „Vorboten künftigen Übels oder künftigen Glücks“ zu identifizieren. Eine Prognose von Entwicklung ermöglicht Ansätze zu Prävention und Optimierung. Es bestehen zwischen Menschen – sowie bei demselben Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben – immense Unterschiede hinsichtlich der Entwicklung (Zeitpunkt, Tempo, Ausmaß etc.). Allgemein nehmen die Interindividuellen Differenzen mit dem Alter zu. Entwicklung hat „Fenster“ (vgl. sensible Phase bei der Prägung). Proximale Prozesse: Reziproke Interaktionen mit Personen, Objekten und Symbolen in der unmittelbaren Umwelt. Der Motor hinter Entwicklung ist stets das Wechselspiel zwischen genetischem Programm und ökologischen Erfahrungen. In der Biologie nennt man dieses zusammenwirken Epigenese. Die Entwicklungspsychologie verwendet den Begriff „proximale Prozesse“ (Bronfenbrenner). In dem Adjektiv „ökologisch“ stecken auch kulturelle Vorstellungen. 1 Beispiel: Ein Kind zieht an einer herabhängenden Glocke. Der Bewegungsdrang ist angeboren und wird durch Umweltreize stimuliert: Anlage + Umwelt. Entwicklungsmechanismen: Ontogenese und Phylogenese So ist der Krieg Mann gegen Mann beispielsweise eine „Errungenschaft“ der griechischen Phalanx, also der Phylogenese. In der Phylogenese erkennt man, zum Beispiel anhand der Auswertung archäologischer Funde wie Werkzeuge, die kognitive Entwicklung in der Stammesgeschichte des Menschen: Die intellektuellen Fähigkeiten von Menschen, die vor 5 bis 2,5 Millionen Jahren lebten, sind vergleichbar mit denen von rezenten Schimpansen. Ein erstes Relikt menschlicher Technologie sind 2,5 Mio. Jahre alte Flakes, d.h. Steinsplitter. • Homo habilis (3,8-1,8 Mio. Jahre v.Chr) wird als der erste Werkzeughersteller anerkannt. Um Werkzeuge herstellen zu können, muss man die Fähigkeit besitzen, sich das Endprodukt vorzustellen. In den Splittern von Homo habilis erkennt man allerdings, dass lediglich der Form des Steins gefolgt wurde. • Anders bei Homo erectus (1,8 Mio.-500.000 Jahre v.Chr.). Dessen kognitive Fähigkeiten waren also bereits höher. • Homo Sapiens (bis ca. 50.000 Jahre v.Chr.) schließlich besaß die Fähigkeit, aus dem selben Ausgangsgegenstand nach Plan verschiedene Gegenstände herzustellen. Holzwerkzeuge sind aufgrund der Verrottungseigenschaften des Materials leider fast vollständig verloren und damit nicht mehr wissenschaftlich verwertbar. Gefunden wurden aber beispielsweise Speere. Die Jagd mit ihnen ist außerordentlich komplex. Sie erfordert eine diffizile Feinmotorik, ballistische Kenntnisse sowie Gruppenorganisation. Erfindung, Herstellung, Beherrschung und Weitergabe der Technologie zeugen von einem recht hoch entwickelten Wesen. 2. Vorlesung vom 25.04.2006 Nach der Themenübersicht: 0. Vorüberlegungen b) Evolutionstheorie und Entwicklungspsychologie Literatur: insbesondere Artikel von Bjorklund Evolutionäre Entwicklungspsychologie Definition: E.E. ist die Betrachtung von Entwicklung unter dem Aspekt von Umweltbedingungen, Organismus und deren Wechselwirkungen. Die Ausprägung des Genotyps ist abhängig von sozialen und Umweltbedingungen. Ein junger, aber bedeutsamer Ansatz der Entwicklungspsychologie ist das Miteinbeziehen evolutionärer Perspektiven. Dies meint die Beschreibung menschlicher Funktionsweisen unter evolutionären Paradigmen. Ziel der evolutionären Entwicklungspsychologie ist es, das den Menschen über lange Zeit Gemeinsame zu finden. Der evolutionstheoretische Ansatz ermöglicht ein Verständnis des „was und wie“ der Entwicklung anhand des „warum“. Zentral ist die Idee, dass zu verschiedenen Zeiten in der Ontogenese spezifische Anpassungszwänge (adaptive pressures) wirksam sind. 2 Grundlage für diese Idee ist Darwins Evolutionstheorie mit folgenden Punkten. • Mehr Geburten als Überlebende (=das Reproduktionsalter erreichende) • Variation von Merkmalen • Heredität: Erblichkeit im Allgemeinen • Selektion ⇒ Anpassung/Adaptation Die Annahme der Evolutionären Entwicklungspsychologie ist dabei: Psychologische Mechanismen (z.B. Lügen können) unterliegen einer evolutionärer Entwicklung. Es gibt viele phylogenetisch alte Verhaltensweisen (Gemeinsamkeiten mit Urmenschen), die sehr resistent gegen Störungen sind. Tritt allerdings eine Störung auf, sind die Auswirkungen oft gravierend. Konsequenz von Entwicklung: Verzögerung der Reife Funktion von Entwicklung: Erlernen komplexer Verhaltensweisen ⇒ Optimierung des Organismus. Dabei gilt: je komplexer das soziale System, desto länger dauert die ontogenetische Entwicklung. Jeder Lebensabschnitt scheint in dieser komplexen Umwelt eine ganz bestimmte Funktion zu haben. So hat ein Kind im Kindergartenalter die Differenzierung zwischen „Du“ und „Sie“ zu lernen, wobei das „Sie“ Respekt, Distanz, Nicht-Familie ausdrückt und damit eine Hierarchie impliziert. Theorie: Es existiert ein Anpassungswert unreifen Verhaltens. Beispiel: Raufereien dienen einerseits direkt der Stimulation der körperlichen Entwicklung (Muskeln, Koordination etc.), andererseits dem Erlernen sozialer Verhaltensweisen (Hierarchien, Aggression, Mitleid etc.). Anhand welcher Determinanten lässt sich Entwicklung (z.B. Pubertät) feststellen? Mögliche Marker: Knochenwachstum in der Archäologie, Vitalkapazität (Atmung, Kreislauf) am lebenden Wesen. Reifealter im Laufe der Stammesgeschichte: Australopithecus 9-11 (wie Schimpanse) Homo erectus 12-14 Homo sapiens sapiens (wir) 13-20 ⇒ Annähernd Verdopplung der Entwicklungsspanne im Laufe der Phylogenese. Möglich war diese Entwicklung nur, weil im selben Zuge die Kindersterblichkeit geringer wurde. Bei Primaten beträgt sie 70-90%, in den Gesellschaften der Jäger und Sammler 50%. Um die Kindersterblichkeit zu reduzieren, müssen hohe Kosten aufgewandt werden, z.B. Unterstützungssystem, Technologie. Entwicklungsphasen müssen einen evolutionären Wert haben, sonst würden sie nicht vollzogen. Der Nutzen muss die Kosten überwiegen. Stages of development beim Jäger und Sammler: 1. Infancy (Säuglingsalter bis 3 J.): Zeit der Nährung durch die Mutter. Diese ist während der Stillzeit nicht fertil ⇒ spacing zwischen den Geburten. Heute ist diese Schutzfunktion obsolet. Beim rezenten Menschen deutlich verkürzt. 2. Childhood (Kindheit bis 7 J.): Gekennzeichnet durch die Fähigkeit, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Voraussetzung: breite Backenzähne. Durch diese Fähigkeit sinkt die Abhängigkeit von den Eltern, die Verantwortung für die Ernährung des Kindes wechselt von der Mutter auf die Blutsverwandten. Beim rezenten Menschen deutlich verlängert. 3. Juvenility (Jugend bis 15 J.): Zwischen Kindheit und sexueller Reife. Typisch für alle Säuger mit Sozialleben: Hinausgleiten aus elterlicher Kontrolle hinein in ein Netz Gleichartiger, Gleichaltriger meist Gleichgeschlechtlicher. 3 4. Adolescence (nach Pubertät, vor Erwachsensein): In vielen einfachen Gesellschaften gibt es diese Periode nicht, stattdessen werden Initiationsriten vollzogen. Diese Periode zeichnet den rezenten Menschen besonders aus. Sie ist gekennzeichnet durch körperliche Veränderungen (growth spurt) als Vorbereitung auf Reproduktionsverhalten. Regeln und Rollen für die Partnerwahl werden spielerisch erlernt. Diese Phase dauert heute deutlich länger als in vorindustriellen Gesellschaften. gender intensification: verstärkte Geschlechtsdifferenzierung (aktiv und passiv). 5. Adulthood: Volle Reproduktionsfähigkeit. Die Motivation für das Geschlechtsverhalten ist bei Mann und Frau grundlegend verschieden: • Mann: maximale Verbreitung des eigenen Erbgutes. • Frau: Sorgsamer Umgang mit limitierten Ressourcen (nur je eine Eizelle). Menschliche Charakteristik: Beteiligung des Mannes an Kindeserziehung. Das Alter fehlt in dieser Aufzählung, da früher die Lebenserwartung erheblich kürzer war. Die Evolution setzt immer in den Sexualphasen an, da postreproduktive Lebensabschnitte kaum modifiziert bzw. optimiert werden können. In vorindustriellen Gesellschaften gebaren Frauen bis zur Menopause und kümmerten sich dann um Enkelkinder (Großmutter-Faktor). Nach der Themenübersicht: 1. Entwicklungspsychologie der Lebensspanne: Grundpositionen a) Kontextualistisches Modell der Lebensspanne Sozial-kognitive Entwicklung In den ersten drei Lebensjahren hat Bindung die Funktion, Mortalität zu verhindern. In der Adoleszenz vollzieht sich ein Wandel von Art (Eltern⇒Gleichaltrige) und Bedeutung: Erwerb von sozial-kognitiven Kompetenzen. • Modell der Module: hierarchisch organisierte Fähigkeiten verschiedener Domänen. Beispiele: social ⇒ individual ⇒ Sprache, Gesichtsverarbeitung, theory of mind bzw. ecological ⇒ biological ⇒ flora, fauna... Die einzelnen Module sind alle angelegt, entwickeln sich aber abhängig von der Umwelt. Beispiel: Großstadtkinder können nicht zwischen verschiedenen Pflanzenarten differenzieren, dafür aber vielleicht besser Gesichter erkennen. Die Module sind primäre biologische Fähigkeiten. Darauf bauen sekundäre auf. Erstere müssen nicht erlernt werden, letztere schon. Beispiel: angeborene Tendenz zur Kommunikation vs. kulturell erlernte Fähigkeit der Mathematik. Für die Beherrschung sekundärer Fähigkeiten sind externe Motivationen (Lernanreize) nötig. Lebensspannen-(Entwicklungs-)Psychologie Die Lebensspanne ist eine kulturelle Vorstellung. Früher ging man von einer klaren Dichotomie, bestehend aus Aufbau im Jugendalter (Entwicklungspsychologie) und Abbau im Alter (Gebiet der Gerontopsychologie), aus. Diese simple Art der Unterteilung wurde durch die Wissenschaft der vergangenen drei Jahrzehnte allerdings revidiert. So erfolgt einerseits der Abbau schon früher (Fähigkeit Sprache zu lernen), andererseits findet in bestimmten Bereichen auch ein lebenslanger Aufbau statt (z.B. Spiritualität im Alter). Abbau kann auch sinnvoll und evolutionär gewollt sein, beispielsweise muss Spielverhalten aufgegeben werden, um im Erwachsenenleben bestehen zu können. Der Vertreter der Lebensspannenpsychologie ist Prof. Paul Baltes. Dessen Grundannahmen lauten: Evolutionary selection: Need for culture: increases decreases with age with age 1) 2) Efficiency of culture: decreases with age 3) 4 Life span Life span Life span 1) Mit fortschreitendem Alter verringern sich die evolutionären Selektionsvorteile, man kann also besonders nach dem Ende der Fertilitätsspanne immer weniger davon ausgehen, dass das „Vorgefundene von der Evolution so gewollt war.“ (Prof.) Die meisten Individuen verstarben, bevor ihre negativen genetischen Attribute manifest wurden. 2) Die Notwendigkeit, die Entwicklung durch Kultur zu befördern, steigt im Laufe des Lebens an. Kultur meint dabei sämtliche psychologische, soziale, materielle und technologische Ressourcen, die Menschen entwickelten (vom Gehstock bis zur künstlichen Hüfte). Ein Säugling benötigt keine kulturellen Errungenschaften, er kann bis zu 10 Tage ohne Nahrung überleben. 3) Effektivität der Kultur sinkt mit Alter. Es muss folglich immer mehr Aufwand betrieben werden, um das gleiche Resultat zu erzielen. Die Plastizität (Anpassungsfähigkeit) lässt nach und wird durch kompensatorische „kulturelle Prothesen“ (Prof.) ersetzt, die allerdings immer weniger Defizite auszugleichen vermögen. Hauptaufgabe der Lifespan Psychology ist die Ergründung der Ursachen veränderter Plastizität, sowohl intra-, als auch interindividuell. Einige Prinzipien der LP: • Entwicklung vollzieht sich lebenslang • Entwicklung ist multidirektional (kognitiv, emotional, motivational...) • Entwicklung ist plastisch • Entwicklung ist kontextualistisch (historisch, sozial u.Ä.) ⇒ Notwendigkeit der Interdisziplinarität Drei Ziele der Ontogenese – Anpassungsaufgaben: a) Wachstum: Verhaltensweisen, die höhere Funktionalität oder Adaptivität ermöglichen b) Erhaltung: Verhaltensweisen, die angesichts neuer Herausforderungen Funktionalität gewährleisten oder diese nach deren Verlust wiederherstellen c) Regulation von Verlust/ Kompensation: Verhaltensweisen, die nach einem Verlust an Ressourcen das adäquate Funktionieren auf niedrigerem Niveau gewährleisten Suboptimale biologische Bedingungen sind die Triebfeder kultureller Entwicklung. Multidimensionalität am Beispiel von Intelligenz: Allgemein ist Intelligenz die Fähigkeit, Redundanz zu erkennen. Es gibt zwei Komponenten der Intelligenz: pragmatische/kristalline und mechanische/fluide Intelligenz. Die Pragmatik ist kulturabhängig und erfahrungsbasiert. Sie steigt über die Lebensspanne, die Steigung nimmt allerdings ab. Die Mechanik ist universell und genetisch prädisponiert. Sie nimmt bereits ab der Mitte der 2. Lebensdekade ab, die Geschwindigkeit des Abbaus steigt im Alter. Beide Komponenten sind komplementär. Die Gesamtleistung ist nicht durch die Betrachtung nur einer Komponente erfassbar: je mehr Wissen und Erfahrung (=Pragmatik) man besitzt, desto mehr kann man auf Mechanik (z.B. schnelle Informationsverarbeitung) verzichten. Beispiel: Der Umgang mit einer Trennung vom Partner fällt mit 50 oft leichter als mit 30, da man mehr Lebenserfahrung besitzt (erlernte Reaktionsweisen). Lebensverlauf Entwicklung als Verhältnis von Gewinn und Verlust: Das Verhältnis von Gewinn und Verlust (v.a. an Plastizität) verschiebt sich im Laufe des Lebens zugunsten der Verluste. Dieses Verhältnis ist allerdings niemals 0:1 oder 1:0. Diese Tatsache ist empirisch belegt, es bestehen aber bedeutende inter- und intraindividuelle Differenzen. 5 S-O-K-Modell Welcher Mechanismus steht hinter der Veränderung von Plastizität, was ist der Motor für Entwicklung? Laut Baltes ist es allgemein die Interaktion mit der Umgebung, die Entwicklung bedingt. Er postuliert drei dafür relevante Prozesse: a) Selektion: z.B. Informationsauswahl und Informationsverarbeitung b) Optimierung: Prozess der Aneignung, Festigung und Erhaltung von effektiven Methoden zum Erreichen wünschenswerter Ziele und zur Vermeidung von nicht Wünschenswertem. c) Kompensation (Zwei Arten): 1. Einsatz neuer Strategien zum Erreichen des selben Zieles 2. Veränderung des Ziels aufgrund eines Verlustes an Fähigkeiten Beispiel: der 80-jährige Pianist Arthur Rubinstein a) beschränkt sich auf wenige Stücke, b) übt diese Stücke öfter, c) um seinem Verlust an Geschwindigkeit entgegen zu wirken, spielt er vor schnellen Segmenten einfach langsamer. Jutta Heckhausen: Studie zur Erwünschtheit und subjektiven Zuordnung zu Lebensaltern von Persönlichkeitseigenschaften. Ergebnis: Negative Korrelation zwischen geschätztem Auftretensalter von Eigenschaften und deren Erwünschtheit (r=-.68). Beispiel: „Mit 60 wird man geizig, mit 33 ist man schon erfolgreich.“ Allerdings werden auch einige positive Eigenschaften (weise, würdevoll) dem hohen Alter zugeschrieben. 3. Vorlesung vom 02.05.2006 PD Dr. Martin Pinquart in Vertretung für Prof. Silbereisen Nach der Themenübersicht: 1. Entwicklungspsychologie der Lebensspanne: Grundpositionen a) Kontextualistisches Modell der Lebensspanne 1. Plastizität Plastizität besteht über die gesamte Lebensspanne hinweg. Man unterscheidet zwischen Ausgangskapazitätsreserve und Entwicklungskapazitätsreserve. Erstere ermöglicht einen Leistungszuwachs aufgrund der Optimierung von Umweltbedingungen, z.B. optimale Raumtemperatur oder Geräuscharmut. Die Entwicklungskapazitätsreserve ist das Potential an Leistungszuwachs, das durch Training, z.B. Lernen, genutzt werden kann. Dazu Experiment von Paul Baltes mittels des „Testing the limits“-Paradigma: Den Versuchspersonen wurde an Hand von 40 Orten in Berlin eine Route vorgegeben, an Hand derer sie Begriffe memorieren sollten. 6 Erinnerte Wörter Jüngere Ältere Übungszeit in h Die Ortsmethode erlaubt einen deutlichen Lernzuwachs. Es zeigt sich, dass ältere Erwachsene mit der neuen Methode nicht so erfolgreich Wörter memorieren konnten wie jüngere. Aus diesen Befunden lässt sich folgern, dass die Plastizität mit zunehmendem Alter abnimmt. Weiterhin zeigt die Grafik, dass die Plastizität limitiert ist und im höheren Alter dieses Maximum früher erreicht wird. 2. Kontexte Paul Baltes sagt: „Entwicklung ist eingebettet in Kontexte“, z.B. biologische, soziale und historische Kontexte. Es gibt drei Arten von Einflüssen: 1. Altersspezifische Einflüsse Gemeint sind oft biologische Einflüsse, die in bestimmten Entwicklungsabschnitten eintreten. Sie sind universell und betreffen nahezu alle Individuen. Beispiel: Reifungsprozess des Laufen Lernens, auch nicht-biologischer Einfluss wie Einschulung. Konsequenz: Individuen werden einander ähnlicher 2. Kohortenspezifische Einflüsse Eine Kohorte ist eine Gruppe von Personen, die in einem bestimmten Zeitraum und in einem gemeinsamen kulturellen Umfeld geboren wurde. Beispiele: die Kohorte der Kinder, die nach der Wende 1990 geboren wurde, wird vom sozialen Wandel anders beeinflusst als die vor der Wende Geborenen Ein weiteres Beispiel ist der Flynn-Effekt (IQ alle 10 Jahre steigt um 3 Punkte an), infolgedessen sich Kohorten (und damit die enthaltenen Individuen) werden einander unähnlicher 3. Nicht-normative Einflüsse: Einflüsse, die in jedem Altersabschnitt auftreten können und nur einzelne Individuen betreffen. Beispiel: Lotteriegewinn, Unfall Konsequenz: Unähnlichkeit zwischen Individuen Die Tatsache, dass Entwicklung von derart vielen Faktoren beeinflusst wird, erfordert eine multidisziplinäre Perspektive. Auch Wissenschaften wie Soziologie, Biologie, Neurophysiologie, Pädagogik und andere Fächer müssen einbezogen werden. Daher wird heute oftmals von developmental science statt von Entwicklungspsychologie gesprochen. Nach der Themenübersicht: 1. Entwicklungspsychologie der Lebensspanne: Grundpositionen c) Bedeutung sozialer Beziehungen 3. Die Rolle früher Erfahrungen Zur Veränderbarkeit psychischer Eigenschaften bestehen zwei konträre Annahmen: das Konzept der sensiblen Phase auf der einen, das Konzept lebenslanger Plastizität auf der anderen Seite. 7 Ersteres geht davon aus, dass frühe und frühste Erfahrungen entscheidend und praktisch irreversibel prägend wirken („Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr!“). Je jünger und unreifer das Kind, desto stärker wirke eine Erfahrung. Beispiel: Fixierung und psychosexuelle Entwicklung bei Freud, Prägungslernen bei Lorenz (Mutterbild: Versuchsleiter als Gänsemutter), frühkindliche Deprivation bei René Spitz (vernachlässigte Heimkinder retardierten). Dem steht die aus der Entwicklungspsychologie stammende modernere Annahme lebenslanger Plastizität entgegen, der zufolge Entwicklung während der gesamten Lebensspanne möglich ist. (Fehl-) Entwicklungen seien daher zu einem gewissen Grade korrigierbar. Für diese Auffassung erbrachte die Forschung in den letzten Jahren immer mehr Anhaltspunkte. Beispiel: Eine Studie von Michael Rutter et al. aus den 1990er Jahren an rumänischen Waisenhauskindern untersuchte das Entwicklungspotenzial der aus widrigen Verhältnissen stammenden Kinder nach einer Adoption in englische Mittelstandsfamilien. Dabei zeigte sich, dass die vorhandenen Defizite größtenteils (wenn auch nicht immer vollständig) kompensiert werden konnten – und zwar umso besser, je jünger die Kinder zum Zeitpunkt der Adoption waren. Weiterhin zeigte sich, dass die Bedeutung eines Einflusses nicht zwingend umso größer ist, je früher er erfolgt. Stattdessen existieren für Entwicklungsprozesse bereichsspezifische Zeitfenster und die Auswirkung von Einflüssen hängt von deren Intensität und Dauer ab. Beispielsweise bildet sich eine Mutter-Kind-Bindung erst zwischen dem 12. und 36. Lebensmonat heraus. Kinder, die innerhalb ihres ersten Lebensjahres adoptiert wurden, entwickelten keinerlei Bindungsstörungen. Fazit: Die Annahme, dass die frühe Kindheit wichtig für die spätere Entwicklung sei, ist zwar zutreffend. Allerdings sind frühe Erfahrungen keineswegs determinierend für das spätere Leben. Gerade in einer neuen Umgebung können neue Entwicklungsprozesse angestoßen werden. Nach der Themenübersicht: 1. Entwicklungspsychologie der Lebensspanne: Grundpositionen b) Bedeutung sozialer Beziehungen Vier Grundsätze von Reis et al. (2000): 1. soziale Kontexte treten mit anderen Kontexten, z.B. biologischen, sowie mit Verhalten in Wechselwirkung. Bei der Beobachtung von Entwicklung registriert man schon bei Neugeborenen eine gewisse Reaktionsbereitschaft auf soziale Reize. Es gibt Hinweise dafür, dass soziale Beziehungen sogar auf die neuronale Entwicklung einwirken können. Belege dafür stammen aus Tierexperimenten: Lässt man Ratten isoliert oder in Gemeinschaft aufwachsen (restringierte vs. normale Umwelt), beobachtet man unter letzterer Bedingung eine stärkere Gehirnentwicklung (v.a. mehr und stärkere Synapsen, vgl. Hebb-Regel). Ferner ist ein Zusammenhang von sozialer Unterstützung und Morbidität bzw. Mortalität erwiesen. Soziale Einbettung wirkt lebensfördernd. Mögliche Mechanismen sind entweder die direkte Beeinflussung über physiologische Prozesse oder die indirekte Einflussnahme des Umfeldes auf das Gesundheitsverhalten. 2. Soziale Beziehungen treten in Wechselwirkung mit der übergeordneten sozialen und physikalischen Umwelt und bilden gemeinsam mit diesen eine ökologische Nische. Beispiel: Kinder aus Hochrisikoumwelten (z.B: Krieg, Katastrophe) stehen stärker unter elterlicher Kontrolle und zeigen später selbst ein höheres Maß an elterlicher Kontrolle. 3. Interaktion von sozialen Beziehungen und Kulturen, d.h. Einbettung der ökologischen Nische in ein übergeordnetes kulturelles System. Beispiel: Heutzutage wird in westlichen Ländern bei der Erziehung mehr Wert auf Selbstständigkeit gelegt, weil Kinder nicht mehr als Altersvorsorge benötigt werden. 8 4. Alle diese Systeme entwickeln sich simultan und beeinflussen sich über die Zeit hinweg. Die Bedeutung von Sozialpartnern ändert sich. Die Beziehungen zu Erwachsenen werden zunehmend symmetrischer und die Bezugspersonen werden selbst gewählt. Nach der Themenübersicht: 2. Entwicklungssysteme und Grunddeterminanten 2.1 Alterskorrelierte Veränderungen und historischer Wandel a) Demographische Entwicklung Demographische Entwicklung Es gibt zwei Arten von Veränderungen des Kontextes: Graduelle Veränderungen (z.B. demographischer Wandel) und plötzlich eintretende Ereignisse (Mauerfall, Wirtschaftskrise). Demographischer Wandel: Welche für die Entwicklungspsychologie relevanten Auswirkungen hat der demographische Wandel? Mögliche Fragestellungen wären z.B.: - Welche Konsequenzen hat der erhöhte Anteil von Einzelkindern für das soziale Gefüge? - Sind die sozialen Kompetenzen von Einzelkindern geringer? - Wie wirken sich Zuzug und Wegzug aus? - Welche Auswirkungen hat die erhöhte Lebenserwartung? Statistische Anhaltspunkte: - Geburtenrückgang zwischen 1970 und 2003 in Deutschland liegt voll im internationalen Trend der Industriestaaten - Seit 1970 liegt die Geburtenrate in Westdeutschland pro Frau immer zwischen 1,4 und 1,5 Kindern - In der DDR gab es ca. 1980 einen Höchststand von 1,9 Kindern pro Frau und 1994 ein Tief von 0,8 Kindern pro Frau - Heute besteht in Ostdeutschland ein akuter Frauenmangel - Der Zuzug von Ausländern ist sehr stark von der Politik bestimmt, z.B. Anwerbestopp (1973) und Asylgesetzgebung (1993) - Die Lebenserwartung für Neugeborene im Jahre 2050 beträgt 81 Jahre für Männer und 86 Jahre für Frauen - 1970 kamen vier 20-bis-60-Jährige auf einen über 65-Jährigen, 2040 werden es voraussichtlich nur noch zwei sein Nach der Themenübersicht: 2. Entwicklungssysteme und Grunddeterminanten 2.1 Alterskorrelierte Veränderungen und historischer Wandel b) Historische Einflüsse auf Entwicklung – Konzepte Plötzlich eintretende Ereignisse: Exemplarisch dafür sind die Studien von Glen H. Elder, einem US-amerikanischen Soziologen, der die Auswirkungen von sozialem Wandel auf individuelle Entwicklung untersucht hat. 9 Abbildung stellt die Verbindungsmechanismen zwischen sozialem Wandel und Individuen dar. 5 Einwirkungsmöglichkeiten sozialen Wandels auf die individuelle Entwicklung (Elder & Caspi, 1990): 1. Kontrollzyklen: Sozialer Wandel führt zu einem Kontrollverlust des Einzelnen, der mit einem Versuch zur Rückgewinnung der Kontrolle reagiert. Erfahrungen und Erwartungen aus der alten Gesellschaftsform funktionieren unter den neuen Bedingungen nicht mehr. 2. Situationale Imperative: Der Wandel schafft neue Anforderungen 3. Akzentuierungsprinzip: Der Wandel führt zu einer Zunahme interindividueller Differenzen, wenn mit ihm nicht auch klare Verhaltensnormen einhergehen. Bei einer Konfrontation mit unbekannten Situationen, wird häufig auf altbewährte Verhaltensweisen zurückgegriffen. Zum Beispiel: Väter, die schon vor dem Wandel dazu neigten, zu dekompensieren (Kinder schlagen), zeigten im Zuge des sozialen Wandels gehäuft dieses Verhalten. Väter, die nicht gewalttätig waren, waren auch nach dem sozialen Wandel weiterhin meist nicht gewalttätig. 4. Lebensstadienprinzip: Die Wirkung sozialen Wandels variiert in Abhängigkeit des Lebensstadiums, also des Alters, der Betroffenen. 5. Wechselseitig abhängige Leben: Die Veränderungen eines Individuums beeinflussen auch die anderen Mitglieder des Systems, z.B. die Familienmitglieder. Die wichtigste Studie in diesem Gebiet ist „Children of the Great Depression“ (Elder, 1974, 1976). Die Fragestellung lautete, ob und welcher Weise sich Krisenbedingungen auf familiäre Beziehungen und die Entwicklung von Kindern auswirken. Dazu wurden zwei Gruppen von Kindern und Jugendlichen untersucht: 1. Kinder aus der Oakland Growth Study, 1920/21 geboren 2. Kinder aus der Berkeley Guidance Study, 1928/29 geboren Als Krisenbedingung wurde ein Einkommensverlust von mindestens 30 % definiert. Es erfolgte ein Vergleich mit weniger stark betroffenen Familien. Ergebnisse: In Krisenfamilien wurde eine Anpassung nötig, weil der Vater oftmals arbeitslos geworden war oder Einkommenseinbußen hinnehmen musste. Somit mussten die anderen Familienmitglieder, insbesondere Ehefrau und Söhne, Geld hinzuverdienen. 10 Die Geschlechterunterschiede fanden sich in Studien aus den 1980er Jahren nicht mehr, da die Geschlechterrollen sich gewandelt hatten. Nach der Themenübersicht: 2. Entwicklungssysteme und Grunddeterminanten 2.1 Alterskorrelierte Veränderungen und historischer Wandel c) Historische Einflüsse auf Entwicklung - Beispiele Elder beschäftigte sich später vor allem mit der Auswirkung von Kriegen. Je nach Zeitpunkt des Eintretens in den Militärdienst stellten sich die Entwicklungsaussichten als günstiger oder weniger günstig dar. Die Effekte des Kriegsdienstes auf früh eingezogene Männer (bis ca. 20 Jahre) schienen eher positiv: Sie hatten günstigere soziale und berufliche Entwicklungsaussichten, z.B. ermöglichte ihnen das Militär ein kostenfreies Studium. Spät eingezogene Männer, bei denen Entwicklungsstränge unterbrochen wurden, erfuhren vor allem die negativen Effekte. Diese Kohorte wies eine erhöhte Scheidungsrate, negative Gesundheitsfolgen sowie oftmals einen sozialen Abstieg auf. Fazit: Je nach Passfähigkeit einer historischen Entwicklung für ein Individuum ergeben sich unterschiedliche Konsequenzen. 4. Vorlesung vom 09.05.2006 Nach der Themenübersicht: 2. Entwicklungssysteme und Grunddeterminanten 2.1 Alterskorrelierte Veränderungen und historischer Wandel c) Historische Einflüsse auf Entwicklung– Beispiele 11 Der demographische Wandel ist ein Phänomen der postindustriellen Gesellschaften. Dort wird er als Bedrohung wahrgenommen, da er oft unvorhersehbare Konsequenzen für das Individuum hat, nämlich die Erhöhung der Fluidität und Flexibilität. Während in diesen Gesellschaften das Bevölkerungswachstum stagniert bzw. negativ ist, findet sich in Entwicklungsländern das gegenteilige Phänomen. Für die Entwicklungspsychologie sind die Auswirkungen der historischen Veränderungen auf die Entwicklung von Menschen relevant. Die Idee zur Betrachtung historischer Einflüsse auf Entwicklung stammt aus der frühen Migrationsforschung. Glen H. Elder, gleichsam der Urvater dieser Forschungsrichtung, bezog sich auf das Werk eines polnischen Wissenschaftlers „The Polish Peasant in America“. Die Hauptaussage des Werkes war: Wenn die eigenen Befähigungen den Änderungen der Umweltanforderungen, wie sie historischer Wandel mit sich bringt, nicht mehr genügen, müssen aktive Anpassungsleistungen erbracht werden. Radikale historische Veränderungen können einen turning point für die Entwicklung eines Individuums darstellen. Historische Entwicklungen haben die Befähigung, lange angelegte Entwicklungspfade massiv zu beeinflussen. Entscheidend ist der Schnitt mit der Umwelt. Wenn eine Kombination glücklicher Umstände eine Lösung von der Vergangenheit bietet, kommt die Plastizität zum Tragen. In jedem Menschen steckt das Potenzial zu positiver Entwicklung. Artikel: Sampson, R. J. und Laub, J. H. (1996) Socioeconomic Achievement in the Life Course of Disadvantaged Men: Military Service as a Turning Point, Circa 1940-1965 In den 1920er Jahren führten Sheldon und Eleanor Glueck, ein deutsches Immigrantenehepaar, eine kriminologische Studie (ein Amalgam aus Soziologie, Psychologie, Kriminologie) durch. Sie untersuchten Jugendliche in einem Problemviertel Bostons. Dabei wuchsen die Kinder der einen Gruppe in Zuchtanstalten (Kinderheim) auf, die der anderen in ihren (problematischen) Familien. Die Heimkinder waren erheblich delinquenter (krimineller) als die Kontrollgruppe. Sampson und Laub griffen die Idee auf, führten die Studie bis zum Tod der Probanden fort und werteten die Daten aus. Untersucht wurden die Auswirkungen des Kriegsdienstes im Zweiten Weltkrieg auf die Entwicklung der Subjekte. Wie verliefen die Schicksale, was wurde aus den ehemaligen Kriminellen und Nicht-Kriminellen nach dem Krieg? Die Annahmen der Autoren waren folgende: 1. Ein gewonnener Krieg mit anschließendem Wirtschaftsboom müsste auf alle Subjekte positiv wirken. 2. Die vorher am schlechtesten gestellten und kriminellsten Subjekte müssten die größten positiven Effekte erfahren. 3. Die Auswirkungen müssten umso stärker sein, je früher die Subjekte eingezogen wurden. Delinquente müssten gemäß Annahme 2 dabei eine noch größere Verbesserung erfahren. (Prof.). Die Methode der Untersuchung: Vergleich von SES der beiden Gruppen vor und nach dem Militärdienst unter Kontrolle verschiedener Einflüsse der Ausgangssituation: Allein der IQ hatte einen bedeutsamen Einfluss: hohe Intelligenz verbessert die Aussichten auf hohen SES. Andere Variabeln (SES der Familie) spielten kaum eine Rolle. Ergebnisse: 1. Nein, nur einige signifikante Effekte – also keine generellen positiven Effekte. 2. Ja, wenn sie nicht während des Militärdienstes weiter delinquent waren (official charges) 12 3. Bedingt richtig. Nur Delinquente erfuhren positive Effekte durch den frühen Einzug, aber auch nur dann signifikant, wenn sie gleichzeitig die GI Bill (Bildungsmöglichkeiten) erhielten. „Overseas deployment“ hatte nur für die Delinquenten einen signifikant positiven Effekt. Eine mögliche Erklärung ist, dass durch den abrupten, völligen Bruch mit der Vergangenheit sich für sie die Möglichkeit zur Ausschöpfung ihres vorher „schlummernden“, durch widrige Umweltbedingungen gehemmten Potenzials ergab. Ebenso hatte der Erhalt einer GI Bill nur für die Delinquenten einen signifikant positiven Effekt, wohl, weil ihr ursprüngliches Bildungsniveau niedriger war. Fazit: Vom Durchschneiden von Entwicklungssträngen profitierten diejenigen Subjekte, welche sich zum Zeitpunkt des Einzugs „außerhalb des Systems“ befanden, also eine ungünstige Entwicklung vollzogen hatten. Subjekte hingegen, deren positiver Entwicklungsstrang hingegen unterbrochen wurden, vermochten nicht zu profitieren, sie waren bereits „im System“. Ganz im Gegensatz dazu, nämlich fast gänzlich negativ, waren die Konsequenzen, die der Vietnamkrieg für die Soldaten hatte. Die Ergebnisse von Laub und Sampson konnten für in Vietnam eingesetzte Soldaten nicht repliziert werden. Diese wurden nach ihrer Rückkehr oftmals sozial geächtet und hatten in vielen Fällen mit einer Verschlechterung ihres SES zu rechnen, auch aufgrund einer folgenden Rezession. Man erkennt klar die Rolle von Kontexten für die Entwicklung. Nach der Themenübersicht: 2. Entwicklungssysteme und Grunddeterminanten 2.2 Interdependenz biologischer und ökologischer Entwicklungssysteme a) Modelle zum Zusammenspiel von Kontext und Person Urie Bronfenbrenner: ökosystemischer Ansatz (Ecological Systems Theory) Bronfenbrenner (1917-2005) fordert, bei der Untersuchung von Entwicklung müssten Kontexte und deren Zusammenspiel differenziert betrachtet werden. Er selbst unterscheidet folgende Ebenen von Kontexten bzw. Systemen: - Mikrokontext: entscheidender Entwicklungskontext, „Keimzelle von Entwicklung“. Ursprünglich stellte für Bronfenbrenner nur die Familie den Mikrokontext dar. Später zählte er auch Peers und andere nahe Bezugspersonen, mit denen intensive Interaktion stattfindet, dazu. Beispiel: Proximaler Prozess des Vorlesens durch die Eltern - Exokontext: Ein Kontext, von dem man zwar beeinflusst wird, dessen aktiver Teil man jedoch selbst nicht ist (Stadt, Arbeit des Vaters, etc.) - Makrokontext: Technologien, Informationsgesellschaft - Chronokontext: alle Kontexte unterliegen ihrerseits einem zeitlichen Wandel - Mesokontext: Schnittmengen von Kontexten Bronfenbrenner fordert zur Untersuchung von Entwicklung ein Design, in dem Person, Prozess und Kontext berücksichtigt werden. Beispiel: Ein Jugendlicher (Person) aus einer zerrütteten Familie (Kontext) erhält mit der intensiven Förderung durch eine Bezugsperson (Prozess) die Chance zu positiver Entwicklung. Bedeutsame Personenmerkmale für eine optimale Nutzung von kontextuellen Bedingungen: a) Persönliche Eigenschaften (Selbstwirksamkeit, Intelligenz, Temperament): Interindividuelle Unterschiede, die es einem erlauben, in einer Situation mehr oder weniger zu erreichen. 13 b) Entwicklungsanregende Charakteristika. Dazu zählt z.B. Ichresilienz (etwa Coolness), ein angenehmes Äußeres. Intelligenz ist dabei Konstruktionskompetenz, d.h. „die Fähigkeit, Ordnung in Unordnung zu bringen“ (Prof). Selbstwirksamkeit (self efficacy) meint eine Art von Optimismus, nämlich die Überzeugung, selbst etwas erreichen zu können. Artikel: Lerner, R.M. (1991). Changing Organism-Context Relations as the Basic Process of Development: a Conceptual Framework and Some Speculative Propositions Laut diesem Modell von Lerner, der sich auf Bronfenbrenner stützt, sind Kontexte ähnlich einer Zwiebel aufgebaut. Die äußerste Schicht stellt dabei die Kultur dar (bei uns: Individualkultur). Die nächste Schicht entspricht Gesellschaftssystemen (bei uns: Kapitalismus). Die innerste der drei äußeren Schichten ist die Gemeinschaft (community, z.B. eine Schwarzwaldgemeinde). Das System wandert über die Zeit. Die Individuen befinden sich willentlich und unwillentlich gleichzeitig in verschiedenen Kontexten. Kontextueller Interaktionismus (geprägt von Lerner): Bei der Untersuchung eines Aspekts von Entwicklung müssen alle anderen Kontexte kontrolliert werden, da Entwicklung ein „moving target“ ist. Niemand kann sie als Ganzes untersuchen. Diesem Modell fehlt eine biologische Perspektive, deren Einbezug jedoch vollzieht Gottlieb vollzieht. 14 Artikel: Boyce, W.T., Frank, E., Jensen, P., Kessler, R., et al. (1998). Social Context in Developmental Psychopathology: Recommendations for Future Research from the MacArthur Network on Psychopathology and Development. 1. Kontexte sind ineinander verschränkt und multidimensional Zwischen Kontexten bestehen funktionelle (Qualität der Struktur – gute oder schlechte Kinderbetreung) und strukturelle Unterschiede (welche Schule, Nachbarschaft, viele vs. wenige Freunde). 2. Kontexte verbreitern sich, differenzieren sich und vertiefen sich mit dem Alter, wobei ihre Auswirkungen spezifischer werden. Die fundamentalen Kontexte sind Grundlagen wie Nahrung, Wärme, Sicherheit. Je mehr sich Kontexte verbreitern, desto weniger fundamental sind diese zusätzlichen Kontexte. Jungen verbreitern ihre Kontexte konzentrisch, Mädchen im Sinne von sicheren Korridoren. Vertiefung meint das Anwachsen der Ansprüche an Kontexte. Beispiel: Intensivierung von Beziehungen innerhalb des eigenen Dorfes. 3. Kontext und Kinder beeinflussen sich wechselseitig. Kontexte evozieren Verhalten und Kinder gestalten Kontexte. Beispiel: Jugendliche mit Bierflaschen besetzen einen Kinderspielplatz und modifizieren dadurch den Kontext der dort spielenden Kinder 4. Die Bedeutung eines Kontextes wird weniger durch die „objektive“ Beschaffenheit als vielmehr durch die subjektive Wahrnehmung bestimmt. Entscheidend dafür ist die Fähigkeit des Kontextes, fundamentale Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen. 5. Unklar: Contexts should be selected for assessment in light of specific questions or outcomes Artikel: Super, C.M., & Harkness, S. (1986). The Developmental Niche: a Conceptualization at the Interface of Child and Culture. Super und Harkness sind Anthropologen und vergleichende Kulturforscher. Ein besonders wichtiger Kontext für die Entwicklungspsychologie ist die Kultur. Es gilt, herauszufinden, welche Teile von Kontexten eine menschliche Universalie darstellen und welche kulturell bedingt sind. In der developmental niche finden die proximalen Prozesse statt (Prof.). Sie ist charakterisiert durch die folgenden Eckpunkte: 1. physisches Setting. Beispiele: Julian Silbereisen hat ein großes Zimmer, in welchem abends die Jalousien herunter gelassen werden. Die Kinder des kenianischen Kipsigi-Stammes schlafen nachts bei ihren Müttern und sind tagsüber alleine. Ihr weniger und unregelmäßiger Schlaf ist kein Entwicklungsrückstand, sondern lediglich ein anderes physisches Setting. 2. cultural customs: unbewusste, aber fest verankerte kulturelle Gewohnheiten, die massiv den Entwicklungsgradienten beeinflussen. Beispiel: in einigen Kulturen ist es üblich, Kinder in Tüchern zu tragen. So fortbewegte Kinder haben ein anderes visuelles Feld und erfahren eine größere motorische Stimulation als Kinder, die in Kinderwägen geschoben werden. Ihr Wachstum und ihre motorische Entwicklung sind aufgrund dieser Stimulation beschleunigt ⇒ Plastizität des Genoms durch An- und Abschalten von Genen (Exons/Introns) 3. Naive Psychologie/ Ethnotheorien: Überzeugungen von Menschen über Entwicklung. Beispiel: Kipsigis glauben, dass Schweigen besser als Sprechen sei. Daher verläuft die Sprachentwicklung ihrer Kinder langsamer (aber nicht zwingend schlechter) als bei uns, die wir glauben, permanent mit unseren Kindern kommunizieren zu müssen. Artikel: Scarr, S. (1993). Biological and Cultural Diversity: The Legacy of Darwin for Development. 15 Eine heute akzeptierte Vorstellung besagt, dass hinter Verhalten neuronale Aktivität stecke. Umwelt und Genom beeinflussten sich gegenseitig. Beispiel: Dass Jugendliche in der Pubertät plötzlich risikofreudiger sind, liegt an Veränderungen in bestimmten Hirnregionen, die erhöhte Neugier verursachen. Neu ist die Annahme folgender Wirkkette: Umwelt beeinflusst Verhalten, Verhalten beeinflusst das Gehirn und das Gehirn wirkt über das Verhalten auf die Gene zurück, indem die neuronale Aktivität das An- und Ausschalten von Genen triggert. Gemäß dieser Annahme ändert die Umwelt also nicht nur das Verhalten, sondern über die beschriebenen „Umwege“ sogar das Genom. Umwelt wird dadurch gleichsam vererbt. Grafik: Bidirectional Influences Scarrs Einwand, für welchen sie von Bronfenbrenner kritisiert wurde, lautet stark vereinfacht: „Die Umwelt muss nur gut genug sein.“ Genauer bedeutet dies: Über weite Bereiche der Qualität von Kontexten kommt es gar nicht darauf an, was speziell angeboten wird, es muss nur gut genug sein (Prof.). Gleiches gilt für die Quantität. Grafik: Anlage-Umwelt-Interaktion Das genetische Potenzial bestimmt das Entwicklungspotenzial. Über einen weiten Teil der Ausprägungen der Umwelt ist das Resultat (die Kurve) asymptotisch. Je größer das genetische Potenzial, desto besser das Resultat – jedoch nur bis zu einer bestimmten Grenze. Dies gilt laut Scarr nur für artspezifische Verhaltensweisen (wie Laufen, Sprechen). Daneben nimmt sie die Existenz kulturoptimierter Verhaltensweisen (Schrift, Mathematik) an. Scarrs Theorie hat weit reichende Konsequenzen für die politische Debatte. Für eine Reform des Bildungssystems ist die Frage, „Was ist schlechter als groß genug?“ von großer Bedeutung. Ist die Hauptschule oder eine allein erziehende Mutter schlechter als gut genug (Prof.)? (Wie die nächste Vorlesung zeigen wird, liegt Scarr mit ihrer Annahme richtig.) 16 5. Vorlesung vom 16.05.2006 Nach der Themenübersicht: 2. Entwicklungssysteme und Grunddeterminanten 2.2 Interdependenz biologischer und ökologischer Entwicklungssysteme b) Genetik und Entwicklungspsychologie Exkurs: PISA-Studie Die 2003 durchgeführte PISA-Studie ist ein Querschnitt. Erhoben wurden Daten zur Kompetenz der zu diesem Zeitpunkt 15-Jährigen aus 27 Nationen in diversen Schulfächern. Für Deutschland bedeutsam ist im Hinblick auf die aktuelle Integrationsdebatte vor allem die Betrachtung der Leistung von Migrantenkindern. Schüler, die in Deutschland geboren wurden (2. Generation) schneiden in der Studie schlechter ab als Schüler, die nicht in Deutschland geboren wurden (1. Generation). Daraus wurde nun in unzulässiger Weise gefolgert, dass die Leistung von einer Einwanderergeneration zur nächsten abnehme. Dies wurde je nach Gusto als Anzeichen für eine geringe Integrationsbereitschaft seitens der Immigranten oder als gescheiterte Integrationspolitik gedeutet. Derartige Schlussfolgerungen sind allerdings nicht möglich, da hier ein Kohortenvergleich als Längsschnittstudie aufgefasst wird. Diese Annahme wäre jedoch nur dann zulässig, wenn sich die Struktur der Einwanderer nicht maßgeblich geändert hätte – gerade das ist aber der Fall: Die in erster Generation hier lebenden Schüler haben tendenziell einen bildungsnäheren familiären Hintergrund (z.B. jugoslawische Bürgerkriegsflüchtlinge) als die meist von einfachen Gastarbeitern abstammenden Schüler zweiter Generation (z.B. Ostanatolen). Dies ist ein Beispiel für die Akkulturation an eine neue developmental niche (vgl. vorige Vorlesung: Super and Harkness) unter unklaren Bedingungen (keine klar formulierte Einwanderungspolitik), die sich äußerst schwierig gestaltet. Übertragen auf die Theorie von Sandra Scarr (vgl. vorige Vorlesung), würden die Ergebnisse der PISA-Studie darauf hindeuten, dass die Umwelt für Migranten in Deutschland schlichtweg „nicht gut genug“ ist, wodurch genetische Potenziale nicht genutzt werden können. Genom-Umwelt-Kovariation Artikel: Scarr, S. (1993). Biological and Cultural Diversity: the Legacy of Darwin for Development. In Bezugname auf das Modell Gottliebs (vgl. vorige Vorlesung) unterscheiden Scarr & McCartney (1983) drei Arten der Genom- (bzw. Person-) Umwelt-Kovariation: passiv, evokativ, aktiv. a) passiv: Eltern schaffen eine Umwelt für das Kind, in welcher das von ihnen mitgegebene genetische Potenzial zur Entfaltung angeregt wird. Es liegt also eine optimale Passung von Genom und Umwelt vor. Die jeweiligen Einflüsse von Genom und Umwelt sind in diesem Fall allerdings nicht mehr klar zu trennen, da beide von den Eltern ausgehen. Beispiel: Ein Kind von sehr musikalischen Eltern wird in frühestem Alter mit dem Themenkomplex „Musik“ konfrontiert und entfaltet in der geneigten Familie (Umwelt) sein Talent (Genom). Passive Effekte nehmen mit der Zeit ab. b) evokativ: das Kind ruft durch Verhalten, in welchem sich sein Genotyp manifestiert, Reaktionen der Umwelt hervor. Beispiel: Ein Kind unmusikalischer Eltern fällt durch musikalische Begabung auf und erhält entsprechende Förderung. Evokative Effekte bleiben über die Entwicklungsspanne konstant 17 c) aktiv: der Genotyp einer Person beeinflusst die Umwelten, welche die Person aufsucht. Die Tendenz, aktiv Umwelten zu wählen, die dem eigenen Genom entsprechen, wird “nichepicking“ genannt. Je älter eine Person, desto mehr niche-picking kann sie aufgrund ihrer wachsenden Unabhängigkeit betreiben. Aktive Effekte nehmen also über die Lebensspanne zu. Genom-Umwelt-Kovariation ist mitnichten nur auf positive Anlagen und Verhaltensweisen beschränkt. Genauso kann z.B. auf das Problemverhalten eines Kindes mit rigiden Erziehungsmethoden reagiert werden. Beispiel für eine aktive Umwelt-Genom-Kovariation: IQ-Korrelation von drei Geschwistertypen im Abhängigkeit vom Alter Erläuterung: Geschwister werden sich bis zum Alter von 15 Jahren immer ähnlicher aufgrund der geteilten Umwelt. Zweieiige Zwillinge (ZZ) werden sich bis zu diesem Alter immer unähnlicher. Eineiige Zwillinge (EZ) werden sich bis zum Alter von 15 Jahren immer ähnlicher. Scarrs Erklärung zu den Ergebnissen: Die westlichen kulturellen Taktiken (v.a. Erziehungsstil) gestatten den Kindern mit zunehmendem Alter mehr Freiheit. Mit einer Zunahme an Freiheitsgraden ergeben sich für die Kinder mehr Gestaltungsmöglichkeiten, die sich dann eine ihren Talenten entsprechende Umwelt suchen. Aktive Umwelt-Genom-Kovariation verlangt nach Optionen zur Gestaltung, die Umwelt muss also dafür „gut genug“ sein. Eine Umwelt, die nicht „gut genug“ ist, kann die Entfaltung von Talenten unterdrücken. Eine spätere, bessere Umwelt kann die Entfaltung dieser Talente dann wieder ermöglichen. Beispiel für evokative Genom-Umwelt-Kovariation: Artikel: Ge, X., Conger R.D., Cadoret, R.J. Neiderhiser, J.M. & et. al. (1996). The Developmental Interface Between Nature and Nurture : A Mutual Influence Model of Child Antisocial Behavior and Parent Behaviors Xaxa Ge untersuchte 2 Gruppen von Adoptivkindern im Alter von 12 bis 18 Jahren und deren Adoptiveltern. In der ersten Gruppe war mindestens ein biologischer Elternteil psychiatrisch auffällig. In der zweiten Gruppe (Kontrollgruppe) waren die biologischen Eltern unauffällig. Generell werden Kinder eher „aufwärts adoptiert“, d.h. die Adoptivfamilie hat einen höheren SES als die biologische 18 Familie. Daraus resultiert zwar eine bessere Umwelt, aber die Kinder nehmen die genetische Belastung ihrer psychiatrisch auffälligen Eltern mit. Wichtigstes Ergebnis der Studie: Das Erziehungsverhalten der sozialen Eltern korreliert zu r=.44* mit dem psychiatrischen Status der biologischen Eltern. Wenn die biologischen Eltern psychiatrisch auffällig waren, verhielten sich die sozialen Eltern inkonsistenter, problematischer und negativer dem Kind gegenüber. Dieser harsche Erziehungsstil wird von dem kindlichen antisozialen Verhalten evoziert, welches seine Wurzeln bei den biologischen Eltern hat und über das Genom weitergegeben wurde. Nach der Themenübersicht: 2. Entwicklungssysteme und Grunddeterminanten 2.2 Interdependenz biologischer und ökologischer Entwicklungssysteme b) Biopsychosoziale Prozesse Artikel: Gottlieb, G. (2002). Induction of Behavioral Change in Individual Development as Prelude to Evolution: the Supragenetic Developmental Basis of Evolutionary Change Aus den voraus gegangenen Ausführungen geht hervor, dass die Umwelt eine wichtige Bedeutung für Entwicklung hat – jedoch nur dann, wenn die Einwirkungsmöglichkeiten des Individuums auf die Umwelt gegeben sind. Der Effekt der Umwelt setzt jedoch nicht etwa erst nach einer gewissen Zeit ein, sondern schon von Geburt an wirken sowohl Genom als auch Umwelt auf Entwicklung ein. Gottlieb untersuchte die Nachfolgeprägung bei Enten. Sofort nach dem Schlüpfen aus dem Ei gibt ein Küken Laute von sich, die der Mutter als Signal dienen, das Küken zu versorgen. Analog und induziert durch die Kontaktlaute des Kükens gibt die Mutter ihrerseits Laute von sich, welche für das Küken ein Signal zur Bindung an das Muttertier darstellen. Durch eine Manipulation am Stimmtrakt der noch ungeborenen Küken verlieren diese die Fähigkeit, artgerechte Laute auszustoßen. Daneben wurde verhindert, dass die Küken im Ei arteigene Laute hörten. Gottlieb präsentierte den Küken artfremde Kontaktlaute von Hühnern, woraufhin die manipulierten Küken auch den fremdartigen Tönen folgten. Dies ist ein Anzeichen für die Flexibilität des Genoms: auch in einer nicht optimalen Umwelt gelangt das angelegte Verhalten zur Ausprägung – wenn die Umwelt gut genug ist, d.h. in diesem Fall ausreichende Reize bietet (die Hühner sind unter den Experimentalbedingungen noch „gut genug“). Das Genom ist so flexibel, dass es nicht nur unter den von uns gemeinhin als normal unterstellten Umweltbedingungen das Überleben der Art garantiert. Nach der Themenübersicht: 3. Frühe Kindheit 3.1 Die ersten Monate a) frühe Verhaltensorganisation Überblicksartikel zu 3. (Pflichtlektüre laut Prof.): Rauh, H. (2002). Vorgeburtliche Entwicklung und frühe Kindheit, in: Oerter & Montada (2002), S. 131-208 Film: Zimmer, Katharina (1994). Das Leben vor der Geburt: die seelische und körperliche Entwicklung im Mutterleib. Die Zeit, die das Kind im Mutterleib (ca. 40 Wochen) verbringt, nennt man Gestationszeit. In den ersten 12 Wochen bezeichnet man das entstehende Leben als Embryo, danach als Fötus. Ab dem 20. Tag schlägt das Herz des Fötus und das Blut des Kindes wird vom Blut der Mutter umspült. Es wird mit Sauerstoff angereichert und mit Nährstoffen versorgt aber es findet keine Vermi19 schung des Bluts statt. Auch Drogen oder Gifte können so auf den Fötus/Embryo übertragen werden. Bereits in den ersten Wochen vollzieht sich eine wichtige initiale Gehirnentwicklung. In der sechsten Woche differenzieren sich die Gehirnstrukturen aus einer bläschenförmigen Erweiterung des Neuralrohrs. Ab der 12. Woche ist der gesamte Körper berührungs- und schmerzempfindlich. Ab der 20. Woche ist für den Fötus kaum noch Platz für größere Bewegungen im Mutterleib. Deshalb nimmt das Strampeln und Drehen ab und wird durch andere Sinneserfahrungen, vornehmlich Saugen und Schlucken, abgelöst, die nun trainiert werden. In den letzten Wochen der Schwangerschaft kann der Fötus bereits hören und kann an Geräuschen Emotionen ablesen. Er zeigt außerdem Reaktionen auf und Gewöhnung an externe Reize. Insgesamt kann man sagen, dass das Kind schon pränatal ein soziales Wesen ist, das sofort nach der Geburt fähig ist, soziale Beziehungen aufzunehmen. Frühgeborene: (Film zu Ende, Prof. Silbereisen spricht) Aufgrund des großen Kopfes und der begrenzten Dehnbarkeit des Geburtskanals werden Menschen eigentlich zu früh geboren. Unser Genom erlaubt jedoch eine erhebliche Variation der Tragezeit. Von einer Frühgeburt spricht man, wenn das Baby nach weniger als 37 Wochen zur Welt kommt, oder weniger als 2500 Gramm wiegt. Dies trifft auf 10 % der Kinder zu. Dank den Errungenschaften der neonatologischen Medizin haben heute Kinder, die bei Geburt nur 600 Gramm wiegen, eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 60 %. Diese Kinder sind allerdings erheblich höheren Belastungen ausgesetzt als zum Normzeitpunkt Geborene. Die Umwelt, die Menschen vor ihrer Geburt gewohnt sind, ist der Uterus. Diese reizarme Umwelt hat ihre Besonderheiten, z.B. ist die Schwerkraft praktisch aufgehoben, akustische und optische Reize dringen nur sehr gedämpft bis zum Fötus vor. Wenn die Kinder zu früh aus dieser pränatalen Umwelt gerissen werden, kann dies zu Entwicklungsstörungen führen. Durch eine frühe Konfrontation mit Schwerkraft, Licht und Schall laufen die Entwicklungsvorgänge anders ab. Frühgeborene zeigen im späteren Leben eine veränderte Erregungskontrolle (Aufmerksamkeit, höhere Reizschwelle, Schlaf/Wachrhythmus) sowie geringere kognitive Leistungen und motorische Defizite. Daher wird heute darauf geachtet, die uterinen Bedingungen weitestgehend zu simulieren. Die Tatsache, dass Frühgeborene überleben, ist ein weiterer Beweis für die Plastizität unseres Genoms. Die Vorhersagekraft der vorgeburtlichen Zeit für die späteren Fähigkeiten ist mit Ausnahme dessen, was hier über Frühgeborene gesagt wurde, praktisch null. Artikel: DiPietro, J.A. (2004). The Role of Prenatal Maternal Stress in Child Development. DiPietro untersuchte die Auswirkungen von mütterlichem Stress während der Schwangerschaft auf die Entwicklung des Säuglings. Bei der Mutter wurde durch den Stroop-Test Stress evoziert. Währenddessen wurde das Aktivitätsmuster des Fötus’ registriert. Ergebnis: Ein mittleres Stressniveau der Mutter ist für die Entwicklung förderlich. Führt die Mutter ein normales Leben ohne Ausschläge in Bezug auf Stress, ist dies wohl das optimale Bedingungsgefüge, um beim Kind eine entwicklungsanregende Wirkung zu erzielen. Zu beachten ist, dass der Stresshormone aufgrund der getrennten Blutkreisläufe nicht direkt auf den Fötus übergehen. Vielmehr wird das mütterlicher Stress über mechanische und akustische Faktoren wie eine veränderte Herzfrequenz, Stimme und Bewegung, vermittelt. Artikel: Dondi, M., Simion, F. & Caltran, G. (1999). Can Newborns Discriminate Between Their Own Cry and the Cry of Another Newborn Infant? 20 Dondi untersuchte die Frage, ob die Fähigkeit zur sozialen Anteilnahme bereits genetisch angelegt ist oder erst erworben wird. Dazu untersuchte er die Fähigkeiten zur Empathie bei Neugeborenen, die höchstens drei Tage alt waren. Den Neugeborenen wurden sowohl ihre eigenen Schmerzensschreie als auch die Schmerzensschreie, die durch Blutabnahme aus der Ferse versucht wurden, von anderen Neugeborenen vorgespielt. Dabei wurden die Veränderungen im Gesichtsausdruck der Neugeborenen mittels des MAXSystems (Izard, 1979) erfasst. Zusätzlich wurde mittels eines Schnullers mit Messfühlern die Saugfrequenz registriert. Bei der Untersuchung gab es drei Gruppen: Die erste Gruppe hörte ihre eigenen Schreie, die zweite Gruppe hörte die Schreie eines anderen Neugeborenen und die dritte Gruppe war eine Kontrollgruppe, der keinerlei akustische Reize dargeboten wurden. Ergebnisse: Säuglinge reagieren auf fremdes Schreien wesentlich stärker als auf das eigene Schreien mit „facial expressions of distress“. Ein Säugling der den Schmerzensschrei eines anderen hört, hat den gleichen Gesichtsausdruck wie wenn er selber vor Schmerz schreit. Dies lässt darauf schließen, dass die Fähigkeit zu empathy (Empathie, Anstecken durch Emotionen Anderer) genetisch angelegt ist. Diese Fähigkeit ist ebenso wie die sympathy (Sympathie, Nachvollziehen der Emotionen Anderer) eine elementare Grundlage des gesamten Sozialverhaltens und menschlicher Interaktion. 6. Vorlesung vom 23.05.2006 Nach der Themenübersicht: 3. Frühe Kindheit 3.1 Die ersten Monate a) Frühe Verhaltensorganisation Artikel: Smotherman, W.P. & Robinson, S.R. (1990): The Prenatal Origins of Behavioral Organization Die Vorlesung gibt den Artikel z.T. verfälscht wieder. Ob der angekündigten Klausurrelevanz der enthaltenen Themen ist eine Lektüre ratsam. Smotherman führt 4 Funktionen (Unterteilung wurde lediglich von Prof.Silbereisen vorgenommen, nicht im Artikel zu finden) von pränataler Bewegung auf: 1. Probelauf: Bereits im Mutterleib treten Verhaltensweisen auf, die wie intendiert wirken und eigentlich erst später sinnvoll sind. „Wir müssen auf Veränderungen der Umwelt nach der Geburt reagieren können“ (Prof.). Beispiel: Atembewegungen, Strampeln, Picken beim Huhn 2. Verfrühte Auslösung: Aufgrund der Plastizität des Genoms können bestimmte Verhaltensweisen bei entsprechender intrauteriner Stimulation verfrüht ausgelöst werden. In der Studie wurde in das Fruchtwasser eines Rattenfötus Zitronensäure in sehr geringer Konzentration injiziert, so dass die Zitronensäure gerade noch gerochen werden konnte. Facial wiping bezeichnet bei (erwachsenen) Ratten das Wischen über das Gesicht, welches nach einer Geruchsempfindung auftritt. Nach der intrauterinen intraoralen Injektion tritt ein erstmaliges facial wiping bereits am 19. Tag der Schwangerschaft auf, zwei Tage früher als normalerweise bei 23-tägiger Tragezeit. Dies bedeutet eine erhebliche prozentuale Verschiebung im Auftreten dieses Reflexes. 21 3. Ambiguität der Umwelt: Umwelt kann Entwicklung und Verhalten nicht nur befördern, sondern auch behindern. Eine typische Erschwernis für Säugetiere ist die Schwerkraft. So können Strampelbewegungen postnatal nicht mehr oder nur in eingeschränktem Maße ausgeführt werden. Erst wenn die Muskulatur sich entsprechend entwickelt hat, können diese Verhaltensweisen wieder ausgeführt werden. Es können auch kulturell bedingte Erschwernisse (naive Theorien) hinzukommen: So verhindert das Einwickeln von Säuglingen deren Strampelbewegungen. 4. Antizipation: [Wo ist der Unterschied zu 1 ? Geht aus VL nicht hervor.] Ratten bereiten mit Strampelbewegungen bereits das Laufenlernen vor. Zwei Beispiele für eine ontogenetische Adaptation: Zum einen das intrauterine Drehen des Kopfes vor der Geburt, das ein aktives Verhalten des Kindes ist und sich evolutionär entwickelt hat. Zum anderen das Befreien von einer Umschlingung durch die Nabelschnur mittels starker Bewegungen. Durch diese optimierten Verhaltensweisen vermochten die evolutionären Kräfte, die Überlebenswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Fazit: Die Kontinuität und Diskontinuität von Entwicklung können nur unter Beachtung von Entwicklungsnischen verstanden werden. Die erste der vielen Entwicklungsnischen ist der Uterus. Die vorgeburtlich bereits vorhandenen Bewegungs- und Reflexmuster sind keine phylogenetischen Relikte, sondern sind zielgerichtet und entsprechen in Innervation und muskulärer Aktivität schon weitgehend dem späteren Verhalten. Entgegen früherer Anschauungen sind die pränatal ausgeführten Verhaltensweisen keineswegs isoliert oder sinnlos, sondern haben vielmehr eine aktiv vorbereitende Funktion. Die ersten Lebenstage Bei der Untersuchung von Neugeborenen stellen sich zwei Grundfragen: 1. Ist der Säugling gesund und zeigt alle typischen Charakteristika? 2. Besonders für die Forschung relevant: mit welcher Ausstattung, welchem Verhaltensrepertoire, gelangt ein Kind zur Welt? Artikel: Brazelton, B. (1984). The Neonatal Behavioral Assessment Scale Laut Brazelton, einem Pädiater, zeigt sich eine gelungene Anpassung an die postnatale Umwelt anhand von vier Systemen: 1. Autonomes System der physiologischen Funktionen, z.B. Kreislauf, Atmung, Verdauung, Temperatur. 2. Motorisches System, z.B. Bewegung, Körperhaltung, Koordination. 3. System des Bewusstseins und Erregungsniveaus. Ein Neugeborenes schläft noch ca. 18 Stunden täglich. Eines der ersten Dinge, die Kinder lernen müssen, ist die Regulation von Schlafen und Wachen, bei deren Ausprägung erhebliche interkulturelle Differenzen bestehen. 4. System der kognitiven, interaktiven und sozialen Prozesse Indem Brazelton auf einer neonatologischen Station Neugeborene stets im Alter von ca. 3 Tagen und in einem maximalen Wachzustand untersuchte, schuf er sich gleichsam eine Standardsituation, die interindividuelle Vergleiche ermöglichte. Ziel der Untersuchung war das Hervorrufen der maximalen Reaktionen der Säuglinge auf visuelle, taktile und akustische Stimuli. Die maximale Leistung Frühgeborener sollte mit den Fähigkeiten normal geborener Kinder verglichen werden. Die prognostische Relevanz der Ergebnisse erwies sich als gering, außer im Bereich der Daueraufmerksamkeit. Sie beträgt bei Neugeborenen zwar nur wenige Sekunden, ist aber prädiktiv für die spätere Aufmerksamkeitsregulation. 22 Plötzlicher Kindstod (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) Artikel: Lipsitt, L. P. (2003). Crib Death: a Bio-Behavioral Phenomenon Unter Bezugnahme auf McGraw, M. B. (1943). The Neuromuscular Maturation of the Infant, der anhand der Schwimmfähigkeit von Säuglingen die motorische Entwicklung erforschte, untersuchte Lipsitt die Ursachen des plötzlichen Kindstodes. Vor allem im Alter von etwa 3 bis 5 Monaten tritt der plötzliche Kindstod auf: Kinder werden meist morgens tot aufgefunden, wobei die blaue Färbung ihres Körpers auf Misshandlungen hindeuten könnte. Aus diesem Grunde und weil der plötzliche Kindstod gehäuft in Problemfamilien auftrat, kam es zu vielen Anklagen gegen Eltern. Ursachen: Die eigentliche Ursache ist ein lagebedingter Verschluss der Luftröhre, dem der Säugling nicht aus eigener Kraft entgegenwirken kann. Zwischen dem 2. und dem 5. Lebensmonat verlagert sich das Kontrollzentrum der Motorik aus dem Hirnstamm in die Motorkortizes. Dieser Zeitraum ist durch temporäre Funktionseinbußen, Desorientierung und Konfusion charakterisiert und stellt somit eine vulnerable Phase für den Säugling dar. Analog zur Schwimmfähigkeit können, wie Lipsitt zeigen konnte, in dieser Phase Bewegungen, die wenige Tage nach der Geburt problemlos ausgeführt werden konnten, nicht mehr bewerkstelligt werden. Als in den 1980er Jahren die Bauchlage als Ursache des plötzlichen Kindstodes erkannt wurde, ergab sich die Möglichkeit zur Prävention. Heute ist es in westlichen Ländern Standard, die Eltern auf die Gefahren des Schlafens auf dem Bauch hinzuweisen. Dadurch sind seit Ende der 1980er Jahre die Fälle des plötzlichen Kindstodes deutlich zurückgegangen. Allerdings zeigt sich in den USA, dass in der schwarzen Bevölkerung die Rate in etwa doppelt so hoch liegt wie bei Weißen, obwohl sie parallel sank. Dies ist auf die unveränderten, relativ schlechteren Bedingungen, in afroamerikanischen Familien (Rauchen, Desorganisation, Vernachlässigung, etc.) zurückzuführen sowie auf eine zu warme Lagerung des Säuglings. Nach der Themenübersicht: 3. Frühe Kindheit 3.2 Sensomotorische und kognitive Entwicklung a) Habituation als Forschungsmethode Artikel: Baillargeon, R. (1987). Object Permanence in 3½- and 4½- Month-Old Infants Die menschliche Wahrnehmung zeichnen einige fundamentale Grundeinheiten aus: Dreidimensionalität, eine Trennung von Objekt und Hintergrund sowie eine Vorstellung von Kausalität aus. Ein Objekt (Mannpfahl-Anekdote des Professors) zeichnet sich allgemein durch Solidität, Stabilität über die Zeit, Beanspruchung von Raum und eine gewisse Immobilität aus. Baillargeon widmete sich der Frage, ab welchem Alter diese Diskriminationsfähigkeit bestehe – ob sie dem Menschen von Geburt an inhärent sei, oder, wie Piaget annahm, erst mühsam erlernt werden müsse. Piaget war der Ansicht, dass Kinder diese Fähigkeiten solange nicht besäßen, wie sie eine Abdeckung von einem verdeckten Objekt nicht entfernten. Dem widerspricht Baillargeon, der bereits die oben ausgeführten Ergebnisse zur sensomotorischen Entwicklung vorlagen. Sie bediente sich für ihre Untersuchungen zur Objekterkennung der Methode der Habituation. 23 Nach einer Habituation auf die Brückenbewegung (Figure 1, Reihe 1) wurde den je etwa 4 ½ Monate alten Säuglingen entweder ein unmögliches Ereignis oder ein mögliches Ereignis präsentiert (Figure 1, Reihen 2 und 3). Nun wurde die Dauer der Aufmerksamkeitszuwendung anhand der Fixationszeit registriert. In Experiment 1 (Figure 2) wurden 4 ½ Monate alte Säuglinge untersucht. Es zeigte sich, dass die Dauer des Hinsehens bei einem unmöglichen Ereignis gegenüber dem möglichen Ereignis signifikant erhöht war. Dies wurde als Indikator für vorhandenes Wissen um die Eigenschaften von Objekten wie Solidität und Kausalität und damit als Fähigkeit zur Objekterkennung interpretiert. 24 In Experiment 2 (Figure 3) konnten diese Ergebnisse für 3 ½ Monate alte Säuglinge nicht repliziert werden. Erst nach einer Aufteilung der Babys in schnelle und langsame Habituierer (Figure 4), zeigte sich, dass lediglich die schnellen Habituierer die o.g. Fähigkeiten besaßen. Als Problem des Untersuchungsparadigmas offenbarte sich die eingeschränkte Vigilanz der Säuglinge. Die schnellen Habituierer erreichten eine Habituation bereits nach 7 bis 8 Durchgängen, die Aufmerksamkeitsspanne der langsamen Habituierer ist für eine sichere Habituation zu kurz. Somit sind der Methode natürliche Grenzen gesetzt. Sie eignet sich nicht wirklich zur Klärung der Frage, ob die Fähigkeiten zur Objektdiskrimination, wie Spelke behauptet, angeboren oder erlernt sind. Baillargeon selbst vertritt die Ansicht, dass diese Fähigkeiten zwar nicht angeboren seien, der dazu notwendige spezielle Lernprozess jedoch sehr früh und rasch an einfachen Stimuli erfolge. So genüge die Beobachtung der Bewegung und Verdeckung der eigenen Extremitäten. Später revidierte sie diese Ansicht und unterstützt nun auch die Position, dass die Fähigkeit zur Objektdiskrimination angeboren sei. Sie müsse sich jedoch im Laufe der Entwicklung vervollständigen und differenzieren. [Anm: die Auseinandersetzung ähnelt sehr der Kontroverse zwischen Empirismus und Rationalismus. John Lockes Satz „Nichts ist im Verstand, was nicht zuvor in den Sinnen war – außer dem Verstande selbst!“ passt sehr gut zu Baillargeons Auffassung] Sokolev nennt Habituationsphänomene einen Zwei-Komponenten-Prozess. Bei der ersten Stufe, der Habituation, werde eine Repräsentation eines Objektes erzeugt. Bei der zweiten Stufe, der Dishabituation, werde eine Diskrepanz zwischen dem dargebotenen Stimulus und der Objektrepräsentation erkannt. 7. Vorlesung vom 30.05.2006 Nach der Themenübersicht: 3. Frühe Kindheit 3.2 Sensomotorische und kognitive Entwicklung a) Frühe Verhaltensorganisation Artikel: Keen, R. (2003),. Representation of Objects and Events: Why Do Infants Look So Smart and Toddlers Look So Dumb? Keen benutzte einen Versuchsaufbau, bei dem eine Kugel über eine schiefe Ebene rollte und schließlich von einer Barriere aufgehalten wurde. Die zwei Jahre alten Versuchspersonen sollten nun das Türchen öffnen, hinter dem sich die Kugel befände (siehe untenstehende Abbildung). 25 Zweijährige hatten massive Schwierigkeiten, das richtige Türchen ausfindig zu machen. Sie waren nur dann dazu in der Lage, wenn sie den gesamten Lauf der Kugel bis zum Halt an der Barriere verfolgen konnten, indem sie über die Abdeckung blickten – und selbst in diesen Fällen gelang die Aufgabe nicht immer. Daraus lässt sich folgendes schließen: die Kinder wussten zwar schon im Alter von 3 Monaten, was ein Objekt und somit eine Barriere ist, sie vermochten jedoch auch im untersuchten Alter von zwei Jahren noch keine Vorhersagen über die Implikationen von Bewegungen zu treffen. Den Kindern mangelte es offenbar an dem Verständnis, dass bewegte Objekte in einer bestimmten Zeit einen entsprechenden Weg zurücklegen. Die Fähigkeit zur Vorhersage muss also erst entwickelt werden. Nach der Themenübersicht: 3. Frühe Kindheit 3.2 Sensomotorische und kognitive Entwicklung b) Frühe kognitive Entwicklung: Objekt und Raum Artikel: Baillargeon, R. (2004): Infants´ reasoning about hidden objects: evidence for event-general and event-specific expectations. Baillargeon entwickelte zur Erklärung dieser Tatsachen ein neues Modell. Sie unterscheidet darin zwischen grundlegendem und fortgeschrittenem Wissen um physikalische Phänomene. Grundlegendes Wissen bezieht sich auf die Solidität und Kontinuität von Objekten. Dieses Wissen sei wohl angeboren (siehe Ende der letzten Vorlesung vom 23.05.2006), in jedem Falle bestehe es im Alter von 2,5 Monaten. Versuche zur Verdeckung von Objekten (occlusion events) unterstützen die Annahme, dass die Fähigkeit zur Objektdiskrimination früh vorhanden ist. Das dritte Bild löste bei den 3 Monate alten Kindern Staunen aus. Die Überdeckung von Objekten (covering events) ruft bei denselben Säuglingen ebenfalls Erstaunen hervor, wenn, wie in den beiden untenstehenden Versuchsanordnungen, ein Objekt im Zuge der Überdeckung verschwindet bzw. an einem unmöglichen Ort wieder erscheint. 26 Während 3 Monate alte Kinder also bereits um die grundlegenden Elemente von Objekten, nämlich Solidität und Kontinuität, wissen, vermögen sie nicht, weitere relevante Merkmale zu berücksichtigen und zu erkennen. Dies zeigen folgende Versuche: 27 Bei 3 Monate alten Kindern löste keine der vier dargestellten Anordnungen Erstaunen aus. Bei 11 Monate alten Kindern hingegen rief die Verdeckung (occlusion) mit anschließender Größenänderung des Objekts Erstaunen hervor, nicht so hingegen die analoge Überdeckung (covering) mit anschließender Größenänderung. Baillargeon entwickelte zur Erklärung dieser Befunde das sog. Arbeitsmodell (Prof.). Kinder würden während ihrer ersten Lebensmonate in ihrer natürlichen Umwelt zwar häufig mit Verdeckungssituationen (occlusion events), selten hingegen mit Überdeckungssituationen konfrontiert. Diese Verdeckungssituationen erlaubten den Aufbau einer Repräsentation der physikalischen Umwelt, wobei jedoch vorwiegend grundlegende Informationen gelernt würden. Erst anhand komplexerer Erfahrungen, die im Laufe der ersten beiden Lebensjahre erfolgen (erhöhte Eigenmobilität, gereifter Wahrnehmungsapparat etc.), wird der Einbezug spezifischerer Informationen erlernt. Fazit: Der Prozess des Erlernens von Objekteigenschaften beginnt mit angelegten Fähigkeiten, welche den Aufbau eines grundlegenden physikalischen Weltbildes erlauben. Auf dieser Grundlage erfolgt in den ersten Lebensjahren anhand von Umwelterfahrungen eine Differenzierung und Verfeinerung der Objektwahrnehmung. Dieser zeitaufwändige Lernvorgang verleiht der Tatsache, dass von Erwachsenen als trivial empfundene Variationen in den oben dargestellten Versuchsanordnungen Säuglinge an ihre Grenzen bringen, Plausibilität. Nach der Themenübersicht: 3. Frühe Kindheit 3.2 Sensomotorische und kognitive Entwicklung c) Zielgerichtete Handlungen Artikel: Butterworth, G. & Itakura, S. (1998). Development of Precision Grips in Chimpanzees. Butterworth untersuchte die diffizile Feinmotorik bei Schimpansen. Er ließ die Schimpansen kleine würfelförmige Objekte verschiedener Größe, die er in randomisierter Reihenfolge darbot, aufheben. Dabei registrierte er die Häufigkeiten, mit denen bestimmte Griffe ausgeführt wurden. Ergebnis: Während bei Menschen der artspezifische Pinzettengriff bereits von 2 Jahre alten Kindern problemlos beherrscht wird, beobachtet man solche Präzisionsgriffe bei den Schimpansen erst ab einem Alter von 8 bis 15 Jahren. Menschen wie Schimpansen besitzen die angelegte Fähigkeit, den Präzisionsgriff durchzuführen. Beim Menschen werden die dazu notwendigen Elemente früher als beim Schimpansen zusammengefügt. Dies hat folgende Implikation: Aufgrund der früheren Ausprägung von feinmotorischen Fertigkeiten ist der Mensch früher in der Lage, vertieftes Wissen über Objekte zu akquirieren. Artikel: Connolly, K. & Dalgleish, M. (1989). The Emergence of a Tool-Using Skill in Infancy Connolly untersuchte die Fähigkeit von Kleinkindern im Umgang mit einem Löffel. Beim Essen mit dem Löffel handelt es sich um eine sehr komplizierte Handlungsabfolge, welche nach einer ausgereiften Koordinationsfähigkeit verlangt. Die Autoren zerlegten das Essen von Spinat in kleine messbare Teilvorgänge (siehe untenstehende Grafik, Figure 9). Ergebnisse: Zuerst werden einzelne Handlungssequenzen, wie z.B. das Aufnehmen der Speise, wiederholt eingeübt (repetitive actions). Anschließend werden die einzelnen Sequenzen zunehmend zu einer erfolgreichen Bewegungsabfolge kombiniert. Letztendlich wird der gesamte Bewegungsablauf flüssig ausgeführt und die Kinder beginnen die Handlungskette von neuem, wenn ein Fehler gemacht wurde (correction loops). 28 Bei den 12 Monate alten Kindern zeigte sich noch keine eindeutige Präferenz hinsichtlich der zur Bewegung benutzten Hand, nur ca. 75% hatten sich auf eine Hand festgelegt. Mit 18 Monaten hatten sich 97 % für eine bevorzugte Hand entschieden. Ebenfalls änderten sich die Griffarten und mit zunehmendem Alter wurden vermehrt der kulturellen Norm entsprechende Griffarten gewählt. Der häufigste Griff bei den Kleinkindern war der so genannte TPR (siehe Abbildung links). Im Laufe der Entwicklung verschob sich der Zeitpunkt der Mundöffnung immer weiter nach hinten, weil sich Antizipation und Koordination verbesserten. Fazit: Die Entwicklung der Motorik erfolgt in einem zeitaufwendigen Prozess, angeregt durch repetitives Einüben. Nach der Themenübersicht: 3. Frühe Kindheit 3.3 Sozial-emotionale Entwicklung a) Modelle der Bindungsentwicklung 29 Die Bindungstheorie von John Bowlby Bindung (attachment) bezeichnet ein genetisch vorgeprägtes Verhalten von Neugeborenen und Kindern. Ein Neugeborenes sucht die Nähe zu Bezugspersonen, die auf seine Signale reagieren und in bedrohlichen Situationen Trost spenden und Schutz gewährleisten. Ein Kind hat meistens mehrere Bezugspersonen, deren Bedeutung hierarchisch organisiert ist. Die wichtigste Bezugsperson ist in den allermeisten Fällen die Mutter, es können aber auch andere Personen an ihre Stelle treten. Bei einem bestimmten Ausmaß an Kummer kann allerdings nur die Hauptbindungsperson trösten. Kleinkinder richten ihr Verhalten auf die Hauptbindungsperson aus, die auf die kindlichen Signale in vorhersehbarer Weise reagiert. Ein solches Signal kann Weinen oder Klammern sein, das ein Fürsorgeverhalten hervorruft. Vertrauen zu Bindungspersonen gibt den Kindern Sicherheit und ist eine Voraussetzung für die Exploration der Umwelt, durch die sich Selbstsicherheit und Selbständigkeit entwickeln können. Bindung ist ein dyadisches, d.h. ein auf Gegenseitigkeit beruhendes, Geschehen. Bretherton (1985), eine Schülerin von Ainsworth, entwickelte ein „Arbeitsmodell“ (Prof.) zur Erklärung der bei Bindung ablaufenden Prozesse (siehe untenstehende Abbildung Figure 1). 30 Werden Bindungssignale des Kindes wiederholt von Bindungspersonen, insbesondere der Hauptbindungsperson, ignoriert, entwickelt das Kind eine unsichere Bindung. Zur Erforschung kindlicher Bindungsmuster entwickelte Mary Ainsworth Ende der 1960er Jahre das Untersuchungsdesign der so genannten strange-situation-Methode. Dabei befinden sich Mutter und das 12 bis 18 Monate alte Kind zunächst gemeinsam in einer unvertrauten, aber anregenden Umgebung. Nach einiger Zeit des Spielens lässt die Mutter (bzw. Hauptbindungsperson) ihr Kind alleine im Raum zurück. Später kehrt die Mutter zurück und beginnt wieder mit ihrem Kind zu spielen. Während des gesamten Vorgangs werden die Reaktionen des Kindes registriert. Auf der Grundlage verschiedener Verhaltensweisen verschiedener Kinder entwickelte Ainsworth ein System zur Klassifikation von Bindungen. Sie unterscheidet dabei drei verschiedene Bindungstypen: 1. Sichere Bindung (B-Bindung): Ein sicher gebundenes Kind zeigt Kummer, wenn die Mutter den Raum verlässt und Freude, wenn sie zurückkehrt. 2. Unsicher-ambivalente Bindung (C-Bindung): Auswirkungen im strange-situationExperiment siehe unten im Wikipedia-Artikel. Eine unsicher-ambivalente Bindung entsteht, wenn die Bindungsperson in einer für das Kind unberechenbaren Weise auf Bindungssignale reagiert. Das Kind hat somit keine Möglichkeit zur Vorhersage und ist dauerhaft angespannt und unsicher. 3. Unsicher-vermeidende Bindung (A-Bindung): Als Konsequenz des mangelnden Vertrauens in die Bezugsperson zeigt das unsicher-vermeidend gebundene Kind während der gesamten Untersuchung keine Emotionen. Dennoch steigen während der Trennung sowohl die Herzfrequenz als auch die Cortisol-Konzentration im Blut an. Das Kind erlebt also folglich durch die Trennung eine emotionale Belastung. Eine unsicher-vermeidende Bindung entsteht, wenn die vom Kind offen gezeigten Bedürfnisse von der Bindungsperson ignoriert werden. Hinsichtlich der Intensität und Charakter von Bindungen bestehen interkulturelle Unterschiede. Zum Beispiel wäre in Japan ein Test mittels der strange situation nicht durchführbar, weil es dort unüblich ist, dass die Mutter ihr Kind jemals alleine lässt. Innerhalb einer Kultur ist die Sensitivität der Bezugspersonen das entscheidende Kriterium für die Entwicklung einer sicheren Bindung. Auszüge aus dem Wikipedia-Artikel zur Bindung. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bindung_(Psychologie) am 1.6.2006 Anmerkung: Es wurde ein komplexeres Untersuchungsdesign beschrieben, bei dem während der Abwesenheit der Mutter noch eine dritte, fremde Person hinzukommt. 1. Die sichere Bindung (B-Bindung): Sicher gebundene Kinder entwickeln aufgrund von elterlicher Feinfühligkeit , welche durch vorwiegend positive Interaktionen und beständiges, nachvollziehbares Verhalten gekennzeichnet ist, eine große Zuversichtlichkeit in Bezug auf die Verfügbarkeit der Bindungsperson. Diese Kinder weinen durchaus innerhalb der fremden Situation . Sie zeigen diese Gefühle deutlich und akzeptieren den Trost der fremden Frau im Raum und sind ihr gegenüber freundlich und relativ offen. Obwohl die Trennung bei diesen Kindern also mit negativen Gefühlen verbunden ist, vertrauen sie darauf, dass die Mutter sie im Bedarfsfall nicht im Stich lassen oder in irgendeiner Weise falsch reagieren wird. Die Mutter erfüllt in einer derartigen Bindung die Rolle eines "sicheren Hafens", der immer Schutz bieten wird, wenn man dessen bedarf. Diese Kinder sind traurig darüber, dass die Mutter nicht bei ihnen ist, gehen aber davon aus, dass sie wieder kommen wird. Kehrt die Mutter in den Raum zurück, freuen sich die Kinder demnach und suchen Nähe und Kontakt, wenden sich aber kurz danach wieder der Exploration des Raumes zu. 2. Die unsicher-ambivalente (ängstlich-widerstrebende, resistente, ambivalente) Bindung (CBindung): Kinder die hier beschrieben werden, zeigen sich ängstlich und abhängig von ihrer Bindungsperson. Geht die Mutter, reagieren die Kinder extrem belastet. Die fremde Frau wird ebenso gefürchtet wie der Raum selbst. Schon bevor die Mutter hinausgeht, zeigen diese Kinder Stress, da sie die fremde Situation 31 fürchten, was ihr Bindungssystem schon von Beginn an aktiviert. Die Kinder reagieren so auf das korrelierende Mutterverhalten: Die Mutter reagiert für das Kind nicht zuverlässig, nachvollziehbar und vorhersagbar. Der ständige Wechsel von einmal feinfühligem, dann wieder abweisendem Verhalten führt dazu, dass das Bindungssystem des Kindes ständig aktiviert sein muss. Es kann schwer einschätzen, wie die Mutter in einer bestimmten Situation handeln oder reagieren wird. Das Kind ist somit permanent damit beschäftigt, herauszufinden, in welcher Stimmung sich die Mutter gerade befindet, was sie will und was sie braucht, damit es sich entsprechend anpassen kann. Dies führt zu einer Einschränkung des Neugier- und Erkundungsverhaltens des Kindes, welches sich nicht auf die Exploration des Raumes konzentrieren kann. Diese Kinder können keine positive Erwartungshaltung aufbauen, weil die Bindungsperson häufig nicht verfügbar ist (eben auch nicht dann, wenn sie de facto in der Nähe ist). Dementsprechend erwarten sie keinen positiven Ausgang der Situation und reagieren extrem gestresst und ängstlich innerhalb der fremden Situation . 3. Die unsicher-vermeidende Bindung (A-Bindung): Die hier beschriebenen Kinder reagieren scheinbar unbeeindruckt, wenn ihre Mutter hinausgeht, spielen, erkunden den Raum und sind auf den ersten Blick weder ängstlich noch ärgerlich über das Fortgehen der Bindungsperson. Durch zusätzliche Untersuchung der physiologischen Reaktionen der Kinder während der Situation, wurde jedoch festgestellt, dass ihr Cortisolspiegel bei Fortgehen der Mutter höher ansteigt, als der der sicher gebundenen Kinder, welche ihrem Kummer Ausdruck verleihen. Kommt die Mutter zurück, wird sie ignoriert. Die Kinder suchen die Nähe der fremden Person und meiden die ihrer Mutter. Unsicher-vermeidenden Kindern fehlt die Zuversicht bezüglich der Verfügbarkeit ihrer Bindungsperson. Sie entwickeln die Erwartungshaltung, dass ihre Wünsche grundsätzlich auf Ablehnung stoßen und ihnen kein Anspruch auf Liebe und Unterstützung zusteht. Dieses Bindungsmuster ist bei Kindern zu beobachten, die häufig Zurückweisung erfahren haben. Diese Kinder finden einen Ausweg aus der belastenden bedrohlichen Situation des immer wieder Zurückgewiesen-Seins nur durch Beziehungsvermeidung. Sie wenden ihre Aufmerksamkeit von der Bindungsperson ab, was sie in die Lage versetzt das Risiko von Zurückweisung zu minimieren. 4. Die desorganisiert/desorientiert erscheinende Bindung (D-Bindung): Dieser Bindungstyp wurde erst wesentlich später festgestellt. Es gab immer auch Kinder, deren Verhalten sich nicht eindeutig in eine der drei Hauptreaktionsschemata einordnen ließen. Martin Dornes verdeutlich dies in seinem 2003 erschienenen Buch Die frühe Kindheit. Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre folgendermaßen: Manche näherten sich der Mutter (wie Sichere), drehten dabei aber den Kopf zur Seite (wie Unsichere); andere zeigten extreme Vermeidung (wie A-Kinder), aber untypischerweise zugleich viel offenen, unberuhigbaren Kummer (wie ambivalente C-Kinder) oder benahmen sich in Episode 5 wie Sichere, in Episode 8 aber wie Vermeidende (Seite 224). Ainsworth und auch nachfolgende Kollegen stuften diese Kinder meist innerhalb der sicheren Kategorie, und einige wenige als vermeidend, ein. Nach Entwicklung der 4. Kategorie wurden die bisher forciert klassifizierten Fälle ... erneut gesichtet (Dornes). Ein großer Anteil dieser Kinder wurde schließlich als desorganisiert/desorientierter Bindungstyp klassifiziert. Kinder deren Verhalten diesem Bindungsmuster zugeordnet wird, zeigen äußert unerwartete, nicht klassifizierbare Verhaltensweisen. Dazu gehören Stereotypien und unvollendete oder unvollständige Bewegungsmuster. Die Bindungstheorie geht davon aus, dass ein Kind auf jeden Fall eine Bindung zu seiner Bindungsperson eingehen muss sobald es Schutz und Unterstützung bedarf. Wenn aber die Bindungsperson - also der Mensch der Schutz bieten soll zugleich der Auslöser für das Bindungsverhalten - also die Bedrohung selbst - ist dann gerät das Kind in eine paradoxe Lage aus der es keinen Ausweg gibt. Die Bindungsperson ist in diesem Falle häufig eine, die auf das Kind selbst beängstigend wirkt, weil sie zu gewalttätigem Handeln neigt, oder das Kind seelisch und verbal misshandelt. Eine andere Ursache für dieses Bindungsverhalten zeigt sich bei Kindern, deren Bindungspersonen unter den Folgen eigener Traumata leiden. Die traumatischen Erfahrungen zeigen sich den Kindern im verängstigten Verhalten ihrer Bindungspersonen. Die Angst, die sich im Gesicht einer Mutter spiegelt, welche unter Intrusionen (hartnäckiges Eindringen von traumagebundenen Bildern und Gefühlen in die Gedanken) leidet, ist für ein Kind erschreckend und aktiviert sein Bindungssystem. Die Quelle der Angst ist aber für das Kind nicht nachvollziehbar. Die Mutter kann in einer solchen Situation zumeist nicht adäquat auf die Versorgungsbedürfnisse ihres Kindes eingehen. Das Kind erlebt schließlich die Welt ständig als einen bedrohlichen Ort, dessen Schrecken sich in der Bezugsperson widerspiegelt. Nach der Themenübersicht: 3. Frühe Kindheit 3.3 Sozial-emotionale Entwicklung b) Sensitivität als Voraussetzung Artikel: De Wolff, M.S. & van Ijzendoorn, M.H. (1997). Sensitivity and Attachment: a MetaAnalysis on Parental Antecedents of Infant Attachment 32 Ijzendoorn führte eine Metaanalyse von 66 Studien, in denen über 1000 Mütter und Kinder involviert waren, durch und fasste damit praktisch alle zum Thema Bindung existierenden Forschungsergebnisse zusammen. Im Fokus der Metastudie stand der Zusammenhang von mütterlichem Verhalten und der kindlichen Ausrichtung (sicher vs. unsicher) der Bindung. Ergebnisse: Förderlich für eine sichere Bindung sind: Harmonie, synchrone Interaktion, Wärme, Empathie, Sensitivität und emotionale Unterstützung. Nahezu alle diese Faktoren haben eine mittelgroße Effektstärke (um r=.20) und haben signifikant positiven Einfluss auf die Art der Bindung. Ijzendoorn kontrollierte diese Ergebnisse hinsichtlich verschiedenster Einflüsse, wie z.B. Geburtenreihenfolge. Nur wenige dieser Störvariablen hatten einen signifikanten Einfluss, d.h. die oben genannten Faktoren hatten einen soliden Effekt auf die Bindung zum Kind. Ein signifikanter Störeinfluss war jedoch der familiäre SES, wobei in der Unterschicht der Effekt der oben genannten Faktoren wie z.B. Sensitivität größer war. Artikel: Braungart-Rieker, J.M., Garwood, M.M., Powers, B.P. & Wang, X. (2001). Parental Sensitivity, Infant Affect, and Affect Regulation: Predictors of Later Attachment Es stellt sich die Frage, ob die oben genannten Faktoren (v.a. Sensitivität der Mutter) einen direkten Einfluss auf die Mutter-Kind-Bindung haben. Braungart-Rieker erstellte hierzu ein Strukturgleichungsmodell (siehe nebenstehende Abbildung), in welchem er den Mediator Affektregulation einführte. Es zeigte sich, dass der direkte Zusammenhang zwischen mütterlicher Sensitivität und der Mutter-KindBindung nicht signifikant wurde. Jedoch wurden die Pfade über den Mediator signifikant. Daraus schloss Braungart-Rieker, dass Kinder durch die Sensitivität der Mutter zunächst die fundamentale Fertigkeit der Gefühlsregulation erlernen, welche dann ihrerseits einen Effekt auf die Mutter-Kind-Bindung ausübt. Artikel: Bokhorst, C.L., Bakermans-Kranenburg, M.J., Pasco Fearon, R.M., van Ijzendoorn, M., et al. (2003). The Importance of Shared Environment in Mother-Infant-Attachment Security: A Behavioral Genetics Study Bokhorst et. al. widmeten sich der Frage, ob die verschiedenen Arten von Bindungen (A, B, C nach Ainsworth, s.o.) mit genetischen Gegebenheiten korrelieren. Ergebnisse: Weder für die Mutter-Kind- noch für die Vater-Kind-Bindung findet sich ein nennenswerter genetischer Effekt. Interindividuelle Unterschiede in der Bindung rühren nahezu vollständig aus Effekten geteilter und/oder nicht-geteilter Umwelt. Das Bindungsverhalten ist also genetisch angelegt, jedoch vermag – im Gegensatz zur Affektregulation – die genetische Prädisposition keine Varianz an den beobachteten interindividuellen Variationen von Bindungen aufzuklären. Dies hat folgende Implikation: Bindungsverhalten ist beeinflussbar. Eine unsichere Bindung ist einer Intervention zugänglich, da sie allein der Interaktionsgeschichte zwischen dem Kind und der jeweiligen Bezugsperson entstammt. 33 8. Vorlesung vom 06.06.2006 PD Dr. Matthias Reitzle in Vertretung von Prof. Silbereisen. Nach der Themenübersicht: 3. Frühe Kindheit 3.3 Sozial-emotionale Entwicklung c) Konsequenzen für Sozialverhalten in Kindheit und Jugend Wiederholung: Definition von Bindung: Bindung bezeichnet die Tendenz eines Kleinkindes, die Nähe zu einer Bezugsperson zu suchen, die ihm Sicherheit vermittelt“ (Buchheim, 2004, S.44). Es ist ein psychologisches Konstrukt, das Emotionen, Motivationen und Verhalten des Kindes je nach den Erfordernissen der Situation strukturiert (Rauh, 2002, S.197). Das Bindungsverhalten des Kindes, d.h. die Art und Weise in der es diese Nähe sucht, drückt sich in Schreien oder Weinen, Anlächeln oder Suchen der Bezugsperson aus und wird in sicheren Situationen nicht aktiviert: statt Bindungsverhalten zu zeigen, kann das Kind dann die Bezugsperson als Basis für die eigene Erkundung der Welt nutzen. Darüber hinaus ruft Bindungsverhalten Fürsorgeverhalten in der Bezugsperson hervor. Nach Bowlby (1984, zitiert in Rauh, 2002, S.197) sind beide eng gekoppelten Systeme aus der Evolution hervorgegangen und sichern das Überleben der Art. Bindung und Bindungsverhalten basieren auf einem Bindungsverhaltenssystem, welches als Warnsystem dient und dann aktiv ist, wenn beim Kind negative Emotionen wie Verunsicherung oder Angst auftreten. Artikel: Ahnert, L., Gunnar, M., Lamb, M. & Barthel, M. (2004). Transition to Child-Care: Associations with Infant-Mother Attachment, Infant Negative Emotion and Cortisol Elevations Lieselotte Ahnert widmete sich der Frage, welche Konsequenzen außerhäusliche Kinderbetreuung auf das Bindungsverhalten der Kinder hat. Kernelement der Studie war die Messung des Stressniveaus in Abhängigkeit von ihrem Bindungstyp. Sie untersuchte 70 Kinder, die kurz vor dem Eintritt in den Kindergarten standen, zunächst hinsichtlich der Art ihrer Mutter-Kind-Bindung. Nach einer Erhebung mithilfe der strange-situationAnordnung erfolgte eine Einteilung in sicher und unsicher gebundene Kinder. In den ersten Tagen im Kindergarten blieb ein Elternteil eine gewisse Zeit bei dem Kind, weswegen dieser Zeitraum als Eingewöhnungsphase (adaptation phase) bezeichnet wurde. Daran schloss sich die Trennungsphase (seperation phase) an, in welcher die Eltern nicht mehr anwesend waren. 5 Monate nach dem Eintritt in den Kindergarten wurde die Art der Bindung erneut erfasst. Diese erneute Klassifizierung diente dem Zweck, zu eruieren, ob sich der Bindungstyp seit dem Eintritt in den Kindergarten geändert hatte. Die Messung des Stressniveaus erfolgte vor Eintritt in den Kindergarten (Referenzwert), während der Eingewöhnungsphase, an den Tagen 1, 5 und 9 der Trennungsphase sowie 5 Monate nach dem Eintritt in die Betreuungsinstitution. Dazu wurde mit einem Speicheltest der Cortisolspiegel der Kinder erfasst. Cortisol ist ein Hormon, welches bei Stress ausgeschüttet wird und daher ein sehr genauer Indikator für das Stressniveau ist. Außerdem wurde parallel das Ausmaß von Unmutsbekundungen (fussing and crying) seitens der Kinder erfasst. Ergebnisse: Vor dem Eintritt in den Kindergarten unterschieden sich sicher und unsicher Gebundene hinsichtlich ihres Cortisolspiegels nicht signifikant voneinander. 34 Lediglich während der Eingewöhnungsphase zeigten sicher gebundene Kinder signifikant niedrigere Cortisolwerte als unsicher gebundene. In der Trennungsphase erreichten die Werte der sicher Gebundenen das Niveau der unsicher Gebundenen. Bis zum Zeitpunkt der letzten Messung 5 Monate nach dem Eintritt in den Kindergarten waren die Werte signifikant gesunken, lagen jedoch weiter über dem ursprünglichen Wert (Referenzwert). Die Ursachen dieser generellen Erhöhung können durch die Untersuchung nicht geklärt werden, da keine Daten zu Kindern vorliegen, welche nicht in einem Kindergarten betreut wurden. Die Differenz könnte durch den Kontext Kindergarten bedingt sein, auch ein physiologisches, d.h. entwicklungsbedingtes Ansteigen des Cortisolspiegels ist jedoch möglich. Scheinbar im Widerspruch dazu standen die Ergebnisse der Verhaltensbeobachtung. Die sicher Gebundenen bekundeten insbesondere zu Beginn der Trennungsphase signifikant häufiger Unmut (fussing and crying). Im Kontrast dazu verhielten sich unsicher gebundene Kinder trotz ihrer höheren Cortisolwerte ruhiger und unauffälliger. Dies rührt aus der Tatsache, dass unsicher gebundene Kinder aus Unsicherheit gleichsam ratlos sind, welches Verhalten sie zeigen sollen. Somit offenbaren sie keine augenscheinlichen Anzeichen von Stress, obwohl es „unter dem Deckel brodelt“. Man kann also aus dem manifesten Verhalten von Kindern nicht zwingend auf deren tatsächliche Emotionen schließen. 35 Artikel: National Institute of Child Health and Human Development – Study of Early Child Care Research Network (2003). Does Amount of Time Spent in Child Care Predict Socioemotional Adjustment During the Transition to Kindergarten? Das Institute of Child Health and Human Development (NICHD) führte eine Studie zu den sozioemotionalen Auswirkungen von früher Kinderbetreuung durch. Dabei sollte eruiert werden, ob Kinder, die früh außerhäuslich betreut wurden, mit negativen Konsequenzen für ihre soziale Kompetenz und ihr Verhalten zu rechnen hätten. Methode: Ursprünglich wurden für die Untersuchung 8986 Mütter von Neugeborenen kontaktiert, von welchen sich 5416 zur Teilnahme bereit erklärten. Nach einem Ausschluss von aufgrund bestimmter Eigenschaften (schwere Krankheit des Kindes, Umzug der Familie, etc.) ungeeigneten Kindern und einer zufälligen Auswahl zur Begrenzung des Aufwands, wurden letztendlich 1364 Kinder im Alter von 6 Monaten untersucht. Von diesen schlossen 1081 die Untersuchung im Alter von 4,5 Jahren ab. An ihnen wurden verschiedene Variablen erhoben: UV: - Dauer der außerhäuslichen Betreuung - Qualität der Betreuung als Kontrollvariable - Qualität der Mutter-Kind-Beziehung (maternal sensitivity / parenting) als Kontrollvariable AV: - Sozialkompetenz mittels Social Skills Rating Scale - Verhaltensprobleme mittels Child Behavior Check List (CBCL, 1993) - Erzieher-Kind-Konflikt (teacher-child-conflict) - Dyadische Interaktion mit peers (dyadic play) Es wurden drei Regressionsmodelle unter Hinzunahme jeweils einer weiteren UV berechnet: 1. Dauer der außerhäuslichen Betreuung 2. Zusätzlich: Qualität der Betreuung 3. Zusätzlich: Qualität der Mutter-Kind-Beziehung Ergebnisse: Die Dauer der außerhäuslichen Betreuung hat einen signifikanten negativen Effekt auf die soziale Kompetenz und befördert Problemverhalten. Allerdings ist die Effektstärke gering und die Qualität der Betreuung sowie der Mutter-Kind-Beziehung haben im 2. und 3. Modell einen größeren Einfluss. Die negativen Effekte der Quantität bleiben auch unter Berücksichtigung beider Kontrollvariablen bestehen. Aber die Eltern (parenting) und die Betreuungspersonen haben einen mindestens ebenso hohen Einfluss auf die sozioemotionalen Charakteristika des Kindes. Diskussion: Des Weiteren ist der kausale Zusammenhang unklar: Negatives Verhalten muss nicht aus der Quantität der Kinderbetreuung resultieren. Ebenso gut könnten problematische Kinder tendenziell früher und länger in Betreuungsinstitutionen gegeben werden. Harry McGurk, ein schottischer Psychologe, wies darauf hin, dass die Child Behavior Checklist (s.o.) nicht zwingend nur negative Eigenschaften erfasse, sondern vielmehr assertiveness (Selbstbewusstsein, Durchsetzungsfähigkeit) messe. Somit wären die Effekte der Betreuung keineswegs durchweg bedenklich. Die Befunde aus den USA, wo meist Laien die Betreuungspersonen sind, können nicht ohne weiteres auf andere Länder übertragen werden, wo geschultes Personal zu einer höheren Betreuungsqualität beitragen dürfte. Zusammenfassung der Studie der beschriebenen Studies von http://www.blackwellsynergy.com/links/doi/10.1111/1467-8624.00582/abs/ To examine relations between time in nonmaternal care through the first 4.5 years of life and children's socioemotional adjustment, data on social competence and problem behavior were examined when children participating in the National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Study of Early Child Care were 4.5 years of age and when in kindergarten. The more time children spent in any of a variety of nonmaternal care arrangements across the first 4.5 years of life, the more externalizing problems and conflict with adults they manifested at 54 months of age and in kindergarten, as reported by mothers, caregivers, and teachers. These effects remained, for the most part, even when quality, 36 type, and instability of child care were controlled, and when maternal sensitivity and other family background factors were taken into account. The magnitude of quantity of care effects were modest and smaller than those of maternal sensitivity and indicators of family socioeconomic status, though typically greater than those of other features of child care, maternal depression, and infant temperament. There was no apparent threshold for quantity effects. More time in care not only predicted problem behavior measured on a continuous scale in a dose-response pattern but also predicted at-risk (though not clinical) levels of problem behavior, as well as assertiveness, disobedience, and aggression. Artikel: Schneider, B.H., Atkinson, L. & Tardiff, C. (2001). Child-Parent Attachment and Childrens´ Peer Relations: A Qualitative Review. Die Studie untersuchte, welche Auswirkung die Art der Mutter-Kind-Bindung auf Beziehungen im späteren Leben habe. Viele Bindungsforscher, die einen psychoanalytischen Hintergrund haben, halten frühe Bindungserfahrungen für deterministisch hinsichtlich des gesamten Lebens. Methode: Dazu führten die Autoren eine Metaanalye basierend auf 63 Studien durch, die sowohl Bindungsart als auch peer-Beziehungen untersuchten. Für die Erfassung von peer-Beziehungen gibt es 4 verschiedene Methoden: - Soziometrie: Misst die Beziehungen innerhalb einer Gruppe - Beobachtung - Elternbefragung - Lehrerbefragung Zur Betrachtung der Auswirkungen wurde sowohl die Art der Mutter-Kind-Bindung als auch der Erfolg in peer-Beziehungen dichotomisiert. Ergebnisse: Dabei zeigte sich dass, 59 % der als Kinder sicher Gebundenen, aber nur 41 % des unsicher Gebundenen Erfolg in peer-Beziehungen hatten. Dieses Ergebnis ist unabhängig vom Geschlecht sowie von der Art der Messung der Bindung bzw. des Erfolgs in peer-Beziehungen (s.o.). Die Effektstärke beträgt .20. Jedoch hat der Zeitpunkt, zu welchem die Mutter-Kind-Bindung klassifiziert wird, einen Effekt: Je später die Erfassung erfolgt, desto größer ist die Vorhersagekraft der Art der Bindung für den Erfolg in peer-Beziehungen. Diskussion: Dies widerspricht der psychoanalytischen Sichtweise, dass die frühen Lebensjahre besonders prägend seien. Vielmehr ist aufgrund der menschlichen Plastizität die Art der Mutter-KindBindung und Bindungsverhalten generell veränderbar. Zwar haben sicher gebundene Kinder bessere Aussichten auf Erfolg in späteren Beziehungen, jedoch schließt eine unsichere Mutter-KindBindung ein späteres Gelingen von Beziehungen keineswegs aus. Bei Metastudien stellt sich das Problem, dass nur publizierte Studien miteinbezogen werden. Jedoch gelangen in der gängigen Wissenschaftspraxis zumeist nur diejenigen Untersuchungen zur Veröffentlichung, welche ein signifikantes Ergebnis liefern. Diese Tatsache lässt Effekte in Metaanalysen größer erscheinen, als sie unter Berücksichtigung auch der nicht veröffentlichten Ergebnisse tatsächlich wären. Deshalb wird in Metastudien meist ein Kennwert genannt, der angibt, wie viele Studien ohne signifikantes Ergebnis existieren müssten, um den vorgefundenen Effekt verschwinden zu lassen. In diesem Fall bedürfte es dazu 164 nicht-signifikanter Studien. Dieser relativ hohe Faktor von 2,6 zeigt, dass die lediglich moderate Effektstärke von .20 durchaus bedeutsam ist. Die Metaanalyse von van Ijzendoorn (1995) wurde in dieser Vorlesung nicht vollständig behandelt und wird daher im Skript der nächsten Vorlesung dargestellt. 37 9. Vorlesung vom 13.06.2006 Nach der Themenübersicht: 3. Frühe Kindheit 3.3 Sozial-emotionale Entwicklung d) Stabilität und Kontinuität Artikel: van Ijzendoorn, M.H. (1995) Adult Attachment Representation, Parental Responsiveness and Infant Attachment: a Metaanalysis on the Predictive Validity on the Adult Attachment Interview. Um die Auswirkungen der selbst erfahrenen Mutter-Kind-Bindung auf die spätere Bindung zum eigenen Kind zu analysieren, bieten sich zwei Möglichkeiten an: Zum einen eine aufwändige Längsschnittstudie über mehrere Dekaden, zum anderen ein Rückschluss auf die selbst erfahrene Bindung anhand von Repräsentationen, welche in einer Befragung erfasst werden. Methode: Van Ijzendoorn bediente sich letzterer Vorgehensweise. Dazu benutzte er das sog. AAI (adult attachment interview) von George Kaplan & Main (1985). Darin werden von einem Experten verschiedene Fragen zum Themenkomplex Bindung in der Kindheit gestellt. Nach einer Aufforderung zur Nennung von 5 Adjektiven zu beiden Eltern fordert der Interviewer den Probanden zu einer Begründung seiner Wahl anhand von Anekdoten zu jedem Adjektiv auf. Schließlich stellt er u.A. folgende Fragen: „Welchem Elternteil stehen/standen Sie am nächsten?“ „Wie war die Responsivität ihrer Eltern?“ „Erinnern Sie sich an massive Trennungserlebnisse?“ „Haben sie sich je zurückgewiesen gefühlt?“ „Ist ihre Persönlichkeit als Erwachsener beeinflusst durch die kindlichen Erfahrungen?“ „Haben sie in ihrer Kindheit Missbrauchserfahrungen gemacht?“ Dabei wird insbesondere auf die Konsistenz bzw. Kohärenz der Antworten und subtile Signale mimischer, gestischer und sprachlicher Art geachtet, um so auf die Art der Bindung zu schließen. Wenn ein Proband beispielsweise permanent und pauschal angibt, ein optimales Verhältnis zu seinen Eltern gehabt zu haben, hin und wieder jedoch widersprüchliche Angaben zu Details macht, deutet dies auf ein ambivalentes Verhältnis – ein Anzeichen einer unsicheren Bindung – hin. Es erfolgt eine Einteilung der Erwachsenen in vier Bindungstypen, welche weitgehend, jedoch nicht vollkommen, mit den vier Bindungstypen bei Kindern übereinstimmen: - autonomous and secure - dismissing - preoccupied - unresolved and disorganized Nach dieser Erhebung wurde die Überstimmung zwischen der Repräsentation der Bindung zu den Eltern in der eigenen Kindheit und der Bindung zum eigenen Kind berechnet. Ergebnisse: Dichotomisiert man die Art der Bindung in beiden Fällen in sicher/unsicher, beträgt diese Übereinstimmung 70%. Daraus ergibt sich die Frage, auf welchem Wege die Vermittlung der selbst erfahren Bindung auf die Bindung zum eigenen Kind erfolgt. 38 Die Zahlen entsprechen in etwa ß-Koeffizienten Erklärung zu Figure 1: Die selbst erfahrene Bindung hat über die Sensitivität, d.h. das Eingehen auf das Kind, einen indirekten Effekt auf die Art der Bindung des eigenen Kindes von .34*.32=.11. Hierbei gilt es zu beachten, dass Sensitivität der Mutter zwar auf die Bindung des Kindes einen großen Einfluss besitzt (.32), nicht jedoch auf die Weitergabe der selbst erfahrenen Bindungsart auf das eigene Kind (nämlich nur .11 von insgesamt .47). Neben diesem eher geringen Effekt bestehen andere, im Detail unbekannte, nicht systematische, direkte Effekte in Höhe von .36. Insgesamt hat demnach die selbst erfahrene Bindung von Erwachsenen auf die Bindungsart ihrer Kinder einen Effekt von .47. Methodisch ließe sich einwenden, dass die Daten aus dem AAI nicht die tatsächlich erfahrene Art der Bindung widerspiegelten. Dies wird durch die folgende Studie widerlegt: Artikel: Waters, E., Marrick, S., Treboux, D., Crowell, J., et al. (2000). Attachment Security in Infancy and Early Adulthood: A Twenty-Year Longitudinal Study. Waters untersuchte die Kohärenz von Ergebnissen aus dem AAI mit der tatsächlichen in der Kindheit erfahrenen Bindungsart. Dazu führten er und seine Kollegen eine Längsschnittstudie an 50 Mittelschichtkindern durch. Dabei zeigte sich, dass ein Zusammenhang zwischen der Art der Bindung im Alter von 12 Monaten und der Art der Bindung im Erwachsenenalter (21 Jahre) besteht. Dies lässt sich daraus ersehen, dass die Diagonalen der Tabelle am häufigsten besetzt sind (Table 1). 39 Artikel: Weinfield, N.S., Sroufe, L.A. & Egeland, B. (2000). Attachment from Infancy to Early Adulthood in a High-Risk Sample: Continuity, Discontinuity, and Their Correlates. Die von Waters gefundene Übereinstimmung trifft den Ergebnissen von Weinfield zufolge nicht für Personen zu, welche in einem problematischen Kontext mit einhergehenden Krisenerfahrungen aufwuchsen. Hierzu untersuchte Weinfield 57 Kinder, die in ärmlichen Verhältnissen lebten. Wie Table 2 zeigt, ist bei diesen Kindern aus widrigen Verhältnissen, die tendenziell mehr kritische Lebensereignisse erfahren hatten, nahezu keine Kontinuität in der Bindung existent: Die Diagonalen der Tabelle sind nicht die am häufigsten besetzten Zellen. Artikel: Carlson, E.A. (1998). A Prospective Longitudinal Study of Attachment Disorganization/Disorientation. Carlson widmete sich den Auswirkungen einer desorganisierten Bindung im Kindesalter (2 Jahre) auf die psychische Gesundheit im Erwachsenenalter (19 Jahre). Wie die nebenstehende Grafik zeigt, hat schlechte elterliche Fürsorge keinen signifikanten direkten Effekt auf das Ausmaß psychopathologischer Symptome im Erwachsenenalter. Jedoch besteht ein indirekter Effekt über eine desorganisierte Bindung. Für das Zustandekommen dieser Langzeiteffekte existieren zwei Erklärungsmodelle: 1. kumulatives Modell: A⇒B⇒C. Eine in der Kindheit bestehende Fehlentwicklung, zieht eine Kette von Ereignissen nach sich. Jeder Schritt hat nur eine kleine Wirkung, aber letztendlich kumulieren die Effekte. Beispiel: unsichere Bindung, Schulprobleme, Isolation, Drogenkonsum, Kriminalität). 2. Prädispositionsmodell: A⇒B, A⇒C. Verschiedenen alterstypischen Problemen liegt jeweils die gleiche Fehlentwicklung in einer früheren Altersstufe zugrunde, es besteht also eine grundlegende Vulnerabilität. Beispiel: desorganisierte Bindung führt zu Schulproblemen und später zu Beziehungsproblemen. Artikel: Sagi-Schwartz, A., van IJzendoorn, M. H., Grossmann, K. E., Joels, T. et al. (2003). Attachment and Traumatic Stress in Female Holocaust Child Survivors and Their Daughters. Sagi-Schwartz und Kollegen untersuchten die Konsequenzen extremer Krisensituationen in der 40 Kindheit für das Bindungsverhalten dem eigenen Kind gegenüber. Methode: Sie befragten 48 israelische Holocoustüberlebende, deren Eltern im KZ umgebracht worden waren, d.h. Personen, die ihre Eltern selbst noch kannten und zu diesen vor deren Ermordung eine Bindung entwickeln konnten. Zunächst wurde untersucht, ob die zum Zeitpunkt der Untersuchung durchschnittlich 65-Jährigen auf ihre traumatischen Erfahrungen zurückgehende Störungen aufwiesen. Dann wurde überprüft, ob diese Auffälligkeiten die Bindung der Überlebenden zu ihren Kindern beeinträchtigten. Ergebnisse: Die Überlebenden wiesen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe weitaus häufiger psychische Auffälligkeiten auf. Dennoch hatten diese posttraumatischen Erfahrungen keine Auswirkungen auf die Bindung zu ihren zum Untersuchungszeitpunkt durchschnittlich 35-jährigen Kindern. Es erfolgte also keine intergenerational transmission, sondern die Überlebenden vermochten ihre Kinder so zu erziehen, dass diese keinerlei Defizite im attachment aufwiesen. Hiefür gibt es zwei mögliche Erklärungen: 1. Der Verlust der Eltern wurde von den Überlebenden dem Wirken einer anonymen Macht attribuiert. Somit gaben Sie den Eltern keine Schuld für einen Mangel an erfahrener Zuwendung. 2. Die Überlebenden gewannen durch die Gründung des Staates Israel Sicherheit und Stärke. Zusammenfassung: Quintessenz aus allen oben beschriebenen Studien ist also Folgendes: In geordneten Lebensverhältnissen erfolgt eine intergenerational transmission des Bindungsverhaltens. In ungeordneten Lebensverhältnissen (z.B. Armut, Tod der Eltern) gilt dies nicht. Nach der Themenübersicht: 3. Frühe Kindheit 3.4 Störungen der Entwicklung a) Frühe Störungen und deren Folgen Artikel: Rutter, M. & The English and Romanian Adoptees (ERA) Study Team (1998). Developmental Catch-Up, and Deficit, Following Adoption after Severe Global Early Privation. Sir Michael Rutter untersuchte die Möglichkeiten und Grenzen von Plastizität in der Kompensation von Defiziten aufgrund frühkindlicher Deprivation. Während der Ära Caucescu war in Rumänien Abtreibung strikt verboten, so dass unerwünschte Kinder unmittelbar in Kinderheime gegeben wurden, wo sie unter inhumanen Bedingungen aufwuchsen. In diesen Heimen gab es keinerlei Betreuung und praktisch alle Kinder wiesen Anzeichen von Hospitalisierung (=psychopathologische Auffälligkeiten aufgrund des Fehlens fester Bezugspersonen) auf. Nach Bekannt werden dieser Zustände wurden in einer Woge von Hilfsbereitschaft viele dieser Kinder v.a. in britische Familien „aufwärts“ adoptiert. In seiner Untersuchung differenzierte Rutter nach dem Alter zum Zeitpunkt der Adoption in zwei Subgruppen: 0,5- und 2,5-Jährige. Diese wurden in ihren Eigenschaften und Fähigkeiten mit einer Kontrollgruppe gleichaltriger britischer Adoptivkinder verglichen. Die beschriebenen katastrophalen Verhältnisse in den rumänischen Kinderheimen führten, wie Table 1 verdeutlicht, zu physischen und kognitiven Entwicklungsdefiziten bei den Adoptierten. So lag der durchschnittliche Kopfumfang der rumänischen Kinder, welcher eine direkte Funktion der Gehirngröße ist, etwa zwei Standardabweichungen unter dem der Kontrollgruppe. Ebenso lag ihr durchschnittlicher Denver-Quotient, ein frühkindliches Intelligenzmaß mit Durchschnitt 100, mit 63 Punkten am Rande der Debilität. Die Kinder waren also in jeglicher Hinsicht massiv retardiert. 41 Im Alter von 4 Jahren untersuchte Rutter die Kinder erneut. Die zum Zeitpunkt der Adoption 0,5Jährigen hatten in praktisch allen Belangen das Niveau der Kontrollgruppe erreicht. Dieses Verschwinden der Defizite durch Deprivation deutet auf die massive Plastizität des Organismus hin. Die zum Zeitpunkt der Adoption 2,5-Jährigen verzeichneten im Alter von 4 Jahren zwar ebenfalls positive Effekte, deren Ausmaß allerdings weit unter dem der Gruppe der früher Adoptierten lag. Im Alter von 6 Jahren, nachdem die Gruppe der später Adoptierten ebenfalls 3,5 Jahre in Großbritannien verbracht hatte, bestand für diese hinsichtlich kognitiver Fähigkeiten kein Unterschied zur Kontrollgruppe mehr. In anderen Domänen jedoch war kein vollständiges Aufholen möglich. Laut Rutter sind die positiven Effekte durch die Adoption nicht etwa auf die verbesserte Ernährung in den britischen Adoptivfamilien zurückzuführen, sondern auf die verbesserte Betreuung. An diesen Ergebnissen lässt sich exemplarisch das Prinzip von Kontext und Plastizität aufzeigen. Artikel: van Ijzendoorn, M.H., Juffer, F. & Klein Poelhuis, C.W. (2005). Adoption and Cognitive Development: a Meta-Analytic Comparison of Adopted and Nonadopted Children´ IQ and School Performance Ijzendoorn und Kollegen bezogen in ihre Metaanalyse alle verfügbaren Adoptionsstudien ein. Bei der Betrachtung der Intelligenzquotienten ergibt sich allerdings das Problem des Flynn-Effekts (IQ nimmt mit jeder Generation zu). Wie die Daten der 60 Studien mit 18000 Teilnehmern ergaben, haben Kinder, die adoptiert wurden, einen höheren IQ als ihre nicht adoptierten biologischen Geschwister. Dies wird als positiver Effekt der Betreuung (Aufwärtsadoption) interpretiert. Weiterhin unterschieden sich die Adoptierten kaum von ihren sozialen Geschwistern. Bei der Aufwärtsadoption holen die Kinder in somatischen und kognitiven Belangen massiv auf. Allerdings sind ihre Sprachfertigkeiten und Schulleistungen geringer als die der sozialen Geschwister. Die Adoptierten haben also aufgrund ihrer Herkunft und den Bedingungen, denen sie vor der Adoption ausgesetzt waren, noch gewisse Nachteile. Die Wurzel dieser Nachteile ist die frühe soziale Vernachlässigung. Artikel: Rutter, M. & The English and Romanian Adoptees (ERA) Study Team (1998). Developmental Catch-Up, and Deficit, Following Adoption after Severe Global Early Privation. Rutter stellte sich die Frage, ob die oben angeführte soziale Vernachlässigung Effekte auf das Bindungsverhalten der Kinder hat. Dazu untersuchte er sechsjährige Adoptierte, die nach weniger als zwei Jahren Aufenthalt in einem rumänischen Heim in englische Familien adoptiert wurden. Die 42 Kinder wurden hinsichtlich einer Bindungsstörung (attachment disorder) untersucht. Dabei handelt es sich nicht um eine unsichere Bindung im Sinne der Klassifikation Ainsworths. Attachment disorder ist vielmehr eine psychiatrische Störung. Vor allem wurde untersucht, ob die Kinder sozial indiskriminiert waren, d.h. ob sie Fremden gegenüber allzu vertrauensvoll handelten. Ergebnisse: In ihren kognitiven Fähigkeiten waren die Kinder vollkommen normal entwickelt. Es bestanden allerdings erhebliche Defizite im Bindungsverhalten, welche sich als über die Zeit konstant erwiesen. Die Bindungsstörung ist eine direkte Funktion der Dauer des Heimaufenthaltes, was eine Kausalbeziehung nahe legt. Artikel: Zeanah, C.H., Smyke, A.T., Koga, S.F. & Carlson, E. (2005). Attachment in Institutionalized and Community Children in Romania. Die Autoren dieses Artikels untersuchten rumänische Heimkinder und als Kontrollgruppe NichtHeimkinder im Alter von 12 bis 36 Monaten, also in der sensiblen Phase für Bindung. Heutzutage werden in Rumänien Kinder nicht mehr generell in Heime abgeschoben, sondern gelangen vornehmlich aufgrund von Familienproblemen in Institutionen. Die Heimkinder waren also nicht mehr repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Analog zu Rutter untersuchten sie attachment disorder, unterschieden aber klar zwei Arten: zusätzlich zu sozial-indiskriminiertem (siehe Figure 2 unten) Verhalten wie bei Rutter berücksichtigten die Autoren auch das gegenteilige Phänomen, also gehemmtes Verhalten (siehe Figure 1 unten). Ergebnisse: Für beide Arten der Störung erzielen normal aufgewachsene Kinder systematisch niedrigere Punktzahlen, d.h. sie wiesen weniger Anzeichen für eine attachment disorder auf. Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass frühe Deprivation kein Endschicksal ist. Wie in den vorigen Artikeln beschrieben ist eine Kompensation bei einer Verbesserung der Umwelt in gewissem Ausmaß möglich. Artikel: Boyce, W.T. & Allice, B.J. (2005). Biological Sensitivity to Context: An EvolutionaryDevelopmental Theory of the Origins and Functions of Stress-Reactivity Boyce untersuchte den Effekt von ungünstigen Bedingungen und Stress in der frühen Kindheit auf die biologische Reaktivität (Stressreaktivität) im späteren Leben. Stress ist dabei definiert als eine Situation, welche vorhandene Bewältigungsstrategien überfordert. Eine verbreitete Sichtweise be43 sagt, dass frühe Stressexposition und spätere Stresssensitivität positiv korrelieren und erstere langfristig durchweg negative Auswirkungen besitze. Boyce vertritt eine andere Auffassung. Ergebnisse: Aus der nebenstehenden Folie geht hervor, dass eine mittlere frühe Stressexposition (adversity) für die spätere Stressbewältigung zuträglich ist (Punkt A in Figure 3), während sowohl zu hohe als auch zu niedrige Level abträglich sind. Oftmals wird in Untersuchungen lediglich die Bedingung der high adversity betrachtet. Die rumänischen Waisenkinder waren während ihres Heimaufenthaltes immens hohen Stresslevels ausgesetzt (high adversity). Obwohl die neue Umwelt nach der Adoption allenfalls eine mittlere Stressexposition bewirkte, blieb ihnen als nicht kompensierbares Defizit eine erhöhte Stressreaktivität erhalten. Nach der Themenübersicht: 3. Frühe Kindheit 3.4 Störungen der Entwicklung c) Resilienz Artikel: Masten, A.S., Hubbard, J.J., Gest, S.D., Tellegen, A. et al. (1999). Competence in the Context of Adversity: Pathways to Resilience and Maladaptation from Childhood to Late Adolescence. Anne Masten untersuchte die Bedingungen für Resilienz bei Kindern, welche unter widrigen Bedingungen aufgewachsen waren. Die Stichprobe erzeugte künstlich eine breitere Streuung, indem überproportional viele Kinder mit wenig und mit viel adversity aufgenommen wurden. Die Kinder wurden erstmals in der ersten Klasse untersucht und dann über 10 Jahre weiterverfolgt. Es wurde ihr Umgang mit peers, sozialen Normen und Schulleistungen untersucht. Von den Kindern mit schlechten Ausgangsbedingungen besaßen manche eine so hohe Resilienz, dass sie in den o.g. Domänen nach 10 Jahren ebenso viel Erfolg erzielten wie Kinder mit guten Voraussetzungen. Die resilienten Kinder waren genau jene, welche eine bessere elterliche Betreuung erfahren hatten. Diese manifestiert sich in Sensitivität, Responsivität, Wärme und hohen Erwartungen bei zugleich klaren Regeln und Strukturen. Nach der Themenübersicht: 3. Frühe Kindheit 3.4 Störungen der Entwicklung 44 c) Frühe Vorboten späterer Störungen Artikel: Caspi, A. (2000). The Child is Father of the Man: Personality Continuities from Childhood to Adulthood. Caspi untersuchte die Stabilität von frühen interindividuellen Unterschieden von Persönlichkeitseigenschaften. Als Datenmaterial verwendete er die Dunedin-Studie von Caspi, Moffit, Newman und Silva. Hierbei handelt es sich um eine Geburtskohortenstudie, bei der ein kompletter Geburtsjahrgang (ca. 1000 Kinder) der neuseeländischen Region Dunedin verfolgt wurde. Im Alter von 3 Jahren wurden die Kinder erstmals hinsichtlich der in Table 1 aufgeführten Eigenschaften von geschulten Beobachtern untersucht. Anhand der Ergebnisse erfolgte eine Aufteilung in drei Gruppen: Undercontrolled (z.B. lautes und störendes Verhalten), inhibited (z.B. dauerhaft verunsichert) und well-adjusted, also zwei Formen von Bindungsstörung und eine unauffällige Kontrollgruppe. Im Alter von 18 Jahren wurde der Geburtsjahrgang erneut hinsichtlich der in Table 1 aufgeführten Eigenschaften untersucht. Dabei ergaben sich für die drei Gruppen die in Figure 1 dargestellten Ergebnisse. Im Alter von 21 Jahren wurden Persönlichkeitseigenschaften ähnlich der „Big Five“ erfragt, deren Ergebnisse in Figure 2 dargestellt sind. In diesem Alter wurden auch die zwischenmenschlichen Beziehungen der Probanden untersucht, die Ergebnisse sind in Figure 3 dargestellt. I Fazit: Über alle drei dargestellten Ergebnisse hinweg ist Folgendes festzustellen: Im frühen Kindesalter auftretende Bindungsstörungen wirken sich nachhaltig auf Persönlichkeitseigenschaften und interpersonelle Beziehungen von Individuen aus. Es zeigt sich also in positiver wie in negativer Hinsicht eine Konstanz in Persönlichkeitseigenschaften von der Kindheit mindestens bis ins junge Erwachsenenalter. 45 46 10. Vorlesung vom 20.06.2006 Nach der Themenübersicht: 4. Entwicklung psychophysischer Funktionen 4.1. Kognitive Entwicklung a) Strukturtheoretische Tradition der Denkentwicklung Jean Piaget entwickelte anhand von intensiven Beobachtungen eine umfassende Entwicklungstheorie. Für Piaget existiert im Säuglingsalter kein wirkliches Denken. Die kognitive Entwicklung setzt erst später ein und vollzieht sich insbesondere im Alter von 3 bis 18 Jahren. Dabei richtete er sein Augenmerk mehr auf die Struktur des Denkens als auf die konkreten Inhalte. Piaget sah Kinder als „kleine Epistemologen“ (Erkenntnistheoretiker) an, die anhand von Eigenaktivität zu Erkenntnis gelangen. Die Eigenaktivität durchläuft systematische Veränderungen, die nicht linear, sondern sprunghaft verlaufen. Je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium sich ein Kind befindet, verfügt es nur über eingeschränkte Fähigkeiten, die früher oder später nicht mehr ausreichen, um die Phänomene der Umwelt zu erklären. Defizite in der Erklärung des Wahrgenommenen sind die Triebfeder für Progression zur nächsthöheren Stufe. Piaget unterscheidet folgende „Stufen der Erkenntnis“. Die drei Entwicklungsstufen sind: 0. Sensomotorisches Stadium (in der Vorlesung nicht behandelt) 1. Präoperatives Stadium: 2. Konkret-operatives Stadium 3. Formal-operatives Stadium 47 Die Unterschiede im Zeitpunkt des Verlassens eines Entwicklungsstadiums sind z.B. in der unterschiedlichen Stimulation oder Neugier des Kindes begründet. Der Ablauf der Stufen ist dabei immer gleich: beginnend mit der 1. Stufe werden sukzessive die beiden weiteren Stadien durchlaufen. Nach Erreichen des dritten Stadiums erfolgt keine sprunghafte Veränderung mehr. Es sind allenfalls noch qualitative Änderungen möglich, die Piaget horizontale Verschiebung nennt. Die Unterschiede zwischen Gleichaltrigen hinsichtlich des erreichten Stadiums steigen mit zunehmendem Alter an. Film: IWF (1980). Die Entwicklung des Denkens nach Jean Piaget (präoperative Phase, konkrete Operationen, formale Operationen) Präoperatives Stadium (ca. 2-7 Jahre): Im präoperativen Denken existieren folgende drei Merkmale noch nicht: - Eine stabile und realistische Objektrepräsentation - Physikalische Grundelemente wie Länge, Distanz und Geschwindigkeit - Ein Bezugssystem, das z.B. die Beziehung von Objekten in Raum und Zeit koordiniert Insgesamt ist das Denken also an sehr einfache Vorstellungen sowie überschaubare räumliche und soziale Begriffe gebunden. Wenn mentale Repräsentationen fehlen, neigen Kinder eher zu einer Verzerrung der Realität als zur unmittelbaren Anpassung des eigenen Denkschemas. Auch eine differenzierte Wahrnehmung zeitlicher Relationen und kausaler Vorgänge findet kaum statt. Oftmals werden animistische Erklärungen herangezogen, d.h. den Objekten werden menschliche Intentionen zugeschrieben. Auch bei Hilfestellung durch Erwachsene sind Kinder nicht in der Lage, bestimmte Aufgaben, die die drei oben genannten Merkmale voraussetzen, wie z.B. den Drei-Berge-Versuch, zu lösen. In solchen Misserfolgen liegt die Wurzel kognitiven Fortschritts: Wenn ein kognitiver Konflikt, also eine Diskrepanz zwischen Erwartung und Wahrnehmung, besteht, kommt es zu einer Labilisierung der bestehenden Denkstruktur und nach wiederholter Erfahrung entsprechender Situationen zu einem Voranschreiten in der Stufenfolge. Konkret-operatives Stadium (ca. 7-12 Jahre): In diesem Stadium werden folgende Fähigkeiten beherrscht: - Seriation: Fähigkeit, vorliegende Objekte anhand einer Eigenschaft in eine Reihenfolge zu bringen - Invarianz: Fähigkeit, transformierte Objekte als qualitativ gleich zu erkennen, z.B. Volumeninvarianz-Versuch - Klassifikation: Fähigkeit, Objekte anhand bestimmter Merkmale einzuordnen und in Beziehung zu anderen Objekten zu setzen Artikel: Lohaus, A. & Trautner, H. M. (1986). Informationsintegration bei Kindern: Eine empirische Analyse auf der Basis von Paarvergleichen Lohaus bediente sich einer Invarianzaufgabe, um festzustellen, ob die von ihm untersuchten Fünfund Sechsjährigen sich bereits im konkret-operativen Stadium befinden. Die Kinder sollten unter mehreren Rechtecken „das Größte“ auswählen, wobei sie sich vorstellen sollten, dass es sich um Schokoladentafeln handele. Dabei zeigte sich, dass sich die Kinder in zwei Gruppen unterteilen ließen (siehe untenstehende Grafik): Eine Gruppe wählte die Rechtecke mit der größeren Summe der Kantenlängen (Zentrierer, durchgezogene Linie), eine Gruppe bevorzugte die Rechtecke mit der größeren Fläche (Dezentrierer, gestrichelte Linie). 48 Die Dezentrierer besitzen die Fähigkeit, nicht nur den vordergründigsten Aspekt eines Objekts (hier: die Höhe) wahrzunehmen, sondern mehrere Merkmale (hier: Breite mal Höhe) zueinander in Beziehung zu setzen und somit die Mehrdimensionalität von Objekten zu begreifen. Bei einer Mittelung der Ergebnisse beider Subgruppen würde ein horizontaler Verlauf entstehen, der darauf schließen ließe, dass lediglich das hervorstehende Merkmal der Kantenlänge betrachtet wurde. Dies würde zu dem falschen Schluss verleiten, dass sich alle untersuchten Kinder noch im präoperativen Stadium befänden, da sie nicht – wie von Dezentrierern zu erwarten – die Fläche der Rechtecke betrachteten. Lohaus zeigte, dass – anders als von Piaget angenommen – sich bereits im Alter von 5 bis 6 Jahren ein gewisser Anteil von Kindern bereits im konkret-operativen Stadium befindet. Artikel: Druyan, S. (2001). A Comparison of Four Types of Cognitive Conflict and Their Effect on Cognitive Development. Was ist also der Mechanismus, der hinter der kognitiven Entwicklung steht? Ist es, wie Piaget annahm, der kognitive Konflikt oder wie Baillargeon und Spelke annehmen, ein genetisch determinierter Lernprozess (genomische Interaktion)? Nach Piaget werden kognitive Konflikte beständig vom Prozess der Äquilibration begleitet, welcher aus den beiden Teilprozessen der Assimilation und Akkommodation besteht. Assimilation meint die verzerrende Anpassung der Wahrnehmung an das eigene Denkschema („Vergewaltigung der Realität“). Akkomodation meint die Anpassung des eigenen Denkschemas an die Realität und liegt somit der kognitiven Entwicklung zugrunde. Nun lässt sich untersuchen, wie der kognitive Konflikt beschaffen sein muss, damit eine Akkomodation erfolgt. Druyan untersuchte die Wirkung verschiedener Typen kognitiver Konflikte auf das konkret-operative Denken. Dabei stellte er ein physikalisches Problem (siehe Figure 1) und fragte: „Was passiert, wenn man die beiden weißen Rechtecke unter der Waage wegnimmt?“ 49 Nach einer anfänglichen Messung der Fähigkeit zur korrekten Vorhersage wurden die Kinder in fünf Gruppen eingeteilt: Eine Kontrollgruppe und vier Treatment-Gruppen. Jede der vier Treatment-Gruppen erfuhr eine andere Intervention, in denen sie bewusst kognitiven Konflikten ausgesetzt wurden: visual, kinesthetic, peer und child-adult conflict. Wie Figure 3 zeigt, beeinflussen die meisten Treatments die Problemlösefähigkeit positiv. Insbesondere der child-adult-conflict, wo ein Erwachsener das Kind anleitet und versucht, kognitive Konflikte hervorzurufen, um die Struktur zu labilisieren, erhöht das kognitive Niveau der Kinder. Ohne Induktion eines kognitiven Konfliktes (No-intervention) verbessern sich die Fähigkeiten der Kinder nicht. Es macht aber keinen Sinn, Kinder in einen kognitiven Konflikt zu versetzen, wenn ein kognitives System (ähnlich einer Entwicklungsstufe) gerade erst erworben wurde. Dies zeigt sich an den geringen bis negativen Effekten von induzierten Konflikten (peer und child-adult conflict) für Vorschüler. Zu dieser Tatsache sind die Ergebnisse für visual und kinesthetic conflict widersprüchlich und konnten auch von Prof. Silbereisen nicht erklärt werden. Fazit: Äquilibrationsprozesse treiben Entwicklung voran, wobei Akkommodation zu befördern ist. Dabei kommt der sozialen Interaktion eine bedeutsame Rolle so, was für den pädagogischen Bereich die entwicklungsfördernden Effekte altersheterogener Schulklassen impliziert. 11. Vorlesung vom 27.06.2006 Nach der Themenübersicht: 4. Entwicklung psychophysischer Funktionen 4.1 Kognitive Entwicklung a) Strukturtheoretische Tradition der Denkentwicklung Als prüfungsrelevant zur Lektüre empfohlen: Kapitel in Oerter/Montada (2002). Die geistige Entwicklung aus der Sicht Jean Piagets, S. 418-442 Film: IWF (1980). Die Entwicklung des Denkens nach Jean Piaget (präoperative Phase, konkrete Operationen, formale Operationen). Göttingen, Institut für den wissenschaftlichen Film Für Jean Piaget wird die Stufe des formal-operativen Denkens im Alter von ca. 12 Jahren erreicht. Altersangaben sind in seinem Modell allerdings immer als ungefähre Richtwerte zu verstehen. Der Film zeigt, dass das Alter für das Erreichen eines Entwicklungsstadiums kein guter Prädiktor ist. Vielmehr gibt es eine immens hohe Streuung, sodass beispielsweise ein 8-Jähriger bereits 50 formal-operativ denken kann, während ein 15-Jähriger dies noch nicht vermag. Ferner sinkt die Korrelation zwischen Alter und Entwicklungsstadium, je höher die Entwicklungsstufe ist. Der Film illustriert diese Tatsachen anhand physikalischer Experimente, bei welchen die Kinder und Jugendlichen in ihren Fähigkeiten zu formal-operativem Denken geprüft werden. Bei diesen Versuchsanordnungen handelt es sich um einen mehrdimensionalen Ereignisraum, in welchem zwischen verschiedenen möglich erscheinenden Ursachen für die beobachteten Phänomene entschieden werden muss. So wird den Versuchsteilnehmern unter anderem die Aufgabe gestellt, bei Pendeln die Ursache für verschiedene Pendelfrequenzen herauszufinden (Schnurlänge, Gewicht, Anstoßkraft). Wenn Kinder/Jugendliche das formal-operative Denken beherrschen, bilden sie in einem abstrakten Modell Hypothesen, zwischen welchen durch logische Schlussfolgerungen eine Entscheidung erfolgt. Nach der Themenübersicht: 4. Entwicklung psychophysischer Funktionen 4.1 Kognitive Entwicklung d) Kulturelle Unterschiede und sozialer Wandel Artikel: Flieller, A. (1999): Comparison of the Development of Formal Thought in Adolescent Cohorts Aged 10-15 Years (1967-1996 and 1972-1993). Es stellen sich zwei Fragen: 1. Gibt es langfristige Veränderungen hinsichtlich des Durchschnittsalters, in welchem ein Entwicklungsstadium erreicht wird? 2. Existieren Kulturunterschiede hinsichtlich des Durchschnittsalters, in welchem ein Entwicklungsstadium erreicht wird? Zu 1.) Flieller ging der Frage nach, ob sich zwei Kohorten von 13-15 Jährigen, die 1967 bzw. 1996 untersucht wurden, hinsichtlich ihres Entwicklungsstands unterschieden. Dabei fand er anhand verschiedener Indikatoren für die kognitive Entwicklung, z.B. dem Erkennen von Objektinvarianz (siehe Table 3: conservation), dass die 1996 untersuchte Kohorte systematisch besser in den Aufgaben abschnitt. Hierfür existieren unterschiedliche Erklärungen: Der Autor selbst vertritt die Auffassung, dass der Flynn-Effekt für die zunehmend besseren Resultate der jüngeren Kohorte ursächlich sei. Prof. Silbereisen zufolge seien die Differenzen primär auf einen höheren Anteil von Kindern in weiterführenden Schulen zurückzuführen, wo typischerweise formal-operatives Denken gefördert werde. So sei dieser Anteil 51 in Frankreich, dem Ursprungsland der Studie, zwischen 1967 und 1996 von 60% auf 90% angestiegen. Artikel: Rogoff, B., Chavajay, P. (1995). What´s Become of Research on the Cultural Basis of Cognitive Development? zu 2.) Piaget unterlag der Fehlannahme, dass das Alter, in welchem ein bestimmtes Entwicklungsstadium erreicht wird, unabhängig von Kultur und Gesellschaftsform sei. Barbara Rogoff widerlegte diese Ansicht mit einer Studie, in welcher sie nicht beschulte mexikanische Kinder hinsichtlich ihrer Fähigkeiten zu formal-operativem Denken untersuchte. Sie führte zunächst dieselben Aufgaben durch, welche Piaget seinerzeit an europäischen Kindern zur Klassifikation von Entwicklungsstadien erprobt hatte. In diesen Aufgaben schnitten die unbeschulten mexikanischen Kinder schlecht ab. Man könnte annehmen, dass diese Defizite aus einer mangelnden „Vertrautheit mit dem Material“ rühren. Dies würde bedeuten, dass die fehlende Konfrontation der Kinder mit den für die Untersuchung verwendeten Gegenständen das schlechte Abschneiden bedinge. Diese Hypothese ist jedoch nicht zutreffend. Die mangelnde Vertrautheit mit dem Material ist nicht ausschlaggebend. Vielmehr ist tatsächlich die Art und Weise formal-operativen Denkens entscheidend für das Abschneiden in piagetschen Aufgaben. Eine kulturtypische Aufgabe für formal-operatives Denken, der Erläuterung komplizierter Verwandtschaftsverhältnisse, gelingt den mexikanischen Kindern jedoch problemlos. Artikel: Druyan, S. (2001). A Comparison of Four Types of Cognitive Conflict and Their Effect on Cognitive Development In seiner Untersuchung zeigte Druyan unter anderem auf, dass kulturelle Unterschiede in Denkstilen bestehen. So konnten und wollten sibirische Illiteraten keine syllogistischen Schlussfolgerungen ziehen, wenn es sich dabei nicht um konkrete, selbst erfahrene Tatbestände handelte. Beispielsweise weigerte sich ein Mann fortgeschrittenen Alters, den Syllogismus des Modus Barbara zu vollziehen. Die erste Prämisse war dabei „Im hohen Norden sind alle Bären weiß“, die zweite Prämisse lautete: „Die Insel Novaja Semlja liegt im Hohen Norden“. Nun sollte die Frage beantwortet werden, welche Farbe Bären auf der genannten Insel hätten. Der Befragte insistierte, dass diese Frage solange nicht beantwortet werden könne, wie er selbst oder ein als Berichterstatter fungierender Dritter dort einen Bären gesehen hätten. Dies bedeutet keineswegs, dass der Mann in seiner kognitiven Entwicklung zurückgeblieben ist. Dass er das „als-ob“ nicht vollzieht liegt daran, dass seine Kultur andere Kriterien anwendet. Die Anwendung von formal-operativem Denken (Modus Barbara) ist kulturell determiniert, während die Fähigkeit dazu entwicklungsbedingt ist. Lehrbuchkapitel: Sodian, B. (2002) Entwicklung begrifflichen Wissen. In Oerter/Montada, S. 443468 Es gibt zahlreiche Alternativen zu Piagets Modell der Entwicklungsstufen. Ein Beispiel für einen neueren Ansatz sind die so genannten Wissenstheorien, welche Sodian beschreibt. Eine Gegenthese der Wissenstheorien zu Piaget ist die Auffassung, dass Strukturen im Denken (z.B. Objektpermanenz, Invarianz) bereits in sehr jungem Alter ausgeprägt seien. Piagets Methoden verfehlten allerdings ein frühes Erkennen, da die Erfassung mittels komplizierter Versuchsanordnungen und verbaler Anweisungen erfolge. Die Bearbeitung dieser Aufgaben sei den Kindern nicht möglich, da es ihnen an Wissen und einer effizienten Organisation dieses Wissens mangele. Das Kind sei gleichsam ein universeller Novize, dem es an konkretem Wissen fehle, das aber die wesentlichen Elemente des Denkens beherrsche. Vereinfacht man Piagets Versuchsanordnungen, kann man zeigen, dass Kinder bereits sehr viel früher als von Piaget angenommen über Fähigkeiten wie z.B. Objektinvarianz verfügen. 52 Zunächst erwirbt das Kind Wissen in den wichtigsten Domänen, dem physikalischen und dem psychologischen Weltbild. Anfangs konstituiert es naive Theorien, welche sukzessive ergänzt und ersetzt werden, ähnlich einem wissenschaftlichen Prozess. Eine klassische Methode zur Darstellung dieses auf Grundelementen aufbauenden Prozesses ist die Versuchsanordnung von Perner und Wimmer (1983). Sie untersuchten, zu welchem Zeitpunkt eine Theory of Mind (naive Bewusstseinstheorie) die rein ich-bezogene Perspektive ablöst. Dazu bedienten sie sich der Maxi-Geschichte, die den Kindern, wie auf untenstehender Abbildung dargestellt, vorgelesen wird. Anschließend sollen die Kinder entscheiden, wo Maxi suchen wird. Die Schwierigkeit der Aufgabe liegt in der Erkenntnis, dass individuelles Handeln von subjektivem Wissen und nicht von der objektiven Außenwelt geleitet wird. Dabei zeigt sich, dass erst ab einem bestimmten Alter erkannt wird, dass der eigene Informationsstand nicht dem des Protagonisten entspricht. Die Entwicklung einer Theory of Mind erfolgt als radikaler Schnitt zwischen dem Alter von 3 und 4, statt, wie Piaget annahm, im Alter von 7 Jahren. 3-Jährige Kinder ohne Theory of Mind können im beschriebenen Paradigma ihr Wissen nicht zurückstellen. Dafür ist nicht die Erinnerungsfähigkeit oder Aufgabenschwierigkeit ausschlaggebend. 4-Jährigen hingegen gelingt die Unterscheidung von eigenem Wissen und dem Wissen anderer, ebenso wie zwischen Überzeugung und Realität. Die Theory of Mind wird mit zunehmendem Alter ausdifferenziert und besser organisiert. So wird Menschen sukzessive immer deutlicher, dass sie gemäß selbst konstruierter Überzeugungen handeln, also im Sinne einer naiven Erkenntnistheorie. Ein Faktum ist selbstevident: Denken kann nicht ohne Gedächtnis vonstatten gehen. Wie die Habituationsmethode nahe legt, besteht praktisch schon bei der Geburt ein implizites Gedächtnis. Ein deklaratives Gedächtnis entwickelt sich erst mit der Sprachfähigkeit. Nach der Themenübersicht: 4. Entwicklung psychophysischer Funktionen 4.1 Kognitive Entwicklung c) Entwicklung des Gedächtnisses Artikel: Bauer, P.J. (1996). What do Infants Recall of Their Lives? 53 Mittels des so genannten Imitationsparadigmas untersuchte Bauer die Leistung des prozeduralen Gedächtnisses von Kleinkindern. Das Paradigma umgeht das Problem, dass man sich bei der Untersuchung von frühkindlichen Gedächtnisleistungen keinerlei sprachbasierter Methoden bedienen kann. In Bauers Untersuchungsaufbau lässt man Kinder verschiedene Aufgaben imitieren und überprüft nach einem bestimmten Zeitraum die Reproduktionsleistung. Die Aufgaben sind so gewählt, dass die Ausgangswahrscheinlichkeit für ein selbstständiges Zeigen der Verhaltensweise ohne ein vorher erfolgtes Imitationslernen äußerst gering ist. Bauer untersuchte Kleinkinder jeweils ca. 8 Monate nach dem Imitationslernen. Figure 1 stellt die Ergebnisse einer Untersuchung mit einer aus 4 Teilschritten bestehenden Aufgabe dar, wobei auf der Ordinate die Anzahl der korrekt ausgeführten Teilschritte abgetragen ist. Die Kinder der Kontrollgruppe, die keine Gelegenheit zu Imitationslernen hatten, werden als naive children bezeichnet. Die Differenz zwischen Experimentalund Kontrollgruppe (Figure 1)zeigt eindeutig den Effekt des 8 Monate zuvor erfolgten Imitationslernens und damit das Vorhandensein eines Langzeitgedächtnisses. Dabei hängt die Erinnerungsleistung insbesondere von drei Faktoren ab (Figures 2, 3, 4): 1. (Figure 2) Ist die Reihenfolge der Teilschritte zufällig (arbitrary) oder systematisch aufeinander aufbauend (enabling)? Die Kinder profitieren von einer logischen Abfolge der Teilschritte und memorieren solche Aufgaben besser. 2. (Figure 3) Wie oft wurde die Imitationsaufgabe geübt? Die Grafik zeigt, dass die Aufgabe ohne vorheriges Üben kaum beherrscht wird (die Abweichung des linken Balkens ist zufällig). Die Differenz zwischen linkem und rechtem Teil der Grafik zeigt den Effekt repetitiver Erfahrungen. 54 3. (Figure 4) Wurde den Kindern ein Erinnerungshinweis für die Reproduktion des Gelernten gegeben? Wie die Grafik zeigt, hat ein Erinnerungscue, einen positiven Effekt auf die Erinnerungsleistung (jeweilige Differenz zwischen grauem und schwarzem Balken). Fazit: Mit einem geeigneten Verfahren wie diesem Imitationsparadigma kann man nachweisen, dass schon Kleinkinder in der Lage sind, relativ komplexe Sachverhalte, die sie nur einmal gesehen haben, über Monate hinweg zu memorieren. Dabei nimmt die Reproduktionsleistung mit dem Alter zu. Eventuell besteht diese Fähigkeit auch schon vor dem Alter von 11 Monaten, jedoch kann dieser Zeitraum mit dem Imitationsparadigma nicht mehr untersucht werden. Artikel: Newcomb, N.S., Bullock Drummey, A., Fox, N.A., Lie, E., Ottinger-Alberts, W. (2000). Remembering Early Childhood: How Much, How and Why (Or Why Not) Im frühen Kindesalter tritt das paradoxe Phänomen der Kindheitsamnesie auf. Darunter versteht man die Tatsache, dass sich Kinder im Alter von 4 Jahren zwar an Gegebenheiten im Alter von 2 Jahren erinnern können, als Sechsjährige jedoch nicht mehr in der Lage sind, sich an Gegebenheiten im Alter von 4 Jahren zu erinnern. Man kann sich also mit 4 Jahren problemlos 2 Jahre zurückerinnern, mit 6 Jahren jedoch nicht mehr. Newcomb untersuchte dieses Paradox anhand des autobiographischen Gedächtnisses. Er stellte zwei Fragen: 1. Besteht das Problem der anscheinend fehlenden Erinnerung tatsächlich in der Erinnerungsleistung oder nur in der Wiedergabe der Gedächtnisinhalte? 55 2. Existiert eine implizite Erinnerung, auch wenn kein explizites Erinnern mehr möglich ist? Zu 1.: Hierzu liefert Newcomb folgenden Erklärungsansatz: Den Kindern fehlt die Erinnerung an die Quelle der „versprengten Erinnerungsfragmente“ einer Gegebenheit. Denn erst etwa im Alter von 6 Jahren bildet sich ein Quellengedächtnis heraus, welches solche Fragmente einem Ursprung zuordnet und somit ein Zusammenführen von Erinnerungen erlaubt. Vor der Bildung des Quellengedächtnisses erfolgt eine Kodierung von Gedächtnisinhalten über die mit der Gegebenheit assoziierten Affekte. Aufgrund dieser Reorganisation ist eine Wiedergabe länger zurückliegender Gegebenheiten mit 6 Jahren nicht möglich. Es fehlen also nicht die Erinnerungen, sondern sie können aufgrund der nun veränderten Kodierung nicht mehr wiedergegeben werden. Zu 2.: Mittels einer Messung des Hautwiderstandes bei der visuellen Präsentation erlebter bzw. nicht erlebter Situationen/Personen stellte Newcomb fest, dass durchaus eine implizite Erinnerung besteht. Implikationen: Diese Befunde haben Auswirkungen auf die Psychologie der Zeugenaussagen. So ist es z.B. unrealistisch, dass eine 40-Jährige tatsächlich Erinnerungen an Missbrauch in ihrer frühen Kindheit (vor dem 6. Lebensjahr) hat. Dies gilt, wenn die Erinnerung plötzlich zu Tage tritt und nicht bereits während der zurückliegenden Dekaden aktiv war. Für die Beurteilung der Validität von Zeugenaussagen kann die Detailtreue als Kriterium herangezogen werden: Tatsächlich Erlebtes wird mit mehr Details, die nebensächlich sein können, erinnert als eingebildete Gegebenheiten. 12. Vorlesung vom 04.07.2006 PD Dr. Martin Pinquart in Vertretung für Prof. Dr. Silbereisen Nach der Themenübersicht: 4. Entwicklung psychophysischer Funktionen 4.2 Sprache Kapitel in Oerter/Montada (2002): Grimm, H., Weinert, S. (2002). Sprachentwicklung, S. 517-550 Einleitung: Modelle zur Sprache Eine wichtige Vorüberlegung zum Thema Sprachentwicklung ist die Frage, aus welchen Komponenten Sprache besteht. Lange Zeit war das Drei-Komponenten-Modell von Karl Bühler verbreitet, welches Sprache drei Funktionen zuweist: Darstellung, Ausdruck und Appell (Kommunikation). Heute bestehen komplexere Ansätze wie das Komponentenmodell der Sprache von Snow (1991) und Tracy (2000). Es unterscheidet die folgenden Komponenten: • Prosodik: Sprachmelodie und Sprachrhythmus • Phonologie: bedeutungsdifferenzierende Lautstruktur • Morphologie: Regeln der Wortbildung • Lexikon (Bedeutung von Worten) • Semantik (Bedeutung von Sätzen) • Syntax: Regeln der Kombination von Worten zu Sätzen • Pragmatik: Anpassung an Kontext, z.B. Struktur einer Erzählung, Regeln der Gesprächsführung 56 Evidenz für die Gültigkeit des hier postulierten Modells liefern selektive Störungen und Defizite einzelner Komponenten, z.B. der Syntax bei Menschen mit Down-Syndrom oder der Pragmatik bei Autisten. Bei der Beschäftigung mit Sprachentwicklung stellt sich eine bedeutsame Frage: Wie können Kleinkinder mit ihren begrenzten kognitiven Fähigkeiten Sprache, eine hochkomplexe Leistung, erlernen, während andere Domänen aufgrund der Begrenztheit nur rudimentär entwickelt sind? Die Aufgabe des Spracherwerbs Es gibt zwei Hypothesen dazu, wie Kinder Sprachen erweben: 1. Die erste besagt, dass Spracherwerb durch Imitation der Erwachsenensprache vonstatten gehe. Dass dies nicht zutreffend ist, zeigt allerdings die Tatsache, dass sich Kindersprache eindeutig von der Sprache Erwachsener unterscheidet. Sie ist dabei keine vereinfachte oder fehlerhafte Kopie, sondern besitzt eigenen Satzbau und Wortschatz. 2. Viel eher trifft eine zweite Hypothese zu, welche besagt, dass Spracherwerb ein aktiver, schöpferischer, impliziter, nicht bewusster und interaktiver Lernprozess sei. Stufen des Spracherwerbs Bei der Untersuchung von Sprachentwicklung taucht das Problem auf, dass Sprache selbst zu einem früheren Zeitpunkt beherrscht wird als die Fähigkeit zur Reflexion darüber. Während das erste Wort meist zwischen 10 und 14 Monaten gesprochen wird, sind Kinder erst im Alter von ca. 5 bis 6 Jahren zur Reflexion über Sprache in der Lage. Somit eignet sich zur Untersuchung von Säuglingen und Kleinstkindern vor allem die Habituationsmethode. Sprachentwicklung wird zumeist anhand von fünf Teilaspekten betrachtet, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten einsetzen und ab dann parallel verlaufen: 1. Rezeptive Entwicklung von Phonologie und Prosodik 2. Produktive Entwicklung von Phonologie 3. Entwicklung des Lexikons 4. Entwicklung der Syntax 5. Entwicklung der Pragmatik 1. Rezeptive phonologisch-prosodische Entwicklung (Entwicklung des Verständnisses von Sprachmelodie) Säuglinge können bereits einzelne Silben und die Sprachmelodie ihrer Mutter von der anderer Personen unterscheiden. Sie sind ferner sensitiv für suprasegementale prosodische Merkmale der Sprache. So können 10 Monate alte Kinder ihre Muttersprache von Fremdsprachen unterscheiden. Dies untersuchten Jacques Mehler et al. anhand der Habituationsmethode. Ein Schnuller registrierte die Frequenz von Saugbewegungen der Säuglinge, welche als Indikator von Aufmerksamkeit gewertet wurden. Dabei wurden französischen Kindern sowohl französische, russische als auch Wörter in einer dritten Sprache als Kontrollbedingung präsentiert. Es zeigte sich eine erhöhte Aufmerksamkeit für französische Wörter. Jener Effekt tritt nicht auf, wenn die Wörter der Muttersprache in einer anderen Sprachmelodie oder z.B. rückwärts vorgespielt werden. Daraus lässt sich folgern, dass das diskriminative Merkmal zur Identifizierung der Muttersprache im Säuglingsalter allein die Sprachmelodie ist. Diese Fähigkeit wurzelt in der pränatalen Konfrontation mit der Stimme und Sprache der Mutter. In einem Experiment von 1987 wurde Säuglingen das Märchen Cinderella in zwei verschiedenen Weisen vorgelesen: einmal mit üblicher Pausensetzung und einmal mit einer die Sinneinheiten 57 missachtenden Pausensetzung. Es zeigte sich, dass Kinder bereits ab dem 7. Lebensmonat Sprachbeispiele bevorzugen, bei denen Pausen an grammatisch sinnvollen Stellen stehen. Außerdem bevorzugen Säuglinge eine überdeutlich betonte, übertrieben intonierte Sprechweise, welche als „Ammensprache“ in der Kinderbetreuung seit jeher Anwendung findet. Bis zum Alter von sechs Monaten können Neugeborene zwischen allen möglichen Lauten differenzieren. Bis zum 10. Lebensmonat geht die maximale Anzahl diskriminierter Laute zurück. Jene Laute, welche in der Muttersprache nicht gebräuchlich sind, können dann weder diskriminiert noch produziert werden. So verlieren Asiaten beispielsweise die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen „l“ und „r“. 2. Produktive phonemische Entwicklung (Sprachproduktion) a) Erste vorsprachliche Phase: Von Geburt an tendiert ein Mensch zu Lautäußerungen, die durch viszerale Gegebenheiten ausgelöst werden. Neugeborene äußern sich durch Schreien, auf welches die Eltern durch Aufmerksamkeitszuwendung in Form von sprachlicher oder körperlicher Zuwendung reagieren. Dabei folgen die gebildeten Laute einem reflexartigen Schema. b) Zweite vorsprachliche Phase (2.- 4. Monat): Ab der 6. – 8. Woche beginnen Kinder, tief in der Kehle Gurrlaute zu erzeugen und zu lachen. Außerdem werden erstmals Vokale und Konsonanten nachgeahmt, wobei „Ammensprache“ unterstützend wirkt. Dabei erlernt das Kind basale Regeln der Gesprächsführung, z.B. indem die Mutter das Kind „ausreden“ lässt. Insgesamt erfolgt eine Zunahme spontaner Lautproduktion. c) Dritte vorsprachliche Phase (6.- 9. Monat): Sie stellt eine Übergangsphase zwischen vorsprachlicher und sprachlicher Entwicklung dar. Die Kinder beginnen zu lallen und bilden einfache Silben, die sie in Lallmonologen und -dialogen wiederholen. d) Erste sprachliche Phase (10.- 14. Monat): Es erfolgt eine Produktion erster über Assoziationslernen (s.u.) erworbener Wörter. e) Zweite sprachliche Phase (ca. ab 18. Monat): Diese Phase wurde von Bühler als „Was-Frage-Alter“ bezeichnet. Kinder setzen Fragen aktiv zum Wissenserwerb ein. Damit einhergehend erfolgt ein sprunghafter Anstieg des Wortschatzes von etwa 50 Wörtern im Alter von eineinhalb Jahren auf ca. 200 Wörter im Alter von zwei Jahren. 3. Lexikalische Entwicklung (Entwicklung der Wortbedeutungen) Erste Wörter sind konkrete Wörter, die sich meist auf soziale Sachverhalte und Personen beziehen. Oft entstammen sie nicht dem Wortschatz der Erwachsenen, sondern sind Schöpfungen der Kindersprache, z.B. „Wau-wau“ oder „Mama“. Erst später erlernen Kinder abstraktere Wörter, die sich auf innere psychische Zustände beziehen. Diese Einwortsätze entsprechen nicht immer der gewöhnlich von Erwachsenen verwendeten Bedeutung. Vielmehr kann es zu Übergeneralisierungen und Überspezifizierungen kommen, z.B. wird eine Katze auch als „Wau-wau“ bezeichnet bzw. nur der Familienhund ist „Wau-wau“. Diese „Fehlleistungen“ rühren aus der Schwierigkeit beim Assoziationslernen, d.h. der Zuordnung eines Wortes zu einem Gegenstand. Ein Säugling behilft sich bei der Zuordnung einer Bedeutung zu einem neuen Wort mit drei Annahmen. Diese Regeln (constraints) wurden von Markman formuliert: a) Ganzheitsannahme: Das gesamte Objekt wird mit dem genannten Begriff belegt, z.B. wird mit „Hase“ nicht nur die Pfote assoziiert. b) Taxonomieannahme: Alle ähnlichen oder identischen Objekte werden mit dem gleichen Begriff belegt. 58 c) Disjunktivitätsannahme: Ein Objekt kann nur mit einem Begriff belegt sein. Befinden sich zwei Objekte in Nähe zueinander und ist nur eines von ihnen mit einem Begriff belegt, wird das neue Wort dem unbekannten Objekt zugeschrieben. Dies kann zu Problemen führen, weil z.B. ein Fußballer auch als Stürmer bezeichnet werden kann und Stürmer dann z.B. der Eckfahne zugeordnet werden kann. Diese Annahmen sind für den frühen Erwerb von Worten zweckmäßig, reichen jedoch nicht für den Erwerb komplexerer Sprachfertigkeiten aus. Für den Erwerb von Verben bestehen syntaktische Regeln. So taucht ein Verb meist nur in Kombination mit bestimmten Subjekten oder Objekten auf, was als Hinweis das Erlernen des Verbs erleichtert. Schwierigkeiten treten allerdings beim Erlernen abstrakter Verben wie z.B. „denken“ auf. 4. Syntax: Bildung von Sätzen Schon bei Zweiwortsätzen, welche erstmals im Alter von ca. 18 Monaten verwendet werden, ist eine Syntax unabdingbar. In Zweiwortsätzen stehen Verben oder Adjektive immer am Ende. In den darauf folgenden Dreiwortsätzen nimmt das Verb die mittlere Position ein. Während zunächst nur einfachste grammatikalische Konstruktion beherrscht werden (telegrafische Sprache), werden im Alter von 4 Jahren die wesentlichen grammatikalischen Strukturen der Muttersprache beherrscht. Erst im Alter von 5 bis 8 Jahren erwerben Kinder metalinguistisches Sprachwissen, d.h. sie vermögen über Syntax zu reflektieren. Da das Erlernen von Sprache bisher lediglich implizit erfolgte, kommt es nun aufgrund der neu erworbenen Reflexionsfähigkeit zu einem zeitweiligen Anstieg grammatikalischer Fehler. 5. Entwicklung der pragmatischen Sprachkompetenz Schon ca. ab dem 9. Monat erfolgt intentionales Kommunizieren mit Gesten. Im Alter von 3 Jahren beginnen Kinder, sich auf ihren Kommunikationspartner einzustimmen: sie passen zunächst ihre Sprachmelodie, später auch den Gesprächsinhalt dem Gegenüber an und berücksichtigen so den sozialen Kontext. Allgemeine theoretische Annahmen über Sprachentwicklung In der Sprach- und Entwicklungspsychologie gibt es vier allgemeine Annahmen: 1. Sprache ist humanspezifisch und hat eine biologische Basis: In den 1950er Jahren wurde versucht, Primaten Sprache beizubringen, was allerdings schon an den physiologischen Voraussetzungen (Kehlkopf / Glottis) scheiterte. Die Menschenaffen vermochten nach enormem Trainingsaufwand, wenn überhaupt, bis zu vier Wörter zu sprechen. Erfolgreicher waren Versuche, Primaten Symbolsprache beizubringen, mit der sie einfache Sätze bilden konnten. Dies gilt ebenso für Menschenaffen, denen die Gebärdensprache beigebracht wurde, mit der sie sogar Neologismen bilden konnten. Allen diesen Versuchen ist aber gemein, dass die Tiere niemals auch nur annähernd die grammatikalische Komplexität der menschlichen Sprache erreichten. 2. Kinder sind für den Spracherwerb vorbereitet. Strittig ist allein, ob es sich dabei, wie Noam Chomsky und einige Andere vermuten, um eine angeborene universelle Grammatik handelt oder aber (lediglich) um eine angeborene Lernbereitschaft. 3. Ohne sprachliche Umwelt ist Spracherwerb nicht möglich, dies demonstrieren die Beispiele der isoliert aufgewachsenen Jeannie und Caspar Hauser. Allerdings bedeutet dies nicht, dass die aus der Umwelt erfolgende Stimulation verbal sein muss. So lernen Taubstumme analog zu 59 Hörenden Zwei- und Dreiwortsätze. Der Prozess des Spracherwerbs ist also sehr robust gegen Abweichungen der Umwelt bzw. der eigenen perzeptuellen Fähigkeiten. 4. Innere Voraussetzungen des Kindes und äußere Faktoren müssen im Sinne gelungener Passung zusammenwirken Allgemeine kognitive Voraussetzungen des Spracherwerbs • Sensorisch-kognitive Differenzierungsleistungen (Sensitivität für Regeln des Sprachangebots) • Lern- und Gedächtnisfähigkeit: Eine höhere Arbeitsgedächtnisleistung ist ein Prädiktor für besseren Spracherwerb Sozial-kognitive Voraussetzungen • Geteilte Aufmerksamkeit von Kind und Bezugsperson ist erforderlich, z.B. beim Assoziationslernen eines neuen Begriffes für ein Objekt • Imitationsfähigkeit: die für das Kind neu zu erlernenden Laute dürfen in ihrer Komplexität nicht die Fähigkeiten des Kindes übersteigen Sozial-kommunikative Voraussetzungen • Ammensprache unterstützt den Spracherwerb des Kindes. Wie Kuhl (1997) zeigte, differenzieren Erwachsene die verschiedenen Vokale stärker, wenn sie mit Kindern sprechen. • Unterstützende Sprache von Bezugspersonen („Was ist denn das hier?“) wirkt, insbesondere in dialogischer Form, als Anregung und selektive Bekräftigung der Vokalisation des Kindes • Ab dem 24.-27. Monat des Kindes reden Eltern in „lehrender Sprache“, d.h. sie erklären dem Kind aktiv Begriffe und greifen korrigierend ein, wenn es Fehler in Aussprache und Grammatik macht. Interindividuelle Unterschiede im Spracherwerb • Geschlechtsunterschiede: Mädchen lernen zunächst schneller als Jungen. Diese Unterschiede in den Sprachfähigkeiten gleichen sich aber bis zum Alter von ca. 6 Jahren aus. Die anfangs höhere Lerngeschwindigkeit von Mädchen rührt möglicherweise aus deren geringeren kortikalen Hemisphärenspezialisierung • Sozialschicht: Wie oben angeführt ist die Rolle der Eltern (Stimulation, Korrektur, etc.) beim Spracherwerb essentiell. Eltern aus niedrigeren sozialen Schichten sind dabei weniger qualifiziert und engagiert. In unteren Schichten bestehen bis zu 20 % des Gesprochenen aus Verboten, wohingegen in höheren Schichten kaum Verbote, sondern vor allem Anregungen gegeben werden. • Zwillinge: Einen Zwilling zu haben, hemmt den Spracherwerb aus drei Gründen: o Zwillinge haben im Mutterleib ungünstigere Bedingungen o Zwillinge müssen die Aufmerksamkeit ihrer Mutter teilen o Zwillinge entwickeln oftmals eine eigene Zwillingssprache und grenzen sich damit in ihrer Kommunikation ab 13. Vorlesung vom 11.07.2006 (letzte Vorlesung im Sommersemester 2006) Nach der Themenübersicht: 4. Entwicklung psychophysischer Funktionen 4.3 Soziale Kognition Vorlesung bezieht sich, wenn nicht anders genannt (Artikel), auf: 60 Silbereisen, R.K. & Ahnert, L. (2002). Soziale Kognition – Entwicklung von sozialem Wissen und Verstehen. Kapitel in Oerter/Montada (2002), S. 590-618 Soziale Kognition Soziale Kognition hat zweierlei Bedeutungen: Soziologen verstehen unter dem Begriff die Kognition über Soziales, z.B. das Denken über Stereotype. In der Entwicklungspsychologie meint soziale Kognition Denkprozesse, die sich auf soziale Sachverhalte beziehen, z.B. die Theory of Mind. Triadisches Denken Die untenstehende Abbildung 17.1 stellt Varianten sozialer Kognition dar. Dabei bezeichnet S Subjekt bzw. self und O Objekt bzw. others. Die obere Hälfte der Abbildung zeigt zunächst (Pfeil oben links) selbstreflexives Denken, d.h. das Denken über sich selbst. Die obere Zeile stellt die dyadische Interaktion mit einer zweiten Person dar, wobei der gestrichelte Pfeil einen Denkprozess und der durchgezogene Pfeil eine Handlung repräsentiert. Bei sozialer Kognition interessiert also auch, wie das Denken Verhalten beeinflusst. Der nach unten gerichtet Pfeil stellt einen Denkprozess über eine Gruppe oder eine Interaktion mit einer Gruppe dar, deren Teil das Subjekt sein kann. Ferner zeigt der untere Teil der Abbildung das Denken über Gruppen und sowohl die eigene Interaktion als auch die Interaktion Dritter mit einer Gruppe. Beispielsweise denkt Professor Silbereisen entweder darüber nach, wie er mit Studenten spricht oder wie Frau von Lipinski mit Studenten spricht. Menschen und Primaten zeichnet diese triadische Art zu denken aus. Intentionalität und Kausalität Wie auch im oben angegebenen Kapitel von Oerter/Montada thematisiert, stellt sich die Frage, was soziale Kognition von anderen Arten der Kognition unterscheidet. Menschen sind schließlich etwas anderes als Gegenstände. Spelke untersuchte 7 Monate alte Säuglinge und stellte fest, dass diese neben Wissen um Gegenstände bereits Wissen um Kausalität zwischen Personen, d.h. um Intentionalität, besitzen. Im Habituationsparadigma wunderten sich (dishabituierten) Kinder über zwei Klötze, die sich nach Berührung beide in entgegengesetzter Richtung bewegten. Wurden die Klötze durch Personen ersetzt, fand eine Habituation statt, d.h. die Kinder erwarteten eine solche Bewegung durchaus. Säuglinge unterscheiden also bereits Kausalität (Objekte) und Intentionalität (Subjekte). Artikel: Tomasello, M. (1998). Uniquely Primate, Uniquely Human Dies wirft die Frage auf, ob Primaten diese Unterscheidung ebenfalls zu treffen wissen, teilen diese doch wesentliche Eigenschaften mit dem Menschen. Primaten haben eine machiavellistische Intelligenz, also eine ausbeuterische soziale Intelligenz. Sie können sehr raffinierte Strategien zum eigenen Vorteil bilden. 61 Wie Table 1 zeigt, beherrschen sie die triadische Interaktion. „Protected Threat“ ist eine Variante des bekannten „Sonst hole ich meinen großen Bruder“. So wird der normalerweise vor Z zurückschreckende X durch die Anwesenheit seines stärkeren Verbündeten Y gegenüber Z aufbegehren. Das speziell Menschliche an der triadischen Interaktion ist die Fähigkeit, Intentionalitäten zu erkennen. Beispielsweise vermögen Primaten nicht zu begreifen, warum Maxis Mutter (MaxiParadigma, siehe VL vom 29.06.) die Süßigkeit versteckt. Menschen hingegen verstehen bereits mit 3-4 Jahren die intentionalen Hintergründe von Handlungen. Dass Primaten diese Fähigkeit nicht innehaben, beweist auch die Art ihrer Kommunikation. So können sie lediglich imperativ („Geh weg da“), jedoch nicht deklarativ („Sieh mal die schöne Banane“) kommunizieren, wie dies Menschen tun. In Figure 2 unterscheidet Tomasello Kausalität und Intentionalität. Der obere Teil der Abbildung stellt einen Vorgang dar, den auch Primaten hinsichtlich der Kausalität verstehen. Über Beobachtungslernen erkennen sie Möglichkeiten für das Herunterfallen von Früchten. Der untere Teil der Abbildung stellt einen Vorgang dar, der lediglich von Menschen interpretiert werden kann, weil er ein Verständnis von Intentionalität erfordert. Wenn der Beobachter verstehen soll, warum das Subjekt flieht, muss er sich in die Perspektive dieses Subjekts versetzen können, also eine Theory of Mind besitzen. Beide Vorgänge können vom Menschen durchschaut werden. Primaten hingegen sind nur zum Erkennen von Kausalität imstande. Eine Frage philosophischen Charakters ist, welche der beiden Prozesse zuerst angelegt war. Tomasello vertritt die Auffassung, dass Vorformen des triadischen intentionalen Denkens vor dem triadischen kausalen Denken stehen. 62 Wenn dem so wäre, würde dies die Bedeutung sozialer Kognition noch verstärken. Dieses Verstehen von Intentionen Anderer erlaubt erst die Entwicklung von Kultur, welche „das Produkt vieler erstarrter wechselseitig manipulierter Vorgänge ist“ (Prof.). Fazit: Soziale Kognition ist Menschen und Primaten gemein und stellt somit deren gemeinsames Erbe des triadischen Denkens dar. Das Verstehen von Intentionalität bei der Beobachtung anderer ist hingegen eine rein menschliche Fähigkeit. Weitere Beispiele für soziale Kognition Im Kapitel aus Oerter/Montada sind neben der Theory of Mind noch viele andere Formen von sozialer Kognition dargestellt. Eine davon ist die Personenwahrnehmung. Betrachtet man die Entwicklungslinien der Personenwahrnehmung wird offenbar, dass jüngere Kinder Personen vor allem anhand offensichtlicher Eigenschaften wahrnehmen und beschreiben (z.B.: Aussehen oder Wohnort). Mit zunehmendem Alter orientiert sich die Personenwahrnehmung zunehmend an inneren psychischen Vorgängen (z.B. „Warum ist diese Person gerade traurig?“). Außerdem erfolgt eine bessere Organisation höherer Ordnung, welche situative Differenzierungen in der Personenwahrnehmung erlaubt. Hinsichtlich der Personenkonzepte scheinen Kinder am Verhalten, Jugendliche stärker an psychischen Dispositionen und deren situativer Differenzierung orientiert. Ein weiteres Beispiel sozialer Kognition ist die Perspektivenübernahme, was ein Verstehen von psychischen Zuständen und Prozessen anderer Personen durch ein Erkennen der Situationsgebundenheit des Handelns (der Perspektive) und ein Ziehen der richtigen Schlüsse beschreibt. Die Untersuchung der Fähigkeit der Perspektivenübernahme leitet sich direkt von Piaget her. Kinder wurden aufgefordert, zu der in der untenstehenden Abbildung 17.2 dargestellten Bilderserie eine Geschichte zu erzählen. Anschließend wurde das vierte Bild entfernt und die Kinder sollten nun die Geschichte aus der Perspektive eines imaginären Dritten erzählen, der das zuvor entfernte Bild nie gesehen habe. Wenn die Kinder zur Perspektivenübernahme fähig waren, berichteten sie in ihrer Geschichte, dass der Reifen des Rollers lediglich aufgrund von herumliegenden Glasscherben kaputt gegangen sei. Waren sie nicht zur Perspektivenübernahme fähig, wurde der neue, d.h. reduzierte, Informationsstand nicht berücksichtigt. Es existieren zahlreiche ähnliche Paradigmen, z.B. zur emotionalen Perspektivübernahme, die das Verstehen von Emotionen aufgrund der Lage des Anderen bezeichnet. Aufgaben wie diese Bildergeschichte stellen derart hohe Anforderungen an die Informationsverarbeitung, dass sich nicht sagen lässt, ob eine vereinfachte Aufgabenstellung nicht früher die prinzi63 pielle Fähigkeit zur Differenzierung von sozialen Perspektiven zeigen könnte. Bei der dargestellten Bildergeschichte können 50 % aller Drittklässler eine korrekte Perspektivenübernahme ausführen, d.h. den reduzierten Informationsgehalt nach Entfernung eines der sieben Bilder berücksichtigen. Ein solches alternatives Paradigma mit reduzierten Anforderungen sieht wie folgt aus: Kindern wird eine Abbildung präsentiert, auf der die Puppe Toni einen Schatz versteckt, wobei sie Fußspuren hinterlässt. Nun werden die Kinder gefragt, was man tun könne, damit ein Betrachter den Schatz nicht mehr finde. In einer vorherigen Aufgabe wurde ein Schwamm zum Wegwischen von Elementen der Abbildung eingeführt. Die Kinder greifen nun entweder zum Schwamm und löschen die zum Schatz führenden Fußspuren oder legen falsche Spuren. Gefragt, wo der uniformierte Beobachter nun suchen würde, sind sie sich der Tatsache gewahr, dass er den Schatz nun nicht mehr ausmachen kann. Folglich sind die Kinder zur Täuschung und zum Vorenthalten von Informationen fähig. Etwa 70% aller Dreijährigen vermögen diese Perspektivenübernahme zu vollziehen. Hingegen waren Dreijährige kaum in der Lage, den Maxi-Versuch von Wimmer & Perner (1983) erfolgreich zu absolvieren. Herkunft von Wissen Die Untersuchungen zu falschen Überzeugungen setzten bei ihrer Deutung voraus, dass Kinder zunächst andere Grundelemente des Denkens beherrschen. Dazu gehört eine Vorstellung über die Herkunft von eigenem Wissen. Drei- bis vierjährigen Kindern ist nicht bewusst, dass Wissen über einen bestimmten Informationszugang erworben wird. So zeigten Wimmer et al. (1988), dass Kinder dieser Altersgruppe nicht verstanden, dass andere Personen bei gleichem Wissenserwerb das gleiche Wissen wie sie selber haben. Beispielsweise leugnete ein Dreijähriger, der zusammen mit einem anderen Kind in eine Schachtel sah, dass dieser andere nun dasselbe Wissen besitze wie er selbst. Dies rührt nicht aus dessen Egozentrismus, sondern aus dem Nichterkennen der ursächlichen Beziehung von In-die-Schachtel-Schauen und Wissenserwerb. Taylor et al. (1994) zeigten zudem, dass Kinder dieser Altersgruppe den Erwerb ihres Wissens zeitlich nicht gut einordnen können. Sie schätzten sowohl Altbekanntes als auch gerade erst Erlerntes als gleichwertig vertraut ein. Die Entwicklung der Theory of Mind Schimpansen, die teilweise solche Grundelemente, z.B. das repräsentationale Denken, beherrschen, besitzen keine Theory of Mind. Es stellt sich also die Frage, ob diese Fähigkeit angeboren oder erworben ist, und was ihre Entwicklung befördert. Eine entscheidende Rolle spielt das mütterliche Modell. Einerseits können soziale Prozesse den Kindern fortlaufend vorgeführt werden („Sieh mal, das tut weh“). Daneben ist eine verbale Vermittlung solcher Sachverhalte möglich. Je expressiver und affektiver deren Umgang, desto früher entwickelt sich beim Kind eine Theory of Mind. Eltern können einen Stil zeigen, der als Induktion bezeichnet wird. Im Kern geht es dabei um eine Schilderung von Gedankengängen anderer, die ein Nachvollziehen von Intentionen und somit die Entwicklung einer Theory of Mind befördern sollen. Beispielsweise könnten Eltern anstatt eines plumpen Verbotes „Geh jetzt ins Bett“ dem Kind induktiv ihr Anliegen darlegen: „Wir würden jetzt gerne alleine sein. Du möchtest sicher auch nicht, dass immer jemand in dein Zimmer mitkommt, wenn Du schlafen willst.“ Ein solcher Stil ist aufgrund elterlicher Routine und Zeitmangel nicht immer zu verwirklichen. Unabhängig von Alter und Intelligenz ist er jedoch der Formung von prosozialen, d.h. empathischen und hilfsbereiten, Individuen zuträglich. Unterschiede in der Soziabilität wurzeln in Unterschieden in der sozialen Kognition. Ferner kann kein prosoziales Verhalten – das ja auf der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme beruht – ausgebildet werden, bevor Kinder nicht zu einer Selbst-Andere-Differenzierung in der Lage sind. Diese Differenzierung erlaubt eine Umsetzung von Empathie in Sympathie und etabliert sich zwischen dem 16. und 24. Lebensmonat. Sie äußert sich beispielsweise im Erkennen des eigenen 64 Spiegelbildes. So werden Kinder ohne Selbst-Andere-Differenzierung zwar von der Traurigkeit einer Bezugsperson angesteckt, vermögen aber nicht, diese zu trösten. Fazit: Soziale Kognition ist eine fundamentale Voraussetzung für Verhaltensweisen, die das menschliche Zusammenleben bestimmen, d.h. für das Sozialverhalten. Sie entwickelt sich in einem individuellen Lebenslauf umso früher, je mehr in sozialen Interaktionen Gegenstände behandelt werden, die mit den Perspektiven dritter zusammenhängen. Frühe Vorläufer von sozialer Kognition Artikel: Wellman, H.M., Phillips, A.T., Dunphy-Lelii, S., LaLonde, N. (2004). Infant Social Attention Predicts Preschool Social Cognition Wellman, einer der Pioniere der Forschung zur Theory of Mind, untersuchte, ob es schon vor dem Alter von 2 Jahren Vorboten für die Bildung einer Theory of Mind gebe. Er präsentierte ca. 14 Monate alten Kindern eine Beobachtungsaufgabe. Darin war ein Erwachsener zu sehen, der abwechselnd auf zwei Objekte schaute, wobei er in der einen Richtung eine interessierte, in der anderen Richtung eine desinteressierte Miene machte. Wie in einem Habituationsparadigma wurde die Aufmerksamkeitsdauer der Kinder registriert. Wenn das Kind bereits ein rudimentäres Verständnis von Intentionalität besitzt, schaut es länger auf das Objekt, bei dessen Betrachtung der Erwachsene interessiert scheint. Die zeitliche Differenz zwischen den Aufmerksamkeitszuwendungen zu beiden Blickrichtungen wird als Maß für das kindliche Verständnis von social intention interpretiert. Mit denselben Kindern führte Wellman im Alter von 4 Jahren verschiedene Aufgaben zur Erfassung der Ausprägung der Theory of Mind durch. Dabei fand er zwischen den beiden Altersabschnitten Korrelationen zwischen .50 und .60, die auch bei einer Berücksichtigung der Intelligenz bestehen blieben. Hinderliche Faktoren bei der Ausbildung sozialer Kognition Familiäre Belastung: Beardslee et al. (1987) zeigten, dass Kinder mit mindestens einem depressiven Elternteil Probleme hatten, die Bedürfnisse ihrer verschiedenen Interaktionspartner zu erkennen, da ihre Eltern nicht den Anforderungen eines für die soziale Kognition förderlichen, d.h. responsiven und empathischen, Interaktionspartners gerecht wurden. Dodge entwickelte eine Theorie darüber, welche Faktoren und Schritte an der Entstehung von Aggression beteiligt sind. Dodge et al. (1995) untersuchten in einer Längsschnittstudie Kinder, die Opfer von Misshandlungen geworden waren. Außerdem zeigten die missbrauchten Kinder viermal häufiger Verhaltensauffälligkeiten als eine Kontrollgruppe. Dieser Unterschied war zu einem Drittel auf eine schlechter ausgeprägte soziale Kognition zurückzuführen. Die ehemaligen Missbrauchsopfer verfügten über ein geringeres Repertoire an nicht-aggressiven Verhaltensweisen und über eine schlechtere Einschätzung sozialer Situationen. Soziale Kognition dient also als Vermittler zwischen Missbrauch und späterer Verhaltensauffälligkeit (v.a. aggressives Verhalten): ein missbrauchtes Kind wird missachtet, und schreibt anderen verstärkt Aggressionen zu. Dieses Defizit rührt aus verminderten Möglichkeiten zur sozialen Interaktion, anhand welcher soziale Kognition erlernt wird. Interventionsprogramme berücksichtigen deshalb die Schlüsselrolle sozialer Kognition und versuchen erfolgreich, diese zu fördern. Soziale Kognition im hohen Alter Ältere Menschen versuchen eine Ressourcen schonende soziale Kognition zu betreiben, indem sie sich verstärkt auf für sie pragmatisch bedeutsame Aspekte konzentrieren. Jüngere Menschen sind eher bereit, Änderungen anderer Menschen („vom Saulus zum Paulus“) zu akzeptieren und in ihre Personenwahrnehmung zu integrieren. Ältere Menschen hingegen sind skeptischer und handeln nach dem Prinzip der Selektion, Optimierung und Kompensation (SOK-Modell). Diese „Altersstarrheit“ ist auch eine Folge eines größeren Wissens und Erfahrungsschatzes. 65
