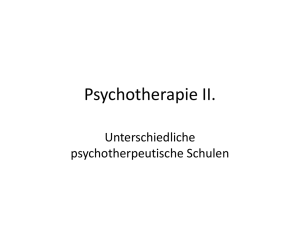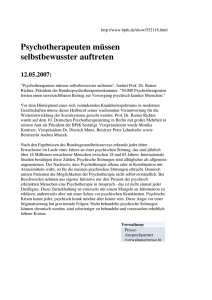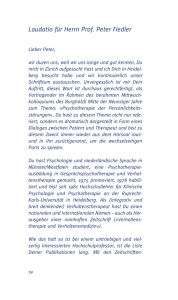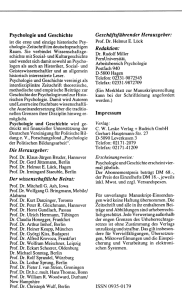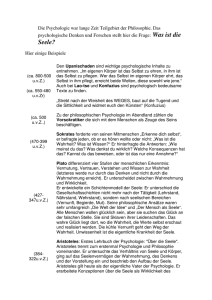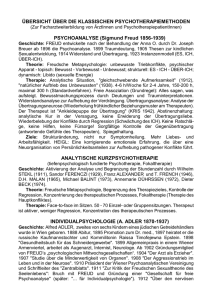schweizer charta für psychotherapie
Werbung

SCHWEIZER CHARTA FÜR PSYCHOTHERAPIE Wissenschaftskolloquium vom 25. März 2000 Diskussionsbeitrag von SGfAP und C.G. Jung-Institut Zürich 2.1. Gesundheitsverständnis, Krankheitsverständnis, Behandlungswürdigkeit Menschliches Sein entwickelt sich ausnahmslos von einem Anfang zu einem Ende. Während der Lebensablauf irreversibel ist, kann der Mensch in mente Künftiges vorwegnehmen und Vergangenes vergegenwärtigen. Auf Grund seiner anthropologischen Verfassung ist menschliches Sein gerichtet, so dass es Ziele haben, sie erreichen, aber auch verfehlen kann mit entsprechenden Folgen für die Befindlichkeit. Aber schon natürlicherweise ist es gekennzeichnet durch Aufbau, Reife, Zerfall und Tod. Für die psychische Ebene bezeichnet Jung diesen Vorgang als Individuationsprozess. Es handelt sich, besonders bei der therapeutischen Arbeit, um einen “bewussten Differenzierungsprozess” (Jung 1960, Definitionen), in dem es darum geht, die eigene Individualität wahrzunehmen und sie im Sinne einer Realisierung des mitbekommenem Potentials sowie auf ein (nicht inhaltlich, sondern bloss formal beschreibbares) optimales Sein hin zu leben. Es ist dies eine Aufgabe, die lebenslang zu leisten, als Ziel aber nie erreichbar ist. Das Gewissen als eine Leitfunktion zum Selbstsein ist eine Art “Massstab”, welcher das faktisch Erreichte am Möglichen misst und so anzeigt, ob ein Verhalten, eine Einstellung individuationsfördernd oder individuationshemmend ist. In dieser auf einem psychodynamischen Menschenbild beruhenden Sicht von Salutogenese könnte man daher ein mehr oder weniger gelingendes Sein als psychisch “gesund” bezeichnen. Die Theorie Jungs unterscheidet bewusste und unbewusste seelische Aktivitäten. Als sich selbst regulierendes System sucht die Psyche das Gleichgewicht (Homöostase) zwischen den Gegensätzen. Schwankungen im Gleichgewicht sind normal; einseitige Entwicklungen und Fixierungen können aber zu Störungen psychischer oder psychosomatischer Art führen, die oft auch die sozialen Beziehungen belasten. Ob es gelingt, ein ausgewogenes Verhältnis der Anpassung an die individuellen, persönlichen Seinsforderungen einerseits und an die gemeinschaftlichen Normen anderseits zu bewerkstelligen, kann darüber bestimmen, wie gesund oder wie gestört sich ein Mensch entwickelt (Jung 1924/45, § 172). Krankheit erscheint so als Ausdruck eines festgefahrenen psychischen Ungleichgewichtszustandes (Schlegel 2000) im Individuum, in dem die Selbstregulation nicht mehr spielt, weil lebensbehindernde Einseitigkeiten nicht mehr kompensiert werden können und auch nicht durch die “transzendente Funktion” (coincidentia oppositorum) ein neues Gleichgewicht gefunden werden kann (Enantiodromie). Der die innere Zerrissenheit heilende Ausgleich gelingt nur, wenn ein die Gegensätze vereinigendes Symbol sich konstelliert und dieses Veränderungsangebot vom Bewusstsein übernommen wird. Jung spricht in physikalischen Metaphern, indem er das Modell der Entropie zwischen Energiepotentialen für die psychische “Energie” oder “Libido”, übernimmt, welche zwischen Bewusstsein und “dem Unbewusstem” (als arbeitshypothetischer Begriff nicht zu hypostasieren) Spannung bzw. Ausgleich bewirkt. All dies gilt selbstverständlich nur für jene Störungen, die ihre Wurzeln in der 1 Lebensführung haben. Daneben gibt es ganz andere Wurzeln, etwa genetische (Beispiel Mongoloidie), epidemische (durch Viren u.ä. verursachte Erkrankungen) oder Unfälle, Katastrophen (z.B. Verstrahlung, Krieg), die meist überhaupt nicht oder nur teilweise von der eigenen Seinsverwirklichung beeinflusst sind. Von gewissen Krankheiten ist die Ätiologie überdies unsicher. Solche Lebensbeeinträchtigungen resultieren nicht aus persönlichem Versagen, sondern sind eher als “Verhängnis” zu sehen – daher verbietet sich jegliches “Moralisieren” gegenüber Patienten. Wie ein Mensch solches Geschehen in sein eigenes Sein “integriert”, wie er damit umgeht, ist oft entscheidend für den Einfluss, den die Störung auf sein Leben zu nehmen vermag, insbesondere auf seine psychische Gesundheit oder Gestörtheit. Im Rahmen der hier nicht weiter darzustellenden philosophischen Anthropologie, der Grundlage jeglicher psychotherapeutischer Theorie und Praxis (Keller 1974), können manche Symptome von Störungen geradezu als negative Indikatoren für eine selbsthafte Seinsgestaltung (Spengler 1964, S. 66) auftreten und damit hilfreich für die Therapie werden. In solchen Fällen ist es möglich, einen Sinn im Leiden zu erkennen, was die Einstellung zum Geschehen entscheidend verändern kann, sowohl im Hinblick auf Anstrengungen zur besseren Seinsbewältigung wie auch für das Akzeptieren von Unvermeidlichem. In der psychosomatischen Sicht des “Morbismus” (Ziegler 1979) erscheint “Krankheit als die beste aller Gesundheiten”, indem sie die Vereinseitigung der Lebensführung durch ein neues Gleichgewicht zwischen Rezessivem (zu wenig oder Ungelebtem) und Dominantem (Bevorzugtem) ablöst. Erkrankung wird da aufgefasst als “die Verwandlung von Rezessivem in körperliches Leiden”. Eine ähnliche Sichtweise ergibt sich auf Grund des Konzepts von “Ich” und “Schatten”. Bei vielen psychischen Erkrankungen liegt für Jung im Kern ein Mangel an “religio”. Damit ist aber nicht ein Glaubensbekenntnis zu einer der kollektiven Theologien gemeint, sondern ein Bezogensein zu einem höchsten oder stärksten Wert, wie er psychisch erlebt, erfahren wird; es ist der überwältigende psychische Faktor, welcher üblicherweise “Gott” genannt wird, psychologisch jedoch als Gottesbild bezeichnet wird. Jung nennt es “Selbst” und beschreibt damit eine integrierende und persönlichkeitszentrierende Funktion. Als psychische Grösse ist das Selbst nicht “jenseitig” im theologischen Sinn, sondern bewusstseinstranszendent. Erlebt werden seine Manifestationen aber ähnlich wie “Gotteserfahrungen” theologischer Art. Der Einbezug solcher psychischer Manifestationen, wie sie sich beispielweise in Träumen zeigen, ist oft hilfreich für eine Neuorientierung in Richtung einer gelingenderen Seinsgestaltung und damit einer Gesundung. Sinngemäss entspricht das Selbst als individuationsgerichtete Funktion dem Selbstwertstreben der philosophischen Anthropologie (Keller 1963, Spengler 1964, S. 120). Das Bezogensein auf und Berücksichtigen der Manifestationen des sogenannten Unbewussten im bewussten Leben ist erfahrungsgemäss oft präventiv gegen psychische Erkrankung. Dieses Bezogensein entspricht dem aktiv-bewussten Streben nach einem psychischen Gleichgewicht. Die Diagnosestellung erfolgt unter zweierlei Gesichtspunkten, einerseits nach psychiatrisch-psychopathologischen Kriterien (ICD-10), anderseits nach psychodynamisch-jungschen. Ob eine Störung bzw. Krankheit behandlungswürdig ist (Indikation), richtet sich primär nach dem Bedürfnis des Patienten, zunächst danach, ob er sich überhaupt in eine Psychotherapie begeben will. Die Leidenstoleranz ist erfahrungsgemäss höchst unterschiedlich. Zu beurteilen sind die Verlaufsprognose der 2 Störung und die Chancen ihrer Behebung. Auch das Ziel einer Therapie ist nach den individuellen Verhältnissen bzw. den anzunehmenden Fähigkeiten des Patienten gemeinsam mit ihm am Anfang vorläufig zu formulieren. Im Lauf der Therapie sind oft Diagnose, Prognose und Ziel zu modifizieren. 2.2. Therapieverständnis 2.2.1 Ziele der Psychotherapie Die Anwendung der Lehre C. G. Jungs ist “ein Heilsweg im doppelten Sinne des Wortes”, nämlich eine Behandlungsmethode für psychische Störungen und Krankheiten sowie ein Weg, den Menschen zu seinem individuellen “Heil” zu führen, zu einer Erkenntnis und Vollendung der eigenen Person (Jacobi 1959, S. 89). Psychotherapie im weiteren Sinne visiert somit Persönlichkeitsoptimierung an, während Psychotherapie im engeren Sinne sich mit der Behandlung psychischer Störungen und Krankheiten befasst. Da es auch Menschen gibt, die partiell an Störungen leiden, während sie in anderen Bereichen ihrer Persönlichkeit durchaus entwicklungsfähig sind, können sich die beiden Therapiearten auch überschneiden. Im Bereich des menschlichen Seins sind scharfe Begriffsabgrenzungen zwar wünschbar, infolge der Vielfalt und gegenseitigen Durchdringung und Verknüpfung der Phänomene jedoch nicht immer praktikabel. Individuation im Sinne eines möglichst verwirklichten Lebenspotentials, das immer auch die Entfaltung in den sozialen Bezügen umfasst, kann erfahrungsgemäss nur angestrebt, aber kaum erreicht werden. Von da her ist dieses Therapieziel schon bei Menschen, die als gesund gelten, bloss Postulat. Patienten mit Behinderungen ihrer Entfaltungsmöglichkeiten, vor allem in der Form umschriebener Krankheiten, sind in der Regel von diesem Therapieziel so weit entfernt, dass seine Ausformulierung gegenüber dem Patienten für diesen eine Überforderung bedeuten kann. Es müssen bei Störungen mit Krankheitscharakter vorwiegend näher liegende, konkreter fassbare Ziele angestrebt werden wie etwa die Lockerung und allmähliche Befreiung von einzelnen Beeinträchtigungen, das Wiedererlangen von bislang behinderten Äusserungs- und Gestaltungsfähigkeiten, die Neuorientierung von einschränkenden Einstellungen, zum Beispiel im Umgang mit andern Menschen. Dazu gehört auch, was mit der Wiederherstellung der Arbeits-, Genuss- und Liebesfähigkeit gemeint ist. Oft muss das Therapieziel gar reduziert werden auf die Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes, so dass keine Verschlechterung resultiert (Stabilisierung), und in gewissen Fällen ist die Sicherung des Überlebens auf Zusehen hin das vordringliche Ziel. Jung war Psychiater und von 1900 bis 1909 im “Burghölzli” stationär tätig. Seine Psychotherapiemethode entwickelte er auch auf Grund seiner klinischen Erfahrung mit Geistes- und Gemütskrankheiten (Jung 19061939). In der 1964 gegründeten Klinik am Zürichberg wurde die Psychotherapiemethode Jungs, gepaart mit moderner Psychiatrie, zur Behandlung von stationären Patienten angewandt (Fierz 1963). Im stationären Rahmen sind die Behandlungsziele vorwiegend die im vorangehenden Abschnitt beschriebenen. 2.4. Erforschung des soziopsychosomatischen Feldes Auf Grund der These, dass der Mensch eine “physiologische Frühgeburt” sei (Portmann 1944), und somit im “extrauterinen Frühjahr” in biologisch noch nicht “fixiertem”, noch “fötalem” Zustand bereits dem kommunikativen “Sog” seiner Bezugspersonen und seiner Umgebung ausgesetzt sei, ergibt sich ein sehr früher entwicklungspsychologischer Beginn des sozialen Menschseins. Doch wie sich in diesem Frühstadium Soma, Psyche und Sozialnetz verknüpfen und das grundsätzliche Offensein (“Trieb”entbundenheit) des Menschen ermöglichen, ist auch heute noch 3 weitgehend unbekannt und daher zu erforschen. Ist der Mensch also ein Zoon politikon, so kann eine psychotherapeutische Theorie sich nicht auf nur scheinbar “innerpsychisches” Geschehen beschränken, sondern hat stets die leiblichen und sozialen Aspekte miteinzubeziehen. Ein wichtiger Beitrag von Jung hierzu war die Ausweitung des Begriffs des Unbewussten bzw. des persönlichen Unbewussten auf das “kollektive Unbewusste”, jenes gemeinschaftliche menschliche Erbgut, das die Grundlage für die Entwicklung von individuell Psychischem darstellt. Die Inhalte des kollektiven Unbewussten sind nicht verdrängte oder vergessene, sondern sie “stammen aus der ererbten Möglichkeit des psychischen Funktionierens überhaupt, nämlich aus der biologischen Hirnstruktur”. Es sind die typischen menschlichen Reaktionsweisen, die “Patterns of behaviour”, die ihren Niederschlag im kollektiven Unbewussten gefunden haben. Schon 1912 sprach Jung von “Urbildern”, später von “Dominanten des kollektiven Unbewussten, und ab 1919 nannte er sie “Archetypen”, wobei er auf Grund von Missverständnissen und Kritik ab 1946 in Anlehnung an Kants Erkenntnistheorie unterschied zwischen dem nur denkbaren, unanschaulichen, bewusstseinstranszendenten Archetypus “an sich” und den “archetypischen Erscheinungen” in Form von erlebten Bildern, Vorstellungen, angeborenen Verhaltensweisen, wobei letztere schon im Tierreich aufzuweisen sind, etwa beim Weben eines Spinnennetzes. Der Archetypusbegriff bedürfte einer kritischen Aufgliederung in seine ontische, energetische, prägende, noetische und seine “zeugende” Funktion (Spengler 1964, S. 39 ff). Mit dem Begriff des “kollektiven Bewusstseins” umschrieb Jung anderseits die erzieherischen und gesellschaftlichen Normen, Traditionen, Zeitgeist und deren Bedeutung für die Entwicklung des Individuums. Er unterschied zwischen “moralischem” (anerzogenem, heteronomem) und “ethischem” (autonomem, letztlich aus dem “Selbst” sich manifestierendem) Gewissen. Zuweilen kann aus dem Konflikt zwischen den persönlichen und den kollektiven Ansprüchen eine Pflichtenkollision erwachsen (Beispiel Luther). Auch mit seiner Typenlehre bearbeitete Jung das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gemeinschaft, aber auch das zwischen Gruppen. Extraversion und Introversion sind zu Ausdrücken der Umgangssprache geworden. Der Begriff der Persona bezeichnet den Anteil des Ichs, welcher der Umwelt zugewandt ist und jenen Kompromiss zwischen Individuum und Sozietät darstellt über das, als was einer erscheint (z.B. positiv als geschätzter Staatsmann, negativ, wenn sich einer mit Amt und Titel so identifiziert, dass er das entsprechende Verhalten auch in den Ferien nicht aufgeben kann). Manche Beziehungen zwischen Individuen, aber auch zwischen Gruppen und ganzen Völkern, sind von Projektionen bestimmt. Schliesslich – ohne dass damit das Feld der sozialen Bezüge des Individuums abschliessend beschrieben wäre – hat Jung ein besonderes Augenmerk auf die in der therapeutischen Beziehung auftretenden Bezogenheitsphänomene gerichtet, die er in der Psychologie der Übertragung beschrieben hat (Jung 1945). Jung hat sich in seinem Werk auch mit Politik, Demokratie, Totalitarismus und Krieg auseinandergesetzt (Odajnyk 1975). Durch den Einbezug von Märchen und Mythen und anderem kulturhistorischem Material in den therapeutischen Prozess (Amplifikation) hat Jung eine immense Quelle von naturhaft-menschlichem Wissen erschlos4 sen und oft auch die entsprechenden Wissenschaften mit neuen Impulsen versehen. Sehr bedeutend ist auch der Einfluss seiner Religionspsychologie auf die aktuelle Theologie, für das Verständnis der religiösen Phänomene überhaupt und für die Bewältigung der religiösen Krisen vieler Menschen im Gefolge der Verblassung von einst wirksamen Dogmen. Seit seinen frühen klinischen Studien hat sich Jung für den innigen Zusammenhang zwischen Psyche, Leibgeschehen und Sozialbezug interessiert. Der psychophysische Konnex wird einerseits im Phänomen der emotionsgeladenen komplexbedingten Reaktionsstörung im Assoziationsexperiment deutlich; anderseits bewirkt der gefühlsbetonte Komplex in der Regel projektive Komplikationen in den mitmenschlichen Beziehungen. Er kann daher als Angelpunkt der Erfahrung und der Erforschung des soziopsychosomatischen Feldes gelten. Dies trifft oft auch bei psychosomatischen Symptomen zu. So schildert Ziegler den Fall einer Dame mit tröpfelnder Harninkontinenz. Dieses Symptom verschwand im Lauf der Therapie, doch fiel die Dame hinfort dadurch auf, dass sie ständig an den Personen in ihrer Umgebung herummäkelte und so überall “ihren S. dazu gab”, was für die sozialen Bezüge viel belastender war als das frühere “körperliche” Symptom (Ziegler 1979). Auch zwischen Magensymptomen und nicht geäusserter Aggressivität lassen sich Zusammenhänge feststellen. In diesem Sinne müsste der Begriff der Psychosomatik ersetzt werden durch jenen der Soziopsychosomatik. Ernst Spengler Literatur Fierz Heinrich Karl (1963), Klinik und Analytische Psychologie, Rascher Zürich Jacobi Jolande (1959), Die Psychologie von C.G. Jung, Rascher Zürich Jung Carl Gustav (1906-1939), Psychogenese der Geisteskrankheiten, GW 3, Walter Olten 1971 – (1924/45), Analytische Psychologie und Erziehung, GW 17, Walter Olten 1972 – (1945), Die Psychologie der Übertragung, GW 16, Rascher Zürich 1968 – (1960), Definitionen, GW 6, Rascher Zürich Keller Wilhelm (1963), Das Selbstwertstreben, Reinhardt Basel – (1974) Dasein und Freiheit. Der Methodenkonflikt in der Psychologie und das Problem des psychischen Seins, Francke Bern Odajnyk Wolodymyr Walter (1975), C.G. Jung und die Politik, Klett Stuttgart Portmann Adolf (1944), Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen, Schwabe Basel 1951 Schlegel Mario (2000), Der Wille und seine Bedeutung in der Analytischen Psychologie von C.G. Jung, im Druck in: Petzold Hilarion (Hrsg.), Der Wille in der Psychotherapie, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen Spengler Ernst (1964), Das Gewissen bei Freud anthropologischen Grundlegung. (Diss.) Juris Zürich und Jung. Mit einer philosophisch- Ziegler Alfred J. (1979), Morbismus, Raben-Reihe, Schweizer Spiegel Zürich 5