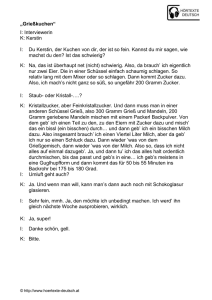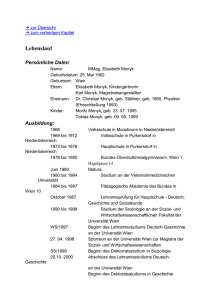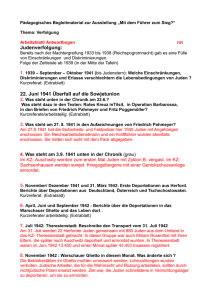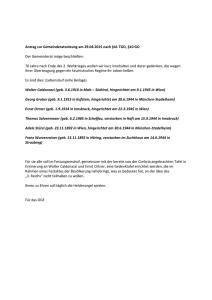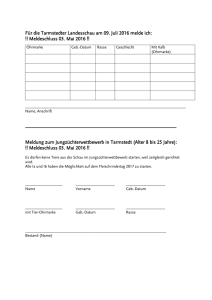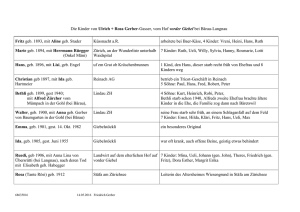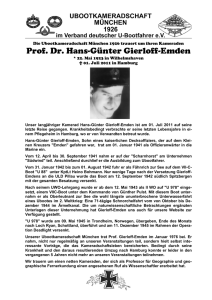Stolpersteine in Hamburg-Barmbek und Hamburg
Werbung
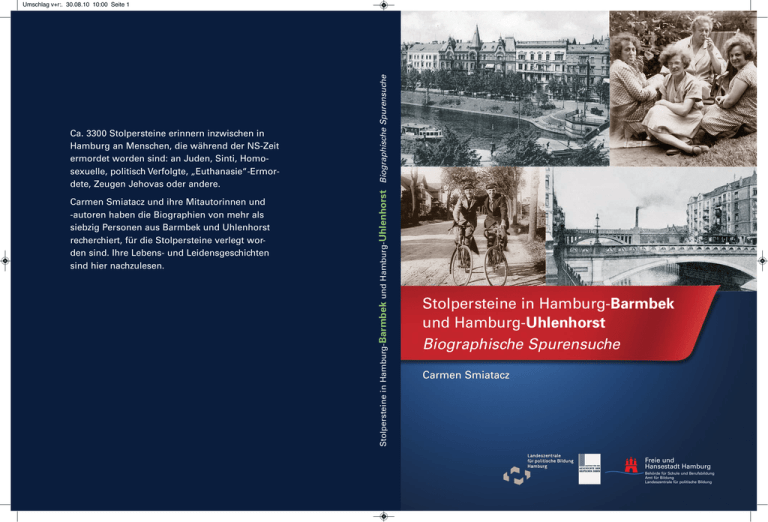
Ca. 3300 Stolpersteine erinnern inzwischen in Hamburg an Menschen, die während der NS-Zeit ermordet worden sind: an Juden, Sinti, Homosexuelle, politisch Verfolgte, „Euthanasie“-Ermordete, Zeugen Jehovas oder andere. Carmen Smiatacz und ihre Mitautorinnen und -autoren haben die Biographien von mehr als siebzig Personen aus Barmbek und Uhlenhorst recherchiert, für die Stolpersteine verlegt worden sind. Ihre Lebens- und Leidensgeschichten sind hier nachzulesen. Stolpersteine in Hamburg-Barmbek und Hamburg-Uhlenhorst Biographische Spurensuche Umschlag v+r:. 30.08.10 10:00 Seite 1 Stolpersteine in Hamburg-Barmbek und Hamburg-Uhlenhorst Biographische Spurensuche Carmen Smiatacz Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung Amt für Bildung Landeszentrale für politische Bildung 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 10:24 Seite 1 Carmen Smiatacz Stolpersteine in Hamburg-Barmbek und Hamburg-Uhlenhorst Biographische Spurensuche mit Beiträgen von Eva Acker Ulf Bollmann Ingrid Budig Erika Draeger Björn Eggert Bernhard Rosenkranz† Stefanie Rückner Ulrike Sparr 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 10:24 Seite 3 Carmen Smiatacz Stolpersteine in Hamburg-Barmbek und Hamburg-Uhlenhorst Biographische Spurensuche Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung Amt für Bildung Landeszentrale für politische Bildung 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 4 Die Landeszentrale für politische Bildung ist Teil der Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg. Ein pluralistisch zusammengesetzter Beirat sichert die Überparteilichkeit der Arbeit. Die Verfasserinnen/Verfasser dieser Reihe haben die Bildrechte eingeholt. Sollte dies nicht in allen Fällen möglich gewesen sein, bitten wir die Rechteinhaber, sich an die Landeszentrale zu wenden. Zu den Aufgaben der Landeszentrale gehören: © Landeszentrale für politische Bildung; Hamburg 2010. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die der Übersetzung, der Sendung in Rundfunk und Fernsehen und der Bereitstellung im Internet. – – – – – – – – Herausgabe eigener Schriften Erwerb und Ausgabe von themengebundenen Publikationen Koordination und Förderung der politischen Bildungsarbeit Beratung in Fragen politischer Bildung Zusammenarbeit mit Organisationen und Vereinen Finanzielle Förderung von Veranstaltungen politischer Bildung Veranstaltung von Rathausseminaren für Zielgruppen Öffentliche Veranstaltungen Unser Angebot richtet sich an alle Hamburgerinnen und Hamburger. Die Informationen und Veröffentlichungen können Sie während der Öffnungszeiten des Informationsladens abholen. Gegen eine Bereitstellungspauschale von 15 P pro Kalenderjahr erhalten Sie bis zu 6 Bücher aus einem zusätzlichen Publikationsangebot. Die Landeszentrale Hamburg arbeitet mit den Landeszentralen der anderen Bundesländer und der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen. Unter der gemeinsamen Internet-Adresse www.hamburg.de/politische-bildung werden alle Angebote erfasst. Die Büroräume befinden sich in der Dammtorstraße 14, 20354 Hamburg; Ladeneingang Dammtorwall 1 Öffnungszeiten des Informationsladens: Montag bis Donnerstag: 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag: 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr In den Hamburger Sommerschulferien: Montag bis Freitag: 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr Erreichbarkeit: Telefon: (040) 428 23-48 26 (Sprechzeiten Mo, Mi, Fr: 10–12 Uhr; Di u Do: 13.30–15.30 Uhr) Telefax: (040) 428 23-48 13 E-Mail: [email protected] Internet: www.hamburg.de/politische-bildung © Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Beim Schlump 83, 20144 Hamburg Projektleitung und Redaktion: Dr. Rita Bake/Dr. Beate Meyer Wissenschaftliche Betreuung: Dr. Beate Meyer Wissenschaftliches Lektorat: Joachim Szodrzynski Gesamtherstellung: Andrea Orth Druck: Roco-Druck, Wolfenbüttel ISBN: 978-3-929728-53-8 Abbildungen Umschlag Die Hartwicusstraße und der Eilbekkanal, Uhlenhorst, 1920er Jahre (o. l., Bildarchiv Hamburg); die Geschwister Kaufmann: Lissi, Käthe und Gertrud, dahinter Mutter Franziska Kaufmann (o. r., Privatbesitz); Willi Häussler (r.) mit einem Freund (u. l., Geschichtswerkstatt Barmbek); die Bramfelder Brücke, Barmbek, 1920er Jahre (u. r.; Geschichtswerkstatt Barmbek) Redaktionsschluss Zu allen Personen, für die bis April 2010 Stolpersteine verlegt oder deren Namen uns bis zu diesem Zeitpunkt bekannt wurden, finden Sie in dieser Broschüre Biographien. Für einige der bislang nicht verlegten Stolpersteine können Sie gerne noch Patenschaften übernehmen. Auskunft hierüber erteilt die Hamburger Stolpersteininitiative. 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 5 Inhalt Einleitung I Rita Bake/Beate Meyer__7 Die Namen in Erinnerung bringen Gunter Demnig__12 Die Hamburger Stolpersteininitiative __15 Einleitung II Carmen Smiatacz__16 Spurensuche im Stadtteil Erika Draeger__19 Erinnerungen eines Davongekommenen Erika Draeger__40 Stolpersteine in den Stadtteilen Barmbek und Uhlenhorst Übersichtsplan, Positionen, Nummerierung __42 Biographien von A bis Z Carmen Smiatacz__46 Anhang Glossar Beate Meyer__216 Zeitleiste der antijüdischen Maßnahmen und Aktionen __233 Zeitleiste „Euthanasie“ __235 Zeitleiste der politischen Verfolgung __236 Zeitleiste der Verfolgung homosexueller Männer __238 Quellen: Abkürzungen, häufig genutzte und weitere Quellen, Archive und gedruckte Quellen, Literatur __240 Straßenverzeichnis __246 Personenregister __248 5 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 6 6 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 7 Rita Bake/Beate Meyer Einleitung I I m Oktober 2006 stellten das Institut für die Geschichte der deutschen Juden (IGdJ) und die Landeszentrale für politische Bildung das Buch „Die Verfolgung und Ermordung der Hamburger Juden 1933–1945. Geschichte. Zeugnis. Erinnerung“ vor. Entgegen der landläufigen Meinung, des Gedenkens sei bereits zu viel getan, waren die Buchvorstellungen sehr gut besucht und das Werk schon nach zwei Monaten vergriffen, während die Nachfrage anhielt. Inzwischen liegt die zweite Auflage in der Landeszentrale zum Abholen bereit. Deren Leserinnen und Leser können sich im Einzelnen über die Verfolgung der Hamburger Juden in den Jahren 1933 bis 1941, die Organisation der Deportationstransporte, die Arbeit des „Jüdischen Religionsverbandes“ in dieser Zeit, über das Leben und Leiden der Deportierten in den Gettos von Lodz, Minsk, Riga und Theresienstadt, ihre Ermordung im Vernichtungslager Auschwitz oder durch tödliche Arbeitsbedingungen in den Zwangsarbeiterlagern informieren. Ergänzend finden sie Aufsätze über Initiativen und Reaktionen aus Hamburg und die Verfolgungserfahrungen derjenigen, die in einem vermeintlich sicheren Exilland doch von den deutschen Truppen eingeholt und von dort deportiert wurden. Der Kölner Künstler Gunter Demnig rief die Idee, Stolpersteine zur Erinnerung an NS-Opfer zu setzen, ins Leben und fand in erstaunlich kurzer Zeit Bürgerinnen und Bürger, die Patenschaften übernahmen. Seine Absichten und Erfahrungen skizziert er in einem Interview, das wir in diesem Band abgedruckt haben. Der Kunstsammler Peter Hess holte die Stolperstein-Aktion dann im Jahr 2002 nach Hamburg. Über die vielfältigen Hindernisse, die Hess noch als Einzelkämpfer überwinden musste, und die zustimmenden Reaktionen, auf die er stieß, berichtet er in dem oben genannten Band ausführlich. In dem vorliegenden Buch finden Sie eine kurze Beschreibung der Initiative und Kontaktdaten. Ca. 3300 Stolpersteine liegen inzwischen in Hamburg. Über 90 % von ihnen tragen die Namen ermordeter Jüdinnen und Juden, andere die von „Euthanasie“Opfern, politisch Verfolgten, Homosexuellen, Bibelforscherinnen und Bibelforschern oder Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Die Stolpersteine ermöglichen dezentrales Gedenken im Alltag an den Wohn- oder Wirkungsorten derer, an die der Stein erinnert. Ein Großteil der Hamburger Juden lebte bekanntlich im Grindelgebiet. So finden wir hier, in den Stadtteilen Rotherbaum und Harveste7 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 8 hude, auch die meisten Stolpersteine. Doch im Zuge ihrer Assimilation hatten viele ihre angestammten Wohngebiete in der Nähe der Synagogen und Einrichtungen der jüdischen Gemeinde verlassen und sich in anderen Teilen der Stadt angesiedelt. Auch dort haben sich in den letzten Jahren Bürgerinnen und Bürger gefunden, die Stolpersteine für sie oder andere Opfer des NS-Regimes haben setzen lassen. Der Name auf dem Messingstein und die wenigen Daten halten die Erinnerung wach, wenngleich oft genug über die Biographie der oder des Genannten nur wenig oder gar nichts bekannt ist. Deshalb entstand während der Arbeit an dem oben genannten Buch die Idee, auch die Biographien derjenigen zu erforschen, für die in anderen Stadtteilen Stolpersteine gesetzt worden sind. Während sie im Grindelgebiet überwiegend an Jüdinnen und Juden erinnern, finden sich in den übrigen Stadtteilen viele dieser Erinnerungssteine an andere Opfer der NS-Herrschaft. Unsere stadtteilbezogenen Broschüren spiegeln deshalb auch weniger, wie viele Verfolgte während der nationalsozialistischen Herrschaft in einem Quartier ermordet wurden, sondern vor allem, wie aktiv die heutigen Bewohner, Initiativen oder Organisationen Hinweise geben, Patenschaften einwerben bzw. übernehmen. Unsere 2006 gestartete Initiative zur „Biographischen Spurensuche“ stieß auf großes Interesse bei Personen, die sich in „ihren“ Hamburger Stadtteilen um die Erinnerung an ermordete Hamburger bemühen. Unter der Leitung von Rita Bake (Landeszentrale) und Beate Meyer (IGdJ) gehen mittlerweile mehr als fünfzig Forscherinnen und Forscher diesen Lebensgeschichten nach. Ihre Arbeitsergebnisse werden in stadtteilbezogenen Broschüren von der Landeszentrale für politische Bildung publiziert und verteilt. Zu Hamm, Altona mit den Elbvororten, Wandsbek mit den Walddörfern, Winterhude, St. Pauli, St. Georg und der Isestraße liegen bereits Broschüren vor. Zu erwarten sind welche zu Eimsbüttel, Eppendorf, Fuhlsbüttel, Harburg/Wilhelmsburg, Neustadt/Altstadt, Eilbek und umliegende Quartiere und eine Broschüre, die vereinzelte Steine in den nicht genannten Stadtteilen umfasst. Die Forschenden stammen teils aus Geschichtswerkstätten, teils sind sie Studentinnen, pensionierte Lehrerinnen und Lehrer oder andere engagierte Bürgerinnen und Bürger. Ihre Motive, einen Großteil ihrer Freizeit in diese Arbeit zu stecken, sind sehr unterschiedlich. Die Beweggründe erläutern sie jeweils in ihren Einleitungen. Doch was finden sie in den Archiven? Wie schlägt sich ein menschliches Leben in Akten nieder? Das Standesamt registriert die Geburt, den/die Namen oder Namensänderungen einer Person; sie oder er wird bei den Eltern als Mitglied einer jüdischen oder christlichen Gemeinde eingetragen; der Schulbesuch wird vermerkt; als Erwachsene mit einem eigenen Einkommen werden Männer wie Frauen dann als eigenständige Gemeindemitglieder geführt, so lange sie allein stehend bleiben oder 8 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 9 durch Scheidung oder Tod wieder werden (minderjährige Kinder und verheiratete Frauen werden bei ihrem Ehemann als dem Haushaltsvorstand eingetragen); Krankheiten, Strafverfolgungen und Haftverbüßungen sind manchmal nur auf Verpflegungslisten, manchmal aber in umfangreichen Gerichtsakten dokumentiert; für jeden Deportationstransport existiert eine Namensliste inklusive derer die zur „Reserve“ aufgerufen wurden; erhaltene Registraturen einiger Gettos geben karge Hinweise auf Lebens- und Arbeitsbedingungen dort, eine Todesfallanzeige hält das Sterbedatum fest. Diese und weitere Unterlagen stehen den Forscherinnen und Forschern zur Verfügung, wenn sie nicht kurz vor Kriegsende gezielt vernichtet oder durch Kriegseinwirkung zerstört wurden wie die meisten solcher Akten, die nur in Ausnahmefällen überliefert sind. Überlebten Familienangehörigen, existiert vielleicht eine Wiedergutmachungsakte, die einen Rückblick auf Verfolgung und Verluste ermöglicht, so weit Angehörige darüber informiert waren. Bezogen auf Juden sind in Hamburg die Akten des Oberfinanzpräsidenten erhalten, aus denen sich die finanzielle Ausplünderung verfolgen lässt. Lesen wir diese Akten heute, so begegnen uns große oder kleine Reichsmarkbeträge, deren jetziger Geldwert sich nicht unmittelbar erschließt. Ist in einem Dokument der 1930er Jahre von einer Geldsumme die Rede, müssen wir den Betrag mit fünf bis sechs multiplizieren, um annäherungsweise den heutigen Wert in Euro zu erhalten. Zum Vergleich: Ein Hilfsarbeiter verdiente in den 1930er Jahren 100 bis 120 Reichsmark (eine Hilfsarbeiterin weniger), ein Facharbeiter zwischen 150 und 180 Reichsmark, eine Volksschullehrerin knapp 200 und ein Gymnasiallehrer ca. 500 Reichsmark. Berücksichtigen wir diese Relationen, bekommen wir eine ungefähre Vorstellung von den Vermögensverhältnissen der Personen, deren Biographien hier beschrieben werden. Die Bearbeiterinnen und Beiträger des vorliegenden Bandes haben sich intensiv mit den Biographien derer befasst, für die in Barmbek Stolpersteine verlegt worden sind. Barmbek als einstige Hochburg der Arbeiterbewegung zeichnet sich durch vergleichsweise viele Stolpersteine für ermordete politisch Verfolgte aus, deren Lebenswegen die Verfasserinnen nachgegangen sind. Im einleitenden Teil versuchten sie aber auch, die Veränderung dieses „roten“ Stadtteils in ein „ganz normales“ Hamburger Quartier nachzuzeichnen, in dem Widerstand geübt wurde, aber auch die Strukturen der NSDAP zu finden waren, wo Anpassung und Mitmachen bald das (äußere) Bild bestimmten. Die am Projekt beteiligten Forscherinnen und Forscher folgen den Spuren, die die auf den Stolpersteinen Genannten in den Archiven und in der Erinnerung ehemaliger Nachbarn, überlebender Leidensgenossen oder in der Literatur hinterlassen 9 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 10 haben. Je nach den zur Verfügung stehenden Informationen variieren Umfang und Aussagekraft der Lebensläufe stark: Während von einzelnen Personen so viel biographisches Material gefunden wurde, dass ihre Schicksale etliche Seiten umfassen, erschöpfen sich unsere Kenntnisse bei anderen – selbst nach intensivsten Nachforschungen – nach wenigen Sätzen. Anfangs hofften alle Projektbeteiligten, möglichst jedem Lebenslauf ein Foto oder wenigstens ein personenbezogenes Dokument beifügen zu können, doch dies ist trotz aller Bemühungen nur bei einem (kleineren) Teil der Biographien möglich. Die Projektbeteiligten nehmen Kontakt zu emigrierten Verwandten auf, sie korrespondieren mit Gedenkstätten und durchsuchen die pages of testimony auf der webside von Yad Vashem und andere Internetseiten nach Hinweisen auf Verwandte und Fotos der Ermordeten. Bernhard Rosenkranz (†) und Ulf Bollmann steuerten die Lebensläufe ermordeter Homosexueller bei. Wir empfehlen ihre Homepage www.hamburg-auf-anderen-wegen.de/Stolpersteine. Die Projektarbeit gelingt nur durch die enge und für beide Seiten fruchtbare Zusammenarbeit mit Peter Hess und Johann-Hinrich Möller von der Stolperstein-Aktion, denen wir herzlich danken. Das Hamburger Staatsarchiv ermöglicht uns den Zugang zu wichtigen Aktenbeständen. Wir danken zudem Dr. Daniel Uziel von der Gedenkstätte Yad Vashem/Jerusalem für seine freundliche Unterstützung. Über das US Holocaust Memorial Museum erhalten wir letzte Lebenszeichen Hamburger Deportierter aus Lodz, die uns Fritz Neubauer mit vielen zusätzlichen Informationen zukommen lässt. Auch die Forschungsstelle für Zeitgeschichte, die dortige „Werkstatt der Erinnerung“ und das Institut für die Geschichte der deutschen Juden stellen Archivalien bereit, das Institut Theresienstädter Initiative in Prag und viele andere Archive, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und Sammler unterstützen die Arbeiten, auch ihnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Da nicht in jeder Broschüre die historiographischen Hintergründe wiederholt werden sollen, die in dem eingangs erwähnten Buch bereits nachlesbar sind (mit Literaturhinweisen zur weiteren Information), uns andererseits jedoch rudimentäre Kenntnisse der damaligen Vorgänge zum Verständnis der Verfolgungsprozesse notwendig scheinen, enthält jede stadtteilbezogene Broschüre ein umfangreiches Glossar und eine Zeitleiste zur jüdischen Verfolgung und anderen Gruppenverfolgungen. Diese Erläuterungen beziehen sich auf Aspekte, die in der vorliegenden Broschüre angesprochen werden, sie geben keine umfassende Erklärung und Beschreibung der NS-Verfolgung insgesamt oder in Hamburg im Besonderen. Mittlerweile erforschen nicht nur die Projektbeteiligten die Lebensläufe. Auch künftige Patinnen und Paten und die Mitglieder der Hamburger Initiative für die 10 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 11 Stolpersteine erstellen biographische Skizzen, bevor neue Steine verlegt werden. Damit dieses Wissen nicht nur verstreut in stadtteilbezogenen Broschüren präsentiert wird oder in privaten Aktenordnern ruht, sondern zentral und auf dem neuesten Stand abgerufen werden kann, ermöglicht die Landeszentrale der StolpersteinInitiative, unter www.stolpersteine-hamburg.de eine Homepage zu unterhalten, von der der aktuelle Stand der in Hamburg verlegten Steine sowie das bisher gesammelte biografische Wissen über die Ermordeten abgerufen werden kann. 11 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 12 Die Namen in Erinnerung bringen Interview mit dem Künstler Gunter Demnig Wie ist die Idee entstanden, Stolpersteine zur Erinnerung an Menschen zu verlegen, die während der NS-Herrschaft ermordet worden sind? Ich habe in Köln mit dem Verein ROM e. V. zusammengearbeitet. Anlässlich des 50. Jahrestages der Deportation der „Zigeuner“ (1940–1990) habe ich beim Ordnungsamt Köln einen Antrag gestellt, eine Schriftspur zu legen zu dürfen: 16 km von deren Wohnhäusern zum Deportationssammellager. Zu der Spur gab es einen Stein, auf dem Anweisungen zur Deportation der „Zigeuner“ mitsamt den Verwaltungsanordnungen eingelassen waren. In Bitumen gegossen, wurde der vor dem Kölner Rathaus versenkt. Daraus entstand die Idee für die Stolpersteine. Ich überlegte, wie ein solcher aussehen könnte, betrachtete es aber noch als konzeptionelles Kunstwerk, das nicht unbedingt umgesetzt werden musste. 200 Steine habe ich 1994 für eine Ausstellung in der Kölner Antoniterkirche gefertigt und wollte sie von dort aus verlegen. Aber bürokratische Hürden standen dem entgegen. Die ersten Steine in Köln (1995) und Berlin (1996) wurden ohne Genehmigung verlegt. Dann wurde ich ermutigt, noch einen Anlauf zu nehmen, wieder dauerte es fast drei Jahre, bis ich die ersten 600 Stolpersteine verlegen konnte. Von da an hat sich das Projekt sofort verselbstständigt. Es kamen Anrufe, Anfragen, Angebote, sich zu beteiligen. In kürzester Zeit waren es 1000 Steine, und auch der örtliche Radius erweiterte sich stetig. Was bezweckst du mit den Steinen? Vor Ort erinnert der Stolperstein die Anwohner an das Geschehen. Er verhindert das Vergessen, er bringt den Namen des einzelnen Verfolgten zurück. Das Grauen begann nicht in Treblinka, sondern im heimischen Wohnzimmer. Ich meine damit, dass Menschen sozial immer weiter heruntergestuft wurden, bis sie im „Judenhaus“ landeten und ihre Heimat verlassen mussten. Und alle haben es gelesen, gesehen und gehört! Auch deshalb bringe ich die Namen in die alte Umgebung zurück und setze nicht irgendwo ein zentrales Denkmal, wo Kränze für alle niedergelegt werden. Mir sind die Namen der Einzelnen wichtig. Der Stein schafft einen Ort der Erinnerung, denn fast alle Steine setze ich ja für Menschen, die keinen Grabstein haben. Ich möchte die heutigen Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner anstoßen, sich mit dem Geschehen damals zu befassen. Und ich möchte etwas für 12 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 13 die Angehörigen tun. Ihre Erinnerung ist mit Trauer verbunden, aber sie zeigen auch Freude über diese Art der Erinnerung und großes Interesse an dem, was heute in Deutschland passiert und wie viele Menschen zu dem Gesamtprojekt beitragen. Wie hat sich die Idee inhaltlich verändert? Die grundsätzliche Idee, dass die Stolpersteine ausschließlich für NS-Opfer gesetzt werden, ist geblieben, aber in Einzelheiten gibt es durchaus Änderungen. Beispielsweise habe ich heute ein stärkeres Sprachgefühl. „Verschollen in Auschwitz“, wie in den Gedenkbüchern, schreibe ich heute nicht mehr, das verharmlost den geplanten Mord. Bei politisch Verfolgten ist es meist nicht möglich, alle Haftstätten aufzuführen, so kann der Stein nur symbolisch sein. Die ??? verwende ich nach wie vor, wenn nichts über den Tod bekannt ist. Das ist ja noch schrecklicher. Gunter Demnig Demnig Verändert hat sich meine Auffassung, wie weit der Opferbegriff zu fassen ist. Inzwischen tendiere ich dazu, ihn weiter als früher zu fassen und das gesamte Familienschicksal zu sehen. Wo erinnern heute überall Stolpersteine an NS-Opfer? Über 15 000 Stolpersteine sind bisher verlegt (inzwischen 22 000, Stand Sommer 2010, B. M.). Sie liegen in Deutschland, Österreich, Ungarn und den Niederlanden. Ich habe Anfragen aus Rom. Für Frankreich beginnen wir jetzt mit Verlegungen in Lyon, Toulouse und Paris. In Oslo gibt es einen ersten Stein für einen ermordeten jüdischen Sportler, in Prag und Umgebung sollen ebenfalls Steine gesetzt werden. In Polen sind wir zweimal gescheitert, aber im Herbst 2008 werden wir mit einem ersten Stolperstein in Wroclaw (Breslau) an Edith Stein erinnern. Wie sieht es in Hamburg aus? Das Interesse und die Reaktionen der Hamburgerinnen und Hamburger sind für mich etwas Besonderes. Sie unterscheiden sich durchaus von anderen Städtern. 13 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 14 Die Anwohner begegnen mir mit großer Offenheit, sind interessiert, informiert und stellen Fragen. Für mich ist es in jeder Beziehung angenehm, hier zu arbeiten, weil die Anteilnahme so groß ist. Ganze Hausgemeinschaften fangen manchmal zu forschen an und sammeln das Geld für Patenschaften. So intensiv habe ich das noch nirgends erlebt. In Hamburg liegen von allen deutschen Städten die meisten Steine, das wird sicher noch lange so bleiben. Außer am Engagement der Bevölkerung liegt das natürlich auch an der Unterstützung durch die örtlichen Organisatoren um Peter Hess. Wie funktioniert das Projekt heute? Zwei Säulen tragen es: Die Initiatoren vor Ort, die entscheiden, wer einen Stein bekommt, die Biographien aufarbeiten und die privaten Patenschaften einwerben. Die Patenschaften übernehmen Privatpersonen, manchmal auch die Angehörigen, wenn sie das unbedingt wollen, manchmal Berufsverbände, Parteien oder Schüler, die sammeln. Manchmal kommt Geld für einen bestimmten Stein zusammen, manchmal wird für den Zweck generell geworben, werden Aktionen erdacht, oder Patenschaften zum Geburtstag oder zu Weihnachten verschenkt. Ich will nicht, dass Stiftungen oder Verwaltungen Steinverlegungen von oben initiieren, sondern die Städte sollen die Stolpersteine – wie Bürgermeister Ole von Beust es formuliert hat – annehmen als Geschenk der Bürgerinnen und Bürger und sich dann darum kümmern. Und last not least natürlich: Ohne Uta Franke, die das Gesamtprojekt von Köln aus koordiniert, wäre das Vorhaben längst zusammengebrochen. Denn das Interesse von allen Seiten hält seit Jahren an. Es sind nicht nur die Angehörigen, sondern die Bürger, die sich einsetzen, und immer wieder junge Menschen, vor allem Schüler. Da entstehen Forschungen, die die traditionelle Wissenschaft nicht erbringen könnte, und Kontakte zwischen heute lebenden jungen Leuten, Überlebenden und Emigranten. Ich habe eine Reihe von Auszeichnungen erhalten und die Ehrungen auf der Bühne entgegen genommen, aber eigentlich kann sich inzwischen jeder der Paten oder Initiatoren gemeint fühlen. Allein hätte ich die Idee der Stolpersteine nicht verwirklichen können. Was dieses Projekt an Kommunikation angeregt hat, ist eine soziale Skulptur geworden. Es hat sich ein Netzwerk gebildet, das in großen Teilen längst unabhängig von mir existiert. Das Interview führte Beate Meyer 14 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 15 Die Hamburger Stolpersteininitiative Im Jahre 2002 holte Peter Hess die Stolperstein-Aktion nach Hamburg. Er überzeugte Verwaltungsbeamte und Politiker, dass die Stolpersteine auf öffentlichen Gehwegen keine Gefahr für Fußgänger, sondern Denk- und Erinnerungsanstöße für Anwohner und Passanten darstellen. Die Resonanz gab ihm recht, das Projekt fand großen Anklang in Hamburg. Er warb bei Interessierten um Patenschaften, sprach mit Angehörigen, recherchierte im Staatsarchiv, entfaltete rege Pressearbeit und suchte geeignete Verlegeorte ... Schon bald fand er Unterstützerinnen und Unterstützer, die heute die Arbeit mittragen: Gesche Cordes, die die Aktionen photographisch festhält und Johann-Hinrich Möller, der u. a. die von der Landeszentrale für Politische Bildung bereitgestellte homepage betreut. Wer sich informieren, die Initiative unterstützen oder eine Patenschaft übernehmen will, kann sich wenden an Peter Hess: Telefon 00 49-40-410 51 62 Fax 00 49-40-45 03 94 53 E-mail [email protected] Homepage www.stolpersteine-hamburg.de 15 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 16 Carmen Smiatacz Einleitung D ie ersten Stolpersteine, die in Barmbek und Uhlenhorst im Jahr 2004 verlegt wurden, fielen wegen ihrer geringen Anzahl den meisten Stadtteilbewohnern kaum ins Auge. Im Sommer 2007 begann unsere Stolpersteingruppe mit der Erforschung der ersten Biografien für Barmbek-Nord und -Süd, damals lagen dort gerade einmal 17 Steine. Kurz darauf entschlossen wir uns, den Stadtteil Uhlenhorst mit hinzuzunehmen, da beide Stadtteile eine gemeinsame Geschichte verbindet. So erhielten wir 20 „neue“ Steine. Neben diesen Biografien begannen wir auch nach weiteren Namen von Personen zu suchen, die in Barmbek oder Uhlenhorst gelebt hatten und ebenfalls Opfer des Nationalsozialismus geworden waren. Dabei erhielten wir Unterstützung aus anderen Stolpersteingruppen und von den Stadtteilbewohnerinnen und -bewohnern. Inzwischen liegen in beiden Stadtteilen zusammen bereits 94 Stolpersteine, in Barmbek 50 und in Uhlenhorst 44 (Stand Dezember 2009), welche nun kaum noch zu übersehen sind. Die Menschen in unseren Stadtteilen, die durch das nationalsozialistische Regime verfolgt wurden, entstammten den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten und litten aus den verschiedensten Gründen unter Diskriminierung. So gibt es neben den jüdischen Opfern auch politisch Verfolgte, Homosexuelle, Opfer der „Euthanasie“ und Zeugen Jehovas. Gemeinsam ist den meisten Personen, über die wir forschten, dass sie keine oder nur eine geringe Rolle im öffentlichen Leben spielten. Deswegen gestaltete sich die Quellenlage auch zumeist schwierig. Oft waren nur winzige Bruchstücke erhalten und wir mussten feststellen, wie wenig von einem Menschenleben übrig geblieben war. Zudem wurden die meisten Quellen von Tätern verfasst, in deren Darstellung und Sprache sich ihre Verachtung widerspiegelte. Umso schwieriger gestaltete es sich, die Quellen zu interpretieren und zu stichhaltigen Erkenntnissen über die Menschen zu gelangen. In den meisten Fällen leben heute keine Angehörigen mehr, die uns etwas hätten berichten können. Deswegen können die Biografien nur Fragmente des Lebens der Personen darstellen und sollen auch nur als solche verstanden werden. Gleichzeitig stellte sich uns auch die Frage, was wir veröffentlichen können. Die Informationen, die wir den Quellen entnehmen konnten, geben nicht immer die vollständigen und korrekten Umstände wieder. Soweit es uns möglich war, 16 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 17 haben wir mit Angehörigen der Opfer die Biografien abgeglichen und bekamen von ihnen Zustimmung für unsere Arbeit. Unsere Hoffnung ist es, dass durch die Stolpersteine und unsere Texte eine Erinnerung an all die Menschen geschaffen wird, die durch das nationalsozialistische Regime verfolgt wurden und zu Tode kamen. Sie sollen in unseren Stadtteilen einen festen Platz erhalten. Zugleich möchten wir aber auch die Leser und Leserinnen dieser Broschüre dazu anregen, sich mit dem Terrorregime der Nationalsozialisten auseinanderzusetzen und die Geschichte ihres Stadtteils und ihrer direkten Nachbarschaft kritisch zu hinterfragen. Ohne die tatkräftige Unterstützung zahlreicher Personen und Institutionen wäre diese Broschüre nicht zustande gekommen. An dieser Stelle gilt es ihnen zu danken, wobei es fast unmöglich ist, jeden Einzelnen zu nennen. Der größte Dank geht an meine Mitautorinnen und Mitstreiterinnen bei diesem Projekt: Eva Acker, Ingrid Budig, Erika Draeger und Stefanie Rückner. Sie haben mit guten Ideen, Ratschlägen und Tipps die Entwicklung der Broschüre vorangetrieben. Auch wenn mal nicht alles so lief, wie wir es uns wünschten, konnten wir uns doch immer gegenseitig motivieren weiterzumachen. Bedanken möchten wir uns vor allen Dingen bei den Angehörigen, die bereit waren, mit uns zu sprechen, sich zu erinnern und wertvolle Dokumente und Fotos bereitzustellen. Unser Dank gilt Antje Kosemund, Ralph Michelson, Alexander Schulenburg und Alice Turner, die viel geleistet haben, um die Biografien ihrer Angehörigen zu vervollständigen. Die Biografien für die homosexuellen Opfer wurden von Bernhard Rosenkranz (†) und Ulf Bollmann beigesteuert, wofür wir beiden danken möchten. Auch das Gymnasium Lerchenfeld steuerte einen Beitrag bei. Die Geschichtswerkstatt Barmbek bot unserer Stolpersteingruppe nicht nur die räumlichen Kapazitäten, sondern konnte uns auch nützliche Tipps und Materialien geben. Dafür möchten wir den Mitarbeitern und insbesondere Dieter Thiele danken. Ein besonderes Dankeschön richten wir an Beate Meyer, ohne deren wissenschaftliche Betreuung diese Broschüre nie entstanden wäre. Sie stand unserer Stolperstein-Gruppe jederzeit als Ansprechpartnerin mit Rat und Unterstützung zur Verfügung. Auch Rita Bake begleitete den gesamten Entstehungsprozess mit vielen positiven Impulsen. Bedanken möchten wir uns zudem für die Gastfreundlichkeit im Kulturhaus Eppendorf, wo es beim Jour Fixe immer wieder nützliche Tipps und Ideen gab, sowie die Möglichkeit Fragen offen zu diskutieren. Die meisten Dokumente und Akten, die für diese Broschüre verwendet wurden, stammen aus dem Hamburger Staatsarchiv. Insbesondere Ulf Bollmann, Helga 17 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 18 Wunderlich und Barbara Koschlig waren mit ihrer umfassenden und kompetenten Beratung eine große Hilfe. Weiterer Dank gilt folgenden Personen und Institutionen: Jürgen Sielemann, Fritz Neubauer, Reimer Möller von der Gedenkstätte Neuengamme, dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden, der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, der Landeszentrale für politische Bildung, Jens Wunderlich, Björn Eggert, Susanne Lohmeyer, Hildegard Thevs, Günther Peterlein aus dem Amt für Wiedergutmachung, Eckart Krause von der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte, Johannes Wrobel aus dem Geschichtsarchiv der Zeugen Jehovas, dem Verein der Verfolgten des Naziregimes und dem International Tracing Service (ITS). Wir bedanken uns beim Bundesarchiv, den zahlreichen Stadt-, Kreis- und Landesarchiven, den Bibliotheken, Museen, Verlagen, Behörden und sonstigen Institutionen und den zahlreichen Einzelpersonen, die uns in unserer Arbeit unterstützt haben sowie allen Menschen, die eine Patenschaft für einen „Stolperstein“ übernommen haben. Hamburg, im Januar 2010 18 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 19 Erika Draeger Spurensuche im Stadtteil W ie lässt sich das Unfassbare fassbar machen, das Unbegreifliche verstehen? Wir Jüngeren, ohne Kriegserfahrung in einem demokratischen System mit Meinungsfreiheit aufgewachsen, haben wohl manches Mal einen Älteren gefragt: „Wie konntet ihr dies zulassen, warum ließ es nicht verhindern?“ Überzeugt, selbst heldenhaft Widerstand geleistet, Verfolgte gerettet zu haben, wären wir damals dabei gewesen, klagten wir pauschal und selbstgerecht die Elternund Großelterngeneration an. Damit versagten wir ihnen und uns oft die Verständigung, das gemeinsame Nachdenken über Hintergründe, die überhaupt erst ermöglichten, was in den Jahren 1933 bis 1945 in Deutschland und in unserer Stadt geschah. Historikerinnen und Historiker leisteten die Arbeit, klärten uns über damalige Verbrechen auf, gaben ihnen Namen – einer lautet Holocaust, ein anderer Shoah. Doch die Geschehnisse lagen in ihrem Ausmaß weit jenseits unseres Erfahrungshorizonts und Vorstellungsvermögens und beanspruchten Phantasie und Empathie in einer Weise, die nur mit großer innerer Distanz zu bewältigen war. Diese Distanz förderte auch den Glauben, es habe sich um eine einmalige geschichtliche Verirrung der Menschheit gehandelt: „Nie wieder“, war ein beruhigendes, oft wiederholtes Mantra: aufgeklärte Generationen werden es zu verhindern wissen. Die Existenz einer Neonazi-Szene und deren fremdenfeindliche Parolen schreckten jedoch immer wieder auf, in den vergangenen Jahren wurde unser Stadtteil mehrfach zum Schauplatz ihrer Aufmärsche. Vielleicht haben sie unabsichtlich einen Beitrag gegen das Vergessen geleistet? Wer am 1. Mai 2008 den großen, friedlichen „Marsch gegen Rechts“ entlang der Fuhlsbüttler Straße miterlebt hat, an dem spontan viele Stadtteilbewohner und Demonstration „gegen Rechts“ am 1. Mai 2008 in Barmbek, Fuhlsbütteler Straße Privat 19 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 20 Stadtteilbewohnerinnen teilnahmen – die Medien berichteten später nahezu ausschließlich über Vorkommnisse nach Ende der Demo, als es zu Konfrontationen zwischen Linken, Rechten und Polizei gekommen war –, könnte den Eindruck gewonnen haben, Barmbeker hätten ihr Geschichtsbewusstsein geschärft und an alte Traditionen angeknüpft. Denn große Teile Barmbeks zählten für die Nazis zu den politisch unzuverlässigen, „gemeinschädigenden“ Regionen, Keimzellen von Rotfront und Widerstand, die Rede war von „marxistisch verseuchter Arbeiterschaft“. Und doch ... auch hier gelang es ihnen ab 1933, ihr menschenverachtendes Regime zu errichten, ihre Strukturen zu installieren und nach und nach breite Zustimmung zu gewinnen, die zur kollektiven Tragödie und zur Ermordung so vieler Verfolgter führte. Nicht als Historikerin, sondern als an der Geschichte des Stadtteils interessierte Bewohnerin unternahm ich im Rahmen des Stolpersteinprojektes den Versuch einer Annäherung an die Zeit des Nationalsozialismus und seine Ausprägungen in Barmbek und dem benachbarten Uhlenhorst. Barmbek damals Das „Barmbeck“ der Vorkriegszeit, dessen Schreibweise sich 1946 in Barmbek änderte, ist in den Bombennächten 1943 untergegangen und lebt nur noch in den Erinnerungen noch lebender damaliger Bewohnerinnen und Bewohner. Das Archiv der hiesigen Geschichtswerkstatt, die seit über zwei Jahrzehnten systematische historische Forschung und Auswertung zahlreicher Gespräche mit Zeitzeugen durchgeführt, Bücher und Broschüren dazu veröffentlicht hat, ermöglicht zusätzliche Einblicke. Was prägte den damaligen Stadtteil? Barmbek war ehemals ein Dorf mit bewirtschafteten Höfen vor den Toren Hamburgs. In den 1860er Jahren begann, nach Wegfall der Hamburger Torsperre, die Entstehung von Vororten in Hamm, Hammerbrook und Barmbek, das sich innerhalb einer Generation zum bevölkerungsreichsten Stadtteil Hamburgs entwickeln sollte. Das alte Barmbeck, heute Barmbek Süd, breitete sich auf bisherigem Ackerboden und Weideland aus zwischen Osterbek- und Eilbekkanal um den früheren Dorfkern herum. Neben intensivem Wohnungsbau mit entsprechender Infrastruktur siedelten sich auch zahlreiche große und kleine Industrie- und Handwerksbetriebe an und nutzten die zu diesem Zweck ausgebauten Wasserwege für Transporte, vor allem auf dem Osterbekkanal. Ein großes Gaswerk am südlichen Ufer erhielt so seine Koks- und Kohlenvorräte und versorgte schon ab 1876 die halbe Stadt mit Gas. Neue Straßenzüge mit fünf- bis sechsgeschossiger Randbebauung, gewerblich genutzten Hinterhöfen oder eher lichtlosen Wohnterrassen prägten das 20 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 21 Bild nördlich der Hamburger Straße. Es musste schnell Wohnraum entstehen für eine große Zahl von Menschen, die im Aufschwung der Industrialisierung nach Hamburg kamen und in den expandierenden Betrieben Arbeit fanden. Allein die Hartgummifabrik „New-York-Hamburger Gummi-Waaren Compagnie“ an der Maurienstraße beschäftigte um 1910 ca. 1100 Arbeiter und Arbeiterinnen. Hinzu kam in den 1880er Jahren der Neubau der Speicherstadt auf einem Gelände, das bis dahin Wohngebiet für etwa 24 000 Menschen gewesen war und für deren zum Teil ärmliche Unterkünfte in den neuen Vororten Ersatz benötigt wurde. Der schnell errichtete Wohnungsbestand entsprach oft der geringen Zahlungsfähigkeit vieler Arbeiter, er war von minderer Bausubstanz und nicht selten feucht. In kleinen Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen lebten bis zu zehnköpfige Familien. Auch Kaufleute und andere sozial Bessergestellte siedelten sich an, bevorzugt im Viertel zwischen Hamburger Straße und Eilbekkanal, ausgewiesen für Einzelhäuser und Stadtvillen für Familien mit Hauspersonal, das teilweise aus den Arbeiterfamilien im nördlichen Wohngebiet stammte. In großbürgerlichen Wohnhäusern mit Vier- bis Sieben-Zimmer-Wohnungen lebten u. a. Geschäftsleute des Stadtteils, auch Arztpraxen waren darin untergebracht. Um die Jahrhundertwende entstanden in Barmbek Süd vereinzelt genossenschaftliche „Burgen“, so in der Wohldorfer Straße, an der Dehnhaide und der PROBlock im Quarée von Schleidenstraße/Bruckner-/Lohkoppel- und Ortrudstraße. Mieter waren überwiegend SPD-Mitglieder, von denen sich viele am kulturellen Leben im Stadtteil, an Projekten für Arbeiterbildung und -freizeitgestaltung aktiv beteiligten. Das um 1842 von ca. 1240 Seelen bewohnte Dorf war bis 1894, als es Stadtteil wurde, auf 38 000 und bis zu Beginn des Ersten Weltkrieges bereits auf annähernd 100 000 Einwohner angewachsen. Um 1939 war Barmbek, einschließlich Dulsberg, das am dichtesten besiedelte Wohngebiet Hamburgs, in dem sich mehr als 190 000 Menschen drängten, denn nach Inflation und Währungsreform waren in den zwanziger Jahren auch der Barmbeker Norden und Dulsberg erschlossen, von Stadtplanern nach neuesten Erkenntnissen konzipiert. Der damalige Oberbaudirektor Fritz Schumacher hatte besonderen Anteil am Entstehen menschenfreundlicher Quartiere. Große Teile des Stadtbilds tragen seine Handschrift, der Dulsberg galt lange als vorbildliche Mustersiedlung. Hier und in Barmbek Nord traten als Bauherren größerer Wohnblocks oft gemeinnützige Unternehmen, Wohnungsbaugenossenschaften, Verbände und Innungen auf, die mit Förderung durch die Beleihungskasse bezahlbare Wohnungen zu erstellen suchten. Der Bedarf war groß, doch die für eine Genossenschaftswohnung aufzubringenden Eigenanteile für die meisten Arbeiterfamilien, deren Pro-Kopf-Einkommen in Barmbek im Vergleich zu anderen Stadtteilen am unteren Ende lag, immer noch unerschwinglich. Die Be21 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 22 wohner der neuen Wohnquartiere waren in der Mehrzahl kleine und mittlere Angestellte, Beamte und aufstrebende Freiberufler. Der Barmbeker Süden blieb überwiegend Arbeiterwohnquartier, die sozialen Verhältnisse teilweise dem Milieu vergleichbar, das der Zeichner Zille in Berlin festgehalten hat. Armut, Enge und Verzicht, Krankheit durch schlechte Wohnsituation, unsichere Einkommensverhältnisse und Lebensperspektiven lähmten viele, erzeugten aber – als starkes Unrecht empfunden – bei anderen die Energie zur Auflehnung, besonders in Zeiten zusätzlicher Härten wie während der Inflation Anfang der zwanziger Jahre und in der Weltwirtschaftskrise ab 1929. Im alten Barmbek verharrten die Menschen nicht in Passivität, die Arbeiterbewegung war stark, auch genährt von den Werften am Hafen, in denen viele Männer aus dem Stadtteil tätig und gewerkschaftlich organisiert waren. Gleiches galt für die großen Fabriken an Osterbek- und Stichkanal wie z. B. Heidenreich und Harbeck, Carl Spaeter, Kampnagel AG. Obgleich geschwächt durch die Spaltung der Arbeiterschaft um 1918, waren insbesondere SPD und KPD in der Arbeiterbewegung aktiv. Trotz eines vorübergehenden Verbots der KPD nach dem „Hamburger Aufstand“ der Kommunisten im Herbst 1923, als der Barmbeker Süden um das Quartier Dehnhaide herum zum Schauplatz der Kämpfe wurde, die von der regierenden SPD niedergeschlagen wurden, blieben beide Parteien stark vertreten. 1932 erlangten sie punktuell, etwa im Umfeld der Humboldtstraße, gemeinsam 76 Prozent, während die NSDAP auf gerade 15 Prozent kam. Bei der letzten Reichstagswahl im März 1933 erzielten SPD und KPD zusammen in Barmbek noch beinahe 53 Prozent der Hamburger Aufstand 1923, Barrikaden an der Vogelweide, Ecke Stimmen, die NSDAP verbuchWohldorfer Straße Geschichtswerkstatt Barmbek te im bessergestellten Viertel südlich der Oberaltenallee bis Eilbekkanal größere Erfolge. Bei den sogenannten Wahlen 1936, als längst alle anderen Parteien verboten waren, hat es im Bezirk um den genossenschaftlichen PRO-Block nahe Schleidenpark noch knapp 27 Prozent Nein-Stimmen gegeben. 22 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 23 Hamburger Straße und Oberaltenallee um 1930, im Vordergrund der Winterhuder Weg Ullstein Bild Im alten Barmbeck gab es Vielfalt und großstädtisches Flair, Armut neben relativem Wohlstand, geschäftiges Treiben auf den Straßen, in Betrieben und Einzelhandel. Als Magnet galt die Hamburger Straße, eine Einkaufsstraße mit vielfältigen Angeboten in über 300 Geschäften, Gaststätten und Restaurants, die in damaliger Zeit mit der Mönckebergstraße in Hamburgs Innenstadt konkurrieren konnte und, ab 1911 gut erreichbar über drei Hochbahnstationen, für Kunden aus nahen und fernen Stadtteilen Anziehungskraft bot. Ab 1928 war die besondere Attraktion das zwischen Deseniß- und Rönnhaidstraße (heute Adolph-Schönfelder-Straße) gelegene, seinerzeit modernste Kaufhausgebäude Europas der Rudolf Karstadt AG. Viergeschossig, auf 5000 qm Grundfläche, 26 Meter hoch mit einer neuartigen großen Rolltreppenanlage und sechs Personenaufzügen. Der riesige Dachgarten war im Sommer ein Freiluftcafé mit Tanzkapelle und Blick über den Stadtteil. Uhlenhorst Im Gegensatz zu Barmbek ist das Gebiet entlang der Außenalster, zwischen Alsterufer und ehemals Bachstraße, nicht aus einer vorhandenen Ansiedlung entstanden, sondern ab 1867 nach einem von den Stadtplanern Plath und Lindley entworfenen Bebauungsplan für Mundsburg und Hohenfelde neu errichtet worden. Auf trockengelegten ehemaligen Schaf- und Rinderweiden in exponierter Lage entstanden bürgerliche Stadthäuser und großbürgerliche Villen, geprägt von der Architektur der ausgehenden Gründerzeit. Ab 1871 war Uhlenhorst ein Vorort Hamburgs und ab 1894 – wie Barmbek – als Stadtteil eingegliedert. Seine Größe beträgt ca. 2,2 qkm, etwa ein Fünftel des Barmbeker Gebiets, die Einwohnerstärke um 1933 bezifferte sich auf 40 102 Personen. 23 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 24 Bewohner des Stadtteils leben nicht in, sondern „auf der Uhlenhorst“, bis heute eine der exklusivsten – und teuersten – Gegenden Hamburgs. Man orientierte sich mehr am angrenzenden Hohenfelde und am westlichen Winterhude oder dem gegenüberliegenden, mit Direktverbindung durch Alsterdampfer erreichbaren Harvestehude. Zum benachbarten Barmbek hin entstanden nordöstlich des Hofwegs auch schlichtere Wohnhäuser für Menschen mit geringeren Einkommen und Gewerbeflächen für Handwerksbetriebe und Kleinindustrie, während sich die Bebauung vom Winterhuder Weg bis zur östlich gelegenen Bachstraße nicht mehr vom übrigen Wohn- und Gewerbegebiet Barmbeks unterschied. Westlich des Hofwegs bis zur Alster gab es kaum Gewerbe, hier finden wir noch heute reines Wohngebiet mit hohem Standard. Der westliche Teil Uhlenhorsts und seine östlichen Nachbarn profitierten voneinander, weil Barmbek viele Handwerks- und Dienstleistungen anzubieten hatte, für die in Uhlenhorst eine Nachfrage bestand. Fortsetzung der Hamburger Straße Richtung Innenstadt war und ist auf heutigem Uhlenhorster, damals teilweise Hohenfelder Gebiet der Mundsburger Damm, vor der Zerstörung ebenfalls mit hohen Wohngebäuden bebaut, die in den Erdgeschossen Geschäfte und Cafés und darüber sehr große, auch als Blick in den Mundsburger Damm um 1910, Eckgebäude WinPraxen und Kanzleien genutzte terhuder Weg Bildarchiv Hamburg Wohnungen enthielten. Zu Zeiten der nationalsozialistischen Verfolgung fanden in diesen Häusern verschiedene jüdische Familien und Einzelpersonen vorübergehend Zuflucht. Der Charakter einer Wohn- und Geschäftsstraße setzt sich in der Papenhuder Straße fort, die, von Norden kommend, an der Mundsburger Brücke auf den Mundsburger Damm trifft und schon damals den Stadtteil mit Lebensnotwendigem versorgte. Die politische Ausrichtung spiegelte den sozialen Stand der Bewohner wider und war im westlichen Uhlenhorst überwiegend konservativ bis liberal, später zu großen Anteilen nationalsozialistisch. Im wohlsituierten Gebiet zwischen Adolfstraße (heutige Herbert-Weichmannstraße) und Alster erreichte die NSDAP bei der letzten freien Wahl 1932 einen Stimmenanteil von 43 Prozent, während SPD und KPD zusammen knapp 16 Prozent auf sich vereinigten. 24 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 25 Ursprünglich verlief die Grenze zwischen Uhlenhorst und Barmbek entlang der Bachstraße, Hamburger Straße und Lerchenfeld, seit 1951 entlang dem Winterhuder Weg, der Oberaltenallee und Richardstraße. Das Gebiet südlich des Uhlenhorster Wegs gehörte zu Hohenfelde, die Grenze verschob sich 1951 bis an den Kuhmühlenteich und Eilbekkanal. Wir haben Biographien von Betroffenen aus diesen Straßen in unsere Sammlung aufgenommen und dabei die aktuellen Umrisse Uhlenhorsts berücksichtigt. Ein Gedenkbuch zum heutigen Stadtteil Hohenfelde ist in Vorbereitung. Zeit des Nationalsozialismus Im Rückblick können wir davon ausgehen, dass auch in Barmbek und Uhlenhorst ein großer Teil der Bevölkerung die nationalsozialistische Machtübernahme 1933 hinnahm oder in der Hoffnung auf bessere Zeiten begrüßte. Bei Gesprächen über diese Epoche wird von Barmbeker Zeitzeugen vor allem die hohe Arbeitslosigkeit genannt, die sich infolge des Krieges und der Inflation seit Beginn der zwanziger Jahre hinzog und aufgrund der Weltwirtschaftskrise 1929 einen neuen Höhepunkt erreichte. Rückzüge von Investoren, Auftragsrückgänge und Firmeninsolvenzen führten zu Massenentlassungen und versetzten unzählige Familien in wirtschaftliche Not. Staatliche Möglichkeiten, diese aufzufangen, waren gering und politische Parteien, die zersplittert waren und keine Koalitionsbereitschaft zeigten, erzeugten eine Atmosphäre der Resignation und den Ruf nach einer „starken Hand“. Zwar gab es in Hamburg eine relativ stabile politische Mehrheit, hier war die SPD stärkste Partei und fand Koalitionspartner im bürgerlichen Lager, musste dafür aber auch die Verantwortung für die Situation vor Ort übernehmen. Die Regierung in Berlin und die noch junge, sich in der Entwicklung befindliche Republik wurde als schwach und unentschlossen wahrgenommen, zu groß war das politische Spektrum mit teils extremen Vorstellungen einzelner Gruppen. Uneinigkeit über Konsequenzen nach der Kriegsniederlage und das Verhalten der Siegermächte führten immer wieder zu Spannungen, etlichen schien die Rückkehr zu einem autokratischen System, einem Obrigkeitsstaat ein Ausweg zu sein. Eine an der Kaiserzeit orientierte Opposition bekam Aufwind, repräsentiert etwa durch die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) und ihren militärischen Arm „Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten“. Einer ihrer Aufmärsche fand auf der Festwiese im Stadtpark statt, die Aufnahme zeigt möglicherweise eine Parallelveranstaltung zur Berliner Großveranstaltung „Zehn Jahre Versailler Vertrag“ im Juni 1929. Diese größte paramilitärische Organisation mit annähernd 500 000 Mitgliedern um 1930 (die Reichswehr war in diesem Friedensvertrag auf 100 000 Angehörige beschränkt,) erhielt von Unternehmern und Großgrundbesitzern finanzielle Unterstützung, zur Reichs25 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 26 wehr existierten gute Verbindungen. Auch andere Parteien hatten enge Verbindungen zu Frontkämpfergruppen, die zu großen Teilen aus ehemaligen Soldaten und Offizieren des aufgelösten Weltkriegsheeres bestanden, jedoch unterschiedliche politische Ziele verfolgten. Beinahe drei MilAufmarsch der „Stahlhelme“ im Stadtpark um 1929 lionen Männer waren im repubGeschichtswerkstatt Barmbek liktreuen Reichsbanner SchwarzRot-Gold organisiert. Dazu kamen weitere kleine regionale Kampf- und Ordnergruppen, schwarze Reichswehrverbände, die zur NSDAP gehörige SA und bis zu 100 000 Rote Frontkämpfer. Die Existenz dieser das Bild der Öffentlichkeit mitprägenden Gruppen trug weiter zur spannungsgeladenen Alltagsatmosphäre bei. Die NSDAP-Forderung nach „Schaffung einer starken Zentralgewalt“ entsprach durchaus den Vorstellungen vieler konservativer Wähler. Ihr Ziel war eine „Deutsche Revolution“. Bereits seit den frühen zwanziger Jahren gehörten Aufmärsche der NSDAP zum Straßenbild, ihre sich als Avantgarde der Revolution verstehende „Sturmabteilung“ (SA) zeigte als Demonstration politischer Stärke Präsenz, wo immer sich Gelegenheit ergab, nicht nur als Saalschutz bei Parteiversammlungen, sondern auf Umzügen mit Musikbegleitung, Massenveranstaltungen, die als „Kampf um die Straße“ bezeichnet wurden. Von Geschäftsleuten und Mittelstand teilweise als Schutzmacht angesehen, die Kriminellen und Kommunisten, der „roten Gefahr“, entgegentrat, provozierte die SA auch in Barmbek viele Schlägereien mit Vertretern des kommunistischen „Rotfrontkämpferbundes“ (RFB), vereinzelt auch mit dem „Reichsbanner“, in Hamburg der SPDRegierung nahestehend. Sowohl KPD als auch NSDAP galten vielen unpolitischen Bürgern als Extremisten, gegen beide gab es zahlreiche Polizeieinsätze Die „Hakenkreuzfeste“ am Wiesendamm war Zenin Hamburg unter SPD-Regierung und trale der Barmbeker NSDAP-Ortsgruppe Zoll Geschichtswerkstatt Barmbek Polizeisenatoren. 26 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 27 Einzelne Parolen der NSDAP-Propaganda sprachen unterschiedliche Zielgruppen an, wie das Versprechen nach Wiederherstellung der „Ehre des deutschen Volkes“, das sich auf den von großen Teilen der Bevölkerung als Demütigung empfundenen Versailler Vertrag bezog und dem bereits der Revanchegedanke innewohnte. Im Parteiprogramm heißt es u. a.: „Wir fordern ... Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung unseres Volkes“, „... daß sich der Staat verpflichtet, in erster Linie für die Erwerbs- und Lebensmöglichkeit der Staatsbürger zu sorgen. Wenn es nicht möglich ist, die Gesamtbevölkerung des Staates zu ernähren, so sind die Angehörigen fremder Nationen (Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen ...“, „... großzügigen Ausbau der Altersversorgung“. Krise und Arbeitslosigkeit verursachten schon damals Angst vor Altersarmut. Die Forderungen suggerierten Einsatz für die Inte- Aufruf des Reichsstatthalters Kaufmann NSDAP-Gaunachrichten 1935 ressen des „kleinen Mannes“. Ehemals sozialistische Forderungen wie die Gewinnbeteiligung an Großbetrieben bis hin zur Kommunalisierung der GroßWarenhäuser zwecks Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende wurden relativiert, als Hitler sich um Spenden zum Aufbau seiner Partei an Das monatlich auch in Barmbek erscheinende Propagandablatt NSDAP-Gaunachrichten 1936 Unternehmer wandte und Privatvermögen favorisierte. Kern der NSDAP-Ideologie war die Beschwörung einer „gesunden Volksgemeinschaft“, eines Wir-Gefühls unter Ausschluss alles Fremden. Allen an dieser Gemeinschaft Beteiligten – vorrangig Parteimitgliedern – stellte man Vorteile in Aussicht, u. a. Arbeitsplätze durch die Vertreibung aller „Gemeinschaftsfremden“ aus öffentlichen Ämtern, die allein Staatsbürgern vorbehalten sein sollten: „Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.“ Der Antisemitismus war fest im Parteiprogramm verankert. Die Ressentiments fielen auf fruchtbaren Boden, es waren Schuldige an der Misere benannt, Fremde und Juden bzw. jüdisches Kapital, während sich deutsches Staatsbürgerkapital zum Verbündeten erklären ließ. Wer als Wähler seine politische Heimat in anderen Parteien nicht finden konnte, sah in der NSDAP eine Chance zum Protest, ein Vehikel zur Verbesserung der eigenen Lebenssituation 27 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 28 oder fühlte sich insgesamt von dieser Ideologie angesprochen – die Ergebnisse der Wahl im März 1933 sprechen für sich. Bei Durchsicht historischer Werke drängt sich der Anschein auf, als habe ein Interessenverbund aus Wirtschaft und Militär, während der Weimarer Republik in Schach gehalten, die neue Stimmung sehr begrüßt. Bot sich doch nun eine durchs Volk legitimierte Gelegenheit, sich dem Diktat der Siegermächte zu widersetzen. Widerstand und politische Verfolgungen Wie sah es in unserer Stadt und unserem Stadtteil aus? Taktische Bemühungen der KPD, noch kurz vor der Wahl am 5. März 1933 zusammen mit SPD und linken Splittergruppen eine Einheitsfront herzustellen, waren gescheitert, zu groß waren die jahrelangen Differenzen. SPD und KPD erhielten zwar in Hamburg 1933 gemeinsam mehr Stimmen als die NSDAP, letztere war aber stärkste Fraktion, bildete ab 24. April zusammen mit DNVP (Stahlhelm), DVP und DStP den neuen „nationalen“ Senat und stellte mit Carl Vincent Krogmann den Bürgermeister. Besondere Macht konzentrierte sich in den Händen des bisherigen Gauleiters und von Hitler nun zum Reichsstatthalter ernannten Karl Kaufmann, der aus Hamburg einen „Mustergau“ machen wollte und eine bisher beispiellose Terrorwelle gegen Arbeiterbewegung, innerparteiliche Gegner, Juden und Ausländer in Gang setzte. SARazzien zur Einschüchterung politischer Gegner waren an der Tagesordnung. Binnen kurzem hatte die Partei ihre Strukturen im gesamten Stadtgebiet und allen öffentlichen Einrichtungen verankert. Wenige Tage nach Verabschiedung des „Ermächtigungsgesetzes“ im April 1933, das einer Blankovollmacht für Adolf Hitler gleichkam, folgte das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, das alle „rassisch“ und politisch unerwünschten Personen aus dem Staatsdienst vertreiben sollte; die frei werdenden Stellen besetzten vorzugsweise arbeitslose Parteiund SA-Mitglieder, „alte Kämpfer“ der Bewegung, oft ohne erforderliche Qualifikationen. Viele Beamte hatten sich rechtzeitig für eine NSDAP-Mitgliedschaft entschieden, um ihre Position und Karriere zu sichern. Dies blieb nicht unbemerkt: wer sich mit der Partei arrangierte, durfte mit Arbeit und einer besseren beruflichen Perspektive rechnen. Materielle und soziale Interessen konnten politische Einstellungen ins Wanken bringen, auch Skeptiker, denen seit Jahren die Mittel fehlten, Grundbedürfnisse ihrer Familien zu erfüllen, kamen ins Nachdenken. In Barmbek Nord und Süd waren um 1933 knapp über 4000 Parteimitglieder verzeichnet, das entsprach etwas mehr als 2 Prozent der Bevölkerung. Die SPD verzeichnete im Stadtteil knapp 10 000 Mitglieder, die KPD etwa 1300. Unter den NSDAP-Anhängern gab es viele Einzelhändler, selbstständige Handwerker, Angestellte, Beamte, Hausbesitzer und auch Gastwirte, die Räumlichkeiten zu Ver28 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 29 sammlungszwecken anzubieten hatten. Zwar war die Neuaufnahme von Mitgliedern bis 1937 blockiert, aber die Übernahme von Ehrenämtern in anderen Organisationen der NSDAP war gern gesehen. Dort gab es unzählige Ämter und Pöstchen, durch die Beteiligte in die Parteiarbeit eingebunden wurden, gleichzusetzen mit einem System gegenseitiger Fuhlsbütteler Straße, Ecke Pestalozzistraße mit Wahlaufruf für die NSDAP Geschichtswerkstatt Barmbek Kontrolle und zugleich Überwachung der Andersdenkenden. Bis 1945 stieg die Zahl der Barmbeker Parteimitglieder auf ca. 16 000 an, wobei erwachsene Männer – wie überall – den größeren Anteil stellten. Überzeugte Nationalsozialisten glaubten, einer Verwirklichung der „Volksgemeinschaft“ mithilfe von Denunziationen und Bespitzelungen ihres Wohn- und Berufs- umfeldes näher zu kommen. Die Parteistruktur im Stadtteil war hierarchisch gegliedert, sie bestand aus Hausgruppen (15 Haushalte), Blocks (40–60 Haushalte) mit Blockleitern, Zellen (4–8 Blocks) mit Zellenleitern, darüber standen Ortsgruppenleiter, Kreisleiter und an der Spitze der Gauleiter. Teilnahme an Schulungen war erwünscht, Diskussionen oder gar kritisches Hinterfragen jedoch nicht. Ziel war die gemeinsame Arbeit am idealisierten „großen Werk“. Mit Verbot oder Auflösung aller übrigen Parteien und der Gewerkschaften entfielen auch die meisten bisherigen Jugend- und Freizeitangebote, für die Gliederungen der NSDAP Ersatz anboten. Viele Angebote richteten sich an Kinder und Jugendliche und übten Anziehung aus, boten gleichzeitig Möglichkeiten der Indoktrination. In den Schulen, deren Leitungen durch Parteimitglieder ausgetauscht waren, standen Schüler und Lehrer unter Kontrolle, letztere nicht selten selbst begeisterte NSDAPAnhänger. Außerschulische Aktivitäten fanden in Jungvolk, Hitlerjugend (HJ) und Bund deutscher Mädel (BdM) statt mit ihren Sport-, Wander-, Bastel-, Tanz-/Singkreisen mit Kurs- und Aufstiegsangeboten. Die zunächst freiwillige Mitgliedschaft war später Pflicht, wie beim Reichsarbeitsdienst, aus dem junge Männer für Parteiorganisationen, SA und SS/Waffen-SS angeworben wurden, umschmeichelt mit dem Nimbus der Elite: „aus SS-Mannen und ihren Angehörigen (wird) eine Führerschaft heranwachsen, die sich aus den Besten des Deutschen Volkes zusammensetzt“. Auch junge Barmbeker fühlten sich von diesem Ruf angezogen und leisteten Schwüre, deren Bedeutung sie vielleicht erst nach Kriegsbeginn in Gänze ermessen konnten. 29 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 30 Es gab Zwangsverbände für alle Berufsstände, Studentenbünde, NS-Frauenschaften, Gau-Frauenschaften, eingebunden in Tätigkeiten für Volkswohlfahrt und Winterhilfswerk, deren Angebote für Bedürftige im Rahmen umfangreicher ehrenamtlicher Arbeit realisiert wurden und den Nutznießern nach langen Entbehrungen das Gefühl vermittelte, dankbar sein zu müssen. Die neue Organisation „Kraft durch Freude“ ermöglichte armen Familien neben einer Vielzahl an Freizeitangeboten erstmals, an Urlaubsreisen in andere Länder teilzunehmen. Die Partei als Helfer und Wohltäter ließ sich feiern, die Zahl der NSDAP-Sympathisanten und Mitläufer wuchs. Das Gros des Volkes erfreute sich in Friedenszeiten auch in unserem Stadtteil an „Brot und Spielen“, ehemals Arbeitslose hatten zu essen, trotz Rationierung, die Olympischen Spiele 1936 hielten das Land in Atem, Kriegsvorbereitungen waren noch nicht deutlich Apell zur Identifikation mit der Volksgemeinschaft sichtbar und wer dies behaupNSDAP-Gaunachrichten 1935 tete, wurde wegen Verleumdung verfolgt. Spiele, Ausfahrten und Sommerfeste, Theater- und Filmvorführungen dienten der Propaganda. Erst relativ wenige Haushalte verfügten zu Beginn der dreißiger Jahre über ein teures Rundfunkgerät oder bezogen überregionale Tageszeitungen. Flugblätter, Wandzeitungen und Transparente oder Parteiorgane wie die „Gaunachrichten“ sorgten für die Verbreitung gefilterter Informationen, die Massenproduktion eines preiswerten „Volksempfängers“, einem Radio mit Sender auf einer Frequenz, diente der Verbreitung von Nachrichten aus Berlin und Worten des „Führers“, dem es mit Hilfe von Rundfunk und Film gelang, die Massen für seine Zwecke zu mobilisieren. Trotz aller Zustimmung, Machtdemonstrationen, Gleichschaltungen und Einschüchterungskampagnen wissen wir aber auch von Anstrengungen innerhalb der Arbeiterparteien, sich in Barmbek zu formieren und Widerstand zu leisten. Wie ist „Widerstand“ zu definieren? Organisierte politische Aktionen konnten nach dem Verbot sämtlicher Parteien und Gewerkschaften und der Abschaffung demokratischer Rechte ab 1933 nur in der Illegalität stattfinden. Führende Kommunisten und Sozialdemokraten wurden zur Einschüchterung gleich nach der Machtübernahme der NSDAP in Hamburger Gefängnisse verbracht, hamburgweit über 5000 Verhaftungen vorgenommen. Im selben Jahr wurde das KZ Fuhlsbüttel eröffnet, ein SS-Sturmbannführer als Leiter der Staatspolizei eingesetzt. Ab Ende 30 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 31 1933 gab es kaum jemanden, der unabhängig Recht sprechen konnte, kritische Richter waren aus ihren Ämtern verdrängt. Viele Inhaftierte verbrachten lange Jahre in Gefängnissen und Zuchthäusern, manche waren schweren Misshandlungen und Folterungen ausgesetzt. In öffentlichen Schauprozessen wurden Todesurteile ausgesprochen. Unter diesen Umständen offen Widerstand zu leisten, waren nur wenige Menschen bereit oder sahen darin einen Sinn. Es gibt Berichte über verdeckte Aktionen der Barmbeker Reichsbannerabteilungen (SPD) und deren Schutzformationen („Schufos“), die zwar nicht aufsehenerregend, aber gefährlich waren. Rechtzeitig versteckte Waffen kamen nicht zum Einsatz, es wurden Netzwerke geknüpft zwischen unerschrockenen Genossinnen und Genossen, die als Kuriere Informationen und Schriften schmuggelten und verbreiteten und in Kontakt mit den Büros der Exil-Vorstände standen. Widerstandsgruppen ehemaliger Reichsbanner-Mitglieder, meist jüngerer Sozialdemokraten in Arbeiterstadtteilen und von Mitgliedern des Internationalen Sozialistischen Kampfbunds (ISK) hat es noch bis mindestens 1937 gegeben. Kämpferische junge Kommunisten ließen sich trotz brutalster Verfolgungen lange nicht einschüchtern, Tausende sollen in den ersten Jahren der NS-Herrschaft in Hamburg aktiv gewesen sein, wobei auch der Einsatz von Schusswaffen überliefert ist. In Dulsberg wurden Schüsse auf einen SA-Umzug abgegeben, in der Von-Essen-Straße ein Bombenanschlag auf ein SA-Versammlungslokal durchgeführt. Die Gestapo zerschlug immer wieder KPD-Widerstandsgruppen (illegale Nachfolgegruppen des verbotenen RFB) und hob illegale Druckereien aus, auch in Barmbek und dem benachbarten Winterhude, bis die Strukturen 1937/38 zerstört waren und die wichtigsten Initiatoren sich in Zuchthäusern oder KZs befanden. Vorzugsweise nachts führte die Gestapo Hausdurchsuchungen und oft willkürlich wirkende Verhaftungen mit brutaler Gewalt durch. Neben immer perfekteren Überwachungsmethoden gab es auch zahlreiche Spitzel und Denunzianten, die sich den Parteiorganen andienten und persönliche Vorteile erhofften. Schwerpunkte der Untergrundarbeit waren Kurierdienste, die Weitergabe von Informationen und Schriften, die legal nicht erhältlich waren, sowie das Sammeln von Geld zur Unterstützung von Familien, deren Männer in Gefängnissen oder Zuchthäusern saßen, und zur Ausschleusung besonders gefährdeter Verfolgter. Nach Kriegsbeginn entstanden neue Widerstandsgruppen, besonders aus den Reihen der KPD nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1942. In Fabriken, die kriegswichtige Produkte herstellten, gab es Sabotageakte. Die Oppositionellen nahmen auch Kontakte zu polnischen und russischen Zwangsarbeitern auf, die in der Firma Heidenreich und Harbeck tätig und in einem Lager an der Burmesterstraße untergebracht waren. Auch aus den Firmen Spaeter und Kampnagel ist betrieblicher Widerstand aus den Kriegsjahren überliefert. 31 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 32 Kleinen, KPD-nahen Gruppen (z. B. Bästlein-Jacobs-Abshagen-Gruppe oder EtterRose-Hampel-Gruppe) gelang es nach Auskunft von Zeitzeugen noch bis Kriegsende, unter Lebensgefahr Flugblätter zu produzieren und zu verteilen, in der Absicht, damit Berichte über die tatsächlichen Zustände im Reich und an der Front zu verbreiten und verbliebene Genossinnen und Genossen zu ermutigen. Zusammenkünfte waren als Ausflüge oder Wanderungen getarnt, als neutrale Treffpunkte dienten Sportveranstaltungen und -Vereine; so haben SPD- und KPD-Mitglieder im Arbeitersportverein USC Paloma gemeinsame Aktionen geplant und Fluchten vorbereitet. Neben politisch motivierten Widerständlern gab es Verweigerer und sich der Anpassung widersetzende Menschen aus unterschiedlichen sozialen Kreisen, denen Anstand und Gewissen verbot, sich an der Ausgrenzung von Mitmenschen oder an Denunziationen zu beteiligen. Sie behielten den ungetrübten Blick für die alltäglichen gewaltsamen Übergriffe auf Andersdenkende und halfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten Verfolgten mit kleinen Gesten. Zeitzeugen, auch jüdische Überlebende, berichteten später darüber. Manche Helfer blieben unbehelligt, andere waren selbst Denunziationen ausgesetzt. Diesen Menschen entgingen auch nicht die stetigen Verschärfungen gegen jüdische Mitmenschen und deren Verdrängung aus öffentlichen Einrichtungen, aus Schulen, Mietverhältnissen, Lebensräumen. Wer gut beobachten und kombinieren konnte, ahnte den künftigen Kurs und den Beginn eines Krieges und konnte dennoch nur wenig tun, ohne sich oder Angehörige zu gefährden. Dann gab es die Empörten und Nonkonformisten, die sich wagemutig über persönliche Einschränkungen hinwegsetzten, sich des Risikos entweder nicht bewusst waren oder es ignorierten. Dazu zählt die „Swingjugend“, die auch in Barmbek Anhänger hatte, sich im weit über den Stadtteil hinaus bekannten „Café König“ zum Tanzen traf und schließlich Verfolgungen und Verhaftungen ausgesetzt war. Andere hörten trotz Verbot ausländische Radiosender, ließen sich den Mund nicht verbieten und äußerten sich kritisch zur Lage im Land, zeigten Mangel an Respekt gegenüber nationalsozialistischen Amtsträgern und Anordnungen oder gefährdeten sich durch die Weigerung, den Hitlergruß zu praktizieren. Ab Juni 1935 begann nach Verschärfung des § 175 – der bis 1969 Bestand hatte – eine Jagd auf Homosexuelle; in Barmbek und Uhlenhorst wurde seit dem Jahr 2000 mehreren Opfern durch Stolpersteinverlegungen gedacht. Roma und Sinti unterlagen wie Juden den sogenannten Rassegesetzen, es gab in Barmbek einzelne Verfolgte und Opfer, deren Biographien in diesem Buch nicht enthalten sind, da die Rom und Sinti Union eine eigene Publikation vorbereitet, die nicht mit der Gedenkform „Stolpersteine“ im Zusammenhang steht. Ärzte des Krankenhauses Barmbek beteiligten sich an Zwangssterilisationen von angeblich „Fortpflanzungsunwürdigen“ und „Erbkranken“, oft handelte es sich 32 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 33 um Menschen mit sogenanntem abweichenden Verhalten, das nicht ins Schema der Machthaber passte. Zu erforschen bleibt, in welchem Maße Anstalten dieses Stadtteils beteiligt waren an der „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ im Rahmen des Euthanasieprogramms, später auch T4-Aktion genannt. Es gibt Hinweise auf Deportationen von Opfern aus dem Versorgungsheim Oberaltenallee, dem Waisenhaus in der Averhoffstraße – über einen Fall wird in diesem Buch berichtet – und der Staatskrankenanstalt Friedrichsberg, in der psychisch Kranke oder sozial auffällige Menschen behandelt wurden. Ressentiments gegen Juden im Stadtteil Um 1925 lebten 544 Menschen „israelitischer“ Religionszugehörigkeit in Barmbek, nach einer Volkszählung im Juni 1933 waren es 724 Personen, 344 weibliche und 380 männliche. In Uhlenhorst waren 242 Personen gemeldet, davon 139 männliche und 103 weibliche. Die Gesamtzahl ist im Vergleich zu anderen Stadtteilen gering. Während politische Verfolgte in Barmbek und Uhlenhorst sich oft auf ein soziales Netz in ihrem Wohnumfeld verlassen konnten, waren die jüdischen Mitbürger nach Beginn der Verfolgungen weitgehend auf sich gestellt. Bis 1933, mit Einschränkungen sogar noch ein paar Jahre darüber hinaus, war dies anders, die im Vergleich zur Bevölkerungszahl in Barmbek und Uhlenhorst sehr kleine Minderheit war nach Zeitzeugenberichten soweit integriert oder assimiliert, dass ihre Existenz kaum jemandem als etwas Besonderes erschien. Jüdische Geschäfte konnten im Stadtteil auch nach den NSDAP-Boykottaktionen auf ihre Kunden zählen, von jüdischen Ärzten ist bekannt, dass sie sehr beliebt waren und nicht selten Patienten aus armen Haushalten kostenlos versorgten. Jüdische Krankenhausärzte hatten mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ schon 1933 ihre Arbeitsplätze verloren, ihre niedergelassenen Kollegen mit eigenen Praxen mussten spätestens 1938 aufgeben. Interviewte Barmbeker und Barmbekerinnen mit unterschiedlicher politischer Herkunft haben gleichlautend versichert, Judenfeindlichkeit sei innerhalb der Bevölkerung bis 1933 unbekannt und bis 1938 kaum zu bemerken gewesen. Manchmal habe man erst in diesen Jahren von der jüdischen Abstammung eines Nachbarn, Klassenkameraden oder Ladeninhabers in nächster Nähe erfahren. Staatliche Eingriffe in das Leben jüdischer Mitbürger und -bürgerinnen zeigten allerdings bereits 1933 auch in Barmbek Auswirkungen in Form von Auswanderungen jüdischer Nachbarn, ihrem Verschwinden aus öffentlichen Ämtern oder der aggressiven Parteipolitik gegen sie. Den „Nürnberger Gesetzen“ 1935 folgten weitere Ausgrenzungen, ab Ende 1938 mussten jüdische Schüler staatsliche Schulen verlassen, Juden wurden aus Vereinen gedrängt, Firmen trennten sich von Mitarbeitern. 33 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 34 Zwischen staatlichem Terror und dem Verhalten der Bevölkerung bestanden offenbar Diskrepanzen, in Barmbek und Uhlenhorst blieben Nachbarschaften noch einige Jahre relativ intakt. Auch jüdische Betroffene, soweit noch Zeugen befragt werden konnten, haben sich ähnlich geäußert; im Rückblick führten sie ein ganz normales Alltagsleben und beteiligten sich am sozialen Miteinander in der Nachbarschaft, Erinnerungen an Übergriffe vor 1933 gab es im Stadtteil keine und bis 1938 allenfalls in verdeckter Form, die der Öffentlichkeit oft nicht auffiel. Kaum bekannt – selbst für Juden, die sich nicht aktiv am Gemeindeleben beteiligten und eher säkular lebten – war die Existenz einer Synagoge im Stadtteil seit Grundriss der Synagoge in der Gluckstraße; leider existieren keine Fotos Geschichtswerkstatt Barmbek/Bauakte Bauprüfamt Barmbek-Uhlenhorst 1920, betrieben vom „Jüdischen Gemeinschaftsbund Barmbeck, Uhlenhorst und Umgegend“, der sich später „Schewes Achim“ nannte, d. h. Brüdereintracht. In der Gluckstraße 7–9 erwarb der Deutsch-Israelitische Synagogenverband ein Grundstück von der benachbarten „Barmbecker Brauerei“, zwei daraufstehende, zurückliegende Villen wurden umgebaut und am 9. September als Synagoge eingeweiht und genutzt bis zu ihrer zwangsweisen Schließung im November 1938. Gewaltsame Übergriffe oder Schändung in der Pogromnacht fanden nicht statt. Eine Gedenktafel auf dem Gehweg erinnert heute an die Synagoge, das Grundstück wird inzwischen von einer freikirchlichen Gemeinde genutzt. Veränderungen nach der nationalsozialistischen Machtergreifung fanden für jüdische Menschen in Barmbek also zunächst überwiegend auf offizieller Ebene statt, im Kontakt mit Behörden und Ämtern und aufgrund der massiv gegen Juden gerichteten nationalsozialistischen Hetze und Propaganda, flankiert von immer 34 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 35 neuen Gesetzen und Verordnungen mit dem Ziel ihrer Ausgrenzung, Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit und letztlich ihrer Vertreibung aus dem öffentlichen Leben, aus Stadt und Land. Den vorgelegten Biographien sind die schrittweisen Verschärfungen zu entnehmen, die schließlich auch in unserem Stadtteil spätestens ab 1938 nicht mehr zu übersehen waren. Jüdischen Ärzten, die bisher durchgehalten hatten, wurden 1938 die Approbationen entzogen. Sie mussten Praxen schließen und verloren damit ihre Existenzgrundlage. Mit der Pogromnacht am 9. November schließlich und der kurz darauf folgenden „Verordnung zur Ausschaltung von Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“ war die systematische „Arisierung“ abgeschlossen. Verbliebene jüdische Betriebe verloren ihre Lizenz, wurden „abgewickelt“ oder zwangsweise „arisiert“ bzw. an „politisch unbedenkliche“ Interessenten verkauft, oft zu Spottpreisen. Allein in der Hamburger Straße waren mindestens 30 Geschäfte betroffen. Juden wurden ab Ende 1938 letzte Freiräume genommen, das Bleiberecht streitig gemacht, Judenfeindlichkeit von Antisemiten offen ausgelebt. Jüdische Nachbarn verschwanden, weil sie wochen- oder monatelang in „Schutzhaft“ genommen waren, ab 1939 ihr Wohnrecht verloren und in „Judenhäusern“ Zuflucht suchen mussten, emigriert waren oder Suizid begangen hatten. Trotzdem kennen wir Berichte von nachbarschaftlichem Zusammenhalt, von freundlichen älteren Polizisten etwa, die einen jüdischen Schüler begleiteten und ihm zur Sicherstellung der familiären Ritualgegenstände Zugang zur geschlossenen Synagoge verschafften. Einer ihrer Kollegen in Barmbek Nord warnte seine jüdische Nachbarin vor der Pogromnacht und forderte sie auf, Verwandte aus einem anderen Stadtteil zur Sicherheit zu sich zu holen (s. Familie Acker). Mit Kriegsbeginn im September 1939 verschärften sich die Drangsalierungen. Betriebene Auswanderungen, die oft per Schiff über England stattfinden sollten, mussten storniert werden. Nur wenige Länder erteilten überhaupt noch ein Visum. Gab es nach hohen Zwangsabgaben noch Vermögen, so war es anzumelden und auf ein Sicherungskonto einzuzahlen, von dem nur geringe monatliche Summen abgehoben werden durften. Auf Lebensmittelkarten standen Juden nur halbe Rationen zu, Produkte wie Fleisch wurden ihnen ganz verwehrt. Sie unterlagen nächtlicher Ausgangssperre, durften nicht telefonieren, ihren Wohnort nicht verlassen, kein Radio hören. Wöchentliche neue Verordnungen schränkten ihr Leben weiter ein. 1941 erfolgten von Hamburg aus die ersten Deportationen, betrieben von Reichsstatthalter Kaufmann, der in Berlin darauf mit der Begründung drängte, es werde nach ersten Zerstörungen durch alliierte Bomben Wohnraum gebraucht. Die genaue Zahl der davongekommenen oder ermordeten jüdischen Familien und Einzelpersonen aus Barmbek und Uhlenhorst ist unbekannt. Unsere Recherchen anhand vorhandener Namen haben traurige, bedrückende Schicksale aufge35 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 36 zeigt. Zerrissene Familien, deren Kinder in der Fremde einer ungewissen Zukunft ausgesetzt waren, während die Eltern, bis zuletzt die Auswanderung betreibend, ihrer Deportation nicht entkommen konnten. Familien, die komplett ausgelöscht wurden. Nichtjüdische oder „halbjüdische“ Angehörige, die als Hinterbliebene weiteren Repressalien ausgesetzt waren. In einem Fall dann ein Lichtblick in all dem Grauen. Familie Kern, Inhaber einer Eiergroßhandlung in der Volksdorfer Straße mit Wohnadresse Richardstraße 11, hatte bereits 1936 verkauft und war nach Kopenhagen entkommen. Von deutschen Besatzungstruppen 1943 dort gefangengenommen und nach Theresienstadt deportiert, galt die Familie als verschollen. Schließlich führte ein Zufall auf ihre Spur und ergab, dass sie zu den ca. 400 dänischen Juden gehörten, die auf Betreiben der zwar entmachteten, aber in Teilen weiter aktiven dänischen Regierung und des Königs noch kurz vor Kriegsende mit Rotkreuz-Bussen aus dem Lager herausgeholt und nach Schweden gebracht worden sind. Die Familie lebte später in Kopenhagen. Beiläufig erhielten wir Informationen über das Verhalten der dänischen Bevölkerung, die in großen Teilen zu ihren jüdischen Mitbürgern stand und ihnen im Herbst 1943 nach dem Befehl aus Berlin, Dänemark „judenfrei“ zu machen, mehrheitlich in Nacht- und Nebelaktionen zur Flucht nach Schweden verhalf. Zerstörung Das alte Barmbek wurde im Zweiten Weltkrieg nahezu vollständig zerstört, es überlebte nur in Erinnerungen. Die „Operation Gomorrha“ im Sommer 1943, eine Antwort auf die Goebbelsche Ankündigung des „totalen Krieges“, sollte nicht nur die Stadt zerstören, sondern auch die Übereinstimmung zwischen NS-Regime und Bevölkerung. Eine Fehlannahme der Alliierten: wer in Kriegszeiten sein Hab und Gut verliert, nach Bombenangriffen traumatisiert ist und nicht weiß, wo Angehörige geblieben sind oder wie es weitergehen soll, hat keine Energie für Revolten übrig. Zwischen dem 24. Juli und 2. August erfolgten vier Nacht- und zwei Tagesangriffe mit insgesamt mehr als 3000 Bombereinsätzen. Neben Eimsbüttel, Hammerbrook, Rothenburgsort, Wedel, Hamm, Horn und Eilbek traf es Barmbek, überwiegend dicht besiedelte Arbeiterwohnbezirke und gleichzeitig Industriestandorte. 23 Quadratkilometer Stadtgebiet verwandelten sich in ein Trümmerfeld, rund 34 000 Menschen verloren während dieser Angriffe ihr Leben. In Barmbek waren über 90 Prozent der Bausubstanz nach den Angriffen – der schwerste in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli – komplett zerstört oder nicht mehr nutzbar, die Einwohnerzahl von 200 000 im Juli auf 15 000 im August 1943 gesunken. Zu den in der Hamburger Straße beidseitig zerstörten Gebäuden gehörte auch das Kaufhaus Karstadt, in dessen öffentlichem Luftschutzraum etwa 370 Schutzsuchende an einer Kohlenmon36 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 37 Trümmerfelder in Barmbek Süd, Blick von der Von-Essen-Straße nach Norden Geschichtswerkstatt Barmbek oxydvergiftung starben, verursacht durch einen im Nachbarkeller in Brand geratenen Koksvorrat. Auch in Uhlenhorst waren schwere Schäden zu verzeichnen, besonders betroffen die Straßenzüge zwischen Hofweg, Winterhuder Weg und Bachstraße. Das westliche reine Wohngebiet blieb teilweise erhalten, am Mundsburger Damm und in seinen Seitenstraßen waren nach den Angriffen nur noch wenige Häuser bewohnbar. Resümé Die eingangs erwähnte Frage „Wie konntet ihr dies zulassen?“ ist nicht mit wenigen Sätzen zu beantworten. Was damals geschah und nie wieder geschehen darf, haben Historikerinnen und Historiker unterschiedlich bewertet und in vielen Werken aufgearbeitet. Die Mitarbeit an diesem Rechercheprojekt, die Auseinandersetzung mit Einzelschicksalen konnte eine Ahnung vermitteln wie das Leben in der Nazizeit einerseits für Verfolgte, aber auch für „Normalbürger“ ausgesehen haben mag. Die Mehrheit beugte sich der schnellen, machtvollen Installation neuer Herrschaftsstrukturen, weil sie keine Alternativen mehr sah oder meinte, nun würde endlich „Ruhe im Land“ einkehren. Manche glaubten der Parole vom „tausendjähigen Reich“ und integrierten es in ihre Zukunftsplanung. Die Hinwendung großer Teile des Mittelstandes und sogar der Oberschicht zur NSDAP kann hier Vorbildcharakter gehabt haben. Das NS-Regime bot Aufstiegsmöglichkeiten, integrierte Frauen und Männer in Berufsverbände, die Gliederungen der NSDAP und ihre angeschlossenen Verbände. Die Männer wurden zur Wehrmacht, später zum „Volkssturm“ eingezogen, Frauen teilweise dienstverpflichtet, Kinder über die 37 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 38 „Kinderlandverschickung“ evakuiert und der Obhut ihrer Eltern entzogen. Selbst wer mit nobelsten Absichten angetreten war, konnte sich nur schwer der umfassenden Beeinflussung und Kontrolle entziehen. Gewalt und primitive Herrschaftsmentalität bewirkten ein Übriges zur Entsolidarisierung, um Maßstäbe humanen Handelns zu verlieren und/oder keine Möglichkeit zu deren Umsetzung zu sehen. Menschen, die sich nicht in das System integrierten, waren Sanktionen und unberechenbarem Terror ausgesetzt. Die Mitarbeit an dem Projekt war lehrreich und bereichernd, wenn auch manchmal schwierig, weil die Auseinandersetzung mit der Materie nicht ohne Emotionen stattfinden konnte und hin und wieder etwas Abstand nötig war. Um einzelne Lebensstationen der Opfer besser einordnen zu können, wurde die Auffrischung von Geschichtskenntnissen erforderlich, ganz sicher kein Nachteil und eine gute Grundlage zum besseren Verständnis der Ereignisse. Nie vorher war mir so bewusst, welche Macht Politiker haben können, binnen Kurzem per Gesetzgebung ein gewachsenes System auszuhebeln und eigene Ziele auf „legale“ Weise rücksichtslos durchzusetzen. (Ich kann nicht verhehlen, auch das aktuelle politische Tagesgeschehen mit wacherem Blick wahrzunehmen.) Beeindruckend finde ich, wie viele Menschen sich an der Spurensuche in Hamburg beteiligen und bereit sind, Patenschaften für Gedenksteine zu übernehmen. Dem Dank für das Entgegenkommen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zuvor schon genannten Archiven möchte ich mich anschließen und die Liste ergänzen um Frau Noeske, Leiterin der Bibliothek des Gymnasiums Christianeum, für Informationen und Hilfe bei der Suche nach Dokumenten. Dr. Beate Meyer und Joachim Szodrzynski von der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte gaben viele hilfreiche Denkanstöße und Literaturempfehlungen. Große Hilfe bei der Suche nach historischen Bildern und Fakten aus dem Stadtteil erhielten wir von den Mitarbeitern der Geschichtswerkstatt Barmbek, Dieter Thiele, Reinhard Saloch und Christian Albrecht. Besonders bedanke ich mich bei Eva Acker, die unsere Arbeit von Anfang an begleitet und unterstützt hat und uns in vielen Gesprächen aus eigener Anschauung einen Eindruck vermitteln konnte, welche weitreichenden Folgen für Überlebende und Angehörige auch lange nach der Shoah noch zu spüren waren. Wir lernten Eva kennen als einen wunderbaren Menschen mit großer Hilfsbereitschaft und hohem sozialen Anspruch, der auf Mitmenschen zugeht und sich für die Belange Benachteiligter einsetzt. Ihre Biographie weist Parallelen auf zu Ralph Giordano, der unsere Forschungen aus der Ferne begrüßt und ebenfalls – trotz allem Erlebten – seinem Stadtteil verbunden bleibt. Nur schwer ist der Gedanke zu ertragen, dass Menschen wie sie vor noch zwei Generationen Bedrohte und Verfolgte gewesen sind. 38 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 39 Den Mitstreiterinnen unserer kleinen Arbeitsgruppe, Carmen Smiatacz, Ingrid Budig und Stefanie Rückner danke ich für die gute Zusammenarbeit und Carmen für die große Geduld! Für das vorliegende Buch war unsere Zeit begrenzt, es berücksichtigt vorrangig Biographien zu schon verlegten Gedenksteinen oder solchen, für deren noch ausstehende Stolpersteine sich schon Paten gemeldet haben. Doch wir wollen weitermachen, soweit möglich, es gibt noch viele Namen. Neue Texte sollen dem Bestand des Internetportals www.stolpersteine-hamburg.de hinzugefügt werden. Wir freuen uns auf interessierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die über die Geschichtswerkstatt Barmbek Kontakt zu uns aufnehmen können. Quellen: Klaus, Andreas: Gewalt und Widerstand in Hamburg-Nord während der NS-Zeit; Büttner, Ursula: Hamburg zur Zeit der Weimarer Republik, S. 189 ff.; Hochmuth, Ursel/Meyer, Gertrud: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand; Meyer, Beate: Die Verfolgung und Ermordung der Hamburger Juden; Meyer, Beate: „Goldfasane“ und „Nazissen“ ; Von Villiez, Anna: Mit aller Kraft verdrängt; Bajohr, Frank: Arisierung in Hamburg; Rosenkranz, Bernhard/Bollmann, Ulf/Lorenz, Gottfried: Homosexuellenverfolgung in Hamburg; Thiele, Dieter/Saloch, Reinhard: Auf den Spuren der Bertinis; Thiele, Dieter: Gerda Ahrens – eine aus Barmbek; Barmbeker Geschichtswerkstatt: Barmbeker Geschichtstafeln, Textbuch; Giordano, Ralph: Erinnerungen eines Davongekommenen; Barber-Kersovan, Alenka/Uhlmann, Gordon (Hg.): Getanzte Freiheit, Swingkultur zwischen NS-Dikatatur und Gegenwart; Statistische Jahrbücher für die freie und Hansestadt Hamburg, Jahrg. 1936/37 und 1937/38; Brunswig, Hans: Feuersturm über Hamburg; Grassmann, Ilse: Ausgebombt, ein Hausfrauen-Kriegstagebuch; „NSDAP-Gaunachrichten“ für Barmbeck-Nord, Barmbeck-Süd und Uhlenhorst , Jahrg. 1935, 1936, 1938 (Mikrofilme, Bibliothek der Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Hamburg). 39 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 40 Erika Draeger Erinnerungen eines Davongekommenen R alph Giordano, in Barmbek aufgewachsen, ist als Betroffener ein Kronzeuge der Verfolgungen in der NS-Zeit und der sehr schleppenden Aufarbeitung in der Zeit danach. Er schrieb uns: „Ich freue mich überaus, daß nun dieses Buch über Barmbek erscheint, meiner Urheimat, die es auch geblieben ist bis heute, also bis in mein 87. Jahr. Und es bleiben wird, solange ich lebe.“ In seinen Erinnerungen lesen wir: „Ich bin später oft gefragt worden: ,Warum habt ihr Deutschland nicht verlassen?‘ ... Ich habe darauf immer die gleiche Antwort gegeben: ‚Weil wir nicht wollten und weil wir nicht gekonnt hätten, wenn wir gewollt hätten.‘ Wir wollten nicht, weil dies unsere Heimat war – wir hatten keine andere. Und wir hätten, selbst wenn wir gewollt hätten, nicht gekonnt, weil dieses Deutschland uns nicht hätte gehen lassen.“ Deutlicher lässt sich nicht ausdrücken, wie sehr alle Verfolgten und Opfer ein Teil vom Ganzen waren und sind, Stadt und Land Ralph Giordano waren ihr Zuhause, wie für jeden von uns. Archiv der Auferstehungskirche Barmbek Ausgegrenzt und vertrieben, misshandelt und ermordet wegen eines anderen Glaubens, eines angeblichen Fremdseins im Land der Heimat, einer anderen Weltanschauung, wurden sie auch nach Beendigung der NS-Zeit oft verdrängt und vergessen. Bis heute ist Ralph Giordano interessiert an Geschehnissen im Stadtteil, am Austausch mit seinen Menschen – und die Menschen an ihm. Auf Initiative der Geschichtswerkstatt Barmbek erhielt ein Weg am ehemaligen Standort des Wohnhauses in der Hufnerstraße, in dem Familie Giordano bis zur Ausbombung 1943 lebte, deren Namen. Im März 2008 folgte er einer Einladung zur nachträglichen Feier seines 85. Geburtstags in der Barmbeker Auferstehungskirche. Alle Plätze waren besetzt, als er 40 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 41 aus seiner Biographie las, sich an die Kindheit in Barmbek erinnerte, den Bruch ab 1933 und die Zeit danach. Die Gemeinde setzte ein Zeichen und bat Ralph Giordano, eine im Kirchenschiff angebrachte Inschrift zu enthüllen. Mit bewegter Stimme las er den Text: Die Gedenktafel in der Auferstehungskirche in Barmbek Archiv der Auferstehungskirche Barmbek In diesem Sinne verstehen wir auch unsere Arbeit an diesem Buch, es soll ein Zeichen sein gegen das Vergessen. Wir hoffen und glauben, dass die Vergangenheit bis in die Gegenwart reicht, dass wir alle daraus gelernt, unser Bewusstsein geschärft haben und zur Gestaltung einer Zukunft beitragen werden, die für alle ein Leben ohne Angst, Vorurteile und Ausgrenzung ermöglichen soll. Quelle: Giordano, Ralph: Erinnerungen eines Davongekommenen 41 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 42 Stolpersteine in Barmbek und Uhlenhorst Übersichtsplan, Positionen, Nummerierung D ie benachbarten Stadtteile Barmbek und Uhlenhorst gehören zum Bezirk Hamburg Nord. Am östlichen Alsterufer gelegen, grenzt Uhlenhorst im Norden an Winterhude, im Süden an Hohenfelde. Ein Teil des heutigen Uhlenhorst – zwischen Uhlenhorster Weg und Kuhmühlenteich – gehörte bis 1951 ebenfalls zu Hohenfelde. Uhlenhorst und der im Osten angrenzende Stadtteil Barmbek Süd liegen zwischen zwei Kanälen, dem Osterbekkanal im Norden und dem Eilbekkanal im Süden, die in die Außenalster fließen. Wasserstraßen, die in der Vergangenheit zu Transportzwecken für anliegende Industriebetriebe oder eine Alsterdampferlinie ausgebaut worden sind, werden heute gern von Wassersportlern genutzt. Barmbek Süd grenzt südlich an den Wandsbeker Stadtteil Eilbek, im Osten an Dulsberg. Am nördlichen Ufer des Osterbekkanals beginnt Barmbek Nord, das sich langgestreckt bis Ohlsdorf hinzieht, im Westen an Winterhude, im Osten an Steilshoop, Bramfeld und Dulsberg grenzend. Barmbek wie Uhlenhorst haben schwere Kriegsschäden erlitten. Während in Uhlenhorst jedoch ein großer Teil alter Gründerzeitwohnhäuser und Stadtvillen erhalten geblieben oder nach dem Krieg restauriert werden konnten, sind auf ehemals dichtbesiedeltem Barmbeker Gebiet bis zu 90 % der Bausubstanz bei Luftangriffen zerstört, ein Stadtteil in eine Trümmerwüste verwandelt worden. Beim Wiederaufbau spielten verkehrsplanerische Aspekte eine große Rolle, Barmbek Süd wird heute von der mehrspurig ausgebauten Hamburger Straße zerschnitten, Teil einer Verkehrsader zwischen Stadtgebiet und nordöstlichen Randgebieten, auf der sich täglich mehr als 40 000 Fahrzeuge bewegen. Einige Straßen sind verlegt worden, andere umbenannt, einige kleine Straßen heute ganz verschwunden und nur noch auf alten Stadtplänen zu finden. Ein Teil früher bebauter Grundstücke wurde zu Freiflächen erklärt, die sich heute als Grünzüge durch die Wohnanlagen der Nachkriegszeit ziehen, als Spielflächen oder Parkplätze zur Verfügung stehen. Dies hat zur Folge, dass verlegte Stolpersteine nicht immer vor bebauten Grundstücken liegen – die ehemaligen Wohnhäuser gehören der Vergangenheit an. 42 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 43 Barmbek rs W eg Barmbek Nord aße Fränkelstr ße De 70st nne str. U2 ch tr aß U 1 stra ße tel Geiers tr U Wa ch 53 Hufnertwiete s use Kra Stichkanal S Str aß e aße rstr Drosse l BARMBEK ndamm 73 Ötzgarten e 51 15 Wiese ts U3 Diesterwegstr. fne Dettmer- 6 straße bi HABICHTSTRASSE Hu Barmbeker Ortsamt e Str aß aß e e aß 29 Halbenkamp 28 tr 5 s e aß ler l Ad ana k O 11 59 sterbek mf Bra ehm el de r Schule str ße tra ekkanal Osterb kt . traße Schleidenstraße Schule Gensler 2 Ha traße kamp Rüben s Saarland e r- 49 r. er S üttel 32 Schule Br am fel de r S Bendixensweg Straße St ra Otto-SpeckterStr. 66 31 18 lsb Fuh Saarlandstraße Ba rm be ke r 69 ALTE WÖHR SAARLANDSTRASSE k ige Margarethe Rothe Gymn. r. Jahnb U Eil Straße Krankenhaus 62 Prechtsweg Steilshooper Allgemeines teler sbüt RÜBENKAMP ter. Meistram-Str Ber Fuhl kamp Rüben S 43 Kampnagel Fabrik k erbe t s O Weg nnh -Ja . str inhe tr. hm s 43 m Schule tst ld bo r St r ge nal r bu lte A m ra P a e H b O ße ra eg Averhoffstr. 57 17 71 bu rg er M un ds 37 of Immenh Hartwicusstr. Armgartstr. FachhochSchule hlenKuhmü h teic d 42 22 el 35 58 13 9 nf wik Schwanen 27 64 45 8 Papenhuder Str. MUNDS56 BURG Gymn. Lerchenfel he rc Weg orster Uhlenh U Le 60 14 m m Schule Da fw Ho 39 Heinr 46 26 63 eg W . z-Str ert ich-H Hu er ud K 72 t sich Aus ße tra - S ne 50 nn rh 10 e traß anals Uhlenhorst 44 a itm ße te 16 54 ALSTER 47 in traße Zimmers ann Schö Feenteich o M 19 ra Schenckendorfstraße Höltystr. 21 G.-Freytag Str. hm 34 52 68 za W Hofweg ic We t - r rbe He Karlstr. 12 44 7 4 e aß tr rts tst ld bo L straße 24 m g an Weid e Hu er g Zu Süd He H.-He nn 67 Barmbek al kan Fra Herderstraße y 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 44 H fü Kü na ll e e a St r. Glu ck 23 al an kk lbe ße Allgemeines Krankenhaus Eilbek ße 41 a str p 38 Schule p Kam r e h nisc l kta e b Eil Ei Schule e n. henfeld Frauenklinik Finkenau ld e nf Hochschule für Bildende au n Künste le Ei 3 48 ar W Schule de nhai Deh Stra Holstei skam ße ß tra ds ar ch Ri Alten- und Pflegeheim 40 25 a str 61 Süd Schule U2 HAMBURGER U STRASSE r ne ag W ße ra t r S lte e rg r bu be O DEHNHAIDE Hein Ha U Barmbek 33 Von - Essen - m bu rg er e raß 20 La ng be k rm Ba t Elsas 65 De hn haide Vogelwe ide Str aß e 55 36 Friedric hsberger . -Str lder önfe -Sch Adolph estraße Weid en er Vogteiweg 30 47 r eh M kt . Schl e 001-045 Titelei-Plan Korr:. 30.08.10 22:08 Seite 45 eg W Schule r ke e ilb E nd s b Wa sbe Wand eker Chau ker Ch ssee te u na Hohenfelde 45 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 46 Carmen Smiatacz Biographien von A bis Z* Robert Carl Albert Abshagen, geb. 12.1.1911, hingerichtet im Untersuchungsgefängnis Hamburg-Holstenglacis am 10.7.1944 1 Wachtelstraße 4 Als Sohn des Bäckergesellen Albert Abshagen und seiner Frau Adelheid, geb. Heidenreich, wuchs Robert Abshagen mit seinen drei Schwestern, Louise, Agnes und Elfriede, in einem sozialistischen Elternhaus auf. Nach dem Besuch der Versuchsschule „Telemannstraße“ und der Aufbauschule „Hohe Weide“ bis zur Untersekunda begann Robert Abshagen eine kaufmännische Lehre. Zudem fuhr er für kurze Zeit zur See, arbeitete als Versicherungsangestellter und auf dem Bau. Im Jahr 1931 trat er der KPD bei, wurde ab 1932 im „Polizeizersetzungsapparat“ und Nachrichtendienst der Partei eingesetzt und war ab 1933 als Funktionär des illegalen RFB („RotRobert Abshagen VVN frontkämpferbund“) tätig. Im Herbst desselben Jahres wurde er deswegen erstmals in „Schutzhaft“ genommen. Ein Jahr später, im September 1934, erfolgte eine erneute Verhaftung, die Anklage lautete auf „Vorbereitung zum Hochverrat“. Diesmal wurde Robert Abshagen vom Strafsenat des Hamburger Oberlandesgerichts zu zwei Jahren und sechs Monaten Zuchthaus verurteilt, die er im Zuchthaus Bremen-Oslebshausen verbüßte. Anstatt ihn anschließend zu entlassen, wurde er jedoch ins KZ Sachsenhausen überführt, wo er erstmals mit Franz Jacob und Bernhard Bästlein zusammentraf. In Sachsenhausen kümmerte sich Robert Abshagen als Vorarbeiter im Häftlingsrevier um die Kranken und Geschwächten. Während dieser Zeit erlernte er auch einige medizinische Kenntnisse und gab sein Wissen an seine Mithäftlinge weiter. Zu Silvester 1937 wurde im Lager sein selbst komponierter Song „Hamburger Jungs“ als „Äquatortaufe“ aufgeführt. * In alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens. Nummern beziehen sich auf verlegte Stolpersteine. Biographien geplanter Stolpersteine sind durch graue Schrift gekennzeichnet. Die letzte Adresse bzw. Verlegeorte der Stolpersteine sind fett gedruckt, in Klammern folgt ggf. die damalige Adresse, wenn sie von der heutigen abweicht. 46 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 47 Im April 1939 wurde Robert Abshagen aus dem KZ Sachsenhausen entlassen. Trotzdem blieb er mit einigen Mithäftlingen in Kontakt, so zum Beispiel mit Hein Bretschneider und Hans Christoffers. Zusammen mit diesen beiden war er als Bauarbeiter bei der Wandsbeker Firma Crone tätig. Die drei Männer waren unter dem Namen „A-B-C-Kolonne“ bekannt und machten durch antinationalsozialistische Propaganda von sich reden. Im März 1941 heiratete Robert Abshagen seine Verlobte Manja (Minna) Hildebrandt und zog mit ihr in die Wachtelstraße. Seit seiner Entlassung aus Sachsenhausen hatte Robert Abshagen in der elterlichen Wohnung gelebt. Manja Abshagen war eigentlich Schauspielerin und bis zur Saison 1933/34 am Deutschen Schauspielhaus tätig gewesen. Doch ihr Gesundheitszustand, sie litt an Herz- und Die Wachtelstraße Nr. 2 bis Nr. 8 in den 1920er Jahren Geschichtswerkstatt Barmbek Kreislaufschwäche, ließ keine weitere Erwerbstätigkeit mehr zu. Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 setzte unter Kommunisten (nicht nur) in Hamburg im Vergleich zur Phase des Hitler-Stalin-Paktes ein Wandel ein und die illegale Arbeit wurde stark ausgeweitet. Anfang Dezember 1941 fand in der Wohnung von Robert Abshagen eine Zusammenkunft statt, die den Beginn einer neuen Widerstandsgruppe markierte. Von da an organisierte sich die sogenannte Bästlein-Jacob-AbshagenGruppe unter der Führung von Bernhard Bästlein, Franz Jacob, Oskar Reincke und Robert Abshagen. Gemeinsam bauten sie ein Netzwerk aus sogenannten Betriebszellen in über 30 Fabriken und Werften auf. Zudem unterhielten sie zahlreiche Kontakte zu anderen Widerstandsorganisationen in Norddeutschland und nach Berlin. Insbesondere auf den Werften von Blohm & Voss bildete sich eine große Gruppe von rund 100 Kontaktpersonen, die sich im Widerstand engagierten. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben lag in der Unterstützung der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen. Diese wurden oftmals in den Werften oder Betrieben eingesetzt und so konnte der Kontakt zu ihnen hergestellt und gesichert werden. Robert Abshagen übernahm vorerst die Leitung der illegalen Betriebsgruppe in den „Vereinigten Deutschen Metallwerken“ (VDM) Groß Borstel. Mitte des Jahres 1942 kam es zu einer größeren Flugblatt-Aktion der „Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe“. Nach einer Vorlage von Robert Abshagen schrieb Franz Jacob das „Merkblatt für Bauarbeiter“. Es richtete sich vor allem an Hamburger Bauarbeiter, die im Frühjahr 1942 zur Dienstleistung bei Bauvorhaben der „Organisation Todt“ (OT) in Norwegen und der Sowjetunion zwangsverpflichtet worden waren. In diesem Flugblatt hieß es unter anderem „Hitlers Niederlage ist nicht unsere Niederlage, sondern unser Sieg!“. 47 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 48 Im Herbst 1942 gelang es der Staatspolizeistelle Hamburg die Widerstandsorganisation um Bernhard Bästlein, Franz Jacob und Robert Abshagen von „oben“ nach „unten“ aufzurollen. Einer der Gründe dafür war ein Gestapo-Spitzel, der sich in die Gruppe eingeschlichen hatte. In diesem Zusammenhang wurde Robert Abshagen am 19. Oktober 1942 erneut von der Gestapo inhaftiert und ins Gefängnis Fuhlsbüttel eingewiesen. Dort wurde er bei der Vernehmung von den Beamten schwer gefoltert, wie sein Freund Roger Fridman berichtete: „Ich denke besonders an Robert Abshagen, dessen Gesicht ich nach seinem Verhör auf der Gestapo nicht mehr wieder erkennen konnte.“ (Ansprache auf einer Veranstaltung des Kuratoriums Ehrenhain am 19. September 1962 in Hamburg.) Zuerst wurde Robert Abshagen zu Weihnachten aus der Einzelhaft auf den Saal II und später im März 1943 in das Untersuchungsgefängnis Hamburg-Holstenglacis verlegt. Bei den alliierten Bombardierungen Hamburgs im Juli 1943 wurde auch die Wohnung der Abshagens völlig zerstört. Manja musste daraufhin zu Robert Abshagens Eltern ziehen. Einen Monat später wurde Robert Abshagen zusammen mit Bernhard Bästlein nach Berlin-Plötzensee überführt, um dort in einem Prozess gegen Martin Weise als Zeuge auszusagen. Kurze Zeit später, im November, beschuldigte die Anklage des Oberreichsanwalts des Volksgerichtshofs Robert Abshagen, Bernhardt Bästlein, Oskar Reincke, Gustav Bruhn und Walter Bohne der „Vorbereitung zum Hochverrat“ und der „Feindbegünstigung“. Am 6. März 1944 begannen vor dem Hamburger Oberlandesgericht die ersten der sogenannten Hamburger Kommunistenprozesse, in denen auch die Anklage gegen Robert Abshagen verhandelt wurde. Zur Hauptverhandlung wurde Robert Abshagen aus Berlin nach Hamburg zurückgeholt. Der Volksgerichtsrat Löhmann sprach am 2. Mai 1944 gegen Oskar Reincke und Robert Abshagen das Urteil, es lautete auf Todesstrafe durch Enthauptung. Zwei Monate später, am 10. Juli, wurde das Urteil gegen Robert Abshagen im Untersuchungsgefängnis Hamburg vollstreckt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Mitangeklagten Gustav Bruhn und Walter Bohne bereits tot und Bernhard Bästlein aus der Haft geflohen und mit Franz Jacob im Berliner Widerstand aktiv. Noch bis kurz vor seinem Tod hielt Robert Abshagen zu seiner Frau Manja Kontakt und wurde in Berlin finanziell mit 20 RM monatlich von ihr unterstützt. Nach seiner Hinrichtung wurden die sterblichen Überreste von Robert Abshagen an die Anatomie der Universität Kiel übergeben und dort in einem Massengrab zwischen Berufsund Schwerverbrechern verscharrt. Im Sommer 1947 wurde seine Leiche in dem Massengrab auf dem Friedhof der Gemeinde Kronshagen gefunden und in Kiel eingeäschert. Am 14. September 1947 wurde seine Urne während einer Gedenkkundgebung im Ehrenhain Hamburger Widerstandskämpfer auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt. Zudem wurde in der DDR ein Grenzregiment nach ihm benannt. Quellen: StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 12.01.11 Abshagen, Robert; VVN, A2 Abshagen, Manja; Bästlein: „Hitlers Niederlage ist nicht unsere Niederlage, sondern unser Sieg!“, S. 55 ff., S. 65 f.; Hochmuth: Niemand und nichts wird vergessen, S. 18 ff.; Hochmuth: Illegale KPD und Bewegung „Freies Deutschland“, S. 25, S. 45 f., S. 72, S. 112, S. 156, S. 164 f., S. 188; Puls: Die Bästlein-Jacob-Abshagen Gruppe, S. 179 ff.; Sparr: Stolpersteine in Hamburg-Winterhude, S. 46 f.; Suhlig: Der unbekannte Widerstand, S. 38 f., S. 160 f., S. 177; Weber/Herbst: Deutsche Kommunisten, S. 51 f. 48 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 49 Franz Josef Acker, geb. 18.10.1903, im Konzentrationslager Sachsenhausen-Oranienburg am 26.5.1943 gestorben 2 Genslerstraße 16 Franz Acker stammte aus einer katholischen Familie. Er hatte zwei Brüder, Hermann und Heinrich, die in den zwanziger Jahren nach Nordamerika auswanderten. Mitte der zwanziger Jahre kam er in Ausübung seines Berufes als Koch, später Küchenchef, nach Hamburg, wo er seine künftige Frau Lissi kennenlernte. Lissi, geboren am 25. April 1904, war die dritte von vier Töchtern der in Barmbek lebenden jüdischen Familie Kaufmann. Die beiden heirateten am 15. November 1930 im Standesamt Barmbek und wohnten zuerst bei Lissis verheirateter Schwester Margarete Meyer in der Habichtstraße, später in der OttoSpeckter-Straße, im Lambrechtsweg und in der Genslerstraße. Vor der Hochzeit hatte Franz eine Anstellung als Küchenchef Franz Acker Privatbesitz in Magdeburg angetreten, wo ein gemeinsames Leben geplant war. Möbel waren bereits bestellt, eine Wohnung hatte das Paar in Aussicht. Als Franz jedoch den Arbeitgeber um Heiratsurlaub bat und dieser von der jüdischen Abstammung der künftigen Ehefrau erfuhr, kam es zu einem Eklat, dem eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses folgte. Erste Repressalien fanden also bereits 1930 statt. Franz kehrte entrüstet nach Hamburg zurück und fand eine Anstellung im damaligen Ernst-Merck-Hotel. 1933 wurde das erste Kind geboren. Auf Lissis Wunsch sollte der Junge Iwan heißen, nach einem von ihr sehr geschätzten Onkel, der als Soldat im Ersten Weltkrieg gefallen war. Doch auf dem Standesamt forderte man vom Vater, einen deutschen Namen auszuwählen, sodass der Sohn den Namen Helmut erhielt. Im Januar 1935 musste Franz die Arbeitsstelle wechseln, weil die Verwaltung in Hamburg eine neue Verordnung umgesetzt hatte, die den Ausschluss von Juden oder Ehepartnern von Juden aus Berufen und Ausbildungsgängen vorantreiben sollte. Franz durfte keine Lehrlinge mehr ausbilden. Die Gestapo forderte ihn auf, sich von seiner Frau zu trennen, selbst Lissi bot ihm diese Lösung an, doch für ihn kam nicht einmal eine Scheintrennung in Frage, weil ihm klar war, dass er damit die Sicherheit seiner Frau gefährden würde. Der Versuch eines Pfarrers, Lissi zum Übertritt zum katholischen Glauben zu bewegen, wurde von ihr abgelehnt. Franz’ in den USA lebende Brüder boten an, sich für die Auswanderung der Familie nach Amerika einzusetzen, doch Lissi schreckte davor zurück, ihre Mutter zu verlassen. Vom 21. Januar 1935 bis 30. Juni 1936 war Franz Acker im noch nicht zu Hamburg gehörenden Harburg im Gloria-Café als Küchenchef tätig. Wegen der weiten Anfahrten wünschte der neue Arbeitgeber einen Umzug nach Harburg. Eine Wohnung fand sich in der Wilstorfer Straße. Zu dieser Zeit hingen an Geschäften bereits Schilder, dass Juden unerwünscht seien bzw. 49 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 50 jüdische Geschäfte nicht betreten werden sollten. Es dauerte nicht lange, bis sich herumgesprochen hatte, dass Lissi Jüdin war. Sie selbst bekannte sich offen dazu, lehnte es auch ab, aus den zur Straße führenden Fenstern ihrer Wohnung die Hakenkreuzfahnen zu hängen, was ihrem Mann erlaubt, ihr aber verboten gewesen wäre. Die Anfeindungen führten zu einem weiteren Arbeitsplatzwechsel. Franz hatte ab Juli 1936 eine neue Stelle in Bremerhaven im Hotel Excelsior. Lissi und der kleine Sohn zogen mit ihm. Das Arbeitsverhältnis dauerte zwei Jahre an, in den Sommermonaten 1937 wurde Franz in einem weiteren Hotel des Inhabers in Westerland auf Sylt eingesetzt. Doch die Repressalien holten die Familie auch in Bremerhaven ein, sodass erneut ein Umzug anstand. Franz und Lissi Acker, ca. 1933 Privatbesitz Der nächste Ort in dieser Odyssee war für Franz dann Köln, wo er von Juli bis September 1938 in der Restauration eines Ausflugsdampfers beschäftigt war, während Lissi mit dem Kind wieder in Hamburg lebte, weil der kleine Helmut sich nach einer Masernerkrankung nicht erholte und ein Kinderarzt starkes Heimweh diagnostiziert hatte. Tatsächlich ging es ihm gleich besser, als Großvater Kaufmann die beiden am Hamburger Hauptbahnhof empfing. Nicht auszuschließen ist, dass auch Lissi selbst sich in eine vertraute Umgebung zurücksehnte, war sie doch die meiste Zeit allein mit dem Kind in fremder, oft feindseliger Umgebung. Überdies wird ihr die groteske Situation klar gewesen sein, in der ihr Mann als Ernährer der Familie bessere Arbeitsbedingungen hatte, wenn sie nicht in seiner Nähe war. Lissis Eltern und zwei Schwestern waren 1938 in den Lambrechtsweg in Barmbek Nord gezogen, wo sich auch für Lissi und ihr Kind eine kleine Wohnung im Nachbarhaus fand. Im gleichen Jahr wurden Eltern und Schwestern durch Denunziation aus der Straße vertrieben und wichen in eine kleinere Wohnung im Bendixensweg aus, ein Grund für Lissi Acker, dort auch wegzuziehen. Ein für damalige Verhältnisse sehr toleranter Vermieter namens Oberländer, der sich über ihre jüdische Abstammung hinwegsetzte und klarmachte, dass sie für ihn zuallererst Mensch sei, bot ihr eine Wohnung in der Genslerstraße 16 an. Ab 1939 war der Mieterschutz für Juden per Erlass aufgehoben, doch auch vorher war es schon äußerst schwierig, Wohnungen zu finden. In der Genslerstraße erlebte Lissi Acker auch positive Nachbarschaft, besonders hervorzuheben sind ihr zugegangene Warnungen vor der Pogromnacht am 9. November 1938. Durch einen benachbarten Polizisten erhielt sie geradezu eine Aufforderung, Verwandte im Stadtteil Hoheluft zu warnen und zu sich zu holen, um sie vor Verhaftungen zu schützen. 50 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 51 Mit Kontrollbesuchen der Gestapo in dieser Zeit waren diverse Schikanen verbunden, so durfte der kleine Helmut seinen Hund nicht behalten. Eine kostbare Bücher- sowie eine wertvolle Briefmarkensammlung des abwesenden Franz wurden beschlagnahmt. Die Absurdität der Verordnungen gipfelte darin, dass Lissi als Jüdin kein eigenes Radio nutzen durfte, während Sohn und Ehemann in der gleichen Wohnung ein Radio besitzen konnten. Helmut Acker besuchte ab 1940 die Schule Genslerstraße, Ecke Rübenkamp. Eines Tages kam er weinend nach Hause, weil er von der Lehrerin bestraft worden war wegen seiner Äußerung, sein Großvater habe als Soldat im Ersten Weltkrieg ein Eisernes Kreuz erhalten und sein Onkel sei als Soldat gefallen. Die Lehrerin hatte ihn der Lüge bezichtigt, angeblich habe es keine jüdischen Soldaten gegeben. Von Lissi zur Rede gestellt, gab sie später zu, selbst Angst um ihren Arbeitsplatz gehabt zu haben. Unterdessen hatte Franz von Oktober 1938 bis August 1939 eine Tätigkeit in Saarbrücken ausgeübt, im Café Kiefer, und sah die Familie nur selten. Der Weg nach Hamburg war weit, sicher hatte ihn die Frage beunruhigt, ob seine ständige Abwesenheit Frau und Kind trotz sogenannter privilegierter Mischehe gefährdete. Er wird von der Vertreibung der Schwiegereltern und Schwägerinnen gehört haben, die auch im Bendixensweg nicht bleiben durften und inzwischen in einer jüdischen Stiftswohnung in der Bogenstraße untergekommen waren. Mit Hilfe alter Kontakte in Hamburg gelang es, ab August 1939 einen neuen und dauerhafteren Arbeitsplatz im Hotel Königstadt in Berlin-Potsdam zu bekommen. Besuche zu Hause konnten nun öfter stattfinden, gab es doch mit dem „fliegenden Hamburger“ eine schnelle Zugverbindung zwischen Hamburg und Berlin. Auch finanziell war es vielleicht lukrativer, denn Franz sparte, um sich eines Tages den Wunsch eines selbstständigen Betriebes erfüllen zu können. Die Sorge um die Familie wuchs, es gab weitere Schikanen gegenüber Juden, immer schärfere Gesetze und Verordnungen. Ab 1941 dann die Deportationen deutscher Jüdinnen und Juden, 1942 waren Lissis Angehörige verschleppt worden, die Schwestern am 11. Juli nach Auschwitz, der Vater eine Woche später am 17. Juli nach Theresienstadt, ihre geliebte Mutter verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Bei seiner Arbeit in einem Hotel in Hauptstadtnähe wird Franz Möglichkeiten gefunden haben, sich über aktuelle Nachrichten ein Bild zu machen von den Zuständen im Land. Im Januar 1943 besuchte Franz Acker Frau und Sohn, er sprach mit Lissi über seinen Wunsch nach einem zweiten Kind. Sohn Helmut war nun bald zehn Jahre alt, vielleicht blieb ein weiterer Kinderwunsch bisher wegen der beruflichen Unsicherheiten und zeitlichen Unwägbarkeiten zurückgestellt, nun aber schien er einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Außerdem glaubte Franz, ein weiteres Kind könne Frau und Sohn zusätzlichen Schutz vor Verfolgung bieten. Zurück in Potsdam legte Franz Acker wenig später in seiner offenen Art einem Küchenjungen nahe, sich „lieber für seine Ausbildung zu interessieren, statt seine Freizeit bei den Mördern (HJ) zu verbringen“. Die Gestapo verhaftete ihn am 13. Februar 1943 aus der Küche heraus, man brachte ihn am 13. Februar 1943 in das KZ Sachsenhausen, Oranienburg. 51 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 52 Lissi Acker bekam zunächst keine Nachricht und wartete auf das dringend benötigte Haushaltsgeld. Erst bei einem Anruf in Potsdam erfuhr sie vom Inhaber des Hotels von der Verhaftung ihres Mannes. Nach Wochen bekam sie die erste Postkarte von ihm, datiert bereits am 21. Februar. Insgesamt existieren vier zensierte Karten, die Lissi bis Mitte des Jahres von ihrem Mann erhielt, als bereits sicher war, dass sein Wunsch nach einem zweiten Kind sich erfüllen würde. Sie hatte kaum Geld und wusste nicht weiter, bis eine Bekannte für sie nach Potsdam fuhr, um Franz’ Sachen aus dem Hotel zu holen, zu denen auch ein Sparbuch über 6000 RM gehörte. Als Jüdin hätte sie Ersparnisse anmelden und mit einer Sicherungsanordnung rechnen müssen, doch es ergab sich eine Möglichkeit, dieses Sparbuch bis Kriegsende in der Schweiz zu deponieren. Franz starb laut Sterbeurkunde am 26. Mai 1943 um 5:30 Uhr, ausgestellt vom Standesamt Oranienburg II am 16. Juni 1943, die Umstände sind unklar. Lissi bekam eine Vorladung zur Gestapo in der ABC-Straße, wo sie und andere Betroffene sich regelmäßig zu melden hatten. Franz Ackers letzter Brief aus OranienburgSachsenhausen Privatbesitz 52 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 53 Diesmal ging sie in Begleitung des jüdischen Rechtsanwalts Plaut, mit dem ihre Familie gut bekannt war. Man teilte ihr den Tod ihres Mannes mit und erklärte, die Todesursache sei eine angebliche Krebserkrankung gewesen. Im Juni erhielt sie ein Paket mit verschimmelten Lebensmitteln zurück, die sie ihm geschickt und die man ihm offensichtlich nicht ausgehändigt hatte. Die Lebensmittel stammten von verschiedenen Geschäftsleuten in Barmbek, die Lissi und ihre Familie kannten und ihr illegal hin und wieder Nahrungsmittel zusteckten, die sie offiziell als Jüdin nicht hätte bekommen dürfen. In einem weiteren Paket wurden ihr Franz’ Kleidungsstücke zugestellt, seine Wäsche mit Blut und Eiter verschmutzt. Das Haus Genslerstraße 16, in dem Lissi – inzwischen hochschwanger – und ihr nun zehnjähriger Sohn Helmut wohnten, wurde Ende Juli 1943 während der „Operation Gomorrha“ ausgebombt, selbst ihre Koffer kamen durch Diebstahl abhanden, als der aufgesuchte Keller wegen Gefahr geräumt werden musste. Mit Hilfe anderer Bombenflüchtlinge gelangten sie und ihr Sohn in den Ort Brunau, wo sie allerdings fast verhungerten, da Lissi sich als Jüdin identifizieren musste und vom Bauern, bei dem ihnen eine Unterkunft zugewiesen wurde, schlecht behandelt wurden. Lissi erinnerte sich später, dass Helmut zu ihr sagte: „Mutti, lass uns lieber in die Trümmer zurückkehren und da sterben.“ Nach der Rückkehr im September 1943 lebten sie übergangsweise unter ärmsten Bedingungen in kleinen Zimmern zur Untermiete am Klosterstern, in der Hartungstraße, schließlich in einem „Judenhaus“ in der Rutschbahn, wo in einer großen Wohnung fünf Familien untergebracht waren. Helmut war zusammen mit einem älteren Cousin beim Bergen von Leichen aus Trümmergrundstücken in der Grindelallee beteiligt, erinnerte sich Lissi später. Im Oktober 1943 kam ihre Tochter Eva Maria im Jüdischen Notkrankenhaus in der Schäferkampsallee zur Welt, als der Vater des Kindes bereits fünf Monate tot war. Noch im Krankenhaus bestand für Lissi die Gefahr einer Verhaftung, weil sie ihren Zwangsnamen Sara nicht auf die Geburtsanzeige geschrieben hatte. Zusammen mit einem anderen Patienten wartete sie auf den Abtransport, es war der jüdische Filmregisseur Walter Koppel, der ihr sagte, sie möge sich um Hilfe an ihn wenden, falls sie beide überleben sollten. Der Abtransport fand nicht statt, vielleicht wegen eines Fliegeralarms, der Grund blieb unklar. Lissi äußerte später in einem Interview, sie habe es nicht über sich gebracht, das Angebot Koppels wahrzunehmen. Außer 64 RM Waisenrente pro Kind erhielt Lissi Acker keine Unterstützung. Nur mit Hilfe von Bekannten und Freunden, darunter ehemalige Nachbarn aus der Genslerstraße, bekam sie die Babyausstattung zusammen. In ihrer Erinnerung hatte sie große Angst um die Kinder, sprach von Anfeindungen, aber oft auch von Hilfe aus der Nachbarschaft. Nach dem Krieg lag ihr viel daran, in die Barmbeker Gegend zurückzukehren. Sie fand zunächst eine Wohnung für sich und die Kinder in der Meister-Francke-Straße, fühlte sich aber dort nicht wohl. Ihr größter Wunsch war, wieder in die Genslerstraße zurückzukehren, die Jahre dort und die erlebte gute Nachbarschaft bedeuteten für sie Heimat. Nach weiteren Wohnungswechseln – in einer Zeit der Wohnungsnot – gelang eines Tages die Rückkehr, Lissi Acker wohnte dort bis zu ihrem Tod 1991. 53 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 54 Lissi und die Kinder haben Krieg und „Drittes Reich“ überlebt, der Deportationsbefehl für jüdische Frauen aus „Mischehen“ im Februar 1945 erreichte sie nicht. Für alle Fälle war sie immer gewappnet, ein Arzt hatte ihr ein sicheres Mittel gegeben, das sie stets bei sich trug und mit dem sie im Ernstfall ihrem Leben ein Ende hätte setzen können. Aber die Zeit hatte tiefe Spuren hinterlassen. Lissis Ehemann und ihre gesamte Familie – Schwestern, Eltern, weitere Verwandte – waren dem Naziregime zum Opfer gefallen, sie litt an Angina Pectoris sowie einer chronischen Gallenerkrankung. Ab 1954 bezog sie eine kleine Arbeitsunfähigkeitsrente. Behördenbesuche und der Kampf um Entschädigungsleistungen Lissi Acker mit ihren Kindern Helmut und Eva, ca. 1946 Privatbesitz raubten ihr die Kraft und verursachten Koliken, sie hatte mehrfach lieber Verzicht geübt als sich diesen Torturen auszusetzen. Helmut kränkelte schon mit 14 Jahren, erlitt in seinem Leben verschiedene Herz- und andere Operationen und wurde nur 64 Jahre alt. Mutter und Sohn litten zeitlebens an Schlafstörungen, nächtliche Schritte im Treppenhaus weckten Erinnerungen an Gestapobesuche. Tochter Eva, Ende 1943 geboren und aufgewachsen mit traumatisierter Mutter und Bruder, ohne weitere nahe Verwandte, hat oft erlebt, wie beide aus Selbstschutz verstummten, wenn es um die NS-Zeit ging. Viele Fragen hat sie vergeblich oder aus Rücksicht gar nicht gestellt und sich allein auf die Suche nach Antworten begeben müssen. – Eva Acker/Erika Draeger Quellen: 1; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 25.04.04 Acker, Lissi; Interview mit Lissi Acker, Dez. 1990, Geschichtswerkstatt Barmbek; Arbeitsbuch Franz Acker, geführt 1918 bis 1943; VVN; IGdJ: Das jüdische Hamburg, S. 206 f; Meyer: Die Verfolgung und Ermordung der Hamburger Juden, S. 48, S. 79 ff, S. 206. Friedrich Adler, geb. 29.4.1878, am 11.7.1942 nach Auschwitz deportiert 3 Lerchenfeld 2 (Kunsthochschule) Schon in seiner Jugend zeigte sich die künstlerische Begabung Friedrich Adlers. Er wuchs in Taupheim bei Ulm auf und zog nach dem Abitur nach München, um dort eine Ausbildung zum Zeichner an der Königlichen Kunstgewerbeschule zu machen. Im Jahr 1903 leitete Friedrich Adler eine der dortigen Fachwerkstätten. Vier Jahre später, nach dem Ende seiner Ausbildung, zog es ihn nach Hamburg an die Landeskunstschule, wo er als Studienrat tätig war. Zu diesem Zeitpunkt war Friedrich Adler bereits ein gefragter Künstler. Seine Arbeiten schwankten zwischen Jugendstil, Neoklassizismus und Art déco. Er wirkte als Designer für mehr als 60 54 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 55 Firmen, entwarf Gabeln, Teelöffel, Tabletts, Bodenbeläge, Haushaltswaren, Kunststoffe und ganze Inneneinrichtungen. In Hamburg heiratete Friedrich Adler seine jüdische Verlobte Bertha Heymann, mit der er fünf Kinder hatte. Das älteste der Geschwister, Hermann, kam am 14. April 1908 zur Welt, Max Wolfgang folgte am 25. November 1910, Ingeborg Elisabeth wurde am 10. März 1912 geboren und Paul Wilhelm kam am 15. Februar 1915. Zum Schluss erblickte Berta am 22. November 1918 das Licht der Welt. Während des Ersten Weltkrieges diente Friedrich Adler als Unteroffizier. Später stieg er zum Feldwebel und zum Offizierstellvertreter auf. Nach Kriegsende kehrte er nach Hamburg zurück, um wieder als Künstler und Lehrer tätig zu sein. Kurz nach der Geburt ihres Leuchter Museum zur Geschichte von Christen und Juden, Schloß Großlaupheim letzten Kindes starb seine Ehefrau Bertha. Die neue Frau in Friedrich Adlers Leben hieß Frieda Fabisch, die ursprünglich aus Berlin stammte. Die Hochzeit fand am 21. Dezember 1920 statt. Ihr erstes gemeinsames Kind, Eva Amarand Friederike, kam am 29. Januar 1925 zur Welt. Die Familie lebte gemeinsam im Orchideenstieg 41, in einer großzügigen Acht-Zimmer-Wohnung. Von 1927 an lehrte Friedrich Adler als Professor an der Kunstgewerbeschule am Lerchenfeld 2 und beschäftigte sich zudem intensiv mit dem Textildruck, er gründete sogar eine eigene Firma. Sein Leben änderte sich jedoch schlagartig mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Im Jahr 1933 wurde er zuerst in den Wartestand und am 31. Oktober in den Ruhestand versetzt. Dies hing mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 zusammen, nach dem Beamte, die keine „arische“ Abstammung nachweisen konnten, in den Ruhestand zu versetzen waren. Da die Reichskulturkammer keine Juden aufnahm, war ihm zudem fast jede Möglichkeit genommen, in Deutschland als freier Künstler zu arbeiten. Deswegen konnte er lediglich im Jüdischen Kulturbund lehren. Aufgrund dieser Entwicklungen wanderten Frieda und ihre Tochter Eva im Januar 1934 nach Zypern aus. Friedrich Adler blieb in Hamburg und zog in eine kleinere Wohnung in der Burgstraße 32. Seine älteren Kinder Hermann, Max und Ingeborg waren bereits Ende der zwanziger Jahre in die USA ausgewandert. Noch im Frühjahr 1936 reiste Friedrich Adler nach Zypern, um sich dort über Möglichkeiten einer Existenzgründung zu informieren. Leider musste er feststellen, dass es für ihn auf Zypern kaum Möglichkeiten gab, einen Neuanfang zu starten. Deswegen verabschiedete er sich von Frau und Tochter und kehrte nach Hamburg zurück. Dort wollte er sich um eine Emigration in die USA bemühen, doch seine Bemühungen scheiterten Friedrich Adler Yad Vashem letztlich. 55 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 56 Noch im selben Jahr erhielt Friedrich Adler aufgrund eines Missverständnisses eine Goldmedaille für einige seiner Entwürfe für Industrieprodukte. Versehentlich hatte man ihn für einen „Arier“ gehalten. Am 22. März 1937 wurde sein Sohn Kurt Jack Michael in Nicosia, Zypern geboren. Friedrich Adler sollte sein jüngstes Kind nicht mehr zu Gesicht bekommen. 1938 wanderte schließlich auch seine Tochter Berta nach Israel aus. Allein sein Sohn Paul Wilhelm blieb bei ihm in Hamburg. 1940 heiratete dieser Eva-Senta Stern und zog mit ihr zusammen. Friedrich Adler musste oft umziehen und lebte zuletzt in der Innocentiastraße 37, in einem sogenannten Judenhaus. Von dort aus wurde er am 11. Juli 1942 nach Auschwitz deportiert, wo er ums Leben kam. Dort liegt ein Stolperstein für ihn. Auch sein Sohn Paul Wilhelm starb in Auschwitz. Der Rest der Familie überlebte den Holocaust im Ausland. Keiner von ihnen kehrte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland zurück. Für Paul Wilhelm Adler wurde ein Stolperstein am Isekai 5 in Eppendorf verlegt. Quellen: 4; 5; 8; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 29.04.78 Adler, Friedrich; StaHH ZAS 751, Friedrich Adler; Museum zur Geschichte von Christen und Juden, Schloß Großlaupheim; http://www.zeichen-dererinnerung.org/n5_1_adler.htm, Zugriff am 16.4.2009; Bruhns: Kunst in der Krise, S. 314f., S. 413f. Robert Anasch, geb. 22.12.1907, am 22.10.1942 verhaftet, am 15.4.1945 im Zuchthaus Bützow-Dreibergen ermordet 4 Schenkendorfstraße 25 Mit seiner Ehefrau Käthe, geb. Clasen, bekam Robert Anasch insgesamt sechs Kinder. Norbert, Ingeborg, Waltraut, Rita, Lothar und Peter kamen zwischen Mai 1931 und Juni 1941 in Hamburg zur Welt. Die Großfamilie lebte in einer Wohnung in der Schenkendorfstraße 25. Robert Anasch arbeitete seit dem 28. Januar 1938 als Schiffsbauhelfer in der Schlosserei bei Blohm & Voss und verdiente rund 60 RM pro Woche. Engagiert in der KPD, beteiligte er sich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten an illegalen Aktionen seiner Partei. Dadurch knüpfte er Kontakte zur „Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe“, einer Hamburger Widerstandsorganisation um Bernhard Bästlein, Franz Jacob und Robert Abshagen. Auf den Werften von Blohm & Voss entstand ein gut ausgebautes Netzwerk der Gruppe, an deren Aktivitäten sich Robert Anasch beteiligte. Durch seine illegale Arbeit wurde die Gestapo auf Robert Anasch aufmerksam und verhaftete ihn am 22. Oktober 1942 auf dem Werftgelände. Er wurde in Untersuchungshaft nach Fuhlsbüttel gebracht und verlor seine Anstellung. Seine Ehefrau Käthe musste nun mit Hilfe der Wohlfahrt die sechs Kinder versorgen. Am 7. März 1944 wurde Robert Anasch wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ vom Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg zu einer Zuchthausstrafe von drei Jahren und sechs Monaten und drei Jahren Ehrverlust verurteilt unter Anrechnung der Untersuchungshaft von 14 Monaten. Die Strafe sollte er im Zuchthaus Celle-Mühlhausen verbüßen, wo er seit dem 56 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 57 Gefangenenkarteikarte von Robert Anasch aus dem Untersuchungsgefängnis Fuhlsbüttel StaHH 1. April 1944 inhaftiert war. Am 15. April 1945 wurde Robert Anasch im Zuchthaus BützowDreibergen ermordet. Quellen: StaHH 242-1 II, Gefängnisverwaltung II , Abl. 1998/1, Untersuchungshaft Männer (jüngere Kartei); StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 22.12.07 Anasch, Robert; Hochmuth/ Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand, S. 351, S. 386. Etkar Josef André, geb. am 17.1.1894 in Aachen, hingerichtet am 4.11.1936 in Hamburg 5 Adlerstraße 12 Etkar Josef André kam am 17. Januar 1894 in der Aachener Friedrichstraße 73 zur Welt. Sein Vater Bernhard André war Kaufmann und gehörte laut Geburtsurkunde zur jüdischen Glaubensgemeinschaft, Mutter Sofie, geb. Koch, war der Religion ebenfalls beigetreten. Etkar wuchs mit einem Bruder auf. Bereits 1899 starb der Vater an Lungentuberkulose, worauf die Mutter mit den Söhnen zu Verwandten nach Lüttich, Belgien, zog. Da sie selbst auch tuberkulös war, wurden die Kinder wegen der Ansteckungsgefahr mehrere Jahre in einem Waisenhaus untergebracht. Etkar André nahm nach dem Schulabschluss eine kaufmännische Ausbildung auf, die ihm nicht lag, er absolvierte dann eine Lehre im Schlosserhandwerk. Seit 1911 war er als Mitglied der Sozialistischen Partei Belgiens aktiv, später als Sekretär der Sozialistischen Arbeiterjugend in Brüssel. Da er die deutsche Staatsbürgerschaft behalten hatte, 57 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 58 Geburtsurkunde Etkar André FZH meldete er sich 1914 im Rheinland als Kriegsfreiwilliger, wenn auch zu Beginn nur mit geringen deutschen Sprachkenntnissen. Als Soldat im Inf.-Res.-Regiment 236 Köln-Deutz nahm er an den Kämpfen an der Flandernfront teil, geriet 1918 in französische Kriegsgefangenschaft und wurde 1920 entlassen. Seine freiwillige Kriegsteilnahme hat er später bedauert. Zunächst hielt er sich dann ab 1920 in Koblenz auf, wo er sich der Sozialistischen Arbeiterjugend und der SPD anschloss. Auf der Suche nach Arbeit gelangte er 1922 nach Hamburg und war als Schauermann im Hafen beschäftigt, zeitweilig auch als Bauarbeiter. Er wurde Mitglied im Deutschen Bauarbeiter-, später im Deutschen Transportarbeiterverband. Ein Schwerpunkt seiner Parteiund Verbandsarbeit bestand darin, sich um die Belange der Arbeitslosen zu kümmern, immer 58 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 59 mehr haderte er aber mit der Politik der SPD und trat Anfang 1923 der in seinen Augen politisch konsequenteren KPD bei. Schon bald gehörte er zum engeren Kreis um Ernst Thälmann, seine offene, kameradschaftliche Art, seine Hilfsbereitschaft und sein soziales Engagement machten ihn sehr beliebt, für jeden hatte er ein Ohr. Auch jetzt setzte er sich weiter stark für die Interessen der Arbeitslosen und ihrer Familien ein, deren materielle Not ihn erschütterte. Bis 1925 war Etkar André Führer der Erwerbslosenbewegung in Hamburg. 1924 gehörte er zu den Gründern des Roten Frontkämpferbundes Wasserkante – Ernst Thälmann bezeichnete den RFB als „antifaschistische Schutz- und Wehrorganisation des Proletariats“ –, und war deren Leiter, außerdem Mitglied der 1925 in Hamburg gegründeten Roten Marine. Ähnlich wie Betriebsgruppen des RFB in den Fabriken sollten in ihrem Namen Bordgruppen unter den Besatzungen aller See- und Handelsschiffe entstehen, bei gegenseitiger Hilfe und Unterstützung der Angehörigen. RFB und Rote Marine unterstützen u. a. den Kampf der KPD gegen den Neubau von Panzerkreuzern der Reichsmarine oder übernahmen die Sicherung von Wahllokalen und Veranstaltungen, beide wurden 1929 verboten. Ihre Mitglieder blieben auch in der Illegalität überwiegend aktiv, André für Etkar André, ca. 1925 FZH die Nachfolgeorganisation „Kampfkomitee gegen das RFB-Verbot“. Als politischer Leiter des KPD-Gaues Wasserkante erhielt er ein kleines Salär von monatlich 100,– RM. Für die Internationale der Seeleute und Hafenarbeiter übernahm er, geschult in der Reichsparteischule der KPD, Aufgaben als Instrukteur und Propagandist, was aufgrund seiner Französischkenntnisse auch mit Reisen nach Belgien und Frankreich verbunden war. André war mehr Aktivist als Parteifunktionär, er sah sich als „Mann von der Straße“, begegnete seinen Mitmenschen in Augenhöhe und mit Respekt, gleichzeitig galt er als umsichtig, kühn und entschlossen, packte mit an, wo es erforderlich war und blieb immer fair. Dafür wurde er geschätzt. Innerhalb des Parteiapparats war seine Rolle nicht herausragend, er gehörte weder dem Zentralkomitee noch dem Politbüro an, nahm weder an programmatischen Auseinandersetzungen teil noch an innerparteilichen Flügelkämpfen. Andrés Lebensgefährtin Martha Berg, geb. Schmidt, betätigte sich aktiv in der KPD-Frauengruppe, sie lernten sich kennen als Parteigenossen, ab 1926 entwickelte sich eine Beziehung, obwohl Marthas Ehe noch nicht geschieden war. Daraus wurde der Vorwurf Ehebruch abgeleitet, der einer späteren Legalisierung der Beziehung im Wege stand und eine Heiratsgenehmigung verhinderte. Die beiden zogen 1928 von der Grindelallee nach Barmbek in die Adlerstraße 12, wo sie bis 1933 wohnten. Hauptmieterin der Wohnung und im Hamburger Adressbuch eingetragen war Frau Berg, Martha. 59 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 60 Als Abgeordneter der KPD wurde André 1928 in die Hamburger Bürgerschaft gewählt, 1931 ein weiteres Mal, diesmal als Mitglied der Stadtvertretung Cuxhaven, bis 1937 zu Hamburg gehörend, wo er vorübergehend einen Zweitwohnsitz in der Poststraße 8 (bei Wesel) führte. Andrés Name war inzwischen nicht nur innerhalb der KPD und der Arbeiterbewegung ein Begriff, sondern auch allen Gegnern der kommunistischen Partei. Der RFB war in diverse Straßenkämpfe verwickelt, Konfrontationen gab es sowohl mit SA-Angehörigen als auch mit der Polizei und den SPD-nahen Reichsbannergruppen. Gegenseitige Provokationen und Racheaktionen zwischen NSDAP/SA und KPD/RFB hatten Verletzte und Tote zur Folge, vereinzelt gab es Schusswechsel. Etkar André als einem der bekanntesten und charismatischsten Arbeiterführer in Hamburg wurde Verantwortung und Rädelsführerschaft für nahezu alle KPDAktionen unterstellt. Im März 1931 kam es zu einem Anschlag, der wahrscheinlich ihm gelten sollte, dem aber sein Parteifreund Ernst Henning zum Opfer fiel. Henning war ebenfalls Bürgerschaftsabgeordneter, er wohnte in Bergedorf und hatte in den Vierlanden an einer Parteiveranstaltung teilgenommen. Auf der Rückfahrt in einem gut besetzten Nachtbus wurde er nach der Frage „sind Sie André?“ trotz Richtigstellung von SA-Männern erschossen, weitere Fahrgäste erlitten teils schwere Schusswunden. Die Täter flüchteten anschließend, stellten sich aber später der Polizei bzw. wurden verhaftet und angeklagt. Der Tat vorausgegangen war einige Monate zuvor die Sprengung einer NSDAP-Versammlung in Geesthacht durch Kommunisten, es war zu schweren Kämpfen gekommen, bei der zwei SA-Leute getötet wurden. Ob André etwas damit zu tun hatte, ist nicht erwiesen, der Hass auf ihn hatte sich allerdings weiter vergrößert. An der Trauerfeier für Ernst Henning nahm Etkar André jedenfalls teil, das belegen Aussagen und Fotos. Es war eine Großveranstaltung mit geschätzten 35 000 Teilnehmern. Der Trauerzug begann in der Jarrestraße vor einer damals dort befindlichen Leichenhalle. Hinter dem von berittenen Schutzleuten begleiteten Leichenwagen gingen dreißig Angehörige des RotfrontEtkar André hält Totenwache für seinen Freund Henning FZH kämpferbundes mit erhobener Faust, Etkar André an der Spitze. Ihnen folgten 120 Kranzträger und 150 Fahnen und Standarten kommunistischer Gruppen aus Hamburg und dem Reichsgebiet, anschließend die vielen Trauergäste, überwiegend schwarz gekleidet, mit Musik- und Schalmeienkapellen, es ertönten Kampflieder und Sprechchöre. Der Vorbeimarsch des Zuges zur Krematoriumshalle in Ohlsdorf dauerte über eine Stunde. An der Gedenkfeier nahmen neben Familienmitgliedern auch der Bürgerschaftspräsident und der Vizepräsident teil, während Ernst Thälmann die Gedenkrede hielt. Der größere Teil des Trauerzuges musste im Freien bleiben und demonstrierte 60 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 61 Geschlossenheit. Auf dem Rückweg löste sich die Versammlung zunächst auf, doch kleinere Gruppen in der Fuhlsbüttler Straße sammelten sich wieder, man entrollte die Fahnen, marschierte in breiter Front zum Barmbeker Bahnhof. Von André wird später behauptet, er habe die Führung übernommen. Die Menge steigerte sich in Sprechchöre hinein, bis es kurz vor den Bahnhofsbrücken zur Eskalation kam. Von der Baustelle eines Neubaus wurden Bretter und Steine geholt, eine Barrikade gebaut, die Straßenbahn gestoppt, es erscholl die „Internationale“. Zwanzig den Zug begleitende Polizisten fühlten sich immer stärker bedrängt, bis einige von ihnen die Waffen zogen und Warnschüsse, schließlich Schüsse in die Menge abgaben. Ein unbeteiligter 20-Jähriger erlag einem Kopfschuss, er war sofort tot, was den Aufruhr weiter anheizte. Eingetroffene Polizeiverstärkung und Demonstranten bekämpften sich stundenlang, bis zum Barmbeker Markt zogen sich die Kämpfe hin, auf beiden Seiten gab es viele Verletzte. Der Prozess gegen die drei 20- bis 25-jährigen Henning-Attentäter, von einem NSDAP-Funktionär zur Tat angestiftet aber laut Parteierklärung angeblich keine Mitglieder, fand im November 1931 statt. Sie erhielten Zuchthausstrafen von je 6 bzw. 7 Jahren, verbüßten die Strafen bis zum 9. März 1933 und gelangten aufgrund der Hindenburg-Amnestie in die Freiheit. Wenige Tage zuvor, am 5. März 1933, war Etkar André verhaftet worden. Bereits seit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 galt André als höchst gefährdet, ihm wurde von Freunden nahegelegt, Deutschland zu verlassen, doch er lehnte ab. Am 1. März zogen er und Martha von der Adlerstraße in die Zeughausstraße 4. Er beteiligte sich noch am Wahlkampf für die Reichstagswahlen am 5. März in Cuxhaven, hielt dort am 4. März eine Rede. Tags darauf fuhr er mit dem Zug zurück nach Hamburg, wo durch die Gestapo unter Missachtung der Abgeordnetenimmunität seine Festnahme erfolgte. Die Anklage gegen ihn lautete auf Vorbereitung zum Hochverrat in Tateinheit mit gemeinschaftlichem, vollendetem Mord im Fall des SA-Truppenführers Dreckmann im September 1932 und versuchtem Mord in sieben Fällen bei dem schon beschriebenen Vorfall in Geesthacht im Januar 1931. Auf ihn wartete eine dreieinhalbjährige Einzelhaft im Untersuchungsgefängnis, Zelle 122, er war laut Strafakte „streng getrennt zu halten von allen wegen Hochverrats inhaftierten Personen“. Man fürchtete offenbar seinen möglichen Einfluss auf Mithäftlinge. Um die Isolation ertragen zu können, stellte er Anträge, Zeitungen halten und Bücher ausleihen zu dürfen, gern löste er Kreuzworträtsel und Schachaufgaben und bat um entsprechende Zeitungen, einen Bleistift, auch mal ein Dominospiel. Ein Antrag auf das Tragen eigener Wäsche wurde genehmigt. Martha Berg als Verlobte besuchte ihn regelmäßig, so oft sie durfte: zweimal monatlich eine halbe Stunde. Sonst kamen nur der Staatsanwalt und sein Verteidiger Dr. Grisebach; andere Angehörige lebten nicht in Deutschland und Freunde hatten kein Besuchsrecht. Mit seinem als Zahnarzt in Belgien lebenden Bruder hielt er Briefkontakt. Von Anfang 1935 gibt es den Hinweis, die Braut wolle ein Aufgebot bestellen, Etkar beantragte die nötigen Papiere, eine Trauung ist in den Gefängnisakten nicht festgehalten. Die Haft war begleitet von Misshandlungen und brutalsten Folterungen. Zeitweilig konnte Etkar André sich nur mit Hilfe von Krücken fortbewegen. Als er wegen schwerer Verletzun61 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 62 gen nicht mehr liegen konnte, wurde ein Wasserbett organisiert, damit er bis zum nächsten Verhör und neuen Misshandlungen wiederhergestellt sein würde. Kopfverletzungen führten zeitweilig zum Verlust des Gehörs. Die Folterungen sprechen dafür, dass er für die Anklage brauchbare Aussagen verweigerte, keine Freunde, Genossen, Parteinterna verriet, sich nicht von seiner Weltanschauung zu distanzieren bereit war. Er stand zu seinen Überzeugungen und stellte das nationalsozialistische System und damit seine Ankläger in Frage. Der Prozess nach drei Jahren gehörte zu den größten politischen Schauprozessen seiner Zeit, er begann am 4. Mai 1936, zog sich über 32 Verhandlungstage hin bis zur Urteilsverkündung am 10. Juli 1936. Aufgrund der am 1. August in Berlin eröffneten Olympiade hielten sich viele ausländische Journalisten in Deutschland auf, von denen einige gespannt den Prozessverlauf verfolgten. Am 7. Mai wurde auch Martha Berg verhaftet, einen Tag vor ihrer Vorladung als Zeugin. Befürchtete man ihretwegen Unruhen? Sie kam später wieder frei. Die Staatsanwaltschaft konnte nur unzureichende Beweismittel für Andrés Schuld vorweisen, annähernd 100 Zeugen traten auf, überwiegend NSDAP/SA-Mitglieder. Zeugen aus dem Zuchthaus Fuhlsbüttel, die selbst Gefangene und bereit waren, gegen André auszusagen, wurden später von Mitgefangenen geschnitten oder so deutlich drangsaliert, dass die Leitung sich zu Umverlegungen in andere Zuchthäuser entschloss. Die Anklage blieb schwach, trotzdem plädierte der Staatsanwalt auf Todesstrafe. Etkars Verteidigungsrede war gleichzeitig Anklage des NS-Regimes, er äußerte u. a.: „Ihre Ehre ist nicht meine Ehre. Denn uns trennen Weltanschauungen, uns trennen Klassen, uns trennt eine tiefe Kluft. Sollten Sie hier das Unmögliche möglich machen und einen unschuldigen Kämpfer zum Richtblock bringen, so bin ich bereit, diesen schweren Gang zu gehen. Ich will keine Gnade! Als Kämpfer habe ich gelebt und als Kämpfer werde ich sterben mit den letzten Worten: Es lebe der Kommunismus!“ Das Gericht unter dem Vorsitz des Richters Otto Roth, der schon im Jahr zuvor das Todesurteil über den Kommunisten Friedrich (Fiete) Schulze gesprochen hatte, folgte dem Antrag des Staatsanwalts und sprach das Urteil: Tod durch Enthauptung, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Etkar André beschloss, für sein Recht zu kämpfen. Einen Antrag auf Begnadigung lehnte er ab und schrieb in einem seiner letzten Briefe am 12. Juli an Martha: „Das Urteil ist unter allen Umständen ein Fehlurteil und deshalb ist es meine Aufgabe, die wenigen zur Verfügung stehenden Rechtsmittel zu nutzen. Ich spreche von Rechtsmitteln, nicht von Gnade. Ein Gnadengesuch werde ich nicht einreichen, weil ich nicht um Gnade bitten sondern mein Recht haben will.“ Er sah nur den Weg eines Wiederaufnahmeverfahrens, die Zeit eilte, er musste aber auf das schriftliche Urteil und die Akte warten, worüber Wochen vergingen, in denen auch kein Besuch zugelassen war. Schriftlich versuchte er Martha davon zu überzeugen, dass es ihm gut ginge, sogar „... ausgezeichnet, die Nerven sind intakt, mein Appetit hat nicht im geringsten gelitten ... und was den Schlaf anbelangt, so habe ich wahr und wahrhaftig nicht zu klagen ...“ Ein zum Tode Verurteilter, der seiner besorgten Partnerin nahe legte, sich nicht zu beunru62 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 63 higen. Erst am 1. August durfte Martha ihn sehen, zuvor musste sie sich auf Waffen untersuchen lassen. Möglicherweise die letzte Begegnung des Paares, denn auch Martha war gefährdet und emigrierte kurz darauf nach Paris – vielleicht auf Anraten Etkar Andrés. Am 19. August beantragte er Papier, um von der Staatsanwaltschaft die Genehmigung für einen Brief an den Reichskanzler zu erbitten. Der Generalstaatsanwalt äußerte keine Bedenken. Ob und wie der Brief geschrieben worden ist, ging aus vorliegenden Akten nicht hervor, allerdings teilte der Generalstaatsanwalt mit Schreiben vom 3. Oktober mit, „...dass André nach Anweisung des Herrn Reichsministers der Justiz bis zu dem Zeitpunkt, in dem eine Entschließung des Führers und Reichskanzlers zur Frage des Vollzugs des ergangenen Urteils vorliegt, nicht besser als ein Gefangener zu behandeln ist, der zu einer zeitigen Zuchthausstrafe verurteilt worden ist. Ich ersuche, dem André auch künftig das Schreiben von Briefen in diesem Umfang zu gestatten. Weiter ersuche ich, mir sämtliche Briefe zur Kontrolle vorzulegen“. Für jedes Schriftstück war ein Antrag auf Papierblätter zu stellen, jedes verwendete Blatt nachzuweisen. Etkar André entwarf die Einleitung eines Wiederaufnahmeverfahrens, das sich auf die Punkte „1. Zu Unrecht erfolgte Verurteilung“ und „2. die sowohl während des Verfahrens sowie Verhandlungen vorgekommenen Rechtsverstöße“ konzentrieren sollte. Eine internationale Protestbewegung ging für die Wiederaufnahme des Verfahrens auf die Straßen, in Paris, Prag, Kopenhagen, Amsterdam und Stockholm gab es Demonstrationen. Vergeblich. Wenn eine Antwort des „Führers“ eingegangen ist, war sie eindeutig. Am Nachmittag des 3. November erhielt Etkar André die Nachricht über den Termin seiner Hinrichtung am folgenden Morgen. Ein Mithäftling, der zufällig an diesem Tag für eine Reparaturarbeit in seine Zelle kam, gab später an, André habe keine Angst gezeigt und gesagt „Habt Vertrauen, es wird sich alles zu unseren Gunsten entwickeln.“ Die letzte Nacht verbrachte sein Anwalt Dr. Grisebach bei ihm, er schrieb letzte Briefe an seinen Bruder und an Martha. Dem Bruder teilte er mit, wie sehr er ihn liebte und ihm dankte für die gemeinsamen Zeiten, auch ihn wollte er beruhigen: „Jammern ist nicht mein Fall und darum werde ich bis zur letzten Sekunde gerade und ungebrochen stehen.“ Er wünschte sich eine Bestattung in Belgien bei den Angehörigen. Der schwere Brief an Martha Berg, geschrieben am frühen Morgen um 3:45 Uhr, ist ein Dank für zehn gemeinsame Jahre, er wünschte sich, dass sie keinen Trübsal blase, nicht allein bleibe und einen guten Freund als Stütze fände. Er schreibt auch: „Bis zuletzt bleibe ich ein ehrlicher Kerl, habe mich bis zuletzt verteidigt und kehre ins Nichts zurück ohne irgendwelche Gewissensbisse.“ Joachim Szodrzynski schreibt: „Bis zuletzt äußerlich ungebrochen ermöglicht er durch seine Haltung während der Haft und sein furchtloses Auftreten im Prozess der internationalen Presse die Entlarvung des NS-Regimes. Umgekehrt schützt ihn wahrscheinlich gerade das Bewusstsein, mit seiner Person für die ‚gerechte Sache’ zu stehen, vor dem Zusammenbruch (...) Die Erfahrung, daß ein nicht geringer Teil seiner Genossen, die das vermeintliche Glück hatten, rechtzeitig vor den Nazis in die Sowjetunion zu entkommen, dort wenige Monate nach seiner Hinrichtung im Namen des von ihm hochgehaltenen Ideals liquidiert wird (darunter der 63 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 64 2. Bundesvorsitzende des RFB, Willy Leow und der Vertraute Thälmanns, Hermann Schubert), bleibt André erspart. Möglicherweise wäre er d a r a n zerbrochen.“ Am 4. November 1936 um sechs Uhr morgens wurde Etkar André, zweiundvierzig Jahre alt, im Hamburger Untersuchungsgefängnis Holstenglacis unter Leitung des Generalstaatsanwalts Dr. Drescher von dem Scharfrichter Gröpler aus Magdeburg mit dem Handbeil hingerichtet. Es soll sich um die letzte Hinrichtung dieser Art in Hamburg gehandelt haben, später ging man zum Einsatz einer Guillotine über, die inzwischen zu den Exponaten eines Kriminalmuseums gehört. Bereits zu Lebzeiten Legende, nahmen Millionen Menschen in Europa Anteil an seinem Tod. Protest- und Trauermärsche fanden statt, im Hamburger Zuchthaus Fuhlsbüttel traten 5000 Insassen in einen Proteststreik. Er hatte keine Berühmtheit als Politiker oder „Parteibonze“ erlangt, sondern wurde als aufrechter Mensch, der für seine Mitmenschlichkeit, seine Überzeugungen und als Gegner des Naziregimes in den Tod gegangen war, zum Symbol des antifaschistischen Widerstands. Ein Stoff, aus dem Mythen gewoben werden, der Text dieser Biographie ist ein Versuch, anhand vorhandener Unterlagen und Veröffentlichungen sowie Berichten von Zeitzeugen dem realen Etkar André auf die Spur zu kommen. Aus Furcht vor weiteren Unruhen ordnete die Gestapo eine Beisetzung „in aller Stille und unter strengster Verschwiegenheit“ an, die Urne wurde heimlich vergraben und erst zehn Jahre später gefunden, weil die Verwaltung des Ohlsdorfer Friedhofs nicht der Anordnung gefolgt war, alle Unterlagen zu vernichten. Zusammen mit 26 weiteren, vom Komitee ehemaliger politischer Gefangener aus Brandenburg überführten Urnen fand die Beisetzung im September 1946 auf dem Platz der Revolutionsopfer von 1918 nahe dem Haupteingang des Friedhofs Ohlsdorf statt. Mit Erlaubnis des britischen Stadtkommandanten waren die Urnen zuvor in Begleitung eines großen Schweigemarsches vom Standort des Komitees in der Maria-Luisen-Straße zu einer Gedenkveranstaltung ins Hamburger Rathaus gebracht worden, anschließend nach Ohlsdorf, in strömendem Regen. Zeitzeugen berichteten von einer eindrucksvollen Demonstration. Heute befindet sich die Grabstätte von Etkar André im Ehrenhain für die Opfer des Faschismus auf dem Ohlsdorfer Friedhof, wohin sie zusammen mit den Urnen weiterer Widerstandskämpfer im April 1962 überführt worden ist. An der Gedenkfeier nahm auch Martha teil, die Etkars Namen angenommen hatte und nun Berg-André hieß. Von seinem Tod hatte sie 1936 in Paris erfahren, wo sie bei Freunden wohnte und sich im Widerstand engagierte. 1940 von der deutschen Besatzung Martha Berg-André bei der Gedenkfeier 1962 64 FZH festgenommen, musste sie längere 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 65 Zeit im Lager Gurs verbringen. Sie ging später nach Ostberlin und war u. a. als Leiterin tätig für die Gemeinschaft Opfer des Faschismus. Ehrungen Etkar Andrés in der DDR spiegelten sich wider in der Benennung von Straßen, Schulen und Plätzen. 1974 erschien anlässlich seines 80. Geburtstags eine Briefmarke mit seinem Konterfei. – Erika Draeger Quellen: StaHH ZC1, Kasten 11, Strafakte André, Etkar; StaHH 433/1a, Mitgliederverzeichnis der Hamburger Bürgerschaft 1921–1931; StaHH, Handschriftensammlung DCIII (603); Gedenkstätte Ernst Thälmann, Hamburg: Personenarchiv, Etkar André; Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg: Männer im Widerstand 1933–1945, Akte A-F, 13-3-3-1; Szodrzynski, Joachim in: Arbeitskreis zur Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein; Hochmuth, Ursel/Meyer, Gertrud: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand, S. 248, 504, 529; Ebeling, Helmut: Hamburger Kriminalgeschichte 1931–36, Band 2; Ebeling, Helmut: Schwarze Chronik einer Weltstadt, S. 275 ff., 281f., 294 ff. Paul Karl Bach, geb. 11.3.1903, am 20.7.1934 im Konzentrationslager Fuhlsbüttel ermordet 6 Detmerstraße 28 Bis zu seinem fünften Lebensjahr verbrachte Paul Bach eine glückliche Kindheit bei seinen Eltern in Wandsbek. Dann starb seine Mutter jedoch an Schwindsucht und Paul Bach wuchs von nun an in einem Waisenhaus auf. Später erhielt er die Möglichkeit, den Beruf des Zimmermanns zu erlernen. Durch seinen Beruf reiste Paul Bach in Norddeutschland umher und kam nach Klein Lobke in der Nähe von Hannover. Hier lernte er die Tochter des Arbeiters Wilhelm Klages, Frieda Gretchen Klages, kennen. Paul Bach und Frieda heirateten und 1926 kam ihre gemeinsame Tochter Louise Grete in Klein Lobke zur Welt. 1927 zog die Familie nach Hamburg und wohnte hier in Barmbek in der Detmerstraße 28. Im selben Jahr begann Paul Bach auch seine Arbeit für die KPD. 1930 wurde er auf die Parteischule nach Berlin geschickt. Nach seiner Rückkehr übernahm er den Posten des Hauptkassierers. Gemeinsam mit seinem Kollegen Walter Gröber hatte er ab 1933 diesen Posten bis zu seiner Die Detmerstraße in den 1930er Jahren Geschichtswerkstatt Barmbek Inhaftierung inne. Seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurde Paul Bach verfolgt. Letztendlich holte die Gestapo ihn am 18. Juli 1934 von zu Hause ab, um ihn ins Konzentrationslager Fuhlsbüttel zu bringen. Als Begründung wurde die Gefahr des Hochverrats, die von Paul Bach ausginge, angegeben. Schon zwei Tage später, am 20. Juli, erhielt seine Frau Gretchen die Nachricht vom angeblichen 65 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 66 Selbstmord ihres Mannes. Mithäftlinge berichteten ihr jedoch später, ihr Mann sei durch die Gewaltanwendung der SS umgekommen. Quellen: StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 11.03.03 Bach, Paul Karl; Diercks: Gedenkbuch „Kola-Fu“, S. 15; VVN, Hinterbliebenenkartei; VVN, B1 Bach, Louise; Totenliste Hamburger Widerstandskämpfer und Verfolgter 1933–1945. Paul Heinrich Wilhelm Bachert, geb. 25.3.1909, am 7.3.1945 verhaftet und im Konzentrationslager Fuhlsbüttel inhaftiert, am 23.4.1945 in das Konzentrationslager Neuengamme verlegt und dort ermordet 7 Schenkendorfstraße 19 Das Ehepaar Wilhelm und Henriette Bachert lebte in Hamburg und hatte zwei gemeinsame Söhne. Otto wurde am 13. Oktober 1903 geboren, sein Bruder Heinrich folgte am 25. März 1909. Die Familie lebte in der Desenißstraße 7 in einer kleinen Wohnung. Beide Brüder absolvierten eine Schlosserlehre und wurden später Monteure. Heinrich fand eine Anstellung als Elektromonteur bei der Firma Conz Bahrenfeld in der Gasstraße in Altona. Seine erste eigene Wohnung fand Heinrich Bachert in der Schenkendorfstraße 19, wo er bis zu seiner Verhaftung wohnte. Heinrichs Vater Wilhelm war evangelisch und seine Frau Henriette, eine Die Schenkendorfstraße um 1905 Bildarchiv Hamburg geborene Levy, war Jüdin, die beiden Söhne wuchsen mit dem christlichen Glauben auf. Doch mit den „Nürnberger Gesetzen“ aus dem Jahr 1935 wurden Heinrich und Otto zu „Halbjuden“ und litten unter Anfeindungen und Verfolgung. Zudem war Heinrich politisch aktiv und beteiligte sich an der illegalen Arbeit der KPD. Privat hatte Heinrich sein Glück bei Grete Ella Schulz gefunden. Sie war drei Jahre jünger als er, evangelisch und stammte ebenfalls aus Hamburg. Seit 1938 waren beide miteinander verlobt, doch sie waren vielen Anfeindungen ausgesetzt, weswegen es zunächst zu keiner Hochzeit kam. Am 4. März 1944 kam ihr einziges gemeinsames Kind, Heidi Henny, zur Welt. Doch schon im Herbst desselben Jahres kam der nächste Schicksalsschlag für die Familie. Heinrich verlor am 1. Oktober seine Anstellung, weil er „Halbjude“ war und seine politische Gesinnung bekannt wurde. Inzwischen beteiligte er sich auch an der Arbeit der „Bästlein-Jacob-AbshagenGruppe“, einer Widerstandsorganisation in Hamburg. 66 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 67 Die Gestapo wurde Anfang 1945 auf Heinrich Bachert aufmerksam und verhaftete ihn aus rassischen und politischen Gründen am 7. März. Er wurde in Fuhlsbüttel inhaftiert. Grete hoffte, ihrem Verlobten mit einer Heirat helfen zu können. Die beiden schlossen deswegen am 1. April 1945 die Ehe, obwohl dies für sie eigentlich verboten war. „Halbjuden“ war die Ehe mit „Nichtjuden“ ohne besondere Genehmigung untersagt, und diese wurde nur in sehr wenigen Fällen erteilt. Wie Heinrich und Grete Bachert es trotzdem schafften, getraut zu werden, ist unbekannt. Heinrich Bachert wurde am 23. April 1945 von Fuhlsbüttel ins Konzentrationslager Neuengamme verlegt. Seither fehlt von ihm jede Spur, er soll dort ohne Urteil gehenkt worden sein. Seine Mutter Henriette Bachert starb bereits am 3. Juli 1940 in Hamburg, ihr Mann folgte ihr am 3. August 1951. Otto und seine Ehefrau Hanna überlebten den Holocaust. Auch Heinrichs Ehefrau Grete und ihre gemeinsame Tochter Heidi überstanden den Zweiten Weltkrieg. 1953 heiratete Grete erneut und lebte in Winterhude. Quellen: StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 04.03.44 Bachert, Heidi; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 53395; Diercks: Gedenkbuch „KOLA-FU“, S. 51; Hochmuth/Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand, S. 386; KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Totenbuch; Totenliste Hamburger Widerstandskämpfer und Verfolgter 1933–1945. Wilhelm Baum, geb. 16.12.1892, am 11.7.1942 nach Auschwitz deportiert und dort umgekommen Hedwig Bernhardine Baum, geb. Hirschfeld, geb. 27.3.1904, am 11.7.1942 nach Auschwitz deportiert und dort umgekommen Hannelore Baum, geb. 22.6.1935, am 11.7.1942 nach Auschwitz deportiert und dort umgekommen 8 Papenhuder Straße 42/Durchschnitt 8 Wilhelm Baum, der Sohn des Ehepaares Leopold und Johanna Baum, geb. Salomon, wuchs in Bernkastel-Kues bei Trier auf. Das Ehepaar Baum hatte noch einen weiteren Sohn, Carl war zwei Jahre älter als Wilhelm. Seine Kindheit verbrachte Wilhelm Baum in seiner Heimatstadt, doch dann zog es ihn nach Gelsenkirchen und später nach Frankfurt am Main. Mit der Hochzeit im Juni 1934 wurde Hamburg Wilhelm Baums neues Zuhause. Seine Ehefrau Hedwig Hirschfeld war die Tochter von Julius und Amalie Hirschfeld, geb. Weinthal, und stammte aus der Hansestadt. Sie hatte zwei jüngere Schwestern, Bertha und Liselotte. Ein Jahr nach der Hochzeit kam Wilhelms und Hedwigs einziges gemeinsames Kind, Hannelore, am 22. Juni 1935 zur Welt. Gemeinsam mit seinem Schwiegervater betrieb Wilhelm Baum das Schuhgeschäft „Julius Hirschfeld I. W. Meyer“ am Steindamm 92, welches seit 1925 existierte. Wilhelm Baum trat am 1. Oktober 1934 als Mitinhaber ein, woraufhin das Geschäft in eine Kommanditgesellschaft (KG) umgewandelt wurde. Das Geschäft hatte meist zwischen sieben und acht Angestellte. Trotzdem lebte die Familie Baum in bescheidenen Verhältnissen. Wilhelm war lediglich mit 67 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 68 6000 RM an dem Schuhgeschäft beteiligt und die Miete für die Privatwohnung, welche im selben Haus lag, wurde direkt vom Geschäft bezahlt und mit seinem Verdienst verrechnet. Die Wohnung von Hedwigs Eltern befand sich ebenfalls im gleichen Haus im Steindamm 92. Am 18. Dezember 1935 wurde die KG in eine offene Handelsgesellschaft (OHG) umgewandelt und Wilhelm und Julius traten der OHG als persönlich haftende Gesellschafter bei. Da sich die Verhältnisse im Deutschen Reich für die Familie Baum zusehends verschlechterten, entschlossen sie sich 1938 nach Melbourne, Australien, auszuwandern. Amalie Hirschfeld war bereits im August 1938 mit ihrer Tochter Bertha, deren Ehemann Robert Philipp und den zwei gemeinsamen Kindern Heinz und Kurt über die Niederlande und England nach Australien ausgewandert. Zwar besaß die Familie etwas Eigenvermögen, doch für eine Auswanderung reichte es nicht aus. Deswegen beschlossen Julius und Wilhelm das Schuhgeschäft zu verkaufen. Julius Hirschfeld wollte nicht emigrieren, sondern vom Verkaufserlös seinen Lebensabend finanzieren. Außerdem lieh er seinem Schwiegersohn Wilhelm noch 5000 RM, damit dessen Familie die Auswanderung organisieren konnte. Als die Devisenstelle von dem bevorstehenden Verkauf des Schuhgeschäftes erfuhr, wurden die Konten der Familien Baum und Hirschfeld im Oktober 1938 aufgrund der Sicherungsanordnung gegen Juden eingefroren. Von nun an konnten die Familien nicht mehr frei über ihr Geld verfügen. Zudem wurde das Schuhgeschäft „arisiert“: Die Geschäftsleute Erich und Ernst Rehder übernahmen den Laden zum 1. November und benannten ihn in Schuhgeschäft Rehder um. Die bestehende OHG wurde am 8. Dezember 1938 aufgelöst. Nach dem Verlust des Schuhgeschäftes mussten sowohl Familie Baum als auch Julius Hirschfeld umziehen und fanden ein neues zu Hause am Gedenkblatt für Wilhelm Baum Yad Vashem 68 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 69 Steindamm 65. Von der Devisenstelle wurde der Familie zusammen mit Julius Hirschfeld ein monatlicher Lebensunterhalt von 1100 RM gewährt. Durch die Beschlagnahmung der Konten konnten die letzten Rechnungen des Schuhgeschäftes nicht bezahlt werden, sodass Julius Hirschfeld verärgerte Lieferanten beruhigen musste, ohne für seine Zahlungsunfähigkeit verantwortlich zu sein. Zu Beginn des Jahres 1939 stellte Familie Baum den Auswanderungsantrag und erhielt alle nötigen Bescheinigungen. Lediglich die Einreiseerlaubnis nach Australien fehlte noch, sodass Wilhelm Baum Kontakt mit dem Hohen Kommissar für Australien in Berlin aufnahm. In der Zwischenzeit wurde ein Großteil der Möbel bei der Spedition Friedrich Wiese, die ihren Sitz in der Schäferkampsallee 16 hatte, eingelagert. Zudem mussten noch das Klavier, der Radioapparat und die Schreibmaschine verkauft werden. Im Sommer 1939 zog Familie Baum an den Eppendorfer Baum 19 I und Julius Hirschfeld in die Isestraße 104. Von nun an waren auch die Konten wieder getrennt und Familie Baum wurden monatlich 360 RM zum Leben zugestanden. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges endeten alle Hoffnungen der Familie Baum auf eine Emigration. Wilhelm Baum fand ab November 1940 eine neue Anstellung als Lagerarbeiter bei der Firma Rasch & Jung, wo er einen Wochenlohn von 35 RM erhielt. Julius Hirschfeld zog im April 1942 ins Jüdische Altersheim in der Beneckestraße 6. Auch Familie Baum musste noch mehrmals umziehen, eine ihrer Adressen war die Papenhuder Straße 42, wo heute die Stolpersteine für die Familie liegen. Im Dezember 1940 zog sie in die Haynstraße 5 und ab März 1942 lebten sie im Durchschnitt 8. Von dort aus wurde die Familie am 11. Juli 1942 nach Ausch- Die Papenhuder Straße im Jahr 1902 Bildarchiv Hamburg witz deportiert. Julius Hirschfeld wurde vier Tage nach Familie Baum am 15. Juli 1942 ins Getto Theresienstadt deportiert und starb dort am 1. November 1942. Auch Hedwigs Schwester Liselotte wurde ermordet, sie starb in Auschwitz. Carl Baum emigrierte in die USA und überlebte dort den Holocaust. Außer den Stolpersteinen für die Familie Baum in der Papenhuder Straße 42 liegt auch ein Stolperstein für Hannelore Baum im Durchschnitt 8. Quellen: 1; 2; 4; 5; 8; StaHH 314-15, OFP, FVg 5916; StaHH 314-15, OFP, R 1938/1398; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 16.12.92 Baum, Willi; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 27.03.04 Baum, Hedwig Bernhardine; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 22.06.35 Baum, Hannelore; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 20.06.90 Baum, Carl; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 24.09.99 Philipp, Robert. 69 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 70 Dorothea Bernstein, geb. 10.8.1893, am 25.10.1941 nach Lodz deportiert, dort gestorben am 5.6.1942 9 Lerchenfeld 10 (Gymnasium Lerchenfeld)/Hauersweg 16 Dorothea Bernstein wurde in Tilsit geboren. Seit ungefähr 1919 lebte sie in Hamburg. Als Lehrerin unterrichtete sie von März 1927 bis September 1933 an der Oberrealschule für Mädchen am Lerchenfeld, dem heutigen Gymnasium Lerchenfeld. Aus Anlass des 90-jährigen Bestehens des Gymnasiums setzten sich Schülerinnen und Schüler in einer Arbeitsgemeinschaft, die von Schulleiter Hans-Walter Hoge geleitet wurde, mit der Geschichte ihrer Schule von 1933 bis 1945 auseinander. In diesem Rahmen erforschten sie auch das Schicksal von Dorothea Bernstein. Auf Initiative der Schule wurde ein Stolperstein für sie vor ihrer ehemaligen Wirkungsstätte verlegt. Anlässlich der Einweihung des Stolpersteins am 14. November 2005 hielt die damalige Schülerin Maris Hubschmid folgende Rede: „Die Geschichte unserer Schule während der schrecklichen Jahre von 1933 bis 1945 ist lange im Dunkeln geblieben. Kaum einem lag daran, in den Nachkriegsjahren und bis in die Sechziger- und Siebzigerjahre hinein das Licht auf die dunklen Flecken deutscher Vergangenheit zu richten. Flecken, die da heißen: Wegschauen, Schweigen, die Gefahr nicht erkennen wollen, Verdrängen. Den Schülern unserer Generation hat man in der Schulchronik große Lücken hinterlassen. Die Zeit von 1933 bis 1945 wird darin nur äußerst spärlich behandelt. Einige Anekdoten, einige Daten, viel über Kinderlandverschickung und einiges über die Bombardierung 1943 – mehr nicht. Nichts, was darin hinweist auf die Veränderungen des Schulalltags am Lerchenfeld während dieser Zeit, kein Vermerk über Schicksale einzelner Schülerinnen, nur ungenaue Angaben über das Aus-dem-Dienst-Scheiden einiger Lehrer und Lehrerinnen. Vor zwei Jahren haben einige von uns es sich gemeinsam mit unserem Schulleiter Herrn Hoge zur Aufgabe gemacht, diese Lücken zu füllen. Wir wollten mehr wissen über die Geschichte des Gymnasiums Lerchenfeld, mehr wissen über eine Generation, die einmal im selben Alter und am selben Ort eine so andere Schulzeit erlebt hat, als wir es heute Die Oberrealschule für Mädchen am Lerchenfeld 1935 StaHH tun. Also haben wir uns auf die Suche begeben. Informationen ge- sucht, Zeitzeugen gesucht, Antworten gesucht. Der Stolperstein, den wir heute einweihen, ist Symbol für ein Ergebnis unserer Suche. Er soll erinnern an Frau Dr. Dorothea Bernstein, die von 1927 bis 1933 Lehrerin unserer Schule war, und die 1942 im Konzentrationslager […] ermordet wurde, weil sie Jüdin war. Er soll aufmerksam machen darauf, dass unsere 70 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 71 Schule Vergangenheit hat, dass wir alle eine Vergangenheit haben. Er soll mit seinen 10 x 10 cm eine erste Lücke füllen. Dorothea Henriette Bernstein wurde am 10. August 1893 in Tilsit in Ostpreußen geboren. Ihre Eltern Aaron und Sophie Bernstein waren beide jüdischen Glaubens. 1914 legte sie ihre Reifeprüfung in Danzig ab, studierte Deutsch, Französisch und Philosophie in Königsberg, München und Hamburg und legte hier 1922 ihre Prüfung für das höhere Lehramt ab. Im gleichen Jahr promovierte sie zum Doktor der Philosophie. An die Mädchen-Oberrealschule am Lerchenfeld kam sie zunächst als Vertretung für eine erkrankte Lehrkraft, im März 1927, nachdem sie am Oberlyzeum in Altona und an der HeleneLange-Schule einen Vorbereitungsdienst absolviert hatte. Zweieinhalb Jahre später wurde sie zur außerplanmäßigen Beamtin ernannt. Fräulein Bernstein unterrichtete Französisch und Deutsch in allen Klassenstufen. Zeitzeugen beschreiben sie als sozial engagierte Lehrerin, deren Unterricht streng, aber ausgezeichnet war. Sie gehörte zu den jüngsten Kolleginnen und stand den Problemen ihrer Schülerinnen sehr aufgeschlossen gegenüber. Eine ehemalige Schülerin erinnerte sich daran, dass Frau Bernstein jeden Morgen einem Mädchen, dessen alkoholkranker Vater sie stark vernachlässigte, ein Frühstück mitbrachte. Die Schüler schätzten ihre Art. Es heißt, man erlaubte sich in ihrer Gegenwart Bemerkungen, die man gegenüber anderen Lehrern Stolpersteinverlegung vor dem Gymnasium am Lerchenfeld Hamburger Wochenblatt/Sabine Rodenbäck nicht zu äußern gewagt hätte. Am 25. September 1933 wurde Frau Dr. Bernstein auf Grund § 3 des Reichsgesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April desselben Jahres ohne jedes Gehalt in den Zwangsruhestand versetzt […] Am 1. Juni 1939 wurde sie an der letzten jüdischen Schule Hamburgs eingestellt, die aus der Zusammenlegung der Mädchenschule der Deutsch-Israelitischen Gemeinde mit der Talmud Tora Oberrealschule für Jungen hervorgegangen war und sich „Volks- und Höhere Schule für Juden“ nennen musste. Diese Schule wurde von der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland unterhalten […] Diese war allerdings kaum noch zahlungsfähig und sah sich gezwungen, viele der letzten jüdischen Lehrer zu entlassen. So bekam Dr. Dorothea Bernstein im Juni 1941 das Kündigungsschreiben und schied am 16. Juli 1941 gänzlich aus dem Schuldienst aus. 71 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 72 Eine Lehrerin namens Dr. Duhne, zu der Frau Bernstein engen Kontakt hatte, berichtet von einem Anruf, in dem Dorothea Bernstein ihren Abtransport für den kommenden Tag ankündigte. Sie soll gesagt haben, sie habe noch einmal eine warme, menschliche Stimme hören wollen. Am 25. Oktober 1941 wurde Frau Dr. Bernstein mit dem ersten Deportationszug und 1033 anderen Juden nach Lodz (ehemals Litzmannstadt) in Polen deportiert [...] Seit dem Jahr 2000 verlegt der Künstler Gunter Demnig sogenannte Stolpersteine und erinnert so an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten selbstgewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing ins Trottoir einlässt. […] Der Stolperstein, den wir heute für Dorothea Bernstein einweihen, unterscheidet sich etwas von den meisten anderen. Statt der üblichen Zeile ,Hier wohnte‘ sind auf ihm die Worte ,Hier lehrte‘ eingraviert. Wir haben ihn bewusst hier verlegen lassen, um auszudrücken, dass Frau Bernstein als Lehrerin und Mensch an unserer Schule unvergessen ist. Und um deutlich zu machen, dass sie für uns hier hergehörte, an diese Schule, und dass sie damit für immer ein Teil unserer Schule und der Geschichte des Gymnasiums Lerchenfeld bleiben wird. ,Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist‘, sagt Gunter Demnig. Mit diesem Stein vor unserem Schuleingang wollen wir die Erinnerung an diesen Menschen, Frau Dr. Dorothea Bernstein, die einst hier lehrte, lebendig halten. [...]“ Ein weiterer Stolperstein für Dorothea Bernstein liegt im Hauersweg 16, vor ihrer letzten Wohnung, die sie selbst wählen konnte. Ihre allerletzte Adresse in Hamburg vor ihrer Deportation war die Klosterallee 11, wo sie zur Untermiete wohnte. Dorothea Bernstein starb am 5. Juni 1942 in Lodz. Künftig wird es noch einen weiteren Ort des Gedenkens geben. In der Nachbarschaft des Gymnasiums Lerchenfeld entsteht ein Neubaugebiet. Dort wird der Dorothea-Bernstein-Weg an sie erinnern. – Ingrid Budig Quellen: 1; 5; 8; Arbeitsgemeinschaft des Gymnasiums Lerchenfeld, Hamburg; Hamburger Wochenblatt, Wochenzeitung für Barmbek, 29.4.2009. Aron Bezen, geb. 5.4.1899, am 25.10.1941 nach Lodz deportiert und dort gestorben Erna Berta Bezen, geb. Hecht, geb. 26.6.1905, am 25.10.1941 nach Lodz, am 29.9.1942 in Chelmno ermordet Leonhard Bezen, geb. 2.7.1938, am 25.10.1941 nach Lodz deportiert, am 29.9.1942 in Chelmno ermordet Bilha Erna Bezen, geb. 5.12.1939, am 25.10.1941 nach Lodz deportiert, am 29.9.1942 in Chelmno ermordet 10 Winterhuder Weg 86 Aron Bezen war gebürtiger Rumäne und wurde in Targoviste bei Bukarest als Sohn von Salomon Bezen und seiner Frau Anna Wilder geboren. Er hatte vier Brüder: Noa, Josef, Bernhard und Heinrich. Alle fünf Brüder wanderten nach Deutschland aus und verteilten sich im ganzen Land. Aron Bezen zog es nach Hamburg. 72 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 73 In Hamburg lernte er seine erste Ehefrau Frieda Bleiweiss kennen. Mit ihr hatte Aron ein gemeinsames Kind, die Tochter Hannelore kam am 13. Juli 1931 in Hamburg zur Welt. Die Ehe scheiterte und wurde in den dreißiger Jahren wieder geschieden. Der gelernte Tapezierer Aron Bezen betrieb seit 1927 eine kleine Reparaturwerkstatt in der Wexstraße 42, wo er auch kurzzeitig mit seiner Familie wohnte. Am 4. Mai 1930 eröffnete er zuerst in der Elbstraße 60 ein Polster- und Tapeziergeschäft. Schnell wechselte die Geschäftsadresse in den Winterhuder Weg 86, wo gleichzeitig immer ein bis zwei Gesellen angestellt waren. Nach der Scheidung zog Frieda mit ihrer Tochter Hannelore in den Neuen Steinweg 79. Seit dem 4. Juni 1936 wohnte Aron auch im Winterhuder Weg 86 in einer kleinen Wohnung. Mitte der dreißiger Jahre lernte er seine zweite Ehefrau kennen. Erna Berta Hecht war die Tochter von Arthur Hecht und seiner Ehefrau Rosalie Löwenthal und wurde am 26. Juni 1905 in Herford geboren. Winterhuder Weg um 1915 Bildarchiv Hamburg Sie arbeitete als Verkäuferin bei Alfred Laassen in der Kaiser-Wilhelmstraße 49. Im Jahr 1938 zog sie zu Aron in den Winterhuder Weg 86. Am 2. Juli 1938 kam ihr erstes gemeinsames Kind Leonhard zur Welt. Im März 1939 heirateten Aron und Erna und ein weiteres Kind folgte, Bilha Erna wurde am 5. Dezember 1939 geboren. Im selben Jahr musste Arons erste Tochter Hannelore von der Volksschule auf die jüdische Talmud Tora Schule wechseln. Mit der „Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“ vom 12. November 1938 verlor auch Aron Bezen sein Geschäft. 1939 wurde die Polsterei „arisiert“ und ein Herr Flashar erwarb das Geschäft für wenig Geld. In der Folge musste Aron Bezen als Geselle in fremden Werkstätten arbeiten, um seine Familie versorgen zu können. Die Wohnung verlor Familie Bezen ebenfalls und musste zur Untermiete in den Eppendorfer Weg 9 ziehen. Dies war auch ihre Deportationsadresse. Am 25. Oktober 1941 wurde die ganze Familie ins Getto nach Lodz deportiert. Dort wechselten sie einmal ihre Adresse. Zuerst lebten sie in der Reiterstraße 27 und zogen dann Ende November 1941 in den Bleicherweg 17. Seit dem 16. Dezember 1941 arbeitete Aron Bezen als Tapezierer im Getto Lodz und wechselte am 12. März 1942 zur Holzwollefabrik Marysin, um dort als Tapezierer tätig zu sein. Im September 1942 erhielt Familie Bezen ein Schreiben, in dem mitgeteilt wurde, sie werde aus dem Getto „ausgesiedelt“. Aron Bezen legte daraufhin Einspruch ein und begründete diesen mit seiner Arbeitsstelle. Tatsächlich wurde Aron Bezen von der „Ausreise“ zurückgestellt. Seine Frau Erna und ihre Kinder Leonhard und Bilha wurden jedoch am 29. September 1942 aus dem Getto Lodz „ausgesiedelt“. Dies bedeutete für sie den sicheren Tod in einem Gaswagen auf dem Schlosshof von Chelmno. Das weitere Schicksal von Aron Bezen ist ungeklärt. 73 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 74 Letztes Lebenszeichen von Aron Bezen aus dem Getto Lodz. „An die Abtg. f. d. Eingesiedelten Ich ersuche Sie von einer AusreiseAufforderung an mich oder meine Frau Erna, geb.Hecht, Abstand zu nehmen (Kinder: 1 Junge Leonhard 3 1/2 Jahre, 1 Mädchen Bilha 2 1/4 Jahre) und begründe das Ansuchen mit nachfolgendem: Ich bin seit 12.3.42 als Tapezierer in der Holzwollefabrik Marysin II zur vollsten Zufriedenheit meiner Vorgesetzten tätig, vorher war ich ab 16.XII.41 im TapeziererRessort tätig. Ich bin 43 Jahre, meine Frau 37 Jahre alt. Hochachtungsvoll Arno Bezen (5.V.1942)“ USHMM Frieda und Hannelore wurden am 8. November 1941 von Hamburg ins Getto nach Minsk deportiert und kamen dort ums Leben. Quellen: 1; 2; 4; 5; 8; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 17.04.99 Bezen, Aron; StaHH 741-4, Fotoarchiv, Sa 1246; Archivum Panstwowe, Lodz; USHMM, RG 15.083 301/103-105; ITS/ARCH/Transportlisten Gestapo (Hamburg) / 11198207#1 (1.2.1.1/0001-0060/0017G/0045); ITS /ARCH / Getto Litzmannstadt/1202403#1 (1.1.22.1/0006/ 0096). Rudolf Borgzinner, geb. 17.4.1896, am 23.6.1943 nach Theresienstadt deportiert und am 28.9.1944 nach Auschwitz weiterdeportiert; am 5.12.1944 im Konzentrationslager Dachau Kaufering gestorben 11 Bramfelder Straße 23/Schäferkampsallee 29 Als einziges Kind des Ehepaares Dr. med. Paul Borgzinner und seiner Frau Minna, geb. Kempenich, kam Rudolf in Hamburg zur Welt. Nach einem dreijährigen Vorschulbesuch wechselte Rudolf Borgzinner 1905 auf die Oberrealschule auf der Uhlenhorst, wo er im August 1914 sein Abitur bestand. Schon Rudolfs Vater war Arzt gewesen und besaß eine eigene Praxis in der Bramfelder Straße 5. Auch Rudolf fasste den Entschluss, Medizin zu studieren. Im Wintersemester 1914/15 74 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 75 war er in Kiel immatrikuliert und wechselte im nächsten Semester nach Würzburg. Zwischen Herbst 1915 und Januar 1919 unterbrach Rudolf Borgzinner sein Studium, um in verschiedenen Infanterieregimentern am Ersten Weltkrieg teilzunehmen. Im Februar 1919 nahm er sein Studium in Hamburg wieder auf und bestand im Frühjahrszwischensemester 1920 in Würzburg seine ärztliche Vorprüfung. Auch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München war Rudolf Borgzinner kurzzeitig eingeschrieben. Im Dezember 1922 bestand er sein Staatsexamen in Hamburg. Während der Semesterferien absolvierte er ein Praktikum am Pathologischen Institut und auf der zweiten Inneren Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses Barmbek, wo er seit Januar 1923 zur Ableistung seines Probejahres beschäftigt war. Im Oktober 1923 legte Rudolf Borgzinner seine 27-seitige Dissertation mit dem Titel „Über Pneumatosis cystoides intestini hominies“ der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg vor. Sein Prüfer war Prof. Dr. Theodor Fahr aus dem Pathologischen Institut des Allgemeinen Krankenhauses Barmbek. Die Dissertation behandelte das seltene Krankheitsbild „Pneumatosis cystoides intestini“, die Ausbildung gashaltiger Zysten in der Darmwand. Nach seiner Promotion war Rudolf Borgzinner als Assistenzarzt im Krankenhaus Barmbek tätig und arbeitete in der dortigen Chirurgie. Doch aufgrund seiner jüdischen Herkunft wurde er 1933 entlassen. Danach ließ er sich als Facharzt für Chirurgie in der alten Praxis seines Vaters, in der Bramfelder Straße 5, nieder. Im Reichsmedizinkalender war er von 1931 bis 1937 verzeichnet. In diesen Jahren lag seine Wohnung ganz in der Nähe seiner Praxis, in der Bramfelder Straße 23. Eine neue Anstellung fand Rudolf Borgzinner beim Israelitischen Kran- Eine Gastwirtschaft in der Bramfelder Straße 23 zu Beginn des 20. Jahrhunderts Geschichtswerkstatt Barmbek kenhaus. Dort wirkte er ab 1940 als Leiter der chirurgischen Abteilung. Zu dem Zeitpunkt hatte das Krankenhaus seinen ursprünglichen Standort an der Eckernförderstraße (heute Simon-von-Utrecht-Straße) in St. Pauli aufgeben müssen und war in das SiloahDiakonissenhaus in der Johnsallee 68/Ecke Schlüterstraße gezogen. 1942 musste es in das ehemalige Jüdische Siechenheim in der Schäferkampsallee umziehen. 1940 zog Rudolf Borgzinner in die Husumerstraße 16, wo auch seine Eltern lebten. Am 30. Januar 1940 erging gegen Rudolf Borgzinner und seine Eltern eine Sicherungsanordnung. Aufgrund des Devisengesetzes vom 12. Dezember 1938 wurde ihr gesamtes Vermögen auf ein Sicherungskonto überwiesen, über welches die Familie nicht frei verfügen konnte. Dem Ehepaar Borgzinner standen monatlich 350 RM zu, Rudolf Borgzinner musste sich mit 240 RM begnügen. Paul Borgzinner, der bis dahin seine verarmte Schwester Betty Aronstein, die in Dortmund wohnte, mit 30 RM im Monat unterstützt hatte, musste diese Hilfe nun einstellen. 75 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 76 Im September 1941 verstarb Paul Borgzinner, seine Ehefrau Minna folgte ihm am 18. Januar 1942. Rudolf wechselte daraufhin erneut seinen Wohnsitz und lebte ab Februar 1942 in der Johnsallee 57. In seinem Beruf wurde Rudolf Borgzinner immer wieder mit den Problemen seiner Patienten konfrontiert, die ebenfalls jüdisch waren und unter der Verfolgung litten. So konnte beispielsweise das Ehepaar Agnes und Leo Offenstadt ihre Rechnung über 82 RM nicht mehr begleichen, da sie im Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert wurden. In solchen Fällen musste Rudolf Borgzinner die Honorarrechnung beim Oberfinanzpräsidenten geltend machen. Ab 14. September 1942 lebte Rudolf Borgzinner in der Schäferkampsallee 29. Ein knappes Jahr später traf ihn dasselbe Schicksal, welches vor ihm schon zahlreiche seiner Patienten ereilt hatte: er erhielt für den 23. Juni den Deportationsbefehl nach Theresienstadt. Eine Operationsschwester aus dem Israelitischen Krankenhaus erinnerte sich später, dass sie mit Rudolf Borgzinner und ihren Eltern Schlüsselwörter verabredet hatte, um sich trotz der Zensur Nachrichten zukommen zu lassen. Rudolf Borgzinner war zu diesem Zeitpunkt der einzige Chirurg am Israelitischen Krankenhaus und wahrscheinlich auch der einzige Arzt mit Krankenhauserfahrung. Die Operationsschwester berichtete, dass Rudolf Borgzinner von alten Bekannten aus Barmbek versteckt werden sollte, falls er einen Deportationsbefehl erhielt. Doch er lehnte dies ab und wurde am 23. Juni 1943 ins Getto nach Theresienstadt deportiert. Rudolf Borgzinner scheint ein Bücherfreund gewesen zu sein. Seine Bibliothek mit ungefähr 800 Büchern und Heften wurde am 14. Oktober 1943 versteigert. Die 261,20 RM Erlös wurden an die Oberfinanzkasse Hamburg überwiesen. Nach einem Jahr im Getto Theresienstadt wurde Rudolf Borgzinner am 28. Karteikarte für Rudolf Borgzinner von der Reichsvereinigung der Juden ITS September 1944 nach Auschwitz deportiert und von dort aus ins Konzen- trationslager Dachau Kaufering weiterdeportiert. Hier starb Rudolf Borgzinner am 5. Dezember 1944 im Alter von 48 Jahren. Außer dem Stolperstein in Barmbek wurde auch in Eimsbüttel ein Stolperstein für Rudolf Borgzinner in der Schäferkampsallee 29 verlegt. Quellen: 1; 2; 4; 5; 7; 8; StaHH 214-1, Gerichtsvollzieherwesen, 174 Dr. Rudolf Borgzinner; StaHH 314-15, OFP, R 1940/86; StaHH 314-15, OFP, R 1940/88; StaHH 352-8/5, Allgemeines Krankenhaus Barmbek, 73; StaHH 741-4, Fotoarchiv, D 1174/36; ITS/ARCH/Transportliste Gestapo/11198038#1 (1.2.1.1/00010060/0017C/0079); ITS/ARCH/Transportliste Gestapo/11197632#1 (1.2.1.1/0001-0060/0017/0139); ITS/ ARCH/Kartei Getto Theresienstadt/5023671#1 (1.1.42.2/THERES30/1699); ITS/ARCH/Getto Theresienstadt / 4958816#1 (1.1.42.1/0026/0003); ITS / ARCH / Konzentrationslager Dachau / 9895779#1 (1.1.6.1/0001-0189/0032/0006); ITS/ARCH/Konzentrationslager Dachau/9911959#1 (1.1.6.1/00010189/0111/0173); ITS/ARCH/Konzentrationslager Dachau/9924018#1 (1.1.6.1/0001-0189/0170/0013); Denkmalpflege Hamburg, Nr. 5/Mai 1991, Das ehemalige Israelitische Krankenhaus; Borgzinner: Über 76 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 77 Pneumatosis cystoides intestini hominies; Meyer: Die Verfolgung und Ermordung der Hamburger Juden, S. 193; Villiez: Die Vertreibung der jüdischen Ärzte, S. 126; WdE/FZH, Aliasname: Elke Petsch, Teil 1 vom 24.6.1994 autorisierte Fassung. Willi Ferdinand Bröckler, geb. 6.3.1897, inhaftiert 1937,1938–1940, gestorben am 22.10.1941 im KZ Groß Rosen 12 Humboldtstraße 122 Willi Bröckler kam 1897 als eines von fünf Kindern des Lademeisters Heinrich Bröckler und der Maria, geb. Greve, in Hamburg-Hammerbrook zur Welt. Nach dem Besuch der Volksschule machte er eine Ausbildung zum Verkäufer in einem Eisenwarengeschäft und war dort bis zu seiner Einberufung zum Militär 1916 tätig. Nach dem Ersten Weltkrieg eröffnete er Ende 1920 einen Tabakwarenhandel in der Harburger Chaussee 119, den Ende 1924 seine Ehefrau Christine, geb. Lüsing, übernahm. Mit dieser schloss er 1923 die Ehe und hatte mit ihr einen Sohn. 1925 wurde Bröckler vom Amtsgericht Hamburg wegen Unterschlagung zu einer zweimonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. 1927 ging seine Ehe aufgrund seiner homosexuellen Neigungen und wegen wirtschaftlicher Zerrüttung in die Brüche, auch das gemeinsame Geschäft musste aufgegeben werden. Nach 1927 fand Bröckler zunächst als Arbeiter bei der Behörde für Strom- und Hafenbau, später im Büro der Behörde eine Beschäftigung, die er in der Wirtschaftskrise 1931 jedoch wieder verlor. Nach 1933 übte er eine geringfügige Beschäftigung in einer Lesehalle für das WHW (Winterhilfswerk des Deutschen Volkes) aus, die er 1937 nach seiner ersten Verurteilung nach § 175 einbüßte. Über seinen ersten Prozess hat sich leider keine Akte erhalten. Bekannt ist nur, dass Willi Bröckler vom 9. Januar bis 19. Februar 1937 im KZ Fuhlsbüttel inhaftiert wurde und am 20. Februar 1937 durch das Amtsgericht Hamburg wegen widernatürlicher Unzucht in zwei Fällen, davon ein Fall in fortgesetzter Handlung, zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Diese Strafe hatte er am 7. August 1937 verbüßt, in welchem Gefängnis ist nicht überliefert. Sein zweiter Prozess wurde im Oktober 1938 durch die Aussage eines ehemaligen Sexualpartners vor der Wilhelmshavener Polizei ausgelöst, den Willi Bröckler 1935 im Lesesaal des WHW kennengelernt hatte. Bröckler bezeichnete sich während seiner Vernehmungen durch das 24. Kriminalkommissariat im Hamburger Stadthaus als bisexuell, der seine Partner zumeist zufällig in St. Pauli auf der Straße oder in Lokalen wie dem „Grenzfass“ [vgl. Stolpersteine in Hamburg-St. Pauli, S. 214] oder dem „Anker“ kennengelernt hatte. Darunter war auch der Strichjunge Karl Baumgart, Jahrgang 1916, von dem er im Zuge der Ermittlungen Ende November 1938 anhand einer Lichtbildkartei erkannt und verraten wurde. Seit dem 29. November 1938 befand sich Bröckler in der Untersuchungshaftanstalt HamburgStadt. Am 1. Februar 1939 wurde ihm vor dem Amtsgericht Hamburg der Prozess gemacht, der ihm zwei Jahre Gefängnis wegen verschiedener nachgewiesener Vergehen nach § 175 einbrachte. Der damalige Amtsgerichtsrat Günther Riebow verstieg sich in seinem Urteil zu 77 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 78 Entlassungsschreiben für Willi Bröckler, 1940 Staatsarchiv Wolfenbüttel 43 A Neu 4 Jg. 1938 Nr. 744 einer heute skurril anmutenden Definition der Homosexualität des Angeklagten: „Zweifelhaft bleibt es, ob der Angeklagte ein Reinhomosexueller ist oder nicht. Urhomosexueller ist er zweifellos nicht, denn er war verheiratet und hat ein Kind gezeugt. Es scheint aber fast so, als ob er im Laufe der Zeit zu einem Reinhomosexuellen geworden ist.“ Am 24. Februar 1939 wurde Willi Bröckler aus der Untersuchungshaft zur Verbüßung seiner Strafe ins Strafgefängnis Wolfenbüttel überstellt, wo er bis zur Entlassung am 27. November 1940 verblieb. Das ihm ausgestellte Zeugnis des Regierungsrates Linder vom Wolfenbüttler Gefängnis bescheinigte ihm zwar gute Führung und Fleiß, stellte ihm jedoch mit den Worten „Ob Bröckler jedoch in der Freiheit seine homosexuelle Veranlagung unterdrücken wird, erscheint zweifelhaft, zumal er den ihm erteilten Rat, sich entmannen zu lassen, nicht befolgt hat“ quasi sein Todesurteil aus. Am 30. November 1940 wurde er ins Polizeigefängnis Hütten überstellt. Von dort kam er wahrscheinlich, ohne wieder in Freiheit gelangt zu sein, am 22. Februar 1941 ins KZ Sachsenhausen, wo er die Häftlingsnummer 36268 führte. Von dort gelangte er am 25. April 1941 in das zunächst „Arbeitslager Groß-Rosen“ genannte Gefängnis, das am 1. Mai 1941 den Rang eines selbstständigen Konzentrationslagers erhielt. Willi Bröckler befand sich auf der Liste der ersten 722 Häftlinge. Am 22. Oktober 1941 starb er dort laut Sterbeurkunde des Standesamtes Groß-Rosen an einem Herzkollaps und an Kreislaufschwäche. – Bernhard Rosenkranz/Ulf Bollmann Quellen: StaHH, 376-2 Gewerbepolizei, Gewerbeanmeldungen 1915–1930; StaHH, 213-11 Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafsachen, 1561/39; StaHH, 213-8 Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht – Verwaltung, Abl. 2, 451 a E 1, 1 a; StaHH, 242-1 II Gefängnisverwaltung II, Ablieferung 16; Staatsarchiv Wolfenbüttel 43 A Neu 4 Jg. 1938 Nr. 744; B. Rosenkranz/U. Bollmann/G. Lorenz: Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg 1919–1969, S. 202–203. Auskünfte Janusz Barszcz, Muzeum Gross-Rosen, Monika Liebscher, Archiv der Gedenkstätte Sachsenhausen, Rainer Hoffschildt, Hannover und Christian-Alexander Wäldner, Ronnenberg-Weetzen, alle aus 2009 und 2010. 78 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 79 Carl August Bruns, geb. 10.2.1885, inhaftiert 1936,1942–1943, zuletzt im KZ Sachsenhausen, gestorben nach dem 21.4.1945 auf einem Todesmarsch 13 Papenhuder Straße 32 „Er ist ins Gefängnis gekommen, weil er als Textilkaufmann so viele Kontakte zu Juden hatte“, war die Begründung seiner Angehörigen dafür, dass Carl Bruns den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt hatte. Die Wahrheit wollte die Familie vor der Umwelt verborgen halten, schließlich wurden Homosexuelle (noch bis 1969) als Kriminelle behandelt. Erst Jahrzehnte später erfuhr Wolfgang Schreiber vom Schicksal seines homosexuellen Großonkels. Wolfgang Schreiber: „Meine Oma, Marta Busse, war die jüngere Schwester von Carl Bruns. Als ich klein war, versuchte sie mich vor ‚Männern mit Kettchen‘ an Bahnhöfen zu warnen, was ich als kleiner Junge natürlich nicht begriff. Wahrscheinlich wollte sie mir das Schicksal ihres Bruders ersparen.“ Erst als seine Großmutter 1985 verstorben war und sich Wolfgang Schreiber 1986 in einem Brief gegenüber seiner Tante Ursula Becker, einer Nichte von Carl Bruns, als schwul geoutet hatte, brach diese das Schweigen und erzählte ihm von seinem Großonkel. „Nun war meine Neugierde entfacht, und ich begab mich auf Spurensuche. Im Hamburger Staatsarchiv wurde ich fündig, dort befinden sich die Strafjustizakten. Heute lebe ich selbst als offen schwuler Mann in Amsterdam und fühle mich meinem Großonkel sehr verbunden, auch wenn ich leider nur sehr wenig von seinem Leben weiß.“ Ursula Becker, Jahrgang 1924, die am 19. Juni 2006 zur Einweihung des Stolpersteins für ihren Onkel nach Hamburg gekommen war, hatte ihn zuletzt gesehen als sie zehn Jahre alt war. „Er war eine elegante Erscheinung und ein Kunst liebender Mensch, man könnte sagen, ein Ästhet. In der Wohnung Papenhuder Straße hatten sie mehrere Untermieter, die dort zusammen mit meiner Großmutter, die den Haushalt führte, Onkel Otto und Onkel Carl lebten. Carl nähte die Gardinen und knüpfte Teppiche. Er war eines von insgesamt sieben Geschwistern, darunter waren auch einige Nazis. Das war wohl auch der Grund dafür, über sein Schicksal in der Familie zu schweigen“, erinnerte sich Ursula Becker. Ihre Mutter hatte das Schicksal ihres Bruders als Schande empfunden. „Als ich 25 Jahre alt war, hat sie mir die Wahrheit gesagt. Meine Mutter hegte den Verdacht, dass Wolfgang genauso sein wird wie Carl Bruns, um 1936 Privatbesitz sein Großonkel. Sie mochte aber nicht mit ihm darüber sprechen, also habe ich das übernommen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ein Stolperstein an meinen Onkel erinnert. Ich kann es nicht verstehen, dass so viele Menschen die Schrecken der Nazi-Zeit nicht wahrhaben wollen. Es muss alles getan werden, um daran zu erinnern.“ Carl Bruns wurde am 10. Februar 1885 in Hollerdeich/Kreis Kehdingen (heute Oederquart/ Kreis Stade) geboren. Von seinen elf Geschwistern starben fünf sehr früh an Kinderkrankhei79 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 80 ten. Nach der Dorfschule absolvierte er eine kaufmännische Lehre, arbeitete als Kaufmann in der Textilbranche und zog nach Hamburg. Am Ersten Weltkrieg nahm Carl Bruns von 1915 bis 1918 teil, zuletzt als Kanonier im Fußartillerie-Regiment 45 Hamburg-Altona. Für seine Verdienste erhielt er das „EK II, Verw.Abzeichen und Frontkämpferehrenzeichen“. Im Polizeiverhör 1942 sagte Carl Bruns: „Meine homosexuelle Veranlagung hat sich erst während des Weltkrieges richtig entwickelt … Nach meiner Militärzeit habe ich mich nicht wieder Frauen genähert.“ Ob er seinen späteren Geschäfts- und Lebenspartner Otto Schildt, Jahrgang 1882, im Krieg kennengelernt hatte, ist nicht überliefert. 1919 wurden die beiden Geschäftsführer und ab 1927 Inhaber des Tuchlagers Welzien & Co. am Graskeller 3, dann am Neuen Wall 103. Beide Gebäude wurden im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört. 1929 lernte Carl Bruns den Fotografen Heinrich Roth, Jahrgang 1907, in dem einschlägigen Lokal „Goldene 13“ in der Koppel in St. Georg kennen. Beide hatten über mehrere Jahre ein Verhältnis miteinander. Fotos belegen, dass Heinrich Roth sich offenbar auch mit Bruns’ Lebenspartner Otto Schildt gut verstand. Am 1. April 1933 zogen Otto Schildt, Carl Bruns und dessen Mutter in eine 8-Zimmer-Wohnung in die zweite Etage des Wohnhauses Papenhuder Straße 32. 1936 wurde Carl Bruns wegen seiner Beziehung zu Heinrich Roth nach § 175 RStGB zu vier Monaten und zwei Wochen Gefängnis verurteilt. Heinrich Roth erhielt acht Monate Gefängnis. Am 27. März 1942 geriet Carl Bruns erneut in die Fänge der Kriminalpolizei: Ein ehemaliger Sexualpartner hatte seinen Namen im Verhör genannt. Noch am selben Tag nahmen Beamte des Kriminalkommissariats 24 Carl Bruns fest. Er bestritt die Anschuldigungen, gab aber einen Sexualkontakt mit einem Unbekannten im Sommer des Jahres 1941 zu. Vom 4. bis zum 13. April 1942 befand sich Carl Bruns als polizeilicher „Schutzhäftling“ im KZ Fuhlsbüttel. Seinen Partner Otto Schildt konnte er aus den Ermittlungen heraushalten. Am 6. Juli 1942 fand der Prozess vor dem Amtsgericht Hamburg statt. Amtsgerichtsrat Friedrich Bertram verhängte eine einjährige Gefängnisstrafe wegen Vergehens nach § 175 RStGB, die Carl Bruns im Männergefängnis Fuhlsbüttel und im Gefängnis Altona verbüßte. Nach seiner Entlassung am 9. März 1943 war sein Leidensweg noch nicht zu Ende: Er wurde der Hamburger Polizei überstellt und in „Vorbeugehaft“ genommen. Im April 1943 folgte seine Verbringung ins KZ Sachsenhausen. Ende April 1945 kam er auf dem Todesmarsch Richtung Parchim ums Leben. Otto Schildt starb 1943 eines natürlichen Todes. Heinrich Roth wurde nach zwei Jahren Zwangsarbeit in den Emslandlagern zunächst ins KZ Sachsenhausen und später ins KZ Neuengamme verbracht. Er starb am 3. Mai 1945 beim Untergang der Cap Arcona (vgl. Stolpersteine in Hamburg-St. Georg, S. 163–166). An sein Schicksal erinnert ein Stolperstein am Steindamm 91/97 in St. Georg. – Bernhard Rosenkranz/Ulf Bollmann Quellen: B. Rosenkranz/U. Bollmann/G. Lorenz: Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg 1919–1969, S. 118– 119; Wolfgang Schreiber, Biographie Carl Bruns (1885–1945), unveröffentlichtes Manuskript sowie Gespräche zwischen Wolfgang Schreiber bzw. Ursula Becker und Bernhard Rosenkranz am 19.6.2006; StaHH, 213-11 Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafsachen, 5209/42; StaHH 331-1 II Polizeibehörde II, Ablieferung 15 Band 2; StaHH, 242-1 II Gefängnisverwaltung II, Ablieferungen 13 und 16. 80 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 81 Ernst Valentin Burchard, geb. 26.1.1891, am 8.11.1941 nach Minsk deportiert Olga Burchard, geb. Jonas, geb. 15.6.1894, am 8.11.1941 nach Minsk deportiert Gabriele Olga Burchard, geb. 23.3.1923, am 8.11.1941 nach Minsk deportiert Marianne Lilly Burchard, geb. 3.4.1928, am 8.11.1941 nach Minsk deportiert 14 Papenhuder Straße 53 Der Sohn von Konsul Martin Burchard und dessen Frau Bertha, geb. Goldzieher, Valentin Burchard, wurde in Hamburg geboren. In Eimsbüttel besuchte er die Oberrealschule und absolvierte danach eine kaufmännische Ausbildung in verschiedenen Hamburger Exportgeschäften. 1912 trat er freiwillig der kaiserlichen Armee bei und verbrachte sein „Einjähriges“ bei einer Einheit in Schwerin. Erste Berufserfahrungen sammelte er im Ausland. Zwischen 1913 und 1915 lebte und arbeitete Valentin Burchard in Buenos Aires. Nach Beginn des Ersten Weltkrieges traf er Vorbereitungen, um ins Deutsche Reich zurückzukehren. Ausgestattet mit falschen Papieren gelang ihm auf Umwegen seine Rückkehr in die Heimat, wo er sich zur Armee meldete und als Unteroffizier an der Westfront eingesetzt wurde. Nach Kriegsende zog es Valentin Burchard erneut ins Ausland. Bis 1920 arbeitete er als Kaufmann in den Niederlanden, danach kehrte er nach Hamburg zurück, um sich selbstständig zu machen. Im März 1921 heiratete Valentin Burchard die drei Jahre jüngere ebenfalls jüdische Olga Jonas, die Tochter von Otto Nathan Jonas und seiner Frau Emma, geb. Jonas. Das Ehepaar zog in eine gemeinsame Wohnung am Schwanenwik 34. Kurz darauf kam ihr erstes Kind, Martin Otto, am 2. Februar 1921 zur Welt. Die Tochter Gabriele Olga wurde am 23. März 1923 geboren und ein Jahr später folgte der Sohn Ernst Valentin am 5. April 1924. Marianne Lilly erblickte als jüngstes der vier Geschwister am 3. April 1928 das Licht der Welt und vervollständigte die Familie. In den zwanziger Jahren hatte Valentin Burchard einige wichtige Ämter inne. So war er Mitglied der Industriekommission der Handelskammer, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft und Arbeitsrichter. Eine berufliche Veränderung brachte das Jahr 1928, als Valentin Burchard Vorstandsmitglied der Firma Hugo Peters & Co. AG, einer Weinhandels- und Spirituosenfabrik, wurde. Wenige Jahre später gründete Burchard dann eine eigene Weingroßhandlung auf der Uhlenhorst in der Papenhuder Straße 53. Als die Burchards im August 1935 ihr Haus am Schwanenwik 34 aufgrund der sich verschärfenden Diskriminierung und Entrechtung jüdischer Bürger aufgeben mussten, zogen sie in das Firmengebäude in der Papenhuder Straße 53. Passfoto von Valentin Burchard aus dem Bürgerschaftsausweis StaHH Angesichts sinkender Umsätze seines Weinhandels gründete Burchard im August 1935 die Firma Valentin Burchard & Co., die pharmazeutische Präparate für den Export herstellte. Burchard war persönlich haftender Gesellschafter der Firma und für den kaufmännischen Bereich zuständig. Unter der Adresse Vogelreth 3 im Hamburger Frei81 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 82 hafen lag der Sitz des Unternehmens. Die auf den Export von Fluid-Extrakten und Tinkturen spezialisierte chemisch- pharmazeutische Fabrik besaß Abnehmer in der ganzen Welt. Ihre Erzeugnisse wurden nach Süd- und Zentralamerika, Afrika, aber auch in einige Teile Europas verschifft. Obwohl die Firma eine gute Entwicklung nahm und die Auslandskontakte Burchards für wachsende Umsätze sorgten, brachte der Austritt der Kommanditisten Oscar Friedländer und John Hausmann im April 1937 die Firma in ernste Schwierigkeiten. Schließlich sicherte aber der Eintritt von Emmy Jonas, der Schwester von Burchards Ehefrau Olga, der Fabrik das Überleben. Während der nächsten Jahre verschlechterte sich das Leben der Familie Burchard zusehends. Valentin Burchard beantragte im September 1938 bei der Industrie- und Handelskammer Hamburg ein Auslandsvisum für eine Geschäftsstelle. Eine Anfrage der IHK bei der Finanzbehörde, ob Burchard bei einer Visaerteilung Sicherheiten für den Fall einer Flucht zwecks Begleichung der dann fällig werdenden „Reichsfluchtsteuer“ zu hinterlegen habe, machte ihn zum Ziel behördlicher Zwangsmaßnahmen. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Antrags leitete die Devisenstelle der Finanzbehörde Ermittlungen wegen des Verdachts der Kapitalflucht ein. Die Polizeibehörde wurde eingeschaltet und beauftragt, Nachforschungen anzustellen, bei der Zollfahndungsstelle wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer möglicherweise bestehenden Auswanderungsabsicht eingeleitet. Obgleich die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass eine Auswanderungsabsicht nicht bestand, wurde ein Visum verweigert. Am 16. Februar 1939 wurde die Firma Valentin Burchard & Co. „arisiert“ und von der Hamburger Chinosolfabrik AG übernommen. Für Familie Burchard bedeutete dies, dass sie faktisch mittellos war. Für ein bescheidenes Entgelt konnte Valentin Burchard nach seiner Enteignung und der Übernahme durch Chinosol dann noch für die Dauer der Abwicklung des Kaufvertrages im Betrieb tätig sein. Diese Tätigkeit war zunächst bis zum Jahresende 1939 befristet, wurde dann aber durch den Kriegsbeginn noch einmal bis zum 1. September 1940 verlängert. Marianne Lilly, die jüngste Tochter des Ehepaares Burchard, besuchte seit 1934 das Paulsenstift. Allerdings musste sie diese Schule zum 13. April 1939 verlassen und wie die meisten anderen jüdischen Kinder auf die Talmud Tora Schule gehen. Weil sich die Situation der Familie Burchard im Deutschen Reich zunehmend verschlechterte, bemühte sich Valentin Burchard im Januar 1939 um Pässe für die Ausreise seiner Familie in die Niederlande. Bis Juli 1939 gelang es ihm, alle von der Devisenstelle der Hamburger Finanzbehörde für eine Bearbeitung des Antrages geforderten Bescheinigungen und Unterlagen zusammenzutragen. Finanziert werden sollte die Auswanderung durch den Rückkauf einer in England bestehenden Lebensversicherung. Allerdings war Burchard nach seiner Enteignung nicht mehr in der Lage, den von der Devisenstelle geforderten Gegenwert der Versicherung in Höhe von 410 Pfund Sterling abzuliefern. Im selben Jahr ereilte Familie Burchard ein weiterer Schicksalsschlag. Ihr Sohn Martin Otto verstarb aus ungeklärten Gründen. Im Juli 1939 konnte Ernst Valentin mit einem Kindertransport nach England gebracht werden. Dort kam er bei einem Pastor, der außerhalb der Stadt Worcester lebte, unter. Bis zu ihrer Deportation hielt die Familie Kontakt zu dem Sohn. 82 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 83 Anfrage an die Devisenstelle zur Auswanderung von Ernst Burchard StaHH Am 8. November 1941 wurde das Ehepaar Burchard mit ihren Töchtern Gabriele Olga und Marianne Lilly ins Getto nach Minsk deportiert. Seit diesem Zeitpunkt gelten sie als verschollen. Ein letztes Lebenszeichen von Valentin Burchard traf Anfang 1942 in Hamburg ein: Max Plaut, der Leiter des Jüdischen Religionsverbandes, erhielt einen Brief (es ist unbekannt, wie dieser nach Hamburg gelangen konnte), in dem Burchard die Zustände im Getto Minsk schilderte. Leider ist das Schreiben nicht erhalten. Quellen: 1; 2; 4; 5; 8; StaHH 121-3, Bürgerschaft I, A 17; StaHH 314-15, OFP, J 2/124/126/128/129; StaHH 314-15, OFP, FVg 5192; StaHH 314-15, OFP, FVg 7658; StaHH 314-15, OFP, R 1938/2404; StaHH 314-15, OFP, R 1939/1239; StaHH 314-5, OFP, R 1940/31; StaHH 741-4, Fotoarchiv, Sa 1246; Müller: Mitglieder der Bürgerschaft, S. 23ff.; Leo Baeck Institut New York, AR 7183, Max Kreuzberger, Box 7 Folder 9, MM reels 129, Schr. Plaut an Lowenthal v. Dezember 1968. 83 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 84 Carl Burmester, geb. 12.3.1901, nach Folterungen durch die Gestapo am 17.9.1934 im Treppenhaus des Stadthauses zu Tode gestürzt 15 Wiesendamm 20 Der Kommunist Carl Burmester entstammte einem sozialdemokratischen Elternhaus und wuchs in Hamburg auf. Nach dem Besuch der Volksschule wechselte Burmester zur Gewerbeschule und machte anschließend eine Ausbildung zum Schiffszimmermann und Bootsbauer, ein Beruf, den bereits sein Vater Franz Burmester ausgeübt hatte. Seit 1917 war Carl Burmester Mitglied im Schiffszimmerverband und trat 1918 auch der Freien Jugend bei. Anfang des Jahres 1924 heiratete Carl Burmester die zwei Jahre jüngere Charlotte Clausen. Sie stammte aus Flensburg und war gelernte Gärtnerin. Am 31. Oktober 1924 kam ihr Sohn Jens Peter in Hamburg zur Welt und am 4. Mai 1926 wurde ihre Tochter Greta in Harxbüttel geboren. Gemeinsam mit seiner Ehefrau trat Carl Burmester 1922 der KPD bei und beteiligte sich aktiv am politischen und gewerkschaftlichen Leben. So war er Zweiter Vorsitzender des Internationalen Hafenarbeiter- und Seeleuteverbandes, Mitglied des Vorstandes der KPD im Bezirk Wasserkante und ließ sich 1932 als Kandidat für die Hamburger Bürgerschaft aufstellen. Zudem stand er in Verbindung mit dem Maler Heinrich Vogeler in Worpswede, der dort für Kinder aus kommunistischen Familien eine Art Erholungsheim betrieb. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 arbeiteten Carl und Charlotte Burmester weiterhin „illegal“ für die KPD. Aufgrund dieser Tatsache kündigte ihre Wohnungsbaugenossenschaft der Familie im Frühjahr 1933 ihre Wohnung am Wiesendamm 20. Familie Burmester zog daraufCarl Burmester Photoarchiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme hin in die Schlettstadter Straße 5 um. Am 1. April 1933 wurde Carl Burmester aufgrund seiner konspirativen Aktivitäten von der Gestapo verhaftet und in „Schutz- haft“ genommen, wurde aber nach einigen Monaten am 30. November 1933 wieder freigelassen. Auch Charlotte befand sich vom 11. Juli 1933 bis zum 21. November in „Schutzhaft“. Nach ihrer Freilassung beteiligte sich das Ehepaar erneut an der illegalen politischen Arbeit und wurde im Sommer 1934 gemeinsam verhaftet. Charlotte Burmester kam am 17. Juni in „Schutzhaft“ und Carl musste zur Vernehmung ins Stadthaus. Grund für die erneute Verhaftung war der Wiederaufbau gewerkschaftlicher Gruppen, an dem sich das Ehepaar beteiligt hatte. Inzwischen war die Ehe der Burmesters gescheitert, vor dem Hamburger Landgericht wurden die beiden am 9. Juli rechtskräftig geschieden. Während Charlotte Burmester in „Schutzhaft“ saß, wurde ihr Mann von der Gestapo im Stadthaus vernommen und dabei schwer gefoltert. Nach Aussagen seines Vaters Franz Burmester 84 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 85 stürzte Carl am 17. September 1934 im Zusammenhang mit einem Verhör im Treppenhaus des Stadthauses. Angeblich soll die Gestapo ihn dort hinuntergestürzt haben. Daraufhin wurde er ins Hafenkrankenhaus überführt. Carl Burmester erlag seinen Verletzungen noch auf dem Transport. Der Todeszeitpunkt wurde mit 18:09 Uhr datiert. Charlotte Burmester erfuhr vom Tod ihres Ex-Ehemannes im Gefängnis. Auf Anraten ihres Anwaltes Paul Nevermann beantragte sie am 20. September eine Haftunterbrechung, um ihre Kinder bei Verwandten unterzubringen. Am 11. Dezember wurde sie vom Oberlandesgericht Hamburg zu einem Jahr Haft wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ verurteilt. Ihre Haftstrafe verbüßte sie im Gefängnis Lübeck-Lauerhof. Aufgrund einer schweren Asthmaerkrankung wurde Charlotte Burmester am 12. August 1935 aus der Haft entlassen, ins Krankenhaus Lübeck eingeliefert und für haftunfähig erklärt. Kurz darauf kehrte sie nach Hamburg zu ihren Kindern zurück und zog mit ihnen in eine Wohnung in der Dehnhaide 11. Trotz all der Verfolgungen und Bedrohungen durch die Nationalsozialisten bot Charlotte Burmester politischen Gefangenen ihre Hilfe an. Deswegen sollte sie 1937 erneut verhaftet werden. Kurz vor der Inhaftierung floh sie Die Stockhausenstraße mit Blick auf den Wiesendamm in den 1930er Jahren Geschichtswerkstatt Barmbek mit ihren Kindern Greta und Jens Peter im Juli 1937 nach Schweden. In Schweden war Charlotte Burmester erneut für eine kommunistische Organisation tätig und sortierte Paketsendungen an Familien politischer Gefangener. Zudem bemühte sie sich, das Leben der zum Tode verurteilten Liselotte Hermann mithilfe einer Protestkampagne zu retten. Die Kinder gingen in Schweden zur Schule und machten ihren Abschluss. Zur Familie Burmester zog 1944 Richard Herbert Wehner, der bis dahin in einem schwedischen Internierungslager in Smedsbo eingesessen hatte. In Deutschland hatte er als KPD-Abgeordneter dem sächsischen Landtag angehört und wurde von den Nationalsozialisten steckbrieflich gesucht. Am 1. Juli 1947 kehrten Familie Burmester und Herbert Wehner aus Schweden zurück. Charlotte und er heirateten am 2. Februar 1953 in Hamburg. In dieser Zeit war Herbert Wehner als Hamburger SPD-Abgeordneter bereits Bundestagsmitglied. Ein weiterer „Stolperstein“ für Carl Burmester wurde an der Stadthausbrücke vor dem Eingang der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) verlegt. Quellen: StaHH 242-1 II, Gefängnisverwaltung II, Abl. 16, Untersuchungshaft; StaHH 314-15, OFP, FVg 7718; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 12.03.01 Burmester, Carl; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 20.08.03 Wehner, verw. Burmester, geb. Clausen, Charlotte; http://www.politisch-verfolgte.de/ Zugriff am 14.03.2009; VVN, B50 Burmester, Greta; Diercks: Gedenkbuch „KOLA-FU“, S. 16 f. 85 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 86 Max Heinrich Werner Dahms, geb. 14.2.1914, nach einem Suizidversuch am 16.10.1940 im Lazarett des Polizeigefängnisses Fuhlsbüttel gestorben 16 Zimmerstraße 47 Der Seemann Max Dahms wurde als eines von vier Kindern des Ehepaares Heinrich und Helene Dahms, geb. Sassarath, in Hamburg geboren. Die Familie lebte in der Zimmerstraße 45. Schon in seiner Jugend politisch engagiert, trat Max Dahms der KPD bei. Später wurde er Mitglied des Rotfrontkämpferbundes (RFB) „Einheit“, welcher ab 1929 nach dem Verbot des RFB illegal weiterarbeitete. Der RFB und die SA lieferten sich zu Beginn der dreißiger Jahre erbitterte Straßenkämpfe. Ab 1933 war Max Dahms an zahlreichen Aktionen des RFB beteiligt, für die er später angeklagt und verurteilt wurde. Am 26. Februar 1933 überfiel er mit 26 Genossen das SA-Lokal Kirchmayer im Alten Teichweg. Bei diesem Vorfall kam es zu einem Schusswechsel zwischen SA und RFB, in dessen Folge einige RFB-Mitglieder verhaftet wurden. Die nächste Aktion fand Anfang März statt. Max Dahms wurde kurzzeitig am 5. März, dem Sonntag der Reichstagswahl, verhaftet, weil man ihm Propaganda vorwarf. Aber nach einer halben Stunde auf dem Polizeirevier konnte er wieder nach Hause gehen. Am Abend desselben Tages trafen sich die RFB-Mitglieder Max Dahms, Adolf Olsson, Werner Stockmann, Paul Krahn und Rudolf Bramfeld in der Wohnung von Bertha und Helmuth Buchholz zwischen 19:00 und 24:00 Uhr. Im Laufe des Abends teilte der Gefangenenkarteikarte von Max Dahms aus dem Gefängnis Fuhlsbüttesl 86 StaHH 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 87 Führer des Zweiten Verbandes des RFB sie zum Schutz des RFB-Lokals von Herrn Ledig in der Schumannstraße 6 ein. Bis Mitternacht schoben sie jeweils zu zweit vor der Gaststätte Wache. Für den nächsten Tag, den 6. März 1933, war Max Dahms erneut zum Wachdienst eingeteilt, da es hieß, die SA plane das Lokal von Herrn Ledig zu stürmen. Treffpunkt war diesmal das Lokal von Düe in der Humboldtstraße 100. Gegen 19:00 Uhr kamen 17 Personen aus dem Jugendsturm des Zweiten Verbandes und dem Vierten Verband des RFB zusammen. Jedes Mitglied erhielt eine Schusswaffe, deren Verteilung unter anderem Max Dahms übernahm, nachdem ein Genosse namens Sonntag sie besorgt hatte. Danach legten sich alle Beteiligten rund um die Gaststätte von Ledig auf die Lauer und warteten auf die SA. Tatsächlich kam diese um 20:00 Uhr beim Lokal vorbei, woraufhin das Feuer sofort eröffnet wurde und die SA zurückschoss. Max Dahms lag zusammen mit Rudolf Bramfeld auf einer Terrasse, als der Schusswechsel begann. Beide feuerten auf den SA-Trupp, doch schon nach drei Schüssen hatte Max Dahms´ Waffe eine Ladehemmung. Daraufhin sprangen Rudolf Bramfeld und Max Dahms auf und rannten zur Schumannstraße, Ecke Beethovenstraße. Auch die anderen Rotfrontkämpfer versuchten zu entkommen und unterzutauchen, doch die meisten wurden innerhalb der nächsten Tage von der Polizei verhaftet. Max Dahms gehörte zu den wenigen, denen die Flucht gelang. Obwohl Max Dahms sich eigentlich vor der Polizei verstecken musste, war er trotzdem noch an einigen RFB-Aktionen gegen die SA beteiligt. Am 21. März 1933 überfiel er gemeinsam mit einigen Kameraden den SA-Mann Angerstein in Barmbek-Uhlenhorst, eine Racheaktion, denn die SA hatte wenige Tage zuvor einen Kommunisten in eines ihrer Sturm-Lokale gezerrt und dort zusammengeschlagen. Die letzte nachweisbare Tat von Max Dahms ereignete sich im April 1933. Bei Bombenanschlägen auf das Lokal Wucherpfennig in der Barmbeker Straße und auf das Mühlenkamper Fährhaus gehörte Dahms zu den Drahtziehern. Hintergrund der Anschläge war die Übernahme des Lokals durch die SA, das bis dahin ein kommunistisches Stammlokal gewesen war. Bei der Aktion wurde niemand verletzt. Schließlich wurde Max Dahms am 28. August 1933 von der Polizei geschnappt, inhaftiert und vor Gericht gestellt. Nach zweimonatiger Verhandlung verurteilte ihn am 23. Oktober 1933 das Hanseatische Sondergericht unter anderem wegen „Landfriedensbruchs“, illegalem Waffenbesitz und versuchtem Mord zu einer Zuchthausstrafe von insgesamt 11 Jahren und 6 Monaten. Zu diesem Zeitpunkt war Max Dahms gerade 19 Jahre alt. Nach sieben Jahren Haft im Gefängnis Fuhlsbüttel versuchte Max Dahms in seiner Zelle Suizid zu begehen und starb wenige Tage später, am 16. Oktober 1940, an den Folgen seiner Verletzungen im Gefängnislazarett. Quellen: StaHH 213-11, Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafakten, L 17/38; StaHH 213-11, Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafakten, L 115/36; StaHH 213-11, Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafakten, 681/89, Bd. 1; StaHH 213-11, Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafakten, 818/41; StaHH 242-1 II, Gefängnisverwaltung II, Abl. 13 Ältere Gefangenenkartei; Diercks: Gedenkbuch „KOLA-FU“, S. 61; Totenliste Hamburger Widerstandskämpfer und Verfolgter 1933–1945. 87 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 88 Anton Carl Engelbert Decker, geb. 10.8.1889, inhaftiert 1936, 1937–1938, 1941, Selbstmord am 30.3.1941 im Polizeigefängnis Hütten 17 Mundsburger Damm 65 Engelbert Decker, der sich Egbert nannte, wurde als achtes von insgesamt neun Kindern des Joseph Decker und der Maria, geb. Wachtmeister, in Werne/Westfalen geboren. Er besuchte das Gymnasium und nahm in München ein Studium der Zahnheilkunde auf, das er 1912 mit der Note „gut“ abschloss. Von 1913–1915 arbeitete er als Assistent in Vegesack bei Bremen, im Ersten Weltkrieg wurde er nicht eingezogen, sondern arbeitete im Zivildienst in einem Lazarett für Kieferverletzte in Münster/Westfalen. 1919 ging er nach Hamburg, wo er sich zum 1. Januar 1920 als selbstständiger Zahnarzt niederließ und wo er am 22. Dezember 1920 die Doktorwürde von der Medizinischen Fakultät der Hamburgischen Universität verliehen bekam. 1937 gab er für seine Hamburger Praxis am Mundsburger Damm 65 an, dass sie „so einigermaßen“ gehe, „so daß meine wirtschaftliche Lage geregelt ist“. Ob seine 1918 und 1932 klinisch behandelte Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit mit seiner homosexuellen Veranlagung in Verbindung standen, geht aus den überlieferten Akten der Staatskrankenanstalt Langenhorn nicht hervor. Jedes Mal fand Egbert Decker wieder zurück in ein geregeltes Leben. Vom 16. bis 31. Oktober 1936 wurde Egbert Decker vermutlich erstmals wegen des Vorwurfs, homosexuelle Handlungen begangen zu haben, im KZ Fuhlsbüttel festgehalten, ohne dass es jedoch zu einer Verurteilung kam. Zu Fall brachte ihn am 18. Oktober 1937 erst die Anzeige eines Stabsheizers, der zuvor mit Egbert Decker sexuelle Handlungen gegen Geldzahlung vorgenommen hatte. Unmittelbar danach rief er die Polizei, um Egbert Decker festnehmen zu lassen. Dieser wies alle Anschuldigungen zurück. Das wenig plausible Verhalten des Stabsheizers, der außerdem in Deckers Wohnung einen schweren Diebstahl begangen hatte, bewahrte den Zahnarzt jedoch nicht vor der Festnahme und der Gestapo-Haft im KZ Fuhlsbüttel, wo er vom 19. Oktober bis 13. November 1937 festgehalten wurde. Danach folgte ein Aufenthalt in der Untersuchungshaftanstalt an der Holstenglacis und Verhöre im Hamburger Stadthaus. Kriminaloberassistent Mertens zufolge „spricht man nur gut von ihm und er soll auch ein guter Zahnarzt sein. Unter seinen Kunden finden sich sämtliche Berufe vor, also vom einfachen Arbeiter bis zum Professor“. Engelbert Decker bezeichnete sich als homosexuell und wurde auf Grund seiner sexuellen Orientierung mehrfach in Polizei- und Justizakten erfasst, ohne aber verurteilt worden zu sein. Am 22. April 1938 wurde er vom Amtsgericht Hamburg zu acht Monaten Gefängnis nach § 175 verurteilt. Aus dem Urteil des Amtsgerichtsdirektors Erwin Krause: „Das Gericht ist der Auffassung, dass der Angeklagte hartnäckig leugnet und daher keineswegs irgendwelche besondere Milde verdient. Er als Arzt und einem gebildeten Stande angehörend, darf sich nicht erlauben, der Wahrheit derartig mit seinen Behauptungen ins Gesicht zu schlagen. Von einem ungebildeten Manne kann man wohl so etwas erwarten und es einem solchen nicht so verübeln wie dem Angeklagten, von 88 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 89 dem man erwartet hätte, daß er mutvoll seine Tat eingestanden hätte“. Nach Anrechnung der „Schutz“- und Untersuchungshaft wurde Decker acht Wochen später, am 24. Juni 1938, aus der Haft im Männergefängnis Fuhlsbüttel entlassen. Während seine Haushälterin und ein vertrauter Freund ihn in keiner Weise belasteten, versuchte seine Familie, ihn unter Vormundschaft stellen zu lassen. Hierzu mag auch Deckers Alkoholismus beigetragen haben. Ob diese Bemühungen Erfolg hatten, lässt sich den Akten nicht entnehmen. Aufgrund des Gerichtsverfahrens wurde Engelbert Decker von der Hansischen Universität am 23. November 1938 der Titel „Dr. med. dent.“ aberkannt. Vermutlich ist ihm auch vom Ham- Antrag des Dekans auf Entziehung der Doktorwürde durch die Universität Hamburg StaHH 89 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 90 burger Polizeipräsidenten die Approbation entzogen worden, darauf lässt Deckers Klage vor dem Verwaltungsgericht Hamburg schließen. Am 29. März 1941 wurde Engelbert Decker erneut festgenommen und ins innerstädtische Polizeigefängnis Hütten eingewiesen. Dieses Mal hatte ein Strichjunge seinen Name im Polizeiverhör preisgegeben. Am 30. März 1941, also nur einen Tag nach seiner Verhaftung, erhängte er sich mit seinem Leibriemen in der Zelle. Als ein von seiner Familie beauftragter Rechtsanwalt am 7. April 1941 beim Oberstaatsanwalt nach dem Verbleib Deckers fragte, war dieser bereits verstorben. Vor seiner Praxis und seiner Wohnung am Mundsburger Damm 65 wird ein Stolperstein an sein Schicksal erinnern. Die Patenschaft für den Stolperstein hat die Hamburger Zahnärztekammer übernommen. – Bernhard Rosenkranz/Ulf Bollmann Quellen: StaHH, 213-11 Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafsachen, 5531/38 und 6908/42; StaHH, 213-8 Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht – Verwaltung, Abl. 2, 451 a E 1, 1 a und 1 b; StaHH, 242-1 II Gefängnisverwaltung II, Ablieferungen 13 und 16; StaHH, 364-5 I Universität I, L 50.6 Heft 22; StaHH, 331-5 Polizeibehörde – Unnatürliche Sterbefälle, 955/41; StaHH, 352-8/7 Staatskrankenanstalt Langenhorn, Abl. 1995/2, 19863; B. Rosenkranz/U. Bollmann/G. Lorenz: Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg 1919–1969, S. 204; Gert Eisentraut: Stolperstein für Hamburger Zahnarzt gesetzt. Dr. Engelbert Decker durch KZV Hamburg geehrt, in: Hamburger Zahnärzteblatt Nr. 5, Mai 2009, S. 8–9; Einen Stolperstein für Hamburger Zahnarzt gesetzt, in: Die ZahnarztWoche DZW, Ausgabe 20/09 vom 05.05.2009, S. 32. Selma Drews, geb. Schönfeld, geb. 4.1.1898, Flucht in den Tod am 2.1.1942 18 Bendixensweg 15 Die Tochter von Johann und Serine Schönfeld wuchs mit ihren fünf Schwestern, Katharina, Melanie, Frieda, Bertha und Therese, in Winterhude auf. Ihre Mutter verstarb schon 1920 im Alter von fünfzig Jahren. Ende der zwanziger Jahre lernte Selma Schönfeld ihren späteren Ehemann Richard kennen. Dieser war zuvor mit einer anderen Frau verheiratet gewesen, die jedoch kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes Claus-Heinz 1926 verstarb. Drei Jahre später heirateten Selma Schönfeld und Richard Drews am 28. März 1929 und zogen gemeinsam mit Claus-Heinz nach Barmbek. Der Bendixensweg in den 1930er Jahren Geschichtswerkstatt Barmbek 90 046-091 Biografien A-D:. 30.08.10 22:10 Seite 91 Anders als ihr Ehemann war Selma Drews Jüdin und litt unter der Bedrohung durch die Nationalsozialisten. Aufgrund der psychischen Belastung bekam sie Ischias und ein Nervenleiden, weswegen sie sich im September 1941 zur Behandlung in die Nervenabteilung des Krankenhauses Eppendorf begab. Acht Wochen später verließ sie freiwillig die Klinik, doch schon im Dezember ließ ihr Mann sie wieder einweisen. Diesmal bekam sie jedoch keinen Platz mehr in Eppendorf und wurde stattdessen ins Hilfskrankenhaus am Kaiser-FriedrichUfer verlegt. Nach nur acht Tagen Behandlung kehrte sie auf eigenen Wunsch nach Hause zurück. Die Aufforderung vom Arbeitsamt Sägerplatz, die am 30. Dezember bei den Drews eintraf, versetzte Selma in Angst. In dem Schreiben wurde sie aufgefordert, sich am 5. Januar zwischen acht und neun Uhr beim Arbeitsamt einzufinden, zwecks einer Arbeitszuteilung. Faktisch bedeutete dies, dass Selma Drews Zwangsarbeit leisten sollte. Ihr Mann bemühte sich, sie zu beruhigen, indem er ihr versicherte, sie werde aufgrund ihrer Krankheit nicht zur Arbeit eingeteilt. Doch das gute Zureden nützte nichts. Immer wieder ließ Selma verlauten, dass es sich nicht mehr zu leben lohne. Am 2. Januar verließ Richard Drews die gemeinsame Wohnung gegen 7 Uhr früh, um zu seiner Arbeit bei Emil Fenzelmann in der Alsterkrugchaussee 550 zu gehen. Claus-Heinz blieb bei seiner Stiefmutter, bis diese ihn um 11 Uhr zu ihrem kranken Bekannten Meyer schickte. Als Claus-Heinz gegen 16 Uhr nach Hause kam und nach Selma Drews rief, antwortete diese ihm nicht. Daraufhin durch- Karteikarte der Reichsvereinigung der Juden ITS suchte er die Wohnung, bis er schließlich vor dem verschlossenen Wohnzimmer stehen blieb. Die Tür ließ sich nur einen Spalt öffnen, doch Claus-Heinz konnte erkennen, dass Selma Drews sich mit einer Wäscheleine an der Türangel erhängt hatte. Sofort lief er ins Treppenhaus, um Hilfe zu holen. Zwei Nachbarn halfen ihm, seine Mutter loszumachen. Kurz darauf erschienen auch die Polizei und ein Krankentransport. Noch lebte Selma Drews, doch auf dem Weg ins Krankenhaus Barmbek verstarb sie und wurde in die Leichenhalle des Hafenkrankenhauses überführt. Von ihren fünf Schwestern überlebten nur zwei den Holocaust. Katharina starb in Theresienstadt, Melanie in Minsk und Bertha an einem unbekannten Deportationsort. Quellen: 1; 4; 5; StaHH 331-5, Polizeibehörde – Unnatürliche Sterbefälle, Akte 1942 79/42 Drews, geb. Schönfeld, Selma. 91 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 92 Else Blum, geb. Eisenstein, geb. 28.4.1910, am 8.11.1941 nach Minsk deportiert Karl Blum, geb. 27.11.1907, am 18.11.1941 nach Minsk deportiert Ruth Eisenstein, geb. 16.1.1931, am 8.11.1941 nach Minsk deportiert 19 Heitmannstraße 68 Else Eisenstein kam als Tochter des Zimmermanns Gustav Eisenstein und seiner Ehefrau Emmi, geb. Meyer, in Dortmund zur Welt. Das Ehepaar Eisenstein hatte noch zwei weitere Kinder, Hildegard und Günther. Nach dem Besuch der Volksschule machte Else eine Lehre zur Schneiderin. 1930 verließ Else Eisenstein ihre Heimatstadt, um nach Göttingen zu ziehen. Am 16. Januar 1931 kam hier ihre erste Tochter Ruth zur Welt. Der Vater des Kindes ist nicht bekannt. Mutter und Tochter verschlug es von Göttingen nach Hamburg, wo sie ab 1934 offiziell gemeldet waren. Ihre erste Adresse war am Steindamm 12. In Hamburg fand Else zunächst eine Anstellung als Schneiderin und arbeitete später als Hausangestellte. Hier traf Else Eisenstein den Arbeiter Erwin Albert Carl Uterhardt. Die beiden verliebten sich und heirateten am 20. Juli 1935 standesamtlich. Erwin Uterhardt war evangelisch. Die Familie musste oft umziehen. So lebte sie anfangs in der Heimhuderstraße 27, dann in der Hammer Landstraße 17, in der Isestraße, der Angerstraße und ab dem 25. Oktober 1939 in der Heitmannstraße 68, ihrer letzten Adresse in Hamburg. Ruth Eisenstein wurde 1937 in die Mädchenvolksschule in der Angerstraße 33 eingeschult und musste zwei Jahre später zur Jüdischen Mädchenschule wechseln. Erwin und Else hatten auch gemeinsame Kinder, ihre Tochter Edith Ilse kam am 15. März 1937 zur Welt und die zweite Tochter Alice wurde am 13. September 1940 geboren. Seit 1938 war Else Uterhardt arbeitslos und die finanzielle Situation der Familie dementsprechend schwierig. Die Ehe von Erwin und Else scheiterte und wurde am 21. Februar 1941 geschieden. Das Sorgerecht für beide Kinder erhielt Erwin Uterhardt. Edith verbrachte einen Teil ihrer Kindheit und Jugend in Kinderheimen. Alice lebte bis zu ihrer Heirat 1966 in einer Hamburger Pflegefamilie. Am 27. Juni 1941 heiratete Else den jüdischen Bauhilfsarbeiter Karl Blum und zog mit ihm zusammen. Trauzeugen waren Siegfried Rosenblum und Max Piltz. Karl Blum stammte aus Ruth Eisenstein mit ihrer kleinen Schwester Edith Privatbesitz 92 Idstein in Hessen und war der Sohn des Ehepaares Jonas und Zerline Blum, geb. Goldschmidt. 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 93 Else Blums letzte Arbeitsstelle war die Jute-Fabrik Stein in Bahrenfeld, wo sie Säcke nähte. Am 8. November 1941 wurden Else und Ruth Eisenstein ins Getto nach Minsk deportiert. Karl Blum folgte ihnen zehn Tage später am 18. November. Keiner von ihnen kehrte zurück. Auf dem Transport von Hamburg nach Minsk am 8. November 1941 befanden sich auch die Trauzeugen von Karl und Else Blum. Sowohl Siegfried Rosenblum als auch Max Piltz gelten seither als verschollen. Elses Eltern Gustav und Emmy Eisenstein kamen ebenfalls im Holocaust um. Sie wurden am 27. Januar 1942 von Dortmund ins Getto nach Riga deportiert. Erwin und Elses gemeinsame Töchter Edith und Alice überlebten den Holocaust. Quellen: 1; 4; 5; 8; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 26.04.10 Blum, Else; StaHH 362-3, Mädchenschule Angerstraße, 1 Schulstatistik; StaHH 741-4, Fotoarchiv, Sa 1246; ITS/ARCH/Transportlisten Gestapo/ 11197706#1 (1.2.1.1/0001-0060/0017A/0041); ITS / ARCH / Transportlisten Gestapo (Hamburg)/ 11198264#1 (1.2.1.1/0001-0060/0017G/0102). Maier David Freschel, geb. 28.5.1888, am 28.10.1938 nach Bentschen (Zbaszyn), Polen, ausgewiesen, später verschollen Henny Freschel, geb. Urich, geb. 20.3.1889, am 25.10.1941 nach Lodz deportiert Heinz Leon Freschel, geb. 13.1.1918, am 28.10.1938 nach Bentschen (Zbaszyn), Polen, ausgewiesen, später verschollen 20 Hamburger Straße 164 Der Kürschner Maier David Freschel, genannt Max, wuchs in dem kleinen Städtchen Przemysl im äußersten Südosten Polens an der Grenze zur Ukraine auf. Seine Eltern Leon (Leib) und Schajndel Freschel (auch als Freschl oder Fröschel notiert) hatten noch vier weitere Kinder: Adolf, Eva, Heinrich und Michael. Bis auf den jüngsten Bruder Adolf und die Mutter Schajndel wanderte die gesamte Familie nach Hamburg aus. Max Freschel heiratete die gebürtige Hamburgerin Henny Urich, welche die Tochter von David und Anita, geb. Italiener, war. Henny hatte noch zwei Brüder. Hermann kam im Jahr 1887 zur Welt, Jacob 1892. In Hamburg baute sich Max Freschel sein eigenes Geschäft auf, die Textilfirma Max Freschel. Der gelernte Kürschner fertigte hier meist für Hamburger Damen Pelzmäntel und andere Accessoires aus Tierfell an. Auch Max’ Bruder Michael war gelernter Kürschner und betrieb am Schulterblatt 41 ein Pelzwarengeschäft. Max und Henny wurden 1918 das erste und einzige Mal Eltern. Ihr Sohn wurde am 13. Januar geboren und erhielt den Namen Heinz Leon, benannt nach seinem Großvater Leon Freschel. Die Familie lebte gemeinsam in einer Wohnung in der Hamburger Straße 164, wo sich auch die eigene Firma gefand. Im Oktober 1924 wurde Heinz Leon in die Talmud Tora Schule eingeschult und verbrachte dort seine gesamte Schulzeit bis zum Abschluss. In den dreißiger Jahren musste Familie Freschel in die Heinrich-Barth-Straße 11 umziehen. Dies war ihre letzte gemeinsame Adresse in Hamburg vor ihrer Abschiebung nach Polen am 28. Oktober 1938. Sie gehörte zu den insgesamt 17 000 während der sogenannten Polenaktion aus Deutschland abgeschobenen Juden. 93 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 94 Kultussteuerkarteikarte von Max Freschel StaHH Am 31. März 1938 verabschiedete die polnische Regierung ein Gesetz, welches vorsah, allen polnischen Staatsbürgern, die länger als fünf Jahre ununterbrochen im Ausland lebten, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Um einer Massenausweisung aus dem Deutschen Reich zuvorzukommen, forderte die polnische Regierung ihre Staatsbürger im Ausland auf, sich bei ihrem zuständigen Konsulat zu melden, um sich ihren Pass mit einem Kontrollvermerk versehen zu lassen. Ansonsten wäre der Pass zum 30. Oktober 1938 ausgelaufen und der Besitzer staatenlos geworden. Familie Freschel ließ keinen derartigen Kontrollvermerk in ihren Pass aufnehmen, da Henny im Deutschen Reich geboren war und auch Max sich als Deutscher fühlte. Als dieser Erlass über die deutsche Botschaft in Warschau auch in Berlin bekannt wurde, erhielten kurz darauf tausende polnischer Juden im Deutschen Reich einen Ausweisungsbefehl. Zwischen dem 27. und dem 29. Oktober 1938 wurden sie zu Fuß oder in einem Sammeltransport über die deutsche Grenze nach Polen geschickt. Familie Freschel ereilte dieses Schicksal am 28. Oktober. Mit ihnen wurden auch Max’ ältester Bruder Heinrich Freschl mit seinen Söhnen Kurt, Erwin und Herbert sowie der Ehemann der Schwester Eva, Leon Kitz, aus dem Deutschen Reich abgeschoben. Die Familie wurde zusammen mit ca. 4800 anderen polnischstämmigen Juden zum Grenzort Bentschen (Zbaszyn) getrieben. Dort herrschten chaotische Zustände, die Menschen irrten im Niemandsland umher, drängten sich auf dem Bahngelände, hausten im Stationsgebäude oder auf einem der nahegelegenen Plätze in Bentschen. Die polnischen Grenzbeamten waren völlig überfordert und wussten nicht, was sie mit den vielen Menschen anfangen sollten. Waren in Polen Verwandte vorhanden, durften einzelne Personen ins Landesinnere einreisen. 94 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 95 Familie Freschel gehörte dazu, weil Max Freschels Eltern noch immer in seinem Heimatort Przemysl wohnten. Ob Familie Freschel wirklich nach Przemysl reiste und dort zusammen wohnte, lässt sich nicht mehr feststellen. Bis zum deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 lebten Max und Heinz Leon Freschel definitiv in Polen. Henny Freschel wurde hingegen im Juni 1939 aus Polen ausgewiesen und ins Deutsche Reich abgeschoben. Mit einer Einreisegenehmigung für sechs Wochen kehrte Henny Freschel nach Hamburg zurück, offiziell galt sie jetzt als staatenlos. Bei ihrer Mutter Anita Urich konnte sie in der Bundesstraße 35 unterkommen. In den folgenden Wochen bemühte sich Henny Freschel um eine Auswanderung nach Polen. Zudem erhoffte sie sich, ihren Hausrat, den die Familie hatte zurücklassen müssen, nach Polen überführen zu können. Bevor die Familie 1938 abgeschoben worden war, hatte sie ihren Hausrat bei der Spedition Brasch & Rothenstein unterbringen können. Außerdem existierte noch ein Schließfach bei der Deutschen Bank, Filiale Hamburg, in dem Schmuck aufbewahrt war. Diese Gegenstände sollten nun mit nach Polen genommen werden. Doch Henny Freschel gelang es nicht, sich gegen die Bürokratie durchzusetzen und langsam lief ihr die Zeit davon. Ihr deutsches Visum musste verlängert werden und am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Nun musste Henny Freschel erfahren, dass sie nicht mehr zu Mann und Sohn gelangen konnte. Im Oktober 1939 ließ die Deutsche Bank den Schließfachinhalt verkaufen. Der Erlös in Höhe von 1080 RM wurde auf ein Auswandererkonto eingezahlt, auf das Henny Freschel keinen Zugriff hatte. Die Devisenstelle genehmigte ihr lediglich eine monatliche Summe von 80 RM. Henny Freschel musste in eine kleine Wohnung in der Bornstraße 8 umziehen, von wo aus sie am 25. Oktober 1941 ins Getto nach Lodz deportiert wurde. Seit diesem Zeitpunkt gilt sie als verschollen. Max und Heinz Leon Freschel gelten als an einem unbekannten Deportationsort umgekommen. Sollten sie sich zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in der Stadt Przemysl aufgehalten haben, kamen sie wahrscheinlich beim Massaker an der jüdischen Bevölkerung am 16. September 1939 ums Leben, welches durch deutsche Einsatzgruppen verübt wurde. Max‘ Brüder Heinrich und Michel wurden nach Auschwitz deportiert und kamen dort ums Leben. Heinrich wurde am 23. Mai 1942 ermordet und Michel starb am 16. Januar 1943. Hennys Mutter Anita wurde am 15. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert und starb dort am 18. Dezember desselben Jahres. Quellen: 1; 2; 4; 5; 8; StaHH 314-15, OFP, F 592; StaHH 314-15, OFP, R 1939/2932; StaHH 621/86, Firmenarchiv, 21; StaHH 741-4, Fotoarchiv, Sa 1244; Jungbluth/ Ohl-Hinz: Stolpersteine in Hamburg-St. Pauli, S. 92 ff. Das Haus in der Hamburger Straße 164 nach der Bombardierung Geschichtswerkstatt Barmbek 95 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 96 Kurt Albin Friedrich, geb. 30.5.1903, am 13.8.1944 im Konzentrationslager Fuhlsbüttel gestorben 21 Höltystraße 15 Der Kommunist Kurt Albin Friedrich wurde in Hildburghausen im Süden Thüringens geboren. Nach dem Ende seiner Schulzeit begann Kurt Friedrich ein Studium der Volkswirtschaft, welches er auch abschloss. In Hamburg fand Kurt Friedrich eine Arbeit als kaufmännischer Angestellter bei der Firma I. G. Farben. Mit seiner Ehefrau Gerda lebte er in der Höltystraße 15, das Ehepaar hatte keine Kinder. Aufgrund seiner Zugehörigkeit zur KPD wurde Kurt Friedrich mehrmals nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verhaftet. Seine Ehefrau und er betäWohnhaus von Kurt Friedrich in der Höltystraße 15, 2009 Privatbesitz tigten sich im illegalen kommunistischen Widerstand. So erinnerte sich seine Ehefrau Gerda später: „Im Winter 1943/44 bat mein Mann mich einige Male, Silbergeld und Kleidungsstücke zu beschaffen. Es sollte für Genossen sein, die 1943 nach der Katastrophe nicht ins Gefängnis zurückgegangen waren und seither illegal lebten.“ Kurt Friedrich gehörte der engeren Leitung der illegalen „Bästlein-Jacob-Abshagen“-Widerstandsorganisation an. Friedrich war im sogenannten I-Apparat tätig, einem Informationsdienst, durch den NS-kritische Informationen an Wehrmachtsangehörige weitergegeben wurden. Am 13. Juni 1944 wurde Kurt Friedrich von der Gestapo wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ verhaftet und im Konzentrationslager Fuhlsbüttel inhaftiert. Zwei Monate später, am 13. August 1944, starb Kurt Friedrich im Konzentrationslager an den Folgen von Folterungen. Quellen: StaHH 213-9, Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht, Js 13/45; Diercks: Gedenkbuch „KOLA-FU“, S. 21; Hochmuth/Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand, S. 357, S. 371, S. 385; VVN, Hinter bliebenenkartei; VVN, Unsere Toten; Totenliste Hamburger Widerstandskämpfer und Verfolgter 1933–1945. Else Amalie Geiershoefer, geb. Kann, geb. 9.11.1879, am 25.10.1941 nach Lodz deportiert und dort am 22.10.1942 gestorben 22 Immenhof 10 (Pastorat der St. Gertrud Kirche) Else Amalie Kann wurde als Tochter des jüdischen Ehepaares Mayer und Pauline Kann, geb. Dreyfuss, in Nürnberg geboren. Ihr Vater war Kaufmann und handelte mit Textilien. Am 10. Juni 1902 heiratete Else Kann den ebenfalls in Nürnberg geborenen Unternehmer Otto Geiershoefer. Dieser stammte zwar auch aus einer jüdischen Familie, war jedoch bereits 96 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 97 vor der Hochzeit zum evangelisch-lutherischen Glauben übergetreten. Seine Frau Else konvertierte erst am 28. Juni 1936, als sie schon verwitwet war, bei einem Besuch in Meran. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, Erik Ludwig kam am 24. Mai 1903 zur Welt und Herbert Theodor folgte am 20. Januar 1906. Beide Kinder wurden getauft und wuchsen mit dem christlichen Glauben auf. Im Jahre 1894 hatte die Familie Geiershoefer die Firma Jacob Gilardi erworben, die ihren Sitz in Allersberg bei Nürnberg hatte. Unter der Leitung von Otto Geiershoefer, der die Firma 1904 von seinem Bruder Anton als Alleineigentümer übernahm, wurde in erster Linie Christbaumschmuck aus leonischen Drähten (versilberte, vermessingte oder vergoldete dünne Drähte) hergestellt. Die Familie Geiershoefer wohnte im an Else Geiershoefer die Fabrikgebäude angebauten barocken Gilardihaus. Die Firma Gilardi war nicht nur der größte Arbeitgeber in Allersberg, die Geiershoefers engagierten sich auch sozial. So ließen sie der Gemeinde Allersberg unter anderem Stiftungsgelder zukommen: 5000 Mark im Jahr 1918 für bedürftige Kriegsinvaliden und 3000 Mark im Jahr 1927 für bedürftige ältere Männer und Frauen, die früher bei der Firma Gilardi beschäftigt gewesen waren. Die Geiershoefers stifteten auch die Glocken für die 1933 erbaute evangelisch-lutherische Kirche in Allersberg. Als Otto Geiershoefer am 11. März 1936 starb, ging die Firma in den Besitz seiner Witwe Else und deren Söhne über; der älteste Sohn Erik wurde Geschäftsführer. Im Juli 1938 besuchte Else einige Wochen ihren Bruder Charles in New York, kehrte aber trotz der Verhältnisse in Deutschland nach Allersberg zurück. Am 10. November 1938 wurden Else und ihr Sohn Erik verhaftet. Else kam acht Tage in „Schutzhaft“. In dieser Zeit wurden von den Geiershoefern Vollmachten erpresst, mit denen die Kreisleitung der NSDAP die Firma Gilardi an den Weissenburger Nationalsozialisten Hermann Gutmann verkaufte. Das Gilardihaus, in dem die verwitwete Else weiterhin wohnte, wurde vorher von der Kreisleitung fast komplett geplündert. Nach der Haftentlassung zog Else sofort Else und Otto Geierhoefer in Marienbad in den 1930er Jahren Sammlung Familie Geiershoefer/Schulenburg (2) von Allersberg nach Hamburg. Hier fand sie in der HeinrichBarth-Straße 6 eine neue Unterkunft, wie Erik Geiershoefer 1939 berichtete: „Obwohl in Hamburg wie in fast allen übrigen Orten für Juden keine Zuzugsgenehmigung erteilt wurde, gelang es meinem Bruder, diese für Mutter zu erhalten. Einer der maßgebenden Polizeibeamten war zufällig ein alter Bekannter von ihm. Auch gelang es ihm seine bis97 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 98 herige Wohnung – er hatte dieselbe bereits gekündigt, da er im Laufe des Dezembers nach Basrah, Irac [sic] auswandern wollte – für Mutter zu erhalten.“ Bereits in Nürnberg wurden Teile des Vermögens der Familie Geiershoefer beschlagnahmt. So musste Else zum Beispiel für die Reichsfluchtsteuer ihrer Söhne aufkommen. Trotzdem blieb ihr, als sie nach Hamburg zog, ein Eigenkapital von rund 122 000 RM. Dies änderte sich mit der Sicherungsanordnung, welche gegen sie im Dezember 1938 erging. Von nun an durfte sie nicht mehr frei über ihr eigenes Vermögen verfügen, weil sie Jüdin war. Ihr Konto wurde eingefroren, und sie erhielt monatlich einen Freibetrag von lediglich 350 RM. Mit dieser Einschränkung konnte Else Geiershoefer kaum umgehen. Sie musste ihren Haushalt neu bestücken und war es schlichtweg nicht gewohnt, so wenig Geld zur Verfügung zu haben. Ein weiteres Problem für Else Geiershoefer waren fehlende Bekannte und Freunde in Hamburg, die sie hätten unterstützen können. In keinem Geschäft bekam sie Kredit. Deswegen musste sie fast jeden Monat bei der Hamburger Devisenstelle um weitere Geldmittel bitten. Schließlich verbot die Devisenstelle Else Geiershoefer im Mai 1940, nachträglich Rech- Letztes Lebenszeichen von Else Geiershoefer: Brief aus dem Getto Lodz USHMM 98 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 99 nungen einzureichen. Stattdessen sollte sie bereits zum Monatsbeginn all ihre zusätzlichen Ausgaben anführen, was ihr fast unmöglich erschien. Als Erik Geiershoefer mit seiner Frau Magda und der gemeinsamen Tochter Susanne im April 1939 nach England auswanderte, überlegte auch Else zu emigrieren. Dafür hinterlegte sie ihre Wertsachen in einem Depot bei der Deutschen Bank. Der Juwelier Otto Hilcken aus der Spitalerstraße schätzte den Wert des Depotinhalts auf 2000 RM. Aufgrund der Sicherungsanordnung durfte sie auch über die Gegenstände im Depot nicht mehr frei verfügen. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges schwanden für Else Geiershoefer alle Hoffnungen auf eine Auswanderung. Etwas Halt fand sie während dieser schweren Zeit in der Gemeinde St. Gertrud in Uhlenhorst und bei dem dortigen Pastor Walter Uhsadel. Zudem erhielt sie wohl auch ein kleines Zusatzeinkommen durch ihre Arbeit im Gemeindebüro. Pastor Uhsadel erinnerte sich nach Kriegsende an Else Geiershoefer: „Die schmerzlichsten Erinnerungen verbinden mich mit Frau Else Geiershoefer, die ihres großen Vermögens beraubt worden war und nun unter Aufsicht der Gestapo ein kärgliches Leben führte. Sie war fast täglich in meinem Hause, um mir Schreibarbeit und anderes abzunehmen. Ihr einziger Trost war die regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst und am Heiligen Abendmahl. An einem Mittwoch im Herbst 1941 schickte sie mir die Schreckensnachricht, dass sie am Freitag unter Zurücklassung ihrer bescheidenen Habe auf einem Sammelplatz zum Abtransport erscheinen müsse. Ich war am Mittwochnachmittag bei ihr, um die Verzweifelte zu trösten, und nahm mich ihrer auch fast den ganzen Donnerstag an. Am Freitagmorgen um 7 Uhr kam sie zum letzten Male in mein Haus. Ich hatte eine kleine Schar von Gemeindegliedern eingeladen, und wir hielten mit ihr das Heilige Abendmahl. Unter unserer Fürbitte trat sie in festem Glauben den schweren Weg an. Ein paar Zettelchen mit Dankesworten aus dem Güterzug, mit dem sie abtransportiert wurde, waren das letzte Lebenszeichen. Kurz vor Ostern 1942 muss sie in Polen mit vielen Tausenden von Leidensgefährten ermordet worden sein.“ Am 25. Oktober 1941 wurde Else Geiershoefer mit einem Transport in das Getto Lodz deportiert. Dort wohnte sie in der Steinmetzstraße 21, Wohnung 2. Eigentlich sollte Else Geiershoefer am 7. Mai 1942 nach Chelmno „ausgesiedelt“ werden, was ihren sicheren Tod in einem Gaswagen bedeutet hätte. Doch aufgrund eines Oberschenkelhalsbruches, den sie sich im Getto zugezogen hatte, wurde sie vom Transport zurückgestellt. Else Geiershoefer starb am 22. Oktober 1942 im Getto Lodz. Vor der Heinrich-Barth-Straße 6 erinnert ein Stolperstein an sie. Erik Geiershoefer kehrte nach Kriegsende im Jahr 1946 mit seiner Familie nach Allersberg zurück und begann mit dem Wiederaufbau der Firma Jacob Gilardi und der teilweise schwer zerstörten Gebäude. Herbert Geiershoefer und dessen Frau Rita verbrachten den Krieg im Ausland und lebten später in Uganda. Quellen: 1; 2; 4; 5, 8; StaHH 314-15, OFP, F 664; StaHH 314-15, OFP, FVg 2306; StaHH 314-15, OFP, FVg 2307; StaHH 314-15, OFP, R 1938/3551; Uhsadel: Persönliche Erinnerungen an St. Gertrud 1928–1943; USHMM, RG 15.083 301/1123; Dr. Alexander Schulenburg, Sammlung Familie Geiershoefer/Schulenburg (England). 99 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 100 Max August Grote, geb. 12.4.1882, am 21.10.1940 im Strafgefängnis Wolfenbüttel an den Folgen der Haft gestorben 23 Von-Essen-Straße 53 Nach bestandener Reifeprüfung erlernte Max Grote das Konditorenhandwerk und legte auch eine Meisterprüfung ab. Im Jahr 1906 erfüllte er sich seinen Traum und baute eine Fabrik zur Herstellung von Biskuit- und Schokoladenerzeugnissen auf. Im selben Jahr heiratete Max Grote die 26-jährige Berta Westmeier, die aus Tüßling in Oberbayern stammte. Am 21. November 1909 kam Max und Bertas gemeinsame Tochter Hilde in Hamburg zur Welt. Kurz danach ereilte die Familie ein Unglück: bei einem Feuer brannte die Fabrik vollständig nieder. Für einen Wiederaufbau fehlten Max Grote die finanziellen Mittel. Eine neue Arbeitsstelle fand er ab 1910 als Werkmeister bei den Reichard-Kakao-Werken in Wandsbek, wo er rund 350 RM brutto verdiente. Max und Berta Grote traten 1912 den Zeugen Jehovas bei und waren seither „aktive Bibelforscher“. Ihr Glaube wurde für sie mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 zur Gefahr. Die Zeugen Jehovas, wie sich die Internationale Bibelforscher-Vereinigung seit 1931 offiziell nannte, wurden am 24. Juni 1933 als erste Glaubensgemeinschaft verboten. Der Grund dafür lag in ihrer Distanz zum nationalsozialistischen Staat. Sie verweigerten den Hitlergruß, weil nach ihrem Verständnis nur Gott „Heil“ zuzusprechen war. Zudem traten sie keiner nationalsozialistischen Vereinigung bei, ließen ihre Kinder nicht in die Hitlerjugend und leisteten keinen Kriegsdienst, wegen des biblischen Gebotes, nicht zu töten. Für die Nationalsozialisten waren die Zeugen Jehovas „Wegbereiter Max Grote bei einem Kongress der Zeugen Jehovas in BerlinWilmersdorf am 25. Juni 1933 Wachturm-Ges., Geschichtsarchiv des jüdischen Bolschewismus“ und sie kritisierten ihre „Fremdlenkung“ aus den USA. Einen Tag nach dem Verbot der Zeugen Jehovas fand als Reaktion auf diese Entwicklung in Berlin-Wilmersdorf eine Konferenz der Bibelforscher statt, an der auch Max Grote teilnahm. In der Folge der Konferenz bildeten sich in ganz Deutschland zahlreiche „illegale“ Bibelforschergruppen, die sich heimlich regelmäßig versammelten. Max Grote nahm in Hamburg eine herausragende Stellung ein, er war der Gesamtleiter der Stadtteilgruppen und betreute diese. Schnell wurde die Gestapo auf Familie Grote aufmerksam und verhaftete Max Grote erstmals am 28. Juni 1934. Einen Monat verbrachte er daraufhin im Untersuchungsgefängnis. Anfang Dezember 1934 griff die Gestapo erneut bei einem Treffen der Zeugen Jehovas zu. Einen Tag nach dem Treffen, am 7. Dezember, wurde Max Grote wieder verhaftet und muss100 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 101 te bis zum 11. Februar 1935 in Gestapohaft bleiben. Nach seiner Verurteilung wurde Max Grote vom 15. März bis zum 8. September 1935 im Gefängnis Bergedorf inhaftiert. Diesmal wurde auch Berta festgenommen und war insgesamt fünf Wochen in „Schutzhaft“ im Konzentrationslager Fuhlsbüttel. Während dieser Zeit trat bei ihr ein Magenleiden auf, welches sie für den Rest ihres Lebens begleiten sollte. Neben den zahlreichen Verhaftungen wurde die Familie Grote ständig von der Gestapo überwacht und ihre Wohnung in regelmäßigen Abständen durchsucht. Berta Grote erinnerte sich später an mindestens neun Durchsuchungen seit 1934. Besonders niederschmetternd war jedoch der Verlust ihrer kleinen Bibliothek mit 80 bis 100 Bänden, welche der Familie von der Gestapo weggenommen wurde. Unter den Wertgegenständen befanden sich auch zwei Bilder von Pastor Russèl und Richter Rutherford, den Begründern der Zeugen Jehovas. In den Jahren 1936 und 1937 beteiligte sich Max Grote an zwei Flugblattaktionen der Zeugen Jehovas, bei denen die Flugblätter „Resolution“ und „Offener Brief“ verteilt wurden. Zudem beteiligte er sich an der Taufe von vier Frauen und einem Mann im Jahr 1936 in Harburg. Daraufhin richtete die Gestapo ihr Augenmerk erneut auf Familie Grote. Am 11. September 1937 verhaftete die Gestapo Max Grote erneut. Wie die „Hamburger Nachrichten“ vom 13. April 1938 berichteten, wurden 39 Bibelforscher nach dreitägiger Verhandlung vom Sondergerichtshof Hamburg wegen „staatsfeindlicher Betätigung“ schuldig gesprochen. Unter ihnen befand sich auch Max Grote, der zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt wurde. Max Grote wurde zur Verbüßung seiner Strafe ins Gefängnis Wolfenbüttel eingeliefert. Seine Ehefrau Berta berichtete, ihr Mann sei dort von der SS mit Schlägen ins Gesicht misshandelt worden. Am 21. Oktober 1940 starb Max Grote in der Justizhaft im Strafgefängnis Wolfenbüttel im Alter von 58 Jahren an den Folgen der Haft. Quellen: Garbe: Zwischen Widerstand und Martyrium, S. 221 ff.; Gewehr: Stolpersteine in HamburgAltona, S. 25; „39 Bibelforscher verurteilt“ in: Hamburger Nachrichten vom 13.04.1938; StaHH 231-9, Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht, 11256/41, Bd. 1; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 4392. Karl Johann August Hacker, geb. 11.4.1906, am 23.11.1933 im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel ermordet 24 Weidestraße 125 Der Maschinenbauer Karl Hacker wurde in Hamburg geboren. Mit seiner Ehefrau Irmgard Enke hatte er einen gemeinsamen Sohn, Peter, welcher am 10. Juli 1931 in Hamburg zur Welt kam. Die Familie lebte in einer kleinen Wohnung in Barmbek in der Weidestraße 125. Das Eckhaus Weidestraße und Von-Axen-Straße in den 1930er Jahren Geschichtswerkstatt Barmbek 101 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 102 Schon in seiner Jugend war Karl Hacker politisch aktiv und trat dem Kommunistischen Jugendverband Deutschland (KJVD) bei. Als Erwachsener wurde er Mitglied der KPD und engagierte sich zudem im Arbeitersport, dem RS (Rotsport) „Fichte“. Kurz vor seiner Verhaftung wurde Karl Hacker zum Vorsitzenden des Barmbeker Kraftsportvereins gewählt. Während der Voruntersuchung zum Rotsport-Prozess „Walter Bohne und Genossen“ wurde Karl Hacker am 23. Oktober 1933 von der Gestapo verhaftet und ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel gebracht. Der Grund für die Verhaftung lautete auf „Vorbereitung zum Hochverrat“. Seine Ehefrau Irmgard Hacker erhielt am 23. November 1933 die Nachricht vom angeblichen Suizid ihres Ehemannes. Ein Familienangehöriger durfte die Leiche in Augenschein nehmen, entdeckte an ihr Würgemale und erstattete Mordanzeige. Das Verfahren wurde später ergebnislos eingestellt. Willi Gerlach, ein Freund Karl Hackers, berichtete über dessen Tod in Fuhlsbüttel: „Nach Abschluss der Vernehmung kam ich bis zum 31. Dezember 1933 ins KOLA-FU. Dort erlebte ich den Tod unseres Freundes Karl Hacker, der, als Funktionär des Hamburger Kraftsportvereins festgenommen, im November 1933 von der SA zu Tode gemartert und dann aufgehängt wurde. Ich sah ihn selbst in seiner Zelle hängen.“ Karl Hacker starb im Alter von 27 Jahren. Seine Familie hatte auch nach seinem Tod noch unter der Verfolgung und Bedrohung durch die Gestapo zu leiden. Quellen: StaHH 213-9, Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht, OIV 354/33; StaHH 332-5, Personenstandsunterlagen, 9867 und 191/1933; Diercks: Gedenkbuch „KOLA-FU“, S. 21; Hochmuth/Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand, S. 317, S. 322; VVN, Hinterbliebenenkartei; VVN, H9 Hacker, Peter; Totenliste Hamburger Widerstandskämpfer und Verfolgter 1933–1945. Wolff William Hagenow, geb. 21.11.1871, am 19.1.1944 nach Theresienstadt deportiert und dort am 16.4.1944 gestorben 25 Heinskamp 20 Nach dem Besuch des Gymnasiums und der Erlangung der Mittleren Reife begann Wolff Hagenow eine kaufmännische Lehre. Danach war er als selbstständiger Kaufmann in einem Textilhandel tätig, dessen Sitz in der Conventstraße 32 lag. Mit seiner ersten Ehefrau Helene, die ebenfalls jüdisch war, hatte Wolff Hagenow eine gemeinsame Tochter, Erna, die am 7. Januar 1903 zur Welt kam. Die Ehe hielt nicht lange und wurde letztendlich geschieden. In den Der Heinskamp in den 1930er Jahren Geschichtswerkstatt Barmbek 102 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 103 dreißiger Jahren wanderte Helene mit Erna nach New Jersey aus, wo sie auch nach Kriegsende blieb. Wolff Hagenows zweite Ehefrau war die 20 Jahre jüngere nichtjüdische Betty Adolphine Berta Dittmann aus Hamburg. Die Hochzeit fand am 16. Februar 1920 statt. Sechs Jahre später, am 1. Juli 1926, kam ihr Sohn Curt Siegmund zur Welt. Die Halbgeschwister Erna und Curt wussten bis kurz nach Ende des Krieges nichts voneinander. Den Textilhandel musste Wolff Hagenow aus finanziellen Gründen aufgeben und arbeitete kurzzeitig als Vertreter und schließlich als Lagerist bei der Firma Jacobsen in der Woltmannstraße 7–9, bis er 1929 arbeitslos wurde. Ab 1934 bezog Wolff Hagenow eine kleine Rente und die Familie musste in eine kleinere Wohnung im Heinskamp 20 umziehen. Nach der NS-Terminologie lebten Wolff und Betty Hagenow in „privilegierter Mischehe“, da sie „Arierin“ war und beide ein gemeinsames Kind hatten. Dadurch war Wolff Hagenow zunächst vor dem Zugriff der Nationalsozialisten geschützt. Dies änderte sich mit der Scheidung des Ehepaares am 29. Januar 1941. Wolff Hagenow musste aus der gemeinsamen Wohnung im Heinskamp ausziehen und zur Untermiete in der Weidestraße 6 wohnen. Von seiner kleinen Rente, die monatlich 64,40 RM betrug, zahlte er 10,50 RM an Alimenten. Curt Hagenow, nach der NS-Terminologie ein „Mischling ersten Grades“, wurde 1939 kurz vor Beginn des Krieges aufgrund des „Dienstpflichtgesetzes“ aufgefordert, dem Jungvolk beizutreten. Zwei Jahre später kam er zur Hitlerjugend, die jüdische Herkunft seines Vaters schien dabei nicht aufzufallen. Im Sommer 1943 wurden Betty Hagenow und ihr Sohn ausgebombt und zogen in das Jugendwohnheim der Hitlerjugend an der Elbchaussee 88/90. Kurz darauf wur- Karteikarte von Wolff Hagenow aus dem Getto Theresienstadt ITS de seine jüdische Herkunft aber doch noch bekannt und Betty und Curt mussten das Wohnheim verlassen. Wolff Hagenow wurde am 19. Januar 1944 aus seiner letzten Wohnung in der Rappstraße 15 ins Getto Theresienstadt deportiert. Dort traf er seine Schwester Ida, die bereits am 20. Juli 1942 dorthin deportiert worden war. Wolff Hagenow starb am 16. April 1944 im Getto, seine Schwester Ida folgte ihm am 15. Mai 1944. Quellen: 1; 4, 5; 7; 8; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 12.03.91 Hagenow, Betty; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 01.07.26 Hagenow, Curt; ITS/ARCH/Kartei Getto Theresienstadt/5039313#1 (1.1.42.2/THERES37/1177); ITS/ARCH/Transportlisten Gestapo, zum Getto Theresienstadt/11197641#1 (1.2.1.1/00010060/0017/0148); ITS/ARCH/Transportlisten Gestapo, Hamburg/11198449#1 (1.2.1.1/0001-0060/ 0017G/0287). 103 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 104 John Hasenberg, geb. 8.10.1892, aus den Niederlande am 16.2.1944 in das Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert; gestorben an den Folgen seiner Inhaftierung am 23.1.1945 26 Schwanenwik 29 John Hasenberg wurde als eines von sieben Kindern des jüdischen Ehepaares Julius und Henny Hasenberg, geb. Lippstadt, in Neumünster geboren. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Familie nach Elmshorn gezogen, wo Julius Hasenberg in der Kirchenstraße 40 eine Immobilienfirma betrieb. Von 1902 bis 1909 besuchte John Hasenberg die Bismarckschule und beendete diese mit dem Abschluss eines Realgymnasiums. Im Ersten Weltkrieg war er Soldat und erhielt für seine Verdienste das Eiserne Kreuz II. Klasse. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges blieb John Hasenberg nicht mehr lange in Elmshorn. Er zog nach Hamburg, wo er zuerst in der Hammer Straße 27 und dann am Schwanenwik 29 wohnte. In der Bank von Willi Seligmann am Gänsemarkt 35 fand er eine Anstellung als Kaufmann. 1927 verließ John Hasenberg Hamburg, um nach Berlin zu gehen. Dort heiratete er die elf Jahre jüngere Gertrud Meyer und bekam zwei Kinder mit ihr. Sein Sohn wurde 1928 geboren und seine Tochter Irene kam 1930 zur Welt. Zehn Jahre nach seiner Ankunft in Berlin erhielt John Hasenberg die Chance, Deutschland zu verlassen. Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft wurde das Leben für Familie Hasenberg in Deutschland immer schwieriger und bedrohlicher. Die Firma American Express bot ihrem Mitarbeiter John Hasenberg nun die Möglichkeit, diesem Land zu entkommen. Er bekam die Option entweder in Curaçao oder in den Niederlanden zu John Hasenberg Yad Vashem arbeiten. Die Familie entschied sich für die Niederlande und zog 1937 nach Amsterdam. Als die deutsche Wehrmacht 1940 auch in den Niederlanden einmarschierte, begann die Verfolgung für die jüdischen Menschen erneut. Weil Familie Hasenberg eine Straßenbahn benutzte, wurde sie inhaftiert und nur durch Glück kurze Zeit später wieder freigelassen. Die Firma American Express durfte keine jüdischen Mitarbeiter mehr beschäftigen und musste somit auch John Hasenberg entlassen. Kurz darauf begann er beim Joodse raad, einem von den Nationalsozialisten eingerichteten Judenrat, zu arbeiten. Eine seiner Aufgaben bestand darin, den durch Razzien deportierten Juden ihr Gepäck in die Durchgangslager nachzusenden. Er hoffte darauf, dass er durch seine Arbeit den deportierten jüdischen Menschen noch irgendwie helfen konnte. 104 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 105 Am 23. Juni 1943 durchkämmte die SS das Stadtviertel, in dem Familie Hasenberg lebte. Gegen 10 Uhr klopften sie bei ihnen an der Wohnungstür. Die Familie durfte noch etwas Gepäck und Proviant mitnehmen, wurde dann mit anderen jüdischen Menschen zur Sammelstelle getrieben und in Güterwaggons gepfercht. Der Zug fuhr zum Durchgangslager Westerbork, wo Familie Hasenberg die nächsten acht Monate verbrachte. Noch in Amsterdam hatte John Hasenberg durch einen Freund von einem Schweden erfahren, der gefälschte Papiere besorgen konnte. Auf Johns schriftliche Anfrage erhielt die Familie Hasenberg vier ecuadorianische Pässe. Wie die gefälschten Ausweise die Familie überhaupt erreichen konnten, ist ungeklärt. Fest steht, dass die Pässe ihr enorm halfen. Eigentlich sollte die Familie nach Auschwitz deportiert werden, doch da sie nun keine deutschen Staatsbürger mehr waren, wurden sie von der Liste gestrichen. Am 16. Februar 1944 wurde die gesamte Familie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert. Dort herrschten furchtbarere Zustände als im Durchgangslager Westerbork. Die Menschen litten an Mangelernährung, mussten hart arbeiten und erduldeten Prügelstrafen. Dies alles schwächte auch Familie Hasenberg sehr. Anfang 1945 hatte die Familie plötzlich Glück. Bei einem Gefangenenaustausch zwischen Amerikanern und Deutschen gab es auf deutscher Seite zu wenige amerikanische Soldaten, sodass sie auf ausländische Gefangene zurückgreifen musste. Die ecuadorianischen Pässe halfen der Familie Hasenberg erneut, sie gehörte zu den Gefangenen, die freikamen. Mit einem Zug wurde sie in die Schweiz gebracht. John Hasenberg war durch die letzten Prügelstrafen jedoch so schwer verletzt, dass er auf der Zugfahrt am 23. Januar 1945 in der Nähe von Laubheim verstarb. Seine Familie erreichte die sichere Schweiz und emigrierte später in die USA. Auch in Elmshorn wurde für John Hasenberg ein Stolperstein in der Kirchenstraße 40 verlegt. Quellen: 1; 4; 5; 8; ITS/ATCH/Durchgangslager Westerbork/5146036#1 (1.1.46.1/0009/0142); ITS/ ARCH/Konzentrationslager Bergen Belsen/3394120#1 (1.1.3.1/0006/0029); ITS/ARCH/Verschieden Konzentrationslager/5165765#1 (1.1.47.1/0001-0181/0062/0001); „Aktion Stolpersteine: Die Serie. Doppelt so viele Elmshorner Juden ermordet wie bisher angenommen“, in: Elmshorner Nachrichten vom 5.4.2008; Stolpersteine in Elmshorn: http://www.stolpersteine-elmshorn.de/themen/juden/hasenberg/hasen berg.htm, Zugriff am 25.6.2009. Theodor Haubach, geb. 15.9.1896, hingerichtet in Berlin-Plötzensee am 23.1.1945 27 Hartwicusstraße 2 Theodor Haubachs Vater, ein Großkaufmann, verstarb ein Jahr nach der Geburt seines Sohnes. Deswegen zog seine Mutter, die Jüdin war, mit ihm von Frankfurt am Main nach Darmstadt in die Kiesstraße. Ein Vormund ermöglichte ihm den Besuch eines Gymnasiums. Seit 1906 besuchte Theodor Haubach daraufhin das Ludwig-Georg-Gymnasium in Darmstadt, wo er Carlo Mierendorff kennenlernte, mit dem er sein Leben lang eng befreundet bleiben sollte. 105 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 106 Als einer der letzten seiner Altersklasse besuchte Theodor Haubach noch zwölf Jahre lang die Schule, bis zum Jahr 1914, als er sein Notabitur machte. Danach meldete er sich freiwillig zum Kriegsdienst. 1918 wurde er zum Leutnant befördert. Allerdings wurde er während des Krieges einige Male verwundet und erlitt vor Kriegsende noch eine schwere Verletzung. Durch einen Schulterschuss gerieten Uniformstücke in seine Wunde, die durch eine Operation entfernt werden mussten. Im Zusammenhang mit dieser Verwundung entstanden auch die markanten Narben an seinem Kinn, die auf Schnittwunden zurückzuführen waren. Nach Kriegsende kehrte er zunächst nach Darmstadt zurück. Das Ende des Ersten Weltkrieges stellte für Theodor Haubach den Zusammenbruch einer alten Epoche und zeitgleich den Beginn einer neuen deutschen und europäischen Ära dar. Deswegen wuchs sein Interesse für die Politik, insbesondere für die Sozialdemokratie. In Darmstadt wurde er 1920 Kommandant der Abwehrkräfte gegen den sogenannten KappPutsch. Zudem studierte er seit 1919 in Heidelberg Philosophie, Soziologie und Staatswissenschaften. Vier Jahre später schrieb er im Fach Philosophie seine Doktorarbeit bei Professor Karl Jaspers. Während dieser Zeit stand er zusammen mit seinem Freund Carlo Mierendorff an der Spitze der sozialdemokratischen Studentenbewegung. Dadurch kam es zu ersten Auseinandersetzungen mit der nationalsozialistischen Szene, in der sich sowohl Studenten als auch Professoren engagierten. Theodor Haubach genoss schon damals den Ruf eines talentierten Redners. Nach dem Ende seines Studiums zog es Theodor Haubach nach Hamburg, um für das Institut für Außenpolitik zu arbeiten. Ein Jahr später, 1924, begann er sein Wirken als außenpolitischer Redakteur der sozialdemokratischen Tageszeitung „Hamburger Echo“. Diesen Posten behielt er bis 1929. Zeitgleich trat er der Leitung des Theodor Haubach Enge Zeit, S. 57 „Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold“ bei, einem sozialdemokratischen Wehrverband, der es sich zur Aufgabe ge- macht hatte, die demokratische Grundordnung in der Weimarer Republik zu verteidigen. Zudem sahen sich die Mitglieder als Gegengewicht zu den immer stärker auftretenden nationalen und nationalsozialistischen Kampfverbänden. Theodor Haubach wohnte in Hamburg in seiner Wohnung in der Hartwicusstraße 2 nicht allein. Seine Mutter zog zu ihm und lebte bis zu ihrem Tod im Jahr 1939 bei ihrem Sohn. Sie kümmerte sich um den Haushalt, während Theodor Haubach sich ganz der Politik widmete. Dadurch entwickelte sich sein Ruf eines ewigen Junggesellen. Während seiner Jahre in Hamburg stand Theodor Haubach oft als Redner auf Bühnen bei demokratischen Großveranstaltungen. 1927 wurde er als SPD-Mitglied in die Hamburger Bürgerschaft gewählt. Zwei Jahre später endete seine Zeit in Hamburg, denn er wurde zuerst 106 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 107 Pressechef beim Reichsinnenministerium und danach beim Berliner Polizeipräsidenten. Ein Ziel Theodor Haubachs lag in der Stärkung und Förderung der demokratischen Kräfte in der Berliner Polizei. Zudem übernahm er ab 1932 die politische Redaktion des „Reichsbanners“, einer SPD-nahen Zeitung. Nach dem Staatsstreich von Franz von Papen am 20. Juli 1932 wurde Theodor Haubach, wie viele andere auch, aus dem Staatsdienst entlassen. Danach konzentrierte er sich auf seine Arbeit im „Reichsbanner“, die ab 1933 illegal fortgeführt wurde. Im Kampf gegen den Nationalsozialismus trafen sich die Mitglieder des „Reichsbanners“ zu geheimen Sitzungen, warben neue Aktive, verbreiteten politische Schriften und Aufklärungsmaterial. Aufgrund dieser Arbeit wurde Theodor Haubach 1933 zum ersten Mal verhaftet, aber schon nach kurzer Zeit wieder entlassen. Ein Jahr später, am 24. November 1934, wurde er jedoch erneut festgenommen. Diesmal sollte seine Haft länger andauern. Bis 1936 war er zuerst im Konzentrationslager Columbiahaus und später im Konzentrationslager Esterwege bei Papenburg im Emsland in Gefangenschaft. Hier musste er mit den anderen Insassen an der Trockenlegung des Börgermoores arbeiten. Nach seiner Entlassung 1936 sah man ihm die Spuren der Inhaftierung an – er schien um Jahre gealtert. Seine erste Anstellung nach der Haft fand Theodor Haubach als Handels- und Versicherungsvertreter. Danach bekam er eine Stelle als Mitarbeiter seines Freundes Viktor Bausch in dessen Papierfirma Felix Schoeller & Bausch. Durch diese Arbeit stellte sich auch wieder der Kontakt zu alten Sozialdemokraten und Gewerkschaftern her. Zudem wurde 1938 Carlo Mierendorff nach fünfjähriger Haft aus dem Konzentrationslager entlassen. 1939 wurde Theodor Haubach noch einmal kurz verhaftet, da man ihm Spionage für die Tschechoslowakei vorwarf. Als 1940 der „Kreisauer Kreis“ als Widerstandsgruppe gegen das nationalsozialistische Regime entstand, trat auch Theodor Haubach ihm bei. Carlo Mierendorff hatte schon länger Kontakt zu der Widerstandsgruppe um Helmuth James Graf von Moltke und führte nun auch Theodor Haubach in den Kreis ein. Dieser nahm zum ersten Mal an einem Treffen vom 18. bis 20. Oktober 1942 teil. Das Ziel der Widerstandsorganisation lag in der geistigen, politischen und sozialen Neuordnung Deutschlands nach dem Ende der Diktatur. Eine ihrer Forderungen lautete: „Nie wieder Krieg – nie wieder Faschismus!“ Ab 1943 wandte sich der „Kreisauer Kreis“ auch anderen Widerstandsgruppen zu, um sich an einer aktiven Verschwörung gegen den Nationalsozialismus zu beteiligen. So kamen die Mitglieder in Kontakt mit Graf von Stauffenberg und Carl Friedrich Goerdeler. Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler wurden viele Beteiligte in Berlin sofort verhaftet. Theodor Haubach befand sich noch in Oberstdorf im Allgäu. Obwohl er wusste, wie gefährlich es für ihn in Berlin geworden war, kehrte er Anfang August dorthin zurück. Carlo Mierendorff lebte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Eine Fliegerbombe hatte ihn am 4. Dezember 1943 in Leipzig getötet. Am Morgen des 9. August 1944 wurde Theodor Haubach von der Gestapo in seiner Wohnung im Falterweg 1 in Berlin verhaftet. Man brachte ihn in die Sicherheitspolizei-Schule Drögen bei Ravensbrück, danach wurde er ins Berliner Gefängnis Lehrter Straße überführt. 107 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 108 Kurz vor seiner Festnahme hatte Theodor Haubach die Sängerin Anneliese Schellhase kennengelernt, die seine große Liebe werden sollte. Theodor Haubachs langjährige gute Freundin Alma de l’Aigle schrieb im Vorwort zu dem Abdruck einiger Briefe Haubachs an Anneliese Schellhase: „Es ist wie ein Wunder, wie eine ganz besondere Gnade, die in allem Unglück in seinem Leben waltete, dass er nicht lange vor dem gewaltsamen Abschluss seines Lebens noch die große Liebe kennen lernte, die auch zu einem späten Lebensbündnis geführt hätte, wenn der Tod nicht gewaltsam dazwischen geschlagen hätte. Er kannte Anneliese Schellhase schon vor seiner Verhaftung. Die herbe knabenhafte Erscheinung, das klassische Gesicht und der rege Geist der jungen Sängerin hatten ihn bald angezogen. Aber das große Wunder der Seelenbegegnung fand erst statt, als Haubach in der Zelle des Gefängnisses Lehrter Straße saß.“ Aus dem Gefängnis schrieb Theodor Haubach Briefe an Anneliese Schellhase, zog sie von Partenkirchen nach Berlin. Nach der Verlobung war es ihr gestattet, ihn regelmäßig zu besuchen und ihm die nötigsten Dinge für den täglichen Bedarf zu besorgen. Nichts konnte Anneliese Schellhase davon abhalten, ihren Verlobten im Gefängnis zu besuchen. Selbst als sie bei einem Bombenangriff schwer verletzt wurde und fortan gehbehindert war, besuchte sie ihn regelmäßig. Sein letztes gemeinsames Weihnachtsfest feierte das Paar im Gefängnis Lehrter Straße. Der wachhabende SS-Untersturmführer Knuth hatte den beiden seine Kammer zur Verfügung gestellt. Im Gefängnis Lehrter Straße schrieb Theodor Haubach am 6. Januar 1945 einen letzten Brief an Anneliese Schellhase, bevor das Urteil gegen ihn gefällt wurde: „Mein Liebes, Geliebtes! Wir wollen doch die Dinge richtig sehen. Entweder lässt Gott in Gnade und Barmherzigkeit zu, dass alles gut geht – dann schadet auch Dr. W. nichts – oder er lässt es nicht zu, dann helfen auch alle Götter nicht … Wo immer Deutschland in Not stand, stand auch immer ich. Einen kleinmütigen und verzagten Angeklagten werden die Herren in mir nicht kennen lernen. Vielleicht werden sie sich sogar wundern. Voriges Jahr um diese Zeit stand ich auf so manchem brennenden Dach in Berlin, heute soll ich mich darüber rechtfertigen, ob ich ein nationaler Mann bin.“ Den Vorsitz bei den Gerichtsverhandlungen nach dem 20. Juli 1944 hatte der Präsident des Volksgerichtshofes, Roland Freisler. Für ihn stand das Todesurteil schon vor Beginn der Verhandlung fest. Während der Prozesse liefen Kameras und Tonbandgeräte. Theodor Haubach wirkte ernst und gefasst. Mit leicht nach hinten geneigtem Kopf und den Blick in die Ferne gerichtet, saß er vor dem Richter. Da er bereits im Gefängnis an einer schweren Gallenkolik erkrankt war, brach er während des Prozesses zusammen und musste aus dem Saal getragen werden. Seine Verhandlung wurde daraufhin von den anderen abgetrennt. Am 15. Januar 1945 wurde der Schwerkranke wegen Hoch- und Landesverrats zum Tode verurteilt. Anneliese Schellhase reichte zwei Gnadengesuche ein. Sie drang sogar bis zu Roland Freisler vor, um ihn von dem Todesurteil abzubringen. Doch alle Hoffnungen zerschlugen sich mit der Hinrichtung Theodor Haubachs am 23. Januar 1945 im Gefängnis Plötzensee. 108 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 109 Einige Tage vor der Hinrichtung wurden die Gefangenen, unter ihnen auch Theodor Haubach, in die Todeszelle gebracht. Wegen seiner Gallenerkrankung musste Theodor Haubach am 23. Januar zum Galgen getragen werden. Dann wurde er, wie seine Mitgefangenen auch, erhängt. Heute gibt es in Deutschland zwei Schulen, die nach Theodor Haubach benannt sind. Eine steht in Berlin-Charlottenburg, die andere in Hamburg-Altona. Zudem existieren in BerlinCharlottenburg, Hamburg, Frankfurt am Main, Bielefeld und Lüneburg Straßen mit seinem Namen. In Berlin trägt der Briefingsaal im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung seinen Namen. Quellen: StaHH 121-3, Bürgerschaft I, A 17; Beuys: Verteidigung der Republik; Brakelmann: Die Kreisauer, S. 373 ff.; Ditt: Sozialdemokraten im Widerstand, S. 74; Hamburg im „Dritten Reich“, S. 45 f. ; Leber: Das Gewissen steht auf, S. 215 ff.; Zimmermann: Theodor Haubach (1896–1945). Wilhelm „Willi“ Häussler, geb. 18.4.1907, am 22.3.1945 bei Zwangsarbeiten in Wilhelmsburg gestorben 28 Halbenkamp 16 (Pestalozzistraße 72) Der Wohnblock der Genossenschaft Produktion, genannt PRO-Block, wurde 1906 erbaut und galt seitdem in Barmbek als Hochburg der Arbeiterkultur. In diesem PRO-Block, in der Hinrichsenstraße (heute Brucknerstraße), wuchs Willi Häussler mit seinen Geschwistern Karl und Helmi auf. So verwundert es nicht, dass Willi Häussler sich schon in der Schulzeit mit Anhängern der linken und rechten politischen Szene auseinandersetzte und sich an zahlreichen Diskussionen beteiligte. Sein Freund Bruno Wagner berichtete über ihn: „Willi war ein schlanker Bursche, dunkelblond, 1,75 m bis 1,80 m groß. Unerschrocken in der Verteidigung der Republik gegen Gegner von links wie rechts. Von Hause aus war er ein überlegter, eher ruhiger, freundlicher Mensch, kein großer Redner, jedoch mit festen Prinzipien, die er vorzubringen wusste.“ Schon in frühester Jugend trat Willi Häussler linksgerichteten Vereinen bei. So war er Mitglied der Kinderfreunde, der Sozialistischen Arbeiter Jugend (SAJ) und trat im Alter von 18 Jahren der SPD bei. Auch bei dem 1924 gegründeten Reichsbanner, einem sozialdemokratischen Wehrverband, und der 1930 gegründeten Schutzformation, kurz „Schufo“, war er engagiert. In Barmbek existierte die „Schufo 10“, deren Mitglieder sich regelmäßig in der Gaststätte von Gustav Mause in der PRO-Block-Ecke Lohkoppelstraße/Schleidenstraße trafen. Auch Willi Häussler saß dort oft mit seinen Freunden, darunter auch Bruno Wagner, zusammen. Dieser erinnerte sich auch Jahre später noch an eine abenteuerliche Der Biergarten von Gustav Mauses Lokal in der Lohkoppelstraße Geschichtswerkstatt Barmbek 109 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 110 Fahrt der „Schufo 10“ nach Wilhelmsburg: „Wie andere Abteilungen fuhren wir auf Lastwagen verfrachtet über die Elbbrücken, als unser Wagen plötzlich ins Schleudern geriet, die Seitenplanken des Wagens brachen und 40 Männer – unter ihnen Willi Häussler – auf die Straße stürzten. Willi wurde schwer verletzt mit etlichen anderen Männern ins LohmühlenKrankenhaus gebracht. Just in der Zeit wollte Willi mit seiner Frau Mimi eine Neubauwohnung in der Schwansenstraße auf dem Dulsberg beziehen. Er war sehr dankbar dafür, dass ich es übernahm, während seines Krankenhausaufenthalts mit seiner Frau zusammen die Wohnung einzurichten und die Behördenwege zu erledigen.“ Die „Schufos“ wurden 1932 vom Reichsbanner aufgelöst, da sonst ein Verbot des gesamten Reichsbanners gedroht hätte. Doch 1933 lebte die „Schufo 10“ erneut auf, um Widerstand gegen die nationalsozialistische Herrschaft zu leisten. Hierbei schrieben die Mitglieder zum Beispiel antifaschistische Parolen auf Hauswände oder verteilten Flugblätter. Aufgrund seines Mitwirkens in der „Schufo 10“ erhielt Willi Häussler 1933 die Kündigung. Bis dahin war er bei einer Lagerhausgesellschaft angestellt, für die er als Kaiarbeiter im Hafen tätig war. Wegen seiner „staatsfeindlichen Einstellung“ wurde er entlassen. Ein Jahr später ernannte ihn die „Schufo 10“ zum Leiter. Eine seiner Aktionen war die Verteilung von Konfirmationsglückwunschkarten, die zur Tarnung dienten, um Appelle gegen den Nationalsozialismus zu verbreiten. Willi Häussler lebte mit seiner Frau Wilhelmine, genannt „Mimi“, vor seiner Verhaftung in der Pestalozzistraße 72, heute Halbenkamp 16. Sie hatten eine gemeinsame Tochter, die zum Zeitpunkt der Verhaftung ihres Vaters fünf Jahre alt war. Im Sommer 1936 lebte die Familie einige Wochen in ihrer Schrebergartenlaube. Bei der Rückkehr in ihre Wohnung berichteten Nachbarn ihnen, dass nachts zuvor die Gestapo da gewesen sei, um sie zu suchen. Daraufhin schlüpfte Willi Häussler bei einem Freund, einem ehemaligen KPD-Mitglied, unter, der in der Kegelhofstraße wohnte. Am 13. Juni 1936 flog das Versteck jedoch auf und Willi Häussler wurde von der Gestapo verhaftet. Seine Frau Mimi erinnerte sich an die Zeit bis zur VerhafWilli und seine Ehefrau Mimi Geschichtswerkstatt Barmbek tung: „Bis zu seiner Verhaftung seit dem ersten Besuch erschien die Gestapo Nacht für Nacht bei mir, um aus mir herauszubekommen, wo mein Mann sich aufhält. Mein Mann besorgte sich alle nötigen Papiere und Fahrkarten, um nach Dänemark fliehen zu können. Doch zwei Stunden vor der Abfahrt erfolgte die Verhaftung.“ Der Prozess gegen Willi Häussler zog sich in die Länge, rund 45 weitere Personen waren darin involviert. Seine Verurteilung erfolgte schließlich am 13. Juni 1938. Zuerst wurde er zu 110 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 111 sieben Jahren Zuchthaus verurteilt. Allerdings wurde ihm wenigstens ein Jahr seiner Untersuchungshaft angerechnet, sodass er schließlich sechs Jahre Haft im Zuchthaus Bremen-Oslebshausen verbüßen musste. Während dieser Zeit war es seiner Frau nur alle vier Monate gestattet, ihn zu besuchen. Seine Tochter erhielt zudem in ihrer Schulakte den Vermerk: „Vater politisch in Haft.“ Am 13. April 1943 wurde Willi Häussler entlassen und sofort an das Polizeigefängnis Fuhlsbüttel überstellt. Dort blieb er bis Mai, um dann ins GestapoLager Wilhelmsburg verlegt zu werden. Hier musste er bis zu seinem Tod Zwangsarbeit leisten. Mimi Häussler konnte während der gesamten Haftzeit nur knapp ihre kleine Familie ernähren. Ab und Willi Häussler im Gestapo-Lager Wilhelmsburg, 1944 Geschichtswerkstatt Barmbek zu gelang es ihr eine Arbeitsstelle zu finden, die sie jedoch jedes Mal schnell wieder verlor. „Eine Unterstützung während der ganzen Haftzeit durch Freunde war so gut wie gar nicht möglich. Zweimal, bald nach der Verhaftung 1936, erhielt ich etwas Geld. Von der damaligen Wohlfahrtsbehörde erhielt ich keine Unterstützung. Nur dann sollte ich sie erhalten, wenn ich mich scheiden lasse. Erst musste ich Pflichtarbeiten für einen Lohn von 0,75 RM pro Tag verrichten, später leistete ich Fürsorgearbeit.“ In das Gestapo-Lager Wilhelmsburg musste Mimi ihrem Ehemann regelmäßig frische Wäsche bringen. Dadurch konnten sich die beiden allerdings auch wieder öfter sehen. Zwei Wochen vor seinem Tod besorgte Mimi ihrem Mann Geld, Papiere und Lebensmittelkarten. Die Häftlinge wussten, dass der Krieg verloren war und dass sich ihr Schicksal bald entscheiden würde. Willi Häussler versprach, dass er zu fliehen versuchen würde, sollte er etwas von seiner geplanten Hinrichtung erfahren. Am 22. März 1945 starb Willi Häussler bei der Zwangsarbeit in Wilhelmsburg. Seine Frau erhielt einen Todesschein, auf dem vermerkt war: „Bei Feindeinwirkung am 22. März 1945 im Lager Wilhelmsburg ums Leben gekommen.“ Seine Leiche wurde trotz eines Antrages nicht freigegeben. Willi Häusslers Leichnam konnte 1946 in einem Massengrab in Harburg identifiziert werden. Daraufhin wurde seine Leiche am 2. November 1946 nach Wandsbek-Tonndorf überführt. 1968 setzten sich Bekannte und Angehörige dafür ein, dass seine sterblichen Überreste auf dem Areal der „Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ der Geschwister-Scholl-Stiftung auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt wurden. Quellen: Ditt: Sozialdemokraten im Widerstand, S. 91; Hochmuth/Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand, S. 124, S. 128 ff., S. 590; Leber: Das Gewissen steht auf, S. 86 ff.; Interview mit Willi Häusslers Freund Bruno Wagner, Geschichtswerkstatt Barmbek. 111 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 112 Gustav Heidtmann, geb. 20.8.1873, am 20.8.1936 im Konzentrationslager Fuhlsbüttel gestorben 29 Wachtelstraße 48 Bereits in seiner Jugend war der gebürtige Hamburger Gustav Heidtmann politisch und gewerkschaftlich organisiert. Zuerst war er Mitglied der SAJ und trat danach der SPD bei. Von 1895 bis 1933 war Gustav Heidtmann Bezirksführer der SPD in Wandsbek. Hauptberuflich arbeitete Heidtmann als Werkzeugmacher. Mit seiner ein Jahr älteren Ehefrau Auguste, geb. Schmidt, wohnte er in einer kleinen Wohnung in der Wachtelstraße 48. Das Ehepaar hatte keine gemeinsamen Kinder. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten organisierte Gustav Heidtmann den Widerstand der SPD in Hamburgs Norden. Deshalb wurde er am 14. August 1936 auf seiner Arbeitsstelle von der Gestapo verhaftet und im Konzentrationslager Fuhlsbüttel inhaftiert. Eine Woche nach seiner Festnahme, am 20. August 1936, an seinem 63. Geburtstag, starb Gustav Heidtmann im Konzentrationslager Fuhlsbüttel. Quellen: StaHH 213-9, Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht, OIV 144-7; StaHH 332-5, Personenstandsunterlagen, 9882 und 191/1936; Diercks: Gedenkbuch „KOLA-FU“, S. 23; Totenliste Hamburger Widerstandskämpfer und Verfolgter 1933-1945; http://verfolgte.spd-hamburg.de/gedenkbuch/ Gedenkbuch_G-H.pdf Zugriff am 3.11.2008; VVN, H28 Heidtmann, Auguste. Wilhelm Karl Ferdinand Jastram, geb. 21.6.1895, inhaftiert 1936–1937, 1938, Selbstmord am 13.7.1938 KZ Fuhlsbüttel 30 Vogteiweg, gegenüber Hausnummer 11 Wilhelm Jastram gehört zu den Homosexuellen, über deren Schicksal nur in einer Polizeiakte über„unnatürliche Sterbefälle“ Hinweise enthalten sind. Auf seine homosexuelle Veranlagung als Grund für die Inhaftierung deutete lediglich der Aktenvermerk „K.24“ (Kriminalkommissariat 24, das für die „Bekämpfung der Homosexualität“ zuständig war) hin. Die Strafjustizakte, die Auskunft über seine Biographie hätte geben können, ist vernichtet worden. Der technische Zeichner Wilhelm Jastram wurde am 21. Juni 1895 in Altona bei Eldena in Mecklenburg geboren. Laut Gefangenenkarteikarte wurde er am 14. September 1936 vom Landgericht Hamburg wegen „widernatürlicher Unzucht“ zu einer einjährigen Der Vogteiweg 3–9 in den 1930er Jahren Geschichtswerkstatt Barmbek 112 Gefängnisstrafe verurteilt, die er vom 18. September 1936 bis zum 30. Juli 1937 im Männergefängnis 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 113 Hamburg-Fuhlsbüttel verbüßte. Zuvor befand er sich seit dem 31. Juli 1936 im Untersuchungsgefängnis an der Holstenglacis, wo er zunächst unter die Kategorie „Sittenverbrecher“ eingeordnet wurde. Nach erneuter Verhaftung, die für ihn ab dem 7. Juli 1938 in einem Aufenthalt im KZ Fuhlsbüttel mündete, erhängte sich Wilhelm Jastram am 13. Juli 1938 in seiner Zelle. Da der letzte frei gewählte Wohnsitz von Wilhelm Jastram bei seiner Schwester im Vogteiweg 8 in Barmbek-Süd war, soll dort ein Stolperstein an sein Schicksal erinnern. In die Messingplatte wurde der Text „Flucht in den Tod“ eingraviert. – Bernhard Rosenkranz/Ulf Bollmann Quellen: StaHH, 331-5 Polizeibehörde – Unnatürliche Sterbefälle, 1180/38; StaHH, 213-8 Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht – Verwaltung, Abl. 2, 451 a E 1, 1 c; StaHH, 242-1 II Gefängnisverwaltung II, Ablieferungen 13 und 16; B. Rosenkranz/U. Bollmann/G. Lorenz: Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg 1919–1969, S. 221. Jacob Kaufmann, geb. 23.4.1870, deportiert nach Theresienstadt am 19.7.1942, dort am 8.2.1943 gestorben Franziska Kaufmann, geb. Cohn, geb. 27.6.1872 in Hamburg, verstorben am 23.7.1942 in Hamburg Gertrud Silberberg, geb. Kaufmann, geb. 21.5.1898, deportiert am 17.3.1943 nach Auschwitz Käthe Selma Kaufmann, geb. 18.1.1902, deportiert am 11.7.1942 nach Auschwitz Margarete Meyer, geb. Kaufmann, geb. 15.10.1905, deportiert am 11.7.1942 nach Auschwitz 31 Bendixensweg 11 Jacob Kaufmanns Eltern Moses Kaufmann und Gertrud, geb. Stock, lebten in Sürth bei Köln. Hier wurde er am 23. April 1870 geboren und wuchs als jüngster Sohn mit sechs Geschwistern auf. Die Eltern hatten gehofft, dass er Interesse für den Viehhandel entwickeln würde, doch Jacobs Interesse ging schon früh in andere Richtungen, er schloss sich einem Zirkus an und gelangte so nach Hamburg. Franziska Kaufmann, geb. Cohn, kam am 27. Juni 1872 in Hamburg zur Welt und hatte acht Geschwister. Ihre Eltern waren Catharina, geb. Brose, und Abraham Joachim Cohn. Der Vater kam aus einer jüdischen Familie, während die Mutter evangelisch getauft und zum jüdischen Glauben übergetreten war. Großvater Johann Brose, ein Bildhauer, war einst aus Tarnow/Galizien nach Norddeutschland gekommen. Jacob und Franziska lernten sich in Hamburg kennen, die Trauung fand am 3. Juni 1897 im Standesamt Rotherbaum statt. Die beiden bekamen vier Töchter: Gertrud, Käthe, Lissi und Margarete, die alle zeitlebens sehr an der Mutter hingen. 1912 wohnte die Familie – laut Hamburger Adressbuch – in der Karolinenstraße 24, sodass die Schwestern einen kurzen Weg zur Israelitischen Töchterschule auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatten. Später besuchten sie ein Lyzeum. Die Bildung der Töchter war der Mutter ein wichtiges Anliegen, 113 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 114 auch war es für sie selbstverständlich, dass alle schließlich einen Beruf erlernten, um sich selbst versorgen zu können. Vater Jacob, dem Theater und Schauspiel weiter verbunden, war unter anderem als Bühnenarbeiter und -techniker tätig. Im Ersten Weltkrieg wurde er zum Kriegsdienst eingezogen und war stolz auf seine Auszeichnung, ein Eisernes Kreuz. Seine Einstellung oder Haltung, so schilderte es die einzig überlebende Tochter Lissi Jahrzehnte später, war patriotisch und ging in die sozialdemokratische Richtung. Bis 1926 wohnte die Familie in der Gneisenaustraße im Stadtteil Hoheluft in einer 5 ½-Zimmer-Wohnung und zog dann, wohl aus finanziellen Gründen, nach Barmbek Nord in eine 3Zimmer-Neubauwohnung in der Straße Heidhörn/Ecke Steilshooper Straße. Die älteste Tochter Gertrud heiratete am 8. Juni 1926 in Hamburg Siegfried Silberberg, geboren am 14. Juni 1895 in Wandsbek. Das Ehepaar Gertrud und Siegfried Silberberg zog 1932 nach Berlin, wo Siegfried eine Tätigkeit als Buchhalter annahm. Die beiden adoptierten einen Sohn, Peter, geb. Binner, geboren am 3. Juni 1936 in Berlin. Seine Mutter Käthe Binner trug später den Namen Klein. Familie Silberberg wohnte bis 1934 in der Storkower Straße 18, danach Brunnenstraße 40; ab 1939 gibt das Berliner Adressbuch über sie keine Auskunft mehr. Nach einem Schreiben des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen wohnten sie möglicherweise zuletzt in der Rosenstraße 14. Die noch zu Hause lebenden Töchter Käthe, Lissi und Margarete schienen zunächst nicht sehr begeistert von dem Umzug, sollten sie sich doch als inzwischen berufstätige junge Frauen ein Zimmer teilen. Liebevoll eingerichtet von der Mutter, fand es schließlich doch ihre Zustimmung, wobei das gute Verhältnis zu den Eltern die Entscheidung erleichterte. Trotz eigener kleiner Einkünfte Die Schwestern Lissi, Käthe und Margarete mit Mutter Franziska Kaufmann, Lissis Sohn Helmut und einer Freundin bei der Erdbeerernte im Schrebergarten, Sommer 1934 dürfte das Geld für eine größere Wohnung nicht gereicht haben. Franziska Kaufmann, die als sehr kinderlieb galt, zog für einige Jahre auch ein Pflegekind auf, nachdem ihre Töchter selbstständig und erwachsen geworden waren. Mutter des Kindes war eine Freundin ihrer Töchter. Tochter Margarete ging zwischen 1931 und 1933 eine kurze Ehe ein, die geschieden wurde, nachdem sich die SA-Mitgliedschaft ihres Mannes herausgestellt hatte. Sie zog anschließend wieder zu den Eltern. Tochter Lissi heiratete 1930 ihren christlichen Mann Franz Acker und lebte ebenfalls überwiegend in Barmbek, in der Nähe der Eltern und Schwestern. Die Familie unterhielt gute soziale, nachbarschaftliche Kontakte. So engagierte sich Jacob Kaufmann unter anderem für die Gründung eines Schrebergartenvereins an der Otto-Speckter-Straße, woran sich viele Familien aus der Nachbarschaft beteiligten. Hier konnte nicht nur 114 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 115 freie Zeit im Grünen verbracht werden, der Anbau von Nutzpflanzen war für die oft geringen Haushaltseinkommen gleichzeitig ein Beitrag zum Lebensunterhalt. Ab 1935 jedoch wurden Juden, auch Familie Kaufmann, aus ihren Schrebergärten vertrieben. Jacob Kaufmanns damalige Arbeit beim Hamburger Stadttheater (heute Staatsoper) fand 1935 ebenfalls aus rassischen Gründen ein abruptes Ende. Als Leiter der Werkstätten hatte man ihn nach 15-jähriger Mitarbeit entlassen. Daraufhin fand er eine Beschäftigung beim Jüdischen Kulturbund Hamburg, wo er bis Ende 1937 im Theater am Besenbinderhof für die technische Bühneneinrichtung zuständig war. Doch der Verdienst war gering, der Kulturbund war auf die Beiträge seiner Mitglieder angewiesen und hatte etliche andere vom Berufsverbot betroffene jüdische Künstler und Mitarbeiter angestellt, um ihnen Arbeit und eine Existenzgrundlage zu verschaffen. Die schwierige Wirtschaftslage zwang die Kaufmanns, sich an die Jüdische Wohlfahrt zu wenden und vorübergehend Unterhalt zu beantragen. Hinzu kam eine Anklage gegen Jacob wegen Betruges, weil unregelmäßige Einkünfte aus Neben- Lissi, Käthe und Margarete, ca. 1932 tätigkeiten als Kassierer auf Veranstaltungen angeblich nicht ausreichend angegeben worden waren. Die Strafe war ein dreimonatiger Gefängnisaufenthalt, wobei unklar ist, ob er sie antreten musste. Jacob und Franziska Kaufmann sowie beide noch bei ihnen lebenden Töchter Käthe und Margarethe wechselten in den folgenden Jahren im Stadtteil einige Male die Wohnungen, aus Geldmangel und wegen zunehmender Feindseligkeiten in der Nachbarschaft. Sie wohnten, wie vorübergehend auch Lissis Familie, im Lambrechtsweg, bis sie aufgrund von De- Franziska und Jacob Kaufmann mit ihrem Enkel Helmut Acker, ca. 1936 Privatbesitz (3) nunziationen auch hier nicht bleiben konnten. Im Bendixensweg 11 fanden sie 1938 schließlich noch eine äußerst beengte Wohnung. Am 30. November 1938 erhielten sie durch einen Boten des Gerichtsvollzieheramts eine Kündigung der Wohnung zum 1. Januar 1939. Margarete Kaufmann, bis dahin die Hauptverdienerin der Familie, hatte gerade ihre Anstellung verloren. Sofort nahm sie telefonisch Kontakt zur Hausverwalterfirma Adalbert Hansen in der Mönckebergstraße auf und erfuhr vom Brief eines Anwohners des Hauses Bendixensweg 11. Hierin wurde mitgeteilt, dass die Hausgemeinschaft sich gegen das Zusammenwohnen mit Juden aussprach, deren Verbleib aber 115 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 116 billigen wollte, wenn den übrigen Mietern eine Mietermäßigung zugestanden würde. Die Hausverwaltung entschied sich für eine Kündigung. Im Telefongespräch räumte man Familie Kaufmann eine Frist bis Ende Februar ein, doch angesichts der angespannten finanziellen Lage bot Margarete Kaufmann einen Auszug zu einem früheren Termin an. Bereits zum 10. Januar 1939 sollte die Wohnung zur Verfügung stehen, es gab eine telefonische Verabredung, auf die Januarmiete die mit 16 RM vorausbezahlte Gasuhr und die beim Einzug wenige Monate zuvor gänzlich renovierte Wohnung anzurechnen. Die mündliche Zusage am Telefon wurde jedoch nicht eingehalten, sodass ein Gerichtsverfahren folgte. Der Grundeigentümer Adalbert Hansen, An der Alster 3, verklagte Jacob Kaufmann und dessen Ehefrau wegen nicht gezahlter Miete für den Monat Januar. Am 17. Mai 1939 erging das Urteil und Familie Kaufmann wurde schuldig gesprochen. Strafe: 44 RM und 4 Prozent Zinsen, zahlbar an Adalbert Hansen. Ein damals hoher Betrag, der nur in kleinen Raten abgezahlt werden konnte. Familie Kaufmann wohnte nun in einer jüdischen Stiftswohnung in der Bogenstraße 25, wo Jacob eine Tätigkeit als Hausverwalter übernehmen konnte. Nach Beschlagnahmung dieses Hauses durch die Gestapo folgte als letzter unfreiwilliger Wohnsitz eine Unterkunft in einem „Judenhaus“ in der ehemaligen Schlachterstraße 46/47, Neustadt (nahe der Michaeliskirche). Mutter Franziska war bereits seit längerem krank und wurde von Tochter Käthe gepflegt. Mit Käthes eigener Gesundheit stand es auch nicht gut, sie kränkelte häufiger und war sehr kurzsichtig. Margarete trug durch ihre Berufstätigkeit weitgehend zum Familienunterhalt bei. Es ist anzunehmen, dass beide aus Rücksicht auf die kranke Mutter davon abgesehen hatten, Fluchtmöglichkeiten wahrzunehmen. Eine hätte zu Bekannten nach Palästina auswandern, die andere den Heiratsantrag eines amerikanischen Freundes annehmen können. Wie groß die Bedrohung wirklich war, hat auch Familie Kaufmann sich offenbar bis kurz vor dem Ende nicht vorstellen können. Laut Tochter Lissi hatte die Mutter zu kursierenden Gerüchten gesagt, „so etwas gibt es nicht, das kann kein Mensch tun!“. Als der Deportationsbefehl für die Töchter kam, wollte man immer noch an ein „Arbeitslager“ glauben, Jacob kaufte Overalls und eine gut gefüllte Werkzeugkiste, damit sie in der Lage wären, sich zur Not eine Hütte zu bauen. Die Deportation der Töchter Käthe und Margarete nach Auschwitz fand am 11. Juli 1942 statt. Ihre Schwester Gertrud mit Ehemann Siegfried und dem gemeinsamen 5-jährigen Sohn Peter Silberberg wurden am 12. März 1943 von Berlin aus durch die Gestapo mit dem 36. Osttransport nach Auschwitz „evakuiert“. Alle fanden dort den Tod. Wusste Jacob Kaufmann, was ihn erwartete? Er wurde am 17. Juli 1942 von seiner kranken Frau getrennt und eine Woche nach Abtransport der Töchter nach Theresienstadt deportiert, wo er im Gebäude Q 418 unterkam und nach Aussagen Überlebender dem Hungertyphus erlegen sein soll. In der vorhandenen Todesfallanzeige vom 8. Februar 1943 wurde offiziell angegeben, es habe sich um eine Sepsis/Blutvergiftung gehandelt mit Todesursache Myodegeneratio Gordis/Herzmuskelentartung. Seine Frau Franziska Kaufmann blieb in Hamburg zurück, nachdem sie zuvor nach einem Schlaganfall ins Israelitische Krankenhaus in der Schäferkampsallee eingewiesen worden war. 116 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 117 Tochter Lissi durfte sie nicht zu sich nehmen und berichtete später vom qualvollen Tod ihrer Mutter, die immer nur laut nach ihren Kindern und dem Ehemann gerufen habe. Vielleicht ahnte sie, was ihren Angehörigen widerfahren würde? Sie starb am 23. Juli 1942, zwei Wochen nach der Deportation ihrer Töchter und eine Woche nach dem Abtransport ihres Ehemannes. In der Sterbeurkunde war als Todesursache ein weiterer Schlaganfall vermerkt. Die einzige überlebende Tochter von Jacob und Franziska Kaufmann war Lissi, verheiratet mit Franz Acker, deren Schicksal in diesem Buch gesondert nachzulesen ist. Brief von Margarete Meyer an ihren Anwalt im März 1939 StaHH 117 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 118 Jacob Kaufmann wird noch seinem verwitweten Bruder Samuel Kaufmann, geb. am 31. Juli 1868 in Sürth, begegnet sein, dessen Transport nach Theresienstadt am 1. September 1942 stattfand. Beide kamen dort um. Ihre jüngste Schwester Adelheid, verh. Wolff, geb. am 22. Juni 1871 in Sürth, und ihr Ehemann Alexander Wolff wurden in Minsk ermordet. Die Schicksale zweier weiterer Brüder und zweier Schwestern sowie der Geschwister von Franziska Kaufmann sind noch unbekannt. – Eva Acker/Erika Draeger Quellen: 1; 3; 4; 5; 8; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 25.04.04 Acker, Lissi; StaH, 621-1/85, 71, Konsulentenakte; Interview mit Lissi Acker, Dez. 1990, Geschichtswerkstatt Barmbek; Private Familienunterlagen; Wamser/ Weinke: Eine verschwundene Welt, S. 236; IGDJ: Das Jüdische Hamburg, S.131, S.144; Meyer: Die Verfolgung und Ermordung der Hamburger Juden, S. 29, S. 51, S. 68ff, S. 206. Franz Klein, geb. 18.7.1892, am 24.3.1943 nach Theresienstadt deportiert und am 29.9.1944 nach Auschwitz weiterdeportiert 32 Rübenkamp 78 Franz Klein kam als Sohn des jüdischen Ehepaares Maximilian und Malwine Klein, geb. Freud, in Budapest zur Welt. Zu einer Ingenieursausbildung zog es ihn nach Deutschland, wo er am 13. November 1922 an der Technischen Hochschule in Darmstadt sein Studium abschloss. Danach arbeitete Franz Klein bis Ende 1925 als Bauleiter in Heidelberg. Seit dem 1. Januar 1928 wohnte und arbeitete er in Hamburg. Sein neuer Arbeitgeber war die Elektroinstallateurs-Firma von Wilhelm Wolfson. Franz Kleins zukünftige Ehefrau, Marie Braker, stammte ebenfalls aus Hamburg. Die 36-Jährige brachte eine Tochter aus erster Ehe mit in die Beziehung. Am 14. April 1928 heirateten Der Rübenkamp nach der Bombardierung 1943 Geschichtswerkstatt Barmbek Franz und Marie in Hamburg und zogen kurz darauf in eine gemeinsame Wohnung am Rübenkamp 78. Seine Anstellung bei Wilhelm Wolfson endete schon am 31. Mai 1928. Das Röntgenwerk C. H. F. Müller AG wurde ab 1934 zu Franz Kleins neuem Arbeitgeber. Allerdings bezahlten sie ihm nur 450 RM im Monat, obwohl er Diplom-Ingenieur war. Dies lag nicht zuletzt an seiner jüdischen Herkunft. In dieser Firma war Franz Klein bis zum 31. März 1939 beschäftigt. Danach fand er bis zu seiner Deportation 1943 immer wieder kurzfristige Anstellungen. Marie Klein war evangelisch und dadurch ging das Ehepaar davon aus, dass es in einer sogenannten privilegierten Mischehe lebte und Franz somit vor dem Zugriff der Gestapo geschützt war. Da das Ehepaar aber keine gemeinsamen Kinder hatte, galt es als „nichtprivile118 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 119 gierte Mischehe“, die vielen Verfolgungsmaßnahmen unterlag. Deshalb wurde Franz Klein 1942 mit den Vorwürfen konfrontiert, er trage nicht den „Davidstern“, beziehe ungekürzte Lebensmittelkarten und besäße eine Kleiderkarte für Nichtjuden. Zudem wohne er noch immer in der gemeinsamen Wohnung im Rübenkamp, obwohl er eigentlich in die Rutschbahn, in eines der dortigen „Judenhäuser“, ziehen sollte. Marie Klein machte sich nun zunehmend Sorgen um ihren Ehemann und war bereit, mit ihm in die Rutschbahn zu ziehen, wenn ihm dies helfen sollte. Anfang 1943 bekam Franz Klein jedoch einen Deportationsbefehl: Er sollte am 12. Februar nach Auschwitz deportiert werden. Nun suchte das Ehepaar Rat bei Max Plaut, dem damaligen Leiter des Jüdischen Religionsverbandes und Vorstand aller jüdischen Organisationen in Hamburg. Dieser erklärte den Eheleuten, es gebe für Franz Klein nur eine Hoffnung, und das sei die Abschiebung nach Theresienstadt. Damit sollte er vor dem Zugriff der Gestapo geschützt sein und in Theresienstadt erschienen die Überlebenschancen größer als in Auschwitz. Bevor aber Franz Klein nach Theresienstadt deportiert werden konnte, tat sich noch ein Problem auf. Für die „Abschiebung“ musste er geschieden sein. Nach zahlreichen Gesprächen und in der Hoffnung, sie könne ihn später in besseren Zeiten erneut heiraten, willigte Marie Klein schließlich „unter Tränen“ in die Scheidung von ihrem Mann ein. Tatsächlich war genau das Gegenteil der Fall: Ungeschieden wäre Franz Klein nicht deportiert worden, als Geschiedener stand ihm das Deportationsziel Theresienstadt zu, das jedoch die Durchgangsstation ins Vernichtungslager Auschwitz war. Dies wussten allerdings weder Max Plaut noch Marie Klein. Nun musste es schnell gehen, da niemand wusste, wie viele Transporte noch nach Theresienstadt gehen würden und der nächste bereits für den 24. März vorgesehen war. Vor dem Landgericht Hamburg wurde das Scheidungsverfahren verhandelt. Am 22. April 1943 erklärte das Hamburger Landgericht die Ehe zwischen Marie und Franz Klein für ungültig. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Franz Klein bereits seit einem Monat im Getto Theresienstadt. Auch in Theresienstadt blieben die Eheleute so gut es ging in Kontakt. Marie schickte ihrem Ehemann kleine Lebensmittelpakete und animierte Freunde und Verwandte dazu, dies ebenfalls zu tun. Erst mit seiner Deportation nach Auschwitz am 29. September 1944 brach der Kontakt zwischen dem Paar ab. Franz Klein starb in Auschwitz in einer Gaskammer. Nach seinem Tod machte Marie sich noch Jahrzehnte lang Vorwürfe, dass sie einer Scheidung letztlich doch zugestimmt hatte. Franz Klein auf der Deportationsliste nach Theresienstadt ITS Quellen: 2; 4; 5; 7; 8; StaHH 214-1, Gerichtsvollzieherwesen, 396; StaHH 314-15, OFP, R 1940/492; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 31.10.91 Klein, Maria; ITS/ARCH/Kartei Getto Theresienstadt/4997392#1 (1.1.42.2/THERES18/1162); ITS/ARCH/Transportlisten Gestapo (Hamburg)/11198433#1 (1.2.1.1/00010060/0017G/0271); ITS/ARCH/Transportliste Gestapo/11197794#1 (1.2.1.1/0001-0060/0017A/0129); ITS/ARCH/Getto Theresienstadt, Transport zum Konzentrationslager Auschwitz/4958969#1 (1.1.42.1/ 0027/0039); Meyer: „Jüdische Mischlinge“, S. 88 ff. 119 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 120 Fritz Klein, geb. am 10.9.1901, am 24.6.1934 im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel gestorben 33 Langenrehm 14 Fritz Klein wurde als Sohn des Arbeiters Gustav Klein und dessen Ehefrau Auguste, geb. Schusster, im ostpreußischen Pikallen geboren. Vom sechsten bis vierzehnten Lebensjahr besuchte Fritz die Volksschule und begann nach seinem Schulabschluss eine Malerlehre. 1920 bestand er seine Gesellenprüfung und zog vier Jahre später nach Hamburg, wo er eine Anstellung als Maler fand. Zudem begann er sich politisch zu engagieren und wurde Mitglied der KPD. Später wurde Fritz Klein Hauptkassierer der Roten Hilfe in Barmbek, einer politischen Hilfsorganisation für inhaftierte Genossen, die der KPD nahestand. Am 28. Januar 1928 heiratete Fritz Klein die 21-jährige Verkäuferin Mariechen Dorothea Elisabeth Griem. Sie war die Tochter von Max und Martha Griem und stammte aus Bramfeld. Ein Jahr später kam am 4. März 1929 ihre Tochter Inge Karla zur Welt. Die Familie wohnte im Langenrehm 14. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde die Rote Hilfe 1933 verboten, arbeitete jedoch illegal weiter. Auch Fritz Klein blieb weiterhin engagiert und musste nun sehr vorsichtig sein, denn die Mitglieder wurden politisch verfolgt. Am 8. Juni 1934 wurde Fritz Klein von der Gestapo verhaftet, als Begründung wurde „Vorbereitung zum Hochverrat“ angegeben. Im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel wurde Fritz Klein inhaftiert und vernommen. Bei diesen Vernehmungen muss er schwer geFritz Klein Photoarchiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme foltert worden sein, denn nur zwei Wochen nach seiner Verhaftung war Fritz Klein tot. Am 24. Juni 1934 teilte die Gestapo Mariechen Klein mit, dass ihr Mann gestorben sei. Angeblich hatte er sich erhängt. Die Leiche wurde beschlagnahmt und durfte nicht besichtigt werden. Schon einen Tag später, am 25. Juni, wurde sie im Krematorium Ohlsdorf eingeäschert, wobei auch die Gestapo anwesend war. Nach Fritz Kleins Tod geriet die Familie in finanzielle Not. Mariechen Klein bemühte sich immer wieder um Arbeit, um ihre Tochter ernähren zu können. Während dieser Zeit wuchs Inge bei ihren Großeltern auf. Letztlich überstand die Familie den Zweiten Weltkrieg, aber durch den Verlust ihres Ehemannes und Vaters mussten Mariechen und Inge mit zahlreichen Problemen allein fertig werden. Quellen: StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 04.03.29 Detjen, Inge; Diercks: Gedenkbuch „KOLA-FU“, S. 26 f., S. 34; VVN, K 34 Klein, Mariechen; Totenliste Hamburger Widerstandskämpfer und Verfolgter 1933–1945. 120 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 121 David Herz Hermann Kobritz, geb. 12.8.1865, deportiert am 17.7. / 19.7.1942 nach Theresienstadt, dort gestorben am 8.12.1944 34 Herbert-Weichmann-Straße 51 (Adolphstraße 51) David Herz Hermann Kobritz wurde in Brody geboren. Über seine Eltern, seine Kindheit und Jugend ist uns nichts bekannt. Im Mai 1890 heiratete er in Brody Rosalia, genannt Rosa, Kleinmann, die am 23. Mai 1874 in Odessa geboren worden war. Ihr erstes Kind, die Tochter Eleonore/Leonora, kam im Dezember 1890 oder im Januar 1891 in Wien zur Welt. In Moskau wurden am 18. Juli 1894 die Tochter Juliette und am 12. Juli 1896 der Sohn Maximilian geboren. Es folgte Katharina, genannt Katja, die im Dezember 1897 in Odessa geboren wurde. Die beiden letzten Kinder kamen wieder in Moskau zur Welt, Richard am 27. September 1899 und Heinrich am 1. November 1903. Ungefähr seit 1906 lebte die jüdische Familie in Hamburg. Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist in allen Unterlagen lediglich der Vorname Hermann angegeben. Hermann Kobritz betrieb als Kaufmann ein Ex- und Importgeschäft. Firmensitz war zunächst Raboisen 5, ab etwa 1914 Mönckebergstraße 9 und in den Jahren 1931/32 Spitalerstraße 16. Mindestens von 1912 bis 1919 unterhielt die Firma Hermann Kobritz gemäß Adressbucheintrag Niederlassungen in Moskau und Charbin. Die Firma wurde im September 1908 ins Handelsregister eingetragen. Am 4. März 1933 wurde der Eintrag „von Amts wegen gelöscht“. Für die Jahre 1933 bis 1935 wird als Firmensitz das Wohnhaus der Familie in den Adressbüchern angegeben. Dieses Haus kaufte Hermann Kobritz 1913. Es handelte sich um ein Einzelwohnhaus mit Garten in der Adolphstraße 51, in das die Familie, die zuvor in der Schäferkampsallee 28 gewohnt hatte, einzog. Im Erdgeschoss des Hauses befanden sich unter anderem ein Saal, ein Salon, ein Herrenzimmer und eine Terrasse. In den beiden Obergeschossen lagen mehrere geräumige Zimmer. Im Keller befanden sich Küche und weitere Wirtschaftsräume. In der Beschreibung des zum Verkauf stehen- Die Villa in der Herbert-Weichmann-Straße 51, 2009 Privatbesitz den Hauses wurde ausgeführt: „Dieses Grundstück verdient besondere Beachtung wegen seiner hübschen ruhigen Lage inmitten des besten Teils der Uhlenhorst und bequemer Verbindung mit der Stadt durch Dampfschiff und Straßenbahn.“ 1926 war Hermann Kobritz Trauzeuge bei der Hochzeit seiner Tochter Katja in Hamburg, die zu diesem Zeitpunkt noch im Haus ihrer Eltern in der Adolphstraße lebte. Ab etwa 1930 hatte die Familie neben dem Haus in der Adolphstraße eine Wohnung in der Gemeinde Ratekau, Timmendorfer Strand, Strandallee 41 a (später umbenannt in Timmendorfer 121 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 122 Platz 5). Das Haus Adolphstraße 51 wurde1932 in ein Mehrfamilienhaus umgebaut. Nach dem Umbau wohnten in dem Haus mehrere Mieter. Hermann und Rosa Kobritz wohnten spätestens seit 1936 nicht mehr in Hamburg. Sie lebten nun in der Wohnung in Timmendorfer Strand, bei der es sich um eine große 4-Zimmer-Wohnung handelte, die gut eingerichtet war. Im Februar 1942 wurde das Haus Adolphstraße 51, das bis dahin Hermann Kobritz gehört hatte, zwangsversteigert. Anfang der fünfziger Jahre schlossen die Kinder des Ehepaars Kobritz als deren Erben vor dem Wiedergutmachungsamt beim Landgericht Hamburg einen Vergleich mit dem neuen Eigentümer des Grundstücks über eine Entschädigungszahlung. Hermann und Rosa Kobritz wurden am 17. Juli 1942 von ihrer Wohnung in Timmendorfer Strand aus deportiert. Über eine Sammelstelle in Lübeck wurden sie mit etwa 40 anderen Jüdinnen und Juden, die vorwiegend aus Kiel und Lübeck kamen, nach Hamburg gebracht und dem Transport zugewiesen, der am 19. Juli 1942 nach Theresienstadt fuhr. Dort kamen sie am 20. Juli 1942 an. Die Wohnungseinrichtung und der Hausrat des Ehepaars Kobritz wurden 1942 durch das Amtsgericht Schwartau versteigert. Der Versteigerungserlös wurde der Oberfinanzkasse in Kiel zugeleitet und an die Reichshauptkasse abgeführt. Hermann Kobritz starb am 8. Dezember 1944 in Theresienstadt. Rosa Kobritz hat überlebt. Sie kehrte am 2. August 1945 aus Theresienstadt zurück und wohnte zunächst einige Monate bei ihrer Tochter und deren Ehemann, bevor sie in eine andere Wohnung umzog. Rosa Kobritz starb am 14. Januar 1947 in Hamburg. Alle sechs Kinder von Hermann und Rosa Kobritz haben den Nationalsozialismus überlebt. Die Tochter Katja war in Hamburg mit einem nichtjüdischen Mann verheiratet. Sie, ihr Mann und die zwei Söhne waren zahlreichen Repressalien ausgesetzt. Die anderen fünf Kinder lebten in den fünfziger Jahren in Frankreich, Holland, Australien, Venezuela und in den USA. Wann sie dorthin auswanderten ist nicht bekannt. – Ingrid Budig Quellen: 5; 8; StaHH 213-13, Landgericht Wiedergutmachung, Z 3818; StaHH 231-7, Amtsgericht Hamburg - Handels- und Genossenschaftsregister, A1 Band 41; StaHH 332-5, Personenstandsunterlagen, 6646 + 293/1926; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 29.12.97 Brinkama, Katharina; StaHH 552-1, Jüdische Gemeinden, 992m Band 2; Landesarchiv Schleswig-Holstein, Abt. 510 Nr. 9699, Abt. 761 Nr. 17347; Wiener Stadt- und Landesarchiv; Bezirksamt Hamburg-Nord, Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt, Fachbereich Bauprüfung, Akte Herbert-Weichmann-Str. 51; AB 1907, 1912 bis 1919, 1924, 1929, 1931 bis 1938, 1941, 1943. Ida Kohn, geb. Grünhut, geb. 13.10.1874, am 25.10.1941 nach Lodz deportiert und dort am 20.4.1942 gestorben Gertrud Kohn, geb. 28.4.1897, am 25.10.1941 nach Lodz deportiert 35 Mundsburger Damm 26 Ida Kohn kam in Prag als zweitälteste Tochter des jüdischen Ehepaares Simon und Johanna Grünhut, geb. Jetmar, zur Welt. Simon und Johanna Grünhut hatten noch vier weitere Töchter: Adele, Gisela, Selma und Alice. 122 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 123 Ida heiratete den österreichischen Kaufmann Isidor Kohn. Am 28. April 1897 wurde ihr einziges gemeinsames Kind Gertrud in Jungbunzlau in Österreich geboren. Kurz nach Gertruds Geburt verstarb Isidor. Daraufhin zog Ida Kohn mit ihrer Tochter nach Deutschland. Mutter und Tochter Kohn verbrachten einige Jahre in Magdeburg, wo Gertrud die Luisenschule, ein Gymnasium, besuchte, ehe sie nach Hamburg zogen. Hier bestand Gertrud 1917 ihr Abitur im Kloster St. Johannis am Holzdamm. Nach bestandenem Abitur begann Gertrud Kohn ein Studium der Geschichte, der Nationalökonomie, der Philosophie, der Mathematik und der Naturwissenschaften an den Universitäten Rostock, Berlin und Hamburg. An der Universität Hamburg war ihr Hauptfach Mittlere und Neuere Geschichte bei Prof. Max Lenz und Prof. Friedrich Keutgen. Bei Prof. Ernst Cassirer studierte sie Philosophie und Nationalökonomie lehrte Prof. Heinrich Sieveking. Gertrud Kohn promovierte bei Prof. Otto Lauffer und Prof. Conrad Borchling an Urkunde von Gertrud Kohn zur Erlangung der Doktorwürde StaHH der Universität Hamburg am 19. Juni 1923 mit der Doktorarbeit „Friedrich der Große in der Geschichtsschreibung Rankes und der kleindeutschen Historiker“. Sie bestand die schriftliche wie die mündliche Prüfung am 29. Juli 1922. Die zwei Frauen Kohn wohnten zusammen in einer Wohnung am Mundsburger Damm 26. Ida war verwitwet und Gertrud blieb bis an ihr Lebensende ledig. Zwischen dem 6. Dezember 1922 und dem 31. März 1923 arbeitete Gertrud Kohn als Bürogehilfin in der Konsumentenkammer, die 1919 initiiert und 1920 als rechtsfähige Kammer der Deputation für Handel, Schifffahrt und Gewerbe unterstellt wurde. Im März 1933 wurde diese Kammer von den Nationalsozialisten aufgelöst. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten änderte sich das Leben der Familie Kohn radikal. Ida galt nicht als deutsche Staatsbürgerin, da sie in Prag geboren war und konnte nur mit Hilfe ihrer Schwester Adele ihr Leben finanzieren. Adele war rechtzeitig nach London emigriert und schickte ihrer Schwester Ida nun monatlich 200 RM. Ida und Gertrud Kohn zogen im Juli 1939 aus ihrer Wohnung am Mundsburger Damm aus und wohnten seither in der Parkallee 8. Zwischen März und Mai 1941 erhielten beide noch einmal finanzielle Unterstützung. Bekannte von Ida, das Ehepaar Kurt und Mary Schindler aus Prag, überwiesen monatlich 2000 Kronen an die Kohns. Ihr gesamtes Vermögen wurde zugunsten des Deutschen Reiches eingezogen. 123 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 124 Auf dem ersten Transport von Hamburg ins Getto Lodz am 25. Oktober 1941 befanden sich auch Ida und Gertrud Kohn. Im Getto bezogen sie die Wohnung Nummer 23 in der Reiterstraße 15. In der Anmeldekarte für das Getto wurde Gertruds Beruf mit Journalistin angegeben. Ob und wann sie diesen Beruf ausgeübt hatte, ist ungeklärt. Ida Kohn starb am 20. April 1942 im Getto Lodz. Ihre Tochter Gertrud musste das Getto am 13. Mai 1942 verlassen. Wahrscheinlich wurde sie nach Chelmno gebracht und dort in einem Gaswagen ermordet. Quellen: 1; 4; 5; 8; StaHH 314-15, OFP, R 1939/3066; StaHH 364-13, Fakultäten, Phil Fak Prom A 2; StaHH 371-12, Konsumentenkammer I, A II 3 Personalakte; USHMM, RG 15.083 300/17; ITS/ARCH/Getto Litzmannstadt / 1203239#1 (1.1.22.1/0007/0552); ITS / ARCH / Kartei Gestapo Hamburg / 12425847#1 (1.2.3.2/GHH016/0089); ITS/ ARCH/ Transportliste Gestapo/ 11198203#1 (1.2.1.1/0001-0060/0017G/0041); Archivum Panstwowe, Lodz. Anmeldekarte von Ida Kohn aus dem Getto Lodz Archivum Panstwowe, Lodz Gabriel Jakob (Georg) Lehr, geb. 11.10.1861 in Posen, deportiert am 15.7.1942 nach Theresienstadt, dort am 6.9.1942 verstorben 36 Barmbeker Markt 37 (Am Markt 37) Gabriel Jakob – genannt Georg – Lehr kam am 11. Oktober 1861 als Sohn der jüdischen Eheleute Abraham und Bertha Lehr in Posen zur Welt. Nach einem Medizinstudium erlangte er 1888 die Approbation und ließ sich im gleichen Jahr, zunächst als praktischer Arzt, in Hamburg nieder. Seine Ehefrau war Hedwig, geboren am 31. März 1875 als Tochter von Simon Kaufmann und Paula, geb. Gumpertz. Georg und Hedwig Lehr bekamen zwei Söhne, Hans Walter wurde am 31. August 1895 geboren und Fritz Herbert am 6. Juni 1900. Die Zulassung für Georg Lehr zu allen Kassen erfolgte 1909. Etwa zu dieser Zeit verlegte er seine Praxis von den Colonnaden an den Markt in Barmbek, die Familie lebte in einer großen Wohnung mit 6 ½ Zimmern am Immenhof 16. Georg Lehr war inzwischen ein in Hamburg anerkannter HNO-Spezialist. Sein großer Erfolg mehrte das Vermögen, später erinnerten sich Zeitzeugen an eine kostbare, mit erlesenen Dingen ausgestattete Wohnungseinrichtung. 124 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 125 Die Söhne des Ehepaars Lehr ergriffen andere Berufe. Hans Walter studierte Jura und war für die Hamburgische Gesandtschaft in Berlin tätig. Er kam im Alter von 30 Jahren bei einem Lawinenunglück in der Schweiz ums Leben. Der jüngere Bruder Fritz Herbert, Doktor der Kunstgeschichte, lebte ebenfalls in Berlin und litt sehr unter den Verfolgungen. Als er seine Tätigkeit als Redakteur 1936 aus „rassischen“ Gründen verlor, entschied er sich für den Freitod. Häuserzeile Am Markt 35 bis 40 zwischen Farmsener Straße (heute Beimoorstraße) und Dehnhaide. Im Haus Nr. 37 befand sich auch das Postamt 22. Geschichtswerkstatt Barmbek Die Eltern in Hamburg waren nun allein, sie hatten keine Enkel. Hedwig Lehr wurde bald sehr krank. Ihr Mann Georg Lehr verlor am 1. Januar 1938 die Kassenzulassung, am 30. September wurde ihm wie allen anderen jüdischen Ärzten in Hamburg die Approbation entzogen. Kurz darauf – am 13. Oktober, zwei Tage nach seinem 77. Geburtstag – starb seine Frau. Ein ehemaliger Nachbar schrieb später, sie habe Brustkrebs gehabt. Das Ehepaar war etwa zwei Jahre zuvor in eine 3 ½-Zimmer-Wohnung in der Eppendorfer Landstraße 30 gezogen, die Georg Lehr bis 1941 weiter bewohnte. Im Juni 1939 legte ein Mitarbeiter des Oberfinanzdirektion, Devisenstelle, eine Akte zu Georg Lehr an mit dem Vermerk „Es erschien der obengenannte Dr. Lehr und überreichte anliegendes Vermögensverzeichnis, wonach außer einer Leibrente nur geringe Vermögenswerte vorhanden sind. Daher keine Sicherheitsanordnung erforderlich.“ Das handschriftlich gefertigte Verzeichnis vom 1. Juni 1939 listete Werte in erstaunlich geringer Höhe auf: RM 600 Goldpfandbriefe der Hamburgischen Hypothekenbank, 200 £ Hamburgische Staatsanleihe, 300 £ Brasilianische Staatsanleihe. Auf dem Girokonto bei der Deutschen Bank, Filiale Hamburg, waren 233,14 RM und beim Postscheckamt Hamburg 1 147,89 RM. Hinzu kamen die Leibrente von 3614 RM per Anno und die Kassenvereinigungsrente in Höhe von 95 RM, unterzeichnet von Dr. med. Gabriel Jacob Israel Lehr, Eppendorfer Landstraße 30 in Hamburg 20. Ein weiteres Schreiben vom Nordischen Assekuranzcontor an den Oberfinanzpräsidenten vom 20. Mai 1942 teilte mit: „Herr Dr. ... Lehr, wohnhaft in Hamburg 13, Beneckestraße 4, unterhält seit dem 9. Dezember 1938 durch uns bei der Baseler Lebensversicherungsgesellschaft eine Rentenversicherung, worauf er vierteljährlich eine Rente von RM 903,65 ausbezahlt bekommt.“ Nachgefragt wurden die Zahlungsmodalitäten, da nach einer neuen Information Barauszahlungen an Juden nicht mehr vorgenommen werden durften. „Der Rentner verlangt das Geld auf das Konto des Altersheims Dr. Simon, wo er wohnt. (...) Welche Zahlungsmöglichkeiten liegen für uns noch vor?“ Die Antwort lautete unter anderem: 125 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 126 „Gegen Herrn Dr. Lehr habe ich eine S. A. nicht erlassen. Es bestehen daher devisenrechtlich keine Bedenken, dass Sie die Rente an ihn in bar oder an das Altersheim zahlen.“ Der Vorgang wirft die Frage auf, was aus Georg Lehrs Vermögen geworden sein mag, von dem angenommen werden kann, dass es nicht unbeträchtlich gewesen und nicht allein durch Zwangsabgaben so stark reduziert worden ist. Die Leibrente könnte eine Erklärung sein, denn eine der wenigen Möglichkeiten, dem Unrechtsstaat Zugriff auf jüdische Ersparnisse zu entziehen, bestand bis 1941 darin, sie als einmalige Kapitaleinzahlung einer Lebensversicherungsgesellschaft Handschriftliches Vermögensverzeichnis von Dr. Lehr, 1939 StaHH zu überschreiben gegen lebenslängliche, unveräußerliche Leibrenten. Den Vertrag mit der Schweizer Versicherung hatte er im Dezember 1938 abgeschlossen. Ab September 1941 musste auch Georg Lehr den „Judenstern“ tragen. Er zog in diesem Jahr von der Eppendorfer Landstraße vorübergehend in die Hallerstraße 72 und 1942 für kurze Zeit ins Jüdische Altenheim Beneckestraße 4. Hier erreichte ihn der Deportationsbefehl. Der Transport nach Theresienstadt fand für den fast 81-Jährigen am 15. Juli 1942 statt, wo er am 6. September des gleichen Jahres starb. – Erika Draeger Quellen: 1; 2; 3; 5; 8; StaHH 314-15, OFP, R 1941/223a; StaHH 314-15, OFP, 9 UA 8; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 731, Lehr, Georg; von Viliez: Mit aller Kraft verdrängt, S. 329; Bajohr: „Arisierung in Hamburg“, S. 153 ff., S. 369. Jon Levie, geb. 10.9.1878, 1938 in die Niederlande emigriert und von dort am 21.9.1942 nach Auschwitz deportiert Hertha Levie, geb. Goldschmidt, geb. 11.3.1892, 1938 in die Niederlande emigriert und von dort am 21.9.1942 nach Auschwitz deportiert 37 Papenhuder Straße 22 Über die Herkunft Jon Levies ist nur wenig bekannt. Der niederländisch-jüdische Staatsbürger wurde in Hamburg geboren. Seine Eltern waren der Cigarrenfabrikant Tanchum (Theodor) Levie und Hannah Levie, geb. Ricardo-Rocamora. Er hatte einen sechs Jahre jüngeren Bruder namens Iwan. 126 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 127 Seine spätere Frau Hertha wurde am 11. März 1903 als jüngstes von drei Kindern des Ehepaares Natan, genannt Louis, und Johanna Goldschmidt, geb. Mayer, geboren. Schwester Irma wurde 1895, Hilde drei Jahre später geboren. Louis Goldschmidt betrieb in Krefeld ein Konfektionsgeschäft in der Hochstraße 128. Im Jahr 1904 zog Familie Goldschmidt nach Berlin und lebte dort im Stadtteil Schöneberg. In Hamburg war Jon Levie zuerst selbstständig und arbeitete später als Vertreter für Rohtabak. Wann und wo sich Hertha und Jon kennenlernten, ist unbekannt. Nach ihrer Hochzeit zogen sie Anfang der zwanziger Jahre in die Papenhuder Straße 22. In den dreißiger Jahren zog das Ehepaar Levie in den Hofweg 45 und eröffnete dort in der 3. Etage die Pension „Holland“. Aufgrund zunehmender Anfeindungen und der stärker werdenden Bedrohung durch die Nationalsozialisten entschloss sich das Ehepaar, in die Niederlande zu gehen. Louis Goldschmidt half seiner Tochter und seinem Schwiegersohn bei den Vorbereitungen zur Auswanderung. Ein großer Teil der Möbel wurde an die Nachbarin, Margarethe Seifert, verkauft, die zum 1. Dezember 1938 auch die Pension übernahm. Zu diesem Zeitpunkt lebte das Ehepaar Levie bereits in Amsterdam in der Pension „Otens“, Singel 52. Deswegen regelte Louis Goldschmidt alle Anträge bei der Devisen- und der Vermögensverwertungsstelle. Die Möbel des Ehepaares lagerten im Januar 1939 noch immer bei der Speditionsfirma Carl Luppy im Eppendorfer Weg 155 und wurden erst im August in die Niederlande überführt. Außerdem verfügte das Ehepaar Levie noch über ein Vermögen von 1390 RM, welches auf einem Konto bei der Deutschen Bank ruhte. Louis Goldschmidt bemühte sich verzweifelt, das Geld in die Niederlande zu schaffen, doch das Deutsche Reich behielt es ein. 1941 lebten Jon und Hertha in einem Mehrfamilienhaus in Amsterdam in der Vossiusstraße 14. Dort wurden sie 1942 verhaftet und ins niederländische Durchgangslager Westerbork gebracht. Am 21. September 1942 erfolgte die Deportation nach Auschwitz, wo sie umkamen. Jon Levies Bruder Iwan wurde 1942 nach Auschwitz deportiert und kam dort ums Leben. Für ihn ist ein Stolperstein in der Bismarckstraße geplant. Louis Goldschmidt beging nach dem Tod seiner Ehefrau am 31. Oktober 1942 in Berlin Selbstmord. Als einzige Karteikarte von Jon Levie aus dem Durchgangslager Westerbork ITS überlebte Irma Goldschmidt den Holocaust. Quellen: 1; 2; 4; 5; 8; StaHH 314-15, OFP, FVg 5514; StaHH 314-15, OFP, R 1940/674; ITS/ARCH/Durchgangslager Westerbork/5145028#1 (1.1.46.1/0005/0205); ITS/ARCH/Kartei Durchgangslager Westerbork/ 12768379#1 (1.2.4.2/LEGR-LEVIN-H/1912); Stadtarchiv Felsberg; Stadtarchiv Krefeld; http://www.joodsmonument.nl/person-481905-nl.html, Zugriff am 14.6.2009. 127 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 128 Albert Levisohn, geb. 17.3.1891, am 25.10.1941 nach Lodz deportiert und dort am 18.2.1942 gestorben Cilly Levisohn, geb. Magnus, geb. 31.12.1894, am 25.10.1941 nach Lodz deportiert und im Mai 1942 in Chelmno gestorben Rolf William Levisohn, geb. 11.9.1920, am 25.10.1941 nach Lodz deportiert und im Mai 1942 in Chelmno gestorben 38 Gluckstraße 24 Albert Levisohn wurde als Sohn des jüdischen Ehepaares William und Bertha Levisohn in Hamburg geboren. Seine spätere Ehefrau war die gebürtige Hamburger Jüdin Cilly Magnus, die Tochter von Adolf und Jenny Magnus. Albert und Cilly Levisohn lebten allein in ihrer Wohnung in der Gluckstraße 24, bis im September 1920 ihr erstes gemeinsames Kind Rolf geboren wurde. Ihr Sohn war von Geburt an körperlich behindert, er litt an Kleinwuchs. Acht Jahre später kam im Februar ihre Tochter Ruth zur Welt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie waren bescheiden. Albert Levisohn war als Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg aktiv gewesen und mit dem Hanseatenkreuz ausgezeichnet worden. Nach dem Krieg machte er sich als Kaufmann selbstständig. Dann arbeitete er als Buchhalter und später als Bücherrevisor bei der Firma Siegfried Halberstadt, Hohe Bleichen 31, und verdiente dort durchschnittlich 350 RM im Ein Haus in der Gluckstraße in den 1930er Jahren Geschichtswerkstatt Barmbek Monat, mit denen er seine Familie zu ernähren versuchte. Bis März 1935 besuchte Rolf Levisohn die Lichtwarkschule, eine bekannte reformpädagogische Schule, die er verlassen musste, weil er jüdisch war. Seine ehemaligen Schulkameraden erinnerten sich später zwar noch an ihn, doch wirkliche Freunde besaß er dort nicht. Nach seiner Entlassung aus der Lichtwarkschule wechselte er zur Talmud Tora Schule, der orthodoxen jüdischen Volks- und Oberrealschule in Hamburg. Im November 1938, kurz nach dem Novemberpogrom, wurde der 18-jährige Rolf Levisohn festgenommen und zusammen mit rund 6000 jüdischen „Schutzhäftlingen“ aus dem gesamten Reich ins Konzentrationslager Oranienburg-Sachsenhausen gebracht. Dort erwarteten ihn zahllose Quälereien und Schikanen. So musste er unter anderem 24 Stunden lang regungslos in eisi128 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 129 ger Kälte ausharren oder im Laufschritt schwere Steine transportieren. Bei „Ungehorsam“ wurden die Häftlinge zu stundenlangem Stehen vor einem elektrisch geladenen Stacheldrahtzaun gezwungen. Rolf Levisohn berichtete, dass sich viele Häftlinge in den Zaun stürzten, nur um nicht mehr stehen zu müssen. Nach sechs Wochen Haft kehrte er nach Hamburg zurück. Spätestens seit diesen Erfahrungen konzentrierte sich Rolf Levisohn darauf, Deutschland zu verlassen. Da er schon über 18 Jahre alt war, bestand für ihn nicht mehr die Möglichkeit, mit einem Kindertransport auszureisen. Insbesondere seine Mutter Cilly Levisohn bemühte sich sehr, Verwandte und Bekannte in der ganzen Welt zu kontaktieren, um ihren Sohn irgendwo unterzubringen. Mehr Glück hatte seine damals elfjährige Schwester Ruth. Sie gelangte im Juni 1939 mit einem Kindertransport nach England und entging so weiterer Verfolgung. Zeitweise schien es so, als könne auch Rolf Levisohn mit Hilfe eines Schülerzertifikats zu Bekannten über Basel nach Palästina fliehen, doch alle unternommenen Schritte scheiterten. Das letzte Abitur an der Talmud Tora Schule fand im Schuljahr 1939/40 statt. Nur noch zwei Schüler waren übrig geblieben, die sich den Prüfungen stellten: Oskar Judelowitz und Rolf Levisohn. Im Fach Deutsch absolvierte Rolf Levisohn sein schriftliches Abitur zum Thema: „Unglück selber taugt nicht viel, doch es hat drei gute Kinder: Kraft, Erfahrung, Mitgefühl“. Die Erinnerungen an seine Internierung im KZ Sachsenhausen, die Stigmatisierung durch seine Behinderung und das Leben als Jude im Deutschen Reich beeinflussten seinen Abituraufsatz sicherlich zutiefst. Das Fazit seines Aufsatzes zeigt dies deutlich: „So dürfen wir wohl zusammenfassend sagen, dass wohl das Unglück für den Menschen im Augenblick etwas Entsetzliches ist, dass aber gerade durch das Unglück ein Mensch zur Vollkommenheit gelangt.“ Am 12. Januar 1940 bestand Rolf Levisohn die Reifeprüfung, die unter dem Vorsitz von Oberschulrat Oberdörffer abgenommen wurde. Nach seinem Abitur bemühte sich Rolf Levisohn weiterhin um seine Auswanderung. Aus diesem Grund gehörte er dem zionistischen Jugendbund Habonim an, mit dem er auch an Sommerlagern teilnahm und so etwas Abwechslung und Hoffnung erhielt. Zudem begann Rolf Levisohn eine Lehre in einer Lehrwerkstatt für Schlosserei, die zu der „Volks- und Höheren Schule für Juden“ gehörte und ihren Sitz in der Weidenalle 10 b hatte. Dies war eine jüdische Einrichtung zur Förderung und Vorbereitung der Auswanderung nach Palästina. Bevor Rolf Levisohn mit seiner Ausbildung beginnen konnte, musste er dort zunächst eine Probezeit überstehen. Doch am 4. März 1940 erhielt sein Vater die Benachrichtigung, dass sein Sohn eine Ausbildung zum Schlosser beginnen könne. Henry Halle, ebenfalls Auszubildender in der Schlosserei und ein Freund Rolfs, berichtete später, dass es Rolf Levisohn mit seiner Behinderung in der Schlosserei oft nicht leicht fiel. Er sei wesentlich zierlicher und zerbrechlicher gewesen als die anderen Jungen dort. Deswegen habe man ihn an einen Schraubstock in der hintersten Ecke gestellt, sodass er nicht von den anderen Auszubildenden angerempelt werden konnte. Im Oktober 1941 kam die Wende im Leben der Familie Levisohn. Sie erhielten die Aufforderung, sich am 24. Oktober in der „Provinzialloge für Niedersachsen“ in der Moorweiden129 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 130 straße einzufinden, von wo sie einen Tag später mit dem ersten Transport von Hamburg nach Lodz deportiert wurden. Die Fahrt dauerte insgesamt zwei Tage und führte in ein völlig überfülltes Getto, in dem katastrophale Lebensbedingungen herrschten. Die Häuser, in denen die Bewohner leben mussten, besaßen keine sanitären Einrichtungen und waren zum größten Teil baufällig. Die hygienischen Bedingungen waren erschreckend, es herrschten Hunger, Typhus und rote Ruhr. Zudem fehlte es an Medikamenten, Kleidung und Heizmaterial. Familie Levisohn wohnte in der Rubensgasse 2 und Rolf Levisohn wurde als Schlosser in den Listen geführt. Vier Wochen nach der Ankunft der Familie in Lodz, am 18. Februar 1942, starb Albert Levisohn im Alter von 51 Jahren. Die Todesursache ist nicht bekannt. Ein Großteil der Gettobewohner erhielt im April die Aufforderung, sich zu medizinischen Untersuchungen einzufinden. Diese Nachricht löste Aufruhr unter den Bewohnern aus, weswegen sich auch nicht genügend Personen meldeten. Als Konsequenz daraus holte die SS einzelne Einwohner gewaltsam aus ihren Wohnungen. Am 25. April wurden auch Rolf und Cilly Levisohn abgeholt und zu einer Sammelstelle gebracht. Dort blieben sie acht Tage lang, wurden untersucht und erhielten einen Stempel auf den Brustkorb und eine Suppe. Am 4. Mai 1942 wurden Cilly und Rolf Levisohn nach Chelmno „ausgesiedelt“, was für sie den sicheren Tod durch Giftgas bedeutete. Zusammen mit anderen Bewohnern des Gettos Lodz wurden die beiden auf Lastwagen verladen und auf den Schlosshof von Chelmno gefahren. Dort wurde den Deportierten erzählt, sie würden in ein Arbeitslager nach Öster- Gedenkblätter für Albert und Cilly Levisohn 130 Yad Vashem (2) 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 131 reich kommen und müssten vorher noch entlaust und gebadet werden, weswegen sie sich zu entkleiden hätten. Nach der Entkleidung wurden sie durch den Keller auf eine hölzerne Rampe geführt, an deren Ende ein Gaswagen stand. Die Möglichkeit zur Flucht war ausgeschlossen. Nachdem 30 bis 40 Personen in den Wagen gezwängt waren, wurden die Flügeltüren geschlossen. Schließlich wurde die Verbindung von Auspuff und Wageninnerem hergestellt und der Motor angestellt. Daraufhin waren Schreie und Stöhnen der Kinder, Frauen und Männer zu hören. Nach zehn Minuten verstummten diese Geräusche. Die Opfer wurden später in einem Massengrab in den Wäldern rund um Chelmno vergraben. Cilly Levisohn war 46 Jahre, ihr Sohn Rolf 21, als sie auf diese Art getötet wurden. Ihr wahrscheinliches Todesdatum ist der 5. Mai 1942. Quellen: 1; 4; 5; 8; StaHH 362-2/20, Lichtwarkschule, 45; Hochmuth/de Lorent: Hamburg: Schule unterm Hakenkreuz, S. 98; Louven: Stolpersteine in Hamburg-Wandsbek, S. 120; Offenborn: Jüdische Jugend, S. 837, S. 1211; Pritzlaff: Entrechtet – ermordet – vergessen, S. 16 ff. Jacob Rosenbacher-Levy, geb. 25.3.1867, Flucht in den Tod am 27.2.1942 Sara Levy, geb. Fehr, geb. 14.1.1868, Flucht in den Tod am 27.2.1942 39 Heinrich-Hertz-Straße 19 Der Kaufmann Jacob Levy kam als jüngster Sohn von Nachmann Jacob Levy und der gebürtigen Pragerin Sophie, geb. Rosenbacher, in Hamburg zur Welt. Er hatte eine drei Jahre ältere Schwester, Anna, die am 30. Mai 1864 geboren wurde. Die Familie lebte bereits seit 1875 in der Sophienstraße 17, einer kleinen Privatstraße zwischen Mittelweg und Außenalster. Der Vater Nachmann Jacob Levy war von Beruf Kaufmann und besaß eine eigene Firma „Mobilien-Lager, Holz- und Fournier = Handl“ mit Sitz in der Catharinenstraße 31 direkt am Fleet. Sophie Levy starb 1892 und ihr Mann folgte ihr im Jahr 1904. Danach wurde der Hausstand in dem geräumigen Stadthaus aufgelöst. Jacob Levy zog daraufhin in den Uhlenhorster Weg 37 in seine erste eigene Wohnung. Seine spätere Frau, Sara Fehr, war die Tochter von Salomon und Johanna, geb. Behrens, und stammte eigentlich aus Braunschweig. Jacob und Sara heirateten am 23. März 1906 in Berlin, Charlottenburg. Heinrich-Hertz-Straße 19, 2009 Privatbesitz Nach ihrer Hochzeit zogen sie nach Hamburg in eine gemeinsame Wohnung in der Heinrich-Hertz-Straße 19. Das jüdische Ehepaar hatte keine Kinder. 131 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 132 Nach 30 Jahren in ihrer Wohnung in der Heinrich-Hertz-Straße wurde das Ehepaar aufgefordert, zum 1. März 1936 umzuziehen. Dieser Aufforderung kamen sie nach und zogen in die Leipziger Straße 19, heute eine Verlängerung der Heinrich-Hertz-Straße. Mit ihren neuen Nachbarn hatten sie kaum Kontakt. Als im Februar 1942 ein weiteres Schreiben der Gestapo die Levys erreichte, in dem sie aufgefordert wurden, ihre Wohnung zum 1. März zu räumen, entschloss sich das Ehepaar, sich das Leben zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt waren beide 74 Jahre alt. Am Abend des 26. Februar 1942 warfen sie den Schlüssel zu ihrer Wohnung in den Briefkasten des Büros ihres Rechtsanwaltes Samson in der Ferdinandstraße 76; Samson war zugleich ihr Testamentsvollstrecker. Der Anwalt entdeckte am nächsten Morgen den Haustürschlüssel und ging direkt zum Polizeirevier, da er bereits annahm, die Eheleute hätten Suizid begangen. Zusammen mit einem Hauptwachtmeister fuhr der Anwalt zur Wohnung der Levys. In der Wohnung fanden beide dann die Eheleute. Jacob Levy saß auf einem Sessel, seine Frau Sara lag daneben auf dem Fußboden. In der Küche lagen vier leere Hülsen Veronaltabletten. Daraufhin wurde der jüdische Arzt Berthold Hannes gerufen. Dieser diagnostizierte eine Veronalvergiftung und ordnete eine Überführung ins Israelitische Krankenhaus in der Johnsallee 54 an, denn noch waren beide Eheleute am Leben. Samson kümmerte sich um die Sicherung der Wohnung und den Nachlass des Ehepaares Levy. Die Ehefrau des Hauswarts aus der Leipziger Straße gab bei der Vernehmung folgendes zu Protokoll: „Zu den Eheleuten Levy kam hin und wieder eine Reinemachefrau, wie sie heißt und wo sie wohnt, kann ich nicht sagen. Die Wohnung Levy liegt über der unseren. Gestern, Donnerstag, wurde um 22 Uhr in der Wohnung Levy Klavier gespielt. So gegen 23:30 Uhr hörten wir Möbelstücke von vorn nach der nach hinten gelegenen Küche tragen. Hier im Haus war allgemein bekannt, dass die Eheleute Levy ihre Wohnung räumen sollten. Um diesem aus dem Weg zu gehen, werden sie wohl übereingekommen sein, freiwillig aus dem Leben zu gehen.“ Jacob Levy verstarb noch am 27. Februar. Seine Frau Sara folgte ihm wenige Tage später am 1. März 1942. Jacobs Schwester Anna Levy beging ebenfalls Selbsttötung, sie starb am 15. Juli 1942 an einer Schlaftablettenvergiftung. Quellen: 1; 4; 5; 8; StaHH 314-15, OFP, R 1941/181; StaHH 331-5, 3 Akte 378; StaHH 331-5, 3 Akte 377; Sparr: Stolpersteine in Hamburg-Winterhude, S. 141. Hans Lieber, geb. 29.4.1890, am 20.2.1945 im Zuchthaus Celle gestorben 40 Von-Essen-Straße 82 (ehemalige Volksschule) Der Sohn eines Angestellten entstammte kleinbürgerlichen Verhältnissen und trat im Alter von 15 Jahren nach seinem Schulabschluss in das Lehrerseminar ein. 1911 wurde Hans Lieber 132 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 133 Hilfslehrer, vier Jahre später bekam er eine Festanstellung an der Volksschule „Von-Essen-Straße“. Noch im selben Jahr, in dem er seine Festanstellung erhielt, zog Hans Lieber als Soldat in den Ersten Weltkrieg. Doch schon nach einem halben Jahr wurde er aufgrund einer Verletzung kriegsunfähig. Nach der Rückkehr aus dem Krieg trat Hans Lieber wieder seine alte Stellung an der Volksschule in Barmbek an und unterrichtete dort Englisch, Biologie und Hans Lieber HLZ Chemie. Neben diesen Fächern bemühte er sich, seinen Schülern seine Vorliebe für den Sport, insbesondere das Wandern, nahezubringen. Während der Weimarer Republik war Hans Lieber Mitglied in der Lehrergewerkschaft „Gesellschaft der Freunde“, welche vor allem sozialdemokratische Mitglieder hatte. Trotzdem traten viele der Kollegen 1933 dem NS-Lehrerbund bei, so auch Hans Lieber. Der Zweite Weltkrieg beeinflusste auch Hans Liebers Arbeit. 1941 musste er im Rahmen der Kinderlandverschickung seine Schulklasse ins sichere Oberbayern begleiten und dort unterrichten. Das Schulgebäude wurde unterdessen für kriegswichtige Einrichtungen genutzt. Bei der Bombardierung Hamburgs im Sommer 1943 wurde Barmbek stark zerstört. Sowohl die Volksschule „Von-Essen-Straße“ als auch Hans Liebers Wohnung im Eilbektal 24 brannten aus. Nach seiner Rückkehr aus Oberbayern wurde Hans Lieber als Vertrauenslehrer für Luftwaffenhelfer im Kreis Harburg eingesetzt. Seine Schüler bedienten Flak-Geschütze, was Hans Lieber in einen tiefen inneren Konflikt stürzte und ihn am Sinn des Krieges zweifeln ließ. Diese Zweifel führten letztlich zu der Äußerung, die ihn sein Leben kostete. Im Kreis seiner Schüler äußerte Hans Lieber im Winter 1943/44 Zweifel am Endsieg der Nationalsozialisten. Damit gerieten die Schüler nun ihrerseits in einen Gewissenskonflikt. Ein Schüler meldete die Äußerung einem Leutnant der Flak-Batterie. Daraufhin wurde Hans Lieber angezeigt und der Vorfall gelangte zur Gestapo-Stelle in Harburg. Nun galt Hans Lieber als „Wehrkraftzersetzer“ und wurde im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel inhaftiert, ehe er zu seiner Verhandlung nach Berlin-Plötzensee verlegt wurde. In Berlin verurteilte ihn der Volksgerichtshof zu fünf Jahren Zuchthaus, die er im Zuchthaus Celle verbüßen sollte. Im August 1944 beteuerte Hans Lieber in seinem Lebenslauf an die Zuchthausbehörde in Celle, er sei nie politisch aktiv gewesen. „Ich habe mich vor 1933 niemals politisch betätigt, habe keiner Partei oder Loge angehört. Ich gehöre seit 1933 dem NS-Lehrerbund und dem NS-Reichsbund für Leibesübungen an und bin seit 1936 ehrenamtlich in der NSGemeinschaft Kraft durch Freude tätig. Ich bin seit Mai 1937 Mitglied der NSDAP.“ Hans Lieber im Zuchthaus Celle HLZ 133 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:13 Seite 134 Am 20. Februar 1945, fünf Tage nach der Inhaftierung im Zuchthaus Celle, starb Hans Lieber an den Folgen eines unzureichend behandelten Erschöpfungszustandes. Zu diesem Zeitpunkt war er gerade 54 Jahre alt. Er wog nur noch 58 kg und wurde als nicht „moorfähig“, wohl aber als „kommandofähig“, eingestuft. Nach seinem Tod wurden seine Kleider verbrannt. Hans Liebers Familie, seine Ehefrau und seine Tochter, erhielten eine kurze Mitteilung über seinen Tod. 1946 wurde Hans Liebers Urne auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt. Bei der Beerdigung hielt der Schulleiter der Volksschule „Von-Essen-Straße“ eine kurze Ansprache für seinen ehemaligen Kollegen. Quellen: Hamburger Lehrerzeitung 11/83; Hochmuth/de Lorent: Hamburg: Schule unterm Hakenkreuz, S. 256 ff. Andreas London, geb. 24.1.1882, am 26.2.1943 deportiert nach Theresienstadt und dort am 18.1.1944 gestorben 41 Friedrichsberger Straße 35 Andreas London wurde als ältestes Kind des jüdischen Ehepaares Adolf und Marianne London, geb. Os, in Lingen geboren. Einige seiner jüngeren Geschwister waren Sophie, Moritz, Elise und Ottilie. Beide Eltern verstarben Anfang der zwanziger Jahre. Schon von Geburt an litt Andreas London an einer Augenkrankheit und an einer körperlichen Missbildung. Deswegen benötigte er Zeit seines Lebens Unterstützung. Außerdem besuchte er lediglich zwei Jahre lang die Volksschule, da er bereits fast erblindet war. Lesen und Schreiben erlernte er nie, sodass er auch keinen Beruf ergreifen konnte. Im Jahr 1904 bekam er einen Pfleger zugesprochen, der ihm helfen sollte. Dieser traf Andreas London jedoch nur selten zu Hause an. Da er keinen richtigen Beruf ausüben konnte, bemühte sich London, mit einem Hausierhandel Geld zu verdienen und war meist unterwegs. Zeitweise schlief Andreas London bei seiner Tante auf einer Couch. Seine Eltern, die ein kleines Geschäft besaßen, hätten ihn vielleicht unterstützen können, doch sie schienen keinen Platz für ihn zu haben. Die Nachbarn beklagten sich mehrfach über Andreas London. Man warf ihm vor, er sei ein Betrüger. Seit 1908 war er vollständig erblindet und fortan auf Fürsorge angewiesen. Deswegen bezog er bis Dezember 1915 auch Armenhilfe, die zwischen 12 und 20 Mark monatlich betrug. Zudem erhielt er mehrmals Geld aus Stiftungen. Mit seinem Freund Berthold Freundlich verließ Andreas London Hamburg. Die beiden wollten eigentlich in Berlin ihr Glück versuchen und dort in den Handel einsteigen. Da dies jedoch nicht funktionierte, kehrten sie schon nach wenigen Tagen ohne Geld in ihre Heimatstadt zurück. Ab Januar 1915 sollte Andreas London in das Werk- und Armenhaus eingeliefert werden. Jedoch weigerte er sich und erschien dort nie. Andreas London wurde immer wieder wegen kleinerer Straftaten festgenommen und verurteilt. So musste er erstmals 1913 für sechs Monate ins Gefängnis, aufgrund eines Sittlich134 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:14 Seite 135 keitsverbrechens. Drei Jahre später wurde er noch einmal zu einem Jahr und neun Monaten wegen Hehlerei verurteilt. Während seiner Haftstrafen bezog eine seiner Schwestern die für ihn bestimmte Armenhilfe. Dies war Betrug und wurde auch geahndet. Im Jahr 1914 wohnte Andreas London kurzzeitig bei einer Bekannten im Bäckerbreitergang 76. Zu diesem Zeitpunkt kannte er wohl schon seine zukünftige Ehefrau Dora Plackmeyer, die evangelisch war. Am 7. Juli 1915 heiratete Andreas London die acht Jahre ältere Dora Plackmeyer. Diese unterstütze fortan ihren Ehemann bei seinem zumeist illegalen Handel. Dies änderte sich jedoch ab dem Jahr 1931, da Dora London erkrankte. 1935 zog das Ehepaar London in die Die Friedrichsberger Straße in den 1950er Jahren Geschichtswerkstatt Barmbek Friedrichsberger Straße 35. Im Dezember desselben Jahres erlitt Dora London einen schweren Unfall, bei dem sie sich vier Rippen brach und im Allgemeinen Krankenhaus Barmbek behandelt werden musste. Wann genau sie verstarb, ist unklar. Jedoch muss sie vor der Deportation ihres Mannes verstorben sein, denn zu diesem Zeitpunkt wurde er als Witwer geführt. Die letzte Adresse von Andreas London lag in der Beneckestraße 6. Von dort aus wurde er am 26. Februar 1943 in das Getto Theresienstadt deportiert, wo er am 18. Januar 1944 starb. Ein ähnliches Schicksal erlitt auch seine Schwester Sophie, die ebenfalls in Theresienstadt ums Leben kam. Quellen: 1; 4; 5; 7; 8; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 24.01.82 London, Andreas. Emilie Löwenstein, geb. 19.4.1875, deportiert am 15.7.1942 nach Theresienstadt, am 21.9.1942 nach Treblinka weiterdeportiert 42 Papenhuder Straße 27 Als eines von drei Geschwistern wurde Emilie Löwenstein in Uelzen geboren. Ihre Eltern Jacob und Cecilie, geb. Esberg, bekamen noch zwei weitere Kinder, Carl und Selma. Nach dem Tod von Jacob Löwenstein zog die Familie in eine kleinere Wohnung um. Anfang der zwanziger Jahre verstarb auch Cecilie Löwenstein und die Geschwister, die bis dahin noch alle zusammengelebt hatten, zogen aus der gemeinsamen Wohnung aus. Im Jahr 1929 entschied sich Emilie Löwenstein, nach Hamburg zu gehen und dort zu leben und zu arbeiten. In der Papenhuder Straße 27 fand sie eine eigene kleine Wohnung und blieb dort bis 1935. Im Warenhaus der Gebrüder Alsberg fand Emilie Löwenstein eine An135 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:14 Seite 136 stellung als Verkäuferin und stieg zur Einkäuferin auf. Dadurch besaß sie ein gutes Einkommen und konnte problemlos für sich sorgen. Geheiratet und eine Familie gegründet hat Emilie Löwenstein nicht. Ihr Neffe Julius Neuhaus erinnerte sich später an das Erscheinungsbild seiner Tante: „Sie war stets modisch und elegant angezogen und trug wertvollen Schmuck, der zum Teil von der Mutter ererbt war.“ 1935 ging Emilie Löwenstein in Rente und damit änderten sich auch ihre finanziellen Möglichkeiten. Von ihrer kleinen Rente konnte sie gerade die Miete zahlen. Zudem musste sie 1935 aus ihrer Wohnung ausziehen und sich ein neues Zuhause suchen. Bis 1939 wohnte sie unter annähernd einem halben Dutzend Adressen bis sie schließlich in der Bornstraße 22, in einem sogenannten Judenhaus unterkam. Am 15. Juli 1942 wurde Emilie Löwenstein ins Getto Theresienstadt deportiert und im September desselben Jahres in das Vernichtungslager Treblinka weiterdeportiert. Dort wurde sie in einer Gaskammer umgebracht. Auch ihre Geschwister Carl und Selma Löwenstein starben im Holocaust. Quelle: 1; 4; 5; 7; 8; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 19.04.75 Löwenstein, Emilie; Juth: Bornstraße 22, S. 97. Julius Löwenstein, geb. 2.4.1881, am 8.11.1941 nach Minsk deportiert und dort verschollen Marianne Martha Löwenstein, geb. Bielefeld, geb. 13.8.1884, am 8.11.1941 nach Minsk deportiert und dort verschollen Ilse Löwenstein, geb. 21.9.1924, am 8.11.1941 nach Minsk deportiert und dort verschollen 43 Humboldtstraße 56 In der Baustraße in Hameln wuchs Julius Löwenstein als Sohn der jüdischen Eheleute Moses und Sara auf. Seine zukünftige Ehefrau Martha war gebürtige Hamburgerin und die Tochter von Hermann und Jeanette Bielefeld. Gemeinsam lebten beide in Hamburg in ihrer Wohnung in der Rutschbahn 25 a. Ihre erste Tochter Margot wurde am 25. Dezember 1914 geboren und am 21. September 1924 folgte ihre zweite Tochter Ilse. Julius Löwenstein war gelernter Konditor und eröffnete 1925 seine eigene Konditorei mit Café im Strohhause. Nach ein paar Jahren musste er dieses Geschäft jedoch aufgeben, da es sich nicht rentierte. Er verlegte den Betrieb in die Humboldtstraße 54, wo er eine neue, kleinere Konditorei führte. Doch auch hier konnte er sich nicht lange halten. Durch die andauernde Weltwirtschaftskrise und die damit verbundene steigende Arbeitslosigkeit blieben die Kunden aus. Schließlich schloss Julius Löwenstein am 7. Juli 1932 sein Geschäft für immer und lebte seitdem von der Fürsorgeunterstützung. Seine Frau Martha Löwenstein war zwar gelernte Friseurin, allerdings ebenfalls erwerbslos. Die Töchter Margot und Ilse verlebten trotzdem eine glückliche Kindheit in der Weimarer Republik. 1921 wurde Margot eingeschult und blieb bis zu ihrem 13. Lebensjahr in der Privat136 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:14 Seite 137 schule in der Johnsallee bei Dr. Löwenberg. Anschließend besuchte sie für zwei Jahre die Jüdische Mädchenschule in der Carolinenstraße. Zu Ostern 1931 wurde auch Ilse eingeschult und blieb bis 1939 auf der Volksschule. Margot Löwenstein bekam nach ihrer Schulzeit eine Lehrstelle bei der Firma Freundlich, die an der Ecke Neuer Wall/ Poststraße ihren Sitz hatte. Dort erlernte sie den Beruf einer Verkäuferin. 1934 fand sie eine Anstellung im Modehaus Alsterdamm, wurde jedoch schon ein Jahr später aufgrund ihrer jüdischen Religion entlassen. Danach fand sie keinen Arbeitsplatz mehr und beschloss des- Die Humboldtstraße in den 1920er Jahren Geschichtswerkstatt Barmbek halb, in die Niederlande auszuwandern. Dort konnte sie bei einer holländischen Familie unterkommen, der sie für Kost und Logis im Haushalt half. 1936 kehrte Margot Löwenstein nach Hamburg zurück, weil ihre Mutter Martha erkrankt war. Margot bemühte sich um eine Arbeitserlaubnis und erhielt letztendlich eine Erlaubnis für Arbeiten im Haushalt. Bis zum Ende des Jahres 1938 konnte sie so bei Katzenstein in der Grindelallee im Haushalt aushelfen. Anfang 1939 emigrierte Margot nach Großbritannien, wo sie Kurt Rosen, einen britischen Soldaten, heiratete und mit ihm in London lebte. Noch im selben Jahr am 17. Dezember kam ihr einziges Kind, Dennis Winston, zur Welt. In Hamburg hatte Julius Löwenstein seit 1935 eine Arbeit als Provisionsreisender gefunden. Nach dem Novemberpogrom erhielt er eine Anstellung als Konditor bei Hellmann’s Gaststätten. Trotzdem reichte das Gehalt kaum aus, um die Familie zu ernähren. Zu Ostern 1939 verließ Ilse Löwenstein die Schule und bemühte sich um eine Lehrstelle. Da sie Jüdin war, gab ihr kein Arbeitgeber einen Ausbildungsplatz. Schließlich fand sie im Mai 1940 eine Anstellung als Arbeiterin und war dort bis zu ihrer Deportation tätig. Familie Löwenstein musste in ihren letzten Jahren in Hamburg, wie viele andere jüdische Familien auch, häufig umziehen. Ihre letzte Adresse lag in der Grindelallee 21, wohin auch der Deportationsbefehl für den 8. November 1941 geschickt wurde. An diesem Tag wurden Julius, Martha und Ilse Löwenstein ins Getto nach Minsk deportiert und gelten seither als verschollen. Margot Löwenstein überlebte als einziges Familienmitglied den Holocaust. Sie verstarb am 25. Dezember 1957 in einem Londoner Krankenhaus. Quellen: 1; 4; 5; 8; StaHH 314-15, OFP, Abl. 1998, J 2/539; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 25.12.14 Rosen, Margot. 137 092-138 Biografien E-L:. 30.08.10 22:14 Seite 138 Paul Lucht, geb. 13.1.1899, inhaftiert 1939–1940, gestorben am 19.1.1942 KZ Neuengamme 44 Mozartstraße 6 a Der am 13. Januar 1899 in Hamburg geborene Paul Lucht versuchte sich als Musiker, Schausteller, Hausierer und Arbeiter seinen Lebensunterhalt zu verdienen, was ihm nicht in ausreichendem Maße gelang, sodass er auch durch Betteln und kleinere Diebstähle zu überleben versuchte. Das führte dazu, dass er zwischen 1922 und 1937 zu insgesamt 28 Geld- und Gefängnisstrafen wegen Eigentumsdelikten, Gewerbevergehens, Hausfriedensbruchs und Bettelns verurteilt wurde. Im Frühjahr 1936 kam zudem eine Verurteilung unbekannten Strafmaßes wegen „Verbreitung unzücht[iger]. Schriften“ hinzu. Im Zusammenhang mit einem „Vergehen gegen den § 175“ wurde er erstmals vom 7. bis 15. November 1939 vom 24. Kriminalkommissariat im KZ Fuhlsbüttel inhaftiert. Daran schlossen sich eine Untersuchungshaft und – nach Verurteilung am 9. Februar 1940 vom Amtsgericht Hamburg zu einer neunmonatigen Gefängnisstrafe nach § 175 – Aufenthalte in den Strafgefängnissen Altona und Glasmoor an. Nach seiner Strafverbüßung am 5. August 1940 wurde Paul Lucht zur Kripo Hamburg überstellt und vermutlich ohne wieder in Freiheit zu gelangen im November 1940 ins KZ Neuengamme eingewiesen, wo er die Häftlingsnummer 3363 tragen musste. Für den 19. Januar 1942 wird dort sein Tod vermerkt. – Bernhard Rosenkranz/Ulf Bollmann Quellen: StaHH, 213-11 Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafsachen, 1351/37 und 4478/38; StaHH, 213-8 Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht – Verwaltung, Abl. 2, 451 a E 1, 1 d; StaHH, 242-1 II Gefängnisverwaltung II, Ablieferungen 13 und 16; B. Rosenkranz/U. Bollmann/G. Lorenz: Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg 1919–1969, S. 233. Foto: Thomas Seelig Max Bernhard Kurt Lübcke, geb. 1.6.1899, inhaftiert 1940–1941, 1943, Selbstmord am 30.4.1943 Polizeirevier Hachmannplatz 45 Hartwicusstraße 3 Max Lübcke kam in Hof Redefin in Mecklenburg als Sohn des Landgestütsdieners Georg Lübcke und der Friederike, geb. Krüger, zur Welt. Als Berufsbezeichnung gab er Dekorateur an, vor seiner letzten Verhaftung arbeitete er als Reichsangestellter beim Flakstützpunkt in der Kaserne Osdorf. Am 24. Februar 1940 war Max Lübcke erstmals wegen homosexueller Handlungen in die Fänge der Kriminalpolizei geraten. Er war bis zum 29. Februar 1940 in „Schutzhaft“ im KZ Fuhlsbüttel und anschließend bis zu seinem Prozess in Untersuchungshaft. Am 10. April 1940 138 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 139 wurde er vom Amtsgericht Hamburg wegen „widernatürlicher Unzucht in zwölf Fällen“ zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Aus dem Urteil: „Es handelt sich bei dem Angeklagten um einen Mann, der in sexueller Hinsicht sich zu allen Verirrungen verleiten lässt und hemmungslos sich seinen geschlechtlichen Verirrungen hingibt.“ Am 29. April 1943 wurde Max Lübcke von einem Kriminalsekretär des 24. Kriminalkommissariats bei einer Razzia in der öffentlichen Bedürfnisanstalt Lange Reihe/Ecke Spadenteich erneut verhaftet, nachdem er mit einem Flaksoldaten in flagranti erwischt worden war. Nach ersten Verhören im 44. Polizeirevier der Bahnhofswache am Hachmannplatz nahm sich Max Lübcke in seiner Arrestzelle in der Nacht zum 30. April 1943 das Leben. Ein von seinem Tod benachrichtigter Onkel lehnte die Übernahme der Beerdigung mit den Worten „Von dem Verstorbenen haben wir uns alle losgesagt gehabt, weil er leichtsinnig war“ ab. – Bernhard Rosenkranz/Ulf Bollmann Quellen: StaHH, 213-11 Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafsachen, 1247/41; StaHH, 331-5 Polizeibehörde – Unnatürliche Sterbefälle, 910/43; StaHH, 213-8 Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht – Verwaltung, Abl. 2, 451 a E 1, 1 e; StaHH, 242-1 II Gefängnisverwaltung II, Ablieferung 16; B. Rosenkranz/U. Bollmann/G. Lorenz: Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg 1919–1969, S. 234. Esther (Elise) Mansfeld, geb. David, geb. 27.9. oder 15.10.1854, deportiert am 23.6.1943 nach Theresienstadt, dort gestorben am 2.10.1943 46 Hofweg 9 Ihr „offizieller“ Vorname war Esther – gerufen wurde sie aber immer Elise. Sie wurde in Großendorf, heute Rahden/Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen, geboren. Ihre Eltern waren Ascher David und seine Frau Mina, geb. Leeser. Ihr Vater arbeitete als Handelsmann und Metzger. Er unternahm mehrmals Reisen, „um Handelsgeschäfte zu verrichten“, z. B. „nach Tecklenburg über Osnabrück“. Dafür wurden ihm die damals erforderlichen Pässe ausgestellt. Elise hatte eine ältere Schwester, die aber im Alter von vier Jahren starb. Von ihren fünf jüngeren Geschwistern starben zwei im Säuglingsalter. Elise besuchte in Großendorf die Schule. Etwa 1864 oder 1865 verließ die Familie Großendorf. Wohin sie von dort aus verzog, ist nicht bekannt. Ab März 1874 lebte die jüdische Familie David in Hannover. Am 2. Januar 1879 heiratete Elise David, die jetzt 24 Jahre alt war, den drei Jahre älteren Albert Mansfeld. In der Heiratsurkunde ist zu ihr vermerkt „ohne besonderes Geschäft“, sodass wohl anzunehmen ist, dass sie nicht berufstätig war. Sie zog von der elterlichen Wohnung am Engelborsteler Damm 2 in die Wohnung ihres Ehemanns am Engelborsteler Damm 74, der dort eine Tabak- und Zigarrenhandlung betrieb. 139 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 140 Erste Seite der Heiratsurkunde von Elise und Albert Mansfeld: „Hannover, am zweiten Januar tausendachthundertsiebenzigundneun Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zum Zweck der Eheschließung: 1. Der Kaufmann Albert Mansfeld, der Persönlichkeit nach durch die nachbenannten beiden Zeugen anerkannt, mosaischer Religion, geboren den fünfzehnten September des Jahres tausendachthundertfünfzigundein zu Wustrow, wohnhaft zu Hannover, Engelborstelerdamm Nr. 74, Sohn der Eheleute: verstorbener Kaufmann Marcus Mansfeld und Hannchen, geborene Cohn, erster zuletzt, letztere noch wohnhaft zu Wustrow, Amt Lüchow 2. die Esther, gerufen Elise, David, ohne besonderes Geschäft, der Persönlichkeit nach durch die nachbenannten beiden Zeugen anerkannt, mosaischer Religion, geboren den 15. Oktober des Jahres tausendachthundertfünfzigundvier zu Grossendorf, Kreis Rahden, wohnhaft zu Hannover, Engelborstelerdamm Nr. 2, Tochter der Eheleute: Handelsmann Ascher David und Minna, geborene Leeser, beide wohnhaft zu Hannover“ Vermerk am linken Rand des Dokuments (hier nicht zu sehen): „Hannover, den 16. Juli 1955 Die Frau Mansfeld ist am 2. Oktober 1943 in Theresienstadt verstorben. Sterbebuch 588, 1955 des Sonderstandesamts Arolsen, Kreis Waldeck. …“ Stadtarchiv Hannover Am 14. November 1879 wurde das erste Kind geboren, der Sohn Paul. In seiner Geburtsurkunde ist vermerkt, „… daß von der Esther, gerufen Elise, Mansfeld, geborene David, Ehefrau des Kaufmanns Albert Mansfeld, beide mosaischer Religion, wohnhaft bei ihrem Ehemanne, zu Hannover, Engelborsteler Damm 74, in der Wohnung ihres Ehemannes … ein Kind 140 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 141 männlichen Geschlechts geboren worden sei, welches die Vornamen Marcus Paul erhalten habe. …“. Am 28. August 1881 wurde das zweite Kind, die Tochter Bertha, geboren. Es folgten Sohn Otto am 7. März 1884 und die Tochter Martha am 13. Januar 1886. Als letztes Kind kam am 28. Februar 1890 die Tochter Clara zur Welt. Elise Mansfeld war jetzt 35 Jahre alt. Ab 1890 zog die Familie in Hannover einige Male um. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts verließen alle Mitglieder der Familie Mansfeld nach und nach Hannover. Elise und Albert Mansfeld zogen mit Clara am 1. April 1905 zunächst nach Neuruppin. Etwa ab 1909 lebten sie in Boxhagen-Rummelsburg, einem Vorort von Berlin. Albrecht Mansfeld war, wie schon in Hannover, im Adressbuch als Kaufmann verzeichnet. Spätestens seit 1913 wohnten sie in Berlin in der Graudenzer Straße 2. In diesem Jahr starb Albert Mansfeld. Elise Mansfeld war mittlerweile 59 Jahre alt. Sie blieb noch etwa zwei Jahre in der Wohnung und lebte dann in der in der Nähe gelegenen Gubener Straße 13. Hier wohnte sie etwa 20 Jahre bis 1938. Am 1. Juli 1938 zog sie im Alter von 83 Jahren zu ihrer in Hamburg lebenden Tochter Bertha und deren Ehemann in den Hofweg 9. Hier wohnte sie die letzten fünf Jahre ihres Lebens, bis sie am 23. Juni 1943 nach Theresienstadt deportiert wurde und dort am 2. Oktober 1943 starb. Elise Mansfelds jüngere Schwester Jette, geboren 1861, erlitt ein ähnliches Schicksal. Sie wurde am 3. Oktober 1942 von Berlin aus nach Theresienstadt deportiert und starb dort am 3. Februar 1943. Was wurde aus Elise Mansfelds Kindern? Der älteste Sohn Paul machte eine kaufmännische Ausbildung in Hannover. Seit 1907 lebte er mit seiner ersten Frau in Berlin. Diese Ehe wurde ungefähr 1926 geschieden. Paul Mansfeld heiratete seine zweite Frau Thea im Februar 1935 in Berlin. Er wurde vom 18. Juni bis 12. September 1938 im Konzentrationslager Sachsenhausen inhaftiert. Am 3. Februar 1939 meldete er sich zusammen mit seiner Frau bei der polizeilichen Meldebehörde in Berlin nach Paris ab, wo sie ihre Visen für die USA abwarten wollten. Nach Kriegsbeginn wurden sie in Frankreich interniert. Als die Visen endlich vorlagen, war eine Ausreise aus einem französischen Hafen nicht mehr möglich. Zu Fuß flohen beide über die Pyrenäen nach Spanien und weiter nach Lissabon. Von dort aus fuhren sie im Mai 1941 mit dem Schiff in die USA zu Thea Mansfelds Tochter aus erster Ehe. Paul Mansfeld starb im Juli 1963 in den USA. Die Tochter Bertha wurde im Alter von 26 Jahren am 13. Februar 1908 in Hannover von ihrer Tante Sophie, der Schwester von Elise Mansfeld, und deren Ehemann Benjamin Biene Bargeboer adoptiert. Bertha Bargeboer lebte spätestens seit 1914 in Hamburg. Auch ihre Adoptiveltern lebten hier für einige Jahre. Als Dentistin betrieb Bertha Bargeboer mehrere Jahre eine Zahnpraxis. Am 26. Juni 1917 heiratete sie Arnold Adolf Wilhelm Welschen, Kaufmann und Fotograf. Er zog in die Wohnung seiner Frau am Steindamm, in der sie noch viele Jahre wohnten. Sie lebten dann einige Jahre im Graumannsweg und zogen im Oktober 1936 in eine große Wohnung im Hofweg 9, in die dann 1938 auch Elise Mansfeld einzog, die von 141 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 142 hier aus deportiert wurde. Bertha Welschen-Bargeboers nichtjüdischer Ehemann musste von Ende Oktober 1944 bis Ende April 1945 Zwangsarbeit leisten – wie alle „jüdisch Versippten“. Er war auf dem Ohlsdorfer Friedhof eingesetzt. Dort lebten sie in einem bewachten Lager und leisteten schwere Arbeit: sie rodeten Bäume, harkten Erde und hoben immer wieder Gräber für KZ-Häftlinge aus Neuengamme aus. Hinzu kam die Angst um den jüdischen Ehepartner, der schutzlos zurückgeblieben war. Bertha Welschen-Bargeboer schrieb in einem Unterstützungsantrag im März 1946: „Ich stand unter dem dauernden seelischen Druck, abgeholt zu werden. Meine Mutter, meine Schwester und mein Bruder wurden nach dem Osten evakuiert, von wo sie nicht zurückgekehrt sind.“ Bertha starb am 19. April 1948 in Hamburg. Otto Mansfeld war von Beruf Kellner. Er heiratete im April 1906 in Hannover. Das Ehepaar zog im Juli 1907 nach Berlin-Rummelsburg. Über den weiteren Verlauf dieser Ehe ist nichts bekannt. Otto Mansfeld lebte bis zu seiner Deportation in Berlin, von 1924 bis 1940 in Neukölln in der Emser Straße. Er wurde am 27. November 1941 von Berlin aus nach Riga deportiert. Das Bundesgedenkbuch weist aus, dass er dort am 30. November 1941 gestorben ist. Vom Berliner Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg wurde er 1955 mit dem 31. Dezember 1945 für tot erklärt. Die Tochter Martha Mansfeld meldete sich von Hannover am 11. März 1906 nach Hasselfelde/Harz ab. Als Beruf ist „Verkäuferin und Stütze“ bei der Abmeldung angegeben. Über ihren weiteren Lebensweg ist nur wenig bekannt. Sie lebte später in Berlin. Sie heiratete, ihr Ehename war Gottberg. Die Ehe wurde geschieden. Von Berlin aus wurde sie am 2. März 1943 nach Auschwitz deportiert. Martha Gottberg, geb. Mansfeld, wurde für tot erklärt. Die jüngste Tochter Clara machte in Hannover eine Ausbildung zur Putzmacherin. Mit ihren Eltern zog sie 1905 nach Neuruppin. Sie heiratete am 4. März 1922 in Berlin den nichtjüdischen Fritz Ambos. Diesen lernte sie wohl in der Gubener Straße 13 kennen, wo sowohl ihre Mutter als auch die Mutter von Fritz Ambos wohnten. Clara und Fritz Ambos wohnten spätestens seit 1927 in Berlin SO 36 in der Cuvrystraße 36. Clara Ambos musste ihre Arbeitsstelle als Putzmacherin auf Veranlassung der Gestapo zum 1. April 1943 aufgeben und den Betrieb verlassen. Auch ihr Mann hatte unter Repressalien zu leiden, weil seine Frau Jüdin war. Fritz Ambos starb im Juni 1949. Clara Ambos, geb. Mansfeld, die weiterhin in der Cuvrystraßr 36 wohnte, ist am 14. November 1970 gestorben. – Ingrid Budig Quellen: 5; 8; StaHH 332-5, Personenstandsunterlagen, 726 + 871/1915; StaHH 332-5, Personenstandsunterlagen, 878 + 385/1924; StaHH 332-5, Personenstandsunterlagen, 1281 + 378/1948; StaHH 332-5, Personenstandsunterlagen, 3753 + 185/1917; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 15.10.54 Mansfeld, Elise; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 28.08.81 Welschen, Bertha; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 22.04.86 Welschen, Wilhelm; StaHH 522-1, Jüdische Gemeinde, 992e; StaHH 741-4, Fotoarchiv, K 2401 L; StaHH 741-4, Fotoarchiv, K 2416 L; Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Abt. I –Entschädigungsbehörde, Berlin, Reg.Nr. 773, 61.631, 327.509, 348.829, 348.830; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Sign. P 2 Nr. 237, 239; Stadtarchiv Rahden , Sign. A 416, A 417, A 831, A 832; Stadtarchiv Hannover; AB 1914 bis 1919, 1927, 1938; AB Berlin, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 1920, 1924,1925,1927, 1928, 1935, 1938; Meyer: „Sonderkommando J“, S. 102ff. 142 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 143 Friedrich Theodor Christian Heinrich Meier, geb. 1.7.1865, inhaftiert 1939, Selbstmord am 2.3.1940 in Hamburg 47 Framheinstraße 4 „Ich bringe dich noch dahin, wo du hingehörst“, waren nach Aussage der Vermieterin Frau Lampa in der Framheinstraße 4 im 1. Stock die Worte eines unbekannten Mannes, der am Morgen des 2. März 1940 ihren Untermieter Friedrich Meier aufsuchte. Dieser Unbekannte soll von ihm Geld gefordert und mit Zuchthaus gedroht haben. Ohne Widerstand ließ sich der 74-jährige Mann seinen Mantel durchsuchen und 10 Mark entwenden. Am späten Vormittag fand die Vermieterin Friedrich Meier dann erhängt in seinem Zimmer, das er erst seit Februar 1940 bei ihr gemietet hatte. Ein Haus in der Framheinstraße, um 1940 Geschichtswerkstatt Barmbek Der am 1. Juli 1865 Neu Lüblow in Mecklenburg geborene Rentner Friedrich Meier war verwitwet und hatte einen Sohn und eine Stieftochter, ersterer konnte von der Polizei nicht ermittelt werden, letztere wollte mit ihrem Stiefvater nichts zu tun haben. Möglicherweise war Friedrich Meier wegen homosexueller Handlungen erpresst worden, denn es ist wahrscheinlich, dass er mit jenem Friedrich Meier identisch war, der vom 10. bis 16. März 1939 im KZ Fuhlsbüttel auf Anordnung des 24. Kriminalkommissariats in Haft saß. – Bernhard Rosenkranz/Ulf Bollmann Quellen: StaHH, 331-5 Polizeibehörde – Unnatürliche Sterbefälle, 765/40; StaHH, 213-8 Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht – Verwaltung, Abl. 2, 451 a E 1, 1 d; B. Rosenkranz/U. Bollmann/G. Lorenz: Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg 1919–1969, S. 235–236. Hugo Meier-Thur, geb. 26.10.1881, am 5.12.1943 im Konzentrationslager Fuhlsbüttel gestorben 48 Lerchenfeld 2 (Kunsthochschule) Der Maler und Grafiker Hugo Meier-Thur lehrte als Professor an der heutigen Hochschule für Bildende Künste am Lerchenfeld 2, die während des Nationalsozialismus noch Hansische Hochschule für bildende Künste hieß. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges musste Hugo Meier-Thur um eine Anstellung an der Kunsthochschule kämpfen und litt unter finanzieller Not. Seine ehemaligen Lehrer brachten ihm Neid und Missgunst entgegen, da sie in ihm einen Konkurrenten an der Kunsthochschule sahen. Deswegen beklagten sie sich über seine Lehrmethoden beim damaligen Direktor Prof. Richard Meyer. Seine größten Konkurrenten 143 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 144 waren Prof. Carl Otto Czeschka und Prof. Paul Helms. Doch noch konnte Hugo Meier-Thur sich gegen die Anfeindungen wehren. Durch eine erfolgreiche Ausstellung konnte Hugo Meier-Thur 1932 auch Anschuldigungen des damaligen Bundes deutscher Gebrauchsgrafiker entgegenwirken. Allerdings gab es nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten einige Personalwechsel und Paul Helms wurde neuer Direktor der Kunsthochschule. Nun wurde es für Hugo Meier-Thur immer schwieriger seiner Arbeit nachzugehen. Seine Zeichnungen und Grafiken Hugo Meier-Thur galten als „entartet“ und er verlor immer mehr Schüler. Eine Stütze fand er in seinem Kollegen Walter Funder, der sich be- reits seit Anfang der zwanziger Jahre in seiner Zeitung „Der Zeitungshändler“ gegen die Nationalsozialisten aussprach. Zu Hause bei Hugo Meier-Thur herrschte eine gemütliche und freundliche Atmosphäre. Er lebte mit seiner Frau Lina und den beiden Kindern Annemarie und Hans Hugo in einer Wohnung in der Wagnerstraße 72. Hugo Meier-Thur besaß kein eigenes Atelier, sondern zeichnete mitten Landschaftsskizze von Hugo Meier-Thur, gezeichnet am 22.11.1943 im Gefängnis StaHH (3) in der Wonung, während um ihn herum das Familienleben tobte. Annemarie heiratete in den dreißiger Jahren und zog von zu Hause aus. Sein Sohn Hans studierte Architektur und arbeitete bei dem Architekten Langenmaack. Während dieser Zeit blieb er in der Wohnung in der Wagnerstraße. Hans Meier-Thur wurde im Frühjahr 1939 zum Pflichtarbeitsdienst einberufen und musste sich dafür zumindest räumlich von seiner Freundin Malve Wilckens trennen. Sie verließ daraufhin Hamburg und fand eine Anstellung in der Werkstatt von Eva Danielzig in Lasdehnen in Ostpreußen. Dort wurde 1940 auch die Verlobung von Hans und Malve gefeiert. Malve Wilckens kehrte im Sommer nach Hamburg zurück und zog zu Hugo und Lina Meier-Thur. Sie schildert Hugo Meier-Thur als einen fürsorglichen und rücksichtsvollen, gleichzeitig aber auch zurückhaltenden und scheuen Mann. Eigentlich sollte die Hochzeit von Hans und Malve im Juni 1941 gefeiert werden, doch dann wurde der Heiratsurlaub für Hans, der sich zu diesem Zeitpunkt als Soldat an der Ostfront befand, gestrichen. Ende Juni 1941 erhielt Familie Meier-Thur die Nachricht, Hans sei am 25. Juni in Litauen an der Front gefallen. Nach diesem Schock kehrte Malve an die Hamburger Kunsthochschule zurück und nahm eine Tätigkeit als Hugo Meier-Thurs Assistentin an. 144 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 145 Zwischen Walter Funder und Hugo MeierThur entwickelte sich im Laufe der Jahre eine enge Freundschaft, da beide das nationalsozialistische Regime ablehnten und sich von den überwiegend regimetreuen Lehrkräfte an der Kunsthochschule abzugrenzen suchten. Gemeinsam verfassten sie Aufsätze und Walter Funder veröffentlichte zu Hugo Meier-Thurs 60. Geburtstag eine Denkschrift. Hugo Meier-Thur und einer seiner Schüler im Jahr 1937 Doch im Dezember 1942 ereilte die Familie Meier-Thur ein weiterer Schicksalsschlag. Lina starb Anfang Dezember auf dem Rückweg von einem Friseurbesuch, als sie von einer Straßenbahn erfasst wurde. Tags darauf wurde Hugo Meier-Thur zur Gestapo zitiert, wo ihm unmissverständlich klargemacht wurde, dass er mit einer sofortigen Verhaftung zu rechnen habe, wenn er weiterhin als Gegner der nationalsozialistischen Kunstauffassung auftrete. Er solle Linas Tod als einen fühlbaren Ordnungsruf verstehen. Diese Drohung nährte in ihm den Verdacht, dass Linas Tod kein Unfall gewesen sei und sie vor die Straßenbahn gestoßen wurde. Bei der Bombardierung Hamburgs im Sommer 1943 wurde die Wohnung in der Wagnerstraße 72 vollständig zerstört. Hugo Meier-Thur wurde verschüttet, überlebte aber leicht verletzt. Er trug lediglich eine Schwerhörigkeit davon. Allerdings war fast seine gesamte 30-jährige Kunstsammlung, sowie die Werke seines verstorbenen Sohnes, zerstört worden. Da Hugo Meier-Thur und Malve Wilckens ausgebombt waren, zogen sie nach Klein Borstel in die Wohnung von Gerda Rosenbrook, der Lebensgefährtin von Walter Funder. Dieser zog ebenfalls dorthin, da auch seine Wohnung in der Bismarckstraße zerstört worden war. Am 1. August 1943 nahm das Verhängnis seinen Lauf. Hugo Meier-Thur und Walter Funder besuchten einen ehemaligen Freund und Nachbarn, Alexander Freiherr von Seld. Beide fühlten sich bei ihm sicher und Walter Funder sprach offen über seine ablehnende Haltung gegenüber den Nationalsozialisten. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Sohn von Herrn von Seld, Alexander jr., gerade Fronturlaub und war zu Hause. Er kannte die Freunde seines Vaters nicht und als Hugo Meier-Thur und Walter Funder das Haus verließen, folgte er beiden mit einem Gewehr bewaffnet, eine „Heldentat“, für die er später Sonderurlaub bekam. Auf der Straße war Geschrei zu hören, weswegen Gerda Rosenbrook Malve Wilckens nach draußen schickte, um nach dem Rechten zu sehen. Als sie Hugo Meier-Thur und Walter Funder fand, saßen beide auf einem Tempo-Wagen mit erhobenen Armen und eine bewaffnete Meute verhöhnte sie als „englische Agenten“, die über Klein Borstel abgesprungen seien. Der Wagen fuhr zur Gestapo. Malve Wilckens musste alleine zurückkehren und beide Frauen bemühten sich daraufhin herauszufinden, was mit den Männern geschehen sei. Hugo Meier-Thur und Walter Funder wurden ins Konzentrationslager Fuhlsbüttel gebracht, wo Gerda Rosenbrook und Malve Wilckens sie einmal im Monat besuchen durften. 145 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 146 Anfang September wurden beide Männer nach Berlin gebracht und vor dem Volksgerichtshof angeklagt. Die Frauen folgten ihnen nach Berlin und nach fünf Wochen trafen alle vier wieder aufeinander. Hugo Meier-Thur und Walter Funder waren müde, erschöpft und ausgehungert. Während gegen Walter Funder Anklage erhoben wurde, schickte man Hugo MeierThur als „Schutzhäftling“ zurück nach Hamburg in die Hände der dortigen Gestapo. Dies war für ihn das Todesurteil. Malve Wilckens wurde telefonisch von dem Gestapobeamten Heyen über den Tod Hugo Meier-Thurs informiert. Eigentlich wollten sie und Hugo heiraten. In ihrer Verzweiflung rannte Malve zur Geschäftsstelle der Gestapo in der Dammtorstraße 25 und machte die im Raum anwesenden Beamten für den Tod Hugo Meier-Thurs verantwortlich. Der Leichnam Hugo Meier-Thurs wurde den Angehörigen zur Bestattung übergeben und wenige Tage später durfte Malve Wilckens seinen Nachlass von der Gestapo abholen. Inwieweit die ehemaligen Gegner an der Kunsthochschule am Tod Hugo Meier-Thurs beteiligt waren, lässt sich nicht nachweisen. Fest steht, dass die Kunsthochschule fast alle Dokumente Hugo Meier-Thurs vernichten ließ. Walter Funder wurde im März 1945 aus der Haft entlassen und überlebte das nationalsozialistische Regime. Allerdings hinterließ die Folter in der Haft ihre Spuren. Walter Funder war nach seiner Entlassung schwer gehbehindert, seine Gesundheit und seine Existenz waren für immer ruiniert. Quellen: StaHH 622-1, Familienarchiv, Meier-Thur, Hugo; Heisig: Der Mord an Hugo Meier-Thur; Bruhns: Kunst in der Krise, S. 414 f. Hertha Melhausen, geb. Lübeck, geb. 8.11.1866, deportiert nach Theresienstadt am 19.7.1942, Todesdatum 18.8.1942 Jonni Melhausen, geb. 20.12.1891, gestorben am 26.8.1943 in Auschwitz 49 Otto-Speckter-Straße 1 Hertha Melhausen wurde am 8. November 1866 als Tochter der jüdischen Eheleute Wilhelm Lübeck und Hannchen, geb. Lilienfeld, in Hamburg geboren. Ihr Ehemann war Isaak Melhausen. Das Ehepaar hatte mehrere Kinder, neben Jonni hatte Hertha 1907 und 1910 auch die Söhne Walter und Kurt geboren, ein älterer Sohn Max stammte möglicherweise aus der ersten Ehe Isaak Melhausens. Hertha Melhausen war in den dreißiger Jahren verwitwet. Sie wohnte in verschiedenen Stadtteilen, in den 1930er Jahren in Barmbek Nord, zuletzt in der Otto-Speckter-Straße 1. Von ihr wissen wir, dass sie am 19. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert wurde. Als Todesdatum gilt der 18. August 1942. Im gleichen Transport befanden sich ihre Verwandten Marianne Melhausen, geboren am 9. April 1864 in Hamburg, und Louis Melhausen, geboren am 2. Januar 1867. Beide kamen um, Louis am 26. Januar 1943 in Theresienstadt und Marianne am 26. September 1942 im Vernichtungslager Treblinka. 146 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 147 Hertha Melhausens Sohn Jonni wurde am 20. Dezember 1891 in Hamburg geboren. Er besuchte die Volksschule und absolvierte eine kaufmännische Lehre in einer Mehlhandlung. Am 28. August 1918 heiratete er die evangelisch getaufte Auguste Karoline Luise Haberland, geboren am 14. November 1998. Im Jahr darauf wurde am 2. September Tochter Käthe geboren, drei Jahre später, am 8. Juni 1922, die Tochter Edith. Jonni Melhausen betrieb einen kleinen Kolonialwarenladen in der Grindelallee, das Amt für Wirtschaftsordnung stellte den Gewerbeschein am 15. November 1914 aus. Nach dem Verkauf des Ladens 1921 eröffnete er einen weiteren Laden in der Schwenkestraße, der nicht gut lief. Ab 1932 arbeitete Jonni als selbstständiger Vertreter, anfangs bei seinem Bruder Max Melhausen, dem ein Ladengeschäft für Tabakwaren gehörte. Nach Differenzen zwischen den Brüdern war er unter anderem für die Firmen Matthes am Schulterblatt und Elektro-Lux als Vertreter für Staubsauger und Radioapparate tätig. In dieser Zeit soll er ca. 500 RM im Monat verdient haben. Seine Miete im Jahre 1932 betrug 90 RM. 1934 war Jonni Melhausen kein Mitglied der Jüdischen Gemeinde und zahlte keine Kultussteuern. Nach Erlass der „Nürnberger Gesetze“ fand er keine Arbeit mehr, weil niemand einen Juden beschäftigen wollte. Er musste sich als arbeitsuchend beim Arbeitsamt melden. Dadurch wurde er in der Folge von verschiedenen Firmen dienstverpflichtet zu einem äußerst geringen Lohn von monatlich 50 RM. 1938 musste Jonni Melhausen – wie alle jüdischen Haushaltsvorstände – sein Radio abgeben. Die Familie hatte nacheinander Wohnsitze in Barmbek und Uhlenhorst, im Hamburger Adressbuch von 1938 ist die Otto-Speckter-Straße 1 genannt. Möglicherweise lebten sie aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage zusammen mit der Mutter Hertha Melhausen, die ebenfalls in diesem Haus wohnte und zuvor noch eine ältere Verwandte in ihrer Wohnung gepflegt hatte. Die beiden Töchter hatten früh geheiratet, es ist nicht sicher, bis wann sie bei den Eltern lebten. Im Herbst 1939 wurde Jonni Melhausen als Jude vom Arbeitsamt zur Zwangsarbeit als Straßenfeger und in andere Stellen verpflichtet. Am 27. Februar 1943 wurde er im Rahmen der sogenannten Schallert-Aktion an seinem Arbeitsplatz in der Fabrik einer Harburger Mühle (evtl. Reismühle) verhaftet, wie weitere Zwangsarbeiter auch. Betroffen waren insgesamt 17 männliche Juden, die „privilegierte Mischehen“ führten und in deren Rahmen eigentlich einen gewissen Schutz genossen. Willibald Schallert, Leiter der Sonderdienststelle des Arbeitsamtes für jüdischen Arbeitseinsatz, hatte nach der „Fabrik-Aktion“, bei der reichsweit Tausende jüdischer Zwangsarbeiter verhaftet und nach Auschwitz deportiert worden waren, in Hamburg eine Liste jüdischer „Arbeitssaboteure“ erstellt, die allesamt in „Mischehen“ lebten. Jonni Melhausens Frau Auguste erhielt die Nachricht über seine Gefangennahme durch einen anderen Arbeiter. Zwei Wochen vor der Verhaftung, am 12. Februar, war Jonnis erstes Enkelkind zur Welt gekommen, das von seinem Großvater nur kurz begrüßt werden konnte und ihn nicht mehr kennenlernen durfte. Auguste Melhausen hatte nur einmal für zehn Minuten Möglichkeit, 147 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 148 mit ihrem Mann in Gegenwart eines Beamten zu sprechen. Dabei rätselte er über den Grund für seine Inhaftierung, weil es keine Verurteilung gegeben hatte. Seine Frau durfte ihm einmal wöchentlich Lebensmittel bringen und frische Wäsche gegen gebrauchte austauschen. Darin fand sie einen Zettel von ihrem Mann mit dem Hinweis, er solle deportiert werden. Nach zwölf Wochen als „Schutzhäftling“ im KZ Fuhlsbüttel wurde er am 27. April 1943 nach Auschwitz deportiert. Dort starb Jonni Melhausen laut Todesurkunde in der Kasernenstraße am 26. August 1943. Seine Frau forderte eine Sterbeurkunde an und erhielt sie unter dem Datum des 11. November 1943. Auguste Melhausen erhielt weder Unterstützung noch Arbeit, weil niemand sie als Witwe eines Juden beschäftigen wollte. Ihre Wohnung wurde während der Bombenangriffe zerstört, vom Hausrat konnte nichts gerettet werden. So war sie gezwungen, Geld zu leihen und sich zu verschulden. Nach dem Krieg fand sie eine Stelle als Raumpflegerin und Botin im Niederländischen Konsulat. Sie musste ihre Schulden abbezahlen und lange um eine Wiedergutmachungsrente kämpfen, weil Jonni Melhausens Einkommen während seiner freiberuflichen Tätigkeiten schwer geschätzt werden konnte. So bestätigte ein Kaufhaus Matthes, in dem er als Staubsaugervertreter tätig gewesen war, dass er dort in den dreißiger Jahren gearbeitet hatte. Unterlagen darüber existierten jedoch nicht mehr, sodass keine Angaben zur Verdiensthöhe gemacht werden konnten. Angeschriebene Mühlen behaupteten später, nie mit ihm in Kontakt gewesen zu sein – niemand wollte in den Ruf geraten, Zwangsarbeiter beschäftigt zu haben. Bewilligt wurde eine Sonderrente von 140 Mark. Für 4 Monate anerkannte Haftzeit ihres verstorbenen Mannes gab es 225 Mark Entschädigung und eine kleine Summe wurde für bei der Verhaftung einbehaltene Wertgegenstände wie Uhr und Ringe genehmigt. Auguste Melhausen erklärt den ehemaligen Besitz eines Radios, das von ihrem Mann abgeliefert werden musste StaHH 148 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 149 Auguste Melhausens Darstellung zur Verhaftung ihres Ehemannes, seinem Tod und der eigenen Lebenssituation StaHH Auch ihre inzwischen verheirateten Töchter musten um ihre materielle Existenz kämpfen. Auguste Melhausen starb am 8. Juni 1962 in Hamburg. – Eva Acker/Erika Draeger Quellen: 1; 4; 5; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 20.12.91 Melhausen, Jonni; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 14.11.98 Melhausen, Auguste; Beate Meyer: Die Verfolgung und Ermordung der Hamburger Juden, S. 70 ff; S. 84; Beate Meyer: Jüdische Mischlinge – Rassenpolitik und Verfolgungserfahrung 1933–1945, S. 199; Archivum Panstwowe, Lodz. 149 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 150 Margarethe Meyer, geb. Kaufmann, siehe Jakob Kaufmann Bendixensweg 11 Bertha Michelsohn, geb. Hirsch, geb. 23.10.1899, deportiert am 1.7.1942 nach Auschwitz 50 Kanalstraße 2 Bertha Michelsohn war das dritte von vier Geschwistern: Dem Erstgeborenen Arthur, geb. 3. April 1895, folgten Käthe (27. Juli 1893), dann Bertha und am 4. Mai 1902 kam der Jüngste, Hermann, zur Welt. Der Vater Leopold Hirsch, geb. 14. Juni 1862, arbeitete als Schuster, ob seine Frau Johanna, geb. Lehmann, (31. Oktober 1871) im Betrieb mitarbeitete oder sich ausschließlich um den Haushalt und die vier Kinder kümmerte, ist nicht bekannt. Leopold starb spätestens 1925. Bertha heiratete den kaufmännischen Angestellten Waldemar Michelsohn, der am 25. Januar 1890 als Sohn von Simon Arye Michelsohn und seiner ersten Ehefrau Adele, geb. Lilienfeld, geboren wurde. Waldemar und Bertha Michelsohn wohnten in der Kanalstraße 2 „auf der Uhlenhorst“. Bertha wurde früh Witwe, da Waldemar am 28. März 1928 mit nur 37 Jahren verstarb, nachdem er drei Jahre an den Folgen eines Raubüberfalls gelitten hatte. Er wurde, wie seine Eltern und seine 1996 verstorbene Halbschwester, die Tänzerin und Choreographin Erika Milee, auf Das Haus in der Kanalstraße 2, 2009 Privatbesitz dem Jüdischen Friedhof Ilandkoppel bestattet. Bertha Michelsohn verdiente Ihren Lebensunterhalt als Haus- angestellte, ihr letzter Wohnort und möglicherweise gleichzeitig ihr Arbeitsplatz, war in der Johnsallee 54 (einem sogenannten Judenhaus). Das Haus gehörte der Jüdischen Gemeinde, im Laufe der Zeit waren verschiedenste jüdische Institutionen in dem Gebäude untergebracht, u. a. diverse Jugendorganisationen, eine Musikschule, die Gemeindebibliothek, ein Sportverein und eine Außenstelle des Israelitischen Krankenhauses. Das alte Gebäude existiert nicht mehr, es wurde in einer Bombennacht zerstört. Bertha Michelsohn wurde am 11. Juli 1942 von Hamburg nach Auschwitz deportiert. Wahrscheinlich starb sie dort bald nach ihrer Ankunft in den Gaskammern. Nach Kriegsende wurde Bertha Michelsohn für tot erklärt. – Stefanie Rückner Quellen : 1; 4; 5; 8; ITS/ARCH/Transportliste Gestapo, Hamburg am 11. Juli 1942/11197782#1 (1.2.1.1/0001-0060/0017A/0117); E-Mails mit Ralph Michelson, Israel, 2009; Jüdischer Friedhof Ilandkoppel. 150 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 151 Rudolf Albert Müller, geb. 9.3.1910, inhaftiert 1936–1937, 1939, Selbstmord am 3.2.1939 im KZ Fuhlsbüttel 51 Diesterwegstraße 4 Der am 9. März 1910 in Hamburg geborene Rudolf Müller war einer von mindestens vier Kindern des Wilhelm Müller und der Luise, geb. Wichmann. Rudolf Müller erlernte das Schneiderhandwerk und arbeitete in diesem Beruf als Geselle. Zusammen mit seinem ebenfalls homosexuellen Bruder Herbert verkehrte er Mitte der dreißiger Jahre regelmäßig in den Homosexuellenlokalen „Colibri“ (Raboisen), „Stadtcasino“ (Graskeller) und im Alsterpavillon. In dieser Zeit wohnte er bei seinen Eltern in der Straße Ölmühle 27 auf St. Pauli. Im Sommer 1936 sollten in Berlin die internationalen Gäste der Olympiade die Stadt unbehelligt von der Homosexuellenverfolgung der Gestapo erleben. Während dieser Zeit wurde das Sonderkommando Nord der Gestapo zur gezielten Verfolgung Homosexueller von Altona aus in Hamburg eingesetzt. Im Zuge der Ermittlungen dieser Fahndungsgruppe wurde am 25. Juli 1936 auch Herbert Müller verhaftet und bis zum 24. August im KZ Fuhlsbüttel festgehalten. Bei der Durchsuchung der elterlichen Wohnung des Verhafteten am 28. Juli wurde auch Rudolf Müller angetroffen. Dessen „äusserliche Erscheinung ... und sein dabei zu Tage Bericht der Gestapo vom 29. Juli 1936 StaHH 151 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 152 tretendes Gebahren“ veranlassten die Polizei, „den dringenden Verdacht der homosexuellen Veranlagung“ gegen Rudolf Müller zu erheben. Auch er wurde einen Tag später verhaftet und blieb bis zum 24. August 1936 im KZ Fuhlsbüttel. Nach anfänglichem Leugnen räumte er in späteren Verhören eine bisexuelle Veranlagung ein und bekannte sich auch zu gleichgeschlechtliche Handlungen, nannte jedoch keine Namen seiner Partner. Am 4. September 1936 wurde er vom Amtsgericht Hamburg zu einem Jahr Gefängnis nach § 175 alter und neuer Fassung verurteilt, 1937 erreichte sein Vater durch ein Gnadengesuch einen Straferlass von 61 Tagen. Am 24. Januar 1939 wurde er erneut wegen Vergehens nach § 175 festgenommen und nach Verhören zum Geständnis zweier sexueller Handlungen mit einem Soldaten und dem 20-jährigen Reisevertreter Egon Hartmann, seinem damaligen festen Freund, gebracht. Vom 25. Januar bis 3. Februar 1939 befand er sich im KZ Fuhlsbüttel, wo er sich am 3. Februar 1939 mit einem Schal erhängte. – Bernhard Rosenkranz/Ulf Bollmann Quellen: StaHH, 213-11 Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafsachen, 8168/36; StaHH, 331-5 Polizeibehörde – Unnatürliche Sterbefälle, 369/39; StaHH, 213-8 Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht – Verwaltung, Abl. 2, 451 a E 1, 1 a; StaHH, 242-1 II Gefängnisverwaltung II, Ablieferungen 13 und 16; B. Rosenkranz/U. Bollmann/G. Lorenz: Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg 1919–1969, S. 239. Max Carl Nathan, geb. 19.3.1878, inhaftiert am 10.7.1936 im Konzentrationslager Fuhlsbüttel, Todesdatum 30.10.1936 Wilhelm Sander (früher Nathan), geb. 21.2.1905, inhaftiert am 10.7.1936 im Konzentrationslager Fuhlsbüttel, deportiert nach Auschwitz, Todesdatum 14.5.1943 52 Karlstraße 2 Max Nathan war in erster Ehe mit Emma Schürmann, die evangelisch war, verheiratet und gründete mit ihr eine Familie. Das Ehepaar hatte drei Kinder, ihr Sohn Alfred kam am 9. April 1902 zur Welt, dann folgte Wilhelm am 21. Februar 1905 und zuletzt wurde ihre Tochter Nanni am 9. Oktober 1907 geboren. Die Familie lebte in der Rothenbaumchaussee 158. Doch das Familienverhältnis war schon früh gestört, da sich beide Elternteile oft stritten und rasch trennten. Nanni zog zu ihrer Mutter und ihre Brüder Alfred und Wilhelm blieben beim Vater und ihrem Kindermädchen Elna Leopold. Max Nathan zog mit seinen beiden Söhnen aus der Wohnung in der Rothenbaumchaussee aus und betrieb einen kleinen landwirtschaftlichen Hof in Wandsbek-Eichthal. Schon während seiner Schulzeit musste sich Sohn Wilhelm abfällige Bemerkungen über seine Familiensituation gefallen lassen, was zu einigen Zusammenstößen mit Schulkameraden führte. Als strebsamer Schüler war Wilhelm Klassenbester, was ihn von einem Studium träumen ließ. Doch diesen Traum setzte er nicht in die Tat um, weil sein Vater ihm wohl nie die lange Studienzeit finanziert hätte. Denn obwohl die Familie wohlhabend war, achtete Max Nathan sehr auf sein Geld. Dadurch war das Verhältnis zwischen den Geschwistern und ihrem Vater oft angespannt. 152 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 153 Mit sechzehn Jahren begann Wilhelm Nathan eine Lehre bei der Firma Kuhlmann. Diesen Ausbildungsplatz besorgte ihm sein Vater. Der Inhaber stellte sich jedoch als Betrüger heraus und nach nur drei Monaten brach Wilhelm seine Lehre ab. Die nächste Ausbildung begann er, erneut auf Anraten des Vaters, bei der Commerz und Industrie GmbH in der Humboldtstraße. Doch auch dieses Unternehmen stellte sich als unseriös heraus. Nun besorgte sich Wilhelm Nathan eigenständig einen Ausbildungsplatz bei der Bankfirma Samson & Co. Zuerst durfte Wilhelm Nathan keinen Börsendienst tätigen, da seine Garderobe zu schäbig war und sein Vater sich weigerte, ihm Geld für einen neuen Anzug zu geben. Nachdem Wilhelm jedoch das erste eigene Gehalt erhielt, konnte er sich neu einkleiden, stieg zum Arbitrageur (Händler, der Kursunterschiede aufspürt und ausnutzt) auf und leitete bis zum Ende seiner Lehre eine Filiale. Mit 19 Jahren hatte Wilhelm Sander ausgelernt und trat ins väterliche Geschäft ein. Max Nathan führte einen Möbel-Groß- und Einzelhandel in der Werderstraße 38, in dem auch schon sein ältester Sohn Alfred mitarbeitete, meist als Chauffeur für seinen Vater. Wilhelm Nathan zeigte einiges Talent für den Beruf, woraufhin ein Konkurrenzkampf zwischen Vater und Sohn entbrannte. 1925 heiratete Max Nathan erneut. Seine neue Ehefrau war die inzwischen 36-jährige Elna Leopold, das ehemalige Kindermädchen. Auch sie war evangelisch. Zu den Söhnen hatte Elna ein gutes Verhältnis, da sie die beiden aufgezogen hatte. Emma Schürmann bat ihren Sohn Wilhelm häufig um Geld, welches er ihr auch gerne gab. Allerdings fand er, dass sich seine Eltern zu sehr für materielle Dinge interessierten. Mit 21 Jahren entschloss sich Wilhelm Nathan, in die USA auszuwandern. Dort angekommen, fand er zwar rasch Arbeit, vertrug jedoch das Klima nicht und musste im Herbst 1926 nach Hamburg zurückkehren. Nach seiner Rückkehr trennte sich Wilhelm Nathan endgültig von seiner Mutter. Beide sahen sich danach nie wieder. Seit diesem Zeitpunkt beschloss er für immer zu seinem Vater zu halten, der ihn zuvor schon vor seiner Mutter gewarnt hatte. Doch das Jahr 1926 brachte für Wilhelm Nathan auch Erfreuliches. In einem Café lernte er Lina Wilhelm, die Tochter des Schlachtermeisters Heinrich Schröder aus Bremen, kennen. Sie war evangelisch, hatte 1921 den Kaufmann Wilhelm geheiratet und ein gemeinsames Kind mit ihm, die Scheidung erfolgte im Jahr 1927. Wilhelm Nathan und Lina Wilhelm blieben bis zu seiner Inhaftierung ein Paar, sie waren zwischen 1928 und 1933 verlobt. Nach seiner Rückkehr aus den USA zog Wilhelm Nathan wieder bei seinem Vater Max Nathan ein und gründete sein erstes Geschäft in der Motorradbranche. Da er recht erfolgreich war, überredete ihn Max Nathan dazu, ihn zur Hälfte am Geschäft zu beteiligen. Als Gegenleistung sollte Wilhelm Nathan zu einem Viertel am Möbelhandel seines Vaters beteiligt werden. Außerdem kaufte Max Nathan zu dieser Zeit die Firma Sewerin auf und ließ seinen Sohn Alfred offiziell als Inhaber eintragen, obwohl dieser weiterhin lediglich der Chauffeur seines Vaters blieb. Von nun an liefen die meisten Finanztransaktionen von Max Nathan über die Firma Sewerin. 153 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 154 Immer wieder geriet Max Nathan bei seinen Geschäften an die falschen Geschäftspartner und dementsprechend oft in Schwierigkeiten mit der Justiz. Einige kleinere Verfahren wälzte er auf seine Söhne ab. Dadurch geriet der Name Nathan in Verruf, was sogar dazu führte, dass Tochter Nanni keine Anstellung als Kassiererin bekam, als ihr Vorgesetzter erfuhr, dass sie eine gebürtige Nathan war. Letztlich musste Wilhelm Nathan feststellen, dass sein Vater sein Leben lang dem Geld nachgejagt war und dabei seine Familie vernachlässigt hatte. Deswegen entschlossen sich die Brüder Alfred und Wilhelm 1930, ihren Nachnamen in Sander ändern zu lassen. So bestand für sie die Chance, wieder einen unbelasteten Namen zu führen und ohne Probleme ihren Geschäften nachzugehen. 1929 erkrankte Wilhelm Sander. Aufgrund eines Herzleidens musste er zweimal zur Kur nach Nauheim. Die Krankheit begleitete ihn bis an sein Lebensende. Nanni heiratete 1930 und Alfred zog ebenfalls von zu Hause aus. Seit einiger Zeit arbeitete er an verschiedensten Patenten, hatte jedoch wenig Erfolg damit. Als Wilhelm Sander ihn darauf ansprach, entbrannte ein Streit zwischen den Brüdern, der zu einem Zerwürfnis der Geschwister führte, das erst 1935 beigelegt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Alfred Sander bereits verheiratet und hatte eigene Kinder. Zu Beginn der dreißiger Jahre nahm der wirtschaftliche Konkurrenzkampf angesichts der Weltwirtschaftskrise erheblich zu. Max Nathan beteiligte sich zunehmend an nicht ganz legalen Geschäften, vergab hohe Kredite, rechnete aber nicht ordentlich ab. Wilhelm Sander gründete seine eigene Firma, Sander & Weiß (Dammthor-Lombard) und etablierte einen eigenen Handel mit neuen Möbeln. 1931 reiste er geschäftlich für kurze Zeit nach Holland. Ein Jahr später trat erstmals das Finanzamt an ihn heran, da es den Verdacht hegte, die Bücher könnten nicht stimmen und es gäbe Steuerrückstände. Max Nathan reagierte darauf mit einer für ihn typischen Redensart, die seine Einstellung zu Steuern deutlich machte: „Der alte Bücherrevisor Gabriel Meyer habe ihm gesagt, bezahlen müsse man erst, wenn der Gerichtsvollzieher zum Abholen vor der Tür stände.“ Bis 1936 zahlte Wilhelm Sander allein seinen Anteil der Steuern an den Familienunternehmen, erst ab Sommer 1936 beteiligte sich auch Max Nathan. Dementsprechend sorgfältig kontrollierte das Finanzamt seit 1932 Wilhelm Sanders Bücher und Steuerzahlungen. Die Söhne bemühten sich, Max Nathan aus den Geschäften möglichst herauszuhalten. Wilhelm Sander übernahm den Möbelhandel und investierte sein Vermögen teilweise in Grundstücke. Eines dieser Grundstücke lag an der Ecke Karlstraße/ Schöne Aussicht. Dorthin verlegte Wilhelm Sander auch seinen Wohnsitz und Max und Elna Nathan zogen zu ihm. Obwohl Wilhelm und Alfred sich bemühten, den Namen Der Eingang des Hauses in der Karlstraße 2, 2009 Privatbesitz 154 Sander zu schützen, begann Max Nathan Mitte der dreißiger Jahre regelmäßig mit Sander zu unterschreiben. Dadurch rui- 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 155 nierte er in kürzester Zeit auch den Ruf dieses Namens und es kam zu Streitigkeiten in der Familie. Auf einer Familienreise zu Pfingsten 1936 nach Kopenhagen eskalierte der Streit. Da Wilhelm und Elna befürchteten, hinter Max Nathans Handlungen könne vielleicht eine Krankheit stecken, schickten sie ihn im Sommer 1936 zur Erholung nach Marienbad. Während Max Nathan noch dort war, wurde Wilhelm Sander am Morgen des 10. Juli von der Gestapo verhaftet und ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel gebracht. Zuerst hieß es, er müsse nur solange in Haft bleiben, bis Max Nathan wieder da sei. Man wolle eine Kollisionsgefahr ausschließen. Doch schon drei Tage später wurde Wilhelm Sander in „Schutzhaft“ genommen und musste 14 Tage auf seine erste Vernehmung warten. Dabei gab er zwar zu, dass die Bücher nicht ganz stimmten, hielt jedoch seinen Vater vollständig heraus. Inzwischen waren auch sein Vater und sein Bruder verhaftet worden. Gefangenenkarteikarte von Wilhelm Sander aus Fuhlsbüttel StaHH Auf dem Gefängnishof wurden die drei Männer zu einem einstündigen Dauerlauf gezwungen. Vorn lief Alfred, hinter ihm Max und zum Schluss folgte Wilhelm. Dieser litt wegen seines Herzleidens unter starken Schmerzen. Später brach er in seiner Zelle bewusstlos zusammen und wurde daraufhin in Eisen gelegt. Er berichtete darüber: „Die furchtbarste Zeit meines Lebens. Stunde um Stunde lief ich in der Zelle herum, die Nerven zerrüttet, von trüben Gedanken zerquält, was war denn auch schon mein Leben bisher gewesen. Familienstreitigkeiten von Anfang an. Da beschloss ich, alles, mag es sein was es war, zu ertragen, um meinen Vater zu unterstützen.“ 155 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 156 Zwar weigerte sich Wilhelm Sander, bei den Vernehmungen gegen seinen Vater auszusagen, doch alle Bemühungen waren vergeblich. Am 31. Juli 1936 fand die Gestapo in der Wohnung von Max Nathan Bargeld, Schmuck, Wilhelm Sanders Pass und den Schlüssel zu einem Schließfach in Kopenhagen, in dem dänische Devisen deponiert waren. Damit hatte die Gestapo genügend Beweise beisammen, um die Familie anzuklagen. Auf dem Rückweg von einer Vernehmung sah Wilhelm Sander seinen Vater ein letztes Mal: „Ich sah meinen Vater vor seiner Tür essen, also auch in Eisen! Ein armer, armer zerbrochener alter Mann! Irgendetwas in mir zerbrach. Ich war fertig, restlos, unfähig auch nur einen Gedanken zu fassen. Es war das letzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen hatte. Dieses Bild meines Vaters in Zuchthauskleidung, zerbrochen, vor der Tür essend, ist wie mit Feuer in meine Seele eingebrannt! Es verfolgt mich heute noch Tag und Nacht.“ Noch am selben Tag versuchte Wilhelm Sander, sich in seiner Zelle zu erhängen. Doch der Hosenträger zerriss, und er stürzte zu Boden. Inzwischen war er aufgrund seines Herzleidens und wegen der schlechten Behandlung im Gefängnis physisch und psychisch am Ende seiner Kräfte. Trotzdem leugnete er bei Vernehmungen weiterhin alles, was mit Max Nathans Finanzen zu tun hatte. Anfang November 1936 wurde Wilhelm Sander mitgeteilt, man habe nun alle nötigen Beweise beisammen und er könne deswegen aus der Einzelhaft entlassen und auf den Saal zu den anderen Häftlingen verlegt werden. Erst von anderen Häftlingen erfuhr Wilhelm Sander, dass sein Vater bereits am 30. Oktober an den Folgen seiner Haft verstorben war. Im November begann der Prozess gegen Wilhelm und Alfred Sander, Elna Nathan und Lina Wilhelm. Die Anklageschrift besagte, dass die Familie Nathan zwischen 1926 und 1936 dem deutschen Staat durch nicht gezahlte Umsatz-, Einkommens-, Gewerbeertrags- und Vermögenssteuer rund 400 000 RM vorenthalten hatte. Wilhelm Sander wurde zudem noch wegen des Verstoßes gegen das „Gesetzes zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“, also wegen „Rassenschande“, angeklagt. Das Hanseatische Sondergericht verurteilte Wilhelm Sander zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft, sowie zu einer Geldstrafe von 150 000 RM. Lina Wilhelm wurde zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt und Elna Nathan erhielt eine Strafe von drei Monaten Zuchthaus und 600 RM Strafe. Nach seiner Verurteilung wurde Wilhelm Sander ins Zuchthaus Bremen-Oslebshausen verlegt. Im Oktober 1942 bestimmte ein Erlass, dass reichsdeutsche Gefängnisse und Zuchthäuser „judenfrei“ werden sollten. Wilhelm Sander wurde nach Auschwitz deportiert, wo er am 14. Mai 1943 den Tod in einer Gaskammer fand. Seine Geschwister Alfred und Nanni, sowie seine Mutter Emma, seine Stiefmutter Elna und seine Verlobte Lina überlebten den Holocaust. Quellen: 1; 4; 5; 8; StaHH 221-5, Verwaltungsgericht, 219; StaHH 314-15, OFP, R 1936/83; StaHH 31415, OFP, R 1939/2486; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 21.2.05 Sander, Wilhelm; Meyer: „Jüdische Mischlinge“, S. 248 f. 156 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 157 Heinrich Georg Orgler, geb. 3.2.1905, inhaftiert 1936–1937, Selbstmord am 11.8.1944 in Hamburg 53 Hufnertwiete 2 Der Damenschneider Heinrich Orgler gehört zu den Fällen, deren Biografien mit den Akten vernichtet wurde. Lediglich einige Gefangenkarteikarten und ein Polizeibericht über das Auffinden seiner Leiche können noch Hinweise auf sein Schicksal geben. Heinrich Orgler wurde am 3. Februar 1905 in Rosenheim als unehelicher Sohn der Franziska Orgler geboren, sein Stiefvater Die Hufnertwiete im Sommer 2009 Privatbesitz hieß Paul Danner. Möglicherweise hat ihn seine in Hamburg wohnende Schwester dazu bewogen, von Bayern in den Norden zu ziehen. Im Oktober 1936 geriet er wegen homosexueller Handlungen in die Fänge des NS-Regimes. Vom 20. Oktober bis zum 27. November 1936 befand er sich deshalb in polizeilicher „Schutzhaft“ im KZ Fuhlsbüttel. Am 12. Dezember 1936 wurde er zu 12 Monaten Haft wegen Vergehens gegen § 175 verurteilt. Durch eine Verfügung der „Gnadenabteilung“ wurde er am 1. August 1937 vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Dann verlieren sich seine Spuren. Anfang 1939 heiratete er die acht Jahr ältere Irma, geb. Lehmbecker. Während des Krieges wurde er in einer Fabrik dienstverpflichtet und soll herzkrank gewesen sein. Am 11. August 1944 wurde er tot in der Parterrewohnung Hufnertwiete 2 aufgefunden, in der er mit seiner Ehefrau und zwei Untermietern wohnte. Seine Ehefrau war zu diesem Zeitpunkt verreist. Er hatte sich mit Leuchtgas vergiftet. Aus der Polizeiakte über den „unnatürlichen Sterbefall“ von Heinrich Orgler geht nicht hervor, ob er den Selbstmord aus Furcht vor einer erneuten Inhaftierung wählte oder aus Verbitterung über eine nicht gelebte Homosexualität. – Bernhard Rosenkranz/Ulf Bollmann Quellen: StaHH, 331-5 Polizeibehörde – Unnatürliche Sterbefälle, 1103/44; StaHH, 213-8 Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht – Verwaltung, Abl. 2, 451 a E 1, 1 a; StaHH, 242-1 II Gefängnisverwaltung II, Ablieferungen 13 und 16; B. Rosenkranz/U. Bollmann/G. Lorenz: Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg 1919–1969, S. 243. Kurt Ferdinand Lothar Perels, geb. 9.3.1878, Flucht in den Tod am 10.9.1933 54 Gustav-Freytag-Straße 7/Edmund-Siemers-Allee 1 Kurt Perels wurde als Sohn von Ferdinand und Anna, geb. Volkmar, in Berlin geboren und entstammte dem dortigen Bildungsbürgertum. Sein Vater Ferdinand Perels hatte jüdische Eltern, konvertierte jedoch schon früh zum Christentum. Auch seine zukünftige Frau Anna war Christin. Dementsprechend wuchsen die gemeinsamen Kinder Kurt, Friederike, Leopold und Ernst auch mit dem christlichen Glauben auf. 157 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 158 Ferdinand Perels war Geheimer Admiralitätsrat im Reichsmarineamt und zudem noch Professor für „Internationales Seerecht“ an der Universität Berlin. Seine Söhne Kurt und Leopold traten in seine Fußstapfen. Der jüngste Sohn Ernst begann ein Geschichtsstudium und avancierte zu einem geachteten Mittelalterhistoriker an der Berliner Universität. Nach dem Abitur am Joachimsthalschen Gymnasium begann Kurt Perels ein Studium der Rechtswissenschaften, das ihn nach Kiel, Heidelberg und Berlin führte. 1899 wurde er Referendar und ein Jahr später mit seiner Dissertation „Streitigkeiten Deutscher Bundesstaaten aufgrund des Art. 76 der Reichsverfassung“ promoviert. Nach beendetem Studium war Kurt Perels in der Gerichtspraxis und bei den „Ältesten der Kaufmannschaft“ in Berlin tätig. Seine Habilitation erfolgte in Kiel bei Albert Hänel. 1908 wurde Kurt Perels zum Professor in Greifswald berufen. Schon ein Jahr später wechselte er nach Hamburg, um dort die Nachfolge von Richard Thoma am Kolonialinstitut anzutreten. Hier hatte er den Lehrstuhl für „Öffentliches Recht“ inne und befasste sich zudem mit dem Aufbau der Bibliothek für „Öffentliches Recht“. Kurt Perels wurde einer der ersten Ordinarien und erster Dekan der gerade neu geschaffenen Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Hamburg. An der Gründung der Universität war er maßgeblich beteiligt und beeinflusste wesentlich deren Rechtsform und Struktur. 1922 übernahm er zudem noch das Amt eines Rats am Hamburgischen Oberlandesgericht, wodurch er automatisch Mitglied des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts wurde. Bis zu seinem Tod hatte Perels sowohl sein Richteramt als auch sein Ordinariat inne. Neben diesen Verpflichtungen war er seit 1912 auch Mitglied der Patriotischen Gesellschaft und blieb wohl auch bis 1933 in ihr. Nachdem Kurt Perels Lebensgefährtin 1926 verstorben war, vereinsamte der Professor zusehends und seine Kollegen bemerkten, dass er auch seelisch angeschlagen war. Im Sommer 1933 veränderte sich Perels Leben radikal. Eigentlich hätte er wohl keine politische Verfolgung zu erwarten gehabt, denn seine Gesinnung war national geprägt. Er war Monarchist und Preuße aus Überzeugung. Doch durch die nationalsozialistische Machtübernahme war er gezwungen, einen sogenannten Ariernachweis zu erbringen. Im „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 wurde festgelegt, dass Beamte, die keine Prof. Dr. jur. Kurt Ferdinand Lothar Perels Enge Zeit „arische“ Abstammung nachweisen konnten, in den Ruhestand zu versetzen seien. Zwar war Kurt Perels getauft, musste aber im Fragebogen die jüdische Herkunft seines Vaters angeben. Dabei war ihm wohl bewusst, dass er durch diese Aussage sein Amt verlieren würde. Lediglich die Fürsprache seiner Kollegen hätte ihm vielleicht noch etwas Aufschub gewährt. Eine Emigration ins Ausland scheint für ihn jedoch auch nicht in Betracht gekommen zu sein. 158 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 159 Die Hamburger Universität im Hamburger Fremdenblatt vom 9. April 1919. Zu den ersten Dekanen gehörte auch Kurt Perels (unten, 2. v. r.) Enge Zeit Der Verlust seines Amtes und seines Ansehens sowie die Demütigung seiner Entlassung trafen ihn in seiner konservativen und preußischen Überzeugung schwer. Dies zeigt sich in einem Brief Perels an Albrecht Mendelssohn-Bartholdy, den damaligen Leiter des Instituts für Auswärtige Politik. Am 25. August 1933 schrieb Perels an ihn: „Lieber Herr Mendelssohn, Unser Dekan hat mir heute eine Mitteilung gemacht, die mich so bewegt und bedrückt hat wie kaum etwas, was mir in den sechzig Semestern, seitdem ich akademischer Lehrer bin, begegnet ist. Ich versuchte, Sie im kleinen Rechtshaus zu treffen. Sie waren gerade fortgegangen. So möchte ich Ihnen wenigstens auf diesem Wege sagen, dass, wie auch die Entscheidung fallen möge, bei mir nichts von dem verloren gehen wird, was ich in langjähriger gemeinsamer Arbeit mit Ihnen für mich gewann.“ Zwei Wochen später, am 10. September 1933, nahm sich Kurt Perels im Alter von 56 Jahren das Leben. 159 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 160 Die Einäscherung fand am 14. September 1933 im damals neuen Krematorium des Ohlsdorfer Friedhofes statt. An der Trauerfeier nahmen der Rektor der Universität, die in Hamburg anwesenden Professoren, Vertreter der Studentenschaft und viele Männer des geistigen Lebens teil. Vier Studenten in Stahlhelm-Uniform hielten die Totenwache. Die Grabrede hielt Prof. Dr. Bonn, ein Fachkollege von Perels. Die Zeitungen berichteten kurz danach, Kurt Perels sei nach langer Krankheit gestorben. Seine Nachfolge trat ein strenger Antisemit an. Ernst Forsthoff war ein Schüler Carl Schmitts und machte sich 1933 mit seinem Werk „Der totale Staat“ einen Namen. Doch seinen Schülern blieb Kurt Perels in guter Erinnerung. Stets hatte er sich um ihre väterlich fürsorgliche Betreuung bemüht. Wenn sie nach seiner Auffassung Begabung, Charakter und Leistungsfähigkeit besaßen, förderte er sie nicht nur pädagogisch und wissenschaftlich, sondern auch materiell. Zahlreiche spätere Rechtswissenschaftler hatten so ihre Karriere vor allen Dingen Kurt Perels zu verdanken. Von den Verfolgungen durch die Nationalsozialisten waren nicht nur Kurt Perels, sondern auch seine Geschwister betroffen. Sein Bruder Ernst überlebte den Holocaust ebenfalls nicht. Da sein Sohn Friedrich-Justus am Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler beteiligt war, wurde Ernst Perels im Oktober 1944 in „Sippenhaft“ genommen und ins Konzentrationslager Flossenbürg gebracht. Er erlag kurz nach der Befreiung durch die Alliierten im Mai 1945 den Folgen der Haft. Quellen: 4; 5; 8; Bottin/Nicolaysen: Enge Zeit, S. 46; Krause/Huber/Fischer: Hochschulalltag im „Dritten Reich“, Bd. 2, S. 870; Lebensbilder hamburgischer Rechtslehrer, S. 69 ff.; Schicksal jüdischer Juristen in Hamburg im Dritten Reich, S. 29 ff.; Roß: Der Ausschluss der jüdischen Mitglieder, S. 35 f.; StaHH ZAS, A 765, Perels, Prof. Dr. jur. Kurt. Hans Karl Louis Hermann Podeyn, geb. 2.7.1888, inhaftiert 1937–1938, 1939–1941, gestorben am 13.3.1942 KZ Buchenwald 55 Elsastraße, gegenüber der Einmündung Mesterkamp „... Ich habe schon immer den Verdacht gehabt, daß mit dem Manne irgendetwas nicht stimmt“ beginnt ein Denunziationsschreiben, das Helene Manuel, geb. Nitschke, wohnhaft im Mesterkamp 6 in Barmbek-Süd an die Hamburger Kriminalpolizei schickte. Die Nachbarin von Hans Podeyn, der in einer Parterrewohnung im Mesterkamp 36 wohnte, kannte diesen vom Sehen und führte die Polizei auf die Spur eines Freundes ihres Untermieters. Mit seiner Festnahme am 13. Mai 1939 um 12:30 Uhr auf Anordnung der Gestapo begann das letzte Kapitel im Leben des Hans Podeyn, er sollte nie wieder in Freiheit gelangen. Hans Podeyn wurde am 2. Juli 1888 in Neumünster als ältester von drei Söhnen des Gendarmeriewachtmeisters Johannes Podeyn und der Marie, geb. Schuldt, geboren. Er absolvierte eine kaufmännische Ausbildung. Im Juli 1937 wurde er vom Schöffengericht Neumünster erstmals wegen „Vornahme unzüchtiger Handlungen mit Männern“ zu einer achtmonatigen 160 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 161 Gefangenenkarte von Hans Podeyn StaHH Gefängnisstrafe verurteilt. Nach einer weiteren Verurteilung im Oktober 1937 aus gleichem Grunde vom Landgericht Kiel, erhöhte sich die Strafe auf 15 Monate. Der kaufmännische Angestellte Hans Podeyn verbüßte diese Strafen bis Ende August 1938 und war seither erwerbslos. Finanziell wurde er von seiner Mutter unterstützt, die jedoch kurz darauf verstarb. Nachdem die Polizei erneut auf die Spur Podeyns gekommen war, wurden ihm erneut sexuelle Kontakte mit Männern nachgewiesen, für die er als Wiederholungstäter nun eine deutlich höhere Strafe von 2 Jahren und 6 Monaten Gefängnis erhielt. Der vorsitzende Richter, Amtsgerichtsrat Bertram, konstruierte gegenüber Podeyn, der einvernehmliche Kontakte mit erwachsenen Männern pflegte, eine Gefahr für Jugendliche allein aus dem Umstand, dass sich die Bedürfnisanstalt in der Langen Reihe, wo Podeyn einen seiner Partner kennengelernt hatte, in der Nähe eines Kinderspielplatzes befand. Die Haft ver161 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 162 brachte er im Gefängnis Wolfenbüttel, aus dem er am 12. November 1941 zwar entlassen, jedoch für die Kripo Hamburg weiter im Polizeigefängnis Hütten in „polizeilicher Vorbeugungshaft“ verblieb. Vom 2. Dezember 1941 bis zum 3. Februar 1942 wurde er ins KZ Fuhlsbüttel verlegt. Am 13. Februar 1942 erfolgte unter der Häftlingsnummer 6856 sein Zugang im KZ Buchenwald. Bereits einen Monat später verstarb er dort im Alter von 53 Jahren angeblich an Herzversagen. – Ulf Bollmann Quellen: StaHH, 213-11 Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafsachen, 5110/39; StaHH, 213-8 Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht – Verwaltung, Abl. 2, 451 a E 1, 1 d; StaHH 331-1 II Polizeibehörde II, Ablieferung 15 Band 1 und Band 2; StaHH, 242-1 II Gefängnisverwaltung II, Ablieferung 16; Auskunft Rainer Hoffschildt, Hannover, im Februar 2010. Leo Julius Raphaeli, genannt Willy Hagen, geb. 15.11.1878, am 25.10.1941 nach Lodz deportiert und dort am 5.4.1942 gestorben 56 Mundsburger Damm 38 Der gebürtige Erfurter Leo Raphaeli war in Hamburg unter dem Namen Willy Hagen als Schauspieler, Kabarettist und Textdichter bekannt. Sein Debüt feierte Raphaeli in dem Stück „Fräulein Julie“ von Strindberg in der Rolle des Jean im Jahr 1903. Seit 1906 trat er regelmäßig als Kabarettist in Hamburg auf und übernahm 1913 die Leitung des Kleinen Theaters in den Großen Bleichen, dem heutigen Sitz des Ohnsorg-Theaters. Zusammen mit seiner Ehefrau, der gebürtigen nichtjüdischen Wienerin Gisela Gollerstepper, wohnte Leo Raphaeli am Mundsburger Damm 38. Das Ehepaar hatte keine gemeinsamen Kinder. In der Weimarer Republik avancierte Leo Raphaeli zu einem gefragten Der Mundsburger Damm im Jahr 1902 Bildarchiv Hamburg Schreiber von Revuen für die großen Hamburger Theater. Außerdem gehörte er seit 1929 zum Mitarbeiter- kreis der Nordischen Rundfunk AG. Hier hatte er fast wöchentliche Programme, welche von Humor und Esprit geprägt waren. Zahlreiche Hörerbriefe und liebevolle Karikaturen seiner Kollegen stellen ein Zeugnis seiner Popularität dar. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde es für Leo Raphaeli aufgrund seiner jüdischen Herkunft immer schwieriger, Engagements zu erhalten. Im Mai 1934 eröffnete er im Curiohaus sein Kabarett „Die Rosenrote Brille“, welches ein beachtliches Ensemble aus bekannten jüdischen Musikern und Schauspielern besaß. Zunächst wurde immer vor ausverkauftem Haus gespielt und dies trotz strenger Zensur und kritischen Kommentaren in der 162 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 163 jüdischen Presse. Doch Ende 1934 folgte das Aus, nachdem Leo Raphaeli seinem Publikum einen selbstverfassten „Offenen Brief eines deutschen Juden“ vortrug, den er den Zensoren vorenthalten hatte. Das Kabarett wurde umgehend geschlossen und Leo Raphaeli erhielt Auftrittsverbot, das für ihn Arbeitslosigkeit bedeutete. Zusammen mit seiner Frau Gisela musste er die gemeinsame Wohnung An der Alster 29 aufgeben und in die Klopstockstraße 30 ziehen. Schon im September 1935 erfolgte der nächste Umzug in die Schlüterstraße 54 a, in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Erst 1936 bekam Leo Raphaeli wieder eine Anstellung. Er übernahm die Leitung der Kleinkunst im Hamburger Kulturbund, durfte selbst jedoch nur selten auftreten und die meisten seiner Stücke wurden nie veröffentlicht. Im Herbst 1938 erhielt Leo Raphaeli eine kleine Rolle in dem Stück „Die kleine ungarische Kirchenmaus“ beim Jüdischen Kulturverbund in Hamburg. Die Central-Verein-Zeitung berichtete in ihrer Ausgabe vom 29. September 1938 darüber: „Leo Raphaeli (Willi Hagen) [setzte] als angegrauter Schwerenöter mit liebenswürdiger Sicherheit Stiche und Pointen.“ Im Sommer 1939 ereilte Leo Raphaeli der nächste Schicksalsschlag. Seine Ehefrau Gisela starb am 18. Juni. Von nun an lebte Raphaeli allein in der Wohnung in der Schlüterstraße 54 a. Bei seiner Arbeit ließ Leo Raphaeli seiner Wut auf das NS-Regime freien Lauf. Seine Programme enthielten fast schon tollkühne Formulierungen und auf der Bühne improvisierte er mit ironischen Seitenhieben auf die Nationalsozialisten. Hinzu kam eine nie veröffentlichte Persiflage auf die Bücherverbrennung. All dies zog ihm endgültig den Hass der nationalsozialistischen Verfolgungsorgane zu. Am 25. Oktober 1941 wurde Leo Raphaeli mit dem ersten Transport von Hamburg ins Getto Lodz deportiert. Im Getto wohnte er in der Rauch Gasse 25 und litt dort unter Hunger und Krankheiten. So erkrankte er kurz vor seinem Tod an einer Blutvergiftung. Leo Raphaeli starb am 5. April 1942, dreiundsechzigjährig, im Getto Lodz. An ihn wurde in zahlreichen Lesungen, Ausstellungen und im Jüdischen Kulturbund erinnert. Ein letztes Lebenszeichen von Leo Raphaeli aus dem Getto Lodz USHMM Quellen: 1; 4; 5; 8; StaHH 214-1, Gerichtsvollzieherwesen, 572; USHMM, RG 15.083 300/575; ITS/ARCH/ Getto Litzmannstadt/1203968#1 (1.1.22.1/0008/0584); „Arm wie eine Kirchenmaus“ in: Central-VereinZeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums vom 29.9.1938, S. 4; Hagen: Du siehst, Emanuel, es geht auch so!; IGDJ: Das jüdische Hamburg, S. 104 f.; Müller-Wesemann: Theater als geistiger Widerstand, S. 270 ff.; Offenborn: Jüdische Jugend, S. 839, S. 1180; Stengel/Gerigk: Lexikon der Juden in der Musik, S. 221. 163 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 164 Markus Rieder, geb. 17.3.1870 in Szobrancz, Deportation 9.6.1943 nach Theresienstadt, 18.12.1943 nach Auschwitz Sophie Rieder, geb. Braunschweiger, geb. 9.7.1874 in Hamburg, Deportation 9.6.1943 nach Theresienstadt, 18.12.1943 nach Auschwitz 57 Averhoffstraße 22 Markus Rieder wurde 1879 im seinerzeit österreichisch-ungarischen Szobrancz geboren, einem Kurort bei Ungvár im Dreiländereck zwischen Ungarn, der Ukraine und der Slowakei. Nach 1918 gehörte das Gebiet zur Tschechoslowakei, heute zur Ukraine. Seine Eltern waren Joseph Ridder und Rachel, geb. Goldenberg. Infolge des seit Mitte der 1870er Jahre in Ungarn zunehmenden Antisemitismus verließen viele jüdische Familien das Land. Um 1889 kamen Markus Rieder und weitere Familienangehörige nach Norddeutschland. Er hatte das Schuhmacherhandwerk erlernt und war in diesem Beruf in Hamburg tätig, wo er bald sein erstes kleines Geschäft am Neuen Steinweg 32 eröffnete. 1895 heiratete er Sophie, die am 9. Juli 1874 als Kind der jüdischen Eheleute Louis Braunschweiger und Betty, geb. Benjamin, in Hamburg zur Welt gekommen war. Markus und Sophie Rieder hatten drei Kinder: Grete Recha wurde am 2. Juni 1897 geboren, ihr folgten die Brüder James am 7. Mai 1899 und Max am 31. Dezember 1901. Die Familie bewohnte ein eigenes Haus in der Johnsallee 20. Geburtsurkunde (Ausschnitt) und „für tot“-Erklärung auf den 8. Mai 1945 für Sophie Rieder StaHH Markus Rieder war fleißig, geschäftstüchtig und erfolgreich. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts hatte er die Kette „M. Rieder“ mit mehreren Schuhläden aufgebaut, Schuhe von Rieder wurden ein Markenzeichen. Nach Ende des Ersten Weltkriegs wollte sich Markus Rieder, durch langjährige harte Arbeit in seiner Gesundheit beeinträchtigt, als 50-Jähriger aus dem 164 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 165 Geschäft zurückziehen und von den Zinsen seines Ersparten leben. Einige Läden wurden an neue Inhaber verpachtet. Die Inflation zu Beginn der zwanziger Jahre änderte jedoch alle Pläne, da er einen beträchtlichen Teil seines Vermögens verlor. Dies veranlasste ihn zu einem Neubeginn. In kurzer Zeit gelang es ihm mit seinen Kenntnissen und Fähigkeiten, den neuen Schuhwarenhandel Rieder & Sohn zu etablieren, die Geschäfte gehörten zu den größten der Stadt. Eine Filiale in der Lappenbergsallee, Eimsbüttel, wurde von seinem Schwiegersohn Julius Mamelok geführt und später übernommen. Die Hauptfilialen lagen in der Hamburger Straße 164 und in der Bramfelder Straße 23 in Barmbek, außerdem gab es Geschäfte am Schulterblatt, am Neuen Steinweg, in Glückstadt und Itzehoe, das von einem Verwandten Markus Rieders geleitet wurde, Aaron und seiner Frau Giska Rieder. Aarons älterer Bruder Simon Rieder leitete das Schuhgeschäft S. Rieder in Hamburg, Fruchtallee 45, wo auch Julius Mamelok als Geschäftsführer tätig war, bevor er zur Filiale von Markus Rieder & Sohn in die Lappenbergsallee wechselte. Marcus und Sophie Rieder hatten ihr bisheriges Wohnhaus in der Johnsallee ab 1932 vermietet und waren seither in Uhlenhorst in der Averhoffstraße 22 gemeldet. Grete Recha, einzige Tochter der Familie, heiratete 1920 Julius Mamelok. Er wurde am 27. Mai 1884 in Freystadt /Westpreußen geboren als Sohn von Nathan Mamelok und Rahel, geb. Marcus. Nach einer kaufmännischen Ausbildung arbeitete er vor dem Ersten Weltkrieg in Berlin als Abteilungsleiter und Einkäufer und kam nach vier Frontdienstjahren 1918 nach Hamburg. Er und Recha heirateten, sie wohnten zu Beginn der Ehe im Haus von Rechas Eltern in der Johnsallee 20 in Harvestehude, wo ihr einziger Sohn Hans Norbert am 11. Mai 1921 geboren wurde. Später wohnte die Familie im Stellinger Weg 4 in Eimsbüttel. Julius Mameloks Geschäft wurde 1938 „arisiert“, der Erlös lag unter seinen finanziellen Verbindlichkeiten, er sollte 13 699,60 RM betragen und auf ein Sonderkonto eingezahlt werden. Am 12. Januar 1939 schrieb Julius an den Oberfinanzpräsidenten: „Ich habe mein Geschäft an Herrn Hans-Christian Hermann verkauft. Ich bitte gefl. um Genehmigung der Auszahlung, da ich meinen Verpflichtungen nachkommen muss.“ Es folgt der Zusatz: „Bemerke noch, daß ich 54 Jahre alt bin und eine Auswanderung für mich ... nicht in Frage kommt, zumal ich leidend bin.“ Die Familie war nun nahezu mittellos und musste von den Eltern/Schwiegereltern Rieder unterstützt werden. Nach Kündigung der Wohnung im Stellinger Weg zogen sie in angemietete Zimmer im Hause Mundsburger Damm 28, unweit von Rechas Eltern in der Averhoffstraße 22. Eine Auswanderung wurde zwar von Julius und Recha Mamelok nicht angestrebt, doch für den Sohn Hans konnte im Frühjahr 1939 mit Hilfe der Großeltern eine Schiffspassage nach Shanghai organisiert werden, der 18-Jährige begab sich allein auf die Reise. Rechas Bruder James Rieder hatte bis 1914 die Talmud Tora Schule besucht und eine zweijährige Lehrzeit in der Schuhfabrik Th. Müller + Co. in Frankfurt absolviert. Zurück in Hamburg, übernahm er Aufgaben im väterlichen Geschäft und leistete dann 1917 bis 1919 seinen Militärdienst an der Front. Anschließend wurde er Teilhaber in der großen Filiale Hamburger 165 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 166 Straße 164, Ecke Volksdorfer Straße. Er war verheiratet mit Alice, die ihm drei Kinder schenkte: Werner, Eva und Ellen. Die Familie wohnte in der Hansastraße 78, Rotherbaum. Max, der Jüngste der Geschwister, besuchte die Talmud Thora Schule bis zum „Einjährigen“ (mittlere Reife). Er absolvierte im Betrieb des Vaters eine kaufmännische Ausbildung, sammelte in anderen Firmen außerhalb Hamburgs Erfahrungen in Leitungspositionen und war nach seiner Rückkehr wieder in der Fa. Rieder & Sohn tätig. In Barmbek baute er eine große Schuhreparaturwerkstatt mit auf. Er hatte ebenfalls geheiratet, seine Frau hieß Ruth, geb. am 2. Dezember 1909, beide wohnten in der Hufnerstraße 42. Bis zu Beginn der dreißiger Jahre florierten die Geschäfte, die Firma hatte zu dieser Zeit einen Gesamtumsatz von knapp einer Million RM, das Vermögen Markus Rieders wurde auf 200 000 RM beziffert. Mit Beginn des Boykotts und der Verfolgungen durch immer einengendere Gesetze und Verordnungen ging der Umsatz zurück, obgleich die Qualität der Ware weiter einen größeren Kundenstamm sicherte. Der Gedanke an Verkauf und Auswanderung war für Geschäftsleute schon zu Beginn des „Dritten Reiches“ äußerst unattraktiv, weil damit hohe Steuern und Zwangsabgaben verbunden waren. Die „Reichsfluchtsteuer“ stieg ab 1933 fortlaufend an, wer zwecks Auswanderung Geld transferieren wollte, musste dies als „Auswanderersperrguthaben“ beim Umtausch von Devisen an die Deutsche Golddiskontbank entrichten mit Abschlägen von 65 Prozent bereits im Jahr 1934, die im Juni 1938 auf 90 Prozent und Ende 1939 auf 96 Prozent anstiegen. Vielleicht spielte zunächst auch noch die Illusion einer Veränderung der politischen Verhältnisse eine Rolle. Viele zögerten jedenfalls, rechtzeitig Konsequenzen zu ziehen. Die zunehmend bedrohlichere Situation raubte jedoch alle Zukunftsperspektiven und veranlasste zunächst die Familien von Max und James Rieder, eine Emigration in die Wege zu leiten. Der NS-Staat wollte die wirtschaftliche Vernichtung von Existenzen durch die „Arisierung“ jüdischer Geschäfte bis Ende 1938 abschließen, auch Firma Rieder & Sohn war gezwungen, sich nach einem „politisch zuverlässigen“ Käufer umzusehen. Max und Ruth Rieder hatten als erste alle Bescheinigungen für die Auswanderung beisammen, er und seine Frau erwarteten gerade das erste Kind. Am 12. Juli 1938 reiste Max jedoch allein nach Australien, um die Ankunft der übrigen Familie vorzubereiten. Ruth litt an Schwangerschaftskomplikationen und sollte zunächst bis zur Geburt des Kindes in Hamburg bleiben. Sie wohnte, da die Wohnung bereits aufgelöst war, vorübergehend im Stellinger Weg in Eimsbüttel bei Familie Mamelok und nach deren Umzug an den Mundsburger Damm bei den Schwiegereltern in der Averhoffstraße. Die Emigration der Familie James Rieders war ebenfalls eingeleitet. Als Mitinhaber der Firma war er vor Ausstellung aller erforderlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen zusätzlichen Prüfungen seitens der Finanzbehörden, Zoll- und Devisenfahndungen, Banken und übrigen eingeschalteten Behörden unterworfen. 1936 war seine jüngste Tochter Ellen zur Welt gekommen, Sohn Werner im Jahre 1923 und Tochter Eva 1926. Die Zukunft der Kinder zu sichern war in den meisten jüdischen Familien eines der wichtigsten Anliegen, oft wurden sie 166 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 167 vorausgeschickt oder irgendwie außer Landes gebracht, wie auch Hans Norbert Mamelok. James und Alice Rieder gelang es, gemeinsam mit den Kindern im September 1938 über Rotterdam und London nach Melbourne in Australien auszuwandern. Bis September 1938 durfte eine vierköpfige jüdische Familie maximal 50 000 RM ins Ausland transferieren bei Kursverlusten bis zu 70 Prozent, danach verschlechterten sich die Kurse weiter. Zwangsabgaben, Transportkosten, Schiffspassagen, Sonderabgaben für Freigabe von Umzugsgut verschlangen die Mittel von James Rieder, am Ende blieben 3000 RM übrig, die er seiner Schwester Recha überließ. Um an 200 australische Pfund zu gelangen, die er bei der Einwanderung in Australien vorzuweisen hatte, war er zur Auflösung seiner Lebensversicherung gezwungen. Das Auswanderungsbegehren der Söhne führte zur Überwachung von Markus und Sophie Rieder. In einer Notiz des zuständigen Polizeireviers an die Devisenfahndung wurde mitgeteilt, es habe „nicht den Anschein, daß R. auswandern will, der gesamte Hausrat ist noch vorhanden. Unterhält noch ein Schuhgeschäft in der Hamburger Straße. Beide besitzen seit Jahren Reisepässe.“ Beamte des Oberfinanzpräsidiums, Devisenstelle, legten am 15. Juli 1938 folgende Aktennotiz an: „... stelle anheim, eine Sicherungsanordnung zu erlassen“. Darunter die Anmerkung „Das Auswanderungsverfahren wird noch nicht eingeleitet.“ Am 20. Juli heißt es: „Wie ich erfahre, hat der Schuhwarenhändler Markus Rieder ... die Absicht, sein Geschäft in der Hamburger Straße zu verkaufen. Da R. Jude ist und sein Sohn bereits ausgewandert ist, ist anzunehmen, daß er und seine Ehefrau gleichfalls auswandern werden. R. besitzt die tschechische Staatsangehörigkeit. Nach Mitteilung des Finanzamts Hamburg Barmbeck ... hat das Vermögen der Rieders am 1.1.1935 RM 117 000 und das Einkommen 1927 RM 22 632,– betragen. .... prüfen, ob Maßnahmen gem. § 37 a Dev. zu treffen sind.“ Die Zollfahndungsstelle schrieb am 27. Juli: „Da James Rieder bereits seine Auswanderung betreibt, mussten auch gegen seinen Vater vorläufige Sicherungsanordnungen getroffen werden, um einer möglichen Kapitalflucht entgegen zu steuern.“ Weiter sei es zur Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung an James Rieder notwendig, von ihm „den einwandfreien Nachweis über die Verwendung der aus dem Geschäft stammenden Mittel zu fordern, um einer möglichen Kapitalflucht auf die Spur zu kommen.“ Das gesamte Vermögen von Markus Rieder wurde vorläufig sichergestellt. Am 22. August 1938 „...erscheint Frau Sophie Rieder, geb. Braunschweiger, und erklärt, daß ihr Mann krankheitshalber nicht erscheinen kann.“ Sophie Rieder stellte künftig mit Vollmacht Ihres Mannes Markus notwendige Anträge und tätigte Geschäfte. Markus Rieders Gesundheitszustand hatte sich verschlechtert, er war jetzt 68 Jahre alt. In einem späteren Wiedergutmachungsverfahren wird von einer familiären Belastung im Zusammenhang mit Herzerkrankungen gesprochen. Das Kesseltreiben gegen jüdische Mitmenschen spitzte sich 1938 dramatisch zu, Angst vor der Zukunft, um die Kinder, um Verlust der Früchte einer Lebensarbeit und der Wahlheimat lieferten viele Gründe für unerträgliche Belastungen für alle Betroffenen. 167 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 168 Am 17. September traf eine Genehmigung über Verfügung von Grundstücken ein, die verkauft/„arisiert“ werden mussten. Ein Schuhgeschäft M. Rieder, Inhaber Joseph Leva am Neuen Steinweg 1–3 stand auf der Liste jüdischer Geschäfte, die aufgelöst werden sollten. Es ging um die Liegenschaften am neuen Steinweg 20 in Hamburg (Sophies Geburtshaus, am Sandberg 11 in Itzehoe und an der Großen Deichstraße 15 in Glückstadt. Verkaufserlöse waren auf das Sperrkonto einzuzahlen, gleiches galt für Hypothekenforderungen und Wertpapiere. „Über das Warenlager darf nur im Rahmen des laufenden Einzelhandels verfügt werden.“ Als Interessenten aus der SchuhbranDas Schuhgeschäft Citreck in der Hamburger Straße 164 Verlag Weidmann che für den Kauf der Geschäfte und das dazugehörige Warenlager in Barmbek traten Michael und Hermann Citreck mit Geschäftsadresse in der Mozart- straße 26–28 auf. Am 31. Oktober 1938 kam der Kauf zustande, der Erlös von 105 000 RM wurde dem Sperrkonto gutgeschrieben, die Schuhgeschäfte Rieder unter dem Namen Citreck neu eröffnet. Das Gebäude Hamburger Straße 164 existierte nur noch bis zur Zerstörung am 27. Juli 1942 durch Bombenangriffe, ein Jahr später bei den „Gomorrha“-Angriffen traf es auch die Bramfelder Straße 23. Ruth Rieders Gesundheitszustand führte schließlich zur stationären Aufnahme im Israelitischen Krankenhaus. Kurz vor der Entbindung musste sie das Krankenhaus verlassen, im Anschluss an die Pogromnacht vom 9. November gab es Ver- Das brennende Haus in der Hamburger Straße 164 nach der Bombardierung Archiv Hans Brunswig haftungen von Ärzten und Pflegekräften durch die Gestapo. Einzig das katholische Marienkrankenhaus war bereit, die Patientin aufzunehmen, nachdem sie zuvor mehrere Abweisungen erlebt hatte. Am 17. November 1938 wurde Ruth von ihrem ersten Kind entbunden, im Januar 1939 konnte sie mit ihm dem Ehemann nach Australien folgen, da die Reise genehmigt und wegen der Komplikationen nur aufgeschoben war. Für Markus und Sophie Rieder war ein Verbleib in Deutschland nun auch nicht länger denkbar. Sie strebten den schnellstmöglichen Abschluss aller Geschäfte an – die Grundstücke wurden 168 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 09:38 Seite 169 zur Belastung – und stellten Auswanderungsanträge, um ebenfalls nach Australien zu gelangen. Für die Tochter wurde ein Sperrkonto eingerichtet und eine Genehmigung für den Transfer von 23 000 RM als Geschenk eingeholt. Recha durfte laut Sicherheitsverordnung über einen monatlichen Freibetrag von zunächst 400, später 300 RM von diesem Konto verfügen. Das Genehmigungsverfahren für Markus und Sophie zog sich hin, während hohe Zwangsabgaben wie Judenvermögensabgaben, Reichsfluchtsteuer, Auswanderungsabgaben die Ersparnisse schwinden ließen. Es existieren viele Belege über Anschaffungen für die Auswanderung, Transportkosten, Frachtgut, Beratungsgebühren. Am 29. Juli 1939 stellte das „Weltreisebüro“ eine Quittung für Schiffspassagen und zwei Fahrkarten Hamburg–London aus, doch der Kriegsbeginn verhinderte die Reise. Ende Oktober 1939 teilte der Oberfinanzpräsident eine Minderung des monatlichen Freibetrags auf 550 RM für das Ehepaar Rieder mit, das sich entschloss, die Wohnung in der Averhoffstraße aufzugeben. Ein großer Teil des Mobiliars wurde als Umzugsgut verpackt und im Freihafen gelagert. Im Januar 1940 teilten die Rieders den Behörden ihre neue Adresse in der Haynstraße 5 mit. Inzwischen warteten sie auf Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die sich u. a. wegen vorgeblicher Unklarheiten und Zuständigkeiten bezüglich der Grundstücksverkäufe in Hamburg und Schleswig-Holstein verzögerten. Zu Spottpreisen hatten die Grundstücke Käufer gefunden, das Wohnhaus in der Johnsallee übernahm der Zahnarzt und bisherige Mieter Carl Koopmann. Das Ehepaar änderte noch zweimal seine Adresse. Von der Haynstraße zog es in das May-Stift, Bogenstraße 25, von dort in ein „Judenhaus“ in der Dillstraße 13; die letzte Unterkunft war ein weiteres „Judenhaus“ in der Beneckestraße 2. Ab 19. September 1941 mussten auch Markus und Sophie Rieder den gelben Stern tragen. Im Oktober erfolgte die Deportation ihrer Tochter Recha und des Schwiegersohnes Julius Mamelok. Knapp zwei Jahre nach deren Verschwinden ereilte sie der eigene Deportationsbefehl. Auf Zwang der Gestapo mussten sie noch einen „Heimeinkaufsvertrag“ unterschreiben und bezahlen, bevor am 9. Juni 1943 die Deportation ins „Vorzeigelager“ Theresienstadt stattfand, von dort am 18. Dezember 1943 ins Vernichtungslager Auschwitz. Sophie und Markus Rieder galten nach Kriegsende als verschollen und wurden 1951 vom Amtsgericht Hamburg mit Datum 8. Mai 1945 für tot erklärt. Für die Tochter und den Schwiegersohn kam der Deportationsbefehl schon 1941. Wie Agnes und Iwan Schumacher wurden sie laut Anordnung der geheimen Staatspolizei, Leitstelle Hamburg, mit dem Transport am 25. Oktober 1941 ins Getto Lodz verbracht. Mit dem 10. Mai 1942 ist ihre Weiterdeportation ins Vernichtungslager Chelmno dokumentiert, danach galten sie als verschollen. Nach 812 Tagen im Getto Shanghai erlebte Hans Mamelok die Befreiung durch die Amerikaner am 3. September 1945. Er litt allerdings zeitlebens unter den Folgen einer unzureichend behandelten Amöbenruhr. Von Shanghai aus gelang ihm mit Hilfe seines Onkels James dann die Überfahrt nach Australien, wo die Brüder seiner Mutter, Max und James Rieder, seit 1938 mit ihren Familien den Holocaust überlebt haben. Hans ließ sich später in St. Kilda, Victoria, nieder. Erst durch die Verwandten erfuhr er vom Schicksal seiner Eltern und Großeltern. 169 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 170 James und Max Rieder mit Familien versuchten in Australien unter schwierigen Bedingungen, neue Existenzen aufzubauen. Über Max, der eine Arbeit als Schuhmacher gefunden hatte, und James Rieder, der als Chemiearbeiter tätig war, wissen wir aus den Wiedergutmachungsakten, dass ihre Gesundheit stark angegriffen war. Beide Brüder waren schwer herzkrank und deshalb erwerbsgemindert, Max starb 1960 mit 58 Jahren an Herzversagen, Ursache Coronarverschluss, sein Bruder James hatte 1955 einen Hinterwandinfarkt, litt an Coronarsklerose und Angina Pectoris. Ähnliche Diagnosen traten häufig bei überlebenden Nachkommen auf, es kann wohl angenommen werden, dass Verluste, Trauer und Verzweiflung einen nicht geringen Anteil an den Krankheitsentwicklungen hatten. Simon Rieder betrieb seine Auswanderung frühzeitig, ihm und seiner Familie gelang 1937 die Emigration in die USA. Aaron Rieder aus Itzehoe mit Frau und zwei Töchtern sowie drei seiner Brüder und weitere sechs Kinder sind in Auschwitz ermordet worden. Sophie Rieder, geb. Braunschweiger, war eine Verwandte von Agnes Schumacher, geb. Braunschweiger, die mit ihrem Ehemann Iwan 1941 nach Lodz verschleppt worden und dort umgekommen ist. Stolpersteine für Recha und Julius Mamelok sollen im Stellinger Weg/Eimsbüttel verlegt werden. – Erika Draeger Quellen: 1; 2; 5; 7; 8; StaHH 314-15, OFP, R 1938/1059; StaHH 314-15, OFP, R 1939/204; StaHH 314-15, OFP, R 1938/204; StaHH 332-3, A 181; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 2482 Rieder, Sophie; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 24.08.09 Rieder, Max; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 07.05.99 Rieder, James; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, E 11.05.21 Mamelok, Hans Norbert; Bajohr: „Arisierung in Hamburg“, S. 153 ff, S. 369; Meyer: Die Verfolgung und Ermordung der Hamburger Juden, S. 25 ff, S. 42–74; Brunswig: Feuersturm über Hamburg, S. 248 ff; Galerie Morgenland: „Wo Wurzeln waren...“, S. 114 ff.; König: „... wohl nach Amerika oder Palästina ausgewandert“, http://www.akens.org/akens/texte/info/ 29/3.html Zugriff am 4.10.2009. Jacob Rosenbacher-Levy, siehe Sara Levy Heinrich-Hertz-Straße 19 Charlotte Rosenfeld, geb. 10.9.1905, am 1.12.1941 von Stuttgart aus nach Riga deportiert und dort ermordet 58 Papenhuder Straße 40 Charlotte Rosenfeld wurde als eine von drei Töchtern des jüdischen Ehepaares Benjamin und Theresia Rosenfeld, geb. Meyer, in Stuttgart geboren. Ihr Vater Benjamin Rosenfeld war Inhaber der Firma B. Rosenfeld, Maschinenöle und Putzwollfabrik. Die Familie wohnte in einer Sechs-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock in der Militärstraße 35 (heute Breitscheidstraße 35) in Stuttgart, im Hinterhaus befand sich das Firmengebäude. Auch das Gebäude selbst gehörte seit 1898 Benjamin Rosenfeld. Die gelernte Kontoristin Charlotte Rosenfeld zog Anfang der dreißiger Jahre nach Hamburg, um hier als „Sozialbeamtin“ tätig zu sein. Eine Wohnung fand sie in der Papenhuder Straße 170 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 171 40. Durch das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 verlor Charlotte ihre Anstellung und kehrte daraufhin am 1. Juni 1933 nach Stuttgart zurück, wo sie wieder in die elterliche Wohnung zog. Im August 1937 starb Charlottes Vater Benjamin Rosenfeld und sein Besitz ging auf seine Familie über. Zwei Jahre später zog das Deutsche Reich das Haus der Familie Rosenfeld ein und die Firma wurde „arisiert“. Doch zunächst konnten die restlichen Familienmitglieder in der Militärstraße Die Deportationsliste aus Baden-Württemberg ITS wohnen bleiben. 1941 zog Theresias Schwester, Charlotte Behr, zu ihnen in die Wohnung. Sie war geschieden und hatte zuvor im fünften Stock des Hauses in einer eigenen Wohnung gelebt. Charlotte Rosenfeld wurde am 1. Dezember 1941 von Stuttgart in das Getto Riga deportiert und gilt seitdem als verschollen. Zu diesem Zeitpunkt war sie 36 Jahre alt, unverheiratet und hatte keine Kinder. Die zwei Schwestern von Charlotte und ihr Schicksal sind unbekannt. Mutter Theresia Rosenfeld und ihre Schwester Charlotte Behr wurden 1942 gezwungen, ins Jüdische Altersheim nach Dellmensingen zu ziehen. Lediglich zwei Koffer und einen Teppich durfte Theresia mitnehmen. Am 22. August 1942 wurden die Schwestern nach Theresienstadt deportiert und von dort aus nach Treblinka weiterdeportiert. Vor dem Gebäude in der Stuttgarter Breitscheidstraße 35, ehemals Militärstraße 35, liegen drei Stolpersteine in Gedenken an Charlotte Behr, Theresia Rosenfeld und ihre Tochter Charlotte Rosenfeld. Quellen: 1; 4; 5; 8; ITS/ARCH/Transportlisten Gestapo, Baden-Württemberg/11201363#1 (1.2.1.1/00010060/0026C/0221); Israelitische Kulturvereinigung in Württemberg und Hohenzollern (Hg.): Deportiertenliste der von 1939 bis 1945 zwangsweise in KZ’s, Arbeitslager usw. verbrachten Juden aus Württemberg und Hohenzollern; Zelzer: Weg und Schicksal der Stuttgarter Juden S. 359; Stolpersteine in Stuttgart: http://www.stolpersteine-stuttgart.de/index.php?docid=196, Zugriff am 11.6.2009. Wilhelm Sander, siehe Max Nathan Karlstraße 2 Jakob Schoeps, geb. 10.9.1877 in Zerkow, deportiert am 8.11.1941 nach Minsk Irma Schoeps, geb. Levy, geb. 20.9.1890 in Altona, deportiert 8.11.1941 nach Minsk 59 Bramfelder Straße 23 Jakob Schoeps, auch Jacob oder Jaques, wurde am 10. September 1877 in Zerkow, Provinz Posen, geboren. Seine Eltern waren Hermann Schoeps und Pauline, geb. Brinn. Er wohnte ab 171 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 172 1905 in Hamburg. Am 8. Januar 1910 heiratete er seine Frau Irma, die am 20. September 1890 in Altona als Kind der Familie Levy zur Welt gekommen war. Ihre früh verwitwete Mutter hieß Rosa. Das Ehepaar hatte drei Kinder. Sohn Walter Max Ludwig wurde am 22. Oktober 1910 geboren, Tochter Anneliese am 17. Januar 1914 und das Nesthäkchen Eva Pauline am 26. September 1927. Jakob Schoeps erhielt seine ärztliche Approbation 1902 und war seit 1905 zu den Kassen zugelassen. Nach der Bramfelder Straße 23, ca. 1910 Geschichtswerkstatt Barmbek Hochzeit praktizierte er als niedergelassener praktischer Arzt und Geburtshelfer in Barmbek, Praxis und Woh- nung befanden sich in der Bramfelder Straße 23. Am Ersten Weltkrieg nahm er als Kriegsfreiwilliger teil, wurde Offizier und leitete ein Lazarett. Seine Tochter Anneliese erinnerte sich später an mehrere Auszeichnungen, die der Vater für den Kriegsdienst erhalten hatte. Der Junior Walter Schoeps besuchte zunächst das Realgymnasium in Barmbek, später die Oberrealschule in Eppendorf bis zum „Einjährigen“ (mittlere Reife) und absolvierte eine Ausbildung als Drogist in der Firma Krenzin & Seifert AG und der Hamburger Drogistenfachschule. Danach besuchte er die höhere Handelsschule des Gewerkschaftsbundes für Angestellte und begann 1932 durch Vermittlung seines Onkels Max Schoeps in Mülhausen eine kaufmännische Ausbildung, denn geplant war für später der Kauf und Aufbau einer eigenen Drogerie. Die Boykottaktionen im Jahr darauf bewogen ihn zum Abbruch, er kehrte nach Hamburg zurück und entschied sich nach eingehender Beratung mit den Eltern für die Auswanderung nach Palästina. Schon im Oktober 1933 war es soweit. Der Vater Jakob Schoeps transferierte Geld zum Kauf einer Siedlungsgelegenheit und zum Bau eines Hauses in Pardess-Channa. Geplant war, dass die übrige Familie folgen würde. Ende 1934 unternahm Jakob Schoeps allein eine Reise nach Palästina. Das Palästina-Amt Berlin der Jewish Agency for Palestine bescheinigte ihm eine geplante Informationsreise zur Klärung der Frage, ob das Land für eine Auswanderung in Frage komme. Vom Landesfinanzamt benötigte er im September dafür die Genehmigung eines Antrags auf Einzahlung von 500 RM an die Bank der Tempelgesellschaft in Jaffa und die gleiche Summe für Hotelgutscheine für eine Person. Walters Schwester Anneliese besuchte zunächst in Hamburg die höhere Töchterschule und war in der Privatklinik Dr. Kalmann in Hamburg als Lehrschwester tätig. Anschließend nahm sie eine Ausbildung als Laborantin im Jüdischen Krankenhaus auf. Sie stellte im Oktober 1935 einen Antrag auf Ausfuhrgenehmigung von 27 500 RM wegen Auswanderung nach 172 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 173 Palästina und heiratete am 31. Januar 1936 Erich Eckmann. Ihr Abmeldeschein trägt das Datum vom 3. März 1936, über London gelangten sie nach Palästina. Während die älteren Kinder sich in relativer Sicherheit befanden, führte Jakob Schoeps die Praxis in Barmbek bis zur Aberkennung der Approbation 1938 fort. Im August desselben Jahres stellte er einen Antrag auf Genehmigung zur Einzahlung von 50 000 RM auf das Sonderkonto für Palästina-Auswanderung wegen beabsichtigter Auswanderung. Die Genehmigung wurde ihm am 26. August in Aussicht gestellt, Anfang September kam der Bescheid einer Sicherungsanordnung. Verbliebenes Vermögen war auf ein Sonderkonto einzuzahlen, genehmigt wurden monatlich 1000 RM zur Verfügung der Familie. In einer Notiz der Finanzbehörde heißt es „Nach Vorladung erschien Dr. med. Jacob Schoeps und überreichte Vermögensaufstellung ... Er beabsichtigt, innerhalb des nächsten Jahres nach Palästina auszuwandern.“ Sein Vermögen wurde mit ca. 70 000 RM angegeben. Am 16. September war eine Reichsfluchtsteuer von 16 000 RM zu zahlen. Das Finanzamt Hamburg Barmbek teilte der Gestapo am 8. Oktober mit, Jakob Schoeps habe die Absicht zur Auswanderung geäußert. Verteiler waren die Zollfahndungsstelle, die Reichsbankenanstalt, die Devisenstelle und der Steuerfahndungsdienst. Im November 1938 wurde Jakob Schoeps mit vielen anderen Juden in „Schutzhaft“ genommen und im KZ Sachsenhausen misshandelt. Nach seiner Entlassung gelang es den Eltern Schoeps, Tochter Eva auf die Reise zur Schwester Anneliese in Tel Aviv zu schicken. Jakob und Irma Schoeps mussten nun die große Wohnung und ehemalige Praxis in der Bramfelder Straße 23 aufgeben, ein Teil der Möbel war bereits ab Oktober 1938 für die Auswanderung als Umzugsgut bei der Firma Keim, Krauth und Co. in Altona gelagert. Für die Zeit bis zur eigenen Ausreise wollten sie bei Irmas verwitweter Mutter Rosa Levy wohnen und zogen zu ihr in die Parkallee 10. Laut einer Bescheinigung der „Gemeindeverwaltung, öffentliche Ankaufstelle“ lieferte Jakob Schoeps Ende Mai 1939 Gegenstände aus Gold und Silber ab, Schalen, Besteck, Schmuck im Gegenwert von 520 RM, davon 10 Prozent Verwaltungsgebühr. Im August 1939 wurden neue Anträge auf benötigte Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Mitnahme von Umzugsgut gestellt, geplant war nun eine Ausreise nach England, um von dort nach Palästina zu gelangen. Doch am 1. September begann durch den deutschen Einmarsch in Polen der Zweite Weltkrieg, zwei Tage später folgte die Kriegserklärung Englands als Antwort und Reisepläne mussten auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Gleichzeitig führte der Oberfinanzpräsident eine neue Befragung zum jüdischen Vermögen durch, auf die eine Neufestsetzung des monatlichen Betrags folgte, der vom Sperrkonto abgehoben werden durfte. Monatlich 275 RM wurden dem Ehepaar am 20. Oktober genehmigt. Im November reichte Jakob Schoeps die Bitte um Ermäßigung der 5. Rate der Judenvermögensabgabe ein. „Mein und meiner Ehefrau Vermögen hat sich durch die Abgaben der letzten Jahre und durch die im August 1939 bezahlte Reichsfluchtsteuer in Höhe von 11 505 RM stark vermindert und beträgt lt. der letzten Aufstellung zur Sicherungsanordnung 173 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 174 Antrag auf Mitnahme einer größeren Menge Wäsche und Haushaltsgegenstände als Umzugsgut StaHH ... 14 430 RM. Da unsere für den September 1939 vorgesehen gewesene Auswanderung inzwischen unmöglich geworden ist und da wir andere Einnahmen nicht haben, sind wir für eine nicht absehbare Zeit auf dieses Vermögen zur Bestreitung unseres Lebensunterhalts angewiesen. Ich bitte darum um Gewährung der Ermäßigung.“ Die Antwort des Oberfinanzpräsidenten: „Für Ihren Antrag bin ich nicht zuständig. Ich stelle anheim, den Antrag bei Ihrem zuständigen Finanzamt zu erneuern.“ Ein neuer Anlauf erfolgte zu Beginn des Jahres 1940, wieder mussten Bescheinigungen beantragt, Fragebögen ausgefüllt werden. Jakob Schoeps beantragte die Freigabe von 100 RM als Anzahlung für Reisegeld („betr. Auswanderung“), Zahlungsempfänger war das AtalaReisebüro Frankfurt/M., Vertretung Hamburg. Am 27. Juni 1940 erfolgte ein neuer Antrag über die gleiche Summe, „zur Verrechnung zukünftiger Auslagen in meiner Auswanderungsangelegenheit, insbes. Telegrammkosten.“ Inzwischen hatte auch ein Wohnungswechsel stattgefunden, die Postanschrift lautete nun auf Haynstraße 5. 174 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 175 Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Kämmerei, Reichsbank und Finanzamt waren erforderlich zur Erlangung der Reisepässe. Die Prozedur zog sich hin, im Februar 1941 mussten neuerlich Gebühren zur Prüfung des Umzugsguts errichtet werden. Ab September waren sie gezwungen, den „Judenstern“ zu tragen und im November 1941 erhielten Jakob und Irma Schoeps den Deportationsbefehl, sie wurden ins Getto Minsk verschleppt und galten nach Kriegsende als verschollen. Beide wurden für tot erklärt, Irma Schoeps zum 8. Mai 1945 und Jakob Schoeps zum Jahresende 1945. Ihre Kinder überlebten den Holocaust in Palästina. Evas künftiger Ehemann war Hanan Epstein, später führte sie den Namen Chawa Avni und lebte in Haifa. Ihr Bruder Walter Schoeps heiratete 1938 Anneliese, geb. Todtenkopf, sie bekamen 1941 einen Sohn. Walter litt inzwischen an einer schweren Wirbelsäulenerkrankung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die ungewohnte schwere Arbeit zurückzuführen war, infolge der von ihm allein bewerkstelligten Bewirtschaftung des Siedlungsgrundstücks und des Hausbaus, in dem auch seine Eltern ihren Lebensabend hatten verbringen sollen. Er konnte keine Landarbeit mehr ausüben und versuchte durch Kauf von Pferd und Wagen ein kleines Fuhrunternehmen aufzubauen, um die Familie zu ernähren. Auch diese Arbeit war zu schwer, vorübergehend war er als Lagerarbeiter tätig und schließlich als Pfleger in einem Krankenhaus für psychisch kranke Menschen. Im Rahmen der Wiedergutmachung beantragte Walter Schoeps 1957 ein Darlehen von 10 000 DM und war bereit, weitere Ansprüche an die Bundesrepublik Deutschland abzutreten. Das Geld wurde dringend benötigt, auch seine Frau Anneliese war körperlich eingeschränkt und erwerbsgemindert, doch der Bearbeitungsprozess zog sich in die Länge. Im September 1958 reiste Walter Schoeps in Begleitung seines 17-jährigen Sohnes nach Hamburg, um sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen, wohl in der Hoffnung, vor Ort mehr erreichen zu können als auf dem Postwege. Hier wurde er am 4. Oktober Opfer eines Verkehrsunfalls und starb am gleichen Tag im Krankenhaus Lohmühlenstraße. Sein Sohn erlitt einen Nervenzusammenbruch, Mutter Anneliese Schoeps musste aus Palästina kommen und sich um alles Notwendige kümmern. Es wird schwer gewesen sein, diesen neuen Schicksalsschlag zu verkraften. – Erika Draeger Quellen: 1; 2; 5; 8; StaHH 314-15, OFP, F 2196 Bd. 1+2; StaHH 314-15, OFP, R 1938/1874; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 22.10.10 Schoeps, Walter; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 23.07.13 Schoeps, Anneliese; von Villiez: Mit aller Kraft verdrängt, S. 395. Heinrich Friedrich Karl Schrage, geb. 30.9.1893, am 12.9.1944 im Konzentrationslager Fuhlsbüttel erhängt aufgefunden 60 Hofweg 6 Karl Schrage wurde am 30. September 1893 als Sohn des Schneiders Carl Ludwig und dessen Ehefrau Emma, geb. Arend, geboren. Die Familie wohnte in Kassel in der Schäfergasse 39. Mit 18 Jahren verließ Karl Schrage sein Elternhaus und lebte vorübergehend zur Unter175 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 176 miete. Seinen Unterhalt verdiente er als Schlosser und Monteur. 1913 zog er nach Saarlouis. Dort erlebte er den Beginn des Ersten Weltkrieges und wurde Soldat. Nach einer Verwundung kam er 1915 ins Lazarett und kehrte dann zu seinen Eltern in die Gießbergstraße 38 in Kassel zurück. Am 17. September 1921 heiratete er die vier Jahre jüngere Annemarie Thiessen aus Marne in Schleswig-Holstein in ihrem Heimatort. Das Ehepaar lebte zunächst in Kassel. Am 1. März 1929 zogen Annemarie und Karl Schrage nach Hamburg. Sie wohnten anfangs in Rothenburgsort, in der Vierländer Straße 39. Ganz in der Nähe, in der Markmannstraße 125, eröffnete Karl Schrage im Jahr 1935 eine Tankstelle. Im Februar 1940 bezog das Ehepaar, das inzwischen die beiden verwaisten Kinder einer Cousine von Annemarie Schrage aufgenommen hatte, eine größere Wohnung in der ersten Etage des Hauses Hofweg 6. Am 9. September 1944 wurde Karl Schrage auf seiner Tankstelle verhaftet und in das Konzentrationslager Fuhlsbüttel gebracht. Der gleiche Schlag traf seinen Bruder Adolf, der in Wellingsbüttel lebte (von ihm wird in einer weiteren Stolperstein-Broschüre die Rede Das Haus Hofweg 6, 2009 Privatbesitz sein). Am 12. September 1944 wurde Karl Schrage erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Genau einen Mo- nat später, am 12. Oktober 1944, wurde sein Bruder unter den gleichen Umständen entdeckt. In beiden Fällen konstatierte der Lagerarzt als Todesursache: „Strangulation, Selbstmord“. Karl Schrages Witwe berichtete nach dem Krieg, dass er erst kurz zuvor nach einer schweren Nieren-Operation aus dem Krankenhaus entlassen worden sei. Sie selbst sei am Tag der Verhaftung bei Bekannten in Marne gewesen und unruhig geworden, als sie ihren Mann an diesem und dem folgenden Tag nicht telefonisch erreichen konnte. Daraufhin sei sie nach Hamburg zurückgekehrt, habe Nachforschungen angestellt und bald darauf von seinem Tod erfahren. Gegenüber dem Wiedergutmachungsamt führte sie (nach dem Krieg wieder verheiratet) die Verhaftung ihres Mannes auf seine Gegnerschaft zum Nationalsozialismus zurück und brachte auch schriftliche Zeugenaussagen von Bekannten ihres damaligen Mannes bei, die bestätigten, dass er sich ihnen gegenüber abfällig über das Regime geäußert hatte. Das Amt bezweifelte jedoch, dass dies der Verhaftungsgrund gewesen sei und verweigerte die Anerkennung der politischen Verfolgung Karl Schrages und damit eine Entschädigungszahlung. Die erhaltene Akte über die Todesumstände gibt ebenfalls keinen Hinweis auf einen politischen Verhaftungsgrund – einschlägige Vorwürfe hätten etwa auf „Wehrkraftzersetzung“, „Heimtücke“ oder „Defaitismus“ lauten können. Stattdessen heißt es in der Akte: „Der Inhaber der Grosstankstelle Hamburg-Rothenburgsort, Karl Schrage, geb. 30.9.93 in Kassel, 176 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 177 wohnhaft in Hamburg, Hofweg 6, wurde am 9.9.44 von der Geheimen Staatspolizei wegen Treibstoff-Sabotage festgenommen. In der Vernehmung am 11.9.44 gab Schrage zu, durch Vermittlung seines Bruders Adolf Schrage, der technischer Angestellter bei der Firma Klöckner [...] ist, wiederholt größere Mengen Benzin erhalten zu haben, das er an verschiedene Personen gegen bezugsbeschränkte Lebensmittel abgegeben habe. Karl Schrage [...] hat sich in der Nacht vom 11. zum 12. 9.44 in seiner Zelle erhängt.“ Es bleibt unklar, wie weit diese Vorwürfe zutrafen. Auch kann ein politischer Kontext der hier genannten Delikte nicht völlig ausgeschlossen werden, den die Gestapo vielleicht nicht erkannt hat. Klar ist jedoch, dass Karl und Adolf Schrage nicht nach rechtstaatlichen Grundsätzen behandelt wurden. Was wirklich mit ihnen geschah, ist nicht mehr sicher aufzuklären. Emil Schacht, der spätere Ehemann der Witwe, berichtete von einem ihm namentlich nicht bekannten Zeugen, der 1950 in der Wohnung am Hofweg 6 auftauchte: „Der Zeuge gab sich als Aufsichtsbeamter des Konzentrationslagers Fuhlsbüttel aus und erklärte, daß dort in seinem Bereich auch die Zelle mit dem inhaftierten Herrn Schrage vorhanden war. [...] Der Zeuge teilte mit, daß er eines Tages den Häftling Herrn Schrage an einem Türpfosten an einer Schnur erhängt vorfand. Der Tod muß kurz vorher eingetreten sein. Auf meine Frage, ob die Häftlinge mißhandelt worden sind, versicherte der Zeuge, daß Mißhandlungen vorgekommmen sind, er daran aber nicht aktiv beteiligt gewesen sei. Vielmehr hätten andere [...] die Gefangenen im Keller zusammengetrieben und schwer mit Knüppeln mißhandelt. Unter den Mißhandelten sei auch Herr Schrage gewesen. [...] Die Todesursache konnte der Zeuge auf mein Befragen nicht erklären. Auf meine Frage nach der Herkunft der Schnur, an der der Tote hing, blieb der Zeuge die Antwort schuldig. Es fiel auf, daß Gefangene nicht selbst im Besitz einer Schnur sein konnten.“ Vielleicht hat es sich so oder so ähnlich abgespielt. Extreme Misshandlungen waren im Konzentrationslager Fuhlsbüttel an der Tagesordnung. Vielleicht wurde Karl Schrage durch eine solche Erfahrung in den Tod getrieben. Genauso ist aber möglich, dass er von den dort Wächterdienste versehenden Schlägern ermordet wurde. – Carmen Smiatacz/Ulrike Sparr Quellen: StaHH 332-5, Personenstandsunterlagen, 9953 und 1373/1944; Diercks, Herbert, Gedenkbuch „KOLA-FU“, S. 37; Stadtarchiv Kassel; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 19217; StaHH 331-5, Polizeibehörde – Unnatürliche Sterbefälle, 3 1944 1420; StaHH 331-5, Polizeibehörde – Unnatürliche Sterbefälle, 1193; Bajohr, Parvenüs und Profiteure; Garbe, Institutionen des Terrors; Hochmuth, Gestapo-Gefängnis Fuhlsbüttel. 177 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 178 Isaak (Iwan) Schumacher, geb. 28.9.1875, am 25.10.1941 nach Lodz deportiert, Todesdatum 12.1.1943 Auguste (Agnes) Schumacher, geb. Lichtenstein, adopt. Braunschweiger, geb. 13.8.1875, deportiert am 25.10.1941 nach Lodz, Todesdatum 6.7.1944 61 Richardstraße 11 Isaak Schumacher, genannt Iwan, wurde in Libau geboren, einer Stadt in Lettland. Seine jüdischen Eltern waren der Kaufmann Jacob Isaac Schumacher, geb. am 20. Juli 1838 in Libau und Johanna (Hannchen), geb. am 26. Juni 1851 in Altona. Ihr Vater Hermann Lewandowski war Kantor und Diament der Israelitischen Gemeinde. Nach der Trauung am 20. Januar 1874, die von einem Rabbiner der Deutsch-Israelitischen Gemeinde in Hamburg durchgeführt wurde, zogen beide nach Libau. Wenige Jahre später verstarb Jacob Isaac Schumacher und der kleine Sohn kam zu den Großeltern Lewandowski nach Altona, wo er aufwuchs und die Schule besuchte. Als Schüler des Christianeums lernte er Moses Goldschmidt kennen, ein Mitschüler, der in seinen Erinnerungen später von einer lebenslangen Freundschaft berichtete. Auguste Schumacher, die Agnes genannt wurde, kam am 13. August 1875 in Altona zur Welt. Ihre ebenfalls jüdischen Eltern waren Abraham Lichtenstein und Marianne, geb. Braunschweiger. 1897 wurde sie vom Kaufmann Moses Braunschweiger adoptiert und nahm dessen Namen an. Sie und Iwan Schumacher waren gleichaltrig und kannten sich schon lange, bevor sie 1907 heirateten. Das Ehepaar hatte keine Kinder. Aus Moses Goldschmidts Erinnerungen wissen wir, dass Iwan und Agnes die Rufnamen des Paares waren. Moses Goldschmidt und der zwei Jahre jüngere Iwan Schumacher besuchten das Christianeum in Altona ab Ostern 1884 und erlangten das Abitur mit Wiederholungen 1894. In ihrer Klasse waren sie die einzigen jüdischen Schüler und zeigten sich an den humanistischen Fächern nicht sonderlich interessiert. Gute Leistungen erzielten sie in den Fächern Physik und Mathematik und entschieden sich beide im Abgangsjahr für ein Medizinstudium. Für Moses war die Fakultät in Würzburg erste Wahl, sein Freund Iwan schrieb sich zunächst in Heidelberg ein, wechselte aber nach einem Semester ebenfalls nach Würzburg. Hier verbrachten sie laut Moses Goldschmidt eine sehr schöne Zeit, waren Mitglieder einer studentischen Verbindung namens Wirceburgia und knüpften enge Kontakte zu Kommilitonen, Bundesbrüder genannt, von denen etliche später auch in Hamburger Kliniken tätig wurden oder sich hier in der Stadt niederließen. Erwähnt werden die Namen Heinrich Katz, Oettinger, Cramer, Jacoby, Julius Jolowicz, Georg Manes und Richard Lewinsohn. Wir erfahren einiges über den damals unverzichtbaren Fechtsport und eine Mensur, der Iwan Schumacher sich zu stellen hatte und von der er die Narbe eines tiefen Schnitts vom Ohr über die Wange bis zum Mundwinkel davontrug. Iwans Dissertation aus dem Jahre 1898, in Würzburg erschienen und im Staatsarchiv Berlin einsehbar, trägt den Titel „Über verästelte Knochenbildung in der Lunge“. Nach dem Studium fand die medizinische Ausbildung in Norddeutschland ihre Fortsetzung. Es folgten schlecht bezahlte Tätigkeiten in Krankenhäusern und verschiedene Aushilfen. Moses Goldschmidt, inzwischen Familienvater und niedergelassener Arzt in St. Georg mit zahl178 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 179 reichen Patienten, traf 1907 seinen strahlenden Freund Iwan Schumacher, der soeben seine große Kassenzulassung erhalten hatte und im Stadtteil Barmbek eine Praxis eröffnen wollte. Endlich konnte er seiner langjährigen Verlobten Agnes eine vermeintlich sichere Zukunft bieten und sie heiraten. Die Praxis befand sich zunächst am Markt, später wurden Wohn- und Praxisräume im ersten Stock der Richard- Blick in die Richardstraße, das mittlere hohe Gebäude in der Häuserzeile war die Nr. 11. Geschichtswerkstatt Barmbek straße 11 gefunden, gut erreichbar für Patienten aus den ärmeren Arbeiterquartieren nördlich und zahlungskräftigere Bewohner südlich der Hamburger Straße, der damals belebten und beliebten Einkaufs- und Flaniermeile. In diesem Haus wohnten beide bis zu ihrer „Aussiedelung“. Iwan Schumacher diente während des Ersten Weltkrieges beim Heer, Nachweise gibt es für die Jahre 1916 und 1917. In dieser Zeit betrug sein Jahreseinkommen 6000 RM, das nach dem Krieg und der anschließenden Inflation langsam anstieg. In Goldschmidts Erinnerungen ist die Rede von einem Unfall des Freundes im Jahre 1923, einem nächtlichen Sturz bei der Rückkehr von einem Hausbesuch. Gerade hatte der „Hamburger Aufstand“ stattgefunden, in Barmbek war es zu heftigen Straßenkämpfen zwischen Kommunisten und der Polizei gekommen. Auf unbeleuchteten Gehwegen lagen noch Stacheldrahtrollen, von der Polizei noch nicht entfernt und für Spätheimkehrer Iwan Schumacher im Dunkeln eine Stolperfalle. Bei seinem Sturz erlitt er eine Fraktur des Ellenbogengelenks und trug dauerhafte Bewegungseinschränkungen davon, doch seine Tätigkeit als praktischer Arzt übte er aus, bis das Naziregime es nicht mehr zuließ. Über das Alltagsleben des Ehepaars in Barmbek wissen wir nichts. Im April 1939, nachdem im Jahr zuvor jüdischen Ärzten erst die Ersatzkassenzulassungen, dann die Approbationen aberkannt worden waren und viele jüdische Kollegen bereits das Land verlassen oder ihre Emigration vorbereitet hatten, wurde gegen Iwan Schumacher eine Sicherungsanordnung erlassen. Aus einem Schreiben der Zollfahndungsstelle an die Devisenstelle des Oberfinanzpräsidiums geht hervor, ein Kapitalfluchtverdacht begründe sich „auf die Tatsache, dass Schumacher Jude ist und auszuwandern beabsichtigt.“ Es gelte „zu verhindern, dass unter Verletzung oder Umgehung bestehender Vorschriften Devisen entzogen werden.“ Zugestellt wurde diese Anordnung neben dem Betroffenen auch der Commerz- und Privatbank Hamburg, die sein Vermögen und ein Girokonto verwaltete, der Depositenkasse Barmbek, die ein weiteres Konto führte und der Iduna-Germania-Lebensversicherung, bei der eine Police abgeschlossen war. Iwan Schumacher hatte bei der Gewerbepolizei sein Vermögen an179 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 180 zumelden, es belief sich auf 121 985,84 RM zzgl. Lebensversicherung und sonstigen Werten wie Ölbilder, Teppiche, Schmuck und Silber, die auf 4000 RM geschätzt wurden. Per Einschreiben wurde ihm mitgeteilt, dass er auf Grund von § 59 des Devisensteuergesetzes vom 12. Dezember 1938 nur noch mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Devisenstelle über sein inzwischen gesperrtes Girokonto verfügen dürfe, auf das auch alle anderen Vermögenswerte „gutzubringen“ seien. Die monatliche Entnahme von 800 RM war ihm gestattet sowie Zahlungen für öffentliche Abgaben und Steuern einschließlich der Judenvermögensabgabe. Für Zuwiderhandlungen wurden Gefängnis und Geldstrafe, in schweren Fällen Brief der Versicherungsgesellschaft 180 StaHH 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 181 Zuchthaus und Geldstrafe angedroht. Begründung: „Herr Dr. I. Schumacher ist Jude. Bei den in letzter Zeit mit Juden gemachten Erfahrungen ist es erforderlich, Verfügungen über ihr Vermögen nur mit Genehmigung der Devisenstelle zuzulassen.“ Möglicherweise legte Iwan Schumacher Beschwerde ein, denn mit Schreiben vom Oberfinanzpräsidenten wird die Sicherungsanordnung bestätigt: „Beschwerde ist an den Herrn Reichswirtschaftsminister, Berlin, gegeben. Sie ist – in doppelter Ausführung – bei mir einzureichen.“ Die Commerzbank informierte die Zollfahndungsstelle über Guthabenhöhe und Wertpapiere, die Iduna-Lebensversicherung fragte beim Oberfinanzpräsidenten an, ob sich die Sicherungsanordnung auch auf die Ehefrau bezöge, die bei vorzeitigem Tod des Versicherungsnehmers Zahlungsempfängerin sein würde. Die Antwort kam per Ergänzungsanordnung: „... ordne mit sofortiger Wirkung an, dass Frau Schumacher als Bezugsberechtigte ... nur mit meiner Genehmigung verfügen darf.“ Im September 1939 musste Iwan Schumacher für eine neue Festsetzung des monatlich zur Verfügung stehenden Betrags einen Fragebogen über laufende Kosten ausfüllen: Miete 180 RM, Lebensunterhalt 250 RM, Hausangestellte 80 RM, Zuwendung an Erna Lewandowski im Jüdischen Siechenheim Altona 10 RM und Sonstiges 250 RM = 800 RM. Es gibt also einen Hinweis auf eine ältere Verwandte mütterlicherseits. Mit Sicherungsanordnung vom 20. Oktober 1939 wurde der bisher genehmigte Betrag von 800 auf 600 RM reduziert. Die Anordnungen vom Oberfinanzpräsidium, Devisenstelle, waren immer noch an die Anschrift Richardstraße 11 gerichtet. Die Wohnung konnte weiter bewohnt werden, da Hypotheken auf das Grundstück von der Depositenkasse milder Stiftungen des Jüdischen Religionsverbandes Hamburg e. V. verwaltet wurden und der seit 1939 aufgehobene Mieterschutz für Juden hier nicht die üblichen Auswirkungen hatte. 1943 gehörte das Haus zu den von der Gestapo beschlagnahmten Immobilien, doch deren Freude daran währte nicht lange. In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli wurde es im Rahmen der „Operation Gomorrha“ durch Bomben zusammen mit den benachbarten Häusern bis auf die Grundmauern zerstört. Moses Goldschmidt befand sich seit 1939 im Exil in Brasilien. Unter widrigen Umständen war ihm die Auswanderung zu seinen bereits dort lebenden Söhnen gelungen, während die Tochter in Frankreich einen Mann mit britischer Staatsangehörigkeit geheiratet hatte und damit vor Verfolgungen geschützt war. Seine Frau war bereits einige Jahre zuvor verstorben, Freund Iwan hatte die Trauerrede gehalten. Das erarbeitete Vermögen war aufgebraucht oder beschlagnahmt, nahezu mittellos und mit angeschlagener Gesundheit lebte Moses Goldschmidt nun bei einem seiner Söhne und ahnte, dass er nicht mehr viel Zeit haben würde. Er war schon lange herzkrank. 1941 begann er mit der Aufzeichnung seiner Erinnerungen und sorgte sich um die Hamburger Freunde. Sie hatten keine Verwandten im Ausland, mit deren Hilfe sie an ein Visum gelangen konnten. Als er seine Aufzeichnungen anfertigte, waren Agnes und Iwan, von denen er keine Nachricht hatte, vielleicht schon fort, der Deportationsbefehl erreichte sie im Herbst. Am 25. Oktober 1941 fand der erste Deportationstransport Hamburger Juden statt, deren letzte Reise an der 181 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 182 Dr. med. I. Schumacher, Litzmannstadt/ Getto, 7/11/41 Herr Max Nagel leidet an hochgradiger Spondylitis und Nervenentzündung der austretenden Nervenstämme. Es ist infolge seines Leidens unmöglich, dass er auf dem Fussboden liegt. Es wird ärztlicherseits empfohlen, ihm möglichst bald ein Quartier zu verschaffen. gez. Dr. Schumacher, Lagerarzt, Mühlgasse 25 Richard Baer, Fischstr. 15, ist noch fieberhaft erkrankt und noch arbeitsunfähig bis 20. Mai. 10/V/42 Dr. Schumacher Weitere Atteste, die Iwan Schumacher ausstellte, lauteten beispielsweise: Ärztliches Attest Frau Nath, Rachel, Hanseatenstraße 76/10, ist wegen eines Uterusprolapses und Senkung für eine Operation im Krankenhaus bereits vorgemerkt. Die Qualification ist beim Gesundheitsamt bereits abgegeben. Frau Nath, die jetzt eine Aussiedlungsaufforderung erhalten hat, ist durch ihr Leiden so behindert, dass sie nicht längere Wege zu Fuss machen kann und sie kann auch nichts tragen. 9.V.42 Dr. Schumacher Ärztliches Zeugnis Herr Schloss, David, 60 Jahre alt, liegt seit 6 Wochen an Herzmuskelschwäche und Nierenentzündung krank. Er hat Ödeme an Händen, Gesicht und Füssen und ist in einem hochgradig geschwächten Ermattungszustand. Herr Schloss ist zur Zeit nicht für die Ausreise transportfähig. 7.V.1942, Dr. Schumacher Zimmer 13, Haus 15 Kind Ruth Schernez, 15 Jahre ist plötzlich fieberhaft an Grippe erkrankt (38,7 recht oft 42) und nicht transportfähig. 6.V.42 Dr. Schumacher 182 Ärztliches Zeugnis Frau Schloss, Zelda (?), 46 Jahre, hat hochgradige Oedeme bis in die Oberschenkel hinauf, Asates (?). Sie ist für die Ausreise nicht transportfähig. 7.V.1942 Dr. Schumacher Ärztliches Attest, Litzmannstadt G. 7.V.42 Herr Gutenberg, Marcus, 43 Jahre, ist seit mehreren Monaten bettlägerig krank. Er leidet an einer Thrombose des linken Beines und an einer Kreislaufstörung. Herr Gutenberg ist nicht transportfähig für die Ausreise. Dr. Schumacher Ärztliches Attest Frau Gutenberg, Rosa, 41 Jahre, ist an einer hochgradigen körperlichen Schwäche mit Schwindelanfällen erkrankt. Sie leidet an Unterleibsblutungen. Frau Gutenberg hat fünf Kinder im Alter von 14, 11, 9, 7, 5 Jahren zu pflegen. Sie ist durch die Pflege körperlich dermassen überanstrengt, dass sich Schwindel und Ohnmachtsanfälle einstellen. Sie ist meines Erachtens zur Zeit nicht transportfähig. 7.V.42 Dr. Schumacher Quelle: USHMM 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 183 Moorweide am Dammtor begann und im polnischen Getto Lodz endete. Drei Tage zuvor wurde das Finanzamt Hamburg-Dammtor mit der Verwertung des von der Gestapo beschlagnahmten Eigentums beauftragt. Transportteilnehmer waren auch Isaak Iwan Schumacher und seine Frau Auguste Agnes, beide 66 Jahre alt und damit zu den 30 über 65-Jährigen gehörend, die entgegen den „Richtlinien“ mit diesem Transport „ausgesiedelt“ wurden. Iwan Schumacher starb am 12. Januar 1943 im Getto Lodz, ein Aktenvermerk nennt als Todesursache „Unterernährung“. Letzte Lebenszeichen besagen, dass er als Lagerarzt andere Gefangene betreut und versucht hatte, Erleichterungen für sie zu erreichen, so etwa durch erbetene Verbesserungen der katastrophalen Unterbringungssituation im Lager oder Atteste, die seine Patienten wegen Transportunfähigkeit vor der „Ausreise“ retten sollten. Doch half dies in den meisten Fällen nicht, denn der Auftrag der Aussiedlungskommission bestand ja gerade darin, diejenigen Leute zu deportieren, die nicht mit der Produktion von Waren beschäftigt waren. In den meisten Fällen führte die Bestätigung „nicht transportfähig“ nur dazu, dass die Kommission „przewoz“ vermerkte, also „mit Wagen transportieren“. Auguste Agnes Schumacher folgte ihrem Mann Iwan im Jahr darauf am 6. Juli 1944, ihre Todesumstände sind unbekannt. Moses Goldschmidt erlag 1943 einem Herzanfall. Seine Aufzeichnungen gelangten Jahrzehnte später in die Hände seiner in England lebenden Enkelin, deren Ehemann Raymond Fromm sie überarbeitet und 2004 veröffentlicht hat. – Erika Draeger Quellen: 1; 2; 5; 8; StaHH 314-15, OFP, R 1939/2318; StaHH 314-15, OFP, St Ic 1424; USHMM, RG 15.083 299/77, 719, 720; 300/701-702, 891; 302/351, 611, 662; Meyer: Die Verfolgung und Ermordung der Hamburger Juden, S. 29, S. 43, S. 48, S. 206; von Villiez: Mit aller Kraft verdrängt., S. 279, S. 396; Goldschmidt/ Fromm: Mein Leben als Jude in Deutschland, S. 59, S. 70, S. 96, S. 109, S. 153; USHMM, RG 15.083 299/77, 719, 720; 300/701-702, 891; 302/351, 611, 662; Brunswig: Feuersturm über Hamburg, S. 248 ff.; Humanistisches Gymnasium Christianeum in Hamburg, Archiv der Schulbibliothek; Staatsbibliothek Berlin online: http://stabikat.de/DB=1/SET=6/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT= LST_aty&TRM=iwan+schumacher, Zugriff am 11.12.2009. Karl Schumann, geb. 21.6.1902, verhaftet wegen Hochverrat im Jahr 1937, am 26.6.1945 in Jugoslawien in Kriegsgefangenschaft gestorben 62 Prechtsweg 15 Der Sozialdemokrat Karl Schumann wurde als Sohn des Ehepaares Carl und Margarethe Schumann in Hamburg geboren. Er hatte noch zwei weitere Geschwister. Zwar war er gelernter Tischler, doch eine Anstellung fand er bei der Hamburgischen Zimmererkrankenkasse in der Hamburger Straße, wo er im Büro tätig war. Karl Schumann heiratete Anfang der dreißiger Jahre die vier Jahre jüngere Margarethe Stolten, mit der er zwei Kinder bekam. Sein erster Sohn Wolfgang wurde am 6. September 1936 in Hamburg geboren. Von seinem monatlichen Gehalt, rund 260 RM, finanzierte Karl Schumann für seine Familie eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung im Prechtsweg 15. 183 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 184 Am 1. Dezember 1936 wurde Karl Schumann von der Gestapo verhaftet. In einer Karteikarte des Sicherheitsdienstes der SS heißt es zu ihm: „Tagesrapport Stapo Hamburg 1.12.36, festgenommen wegen Verbreitung illegaler Schriften bis Mitte 1935. Sozialistische Aktion, Neuer Vorwärts, Rote Bücher, ‚Kunst des Selbstrasierens’“. Durch die Verhaftung verlor Karl Schumann seine Anstellung und MargaDer Prechtsweg 11–19 im Nationalsozialismus Privatbesitz rethe musste die Wohnung aufgeben und ihre Familie mit Hilfe der Wohlfahrt ernähren. Karl Schumann wurde vom Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg zu einer Zuchthausstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt, welche er vom 11. Mai 1937 bis 5. Februar 1938 im Konzentrationslager Fuhlsbüttel und anschließend bis zum 4. September 1939 im Emslandlager Aschendorfermoor verbüßte. Nach seiner Entlassung kehrte er zu seiner Familie zurück. Ende 1942 wurde Karl Schumann zum sogenannten Bewährungsbataillon 999 eingezogen. Dies war eine Strafdivision der Wehrmacht, in der sich Gefangene aus Zuchthäusern und Konzentrationslagern wiederfanden. Zum Teil waren es politische Gefangene, aber auch Gefangenenkarteikarte aus Fuhlsbüttel von Karl Schumann 184 StaHH 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 185 Kriminelle wurden dem Bataillon zugeteilt. Seit dem 5. Mai 1943 musste Schumann als Soldat beim 2. Afrika-Schützen-Regiment 963 dienen. Zu diesem Zeitpunkt war seine Frau Margarethe bereits mit seinem zweiten Sohn Manfred schwanger, welcher am 26. August 1943 in Ludwigslust zur Welt kam. Karl sollte seinen Sohn nicht mehr zu sehen bekommen. Nach seinem Einsatz in Afrika wurde Karl Schumann nach Jugoslawien versetzt. Der letzte Eintrag in seinem Soldbuch lautete: Ersatzbrigade 999, Truppenübungsplatz Baumholder. Am 26. Juni 1944 geriet Karl Schumann in jugoslawische Gefangenschaft. Ein Jahr später, am 26. Juni 1945, starb er in Pancevo, Jugoslawien, in Kriegsgefangenschaft an den Folgen der Ruhr. Quellen: StaHH 242-1 II, Gefängnisverwaltung II, Abl. 13, Gefangenenkartei Männer (ältere Kartei); StaHH 242-1 II, Gefängnisverwaltung II, Abl. 16, Untersuchungshaftkartei Männer; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 21.06.02 Schumann, Karl; Totenliste Hamburger Widerstandskämpfer und Verfolgter 1933–1945. Harald Seligmann, geb. 9.5.1886, am 26.6.1942 im Konzentrationslager Neuengamme gestorben 63 Schwanenwik 29 Harald Seligmann kam als Sohn des AuswandererExpedienten Carl Seligmann und seiner Ehefrau Johanna, geb. Peine, in Hamburg zur Welt. Nachdem er seinen Schulabschluss an der Dr.-Anton-Rée-Realschule bekommen hatte, begann er eine Lehre zum Gastronomen. Seine Arbeit als Gastwirt führte ihn durch ganz Deutschland bis er schließlich im Jahr 1908 zur Armee ging. Zwei Jahre lang diente Harald Seligmann beim 85. Infanterieregiment. Nach seiner Dienstzeit fuhr Harald Seligmann mehrere Jahre zur See. Mit Beginn des Ersten Weltkrie- Das Haus im Schwanenwik 29, 2009 Privatbesitz ges wurde er zur Marine eingezogen und in Kiel stationiert, wo er bis Kriegsende bei der SpionageAbwehr tätig war. 1916 heiratete Harald Seligmann seine Verlobte Bianka Diek. Sie war katholisch und auch er trat ihrem Glauben bei. Ihr einziges Kind, Harald jr., wurde am 19. Oktober 1918 in Kiel geboren. Nach Kriegsende musste Harald Seligmann sich um eine neue Anstellung bemühen. Seit 1925 arbeitete er als Nachtportier im Hamburger Hotel „Vier Jahreszeiten“. Sein Sohn wurde im selben Jahr eingeschult und besuchte bis 1935 eine katholische Realschule. Danach wechselte er auf die Oberrealschule auf der Uhlenhorst, wo er 1937 sein Abitur bestand. Wie sehr sich die Familie Seligmann von ihren jüdischen Wurzeln gelöst hatte, zeigt sich darin, dass Harald jr., „Mischling ersten Grades“, zwei Jahre lang Mitglied der Hitlerjugend war, bis er 1936 aufgrund seines jüdischen Vaters ausgeschlossen wurde. 185 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 186 Nach dem Arbeitsdienst begann Harald jr. ein Chemiestudium an der Universität Hamburg. Die sozialen Verhältnisse der Familie verschlechterten sich 1938, weil Harald Seligmann im März entlassen wurde. Um sein Studium finanzieren zu können, begann Harald jr. bei den Hamburger Gaswerken am Grasbrook als Laborant zu arbeiten. Doch das Geld der Familie reichte auf Dauer nicht aus, um das Studium weiterhin bezahlen zu können. Deswegen entschloss sich Bianka Seligmann, eine Gastwirtschaft zu eröffnen. Die Konzession für den Betrieb wurde ihr jedoch verwehrt. Nur wenn sie sich innerhalb von vier Wochen von ihrem Ehemann scheiden ließ, würde sie die Konzession erhalten, lautete die Forderung. Letztlich beschloss das Ehepaar Seligmann, sich dem Druck zu beugen und Bianka Seligmann reichte 1939 die Scheidung ein. Zwar war das Ehepaar nun geschieden, doch besuchte Harald Seligmann seine Familie weiterhin in der ehemals gemeinsamen Wohnung am Schwanenwik 29. Nach einem dieser Besuche wurde er denunziert und am 6. März 1939 von der Polizei verhaftet. Er habe gegen die §§ 2 und 5 II des „Gesetzes zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ verstoßen, lautete die Anklage. Am 11. August 1939 wurde Harald Seligmann wegen „Rassenschande“ zu zwei Jahren Haft verurteilt, von denen er drei Monate bereits in Untersuchungshaft verbüßt hatte. Am 19. August 1939 trat Harald Seligmann seine Strafe im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel an. Während seiner Haft erlitt er am 18. März 1940 einen Schwindelanfall und stürzte, wodurch er sich eine schwere Platzwunde am Hinterkopf zuzog. Im selben Jahr bemühte sich Harald Seligmann um ein Gnadengesuch beim zuständigen Richter, welches jedoch abgelehnt wurde. Noch während seiner Haft versuchte Harald Seligmann, eine Auswanderung für die Zeit nach seiner Entlassung zu organisieren. Hierzu schrieb er die Jüdische Gemeinde an und hoffte auf Unterstützung durch seinen Vetter Hans Seligmann. Doch eine Auswanderung war für ihn zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Nach der vollständigen Verbüßung seiner Strafe wurde Harald Seligmann am 18. Mai 1941 um 18:00 Uhr abends aus dem Polizeigefängnis Fuhlsbüttel entlassen und mit der Begründung der „Schutzhaft“ ins Konzentrationslager Neuengamme überstellt. Dort starb er am 26. Juni 1942. Offiziell hieß es, er sei an einer Lungen- und Darmtuberkulose in der Landesheil- und Pflegeanstalt Bernburg gestorben. Auch sein Sohn Harald jr. war kurzzeitig in Fuhlsbüttel inhaftiert. Im Mai 1939 traf er seinen alten Schulfreund Hippa auf der Straße. Beide unterhielten sich über Politik und Harald jr. ließ während des Gesprächs verlauten, er halte die aktuelle politische Lage in Deutschland für bedenklich. Im Oktober trafen sich beide zufällig wieder auf der Langen Reihe. Diesmal sprachen sie über den Polenfeldzug und Harald jr. ließ sich zu der Aussage hinreißen: „Der Krieg mit Polen musste so schnell zu Ende gehen, weil wir mit Giftgas geschossen haben. Die Polen sind umgefallen wie die Fliegen.“ Außerdem meinte er, das Naziregime werde bald verschwinden und dann sei der Krieg zu Ende. Harald jr. wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Hippa Politischer Leiter der NSDAP war und jedes Gespräch seiner Ortsgruppe meldete. 186 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 187 Sterbeurkunde aus dem Konzentrationslager Neuengamme Photoarchiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme Es folgten noch mehrere Zusammentreffen der ehemaligen Schulkameraden und bei ihrem letzten wurde Hippa von einem Passanten mit „Heil Hitler!“ gegrüßt. Daraufhin bemerkte Harald Seligmann jr.: „Du kannst ja auch später mal sagen, du hättest anstelle des Parteiabzeichens eine Leuchtplakette getragen.“ Hippa zeigte Harald jr. kurzerhand an und dieser wurde verhaftet. Wegen „Heimtücke“ wurde Harald Seligmann jr. zu einer Gefängnisstrafe von 10 Monaten verurteilt, die er am 15. März 1940 antrat. Im Oktober desselben Jahres wurde er wieder entlassen. Harald Seligmann jr. überlebte den Holocaust. Quellen: 1; 2; 4; 5; 8; StaHH 242-1 II, Gefängnisverwaltung II, 1094/39 Seligmann; StaHH 314-15, OFP, R 1940/937; KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Totenbuch; Sonderstandesamt Neuengamme, Sterberegister. 187 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 188 Noemi Carola Sello, geb. Weil, geb. 26.12.1890, Flucht in den Tod am 24.10.1941 64 Hartwicusstraße 2 Noemi Weil kam als Tochter von Henri Weil und seiner Frau Ada, geb. Wodiska, in Paris zur Welt. Wann sie nach Deutschland zog, ist nicht bekannt, ihre Eltern und Verwandten blieben in Frankreich. Noemi Weil heiratete am 24. April 1922 den neun Jahre älteren Heinrich Sello in BerlinWilmersdorf. Schon drei Jahre nach der Hochzeit wurde die Ehe am 25. Juni 1925 vom Berliner Landgericht geschieden. Nach ihrer Scheidung verließ Noemi Sello Berlin und zog nach Hamburg in die Hartwicusstraße 2. Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft musste sie ihre Wohnung 1939 aufgeben und in die Höltystraße 6 umziehen, wo sie bei Emmi Schanze zur Untermiete wohnte. Bis zuletzt versuchte Noemi Sello, sich ihren Lebensunterhalt als Arbeiterin selbst zu verdienen. Im Herbst 1941 erhielt Noemi Sello die Aufforderung, sich am 24. Oktober in der Niedersachsen Provinzialloge in der Moorweidenstraße einzufinden. Von dort aus sollte sie einen Tag später mit dem ersten Transport von Hamburg ins Getto Lodz deportiert werden. Ihre Vermieterin berichtete der Polizei, dass Noemi Sello am Vorabend der Deportation ihren Koffer packte. Sie selbst ging zu Bett und wachte erst am nächsten Morgen gegen 6 Uhr 20 wieder auf, weil sie einen starken Gasgeruch wahrnahm. In der Küche fand sie Noemi Sello. Diese saß auf einem Küchenstuhl und hatte den Gasschlauch im Mund. Emmi Schanze drehte den Gashahn ab und benachrichtigte die Polizei, die kurz darauf zusammen mit der Feuerwehr erschien. Die Feuerwehr öffnete Fenster und Türen und versuchte Noemi Sello zu reanimieren, doch der herbeigerufene Arzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Noemi Sello wurde nur fünfzig Jahre alt, keiner ihrer Angehörigen konnte ihr in ihren letzten Stunden beistehen. Quellen: 1; 4; 5; 8; StaHH 331-5, Polizeibehörde – Unnatürliche Sterbefälle, 3 Akte 1941/1680. Die Hartwicusstraße im Jahr 1916 Bildarchiv Hamburg 188 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 189 Irma Sperling, geb. 20.1.1930, Todesdatum 8.1.1944 in der Heilanstalt „Am Steinhof“ in Wien 65 Adolf-Schönfelder-Straße 31 (früher Rönnhaidstraße 30, gegenüber) Irma Sperling wurde nur dreizehn Jahre alt. Da sie eine geistige Behinderung hatte, wurde sie von Ärzten in der Heilanstalt „Am Steinhof“ in Wien ermordet und somit ein Opfer der Euthanasie. Bei ihrer Geburt deutete alles auf ein gesundes Kind hin, laut Bericht der Geburtsklinik Finkenau war sie 50 cm groß, 3200 gr. schwer und hatte keine weiteren Auffälligkeiten. Als siebtes von zwölf Kindern wuchs sie in ärmlichen Verhältnissen auf. Ihr Vater, Bruno Sperling, arbeitete als Angestellter bei der „Allgemeinen Ortskrankenkasse Hamburg“. Da er aktiv in der Arbeiterbewegung tätig gewesen war, wurde er am 5. Mai 1933 von der Gestapo verhaftet und verlor während der Haft seine Anstellung. Danach geriet die Familie in immer größere finanzielle Not. Die Mutter, Anna Katharina Helene Sperling, geb. Pappermann, war zu dem Zeitpunkt schon lange krank und musste unter anderem wegen einer Herzbeutelentzündung und Rheumatismus auch stationär behandelt werden. Trotz der schwierigen Verhältnisse, in denen sich Familie Sperling befand, blieb zu Hause immer noch Zeit für schöne Momente. Die Kinder und ihre Eltern sangen und musizierten gemeinsam, und auch Irma zeigte als kleines Mädchen eine musikalische Begabung. Ihre zwei Jahre ältere Schwester Antje Kosemund erinnerte sich später daran, dass Irma oft in ihrem Bettchen saß, sich zur Musik wiegte und im Takt zu klatschen versuchte. Damit Irma Sperlings Behinderung behandelt werden konnte, wurde sie für mehrere Monate ins Krankenhaus Rothenburgsort eingeliefert. Dort entwickelte sie sich gut, erlernte das Sitzen, Stehen und Laufen. Ihr Vater schickte sie danach in eine Tageskrippe. Im August 1933 attestierte ihr jedoch ein Arzt „Schwachsinn“ und forderte die Eltern Irma Sperling (2. v. r.) im Sommer 1936 im Park der ehemaligen Alsterdorfer Anstalten Privatbesitz auf, Irma Sperling in die damaligen Alsterdorfer Anstalten zu verlegen. Die Einweisung erfolgte dann am 21. Dezember 1933. Dort bekam das kleine Mädchen weder die Förderung noch die Zuwendung, die sie dringend benötigte. Deshalb dauerte es auch nicht lange, bis sie ihre Fähigkeiten wieder verlernte und sogar aggressive Züge zeigte. Für Antje Kosemund blieb Irma immer wie folgt in Erinnerung: „Lange braune Locken hatte sie und schöne braune Augen – ein ausdrucksvolles Gesicht. Heute würde man so ein Kind auf die Förderschule schicken, wo sie sich hätte entwickeln können.“ 189 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 190 Zusammen mit 227 anderen Mädchen und Frauen wurde Irma Sperling am 16. August 1943 in als „Reichspost“ getarnten Bussen in die Heilanstalt „Am Steinhof“ in Wien gebracht. Dort begannen ihre Qualen. Das Mädchen wurde kaum noch ernährt und erhielt stattdessen eine Überdosierung der Medikamente. Nach acht Wochen wog sie statt 40 nur noch 28 Kilogramm. In ihrer Krankenakte vom 26. September 1943 wurden zudem auch ihre zunehmenden Aggressionen vermerkt: „[Sie] schlägt eine große Fensterscheibe ein, ohne sich zu verletzen. Zwangsjacke.“ Mit dreizehn anderen Kindern wurde Irma Sperling schließlich in die Kinderfachabteilung „Am Spiegelgrund“, Pavillon 15, Irma Sperling 1934 Privatbesitz verlegt. Keines der Kinder überlebte die „Behandlung“. Zwischen 1942 und 1945 wurden mehr als 300 Kinder in der Heilanstalt „Am Steinhof“ in Wien getötet. Ihre Gehirne wur- den gesammelt und nach 1945 von Dr. Heinrich Gross, der bis in die achtziger Jahre hinein nahezu unbehelligt praktizierte, für gehirnanatomische Forschungen weiterverwendet. Irma Sperling starb am 8. Januar 1944. In der Sterbeurkunde wurde die damals übliche Todesursache angegeben: Grippe und Lungenentzündung, sowie zusätzlich angeborene zerebrale Kinderlähmung. Tatsächlich starben die meisten Kinder an den Folgen des Medikaments Luminol. Auch Irma Sperlings Gehirn wurde nach ihrem Tod präpariert und zu anderen Präparaten in eine Gehirnkammer gestellt. Erst 1996 erreichte ihre Schwester Antje Kosemund eine Überführung der Überreste nach Hamburg. Am 8. Mai 1996 wurden die sterblichen Überreste von Irma, sieben weiteren Kindern bzw. Jugendlichen und zwei Frauen feierlich auf dem Ehrenfeld der Geschwister-Scholl-Stiftung auf dem Friedhof Ohlsdorf bestattet. 2002 erreichte Antje Kosemund die Nachricht, dass die Krankenakte von Irma aufgetaucht sei. Jahrelang hatte sie nach dieser Akte immer wieder gefragt. Man hatte in Wien einen verschlossenen Metallschrank aufgebrochen und dort vier Akten von Opfern noch aus der Alsterdorfer Zeit entdeckt. Auch fanden sich weitere präparierte Gehirnschnitte von Irma und unzähligen weiteren Menschen auf einem Dachboden des Wiener Institutes, die am 28. April 2002 in der Gedenkstätte auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt wurden. In Alsterdorf trägt heute eine Straße den Namen Irma-Sperling-Weg. – Stefanie Rückner/Carmen Smiatacz Quellen: Bake: Wer steckt dahinter?, S. 91 f.; Kosemund: Spurensuche Irma.; Persönliche Gespräche mit Frau Antje Kosemund, Hamburg 2009; Wunder: Auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten mehr, S. 23 ff, S. 222; Spiegelgrund – ein Film von Angelika Schuster und Tristan Sindelgruber, Österreich 2000. 190 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 191 Walter Wolfgang Stock, geb. 17.1.1897 in Altona, Verhaftung 9.3.1944, Deportation nach Auschwitz im Juli 1944 66 Bendixensweg 3 Walter Wolfgang Stock kam am 17. Januar 1897 in Altona zur Welt als Sohn seiner unverheirateten jüdischen Mutter Adelheid Stock, geboren am 7. Januar 1867 in Fliestedten. Walter hatte eine ältere Schwester Helena, geb. 1888, und eine jüngere Schwerster Louise Stock. Adelheid Stock heiratete später Ludwig Behr, geb. am 17. März 1877 in Leimersheim, und hatte mit ihm einen weiteren Sohn, Joseph Behr. Walter Stock besuchte die Talmud Tora Schule bis zum „Einjährigen“ (mittlere Reife), darauf folgte eine kaufmännische Lehre in einer Firma für Schneiderbedarfsartikel. In diesem Beruf war er bis 1928 tätig, danach als Handelsvertreter bei dem Wohnungsanzeiger Lessner in der ABC-Straße. Sein durchschnittliches Monatsgehalt betrug 360 RM. 1936 heiratete er die evangelische Erna Marie Sophie Baumgartl, geboren am 28. August 1899, und lebte mit ihr und Ernas Tochter Marianne, geboren am 2. September 1924 und evangelisch getauft, in einer „privilegierten Mischehe“. Die Familie wohnte in der Alten Wöhr 2a und im Bendixensweg 3 in Barmbek und hatte viel Kontakt mit Lissi Acker, deren Großmutter väterlicherseits eine geborene Stock und mit Walters Mutter verwandt war. Mit Lissi und ihrem neunjährigen Sohn Helmut verbrachten Walter und Erna Stock auch Weihnachtsfest und Sylvesterabend 1942 bei Ackers in der Gens- Walter und Erna Stock zum Jahreswechsel 1942/43 bei Familie Acker Privatbesitz lerstraße 16. Walter Stock verlor seine Arbeit aus Gründen „rassischer“ Verfolgung. Er ging davon aus, „Halbjude“ zu sein und einen „arischen“ Vater zu haben, doch bei der Gestapo galt er als „Volljude“. Nach längerer Arbeitslosigkeit betätigte er sich ab 1941 im Schneiderhandwerk und übernahm Aufträge als Heimarbeiter. Die Familie überlebte 1943 die verheerenden Bombenangriffe auf Hamburg. Aufgrund einer Bemerkung vor oder während eines der Bombardements im Luftschutzkeller („es leben die Luftgangster und Nichtarier“) wurde Walter Monate später von einem Mann aus der Nachbarschaft denunziert. Am 9. März 1944 erfolgte die Verhaftung, man brachte ihn ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel, im Juli 1944 mit einem Deportationstransport nach Auschwitz. Seine Frau erhielt Briefe von ihm mit Datum vom 24. September, 8. Oktober, 26. November und 10. Dezember, danach gab es kein Lebenszeichen mehr, er galt als verschollen. Mit Beschluss vom 6. Oktober 1946 hat das Hamburger Amtsgericht Walter Stock für tot erklärt auf den 8. Mai 1945, 24 Uhr. 191 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 192 Es bestand Unklarheit, von wem die Anzeige ausgegangen war. Vermutungen richteten sich gegen zwei Nachbarn, von denen sich einer im Jahre 1946 schriftlich bei der Witwe Erna Stock gegen den Verdacht der Denunziation verwahrte und ein Ehepaar benannte, das sich ihm gegenüber für die Anzeige verantwortlich erklärt habe. Erna Stock gab später an, dass gegen sie während der Inhaftierung ihres Mannes eine Wohnungsräumung durchgeführt wurde. Sie war wohnungslos, mittellos, krank und musste gleich nach dem Krieg eine Sonderhilfsrente beantragen, die nach dem Bundesergänzungsgesetz von 1953 aufgebessert werden sollte. Noch 1957 galten jedoch die Ermittlungen als nicht abgeschlossen, erst ein Jahr später kam endlich der neue Rentenbescheid. Ehemalige Nachbarn wollen nicht in den Verdacht der Denunziation geraten Privatbesitz Walters Bruder Joseph Behr war Leiter des Verlags M. Lessmann, in dem auch das Israelische Familienblatt erschien. Er und seine Ehefrau Hildegard, geb. Holland, bewohnten eine 3 ½-Zimmer-Wohnung im Alten Teichweg 7 in Barmbek. Der Verlag wurde am 9. November 1938 auf Anordnung der Gestapo liquidiert und Joseph Behr in der Pogromnacht aus der Wohnung der Schwiegereltern in der Hufnerstraße verhaftet. Erst brachte man ihn ins Polizeigefängnis Fuhlsbüttel, von dort ging es weiter ins KZ Sachsenhausen. Am 15. Dezember wurde er freigelassen, weil er seine Bemühungen um Emigration nachweisen konnte. Bis zur endgültigen Ausreise musste er die zermürbende Prozedur durchstehen, sich täglich bei der Gestapo zu melden. Joseph Behr und seine Frau traten am 29. März 1939 mit dem Schiff „General Osono“ die Fahrt in die Emigration nach Buenos Aires an. In Argentinien konnte das Paar zunächst auf192 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 193 atmen, aber die Ehe wurde geschieden oder die erste Frau Behr verstarb dort. Es gab später zwei weitere Ehefrauen. Joseph Behr konnte aufgrund anfänglicher Sprachschwierigkeiten beruflich nur schwer Fuß fassen; nach längerer Eingewöhnung arbeitete er als Buchhalter. Zudem war er durch seine angeschlagene Gesundheit beeinträchtigt, jahrelang quälten ihn ein Zwölffingerdarmgeschwür und eine Ohrenerkrankung. Auch das tropische Klima bekam ihm nicht gut. Joseph – inzwischen José – Behr konnte für einen Teil seiner durch politische Umstände und Flucht bedingten Einschränkungen im Rahmen langwieriger Wiedergutmachungsverfahren Entschädigungen erstreiten. Er starb mit knapp 65 Jahren am 18. Juli 1969. Hildegard Stocks Eltern wohnten in der Hufnerstraße 40, ihre Mutter Lisette Holland, geboren am 15. Mai 1881 in Fliestedten, war eine Tante von Walter Stock. Lisette wurde am 15. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert und von dort am 15. Mai 1944 weiter nach Auschwitz, wo sie ermordet wurde. Hildegards Vater Eugen Holland, geb. am 13. August 1876 in Bad Rappenau, folgte mit dem Transport am 23. Juni 1943 nach Theresienstadt und kam dort am 24. Januar 1944 um.Walters Mutter Adelheid Behr und sein Stiefvater Ludwig Behr wurden nach Minsk verschleppt und fanden dort den Tod. Seine jüngere Schwester Louise wurde nach Auschwitz deportiert, die ältere, Helena, verheiratete Sein, überlebte den Holocaust. – Eva Acker/Erika Draeger Quellen: 1; 4; 5; 8; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1 28.08.99 Stock, Erna; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1 14.08.04 Behr, José; Interview mit Lissi Acker, Dez. 1990, Geschichtswerkstatt Barmbek. Hugo Strauß, geb. 6.6.1878, deportiert am 4.12.1941 nach Riga und dort verschollen Agnes Strauß, geb. Steinfeld, geb. 20.1.1891, Flucht in den Tod am 11.11.1941 Edith Hilde Strauß, geb. 22.6.1914, am 4.12.1941 nach Riga und dort verschollen 67 Hans-Henny-Jahnn-Weg 8 (Osterbeckstraße 8) Hugo Strauß wurde am 6. Juni 1878 in Hamburg als Kind der jüdischen Eheleute Strauß geboren. Sein Vater Selig war Lehrer. Er besuchte die Talmud Tora Realschule, später das Hamburger Wilhelmgymnasium und verbrachte seine Studienzeit in Würzburg, München und Berlin. Die Approbation erhielt er 1903, etwa 1906 ließ er sich als praktischer Arzt in Hamburg nieder und heiratete 1913 seine ebenfalls jüdische Frau Agnes, geb. Steinfeld. Im gleichen Jahr mieteten sie eine 5 ½-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Uhlenhorst, in der Osterbeckstraße 8 nahe Hofweg und Mühlenkamp. Hier eröffnete er auch seine Praxis und war gleichzeitig als Schul- und Wohlfahrtsarzt tätig. Er gehörte frühzeitig der Jüdischen Gemeinde an und nahm am Ersten Weltkrieg teil. Hugo Strauß wurde 1933 gezwungen, seine Tätigkeit als Schularzt aufzugeben, kurz darauf verlor er die Zulassung als Wohlfahrtsarzt und einen Teil seiner Privatpatienten. Seine Praxis erhielt er bis zur Aberkennung der Approbation 1938 aufrecht. Hugo und Agnes Strauß hatten zwei Töchter, Hilde wurde am 22. Juni 1914 geboren und Elisabeth am 17. März 1920. 193 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 194 Hilde besuchte das Real-Gymnasium Mittell-Redlich im Graumannsweg bis zum Abitur 1934, erhielt jedoch aus „rassischen“ Gründen keine Berechtigung zum Hochschulstudium. Sie wäre gern Lehrerin geworden wie ihr Großvater; auch die Schwester ihrer Mutter, die in Essen lebende Margarethe Steinfeld, übte diesen Beruf aus. Der Wunsch, außerhalb der Schule mit Kindern zu arbeiten, wurde ebenfalls erschwert. Das Fröbel-Kindergärtnerinnen-Seminar nahm keine jüdischen Anwärterinnen auf und jüdische Kindergärtnerinnen-Anstalten in Berlin waren hoffnungslos überfüllt. Es gelang ihr jedoch, nach dem Besuch einer Haushaltungsschule, eine Stelle im Heim des Jüdischen Frauenbundes in Wyk auf Föhr zu bekommen, um dort mit Kindern zu arbeiten und anschließend im Privathaushalt der Familie Liebschütz in Blankenese tätig zu werden. Ab 1938 war sie im Israelitischen Krankenhaus zunächst im hauswirtschaftlichen Bereich beschäftigt und erlernte dann die Krankenpflege. Hildes Abschlusszeugnis aus dem Jahr 1934 vom RealGymnasium Mittell-Redlich StaHH 194 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 195 Antrag auf Freigabe von 600 RM StaHH Auch die jüngere Schwester Elisabeth besuchte das Real-Gymnasium Mittell-Redlich. Laut Zeugnis von 1935 sollte sie in die Obersekunda versetzt werden, aber wegen der Aussichtslosigkeit, später ein Studium zu beginnen, brach sie die Schule ab. Gern hätte sie eine medizinisch-technische Ausbildung gewählt, hatte aber keine Chance auf einen Ausbildungsplatz und folgte dem Beispiel der Schwester. Sie erlernte die Hauswirtschaft und war in jüdischen Institutionen in Hamburg, Wyk auf Föhr und Hannover tätig, wo der Bruder ihres Vaters, Hermann Strauß, mit seiner Familie lebte. Im Juni 1939 konnte die 19-jährige Elisabeth dank einer schottischen Quäker-Hilfsorganisation der bedrohlichen Situation im Land durch Emigration entkommen, sie gelangte nach 195 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 196 Edinburgh. Zunächst fand sie eine Beschäftigung als Haushaltshilfe und lernte ihren künftigen Ehemann, den Österreicher Stefan Wirlander kennen, der als Emigrant und Angehöriger des österreichischen Widerstands in der britischen Armee aktiv war und einen Rundfunksender betreute. Die beiden heirateten im März 1943. Kurz darauf konnte sie eine Ausbildung in ihrem Wunschberuf beginnen und wurde 1946 medizinisch-technische Assistentin. Anschließend folgte sie ihrem Mann, der 1945 nach seiner Entlassung aus der Armee schon nach Wien vorausgereist war. Sie gründeten eine Familie mit zwei Kindern. Hugo Strauß geriet im Zuge der Novemberübergriffe 1938 als „Schutzhäftling“ ins KZ Sachsenhausen, wurde jedoch wieder entlassen. Die große Wohnung in der Osterbeckstraße ließ sich nicht mehr halten, es fand sich eine kleinere Unterkunft in der Parkallee 10. Ein Auswanderungsvorhaben von Hugo Strauß und seiner Frau Agnes konnte nicht nachgewiesen werden, trotzdem bestand seitens der Behörden ein Kapitalfluchtverdacht. Die Sicherungsanordnung wurde im Dezember 1938 zugestellt, Reisepässe waren bei der Passpolizei abzugeben, alle Versicherungen, Barbestände und Wertpapiere waren einem Sperrkonto gutzuschreiben. Zunächst durfte die Familie monatlich über 1000 RM verfügen, ein Jahr später waren es nur noch 450 RM. Hugo Strauß erhielt zum 1. Oktober 1939 die Zulassung als „Krankenbehandler“ für jüdische Patienten und führte seine Praxis im Israelitischen Krankenhaus, wo auch Tochter Hilde tätig war. 1941 erhielt die Familie Nachricht vom Tod der Mutter und Großmutter Luise Steinfeld, wohnhaft in Düsseldorf. Der Erbanteil für Agnes Strauß wurde auf das Sperrkonto des Ehemannes eingezahlt. Die Zunahme der Ressentiments gegen Juden und das Damoklesschwert der Deportation wurden für Hugo und Agnes Strauß schließlich unerträglich. Ein Freund schrieb1946 an Elisabeth: „Ihre Eltern haben, als die Evakuierung für sie drohend wurde, im gegenseitigen Einverständnis den Entschluss gefasst, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Sie wurden zu früh geweckt und ins Krankenhaus gebracht, wo Ihre Mutter nach einigen Tagen, am 11. November 1941, starb. Ihr Vater und Hilde gingen am 4. Dezember 1941 mit einem Transport nach Riga. Ich war bis zum letzten Augenblick, da ich dort Bahnwache hatte, bei Ihrem Herrn Vater ... man hat leider nie mehr etwas von den beiden gehört.“ Ein Zeitzeuge erinnerte sich, dass Hugo Strauß vor die Wahl gestellt worden sei, entweder eine Anklage wegen Mordes an seiner Frau zu erwarten oder den nächsten Transport als Arzt zu begleiten. Hugo Strauß und seine Tochter Hilde kamen im Getto Riga um, genaue Umstände sind nicht bekannt, beide wurden zum 31. Dezember 1945 vom Amtsgericht Hamburg für tot erklärt. Wie bei vielen anderen Überlebenden haben jahrelange Verfolgung und die Verluste der nächsten Angehörigen auch Elisabeths weiteres Leben stark beeinträchtigt. Sie litt an chronischen Zwölffingerdarm- und Magengeschwüren, 1958 mit 44 Jahren war sie zu 66 Prozent erwerbsgemindert und nach einer Magenblutung zu schwach für eine Operation. – Erika Draeger 196 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 197 Quellen: 1; 2; 5; 8; StaHH 314-15, OFP, R 1938/3402; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 22.06.14 Strauß, Hilde; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 17.03.20 Wirlander, Elisabeth; von Villiez: Mit aller Kraft verdrängt, S. 405. Willy Erich Georg Unger, geb. 19.9.1908, inhaftiert 1938–1940, Selbstmord am 22.1.1943 in Hamburg 68 Schenkendorfstraße 30 Mit „wechselseitige Onanie im Mittelmeer“ beginnt eine Aufzählung von Sexualpraktiken, die das Landgericht Hamburg dem knapp 30-jährigen Willy Unger auf seinen zum Teil drei Jahre zurückliegenden Fahrten als Steward der Levante-Linie und der HAPAG vorhielt. Ausgelöst wurden die umfangreichen Nachforschungen in seinem Privatleben durch eine Anzeige seines letzten Vorgesetzten, dem Kapitän des HAPAG-Dampfschiffes „Ionia“, im April 1938 bei der Hamburger Polizei. Dieser hatte von den „homosexuellen Umtrieben“ des 1. Stewards mit jugendlichen Besatzungsmitgliedern Kenntnis erhalten. Am 3. Mai 1938 wurde Unger in Untersuchungshaft genommen. Der am 19. September 1908 in Hamburg als Sohn des Wilhelm Unger und der Frida, geb. Hopp, geborene Willy Unger begann 1923 zunächst eine kaufmännische Lehre in einem Ex- und Importgeschäft und fuhr dann für ein Jahr als Küchenjunge zur See. Bis 1930 war er dann als kaufmännischer Angestellter in Hamburg tätig. Danach fuhr er erneut zur See, nunmehr als Steward auf dem Dampfer „Ruhr“ auf Ostasienfahrt, später dann als 1. Steward für die HAPAG auf dem Dampfer „Ionia“ im Mittelmeer. Seine Verurteilung wegen versuchten und vollendeten Verbrechens nach § 175 a Ziffer 3 in vier und wegen Vergehens nach § 175 in sechs Fällen führte im September 1938 zu einer Zuchthausstrafe von 2 Jahren, die er in Fuhlsbüttel und ab Ende Februar Gefängniskarteikarte für Willy Unger StaHH 197 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 198 1939 in verschiedenen Emslandlagern wie dem in Börgermoor absitzen musste. Nach seiner am 1. Mai 1940 erfolgten Freilassung arbeitete er als Kellner in Hamburg. Möglicherweise geriet Willy Unger Anfang 1943 wieder ins Visier der Hamburger Kripo, denn am 22. Januar 1943 nahm er sich in seinem Zimmer in der Schenkendorfstraße 30, wo er im 3. Stockwerk zur Untermiete wohnte, mithilfe von Gas das Leben. Als nach seinem Tode zu benachrichtigenden Personen wurde neben seiner Schwägerin Erna Unger auch sein Freund Max Paustian genannt, der sich seinerseits 1940–1941 wegen des § 175 in Haft befand. – Bernhard Rosenkranz/Ulf Bollmann Quellen: StaHH, 213-11 Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafsachen, 10587/39; StaHH, 331-5 Polizeibehörde – Unnatürliche Sterbefälle, 337/43; StaHH, 213-8 Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht – Verwaltung, Abl. 2, 451 a E 1, 1 e; StaHH, 242-1 II Gefängnisverwaltung II, Ablieferungen 13 und 16; Staatsarchiv Osnabrück, Rep. 947 Lingen II Nr. 7227; B. Rosenkranz/U. Bollmann/G. Lorenz: Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg 1919–1969, S. 263. Auskünfte Rainer Hoffschildt, Hannover und ChristianAlexander Wäldner, Ronnenberg-Weetzen, aus 2009 und 2010. Gustav Wagner, geb. 28.3.1896 in Hamburg, Deportation nach Auschwitz, am 11.11.1943 umgekommen 69 Fraenkelstraße 6 II (Schaudinnsweg) Gustav Wagner wurde am 28. März 1896 in Hamburg geboren, seine jüdischen Eltern waren Moritz Wagner und Mary, geb. Nathan. Das Ehepaar hatte sechs Kinder. Gustav besuchte in Hamburg die Volksschule und wurde aus der ersten Klasse entlassen. Nach Absolvierung einer Schneiderlehre arbeitete er in seinem Beruf, bis er sich 1914 freiwillig zum Kriegsdienst meldete. In diesem Jahr war seine Mutter gestorben. Er machte den ganzen Krieg mit und wurde nach Kriegsende mit dem Eisernen Kreuz, 2. Klasse und dem Hanseatenkreuz entlassen. Anschließend war er wieder als Schneider tätig. Am 6. November 1920 heiratete er die evangelische Marie Elise Frieda Helene Schnee, geboren am 30. März 1892 in Magdeburg, die nach der Volksschule in einer Buchbinderei tätig war. Sie war 1910 nach Hamburg gekommen und hatte kurz darauf geheiratet; ihr Sohn Franz wurde im November 1911 geboren. Als Frieda Note wurde sie 1919 geschieden und brachte aus dieser ersten Ehe zwei Kinder mit, die Ehe mit Gustav Wagner blieb kinderlos. Frieda arbeitete als Näherin, Gustav war bis 1928 als Schneider und anschließend – bis 1938 – bei der Hamburger Stadtreinigung beschäftigt. Als er diese Arbeit verlor, fand er eine Tätigkeit als Hausmeister und Maschinist im Israelitischen Krankenhaus. Sein Wochenlohn betrug 46,69 RM, auch ein monatlicher Mietzuschuss von 40 RM wurde ihm zugestanden. Bereits am 9. Oktober 1922 hatte Gustav Wagner seinen Austritt aus der Jüdischen Gemeinde erklärt, in die er am 16. Oktober 1939 zwangsweise wieder als Mitglied eintrat, weil er als „Volljude“ der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, deren aktiver Zweig die Jüdische Gemeinde Hamburgs war, angehören musste. Früher hatte er dem Staatsarbeiterverbund angehört, seit 1933 der Arbeitsfront. Mit – sicherlich erzwungenem – Ausscheiden aus dem Staatsdienst bei der Stadtreinigung beendete er 198 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 199 auch die DAF-Mitgliedschaft. Seine Frau Frieda trat 1932 aus der ev.-luth. Landeskirche aus. Die beiden „Mischehepaare“ Gustav und Frieda Wagner und ihre Nachbarn Otto und Franziska Schulze wurden 1940 „im Namen des Deutschen Volkes“ vom Hanseatischen Sondergericht angeklagt und wegen „fortgesetzten Abhörens feindlicher Sender“ und Vergehens gegen die Rundfunkverordnung zu Zuchthaus- bzw. Gefängnisstrafen verurteilt. Aus der Strafakte lassen sich die Ereignisse rekonstruieren: Die Familien wohnten im Schaudinnsweg Nr. 6, der heutigen Fraenkelstraße. Gustav und Frieda Wagner seit 1932 im zweiten Stock, ein Stockwerk höher Otto Schulze und seine jüdische Ehefrau Franziska, geb. Wolfsberg, seit 1924 miteinander verheiratet. Otto Schulze, am 29. Juni 1898 in Havelsberg geboren, ebenfalls WK I-Veteran und Inhaber eines Eisernen Kreuzes, 2. Klasse, war bei der Sparkasse von 1864 beschäftigt, die ihm 1937 kündigte, weil er eine jüdische Ehefrau hatte. Seine Frau Franziska, geboren am 24. Februar 1894, war nach einer kaufmännischen Lehre in verschiedenen Firmen tätig und 1933 aus der Jüdischen Religionsgemeinschaft ausgetreten. Das Ehepaar Schulze hatte keine Kinder. Ende August bis Ende September 1939 wurde Otto Schulze zum Bahnschutz eingezogen. In dieser Zeit nahm seine Frau engeren Kontakt zur Nachbarin Wagner auf, wodurch nach Otto Schulzes Rückkehr auch die beiden Ehemänner miteinander bekannt wurden. Die Paare besuchten sich gegenseitig, bis zum Jahresende trafen sie sich oft samstags in der Wohnung der Schulzes, redeten miteinander, hörten Radio. Im Haushalt Wagner gab es kein Radio mehr, weil allen Juden der Besitz inzwischen untersagt war. Frau Schulze war zwar auch Jüdin, aber ihr „arischer“ Mann als Haushaltsvorstand durfte weiterhin ein Radio besitzen. Es ergab sich, dass auch Nachrichten gehört wurden, dabei – möglicherweise auf Anregung Gustav Wagners – der Sender Radio London mit seinen deutschsprachigen Nachrichten. Die Beklagten gaben zu, es sei drei- bis viermal vorgekommen, zuletzt kurz vor Silvester 1939. Erst im Dezember hätten sie von dem Verbot erfahren und nicht gewusst, welche hohen Strafen damit verbunden waren. Am 28. März 1940 stellte die Gestapo Strafantrag gegen die Ehepaare, im späteren Urteil wurde die erlittene Polizei- und Untersuchungshaft auf die erkannte Strafe angerechnet, die Verhaftungen hatten also bereits einige Zeit zuvor stattgefunden. In der Verhandlung sagten alle aus, weder politisch aktiv gewesen zu sein noch einer Partei angehört zu haben. Nach den Geständnissen wurde festgestellt, die Angeklagten hätten sich eines Vergehens oder „fortgesetzten Verbrechens gegen § 1 der Rundfunkverordnung vom 1. September 1939, § 47 StGB“ schuldig gemacht. Das Hanseatische Sondergericht, Kammer 3, bestehend aus Oberlandesgerichtsrat Haack als Vorsitzendem, Landgerichtsrat Ehlers sowie Assessor Rodowinsky als beisitzenden Richtern, dem ersten Staatsanwalt Jauch und Justizinspektor Kister, verurteilte die beteiligten Ehemänner zu je eineinhalb Jahren Zuchthaus und die Ehefrauen zu je neun Monaten Gefängnis. Es gebe keinen Zweifel hinsichtlich der Schuldfrage, das Verbot sei in allen Zeitungen und auch im Rundfunk mitgeteilt worden. Im Gegensatz zur Anklage, die „Vorbereitung zum Hochverrat“ unterstellte, nahm das Gericht nicht an, dass die Angeklagten primär zum Zweck des Hörens feindlicher Sender zusam199 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 200 mengekommen seien. Es ging vielmehr von persönlichen Besuchen aus, bei denen gelegentlich auch der Londoner Sender gehört worden sei. Das Gericht unterschied auch zwischen dem Handeln der Ehefrauen und der Ehemänner und hielt erstere für sekundär beteiligt und politisch indifferent, während ihre Partner die „ganze Härte des Gesetzes treffen müsse“, da es sich bei ihnen um „politisch reife Leute handele, die den Sinn und Zweck des Gesetzes ohne weiteres erkennen mussten und auch erkannt haben“. Berücksichtigt wurde, dass die beiden Angeklagten bisher unbestraft waren und politisch Nachteiliges nicht bekannt war; auch ihre Teilnahme am Weltkrieg wurde gewürdigt. Das Strafmaß wurde als angemessen erachtet und die Anrechnung der Polizei- und Untersuchungshaft damit begründet, dass alle „im Großen und Ganzen geständig gewesen“ seien. Nach neueren Archivfunden lässt sich Gustav Wagners Leidensweg folgendermaßen rekonstruieren: Nach der Urteilsverkündung am 20. März 1940 blieb er zunächst im Untersuchungsgefängnis, von dort erfolgte am 25. April die Einlieferung ins Zuchthaus Fuhlsbüttel. Gefängnispapiere sagen über seine Erscheinung aus, er sei von kräftiger Figur, 1,72 m groß und dunkelblond geweKarteikarte Zuchthaus Fuhlsbüttel ITS sen und habe blaue Augen gehabt. Zur Arbeitsverwendbarkeit gab es die Vermerke „moorfähig“ und „außenarbeitsfähig“. Unter normalen Umständen hätte seine Strafzeit am 19. November 1941 enden müssen. Mit Schreiben vom 4. August 1940 vom Oberstaatsanwalt, Landgericht Hamburg, wurde jedoch eine Verordnung nach RGBl. I vom 11. Juni desselben Jahres herangezogen, die dieses Strafmaß in Frage stellte: für in Kriegszeiten begangene Delikte sei die in die Kriegszeit fallende Vollzugszeit nicht in die Strafzeit einzurechnen. Gustav Wagner war im Zuchthaus mit Tütenkleben beschäftigt. Ein Führungsbericht vom 6. Januar 1941 enthält Anmerkungen von drei Aufsichtspersonen. Ein Wachtmeister bewertete sein Verhalten als „sehr gut“ und die Hoffnung auf Besserung mit „ja“. Der Werkmeister hielt seine Führung für anständig, die Arbeiten würden zu seiner Zufriedenheit ausgeführt. Ein Fürsorger bemerkte lediglich „ist Jude!“. Frieda Wagner hatte im Januar ein Gnadengesuch auf Erlass der Reststrafe ihres Mannes bzw. Umwandlung in eine Gefängnisstrafe bei der Oberstaatsanwaltschaft eingereicht, auf das sie einen abschlägigen Bescheid erhielt. Am 25. Januar 1941 wurde Gustav Wagner in 200 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 201 ein Strafgefangenenlager bei Papenburg (Ems) verlegt. Nach einem weiteren Gnadengesuch Friedas wurde die Lagerverwaltung zur Stellungnahme aufgefordert, in der sie am 7. März 1941 auf die erwähnte Verordnung, nach der ein Strafende nicht zu errechnen sei, verwies. Unter Hinweis auf Wagners kurze Haftzeit im dortigen Lager, sah sich die Lagerverwaltung nicht in der Lage, ein Urteil über dessen Gnadenwürdigkeit abzugeben. Frieda Wagner ließ sich nicht beirren, reichte ein weiteres Gnadengesuch ein und bat zugleich um die Rückführung ihres Mannes nach Hamburg. Die Ablehnung der Oberstaatsanwaltschaft erfolgte am 28. Mai 1941. Der Kommandeur des Strafgefangenenlagers beurteilte Gustav Wagner als gesund und voll arbeitsfähig und sah keine Veranlassung für eine Rückführung. Nach Gnadengesuch von Frieda Wagner ITS einem Aktenvermerk war Gustav Wagner zu dieser Zeit im Brunnenbau eingesetzt. Auch ein weiteres, im August eingereichtes Gesuch wurde letztlich abgelehnt. Immerhin hat man den Eheleuten im Juni eine persönliche „Unterredung“ gestattet, sodass Frieda nach Papenburg reiste, um ihren Mann für eine halbe Stunde sehen zu können. Auf ein viertes Gnadengesuch am 19. August 1941 erfolgte die Ablehnung erst im November. Inzwischen hatte sich ein Vorfall ereignet. Im Oktober 1941 fand man heraus, dass Gustav Wagner über einen – möglicherweise als Spitzel eingesetzten – Mittelsmann Pakete seiner Frau erhalten und einen Brief an sie hinausgeschmuggelt hatte. Die Pakete hatten Ess- und Rauchwaren enthalten. Welche Haftverschärfungen die Folge waren, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Bekannt ist aber Gustavs Verlegung in ein anderes, der Papenburger Kommandantur unterstehendes Lager in Neu Sustrum. Am 11. Januar 1942 erbat Frieda Wagner bei der dortigen Lagerleitung erfolgreich die Erlaubnis, ihren Mann am 29. März besuchen zu dürfen, – Gustav Wagner wurde am 28. März 46 Jahre alt. Eine weitere Besuchserlaubnis liegt für den 7. Juni 1942 vor. Wenig später ging bei der Lagerverwaltung am 20. Juni eine Verfügung ein, nach der Gustav Wagner im Rahmen einer „Zuweisung fachlich vorgebildeter Gefangener“ erneut verlegt werden sollte, diesmal ins Zuchthaus Brandenburg (Havel)-Görden. Die Überführung erfolgte am 25. Juni. Gustavs körperliche Verfassung lässt sich am Gewicht des ehemals kräftigen Mannes ablesen. Wie sein Häftlingsbogen vermerkte, wog er nur noch 54 Kilo. An beiden Beinen hatte er Ödeme und litt unter einem allgemeinen Schwächezustand. Auf ein erneutes Gnadengesuch Friedas vom 4. Juni antwortete die Brandenburger Zuchthausverwaltung am 2. Juli, der Zuchthausgefangene Wagner habe wegen hausordnungswidrigen Verhaltens mit vier Wochen Arrest bestraft werden müssen. Zwar gebe seine Arbeitsleistung keinen Anlass zur Klage, jedoch lägen keine Gründe zur Rechtfertigung eines Gnadenerweises vor. 201 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 202 Über die Art von Wagners Tätigkeit wissen wir nichts. Vielleicht war er als Schneider gefragt, zumindest gewährte man im Oktober 1942 die Beschaffung einer Brille. Da sein eigenes Barvermögen von 7,38 RM nicht ausreichte, sollte die Ehefrau die Kosten übernehmen, musste aber auf ihre eigene Notlage verweisen. Im Dezember 1942 bat Frieda für den 19. Januar 1943 um eine Besuchserlaubnis und darum, ihren Mann über den Tod ihres Sohnes Lothar zu informieren, der ebenso wie sein Bruder Franz zur Wehrmacht eingezogen worden war. Frieda erhielt die Genehmigung mit der Auflage, ihrem Mann keine Esswaren mitzubringen. Offenbar missachtete sie diese zusätzliche Schikane, denn ein Vermerk berichtet von einem „Hausstrafverfahren“ gegen Gustav Wagner, der „gestern Kautabak und Zigaretten von seiner Ehefrau zugesteckt bekommen hat“. Die Strafe bestand in einer dreimonatigen Verschärfung der Haftbedingungen. Noch vor Ablauf dieser Zeit wurde Gustav Wagner nach Auschwitz deportiert. Dort verstarb er – laut Abschrift der Sterbeurkunde 146/1943 – in der Kasernenstraße am 11. November 1943 um 22 Uhr 25 an „Herzmuskelschwäche“. Frieda Wagner trat ihre Gefängnisstrafe ebenfalls am 20. März 1940 an. Sie litt an Diabetes und hatte infolge der psychischen Belastungen durch Gerichtsverhandlung und Haft einen Krankheitsschub erlitten, doch als Frau eines Juden gestand man ihr kein Recht auf besondere Diät zu. Erst nach der Haftentlassung am 20. Oktober 1940 erhielt sie nach ärztlicher Untersuchung eine Insulinbehandlung. 1942 wurden Myome im Uterus festgestellt und im Universitätskrankenhaus mit Röntgenstrahlen behandelt. In einem späteren ärztlichen Gutachten ist von „Röntgenkastration“ die Rede. Ihre Gesundheit war insgesamt stark beeinträchtigt, die Sorgen um den Ehemann und ihre in Russland stationierten Söhne, eine Totalausbombung der Wohnung, der Kampf um Hafterleichterung für ihren Mann und schließlich die Nachricht von seinem Tod trugen zur ständigen Verschlechterung bei. Herz- und Nervenleiden machten ihr zu schaffen, bei andauerndem Erschöpfungszustand war ein regelmäßiger Broterwerb kaum möglich. Etwas Geld konnte sie als Hausnäherin verdienen; ansonsten brauchte sie ihre bescheidenen Ersparnisse auf und musste sich Geld leihen, um existieren zu können. Nach Kriegsende erhielt Frieda Wagner eine Sonderrente von 140 RM. Neben einer Haftentschädigung, von der sie Schulden begleichen konnte, bekam sie eine kleine Entschädigung für die Ausbombung. Sie bemühte sich um Rückgabe ihres Schrebergartens in Steilshoop, um dort Gemüse anbauen zu können, das sie als Zuckerkranke dringend benötigte. Der Nachfolger hatte versprochen, den Garten nach Beendigung des Krieges zurückzugeben, weigerte sich aber nun mit der Begründung, den Garten von ihrem Sohn gekauft zu haben. Sohn Franz befand sich in russischer Gefangenschaft und konnte nicht helfen. Ab 1947 galt Frieda Wagner als „invalidisiert“ und erhielt eine kleine Invalidenrente von 50 RM. Sie lebte zu dieser Zeit im Laeisz-Stift in St. Pauli. Verschiedene Bemühungen um Aufbesserung der Rente als Entschädigung für den gesundheitlichen Schaden, der durch die falsche Behandlung in der Haftzeit entstanden war, scheiterten. Obwohl Mitarbeiter der Sozialbehörde sich für sie einsetzten, wollten mehrere ärztliche Gutachten, das letzte von 202 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 203 einem Professor des AK St. Georg, keinen Zusammenhang ihrer Beschwerden mit den erlittenen Verfolgungen und der Haftstrafe erkennen, sodass der Rentenantrag abgelehnt wurde. Frieda Wagner starb am 28. März 1954. Otto Schulze war in den fünfziger Jahren wieder in einer Bank beschäftigt und wohnte mit seiner Frau Franziska in der Schedestraße in Eppendorf. Er bat die Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Hamburg im August 1957 um Prüfung, ob er als vorbestraft gelte, weil er aus politischen Gründen 1940–42 Strafgefangener gewesen sei. Die Antwort lautete, er könne sich als unbestraft betrachten. Die Verurteilung durch das Sondergericht sei gemäß §§ 1, 5 + 7 der Verordnung über die Gewährung von Straffreiheit v. 3. Juni 1947 – Verordnungsblatt für die britische Zone, S. 68 – aufgehoben und getilgt. Die Strafakte wurde vernichtet, nach Vermerk vom 21. Juni 1951 wurde im Februar eine Notakte angelegt. – Eva Acker/Erika Draeger Quellen: 1; 5; 8; StaHH 213-11, Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafakten, 2087/40; StaHH, 351-11, AfW, Abl. 2008/1 300392, Wagner, Frieda IST-Archieves, Copy of doc. No. 1187958 #1, No. 12021625#1 bis 12021703#1, No. 12030103#1, No. 625193#1, Meyer: Die Verfolgung und Ermordung der Hamburger Juden, S. 68. Ernst Friedrich August Wetzstein, geb. 2.12.1883, beging am 31.10.1933 im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel Selbstmord 70 Dennerstraße 15 Ernst Wetzstein wurde als Sohn des Arbeiters Christian Carl Heinrich und dessen Frau Marietta Dorothea, geb. Wrage, in Hamburg geboren. Die Familie war evangelisch-lutherisch und lebte in Eimsbüttel. Ernst Wetzstein hatte noch einen zwei Jahre älteren Bruder, Heinrich. Während des Ersten Weltkrieges diente Ernst Wetzstein an der Front und wurde schwer verwundet. Dadurch war er zu 50 Prozent kriegsbeschädigt und hatte Mühe einen Arbeitsplatz zu finden. Nach dem Krieg begann er eine Töpferlehre. Am 31. Dezember 1920 heiratete Ernst Wetzstein die 21-jährige Helene Anna Auguste Hardt aus Strippow bei Coeslin. Die Trauzeugen waren sein Bruder Heinrich und seine Mutter Marietta. Zu diesem Zeitpunkt war sein Vater bereits verstorben. Helene zog nach der Hochzeit zu Ernst in die Löwenstraße 33, Haus 10, wo auch Marietta Wetzstein wohnte. Ernst Wetzsteins Kriegsverletzung führte dazu, dass er sich ein Magengeschwür entnehmen lassen musste und zum Frührentner wurde. Am 15. August 1933 wurde Ernst Wetzstein wegen des Verdachts des Sittenverbrechens an Mädchen von der Polizei verhaftet und im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel inhaftiert. Zu diesem Zeitpunkt wohnte das Ehepaar Wetzstein in der Dennerstraße 15, gemeinsame Kinder gab es keine. Aufgrund der Anschuldigungen war Ernst Wetzstein in Einzelhaft. Mehrmals wurde von der Gefängnisverwaltung angefragt, ob man diese nicht aufheben könne, doch es geschah nicht. Noch vor Beginn seines Prozesses sollte Ernst Wetzstein seiner Kastration zustimmen. 203 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 204 Das Verfahren gegen ihn wurde am 14. Oktober 1933 eröffnet und die Verhandlung hätte am 1. November begonnen. Doch zu diesem Zeitpunkt war Ernst Wetzstein bereits tot. Er soll sich in seiner Zelle erhängt haben, wie ein Oberinspektor Körner in seinem Bericht schrieb: „Herrn Präsidenten des Strafvollzugsamtes. Der seit dem 16.8.1933 für gr. Strafkammer VII 336/33 (Staatsanwaltschaft VII b 4306/33) wegen Verdachts des Sittenverbrechens an kleinen Mädchen in Untersuchungshaft befindliche Ernst Friedrich August Wetzstein, geb. 2. Dezember 1883 zu Hamburg, Rentenempfänger, verheiratet, ist heute Vormittag beim Aufschluss 7 Uhr 5 Minuten in seiner Zelle 210 an einem Stück Bettlaken am Zellenfensterkreuz hängend tot aufgefunden worden. Der Stationsbeamte, Wachtmeister Plüschau, hat den Wetzstein sofort abgeschnitten und mit dem sofort benachrichtigten Heilgehilfen gemeinsam Wiederbelebungsversuche angestellt, die aber erfolglos waren. Wetzstein sollte am 1. November 1933 Hauptversammlungstermin haben. Das Motiv seiner Tat ist nicht bekannt. Den Stationsbeamten ist er nie verdächtig vorgekommen. Er war ruhig und still und hat sich um niemand gekümmert und war in Einzelhaft. Der um 9 Uhr erschienene Distriktsarzt Dr. Spaethe stellte ,Selbstmord durch Erhängen‘ fest. Die Ehefrau und die zuständigen Behörden sind benachrichtigt worden; die Leiche wird im Laufe des Tages ins Hafenkrankenhaus (Totenhalle) überführt werden.“ Der herbeigerufene Arzt stellte keine Spuren von Misshandlung fest. Da es nie zu einer Verhandlung und deswegen auch zu keinem Urteil kam, konnte nicht festgestellt werden, ob die Vorwürfe gegen Ernst Wetzstein der Wahrheit entsprachen. Der Künstler Gunter Demnig hat sich trotzdem dazu entschlossen, einen Stein zu setzen. Quellen: StaHH 242-1 II, Gefängnisverwaltung II, Abl. 12, 683 – Wetzstein; StaHH 332-5, Personenstandsunterlagen, 1008 und 288/1933; StaHH 332-5, Personenstandsunterlagen, 1762 und 288/1933; StaHH 332-5, Personenstandsunterlagen, 8982 und 4579/1883; Diercks: Gedenkbuch „KOLA-FU“, S. 43. Leopold Winterfeld, geb. 22.5.1887, aus Frankreich deportiert nach Auschwitz, am 11.11.1942 in Lublin umgekommen Lissi Helena Winterfeld, geb. Stern, geb. 28.2.1896, verstarb am 28.12.1959 in Paris Werner Martin Winterfeld, geb. 30.1.1918, aus Frankreich deportiert nach Auschwitz, am 11.11.1942 in Lublin umgekommen 71 Uhlenhorster Weg 39 Leopold Winterfeld kam als Sohn von Julius und Marianne, geb. Nissel, in Hamburg zur Welt. Er war das älteste von drei Kindern. Sein Bruder Bruno wurde am 4. August 1890 geboren, seine Schwester Louise am 23. März 1893. Leopold besuchte die Gelehrtenschule des Johan204 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 205 neums zu Hamburg. Nach dem Abitur begann er ein Jurastudium, welches dazu führte, dass er sich am 8. Mai 1914 als Rechtsanwalt niederlassen konnte. Doch vorerst konnte er den Beruf nicht lange ausüben, da der Erste Weltkrieg gerade begonnen hatte. Wie viele andere auch wurde Leopold Winterfeld Soldat. Seit 1915 kämpfte er beim 81. Feldartillerieregiment. Lissi Winterfeld war die Tochter des Kaufmanns Bernhard Stern und seiner Frau Martha, geb. Elias. Am 28. Februar 1896 kam sie, als die ältere von zwei Schwestern, in Hamburg zur Welt. Ihre jüngere Schwester Hertha folgte kurze Zeit später. Während ihrer Jugend besuchte Lissi Winterfeld die „Höhere Töchterschule“ und verbrachte anschließend ein Jahr auf einem Pensionat in Brüssel. Während des Ersten Weltkrieges verlobten sich Leopold Winterfeld und seine Freundin Lissi Stern. Die Hochzeit fand am 17. August 1916 statt, zu diesem Zeitpunkt war Lissi bereits mit ihrem ersten Kind Ilse schwanger. Tochter Ilse kam am 21. Februar 1917 in Thorn zur Welt und ein Jahr später, am 30. Januar 1918, wurde ihr Sohn Werner Martin in Danzig geboren. Der Uhlenhorster Weg im Jahr 1925 Bildarchiv Hamburg Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kehrte die jüdische Familie Winterfeld nach Hamburg zurück und Leopold nahm seine Tätigkeit als Rechtsanwalt wieder auf. Eine weitere Tochter, Ruth, wurde geboren, die jedoch schon am 1. Januar 1921, kurz nach ihrer Geburt, verstarb. Leopold Winterfelds erste Kanzlei lag am Rathausmarkt 3 oder 5, später wechselte er ins Ballinhaus. Die Familie lebte zu dieser Zeit in der Hochallee 102, später wohnte sie im Uhlenhorster Weg 39, wo heute die Stolpersteine für Lissi, Leopold und Werner Winterfeld liegen, und zogen anschließend in die Straße Am Markt 39 um, die heute Barmbeker Markt heißt. 1931 änderte sich das Leben der Familie Winterfeld radikal. Leopold Winterfeld wurde wegen Unterschlagung und Untreue angeklagt. Zudem musste er 1932 in Untersuchungshaft, da angeblich Fluchtgefahr bestand. Das Urteil wurde am 19. Juli 1933 gefällt. Leopold Winterfeld wurde für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Hierbei entschied das Gericht angeblich noch zu seinen Gunsten, weil es den Grund für die veruntreuten Gelder strafmildernd bewertete. Das Gericht sah es nämlich als erwiesen an, dass Leopold Winterfeld das Geld ausschließlich genutzt hatte, um den kostspieligen Lebenswandel seiner Frau zu finanzieren und es nicht für sich ausgegeben hatte. Bevor Leopold Winterfeld seine Haftstrafe antreten musste, flüchtete er im August nach Frankreich. Zuvor ließ er sich noch aus der Liste der Rechtsanwälte streichen und kam damit einem Ausschluss zuvor. 205 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 206 Lissi Winterfeld blieb noch kurze Zeit in Hamburg, um ihre Kinder bei ihren Eltern unterzubringen. Danach folgte sie ihrem Mann in die Emigration. Ihre offizielle Wohnadresse behielt sie jedoch unter der Anschrift ihres Vaters, Bernhard Stern, bei. Die Kinder Werner und Ilse bemühten sich in Hamburg ihrem normalen Alltag nachzugehen. Doch besonders Werner war dies fast unmöglich. Eigentlich träumte er davon, Abitur zu machen und zu studieren, um Ingenieur werden zu können. Doch bereits 1932 musste er die Schule wechseln, da er sowohl von Schülern als auch von Lehrern beschimpft und angegriffen wurde. Deswegen blieb ihm nichts anderes übrig, als das Johanneum zu verlassen und auf das Wilhelm-Gymnasium zu wechseln. 1934 verließ er das Gymnasium ohne Abschluss, um eine Lehre anzufangen. Er hoffte darauf, dass sich die politischen Verhältnisse bessern würden und er seinen Abschluss und das Studium nachholen könne. Eine dreijährige Lehre bei Carsten Jacobsen, der eine Autowerkstatt besaß, konnte Werner beenden. Danach bekam er ein Angebot von Arnold Bernstein, welcher eine Schifffahrtsgesellschaft besaß, die Red Star Linien GmbH. Dort war Werner Winterfeld ab Ostern 1937 als Ingenieur-Assistent tätig. Arnold Bernstein wurde jedoch aufgrund seiner jüdischen Herkunft noch im selben Jahr verhaftet und im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel inhaftiert, woraufhin auch Werner Winterfeld seine Anstellung zum 21. Dezember 1937 verlor. Daraufhin emigrierte er 1938 nach Italien. Ilse Winterfeld blieb ebenfalls zunächst bei ihren Großeltern. Ende der dreißiger Jahre heiratete sie Benjamin Fränkel. Gemeinsam emigrierten sie 1940 nach England und suchten sich eine Wohnung in London, wo sie auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges blieben. In Paris konnte Leopold Winterfeld sich allein kaum versorgen, da es schwierig war, an Arbeit zu kommen. Deshalb erhielt er regelmäßig Geld von seinem Schwiegervater Bernhard Stern. Bis 1939 lebte Leopold Winterfeld zusammen mit seiner Frau Lissi abwechselnd in Frankreich und Italien. Mal arbeitete er in Nizza, dann ging er nach Neapel, um dort als Gerber tätig zu sein. In Italien trafen die Eltern auch wieder mit Werner zusammen, der gerade aus Deutschland emigriert war. 1939 hielt sich Lissi Winterfeld für kurze Zeit im mittlerweile von deutschen Truppen besetzten Prag auf und wurde dort von der Gestapo verhaftet. Vom 10. März bis zum 18. April blieb sie in Haft. Nach ihrer Freilassung floh sie nach Paris, wo bereits Mann und Sohn auf sie warteten. Am 14. März 1940 wurden Leopold und Werner Winterfeld verhaftet und im Camp de la Viscose interniert, wo sie in der 15. Fremdarbeiterkompanie Zwangsarbeit leisten mussten. Von dort aus wurden sie am 17. Dezember 1941 ins Konzentrationslager Camp les Milles in der Nähe von Marseille verlegt. Auch hier leisteten sie in einer Fremdarbeiterkompanie Zwangsarbeit. Ihre Inhaftierung dauerte bis zum 31. Oktober 1942; an diesem Tag wurden sie mit einem Transport ins Durchgangslager Drancy, welches nordöstlich von Paris lag, gebracht. Von dort aus gingen fast wöchentlich Transporte in Konzentrationslager in Osteuropa, meist nach Auschwitz. Leopolds Bruder, Bruno Winterfeld, war bereits auf diesem Weg am 28. August 1942 von Drancy nach Auschwitz deportiert worden. Leopold und Werner Winterfeld wurden 206 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 207 gemeinsam mit einem Transport am 11. November ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Dort überlebten beide bis zum Frühjahr 1943. Am 4. März wurden sie nach Lublin deportiert und dort ermordet. Lissi Winterfeld blieb nach der Verhaftung von Mann und Sohn in Paris und versteckte sich unter dem Namen Rougier bei verschiedenen Bekannten. Mal lebte sie bei Marie-Augustine Baumann in der Rue Marbeuf, dann zog sie zu Adéle Silmain in die Rue MacMahon und lebte zuletzt bei Marthe Weinsztock in der Rue du Collisée. Mit Übersetzungen und Gelegenheitsarbeit versuchte Lissi Winterfeld zu überleben. Am 18. April 1944 wurde sie jedoch entdeckt und von der Gestapo verhaftet. Daraufhin begann ein Leidensweg, der sie durch mehrere Konzentrationslager führte. Zuerst wurde sie im Konzentrationslager Fresnes in Frankreich festgehalten. Am 30. Mai 1944 wurde sie in ein Gefängnis nach Berlin überführt und von dort aus weiter nach Auschwitz deportiert. Nach der Auflösung des Konzentrationslagers Auschwitz gelangte Lissi Winterfeld nach Bergen-Belsen und kurz danach ins Außenlager Salzwedel, wo sie in einer Munitionsfabrik Zwangsarbeit leistete. Dort wurde sie am 11. April 1945 von den Alliierten befreit. Schon einen Monat später gelangte sie mit einem Transport französischer KZ-Insassen nach Paris und erfuhr dort vom Tod ihres Mannes und ihres Sohnes. Sie bemühte sich, in Paris Arbeit zu finden und kam kurzzeitig beim Film unter. Jedoch reichte dies auf Dauer nicht für ihren Lebensunterhalt, sodass sie beschloss, nach Hamburg zurückzukehren. Am 20. Dezember 1949 traf sie in ihrer Heimatstadt ein und wohnte zunächst in der Sedanstraße 23, im Jüdischen Pflegeheim, bis sie eine Wohnung in der Sentastraße 44b bekam. Lissi Winterfeld, ihre Tochter Ilse sowie ihre Schwester Hertha Stern und Leopolds Schwester Louise überlebten den Holocaust. Leopolds Bruder Bruno kam in Auschwitz um. Lissis Vater Bernhard Stern wurde nach Theresienstadt deportiert und starb dort. Ihre Mutter verstarb schon vorher in Hamburg an Darmkrebs. Da Lissi Winterfeld bis 1944 in Hamburg unter der Adresse ihres Vaters gemeldet war, stand auch ihr Name auf der Deportationsliste nach Theresienstadt. Daher lässt sich auf ihrem Stolperstein auch die Angabe nachlesen, sie sei 1944 in Theresienstadt verstor- Das Gedenkblatt für Leopold Winterfeld Yad Vashem 207 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 208 ben. Dies entspricht jedoch nicht der Realität. Nach ihrer Befreiung aus dem Konzentrationslager litt Lissi Winterfeld unter ständigen Kopfschmerzen, einem Herzfehler und einem Nervenleiden. 1957 erlitt sie während einer Reise nach Paris einen Schlaganfall und war linksseitig gelähmt. Am 28. Dezember 1959 verstarb sie in Paris. Quellen: 1; 4; 5; 8; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 04.08.90 Winterfeld, Bruno; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 22.05.87 Winterfeld, Leopold; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 28.02.96 Winterfeld, geb. Stern, Lissy; StaHH 351-11, AfW, Abl. 2008/1, 30.01.18 Winterfeld, Werner. Das Gedenkblatt für Werner Winterfeld Yad Vashem Hugo Wolfers, geb. 22.10.1875 in Hamburg, deportiert am 6.12.1941 nach Riga Olga Wolfers, geb. Oppenheimer, geb. 14.10.1885 in Hamburg, deportiert am 6.12.1941 nach Riga 72 Hofweg 31 Die Vorväter von Hugo Wolfers hatten es in der preußischen Garnisons- und Beamtenstadt Minden in Westfalen zu Ansehen und Vermögen gebracht. Drei Kaufleute mit dem Namen Wolf(f)ers gehörten 1848 von ihrem jährlichen Einkommen her zur Mindener Oberschicht. Seit 1851 war das siebengeschossige Giebelhaus in der Bäckerstraße 1 im Besitz der verschiedenen Zweige und Generationen der Wolfers. In dem Haus befand sich auch das Geschäft „Wolffers Söhne. Manufacturen, Modewaren, Putzgeschäfte, Schreib- und Zeichenmaterialien, Tapisserie“. Der Familienname wurde im Grundbuch zeitweilig auch nur mit einem „f“ geschrieben. Samuel Philip(p) Wolf(f)ers (1799–1851), der Großvater von Hugo Wolfers, zählte zu den wichtigsten Kaufmannspersönlichkeiten der Stadt Minden. Seine Bedeutung war auch daran ablesbar, dass er Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und Präsident des Gewerberates war. In dieses selbstbewusste bürgerlich-jüdische Milieu hinein wurde 1839 Eduard Wolfers 208 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 209 geboren (sein Familiennamen wurde konsequent mit nur einem „f“ geschrieben). Eine gute Schulbildung und ausreichende finanzielle Mittel für eine spätere Selbstständigkeit dürfen bei Eduard Wolfers vorausgesetzt werden. Mit dieser Qualifikation und Sicherheit im Rücken zog er gen Norden. 1869 gründete er in Hamburg gemeinsam mit Moses Salomon Schönfeld (gestorben 1885 in St. Georg, Großer Kirchenweg 3) die „Textilhandelsgesellschaft Schönfeld & Wolfers“ (Großhandel mit Leinen und Teppichen); zu diesem Zweck erwarben sie das Lagergeschäft von „Gebrüder Jaffé“ (Inhaber David Abraham Jaffé und J. Jaffé), das bereits 1842 als „Leinen- u. Drell Lager en gros, gr. Burstah no 35“ im Hamburger Adressbuch existierte. Schon im Adressbuch von 1870 lauteten die Einträge für Schönfeld & Wolfers und Gebrüder Jaffé gleichlautend „Leinen-Lager, Alterwall 20“. Ganz in der Nähe, am Neuen Wall 13 (Arcaden-Passage), hatte sich Wolfers eine Wohnung gemietet. 1875 erhielt der 36-jährige Eduard Wolfers das Hamburger Bürgerrecht. Voraussetzung für den Erhalt des Hamburger Bürgerbriefes war ein nachgewiesenes Jahreseinkommen von 1200 Mark in fünf aufeinander folgenden Jahren. Der Bürgerbrief bedeutete zugleich auch die Berechtigung zu wählen. Im selben Jahr wurde auch sein Sohn Hugo in der Hansestadt geboren. Vier Jahre später kam die Tochter Elisabeth zur Welt. Das Geburtsjahr des Sohnes Gustav ist nicht bekannt. 1885 wohnte die Familie in der Moorweidenstraße 15 (Rotherbaum). In der Hamburger Einwohnermeldekartei von 1892 wurde Eduard Wolfers als Kaufmann geführt, die Spalte mit der Religionszugehörigkeit blieb unausgefüllt. Er war Mitglied in der Jüdischen Gemeinde, schon 1884 war in der Schülerkarte des Sohnes Hugo unter „Bekenntnis“ die Bezeichnung „mosaisch“ eingetragen. Daneben war Eduard Wolfers vermutlich schon vor 1897 Mitglied der 1847 gegründeten „Loge zur Bruderkette“. Eduard Wolfers und seiner Ehefrau Natalie, geb. Alsberg (1847–1906), gelang es in rund zwanzig Jahren, sich in Hamburg eine wirtschaftlich und gesellschaftlich geachtete Position aufzubauen. Von 1892 bis 1919 lebten sie in der Hochallee 64 im angesehenen Stadtteil Harvestehude. Am 17. Mai 1919 verstarb Eduard Wolfers im Alter von achtzig Jahren. Er wurde auf dem Jüdischen Friedhof Ohlsdorf neben seiner 1906 verstorbenen Ehefrau beigesetzt. Ihr ältester Sohn Hugo Wolfers besuchte die angesehene Gelehrtenschule des Johanneums bis zur Mittleren Reife 1890, erlernte anschließend den Beruf des Kaufmanns, ging danach für ein Jahr nach Paris „zur weiteren Ausbildung“ und war schließlich bei Schönfeld & Wolfers tätig – erst als Angestellter, ab 1897 als Prokurist und ab 1903 als Teilhaber. Ein Jahr zuvor war bereits sein Bruder Gustav Wolfers (gestorben 1909) als Teilhaber in die Firma eingetreten. 1907 hatten Hugo Wolfers und Olga Oppenheimer geheiratet. Die Oppenheimers lebten bereits seit Generationen als Kaufleute und Juristen in Hamburg. Olgas Vater war der Rechtsanwalt Philipp (genannt Paul) Oppenheimer (1854–1937), ihre Mutter soll kurz nach ihrer Geburt gestorben sein. Ihre Stiefmutter, Alice Oppenheimer, geb. Oppenheim (1867– 1942), stammte aus einer Kaufmannsfamilie. Hugo und Olga Wolfers hatten vier Kinder: zwei Jungen und zwei Mädchen. Die Familie lebte anfänglich in der Rothenbaumchaussee 73 (Rotherbaum). 1919, nach dem Tod des 209 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 210 Vaters zog die Familie ins elterliche Haus in der Hochallee 64 (Harvestehude). 1928 folgte ein weiterer Umzug in den Hofweg 31 (Uhlenhorst). Die Eheleute gehörten seit mindestens 1913 der Deutsch-Israelitischen Gemeinde sowie dem liberalen Israelitischen Tempelverein an, der Reformen des herkömmlichen synogalen Gottesdienstes durchgeführt hatte, wie z. B. die PreSilberhochzeit von Hugo und Olga Wolfers, geb. Oppenheimer (Mitte), auch deren Eltern Dr. Philipp Oppenheimer (o., 2. v. l.) und Alice Oppenheimer (r. außen stehend) sind auf dem Foto, das der Sohn Gustav Wolfers im August 1932 schoss Privatbesitz digt in deutscher Sprache und das Orgelspiel. Der jüngere Sohn Gustav (geb. 1910), benannt nach seinem ein Jahr zuvor verstorbenen Onkel, besuchte das Heinrich-Hertz-Realgymnasium im Stadtteil Winterhude bis zur Obersekundarreife (Mittlere Reife). Nach dem Besuch der Grone Handelsschule und einer dreijährigen kaufmännischen Lehre bei der „Hamburger Regenmantelfabrik GmbH Harefa“ machte er sich 1932 als Handelsvertreter und Textilgroßhändler (u. a. Oberhemden und Oberhemdenstoffe) selbstständig. Dafür nutzte er die vorderen Räume der sechseinhalb Zimmer-Wohnung der Eltern im Hofweg 31. Die Boykottaufrufe der NSDAP im Jahre 1933 führten bei dem Jungunternehmer zu einem starken Geschäftsrückgang. Ab 1935/36 erwog er die Emigration und besuchte zu diesem Zweck Sprachkurse an der Universität in Englisch, Französisch und Spanisch – das genaue Auswanderungsziel stand also noch nicht fest. Auch die Erlernung des Tischlerhandwerks erfolgte unter diesem Aspekt. Eine Woche nach der Heirat mit Grete Abrahamssohn (geb. 1912) reiste das frisch vermählte Ehepaar im Oktober 1937 über Holland und England nach Australien aus. Um die neunzigprozentigen Transferverluste der Geldüberweisungen für die Schiffspassage nach Australien zu vermeiden, ließ Gustav Wolfers von einem deutschen Matrosen Textilien nach England schmuggeln. Von dem Verkaufserlös bezahlte Wolfers die Schiffspassage auf der „Orama“ von Tilbury nach Sydney. Zehn Kisten und mehrere Koffer wurden ihm von den Eltern nachgeschickt; die Möbel blieben in Hamburg zurück. Die zehn Jahre jüngere Schwester Ellen (geb. 1920) hatte die private Mädchen-Oberschule von „Frl.“ Firgau (Sierichstraße 53) von 1927 bis 1937 besucht. Aus „rassischen Gründen“ wurde sie aus der Untersekunda ausgeschlossen. 1937 bis 1938 besuchte sie den Zeichenund Malunterricht bei Gretchen Wohlwill (Flemingstraße 3), immer noch mit dem Ziel, eine Ausbildung zur Dekorateurin zu machen. Doch die Restriktionen gegen Juden waren bereits so weitreichend, dass eine Lehre für Ellen Wolfers nicht mehr möglich war. So blieb ihr nur übrig, die Haushaltungsschule der Jüdischen Gemeinde zu besuchen. 210 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 211 Ellen Wolfers emigrierte im Februar 1939 nach London. 1940 wurde sie nach Somerset in den Südwesten der Insel evakuiert. Als das Gebiet zur „protected area“ erklärt wurde, in dem Flüchtlingen der Aufenthalt nicht gestattet war, kehrte sie nach 18 Monaten in die britische Hauptstadt zurück. Die Firma Schönfeld & Wolfers bildete die Grundlage für den Wohlstand der Familie. Das Unternehmen importierte Leinen- und Baumwollwaren aus England, indische Teppiche, Strohmatten und seidene Taschentücher aus China und Japan sowie Angora-Felle. Exportiert wurden Leinenstoffe, Taschentücher aus Baumwolle, Leinen oder Seide sowie Reisedecken in den gesamten europäischen Raum. Um die Jahrhundertwende unterhielt die Firma auch eine Zweigniederlassung in Manchester. Von 1906 bis 1909 war der Absolvent der Talmud Tora Realschule, Henry Pels (geb. 1890), als Lehrling in der Firma tätig, um danach in die väterliche Firma Wolf Pels (gegründet 1882) „Vertretung der Strick-Wirk- u. Webwaren-Industrie in Hamburg und Umgebung“ einzutreten. Ernst Alsberg (geb. 8. Juni 1879 in Kassel), vermutlich ein Neffe von Natalie Wolfers, geb. Alsberg, der Ehefrau des Geschäftsinhabers, besaß von 1911 bis 1919 die Gesamtprokura für die Firma. (Er wurde am 15. Juli 1942 zusammen mit seiner Ehefrau Gertrud nach Theresienstadt deportiert, siehe Biografie in der EimsbüttelBroschüre). 1920, nach dem Tod des Firmen-Mitbegründers Eduard Wolfers, wurde die Rechtsform der Firma von einer OHG in eine KG umgewandelt. Hugos Schwester Elisabeth Gorden, geb. Wolfers, und seine Schwägerin Gertrud Wolfers, geb. Fränkel, beteiligten sich mit hohen Geldsummen an der Firma. Einziger persönlich haftender Gesellschafter der Kommanditgesellschaft war Hugo Wolfers. Ende 1928 geriet das Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten, ein Konkurs konnte durch ein gerichtliches Vergleichsverfahren abgewendet werden. Ab 1929 änderte sich der Firmensitz, der vom Rödingsmarkt 40 zu den Hohen Bleichen 31–32 (Brandenburger Haus) verlegt wurde. Noch 1931 bemühte sich die Firma um eine größere Beihilfe aus einem Härtefond der Handelskammer Hamburg. Als Jude wurde der Geschäftsmann Hugo Wolfers ab 1933 in steigendem Maße behindert. Über die Zuteilung von Einfuhrkontingenten waren Importfirmen dem Wohlwollen der nationalsozialistisch kontrollierten Bürokratie ausgeliefert. Eher geräuschlos konnte auf diese Weise jüdischen Firmeninhabern die wirtschaftliche Basis entzogen und ein Verkauf der Firma erpresst werden. Nach der „3. Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ vom 14. Juni 1938 wurden Betriebe als „jüdisch“ eingestuft, wenn ihre Inhaber nach NS-Maßstäben als Juden galten. Dennoch konnte die Firma im Geschäftsjahr 1938 einen Reingewinn von 38 500 RM ausweisen. 1939 erfolgte die „Arisierung“ von Schönfeld & Wolfers; dies bedeutete den Zwangsverkauf der Firma unter dem tatsächlichen Wert, meist einhergehend mit der Sperrung aller privaten Vermögenswerte der ehemaligen Eigentümer. Bereits im Februar 1939 war ein erster Übernahmevertrag mit dem gleichaltrigen Kaufmann Ernst Kistenmacher (Imu. Exportfirma E. G. Kistenmacher & Co., Mönckebergstraße 9) aufgesetzt worden, der aber vom NSDAP-Reichsstatthalter abgelehnt wurde. Unter anderem wurde bemängelt, dass für die Firma der bei Eigentümerwechseln übliche „Good will“ gezahlt werden sollte, eine Art 211 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 212 Firmenmehrwert, der z. B. den guten Ruf des Unternehmens und positive Ertragsaussichten berücksichtigte. Diese Zahlung war bei „Arisierungsverträgen“ generell nicht zulässig. Warum es nicht zu einer Vertragsänderung kam ist unbekannt. Möglicherweise sprachen gegen Ernst Kistenmacher dessen fehlende Parteimitgliedschaft und eventuell auch dessen Teilhaber, der mit einer Jüdin verheiratet war. Im Juni 1939 wurde dann mit dem Kaufmann Peter Schlumbom (1887–1959) ein Vertrag geschlossen. Über seinen Rechtsanwalt teilte der Käufer im Jahre 1947 seine Version der Übernahme mit. Über einen Hamburger Kaufmann habe er erfahren, „dass der Kaufmann Hugo Wolfers, Inhaber der Firma Schönfeld & Wolfers für sein Handelsgeschäft einen Käufer suche, weil er zu seinem Sohn nach Australien auswandern wolle. Dieser Hinweis geschah nicht lange vor Ausbruch des Krieges. Der Berufungskläger (Schlumbom) hat sich daraufhin mit Herrn Hugo Wolfers in Verbindung gesetzt. Die Verhandlungen führten am 29. Juni 1939 zum Abschluss des Kaufvertrages. Herr Wolfers wurde jedoch, obwohl er schon die Ausreiseerlaubnis erwirkt und die Passage belegt hatte, durch den Ausbruch des Krieges an der Ausreise gehindert.“ Daraufhin sei die Übernahme noch hinausgezögert und erst am 25. September 1940 mit einem Vertragsnachtrag in Kraft gesetzt worden. Ob dies den tatsächlichen Gegebenheiten entsprach, wurde zumindest vom Berufungsausschuss für Entnazifizierungsverfahren im Juni 1948 angezweifelt. Dieser hatte den Eindruck gewonnen, „dass der Berufungskläger (Schlumbom) die Zwangslage der jüdischen Verkäufer in unrechtmäßiger Weise ausgenutzt und sich auf deren Kosten bereichert hat.“ Peter Schlumbom, von 1934 bis 1938 glückloser Ostasienkaufmann in Japan, hatte noch aus dem Ausland seine „politische Rückfahrkarte“ gebucht und war der Deutschen Arbeitsfront (1. Juni 1935) und der NSDAP (1. November 1936) beigetreten. 1939 folgte die Mitgliedschaft im „Reichsbund der Kinderreichen“ (er hatte vier Kinder) sowie eine Tätigkeit als Blockhelfer/Blockleiter. Neben dem „Arisierungs-Kauf“ von Schönfeld & Wolfers erwarb er zum 1. Januar 1942 die Firma des niederländischen Großhändlers für Berufskleidung Joseph Veffer (Amsterdam, Jodenbreestraat 15) über eine Firma, die von der deutschen Besatzungsmacht mit dem Zwangsverkauf „jüdischer“ Firmen beauftragt wurde. Dem Kaufvertrag stimmte der Hamburger NSDAP-Reichsstatthalter im Oktober 1940 zu. Noch im selben Monat wurde ein notarieller Vertrag aufgesetzt: „Das Geschäft ist mit dem Firmenrecht auf den Kaufmann Peter Christoph Schlumbom übertragen worden. Dieser führt das Geschäft als alleiniger Inhaber unter unveränderter Firma fort.“ Am Ende des Vertrages wurde in einem einzigen Satz die Essenz der NS-Rassegesetze in die nüchterne Sprache der Behörden und Kaufleute übertragen und vom Notar besiegelt: „Die zu 1), 2), 4) und 5) Genannten (Anmerkung: Hugo Wolfers, Elisabeth Gorden geb. Wolfers, Sigrid Hess geb. Wolfers, Natalie Kramer geb. Wolfers) sind Juden, die zu 3) Genannte (Anm.: Gertrud Wolfers geb. Fränkel) ist Mischling ersten Grades, der zu 6) Genannte (Anm.: Peter Schlumbom) ist Arier.“ Reichsstatthalter Karl Kaufmann hatte den Kauf allerdings nur unter Auflagen genehmigt. So hieß es in einem Passus: „Die Beschäftigung des Herrn Wolfers als Angestellter wird zunächst nur bis zum 31. Dezember 1940 genehmigt.“ Auch bezüglich der Firmen212 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 213 bezeichnung wurden Vorgaben gemacht: „Der bisherige Firmenname darf auch mit einem die Nachfolgeschaft ausdrückenden Zusatz nur bis längstens bis zum 31. Dezember 1940 fortgeführt werden.“ Hugo Wolfers quittierte am 2. April 1941 den Erhalt von 4026,33 RM für seine Firma inklusive Geschäftsausstattung und Warenlager. Laut Käufer Schlumbom wurde der ehemalige Firmeninhaber noch bis zum 31. März 1941 als Angestellter gegen Entgelt beschäftigt. Obwohl demütigend, sicherte es Hugo Wolfers in dieser Situation immerhin den Lebensunterhalt. Die Jahreseinnahmen des „Ariseurs“ Schlum- Hugo Wolfers, 1930er Jahre Privatbesitz bom vervierfachten sich durch die Firmenzukäufe. Die zwanzigmonatige Verzögerung des Firmenverkaufs erschwerte eine mögliche Ausreise dramatisch. Neben dem behinderten Sohn Heinz war es auch die Ehefrau Olga, die einer seelischen Stütze bedurfte und Hugo Wolfers wohl zum Bleiben bewog. Das Fernsprechbuch des Jahres 1940 wies nun den Uhlenhorsterweg 2 als Wohnadresse aus. Ehepaar Wolfers war, ihrer Einnahmequelle beraubt, im November 1939 zur Untermiete in die nahegelegene Wohnung der Witwe Eugenie Zimmermann, geb. Isaacs, (geb. 27. Oktober 1873 in Hamburg, deportiert am 19. Juli 1942 nach Theresienstadt, dort am 16. April 1945 gestorben) gezogen. Zu diesem Zeitpunkt waren schon zwei der Wolfers-Kinder emigriert (die ältere Tochter Alice war 1932 mit 17 Jahren an Polio/Kinderlähmung gestorben). Der älteste Sohn Heinz (geb. 14. September 1908) litt unter Schizophrenie. Noch 1933 wohnte er in der Rothenbaumchaussee 103, 1. Stock zur Untermiete bei Rosa Rothenburg (geb. 18. März 1866 in Güstrow/Mecklenburg), die am 15. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert und am 23. September 1942 nach Treblinka weiterdeportiert wurde. Rosa Rothenburg verdiente mit der Vermietung von Zimmern ihrer Wohnung so wenig, dass sie zusätzlich auf Zuwendungen der Wohlfahrt angewiesen war. Möglicherweise hatte sie neben der Zimmervermietung auch die Pflege von Heinz Wolfers übernommen. Nachdem 1934 das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ in Kraft getreten war, wurde Heinz Wolfers in die „Staatsirrenanstalt Friedrichsberg“ eingewiesen. Als die Anstalt Friedrichsberg 1935 aufgehoben wurde, erfolgte am 18. Januar 1935 seine Verlegung in die „Staatskrankenanstalt“ Langenhorn (1893 als Außenstelle der Irrenanstalt Friedrichsberg gegründet). Seit Anfang der dreißiger Jahre verschlechterten sich die Lebensbedingungen der Patienten in den Anstalten durch Sparmaßnahmen und politisch motivierte Einschränkungen. In der Kriegszeit verschlechterte sich auch noch die Personalsituation durch die Einberufung von Ärzten und Pflegepersonal. Am 24. Januar 1940 wurde Heinz Wolfers, eingenäht in eine Wolldecke, mit einem Sammeltransport per Bus in die Heilanstalt Strecknitz bei Lübeck verlegt (Ratzeburger Allee 160). Aufgrund negativer ärztlicher Diagnosen nahm er nicht an ar213 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 214 beitstherapeutischen Maßnahmen teil. Er war bereits körperlich sehr schwächlich und lag zuletzt fast nur noch im Bett. Am 3. Mai 1940 starb er laut ärztlichem Bericht an den Folgen einer Lungen-Tbc, was auf eine schlechte pflegerische Versorgung hindeutet. Im September 1940 wurden die übrigen jüdischen Patienten von Strecknitz über Hamburg nach Brandenburg deportiert, wo sie höchstwahrscheinlich mit Gas getötet wurden. Hugo und Olga Wolfers wurden am 6. Dezember 1941 ins Getto Riga deportiert. Der Hamburger Transport wurde in das Staatsgut Jungfernhof eingewiesen. Dort starben Hugo und Olga Wolfers; die genauen Todesumstände sowie das Todesdatum sind nicht bekannt. Vom Amtsgericht Hamburg wurde das Todesdatum später rückwirkend auf den 8. Mai 1945 festgelegt. Bereits am 25. Oktober 1941 war die Schwester von Hugo Wolfers, Elisabeth Gorden, geb. Wolfers (geb. 23. Dezember 1879 in Hamburg) mit ihrem Sohn Herbert Gorden (geb. 24. September 1902 in Hamburg) ins Getto Lodz deportiert worden. Sie war verheiratet mit dem Amtsrichter Felix Gorden (1863–1939) und Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche. Mit 23 Jahren hatte der Referendar Felix Gorden seinen jüdischen Familiennamen Cohn in Berlin abgelegt und den britisch klingenden Namen Gorden angenommen. 1892 wechselte er als Assessor nach Hamburg, wo er 1895 zum Richter ernannt und am 15. Juli 1933 in den Ruhestand versetzt wurde. Noch im Februar 1939 hatte der selbstständige Kaufmann Herbert Gorden alle erforderlichen Unterlagen für seine Ausreise bei den entsprechenden Amtsstellen vorgelegt. Warum die Emigration dennoch nicht zustande kam, ist nicht bekannt. Möglicherweise hatte der Tod seines Vaters am 15. März 1939 zu einem Umdenken geführt. Die Schwester Hildegard war bereits nach Palästina ausgewandert, und so war Herbert Gorden der Einzige, der seiner Mutter in der Zeit nach dem Todesfall Halt und Hilfe geben konnte. Zweieinhalb Jahre später wurden Mutter und Sohn deportiert und starben im Getto Lodz. Von Elisabeth Gorden ist das Todesdatum nicht bekannt. Herbert Gorden starb am 9. März 1942. An beide erinnern Stolpersteine in der Parkallee 84 in Hamburg-Harvestehude, wo die Familie seit mindestens 1902 wohnte. Für Alice Oppenheimer, geb. Oppenheim (1867–1942), und ihren Sohn Ernst Oppenheimer (1897–1942?) wurden in der Sierichstraße 58 im Stadtteil Winterhude Stolpersteine verlegt. An die Eltern von Grete Wolfers, geb. Abrahamssohn, Joel Abrahamssohn (1869–1942) und Pauline Abrahamssohn geb. Meyer (1872–1942), erinnern Stolpersteine“ in der Peterstraße 33 in Hamburg-Neustadt. – Björn Eggert Quellen: 1; 2; 5; 8; StaHH Staatsangehörigkeitsaufsicht, A III 21 Bd.2, Aufnahme-Register 1865-1879, MZ; StaHH 332-8, Alte Einwohnermeldekartei; StaHH 351-11, AfW, 221075 (Hugo Wolfers); StaHH 351-11, AfW, 271090 Henry Pels; StaHH 352-8/7, Staatskrankenanstalt Langenhorn, Abl. 1/1995, 21121 (Heinz Wolfers); StaHH 231-7, Handels- u. Genossenschaftsregister, B 1982-104, Band 1 u. 3 (Schönfeld & Wolfers); StaHH 314-15, OFP, FVg 4758; StaHH 314-15, OFP, R 1940/492; StaHH 241-2, Justizverwaltung, Personalakten, A 1229; StaHH 221-11, Staatskommissar für die Entnazifizierung, C 3169; StaHH 221-11, Staatskommissar für die Entnazifizierung, C 6984; AB 1842 (Jaffé), 1870, 1885, 1896; Amtliche Fernsprechbücher Hamburg 1895, 1906, 1914, 1917, 1919–1920, 1925, 1928–1930, 1933, 1938–1940; Gräberkartei Jüdischer Friedhof Ohlsdorf; Auskünfte des Historikers Hans-Werner Dirks (Warmsen), 2008; Auskünfte und Privatfotos von Howard Wolfers (Australien), 2008 u. 2009; Auskünfte von Ernest Stiefel, 214 139-215 Biografien M-Z:. 30.08.10 22:16 Seite 215 Seattle/USA, 2009; von Rönn/ Lunderup: Wege in den Tod. S. 233 ff.; Press, Judenmord in Lettland 19411945, S. 67 ff., S. 71, S. 89 ff.; Sparr, Stolpersteine in Hamburg-Winterhude. S. 188 ff.; Hamburger Börsenfirmen, 11. Auflage, Hamburg 1910, S. 591, S. 720 f.; Hamburger Börsenfirmen, 34. Auflage, Hamburg Febr.1933, S. 764, S. 931; Hamburger Börsenfirmen, 36. Auflage, Hamburg 1935, S. 446 (Kistenmacher & Co.); Hamburger Handel und Verkehr, Illustriertes Export-Handbuch der Börsenhalle 1912/14, Hamburg ohne Jahresangabe, S. 130 (Schönfeld & Wolfers); Bajohr, „Arisierung“ in Hamburg, S. 371 (Schönfeld & Wolfers); Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Westfalen, Amt für Denkmalspflege, Bau- u. Kunstdenkmäler von Westfalen, Band 50, Stadt Minden – Teil IV, Minden 2000, S. 132 ff. (Wolffers-Haus); Herzig, Das Sozialprofil der jüdischen Bürger von Minden; Storz: Als aufgeklärter Israelit wohltätig wirken. S. 172 ff.; Gelehrtenschule des Johanneums, Bibliotheca Johannei (Schülerkarte Hugo Wolfers); Königliche Kunst – Freimaurerei in Hamburg seit 1737, Ausstellung im Jenisch-Haus vom 24.3.–22.11.2009, Schriftstück von 1897 in der Ausstellung (darauf erwähnt Ed. Wolfers u. Ernst Wolfers). Theodor Rudolf Jonni Wulff, geb. 1.2.1922, Selbstmord am 27.7.1938 in Hamburg 73 Oertzgarten, Rückseite des Hauses Oertzweg 15 a Eines der jüngsten Opfer der nationalsozialistischen Homosexuellenverfolgung war Theodor Wulff. Am 27. Juli 1938 erhängte er sich im Alter von 16 Jahren. Geboren wurde er am 1. Februar 1922 in Hamburg. Theodor Wulff, der Theo genannt wurde, erlernte das Bäckerhandwerk und war Mitglied der Marine Hitler Jugend (MHJ). Im November 1939 kam durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen gegen einen anderen Homosexuellen heraus, dass er ein Verhältnis zu dem 26 Jahre älteren Johannes Wagner (*1896, † 1942 Tötungsanstalt Bernburg) unterhielt. Zudem soll er zwei etwas jüngeren Jungen gezeigt haben, wie man onaniert. Vermutlich lagen hier die Gründe der polizeilichen Ermittlungen gegen Theodor Wulff und für dessen Selbstmord. – Bernhard Rosenkranz/Ulf Bollmann Theodor Wulff, ca. 1937 StaHH Quellen: StaHH, 331-5 Polizeibehörde – Unnatürliche Sterbefälle, 1146/38; StaHH, 213-11 Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafsachen, 2970/40; B. Rosenkranz/U. Bollmann/G. Lorenz: Homosexuellen-Verfolgung in Hamburg 1919–1969, S. 267–268. 215 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 216 Beate Meyer Glossar „Arisierung“ Unter „Arisierung“ wird in der Regel die Entfernung der Juden aus dem Berufs- und Wirtschaftsleben und der damit erzwungene Transfer ihres Vermögens von Juden auf Nichtjuden verstanden. Aus wirtschaftlichen Gründen – Hamburg war Notstandsgebiet – forcierte die Stadt Hamburg diesen Prozess bis 1938 noch nicht so stark. Nach dem Novemberpogrom vom 9./10. November 1938 kam es jedoch zu einem „Bereicherungswettlauf“ (Frank Bajohr). Bis 1939 wurden in Hamburg 1500 jüdische Unternehmen zwangsweise liquidiert oder weit unter dem marktüblichen Preis an nichtjüdische Erwerber verkauft. Den jüdischen Besitzern wurde zumeist nur ein Teil des Wertes vergütet; insbesondere der „goodwill“, der immaterielle Wert einer eingeführten Firma, ihr Kundenstamm, das Ansehen, die Verbindungen usw. wurde nach 1935 nicht mehr angerechnet. Außerdem wechselten Hunderte von Immobilien den Besitzer oder wurden unter Zwangsverwaltung gestellt. Im weiteren Sinne „arisiert“ wurde auch das private Vermögen über Steuern und Zwangsabgaben. Schließlich griff der NS-Staat auch auf das zurückgelassene Vermögen emigrierter und deportierter Juden zu, das er zugunsten des Deutschen Reiches einzog. Auschwitz (Konzentrations- und Vernichtungslager) Das Lager Auschwitz wurde am Rand der polnischen Stadt Oswiecim gebaut und umfasste ein Gebiet von ca. 40 Quadratkilometern. Es bestand aus drei Teilen: dem Stammlager (Auschwitz I), Auschwitz-Birkenau, dem späteren Vernichtungslager (Auschwitz II) und dem Zwangsarbeiterlager Monowitz (Auschwitz III), dem Buna Monowitz und 45 weitere Lager angegliedert wurden. In Auschwitz I wurden zunächst einheimische Juden und politische polnische Häftlinge interniert, später kam eine Frauenabteilung hinzu, die jedoch nach Auschwitz II überführt wurde. In Auschwitz II befanden sich die meisten Häftlinge, vor allem Juden, eine Zeitlang auch die Familienlager für „Zigeuner“ und für tschechische Juden. Ab Herbst 1941 wurde dort mit dem Gas Zyklon B experimentiert und ab März 1942 mit der industriellen Ermordung der Juden begonnen. In den vier Gaskammern wurden bis November 1944 zwischen 1 und 1,5 Millionen Juden getötet. Hamburg verließen zwei Transporte mit Ziel Auschwitz: am 11.7.1942 mit 300 Personen, am 12.2.1943 mit 24 Personen, die über das zentrale Berliner Sammellager dorthin deportiert wurden. Weitere Hamburger Juden gelangten aus den Gettos dorthin. In Auschwitz III schufteten die Häftlinge bei den Buna-Werken (synthetisches Gummi), den IG Farben oder den Oberschlesischen Hydrierwerken. Wurden sie arbeitsunfähig, wurden sie nach Birkenau überstellt und ermordet. 216 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 217 Auswanderung Zwischen 1933 und 1941 emigrierten mehr als die Hälfte der in Deutschland lebenden 525 000 Jüdinnen und Juden, aus Hamburg zwischen 10 000 und 12 000. Sie verließen Deutschland in mehreren Wellen: Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, nach Verabschiedung der Nürnberger Gesetze und nach dem Novemberpogrom 1938. Zwischen 1933 und 1935 war die Auswanderung noch vergleichsweise ohne große Vermögensverluste möglich; ab 1935 wurden Steuern und Abgaben erhöht, ab 1938 erschwerte es eine Vielzahl von Bestimmungen, überhaupt das Land zu verlassen. Auswanderer durften gerade 10 RM mitnehmen. Wer auswandern wollte, musste einen gültigen Reisepass und ein Visum besitzen, die „Reichsfluchtsteuer“ entrichtet haben, eine Abgabe für ins Ausland transferiertes Geld bezahlt haben (die DegoAbgabe, die 1934 65% der Gesamtsumme betrug und bis September 1939 auf 96% erhöht wurde). Sie/er musste eine Packerlaubnis besitzen, eine Umzugsliste erstellt haben, die genehmigt worden war (auf neu gekaufte Gegenstände musste eine Abgabe bis zu 300% des Anschaffungswertes gezahlt werden), das Umzugsgut vor der Ausreise kontrollieren lassen und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Behörde des Oberfinanzpräsidenten erhalten haben (dass alle Steuern und Abgaben entrichtet waren). Natürlich musste sie/er aus eigenen Mitteln oder mit Unterstützung einer Hilfsorganisation die Schiffs- oder Bahnfahrkarten erworben haben und etliches mehr. Wenn sich eine dieser vorgeschriebenen Formalitäten verzögerte, konnte die Ausreise oft gar nicht angetreten werden. Ein Teil der jüdischen Emigranten ging nach Palästina, das britisches Mandatsgebiet war. Andere versuchten, die Einreisegenehmigung für die USA und Großbritannien zu bekommen oder flüchteten in europäische Nachbarländer, wo die deutschen Truppen sie später einholten. 1939–1941 kamen als Zielgebiete nur noch wenige südamerikanische Länder oder Shanghai in Frage, das kein Visum verlangte. Am 23. Oktober 1941, zeitgleich mit dem Beginn der Deportationen, wurde die Auswanderung verboten. Bewährungsbataillone 999 und „SS-Sonderkommando Dirlewanger“ In die Bewährungsbataillone 999 der Wehrmacht wurden ab 1942 aufgrund eines „Führerbefehls“ Männer zwangsweise verpflichtet, denen ursprünglich die „Wehrwürdigkeit“ wegen krimineller, militärstrafrechtlicher oder politischer Delikte aberkannt worden war (Juden oder „Mischlinge“ ausgenommen.) Die neuen Einheiten sollten die Wehrmacht nach den schweren Verlusten an der Ostfront vor allem an anderen Fronten personell entlasten. Vom Oktober 1942 bis August 1944 wurden aus dem Deutschen Reich und den neuangeschlossenen Gebieten insgesamt ca. 28 000 „Wehrunwürdige“ zu den Bewährungsbataillonen eingezogen. Die meisten hatten ihre Strafen bereits verbüßt, 30–40 % kamen direkt aus den Gefängnissen, Zuchthäusern und Straflagern der Justizverwaltung, eine kleine Minderheit unmittelbar aus den Konzentrationslagern. 30 % der Eingezogenen waren politisch Vorbestrafte, die anderen „Kriminelle“ im Sinne der NS-Strafrechts. Die Bewährungsbataillone wurden insbesondere in Nordafrika, dem Balkan und Griechenland, einige auch an der Westund Ostfront und als Pioniertruppen in Deutschland selbst eingesetzt. Unter den politisch 217 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 218 Vorbestraften dominierten die Mitglieder der Arbeiterparteien. Sie versuchten in vielen Einheiten, ihre Widerstandsaktivitäten fortzusetzen und vor allem möglichst viele „Bewährungssoldaten“ zum Überlaufen zu den alliierten Truppen zu bewegen oder in Einzelfällen sogar eine bewaffnete Rebellion in den eigenen Reihen herbeizuführen. Eine andere „Bewährungseinheit“, die den Namen ihres Leiters Oskar Dirlewanger trug, war als „Freiwilligenabteilung“ der Waffen-SS angegliedert. Diese Einheit wurde im Sommer 1940 ausschließlich aus vorbestraften Wilddieben zusammengestellt. Ihr Kommandeur musste sich selbst wegen eines Sittlichkeitsdelikts „bewähren“. Von 1942 bis Herbst 1944 bekämpfte das Bataillon im sogenannten Generalgouvernement Widerstandsgruppen, bewachte Arbeitslager und Zwangsarbeiter oder ging gegen Partisanen in Weißrussland vor. Ukrainische und russische „Hilfswillige“ verstärkten die Truppe auf 1000–1200 Mann. Im Mai 1943 wurden erstmals KZ-Häftlinge, „Berufsverbrecher“ und „Asoziale“, sowie verurteilte SS-Männer und von Militärgerichten verurteilte Soldaten zum „Sonderkommando Dirlewanger“ eingezogen, das jetzt auf 6500 Mann anwuchs. Die Brigade erwarb sich einen Ruf als brutale Schlächter bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes und der Aufstandsbewegung in der Slowakei im Herbst 1944. Nun wurden 1000 politische KZ-Häftlinge zwangsweise rekrutiert, die eine rudimentäre militärische Ausbildung und Waffen erhielten und Anfang Dezember ins slowakisch-ungarische Grenzgebiet geschickt wurden, um gegen die vorrückende Sowjetarmee zu kämpfen. Aus der Brigade, in der einige Kompanien fast ausschließlich aus „Politischen“ zusammengesetzt waren, flüchteten Hunderte ehemaliger politischer Häftlinge zu den Sowjets – wobei eine nicht bekannte Anzahl wegen ihrer SS-Uniformen in sowjetischen Kriegsgefangenenlagern inhaftiert wurden und bei der Zwangsarbeit ums Leben kamen. – Benedikt Behrens Chelmno, dt. Kulmhof (Vernichtungslager) Dieses erste Vernichtungslager lag ca. 70 km von Lodz entfernt. Nach Schätzungen wurden hier zwischen 152 000 und 320 000 Juden ermordet, darunter die Häftlinge des Gettos Lodz. Das Lager Chelmno bestand aus zwei Teilen: 1) Im „Schloss“ wurden die Menschen aufgenommen und in Gaswagen am Ende einer Rampe ermordet. Hier lebte auch das Mordpersonal. Im Dezember 1941 „arbeiteten“ drei Gaswagen. 2) Im „Waldlager“ mussten ausgesuchte Deportierte, die später erschossen wurden, Massengräber ausheben und die Leichen begraben bzw. diese später in zwei Verbrennungsöfen verbrennen. DIGH (Deutsch-Israelitische Gemeinde Hamburg = Jüdische Gemeinde), Jüdischer Religionsverband e. V., Bezirksstelle Nordwestdeutschland der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland Die Deutsch-Israelitische Gemeinde Hamburgs gab sich 1867 eine Toleranzverfassung: Unter dem organisatorischen Dach der Gemeinde, die für das Schul- und Erziehungswesen, das allgemeine Wohlfahrts- und Begräbniswesen verantwortlich zeichnete, existierten zwei (später 218 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 219 drei) Kultusvereinigungen, die sich um die religiöse Betreuung kümmerten. Jeder Hamburger Jude konnte entscheiden, ob sie/er der Gemeinde und/oder einer Kultusvereinigung angehören wollte. Kultusverbände waren der orthodoxe Synagogenverband, der liberale Tempelverband und die 1894 gegründete gemäßigt-orthodoxe Neue Dammtor-Synagoge. Während der Weimarer Republik zählte die Gemeinde ca. 20000 Mitglieder und stellte damit die viertgrößte jüdische Gemeinschaft im Deutschen Reich dar. Nur ca. 40% der Gemeindemitglieder gehörten einem der Kultusverbände an. Außerhalb der Hamburger Stadtgrenzen hatten sich jüdische Gemeinden in Altona, Wandsbek und Harburg-Wilhelmsburg gebildet. Als mit dem Groß-Hamburg-Gesetz von 1937 diese Städte dem Hamburger Gebiet zugeschlagen wurden, gingen deren jüdische Gemeinden Anfang 1938 in der Hamburger auf, die sich in „Jüdischer Religionsverband“ umbenennen und später – als die jüdischen Gemeinden nur noch als Vereine existieren durften – ein „e. V.“ anhängen musste. Nach dem Novemberpogrom 1938 bestimmte die Gestapo den bisherigen Syndikus, Max Plaut, zum Alleinverantwortlichen für den Religionsverband. Die Kultusverbände mussten ihre Tätigkeit im Frühjahr 1938 beenden. 1939 zählte die jüdische Gemeinde Hamburgs nach den ersten Emigrationswellen noch 10 131 Mitglieder. Im Juli 1939 wurde per Gesetzesakt die „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“ gegründet, deren „Bezirksstelle Nordwestdeutschland“ Plaut nun ebenfalls leitete. Mitglied der Reichsvereinigung musste jeder Angehörige eines aufgelösten Kultusverbandes und der Gemeinde werden mit Ausnahme der in „privilegierter“ Mischehe lebenden Juden. Plauts Betreuungsgebiet umfasste über Hamburg hinaus auch große Teile des heutigen Schleswig-Holsteins und Niedersachsens. Der „Jüdische Religionsverband“ blieb für die Hamburger als Abteilung innerhalb der Reichsvereinigung zuständig, bis er der Zwangsorganisation im August/November 1942 endgültig eingegliedert wurde. Im Juni 1943 löste der NSStaat die Reichsvereinigung auf, ließ aber eine Rest-Reichsvereinigung die Angelegenheiten der Mischehen noch bis Kriegsende weiterführen. Deren Hamburger Büro wurde von dem Arzt Martin-Heinrich Corten geleitet. Emigration siehe Auswanderung „Euthanasie“ Die Tötung „lebensunwerten Lebens“ wurde seit Ausgang des 19. Jahrhunderts unter Rassehygienikern in etlichen Ländern diskutiert. In Deutschland ermöglichten nach der NS-Machtübernahme etliche Gesetze die Erfassung und Aussonderung erbkranker, körperlich oder geistig behinderter Personen. Mit der sog. Kindereuthanasie wurden 1939 mindestens 5000 Säuglinge und Kinder ermordet. Der kurz darauf folgenden „Erwachseneneuthanasie“ („Aktion T4“) fielen ca. 70 000 Personen zum Opfer. Diese wurde im August 1941 nach Protesten kirchlicher Kreise offiziell eingestellt. Doch die Ermordung kranker und nicht mehr arbeitsfähiger KZ-Häftlinge lief bis Ende des Krieges als „Aktion 14f13“ in drei der Tötungsanstalten weiter (Bernburg, Sonnenstein und Hartheim). Sie betraf ca. 20 000 Häftlinge. 219 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 220 Ab 1943 folgte die „wilde Euthanasie“ oder „Aktion Brandt“, benannt nach Hitlers Begleitarzt. Es wurden Heil- und Pflegeanstalten geräumt und die Patienten in besonderen Anstalten konzentriert, wo sie gezielt mit überdosierten Medikamenten oder durch Unterernährung getötet wurden. Dies betraf ca. 30 000 Personen. Juden, die sich in staatlichen Heimen befanden, wurden im Rahmen der ersten beiden „Euthanasie“-Phasen mit ermordet. Jüdische Geisteskranke wurden dann in einer eigenen Anstalt in Benndorf-Sayn gesammelt und den systematischen Deportationen angeschlossen. Insgesamt sollen 150 000 nichtjüdische und jüdische Patienten aus Deutschland getötet worden sein. Fuhlsbüttel, Polizeigefängnis bzw. Konzentrationslager „Kolafu“ (auch: „Kola-Fu“) Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurden 400 bis 600 politische Gegner in der Strafanstalt Fuhlsbüttel inhaftiert, mehr als 100 weitere im „wilden KZ“ Wittmoor, das im Oktober 1933 aufgelöst wurde. Von diesem Zeitpunkt ab nutzte die Staatspolizei unter Bruno Streckenbach Gebäudeteile der Strafanstalt Fuhlsbüttel, das „Kolafu“, als Haftstätte für ca. 700 bis 800 „Schutzhäftlinge“. Unter dem Kommandanten Paul Ellerhusen und Wachmannschaftsführer Willi Dusenschön galt Fuhlsbüttel als eines der brutalsten Lager im Deutschen Reich. Nachdem Todesfälle unliebsames Aufsehen erregt hatten, wurde die Leitung ausgewechselt und das Konzentrationslager 1936 in Polizeigefängnis Fuhlsbüttel umbenannt. Es unterstand der Gestapo, die hier vor allem politische Häftlinge, Homosexuelle und Zeugen Jehovas inhaftierte. Während des Novemberpogroms 1938 sammelte sie hier einen Großteil der Juden, die in das KZ Sachsenhausen transportiert wurden. Später durchliefen auch ca. 400 Swing-Jugendliche das Polizeigefängnis. Im „Kolafu“ herrschte große Fluktuation, weil die Häftlinge in der Regel nach einiger Zeit in andere Lager verlegt wurden. Während des Zweiten Weltkrieges wies die Gestapo vermehrt in Mischehe lebende Juden, die kriminalisiert worden waren, und ausländische Zwangsarbeiter hier ein. Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums Das am 7. April 1933 erlassene Gesetz erlaubte den nationalsozialistischen Machthabern, politisch missliebige oder „nichtarische“ Staatsdiener zu entlassen bzw. in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie vor August 1914 bereits Beamte gewesen waren. Auch „Frontkämpfer“ blieben von der Entlassung verschont. Wer zwangsweise in den Ruhestand versetzt war, erhielt eine Pension, die später mehrfach reduziert wurde. In der Folgezeit musste jeder Beamte den „Ariernachweis“ erbringen und mit Dokumenten belegen, dass kein Jude unter den Vorfahren zu finden war. Etliche Durchführungsverordnungen weiteten das Gesetz auf Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst wie bei halböffentlichen Unternehmen aus. „Ariernachweise“ verlangten später nicht nur Arbeitgeber, Schulen und Universitäten, sondern auch Clubs oder Vereine und andere. 220 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 221 Hachschara(h) Mit diesem Begriff wird die geistige und körperliche Vorbereitung auf ein Leben in Palästina bezeichnet. Die Bewegung entwickelte sich Ende 19. Jahrhunderts. In Deutschland strömten nach der nationalsozialistischen Machtübernahme angesichts der bedrückenden Situation vor allem Jugendliche in die sog. Hachschara-Zentren. Sie lebten während dieser Zeit in Wohnheimen oder Wohngruppen und bereiteten sich in Lehrwerkstätten oder anderen Einrichtungen auf ihre Auswanderung und eine spätere landwirtschaftliche, handwerkliche oder hauswirtschaftliche Tätigkeit in Palästina (Erez Israel, das gelobte Land) vor, wo sie Kibbuzim aufbauen wollten. Dafür befassten sie sich auch intensiv mit jüdischer Geschichte und lernten Hebräisch. Die Träger dieser Ausbildung waren meist zionistische Organisationen, insbesondere der Hechaluz (dt.: Pionier). Dieser linksorientierte Verband war 1917 entstanden und hatte 1922 einen deutschen Landesverband eingerichtet. In Hamburg bestanden Einrichtungen für die Älteren-Hachschara (über 18 Jahre) und die Jüngeren- und Mittleren-H. (14–17 Jahre). Junge Männer konnten auch eine SeemannsHachschara auf den Schiffen der Fairplay-Reederei, später auch der Bernstein- und SchindlerReederei absolvieren. Bis 1938 hatten in Hamburg 800 Jugendliche diese Vorbereitungszeit durchlaufen. Zwischen 1938 und 1941 wurden reichsweit die meisten Hachschara-Zentren zwangsweise geschlossen, einige durften als Zwangsarbeiterlager weitergeführt werden. Der Hechaluz arbeitete von 1938 an im Rahmen des Palästina-Amtes weiter, einer Hilfsorganisation zur Auswanderung nach Palästina, die 1941 aufgelöst wurde. Hechaluz siehe Hachschara und Zionistische Bewegung Homosexuellen-Verfolgung Homosexuelle Handlungen zwischen Männern standen in Deutschland von 1871 bis 1994 unter Strafe (§ 175 des Strafgesetzbuches). Von 1871 bis zum 27. Juni 1935 musste für eine Strafverfolgung eine beischlafähnliche Handlung nachgewiesen werden. Die Nationalsozialisten stellten homosexuelle Männer als „Volksschädlinge“, „gefährliche Gewohnheitsverbrecher“, „Staatsfeinde“ und „bevölkerungspolitische Blindgänger“ dar, die es zu bekämpfen und aus der „gesunden Volksgemeinschaft“ „auszumerzen“ galt. Viele Deutsche teilten diese Meinung offenbar, denn ein Großteil der Homosexuellen geriet durch Denunziationen in das Netz von Gestapo und Kriminalpolizei. Am 28.6.1935 wurde das Strafrecht verschärft (§ 175, § 175 a), sodass bereits ein begehrlicher Blick oder eine Körperberührung für eine Verurteilung ausreichten: Eine sexuelle Handlung musste nicht mehr nachgewiesen werden. Polizei und Justiz sollten eine „Verführung“ heterosexueller Männer verhindern, um das Volk „rein“ zu halten. Insgesamt wurden in der NS-Zeit rund 54 000 Männer nach § 175 und/oder § 175 a zu Gefängnis und Zuchthaus verurteilt bzw. in Anstalten eingewiesen (z. B. Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn). Das ging fast immer einher mit der Zerstörung sozialer Existenzen (Verlust von Arbeitsplatz, Wohnung und Eigentum, 221 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 222 Entzug der Approbation, Aberkennung akademischer Titel). Viele Beschuldigte entzogen sich vor oder während des Verfahrens durch Selbstmord der Verurteilung. Die Männer wurden nicht nur strafrechtlich verfolgt, sondern auch in Konzentrationslager oder Tötungsanstalten eingewiesen und dort ermordet oder zur „freiwilligen“ Kastration gezwungen. Der Zusammenbruch des NS-Regimes beendete die Verfolgung der Homosexuellen keineswegs. Der verschärfte § 175 galt weiter in den Besatzungszonen und später in der Bundesrepublik Deutschland. Von 1949 bis 1969 wurde gegen ca. 100 000 homosexuelle Männer ermittelt. In etwa der Hälfte der Fälle kam es zu Verurteilungen. Erst 1969, 24 Jahre nach Kriegsende, wurden gleichgeschlechtliche Handlungen zwischen erwachsenen Männern (damals über 21 Jahre) straffrei. Weibliche Homosexualität stand nicht unter Strafandrohung, wenngleich sie sich strafverschärfend auswirkte, wenn Frauen wegen anderer Delikte auffällig geworden waren. „Judenhäuser“ Das Reichsgesetz über die Mietverhältnisse mit Juden vom 30.4.1939 schaffte den Mieterschutz für Juden ab und schränkte ihr Recht auf freie Wohnungswahl erheblich ein. Damit bekamen die Behörden die Möglichkeit, Juden in bestimmten Stadtteilen zu konzentrieren. „Judenwohnungen“ galten der NSDAP-Gauleitung als Verfügungsmasse für sozialpolitische und städtebauliche Maßnahmen, später auch als Ersatzwohnraum für Bombengeschädigte. In Hamburg befahl die Gestapo Max Plaut 1941, Wohnraum freizumachen. Der Religionsverband wies die Betroffenen vor allem in Wohnstifte, Alters- und Pflegeheime ein, über die er als Gemeindeeigentum (bzw. dann Eigentum der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland) verfügen konnte. Die meisten Wohnhäuser lagen im Grindelgebiet, Eimsbüttel-Süd und Altona. Zunächst traf der Umquartierungsbefehl ungeschützte „Volljuden“, dann die in „nichtprivilegierter“ Mischehe und schließlich die in „privilegierter“ Mischehe lebenden Juden. Die schweren Luftangriffe auf Hamburg im Juli/August 1943 verstärkten die Wohnraumknappheit in Hamburg. Der Religionsverband musste weitere Zimmer für Ausgebombte freimachen. Dabei waren 600 von den 1257 noch in Hamburg befindlichen Juden selbst betroffen. Dies konnte trotz der Drohung, die Hamburger Juden ersatzweise in Baracken auf dem jüdischen Friedhof umzuquartieren, nur ansatzweise verwirklicht werden. Viele Juden lebten nur eine kurze Zeit im „Judenhaus“, bis sie den Deportationsbefehl erhielten. Der Wohnraum, der ihnen zustand, wurde immer geringer bemessen. Die „Judenhäuser“ waren gekennzeichnet und standen unter Gestapokontrolle. Aus diesem Grund entschied nach dem Krieg das Oberverwaltungsgericht Hamburg, den zwangsweisen Aufenthalt von „Sternträgern“ dort als haftgleich anzuerkennen. „Judenreferat“ der Gestapo Das „Judenreferat“ der Hamburger Gestapo mit ihrem Leiter, dem „Judenreferenten“ Claus Göttsche, war 1938 als eigenständige Abteilung aus dem Referat „Juden, Freimaurer, Logen“ (II B) hervorgegangen. Später erhielt es die Bezeichnung IV B 4. Unter Göttsche arbeiteten dort 222 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 223 u. a. Fritz Beck, Walter Wohlers, Hans Stephan, Ferdinand Amberger, Walter Mecklenburg, Hermann Kühn sowie Beamte namens Götze und Hammerschlag. Die Sicherheitspolizei baute das Jüdische Gemeinschaftshaus in der Rothenbaumchaussee 38 um und quartierte hier das „Judenreferat“ ein, das zuvor in der Staatspolizeileitstelle Hamburg im Stadthaus seinen Sitz gehabt hatte. Inmitten des Grindelviertels organisierte Göttsche nun die Überwachung, Kontrolle und schließlich die Deportation der Hamburger Juden. Im Herbst 1943 kehrte er ins Stadthaus zurück und übernahm die Nachrichtenabteilung. In das ehemalige Gemeinschaftshaus zog das Ausländerreferat der Gestapo. Im Mai 1945 verübte Claus Göttsche Selbstmord, sein Untergebener Walter Mecklenburg folgte ihm 1947, während andere Gestapoleute abtauchten. Die Beamten des „Judenreferats“ wurden nie wegen ihrer Taten in Hamburg vor Gericht gestellt. Aus eingestellten Ermittlungsverfahren wird deutlich, dass sie sich nicht nur immer wieder allein und gemeinschaftlich bereichert, sondern Juden auch schikaniert, erpresst, in den Tod getrieben oder wegen geringer Vergehen auf die Deportationslisten gesetzt hatten. „Judenstern“ Die Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden vom 1.9.1941 verpflichtete alle Juden, die älter als sechs Jahre waren, ab 19.9.1941 einen gelben „Judenstern“ sichtbar auf der linken Brustseite zu tragen. Erwerben mussten sie diesen für 10 Pf. bei der Reichsvereinigung, in Hamburg beim Jüdischen Religionsverband. Sie mussten ihn ausschneiden, säumen und fest aufnähen. Ausgenommen von der „Sternpflicht“ waren die in „privilegierten“ Mischehen lebenden Juden und die „Mischlinge ersten Grades“. Ohne „Stern“ das Haus zu verlassen oder ihn zu verdecken, zog Strafen nach sich, die oftmals zur schnelleren Deportation führten. Judenvermögensabgabe siehe „Sühneleistung“ Jüdischer Religionsverband siehe DIGH Jungfernhof siehe Riga Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), Kommunistischer Jugendverband Deutschlands (KJVD), Revolutionäre Gewerkschaftsopposition (RGO) und andere Unterorganisationen Die KPD, im Dezember 1918 gegründet, kämpfte für die Errichtung einer „Diktatur des Proletariats“ nach sowjetrussischem Vorbild. Bewaffnete Aufstandsversuche in den 1920er Jahren blieben erfolglos. Im Juli 1920 beteiligte sich die KPD erstmals an Reichstagswahlen mit dem Ziel, das Parlament als politische Bühne zu nutzen. Die Demokratie der Weimarer Republik bekämpfte sie weiterhin. Die Zentren der KPD lagen in den Großstädten und den Industrierevieren in Nord-, West- und Mitteldeutschland. Ende der 1920er Jahre wuchs die KPD durch Vereinigung mit der Unab223 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 224 hängigen Sozialdemokratischen Partei (USPD) zur Massenorganisation, 1930 gehörten ihr 120 000, Ende 1932 ca. 300 000 Genossen an. Hier kann nicht auf die Führungspersönlichkeiten und nur auf einige Unterorganisationen oder KP-nahe Vereinigungen eingegangen werden, mit denen die Partei versuchte möglichst viele Mitglieder, Unterstützer und Anhänger zu erreichen: Der seit 1924 existierende paramilitärische Wehrverband „Rotfrontkämpferbund“ (RFB) schützte Versammlungen vor Überfällen und lieferte sich Straßenschlachten mit der SA. Die 1924 gegründete „Rote Hilfe“ unterstützte inhaftierte Kommunisten, Gewerkschafter und andere Gefangene. Der 1925 gegründete Kommunistische Jugendverband Deutschlands (KJVD) bot jungen Leuten politische Diskussionen, verknüpft mit attraktiven Freizeitangeboten an; der gleichzeitig ins Leben gerufene „Rote Frauen- und Mädchenbund“ (RFMB) setzte sich u. a. für die Abschaffung des Abtreibungsparagraphen 218 ein, um nur einige zu nennen. 1929 erklärte die KPD unter dem Begriff „Sozialfaschismus“ den Kampf gegen die Sozialdemokratie zum Hauptziel ihrer künftigen Politik. Die Partei wollte versuchen, die Masse der sozialdemokratischen Arbeiter zu gewinnen, deren Führer sie als „Arbeiterverräter“ ansah, u. a. weil sie zum Schutz der Weimarer Republik Polizei gegen streikende/demonstrierende Arbeiter einsetzte. Die KPD propagierte die „Einheitsfront“ der Arbeiterschaft unter ihrer Führung. Um die Gewerkschafter aus dem sozialdemokratischen Kontext heraus zum Klassenkampf zu führen, wurde die Revolutionäre Gewerkschaftsopposition (RGO) gegründet. Ihre Unterorganisationen wie beispielsweise die Interessengemeinschaft Oppositioneller Lehrer sollten die Mitglieder der Einzelgewerkschaften für die Politik der KPD gewinnen – was diese allerdings als Spaltungsversuche werteten. Ende der 1920er Jahre war die KPD mittlerweile eher zur Partei der Arbeitslosen geworden. Die KPD bündelte linksgerichtete Protestwähler und konnte bei der Reichstagswahl am 6.11.1932 als drittstärkste Partei fast sechs Millionen Stimmen erlangen. Der Vorsitzende der KPD, der Hamburger Ernst Thälmann, schlug der SPD nunmehr eine gemeinsame „Antifaschistische Aktion“ vor, doch auch dieses Angebot beinhaltete ein gemeinsames Vorgehen unter Federführung der KPD und stieß deshalb auf wenig Zustimmung bei den Sozialdemokraten. Anlässlich der nationalsozialistischen Machtübernahme rief die KPD ohne Erfolg zum Generalstreik auf. Nach ihrer Machtübernahme verboten die Nationalsozialisten die KPD, ihre Organisationen, Versammlungen und Publikationen auf der Grundlage der Reichstagsbrandverordnung vom 28.2.1933 als staatsfeindlich. Am 3.3.1933 wurde Ernst Thälmann in „Schutzhaft“ genommen. Dennoch erhielt die KPD bei den Reichstagswahlen am 5.3.1933 noch einmal 12,3 % der Stimmen. Ihre Sitze im Reichstag konnten die kommunistischen Abgeordneten nicht mehr einnehmen. Sie wie andere KPD-Mitglieder wurden systematisch verfolgt, ins Exil gejagt oder in Konzentrationslager eingewiesen. Im Exil widerrief die Kommunistische Partei die verhängnisvolle Sozialfaschismustheorie und propagierte mit der Volksfrontpolitik ein Zusammengehen mit der SPD, was jedoch angesichts des tiefen gegenseitigen Misstrauens nur selten gelang. Viele der in Deutschland zurückgebliebenen Kommunisten organisierten sich in 224 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 225 Widerstandsgruppen, deren Mitglieder massenweise verhaftet wurden, so dass die Gruppen bis Ende 1936 weitgehend zerschlagen waren. Die zentralistische Struktur der KPD stand einer erfolgreichen Widerstandstätigkeit entgegen, die große personelle Fluktuation vor der nationalsozialistischen Machtübernahme ermöglichte es der Gestapo zudem, Spitzel in die Gruppen einzuschleusen. 1940/41 gelang es den entlassenen KZ-Häftlingen Bernhard Bästlein und Franz Jacob noch einmal, ein größeres Widerstandsnetz aufzubauen, das 300 Personen umfasst haben soll. In den 1940er Jahren entstanden weitere kommunistische Widerstandsgruppen in etlichen deutschen Städten. Gemeinsame Erfahrungen in Konzentrationslagern ermöglichten jetzt eine partielle Zusammenarbeit zwischen Kommunisten, Sozialdemokraten und anderen Widerständlern. Die neuen Gruppen wurden unter den Namen „Rote Kapelle“, Schulze-Boysen/ Harnack-Kreis oder als Baum-Gruppe bekannt, die sich um den jungen Berliner Juden Herbert Baum geschart hatte. Viele Mitglieder dieser Gruppen wurden verraten oder aufgespürt, festgenommen, gefoltert und hingerichtet. Auch in den Konzentrationslagern organisierten sich die Kommunisten in Widerstandsgruppen. KP-Führer Ernst Thälmann saß ohne Gerichtsverfahren elf Jahre in Gefängnissen und Konzentrationslagern ein, bis er am 17.8.1944 im KZ Buchenwald erschossen wurde. Kreisauer Kreis Diese 1940 gegründete Widerstandsgruppe trägt den Namen ihres Treffpunkts, des Guts Kreisau in Niederschlesien, das Helmuth James Graf von Moltke gehörte. Der Kreis bestand aus ca. 20 Aktiven und ebenso vielen Sympathisanten. Unter ihnen befanden sich Adlige und Bürgerliche, Sozialdemokraten und Angehörige beider christlicher Konfessionen. Sie diskutierten die grundlegende soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Neuordnung Deutschlands nach einem Sturz der NS-Diktatur. Sie strebten eine enge Verbindung von Kirche und Staat an; „kleine Gemeinschaften“ wie Familien, Betriebsgemeinschaften oder Kirchengemeinden sollten ein Bollwerk gegen eine manipulierbare Massengesellschaft bilden. Der Staatsaufbau sah direkte Wahlen einzelner Persönlichkeiten statt eines Parteiensystems vor. Mitglieder des Kreisauer Kreises suchten Kontakte zu anderen Widerstandsgruppen, so zum militärischen Widerstand und Organisationen in den besetzten Ländern Norwegen, Dänemark und den Niederlanden. Ab 1943 wuchs die Bereitschaft der Mitglieder, an einem Staatsstreich teilzunehmen. Als von Moltke im Januar 1944 verhaftet wurde, schlossen sich einige der Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg an und beteiligten sich an den Vorbereitungen des Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Etliche von ihnen wurden nach dessen Scheitern hingerichtet. Lodz, Getto (Getto „Litzmannstadt“) Die deutschen Besatzer benannten die polnische Stadt Lodz nach General Litzmann um, der sie im Ersten Weltkrieg erobert hatte. Sie richteten im jüdischen Armenviertel Baluty ein vier 225 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 226 Quadratkilometer großes Getto für 164 000 einheimische Juden ein. Im Oktober und November 1941 trafen mit 20 Großtransporten ca. 20 000 deutsche, österreichische und tschechische Juden ein, darunter jene 1034 Hamburger, die den Deportationsbefehl für den 25.10.1941 erhalten hatten. Weniger als 20 Hamburger sollen überlebt haben. 96 Arbeitsstätten, in denen über 90% der Bewohner arbeiteten, dienten meist der Textilproduktion, vor allem für die Wehrmacht. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Holzhäusern des Gettos, die weder Wasser- noch Abwasserleitungen hatten, waren menschenunwürdig, Hunger, Kälte und Seuchen forderten bereits in den ersten Monaten tausende Todesopfer (nicht nur) unter den deutschen Insassen. Zudem erwies sich das Getto als Durchgangsstation zum 70 km entfernten Vernichtungslager Kulmhof/Chelmno. Dort wurden zunächst über 4000 „Zigeuner“ und ca. 45 000 polnische Juden ermordet, bis im Mai 1942 auch ca. 10 000 Juden aus dem „Altreich“, die als nicht mehr arbeitsfähig galten, umgebracht wurden. Die verbliebenen deutschen Juden wurden bei Auflösung des Gettos im August 1944 nach Auschwitz transportiert, wo die meisten in den Gaskammern ermordet wurden. Ein kleinerer Teil wurde in Zwangsarbeiterlager verlegt. Logenhaus (Provinzialloge von Niedersachsen), Moorweide 36 Dieses Gebäude gehörte bis 1941 (und nach dem Krieg wieder) der Provinzial-Loge von Niedersachsen. Die Freimaurer-Vereinigung musste sich in der NS-Zeit auflösen und trug ab 1937 den Zusatz „in Liquidation“. Sie blieb allerdings bis 1941 als Eigentümerin des Anwesens im Grundbuch eingetragen, erst 1942 erschien dort die Stadt Hamburg. Dennoch nutzte die Gestapo das Haus von Oktober bis Dezember 1941 als Sammelstätte für die ersten vier Deportationen, durch die mehr als 3100 Hamburger Juden nach Lodz, Minsk und Riga verschleppt wurden. Dort fertigten Gestapo- und Finanzbeamte die zu Deportierenden ab, die einen Tag vor dem Transport hier erscheinen mussten. Sie und ihr Gepäck wurden kontrolliert und, nachdem sie im Logenhaus übernachtet hatten, am nächsten Tag zum Hannoverschen Bahnhof gefahren, wo sie den Zug ins Getto bzw. das Vernichtungslager bestiegen. Daran erinnert heute auch der Name des Geländes, „Platz der Deportierten“, sowie der Gedenkstein, den der Künstler Ulrich Rückriem 1982 entworfen hat. Minsk, Getto In Minsk, der Hauptstadt Weißrusslands, richteten die deutschen Besatzer ein etwa zwei Quadratkilometer großes Getto für ca. 100 000 einheimische Juden ein. Kurz bevor der erste Transport reichsdeutscher Juden dort am 11.11.1941 eintraf, erschoss die SS ca. 12 000 Juden, um „Platz zu schaffen“ für ein Sondergetto der Juden aus dem „Altreich“. Das Sondergetto stand kaum mit dem Hauptgetto in Verbindung. Von Hamburg aus gingen zwei Deportationen in das Getto von Minsk: am 8.11.1941 mit 968 Personen, von denen 952 ermordet wurden, und 18.11.1941 mit 407 Personen, von denen 403 ermordet wurden. Die Neuankömmlinge aus dem Deutschen Reich arbeiteten für die Wehrmacht, die SS oder die 226 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 227 Organisation Todt in Werkstätten, Lazaretts oder Außenkommandos. Fast alle, die Hunger, Kälte und Infektionskrankheiten in den folgenden eineinhalb Jahren überlebten, wurden in einem der Massaker am 8.5.1943 bzw. bei der Auflösung des Gettos am 14.9.1943 erschossen bzw. in Gaswagen ermordet. Wenige Arbeitsfähige wurden in andere Zwangsarbeitsbzw. Konzentrationslager verbracht. Mischehe, „privilegierte“ und „nichtprivilegierte“ Mit der Einführung der Zivilehe im 19. Jahrhundert konnten Juden auch nichtjüdische Partner heiraten. Anfang der 1930er Jahre lebten ca. 35 000 Juden (d. h. hier: Mitglieder jüdischer Gemeinden) in Mischehen im Deutschen Reich, davon die Mehrzahl Paare mit jüdischen Ehemännern. Bis 1938 trafen die antijüdischen Maßnahmen diese genau so wie andere Juden. Im Dezember 1938 schuf Hitler die Kategorien der „privilegierten“ und der „nichtprivilegierten“ Mischehe, die nie gesetzlich fixiert wurden. Als „privilegiert“ galten nun Paare, bei denen die Frau jüdisch (jetzt nicht mehr nach Mitgliedschaft in einer jüdischen Gemeinde, sondern im „rassischen“ Sinne des NS-Regimes) und der Mann nichtjüdisch war, wenn sie keine oder nichtjüdisch erzogene Kinder hatten und Paare, bei denen der Mann jüdisch und die Frau nichtjüdisch war, wenn sie nichtjüdisch erzogene Kinder hatten. Familien in diesen Konstellationen durften in der bisherigen Wohnung verbleiben, und das Vermögen konnte auf den nichtjüdischen Partner bzw. die Kinder übertragen werden. Später musste der jüdische Partner aus „privilegierter“ Mischehe keinen „Judenstern“ tragen und wurde von der Deportation (bis Jahresbeginn 1945) befreit. Als „nichtprivilegiert“ galten Paare, wenn der Mann Jude und die Ehe kinderlos war, wenn ein Ehepartner jüdisch war und die Kinder jüdisch erzogen wurden, oder wenn der nichtjüdische Partner bei der Eheschließung zum Judentum konvertiert war. Diese Paare besaßen die o. a. Rechte nicht, bei der Auswanderung wurden sie wie Juden behandelt. Der jüdische Partner unterlag der Kennzeichnungspflicht, von der Deportation wurde er/sie „zurückgestellt“. War eine Mischehe durch Scheidung oder Tod aufgelöst, wurde der jüdische Partner deportiert, meist nach Theresienstadt. Unabhängig vom Status der Ehe entfiel der Schutz vor Deportationen, wenn der jüdische Partner kriminalisiert wurde. Die „Schutzhäftlinge“ wurden dann nach Auschwitz deportiert. Bei Kriegsende lebten noch 12 000 Juden in Mischehe in Deutschland, davon 631 in Hamburg. „Mischlinge“ Nach den Ausführungsverordnungen der Nürnberger Gesetze galten „Halbjuden“, die nichtjüdisch erzogen waren, als „Mischlinge ersten Grades“. Gehörten sie allerdings einer jüdischen Gemeinde an, unterlagen sie als „Geltungsjuden“ allen antijüdischen Maßnahmen. Als „Mischlinge ersten Grades“ standen sie hingegen unter Sonderrecht: Sie durften keine pädagogischen, medizinischen, juristischen, künstlerischen Berufe ergreifen und nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt werden. Dafür standen ihnen technische und kaufmännische Berufe offen. 227 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 228 Universitäts- und Schulabschlüsse wurden ihnen erst erschwert, dann verwehrt. Der NS-Staat zog sie zunächst zur Wehrmacht ein, entließ sie dann jedoch wieder, es sei denn, sie hatten sich durch besondere Tapferkeit ausgezeichnet. „Mischlinge“ wurden nicht deportiert, es sei denn, sie saßen nach Oktober/November 1942 als Häftlinge in einem Gefängnis oder KZ ein. Im Deutschen Reich lebten 1939 ca. 8000 „Geltungsjuden“ und ca. 64 000 „Mischlinge ersten Grades“, davon in Hamburg 4428. In der NSDAP, insbesondere in der SS, versuchten die Rassefanantiker immer wieder, die Gleichbehandlung von „Mischlingen ersten Grades“ mit Juden einzuführen. Auf der Wannsee-Konferenz am 20.1.1942 und zwei folgenden „Endlösungskonferenzen“ erreichte die Gefährdung der Mischehen wie der „Mischlinge“ den Höhepunkt. Erstere sollten zwangsweise geschieden und der jüdische Partner deportiert werden, die „Mischlinge“ entweder sterilisiert oder deportiert werden. Doch eine Entscheidung wurde auf die Zeit nach dem Kriege verschoben, was ihr Leben rettete. Ab 1942 wurden die schulpflichtigen „Mischlinge ersten Grades“ von Haupt- und weiterführenden Schulen verwiesen, ab 1943/1944 die über 17-jährigen zur Zwangsarbeit eingezogen, teils in Lagern fernab ihrer Heimatorte. Novemberpogrom 1938 („Reichskristallnacht“ 9./10.11.1938) In der Nacht vom 9./10.11.1938 wurden in Hamburg unzählige jüdische Geschäfte, Arztoder Anwaltspraxen und mindestens fünf Synagogen und Betstuben demoliert. Reichsweit wurden ca. 30 000 Juden verhaftet, in Hamburg waren es zwischen 800 und 1000, die über das „Kolafu“, das Gefängnis Hütten oder kleinere Sammelstätten in das Konzentrationslager Sachsenhausen transportiert wurden. Eine nicht bekannte Zahl jüdischer Häftlinge starb während der brutalen Behandlung dort. Die meisten wurden bis August 1939 entlassen, wenn sie Auswanderungsvorbereitungen nachweisen konnten. „Rassenschande“ Das „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ vom 15.9.1935 verbot Juden, Mischehen einzugehen und stellte außerehelichen Sexualverkehr unter Gefängnis- bzw. Zuchthausstrafe. Nach Hitlers Vorgaben sollte der beteiligte Mann bestraft werden. Das Gesetz rief unzählige Denunzianten auf den Plan, tausende Verfahren wurden eingeleitet. Zwischen 1935 und 1945 wurden ca. 2000 jüdische und nichtjüdische Männer verurteilt, die Juden unter ihnen nach Strafverbüßung oftmals in „Schutzhaft“ genommen und deportiert. Eine nicht bekannte Anzahl jüdischer Frauen wurde ohne Gerichtsverfahren in Konzentrationslager eingeliefert und von dort – nach Oktober/November 1942 – in Vernichtungslager überstellt. Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, siehe DIGH 228 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 229 Riga, Getto Nachdem die deutsche Wehrmacht Riga am 1.7.1941 besetzt hatte, ermordete sie tausende lettischer Juden. Im August richteten die deutschen Besatzer im „Moskauer Viertel“ ein Getto von 9000 Quadratmetern für ca. 30 000 einheimische Juden ein. Bevor der erste reichsdeutsche Transport eintraf, wurden 27 500 Gettobewohner am „Rigaer Blutsonntag“ (30.11. 1941) und am 8.12.1941 erschossen, um für die Neuankömmlinge „Platz zu schaffen“. Insgesamt 20 Transporte von deutschen, österreichischen und tschechischen Juden trafen zwischen November 1941 und Februar 1942 im Gebiet um Riga ein. Aus Hamburg wurde am 6.12.1941 ein Transport mit 753 Personen (von denen 726 umkamen), der eigentlich nach Minsk gehen sollte, dorthin geschickt. Als die Hamburger Juden, unter ihnen Oberrabbiner Joseph Carlebach, im Zielgebiet eintrafen, war die zweite Erschießungsaktion noch nicht beendet. Deshalb wurden sie in das sechs Kilometer entfernte Gut Jungfernhof gebracht. Dieses heruntergekommene Anwesen bestand aus einem Gutshaus, drei Holzscheunen, fünf kleinen Häusern und Viehställen, wo knapp 4000 Menschen (außer den Hamburgern Transporte aus Nürnberg, Stuttgart und Wien) zusammengepfercht wurden. 1700 bis 1800 von ihnen wurden im März 1942 in der „Aktion Dünamünde“ erschossen, 200 Frauen und ein Teil der übrigen wurden nach und nach in das Getto Riga eingewiesen. Ein Teil der Männer zwischen 16 und 50 Jahren wurde in das 18 km vor Riga gelegene Zwangsarbeiterlager Salaspils eingeliefert, das nur die wenigsten überlebten. Ab Sommer 1944 wurden die jüdischen Häftlinge aus dem baltischen Raum Richtung Deutschland zurückverlegt, Hauptziel war das KZ Stutthof bei Danzig. Von dort aus gelangten Frauen nach Neuengamme bei Hamburg, männliche Häftlinge nach Buchenwald, andere nach Auschwitz, Sachsenhausen, Dachau, Mauthausen, Natzweiler. Vereinzelte Häftlinge aus Riga befanden sich dann in den Kolonnen der Todesmärsche, die diese Lager im April 1945 verließen. „Schutzhaft“ Bereits vor 1933 konnte die Polizei eine Person, angeblich zum eigenen Schutz, für 24 Stunden festhalten. Ab 4.2.1933 erlaubte es eine „Verordnung zum Schutze des deutschen Volkes“, einen Verdächtigen bis zu drei Monaten in Haft zu nehmen, zwei Wochen später entfiel diese zeitliche Begrenzung. „Schutzhaft“ wurde zu einem Instrument, das ab 1938 allein der Gestapo zur Verfügung stand, um jenseits aller Rechtswege missliebige Personen in Konzentrationslager einzuweisen und den Zeitpunkt ihrer Entlassung zu bestimmen. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme richtete sich diese Maßnahme zunächst gegen politische Gegner, später verstärkt gegen Juden, Homosexuelle, „Arbeitsbummelanten“, ausländische Zwangsarbeiter und andere. Insbesondere nach Kriegsbeginn gaben unzählige Erlasse des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin den Gestapostellen vor, bei welchen „Delikten“ sie Verhaftungen vornehmen sollten. Das Schutzhaftreferat des Reichssicherheitshauptamtes koordinierte die Maßnahmen, d. h. es genehmigte Verhaftungen und ordnete Verlegungen an. 229 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 230 Betrafen die „Schutzhaftsachen“ jüdische Häftlinge, wurden sie in Eichmanns Judenreferat bearbeitet. Verhaftete ein Gestapobeamter einen Juden, kam dieser zunächst in das örtliche Polizeigefängnis oder Konzentrationslager (in Hamburg ins „Kolafu“). Dann beantragte der Stapostellenleiter in Berlin die Einweisung in eines der großen Konzentrationslager, was im Regelfall bewilligt wurde. Im November 1942 verfügte ein Erlass, die Konzentrationslager im Deutschen Reich „judenfrei“ zu machen und die dort einsitzenden Juden nach Auschwitz zu überstellen. Da zu diesem Zeitpunkt ein Großteil der deutschen Juden bereits deportiert worden war, betraf diese Bestimmung insbesondere die in Mischehen lebenden Juden. Sie gab der Gestapo die Möglichkeit, hunderte Juden in „Schutzhaft“ zu nehmen und in die Gaskammern nach Auschwitz zu schicken. Genaue Zahlen sind nicht bekannt. Sicherungsanordnung Ab Januar 1937 erhielten die Devisenstellen beim Oberfinanzpräsidenten die Befugnis, beim Verdacht von Vermögensverschiebungen die Konten der betroffenen Juden zu sperren. Verfügungen von diesen Konten durften nur mit Genehmigung des Oberfinanzpräsidenten erfolgen. Dieses Prinzip wurde später ausgeweitet. Während Steuern und Abgaben direkt abgebucht werden konnten, mussten betroffene Juden ihre regelmäßigen Kosten für den Lebensunterhalt detailliert nachweisen und sich bewilligen lassen, dass sie monatlich über diese Summe von ihrem Konto verfügen durften. Sonderausgaben wurden extra beantragt. „Sühneleistung“, Judenvermögensabgabe Nach dem Novemberpogrom 1938 erlegte Hermann Göring den deutschen Juden eine Kollektivstrafe von 1 Milliarde Reichsmark „Sühneleistung“ für die Schäden auf. Auf der Grundlage ihrer Vermögenserklärungen wurden alle Juden, die mehr als 5000 RM besaßen, zur Zahlung in vier (später: fünf) Raten im Jahr 1939 herangezogen, so dass die tatsächlich eingezogene Summe 1,2 Milliarden RM betrug. Theresienstadt, Getto Schon bei den ersten Deportationen von Oktober bis Dezember 1941 ordnete das Reichssicherheitshauptamt an, über 65-jährige oder gebrechliche Juden über 55 Jahre, solche mit Kriegsauszeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg, ausländische Juden, solche aus Mischehen oder „Halbjuden“, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Jüdischen Gemeinde als „Geltungsjuden“ behandelt wurden, zunächst zurückzustellen. Für sie sollte das eigentlich für tschechoslowakische Juden vorgesehene Getto Theresienstadt zum „Altersgetto“ erweitert werden. Später wurden dort auch Niederländer, Dänen und etliche deutsche oder österreichische Prominente eingewiesen, die unter dem Schutz hochrangiger Nationalsozialisten standen. So gelangten insgesamt ca. 141 000 Menschen in die kleine Festungsstadt, ca. 88 000 wurden in Vernichtungslager weiterdeportiert, 33 000 starben in Theresienstadt, ca. 16 800 erlebten dort die Befreiung. Unter den 50 000 deutschen Gettobewohnern befanden sich 2490 Ham230 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 231 burger, die mit 11 Transporten zwischen dem 15.7.1942 und dem 14.2.1945 dorthin gebracht worden waren. Die überwiegend älteren Menschen, die vor der Abreise in einem sog. Heimeinkaufsvertrag ihr restliches Vermögen für diese Unterbringung hatten abtreten müssen, starben meist schnell an Hunger, Kälte, Krankheiten oder Seuchen. Nur für jüngere, kräftigere war die Überlebenschance hier höher als an anderen Deportationszielorten. Aus den Transporten bis 1944 überlebten ca. 220 Hamburger, und von den erst zu Jahresbeginn 1945 angelangten 213 Hamburgern aus Mischehen wurden 209 befreit. Treblinka, Vernichtungslager Zwischen Mai und Juli 1942 errichtete die SS das 400 m breite und 600 m lange Vernichtungslager in einem wenig besiedelten, dicht bewaldeten Gebiet nahe der Eisenbahnstrecke Warschau-Bialystok. In einem abgetrennten Teil lag ein Backsteingebäude mit drei Gaskammern von je 4 x 4 m Größe. Ein Dieselmotor erzeugte in einem angrenzenden Schuppen das Kohlenmonoxyd, das durch Röhren in die als Duschräume getarnten Gaskammern geleitet wurde. Die Leichen wurden in zwei großen Gruben beerdigt. Insgesamt – so Schätzungen – sollen 870 000 Juden aus div. Ländern hier ermordet worden sein, darunter 8000, die aus Theresienstadt weiterdeportiert worden waren. USPD (Unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands) Aus Opposition gegen den Pro-Kriegskurs ihrer Partei gründeten sozialdemokratische Abgeordnete 1917 die USPD. In dieser heterogenen Gruppe arbeiteten Marxisten, Reformer und ein linker, revolutionär ausgerichteter Flügel um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zusammen. Das einigende Hauptziel war die Beendigung des Krieges. Das Bündnis hielt nicht lange. Während die USPD mit der SPD Regierungsverantwortung übernahm, gründete der linke Flügel zusammen mit anderen sozialistischen Gruppierungen im Januar 1919 die KPD. Bei der Reichstagswahl 1920 erfuhr die USPD ihre größte Zustimmung mit 17,1% der Wählerstimmen.1920 verließen die meisten Mitglieder die USPD, um sich der KPD oder wieder der SPD anzuschließen, die restliche USPD existierte als Splittergruppe weiter. Die Mitgliederzahl spiegelt diesen Prozess: Sie betrug im November 1918 ca. 100 000 Personen, stieg bis September 1920 auf ca. 894 000 und sank in der Folge auf 291 000 im Jahr 1922 und 10 000 im Jahr 1925. Bei Wahlen erzielte sie nur noch 0,33% (1924) und schließlich 0,03% im Jahr (1930). Vermögenseinziehung Schon mit dem „Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit“ und dem über die „Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens“ konnte das Vermögen (nicht nur) von Juden zugunsten des Deutschen Reiches eingezogen werden. Mit der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25.11.1941 wurde das Verfahren vereinfacht: Lag der „gewöhnliche Aufenthalt“ eines Juden im Ausland, konnte der deutsche Staat sich sein Vermögen aneignen. Dies traf auf Emigranten wie Deportierte zu. 231 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 232 Westerbork, Durchgangslager in den besetzten Niederlanden Das Lager wurde 1939 von der niederländischen Regierung eingerichtet, um illegal eingewanderte jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. Nach der deutschen Besetzung diente es von 1941 bis 1944 als Durchgangslager für Juden, die in den Osten deportiert werden sollten. Über Westerbork wurden ab Juli 1942 ca. 98 000 Juden nach Auschwitz, Sobibor, Theresienstadt und Bergen-Belsen transportiert, darunter auch deutsche Juden, die in die Niederlande geflüchtet waren. Zionistische Bewegung Ziel der zionistischen Bewegung, deren deutsche Sektion (ZVfD = Zionistische Vereinigung für Deutschland) sich 1897 gründete, war die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina. Innerhalb der zionistischen Bewegung existierten religiöse wie säkulare Strömungen nebeneinander. Ihre Gruppierungen kandidierten für die Gremien der Jüdischen Gemeinden, und sie betrieben Kinder- und Jugendarbeit. Dazu gehörten Wander- und Turngruppen („BlauWeiss“ und „Bar-Kochba“), literarische Vereinigungen und eine Frauengruppe. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme erhielten die zionistischen Gruppen starken Zulauf. Sie förderten die Palästina-Emigration durch Hachschara-Zentren, Spendensammlungen und Sprachkurse. In Hamburg gehörten rd. 1000 Personen zionistischen Gruppen an. Die ZVfD wurde 1938 aufgelöst. Ihre Arbeit konnte sie aber bis 1941 fortführen, da die Emigration der deutschen Juden mit den Zielen des Nationalsozialismus übereinstimmte. 232 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 233 Beate Meyer Zeitleisten Zeitleiste der antijüdischen Maßnahmen oder Aktionen* 01.04.1933 Boykott jüdischer Geschäfte sowie Aktionen gegen Ärzte und Anwälte. 07.04.1933 Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ermöglicht die Entlassung „nichtarischer“ Beamter. 1933/34 Übernahme des „Arierparagraphen“ in Berufsvereinigungen, bei den Kammern, Turn- und Sportvereinen, der Wehrmacht, bei Studienabschlüssen etc. führt zum Ausschluss von Juden aus Berufen, Wirtschaftszweigen oder verhindert Studien- und Berufsabschlüsse. 15.09.1935 Die Nürnberger Gesetze verbieten die Eheschließung von Jüdinnen/Juden mit nichtjüdischen Partnern und stellen den außerehelichen Sexualverkehr zwischen Jüdinnen/Juden und nichtjüdischen Partnern unter Strafe („Rassenschande“); sie verbieten Juden die Beschäftigung von nichtjüdischen Hausgehilfinnen unter 45 Jahren und das Hissen der Reichs- und Nationalflagge. In den Ausführungsverordnungen wird Juden das Wahlrecht und die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, aberkannt. Andere Regelungen betreffen die „Mischlinge ersten und zweiten Grades“ (siehe Glossar). 1936/37/38 Weiterer Ausschluss von Juden oder mit Jüdinnen/Juden Verheirateten aus Berufen, Ausbildungsgängen usw.; Erschwerung der Auswanderung durch Verschärfung der finanziellen Bestimmungen. 26.04.1938 Juden müssen ihr Vermögen anmelden, wenn es mehr als 5000 RM beträgt. Juni 1938 Während der „Juni-Aktion“ werden reichsweit „Asoziale“ verhaftet und in Konzentrationslager gebracht, darunter ca. mehrere tausend Juden (in Hamburg 200 von 700 Verhafteten insgesamt). 23.07.1938 Juden müssen ab 1. Januar 1939 eine Kennkarte bei sich führen. 25.07.1938 Jüdischen Ärzten wird die Approbation ab 30. September 1938 aberkannt; in Ausnahmefällen werden sie als „Krankenbehandler“ für jüdische Patienten zugelassen. 05.10.1938 Einziehung der Reisepässe und Kennzeichnung mit einem „J“. 28.10.1938 Zwischen 12 000 bis 17 000 Juden polnischer Herkunft werden über die Grenze nach Polen abgeschoben. * Diese Aufstellung enthält nur einen Teil der antijüdischen Maßnahmen, weitere Informationen finden Sie u. a. bei Joseph Walk, Das Sonderrecht für die Juden im NS-Staat. Eine Sammlung der gesetzlichen Maßnahmen und Richtlinien, Heidelberg 1981. 233 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 234 07.11.1938 Der 17-jährige Herschel Grynszpan, dessen Eltern von der Abschiebung der polnischen Juden betroffen waren, schießt in Paris auf den deutschen Legationsrat Ernst vom Rath. 9./10.11.1938 Vom Raths Tod dient der NSDAP als Vorwand, einen reichsweiten Pogrom anzuzetteln, der als „spontaner Volkszorn“ ausgegeben wird; 26 000 bis 30 000 männliche Juden werden verhaftet und in Konzentrationslager eingewiesen. 12.11.1938 Göring ordnet an, die Juden müssten kollektiv eine „Sühneleistung“ von 1 Milliarde Reichsmark aufbringen. Außerdem müssen Juden alle Schäden des Pogroms selber tragen. 15.11.1938 Jüdische Kinder müssen jüdische Schulen besuchen. Jüdische Geschäfte und Gewerbebetriebe müssen „arisiert“ oder geschlossen werden. 30.11.1938 Jüdische Rechtsanwälte dürfen nicht mehr tätig sein, nur in Ausnahmefällen werden sie als „jüdische Konsulenten“ für Juden zugelassen. 01.01.1939 Juden müssen die Zwangsnamen „Israel“ und „Sara“ führen (wenn sie nicht einen zugelassenen „jüdischen Namen“ tragen). 17.01.1939 Jüdische Zahnärzte, Apotheker und Tierärzte verlieren ihre Zulassungen. 30.04.1939 Das Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden nimmt Juden den Mieterschutz und bereitet ihre Zusammenlegung in „Judenhäusern“ vor. September 1939: Anlässlich des Kriegsbeginns wird über Juden eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, sie müssen in besonderen Lebensmittelgeschäften einkaufen, ihre Rundfunkgeräte abgeben und Zwangsarbeit leisten; polnische Juden werden in Konzentrationslagern inhaftiert. 1940 bis Frühjahr 1941: Erste Deportationen von Juden aus Stettin, Pommern, Baden, der Pfalz und dem annektierten Österreich. 01.09.1941 Erlass: Ab 19.09. müssen Juden vom 6. Lebensjahr an den „Judenstern“ tragen; sie dürfen öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr benutzen, es sei denn, sie erhalten als jüdische Zwangsarbeiter eine Genehmigung. Oktober 1941 Die systematischen Deportationen aus dem „Altreich“ beginnen, gleichzeitig ergeht ein Verbot auszuwandern; Verordnung, nach der das Vermögen deportierter Juden dem Deutschen Reich verfällt; nichtjüdischen Personen, die Juden helfen, droht ein Erlass des Reichssicherheitshauptamtes „Schutzhaft“ an. Oktober 1941 bis Januar 1942: Noch nicht deportierte Juden müssen weiter Zwangsarbeit leisten; sie müssen Schreibmaschinen, Fahrräder, Fotoapparate, Wollsachen, Pelze, Skier und Bergschuhe u. a. abgeben. Juden werden in „Judenhäusern“ konzentriert. 20.01.1942 234 Auf der Wannsee-Konferenz, die eigentlich im Dezember 1941 hätte stattfinden sollen, koordinieren die Vertreter der Reichsbehörden und der SS die Ermordung der europäischen Juden. 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 235 13.03.1942 Wohnungen von Juden müssen mit einem Stern auf weißem Papier gekennzeichnet werden. 02.06.1943 bis April 1945: Juden über 65 Jahre, verwitwete oder geschiedene jüdische Partner aus Mischehen, Juden, die während des Ersten Weltkrieges Auszeichnungen erhalten haben und Prominente werden in das Konzentrationslager/ Getto Theresienstadt deportiert, das sich für viele als Durchgangsstation in Vernichtungslager erweist. Tausende sterben an Hunger, Kälte und Krankheiten in Theresienstadt selbst. 27.02.1943 Beginn der „Fabrik-Aktion“, während derer ca. 11 000 jüdische Zwangsarbeiter und andere noch im „Altreich“ verbliebene Juden verhaftet und – wenn sie nicht in Mischehen lebten – deportiert werden. Nach dieser „Aktion“ befinden sich keine „Volljüdinnen/Volljuden“ mehr in Deutschland (ausgenommen Mischehepartner). Januar bis April 1945: Der Schutz der Mischehe entfällt: Mehr als 2000 Personen werden nach Theresienstadt deportiert, obwohl sowjetische Truppen bereits Majdanek (20.07.44), Auschwitz (27.01.45) und die US-Truppen Buchenwald (11.04.45) befreit haben. 08.05.1945 Die deutsche Wehrmacht kapituliert. Zeitleiste „Euthanasie“* Am 14. Juli 1933 wird das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ verabschiedet, das ab 01.01.1934 in Kraft tritt. Ohne Einwilligung der Betroffenen sollen „Schwachsinnige“, Schizophrene, Manisch-Depressive, Epileptiker, Personen, bei denen Blindheit, Taubheit, Kleinwüchsigkeit, spastische Lähmungen, Muskeldystrophie, Missbildungen an Fingern, Füßen und Hüften als erblich diagnostiziert worden sind, und Personen, denen schwerer Alkoholismus angelastet wird, von Ärzten und anderen Angehörigen medizinischer Berufe gemeldet und nach Entscheidung eines Erbgesundheitsgerichts sterilisiert werden. 18.08.1939 Erlass zur Erfassung behinderter Kinder 21.09.1939 Erfassung der Heil- und Pflegeanstalten, die ersten Tötungen von mehreren tausend Patienten in Westpreußen Oktober 1939 Hitler unterschreibt die „Euthanasie“-Ermächtigung und datiert sie auf den Kriegsbeginn (01.09.39) zurück; die vorbereitete „Aktion T4“ läuft an. Oktober–Dezember 1939: Überall im Land werden Kinder und erwachsene Patienten erfasst und getötet. * Zusammengestellt aus: Ernst Klee, „Euthanasie“ im NS-Staat. Die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“, Frankfurt/M. 1983; Henry Friedlander, Der Weg zum NS-Genozid. Von der Euthanasie zur Endlösung, Berlin 1997; Klaus Böhme/Uwe Lohalm (Hrsg.), Wege in den Tod. Hamburgs Anstalt Langenhorn und die Euthanasie in der Zeit des Nationalsozialismus, Hamburg 1993. 235 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 236 Dezember 1939–Juni 1940: Gaswagen werden eingesetzt, die Tötungsanstalten Brandenburg, Grafeneck, Hartheim und Sonnenstein eingerichtet. Juli 1940 Jüdische Geisteskranke werden nun gesondert gesammelt und die ersten in Brandenburg getötet; später werden jüdische Patienten in der Heil- und Pflegeanstalt Bendorf-Sayn konzentriert. Juli/August 1940 bis August 1941: Etliche Geistliche und der Mediziner Sauerbruch protestieren gegen den Krankenmord; die Bischofskonferenz verbietet den kirchlichen Mitarbeitern, aktiv beim Abtransport mitzuwirken; Kirchen verhandeln, auf welchen Personenkreis „Euthanasie“ begrenzt werden soll; parallel werden die Tötungsanstalten umorganisiert: Bernburg löst Brandenburg ab, Hadamar löst Grafeneck ab. 24.08.1941 Offizieller Stopp der „Euthanasie“ aus außen- und innenpolitischen Gründen, Hadamar beendet Vergasungen, doch Tötungen gehen als Aktion „14 f 13“ weiter, vorzugsweise nun durch Medikamente bzw. Hunger (z. B. Tiegenhof und Meseritz-Obrawalde 16 000 Tote). November 1941–Juli 1942: Das im massenhaften Mord geschulte Personal der Tötungsanstalten wird in die Vernichtungslager Belzec, Sobibor oder Treblinka versetzt. Frühjahr bis Herbst 1942: Die jüdischen Geisteskranken aus Berlin und Bendorf-Sayn werden den systematischen Deportationen angeschlossen; alle Psychiatriepatienten müssen gemeldet werden. 1943 Massenverlegung Kranker in die Ostgebiete und nach Österreich zur Tötung 27.04.1943 „14 f 13“ wird beendet, die potentiell Betroffenen sollen stattdessen zur Arbeit eingesetzt werden; Ärzte bekommen weiter Einzelerlaubnis zur Tötung von Kranken. April 1944 Zweite Phase von „14 f 13“ beginnt, bis März/April 1945 werden Kranke getötet. Reichsweit wurden mehr als 150 000 deutsche Patienten getötet, die Zahl derer aus den besetzten Ostgebieten ist nicht bekannt. Aus Hamburgs einziger staatlicher Anstalt für Geisteskranke in Langenhorn wurden ca. 4000 Patienten verlegt, von denen mehr als 70 % ermordet wurden. Zeitleiste der politischen Verfolgung* 1933 30.01. Ernennung Hitlers zum Reichskanzler 02.02. Demonstrationsverbot für die KPD in Preußen und fünf weiteren Ländern * Ausführlicher siehe Ursula Büttner/Werner Jochmann (Hrsg.), Zwischen Demokratie und Diktatur. Nationalsozialistische Machtaneignung in Hamburg – Tendenzen und Reaktionen in Europa, Hamburg 1984. 236 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 237 27.02. Reichstagsbrand 28.02. Verordnungen des Reichspräsidenten zum „Schutze von Volk und Staat“ und gegen „hochverräterische Umtriebe“: die Verfolgung der KPD beginnt. 01.03. Fünf Hamburger KPD-Funktionäre werden verhaftet, ihre Publikationen, Versammlungen usw. sind verboten. 02./03.03. Erste Schritte gegen Hamburger Sozialdemokraten, der sozialdemokratische Chef der Ordnungspolizei und sozialdemokratische Polizeioffiziere werden beurlaubt, das „Hamburger Echo“ wird 14 Tage verboten. 05.03. Reichstagswahl, in Hamburg gewinnt die NSDAP 38,8 % und die mit ihr verbündete DNVP 8 % der Stimmen. 08.03. Die Bürgerschaft wählt einen Koalitionssenat (sechs Mitglieder der NSDAP, vier der „Kampffront Schwarz-Weiß-Rot“, drei der DVP und der Staatspartei). 14.03. Ernennung des Reichstagsabgeordneten der NSDAP Hans Nieland zum Hamburger Polizeipräsidenten, Verbot des „Hamburger Echos“ wird zunächst 14 Tage, dann auf unbestimmte Zeit verlängert. 20.03. Aufstellung einer Hilfspolizei aus SA, SS und „Stahlhelm“-Mitgliedern von mehr als 300 Männern. 23.03. Das „Ermächtigungsgesetz“ wird verabschiedet. 24.03. Das „Kommando z. b. V.“ wird aufgestellt, das Aktionen gegen politische Gegner durchführt (am 04.01.1934 wird es aufgelöst). 29.03. Der Senat untersagt allen Beamten, Angestellten und Arbeitern in hamburgischen Diensten die Mitgliedschaft in „marxistischen“ Parteien. 31.03. Das „wilde“ Konzentrationslager Wittmoor wird eingerichtet. März/April 1933: Parteien und Verbände schalten sich gleich oder lösen sich auf. 10.05. Das Vermögen der SPD und des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold wird beschlagnahmt; aus Protest bleibt die SPD der Bürgerschaftssitzung fern. 11.05. Der Hamburger SPD-Reichstagsabgeordnete Adolf Biedermann wird bei Recklinghausen tot aufgefunden. 16.05. NSDAP-Gauleiter Karl Kaufmann wird zum Reichsstatthalter Hamburgs ernannt; in den folgenden Tagen treten die Senatoren der Staatspartei und DNVP zurück bzw. zur NSDAP über, sechs sozialdemokratische Abgeordnete treten aus ihrer Fraktion aus und hospitieren bei der NSDAP. 16.06. Die Staatspolizei verhaftet 30 führende SPD-Mitglieder, am 21.06.33 folgt das Betätigungsverbot für die SPD im gesamten Deutschen Reich; am 26.06.33 löst sich die Staatspartei auf, am 27.06.33 die DNVP, am 04./05.07.33 die DVP und die Zentrumspartei; bis Juli 1933 sind in Hamburg ca. 2400 Kommunisten festgenommen. 14.07. Nach dem Gesetz über die Neubildung der Parteien ist die NSDAP die einzige zugelassene Partei in Deutschland. 237 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 238 04.09. Einrichtung des Konzentrationslagers Fuhlsbüttel im ehemaligen Frauengefängnis; SA-Standartenführer Paul Ellerhusen wird zum Kommandanten ernannt. 17.10. Auflösung des KZs Wittmoor, Überführung der Häftlinge nach Fuhlsbüttel. 20.10. SS-Sturmbannführer Bruno Streckenbach wird zum Leiter der Staatspolizei Hamburg ernannt. Januar bis Juli 1934: Die Gestapo zerschlägt die neuorganisierten KPD-Widerstandsgruppen und nimmt 650 Personen fest; weitere 3000 sollen in Hamburg aktiv sein; bis 1936 sind die KPD-Strukturen weitgehend zerschlagen. 1933–1937: Ehemalige Reichsbanner-Mitglieder gründen Widerstandsgruppen, die 1934/35 zerschlagen werden; lediglich eine kann sich bis 1937 halten, dann werden ihre über 100 Mitglieder verhaftet. Jüngere Sozialdemokraten um Walter Schmedemann organisieren sich in etlichen Arbeiterstadtteilen. 1934/35 werden 150 Beteiligte vor Gericht gestellt, auch die Mitglieder ihrer Nachfolgeorganisationen werden schnell verhaftet, so dass Mitte 1935 der sozialdemokratische Widerstand weitgehend zerschlagen ist. Bis 1936 können die konspirativen Gruppen des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes ihre Widerstandsarbeit fortsetzen, dann werden sie bis 1937 reichsweit verhaftet, in Hamburg ca. 30 Personen. 1940/41 Die aus dem KZ Sachsenhausen entlassenen Kommunisten Bernhard Bästlein, Robert Abshagen und Franz Jacob knüpfen Kontakte, aus denen neue KPDWiderstandsgruppen hervorgehen, an denen ca. 300 Personen beteiligt sind. Zeitleiste der Verfolgung homosexueller Männer* 24.10.1934 Anordnung von Heinrich Himmler an alle Polizeidienststellen, eine „namentliche Liste sämtlicher Personen, die sich irgendwie homosexuell betätigt haben“, für das Geheime Staatspolizeiamt Berlin anzufertigen. Dort wird Ende Oktober 1934 ein Sonderdezernat „Homosexualität“ eingerichtet. 26.06.1935 Die Änderung des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ ermöglicht auch die „kriminalpolitisch indizierte Kastration“ homosexueller Männer. Fortan entscheiden sich viele verurteilte Homosexuelle für eine sogenannte freiwillige Entmannung, um der Verschleppung in ein Konzentrationslager zu entgehen. 28.06.1935 Verschärfung des aus dem Strafgesetzbuch des Deutschen Reichs von 1871 stammenden § 175 und Einführung des § 175 a: Ein Nachweis homosexueller Handlung entfiel (siehe auch Glossar). Nach § 175 a konnten homosexuelle * Weiteres ist nachzulesen in: Bernhard Rosenkranz/Ulf Bollmann/Gottfried Lorenz: HomosexuellenVerfolgung in Hamburg 1919–1969, Hamburg 2009. 238 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 239 Handlungen zwischen einem Mann von über einundzwanzig Jahren mit einer männlichen Person von unter 21 Jahren und u. a. auch männliche Prostitution mit einer Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren geahndet werden. 10.10.1936 Errichtung der Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und der Abtreibung zur „zentralen Erfassung“ und „wirksamen Bekämpfung“ der beiden „Volksseuchen“. Sommer 1936 Das Berliner Gestapo-Sonderkommando übernimmt von Altona aus in Hamburg die Verfolgung der Homosexuellen und führt „Säuberungsaktionen“ in Lokalen und Großbetrieben wie den Hamburgischen Electricitäts-Werken (HEW) und dem Warenhaus Tietz (1935 von den Nationalsozialisten in Alsterhaus umbenannt) durch. 12.07.1940 Anordnung von Heinrich Himmler: Homosexuelle, die nach § 175 verurteilt und mehr als einen Partner „verführt“ haben, sind „nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis in polizeiliche Vorbeugehaft zu nehmen“. Das heißt, sie werden in Konzentrationslager verschleppt und müssen dort in der Regel den „Rosa Winkel“ tragen. 15.11.1941 Hitler ordnet im „Erlass des Führers zur Reinhaltung von SS und Polizei“ an, für homosexuelle Handlungen durch Angehörige von SS und Polizei die Todesstrafe zu verhängen. 1942 In Konzentrationslagern werden Zwangskastrationen erlaubt. 19.05.1943 General Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, erlässt die „Richtlinien für die Behandlung von Strafsachen wegen widernatürlicher Unzucht“. Danach kann in „besonders schweren Fällen“ die Todesstrafe verhängt werden. 1944 Im KZ Buchenwald führt der dänische SS-Arzt Carl Vaernet medizinische Experimente an Homosexuellen durch. 08.05.1945 Kriegsende. Befreiung der Konzentrationslager. Der § 175 StGB wird erst 1998 abgeschafft; am 17.05.2002 werden nur die Urteile aus der NS-Zeit nach den §§ 175 und 175 a StGB aufgehoben. – Bernhard Rosenkranz/Ulf Bollmann 239 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 240 Quellen Abkürzungen AB Adressbuch (plus Jahreszahl u. Bd.) AfW Amt für Wiedergutmachung (plus Aktennummer) BA Bundesarchiv DIGH Deutsch Israelitische Gemeinde Hamburg DP Displaced Person FZH/WdE Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg/Werkstatt der Erinnerung Gestapo Geheime Staatspolizei HJ Hitlerjugend IGdJ Institut für die Geschichte der deutschen Juden ITS International Tracing Service (Internationaler Suchdienst) Kola-Fu Konzentrationslager Fuhlsbüttel KPD Kommunistische Partei Deutschlands NDR Norddeutscher Rundfunk NS Nationalsozialismus NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei o. D. ohne Datum OFP Oberfinanzpräsident OHG Offene Handels Gesellschaft RA Rechtsanwalt RM Reichsmark SA „Sturmabteilung“ der NSDAP SD Sicherheitsdienst der SS SS „Schutzstaffel“ der NSDAP StaHH Staatsarchiv Hamburg (plus Signatur) USHMM United States Holocaust Memorial Museum VVN Verein der Antifaschisten und Verfolgten des Naziregimes Z. H. G. Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte Nummerierungen häufig genutzter Quellen 1. Staatsarchiv Hamburg, 552-1, Jüdische Gemeinden, 992b, Kultussteuerkartei der Deutsch-Israelitischen Gemeinde Hamburg 2. Staatsarchiv Hamburg, 314-15, Akten des Oberfinanzpräsidenten 3. Institut Theresienstädter Initiative/Nationalarchiv Prag, Jüdische Matriken, 240 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 241 Todesfallanzeigen 4. Hamburger jüdische Opfer des Nationalsozialismus. Gedenkbuch, Veröffentlichung aus dem Staatsarchiv Hamburg Bd. XV, bearbeitet von Jürgen Sielemann unter Mitarbeit von Paul Flamme, Hamburg 1995 5. Gedenkbuch. Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933–1945, Bd. I-IV, herausgegeben vom Bundesarchiv Koblenz, Koblenz 2006 6. Wolfgang Scheffler/Diana Schulle (Hg.), Buch der Erinnerung. Die ins Baltikum deportierten deutschen, österreichischen und tschechoslowakischen Juden, Bd. 1 und Bd. 2, München 2003. 7. Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942–1945, Prag 2000 8. Yad Vashem, The Central Database of Shoah Victims, Names www.yadvashem.org Archive und sonstige Archivalien Arbeitsstelle und Bibliothek für Universitätsgeschichte Archiv der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes (VVN), Landesverband Hamburg Archivum Panstwowe, Lodz (Ghetto-Archiv und Internet-data-base) Bezirksamt Hamburg-Nord, Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt, Fachbereich Bauprüfung Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg Hamburger Bildarchiv Israelitische Kulturvereinigung in Württemberg und Hohenzollern ITS – International Tracing Service Arolsen KZ-Gedenkstätte Neuengamme Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Abt. I –Entschädigungsbehörde, Berlin Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Landesarchiv Schleswig-Holstein Staatsarchiv Hamburg – StaHH: StaHH 121-3, Bürgerschaft I StaHH 213-8 Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht – Verwaltung StaHH 213-9, Staatsanwaltschaft Oberlandesgericht StaHH 213-11, Staatsanwaltschaft Landgericht – Strafakten StaHH 213-13, Landgericht Wiedergutmachung StaHH 214-1, Gerichtsvollzieherwesen StaHH 221-5, Verwaltungsgericht StaHH 231-7, Amtsgericht Hamburg – Handels- und Genossenschaftsregister StaHH 242-1 II, Gefängnisverwaltung II StaHH 314-15, Oberfinanzpräsident Hamburg, Devisenstelle und Vermögensverwaltungsstelle StaHH 331-1 II Polizeibehörde II 241 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 242 StaHH 331-5 Polizeibehörde – Unnatürliche Sterbefälle StaHH 331-5 II, Polizeibehörde II, Ablieferung 15, 1, Zu- und Abgänge des Polizeigefängnisses (Verpflegungslisten des Konzentrationslagers Fuhlsbüttel) StaHH 332-5, Personenstandsunterlagen StaHH 351-11, Amt für Wiedergutmachung StaHH 352-8/5, Allgemeines Krankenhaus Barmbek StaHH 352-8/7 Staatskrankenanstalt Langenhorn StaHH 362-2/20, Lichtwarkschule StaHH 362-2/30, Gymnasium Lerchenfeld StaHH 362-3, Mädchenschule Angerstraße StaHH 364-5 I Universität I StaHH 364-13, Fakultäten StaHH 371-12, Konsumentenkammer I StaHH 376-2 Gewerbepolizei StaHH 552-1, Jüdische Gemeinden, 992b, Kultussteuerkartei der Deutsch-Israelitischen Gemeinde Hamburg StaHH 621, Firmenarchiv StaHH 622-1, Familienarchiv StaHH 741-4, Fotoarchiv StaHH ZAS Staatsarchiv Osnabrück Stadtarchiv Felsberg Stadtarchiv Göttingen Stadtarchiv Hannover Stadtarchiv Kassel Stadtarchiv Krefeld Stadtarchiv Rahden Stadtarchiv Stuttgart Wiener Stadt- und Landesarchiv Yad Vashem, The Central Database of Shoah Privatbesitz Literaturverzeichnis Arbeitskreis zur Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein, Info Nr.10/Gratwanderung zwischen Mythos und Geschichte. Zum 50. Todestag Etkar Andrés. Bästlein, Klaus: „Hitlers Niederlage ist nicht unsere Niederlage, sondern unser Sieg!“ Die Bästlein-Organisation. Zum Widerstand aus der Arbeiterbewegung in Hamburg und Nordwestdeutschland während des Krieges (1939–1945), in: Meyer, Beate/Szodrzynski, Joachim (Hg.): Vom Zweifeln und Weitermachen. Fragmente der Hamburger KPDGeschichte, Hamburg 1988, S. 44–101. 242 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 243 Bajohr, Frank: „Arisierung“ in Hamburg. Die Verdrängung der jüdischen Unternehmer 1933–1945, Hamburg² 1998. Bake, Rita: Wer steckt dahinter? Nach Frauen benannte Straßen, Plätze und Brücken in Hamburg, Hamburg4 2005. Barber-Kersovan, Alenka/Uhlmann, Gordon (Hg.): Getanzte Freiheit, Swingkultur zwischen NS-Dikatatur und Gegenwart, Hamburg 2002. Beuys, Barbara: Verteidigung der Republik: Der sozialdemokratische Reformer Theodor Haubach (1896–1945), Hamburg 2000. Borgzinner, Rudolf: Über Pneumatosis cystoides intestini hominies, Hamburg 1923. Bottin, Angela/Nicolaysen, Rainer: Enge Zeit. Spuren Vertriebener und Verfolgter der Hamburger Universität, Hamburg 1991. Brakelmann, Günter: Die Kreisauer: folgenreiche Begegnungen. Biographische Skizzen zu Helmuth James von Moltke, Peter Yorck von Wartenburg, Carlo Mierendorff und Theodor Haubach, Münster² 2004. Bruhns, Maike: Kunst in der Krise. Künstlerlexikon Hamburg: 1933–1945. Verfemt, verfolgt – verschollen, vergessen, Hamburg 2001. Brunswig, Hans: Feuersturm über Hamburg. Die Luftangriffe auf Hamburg im Zweiten Weltkrieg und ihre Folgen, Stuttgart 2003. Büttner, Ursula: Hamburg zur Zeit der Weimarer Republik, Hamburg 1996. Central-Verein-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums. Die ZahnarztWoche DZW. Diercks, Herbert: Gedenkbuch „Kola-Fu“: für die Opfer aus dem Konzentrationslager, Gestapogefängnis und KZ-Außenlager Fuhlsbüttel, Hamburg 1987. Ditt, Karl: Sozialdemokraten im Widerstand. Hamburg in der Anfangsphase des Dritten Reiches, Hamburg 1984. Ebeling, Helmut: Schwarze Chronik einer Weltstadt. Hamburger Kriminalgeschichte 1919 bis 1945, Hamburg 1980. Elmshorner Nachrichten. Garbe, Detlef: Zwischen Widerstand und Martyrium: die Zeugen Jehovas im „Dritten Reich“ (Studien zur Zeitgeschichte, Bd. 42), München³ 1997. Gewehr, Birgit: Stolpersteine in Hamburg-Altona mit Elbvororten Altona-Altstadt, AltonaNord, Ottensen, Bahrenfeld, Othmarschen, Groß Flottbek, Nienstedten, Blankenese und Iserbrook. Biographische Spurensuche, Hamburg 2008. Giordano, Ralph: Erinnerungen eines Davongekommenen, Köln 2007. Goldschmidt, Moses/Fromm, Raymond: Mein Leben als Jude in Deutschland 1873–1939, Hamburg 2004. Grassmann, Ilse: Ausgebombt, ein Hausfrauen-Kriegstagebuch, Erinnerungen von Ilse Grassmann, Hamburg 1943–1945, Hamburg 2003. Guth, Karin: Bornstraße 22. Ein Erinnerungsbuch, Hamburg 2001. Hagen, Willy: Du siehst, Emanuel, es geht auch so! Gedichte von Willy Hagen, Hamburg 1917. Hamburg im „Dritten Reich“, hg. von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Göttingen² 2008. Hamburger Zahnärzteblatt Nr. 5, Mai 2009. 243 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 244 Hamburger Nachrichten. Heisig, Malve: Der Mord an Hugo Meier-Thur (Zeitzeugenberichte), Hamburg 1992. Herzig, Arno: Das Sozialprofil der jüdischen Bürger von Minden im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, 1978, Mindener Heimatblätter, Sonderbeilage im Mindener Tageblatt Hochmuth, Ursel: Niemand und nichts wird vergessen. Biogramme und Briefe Hamburger Widerstandskämpfer 1933–1945. Eine Ehrenhain-Dokumentation in Text und Bild, Hamburg 2005. Hochmuth, Ursel: Illegale KPD und Bewegung „Freies Deutschland“ in Berlin und Brandenburg 1942–1945. Biographien und Zeugnisse aus der Widerstandsorganisation um Safkow, Jacob und Bästlein, Berlin 1998. Hochmuth, Ursel/de Lorent, Hans-Peter (Hg.): Hamburg: Schule unterm Hakenkreuz. Beiträge der „Hamburger Lehrerzeitung“ (Organ der GEW) und der Landesgeschichtskommission der VVN/Bund der Antifaschisten, Hamburg 1985. Hochmuth, Ursel: Gestapo-Gefängnis Fuhlsbüttel. Erinnerungen, Dokumente, Totenliste. Initiativen für eine Gedenkstätte, Hamburg 1983. Hochmuth, Ursel/Meyer, Gertrud: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933–1945. Berichte und Dokumente, Frankfurt am Main 1969. Institut für die Geschichte der deutschen Juden (Hg.): Das jüdische Hamburg. Ein historisches Nachschlagewerk, Göttingen 2006. Jungbluth, Christiane/Ohl-Hinz, Gunhild: Stolpersteine in Hamburg-St.Pauli. Biographische Spurensuche, Hamburg 2009. Klaus, Andreas: Gewalt und Widerstand in Hamburg-Nord während der NS-Zeit, Hamburg 1986. Kosemund, Antje: Spurensuche Irma. Berichte und Dokumente zur Geschichte der „Euthanasie-Morde“ an Pfleglingen aus den Alsterdorfer Anstalten, Hamburg 2006. Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Westfalen, Amt für Denkmalspflege, Bau- u. Kunstdenkmäler von Westfalen, Band 50, Stadt Minden – Teil IV, Minden 2000. Lebensbilder hamburgischer Rechtslehrer, hg. von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät aus Anlass des fünfzigjährigen Bestehens der Universität Hamburg 1919–1969, Hamburg 1969. Leber, Annedore: Das Gewissen steht auf. 64 Lebensbilder aus dem deutschen Widerstand 1933–1945, Berlin, Frankfurt am Main 1954. Louven, Astrid: Stolpersteine in Hamburg-Wandsbek mit den Walddörfern. Biographische Spurensuche, Hamburg 2008. Krause, Eckart/Huber, Ludwig/Fischer, Holger (Hg.): Hochschulalltag im „Dritten Reich“. Die Hamburger Universität 1933–1945. Teil II: Philosophische Fakultät, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, Bd. 3, Berlin, Hamburg 1991. Meyer, Beate (Hg.): Die Verfolgung und Ermordung der Hamburger Juden 1933 bis 1945. Geschichte. Zeugnis. Erinnerung, hg. v. Landeszentrale für Politische Bildung, Hamburg 2006. Meyer, Beate: „Sonderkommando J“. Zwangsarbeit der „jüdischen Versippten“ und der „Mischlinge ersten Grades“ in Hamburg, in: Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland, Bd.8/2004, S. 102–110. Meyer, Beate: „Goldfasane“ und „Nazissen“ – die NSDAP im ehemals „roten“ Stadtteil Hamburg-Eimsbüttel, Hamburg 2002. 244 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 245 Meyer, Beate: „Jüdische Mischlinge“. Rassenpolitik und Verfolgungswahn 1933–1945, Hamburg 1999. Müller, Frank: Mitglieder der Bürgerschaft. Opfer totalitärer Verfolgung, Hamburg 1995. Müller-Wesemann, Barbara: Theater als geistiger Widerstand. Der jüdische Kulturbund in Hamburg, 1934–1941, Stuttgart 1997. Offenborn, Peter: Jüdische Jugend in Hamburg 1933–1941. Berufliche Ausbildung, zionistische Schulung, Auswanderung, Hamburg 2008. Press, Bernhard: Judenmord in Lettland 1941–1945, Berlin 1988. Pritzlaff, Christiane: Entrechtet – ermordet – vergessen: jüdische Schüler in Hamburg, Begleitmaterialien zur Tonbildschau, Hamburg 1996. Puls, Ursula: Die Bästlein-Jacob-Abshagen Gruppe. Bericht über den antifaschistischen Widerstandskampf in Hamburg und an der Wasserkante während des Zweiten Weltkriegs, Berlin 1959. Radach, Günther: Barmbek basch. Eine Erinnerung an vergangene Zeiten. Bd.1, Hamburg 1996 von Rönn, Peter/Lunderup, Regina Marie: Wege in den Tod. Hamburgs Anstalt Langenhorn und die Euthanasie, Hamburg 1993. Roß, Marlis: Der Ausschluss der jüdischen Mitglieder 1935. Die Patriotische Gesellschaft im Nationalsozialismus, Hamburg 2007. Rosenkranz, Bernhard/Bollmann, Ulf/Lorenz, Gottfried: Homosexuellenverfolgung in Hamburg, Hamburg 2009. Schicksal jüdischer Juristen in Hamburg im Dritten Reich. Niederschrift einer Podiumsdiskussion mit Wissenschaftlern und Zeitzeugen sowie eines Vortrages von Gert Nicolaysen über die Rechtsfakultät der Universität Hamburg 1933, hg. vom Verein für Hamburgische Geschichte, Heft 27, Hamburg 1985. Sparr, Ulrike: Stolpersteine in Hamburg-Winterhude. Biographische Spurensuche, Hamburg 2008. Stengel, Theophil/Gerigk, Herbert: Lexikon der Juden in der Musik. Mit einem Titelverzeichnis jüdischer Werke, Berlin 1941. Storz, Harald: Als aufgeklärter Israelit wohltätig wirken. Der jüdische Arzt Philipp Wolfers (1796–1832), Bielefeld 2005. Suhlig, Lucie: Der unbekannte Widerstand. Erinnerungen, Frankfurt am Main 1980. Thiele, Dieter: Gerda Ahrens – eine aus Barmbek – zwischen politischem Glauben und Menschenfreundlichkeit, Hamburg 2005. Thiele, Dieter/Saloch, Reinhard: Auf den Spuren der Bertinis – ein literarischer Spaziergang durch Hamburg-Barmbek, Hamburg 2003. Thiele, Dieter/Saloch, Reinhard/Kinter, Jürgen: Barmbeker Geschichtstafeln, Textbuch. von Villiez, Anna: Mit aller Kraft verdrängt. Entrechtung und Verfolgung „nicht arischer“ Ärzte in Hamburg 1933 bis 1945, Hamburg 2009. von Villiez, Anna: Die Vertreibung der jüdischen Ärzte Hamburgs aus dem Berufsleben 1933–1945, Hamburg 2002. Wamser, Ursula/Weinke, Wilfried: Eine verschwundene Welt, jüdisches Leben am Grindel, Springe 2006. 245 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 246 Weber, Hermann/Herbst, Andreas: Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945, Berlin 2004. Wunder, Michael: Auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten mehr. Die Alsterdorfer Anstalten im Nationalsozialismus, Hamburg 1988. Zimmermann, Peter: Theodor Haubach (1896–1945). Eine politische Biographie, Hamburg 2002. Zelzer, Maria: Weg und Schicksal der Stuttgarter Juden. Ein Gedenkbuch, Stuttgart 1964. Internetquellen Bundesarchiv, Gedenkbuch. Die Abschiebung polnischer Juden aus dem Deutschen Reich 1938/39 und ihre Überlieferung, http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/zwangsausweisung.htm?page=2 (12.02.2009) Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland, http://www.joodsmonument.nl/person-481905-nl.html (14.06.2009) König, Regina: „... wohl nach Amerika oder Palästina ausgewandert“ – Der Exodus jüdischer Familien aus dem Kreis Steinburg nach 1933, http://www.akens.org/akens/texte/info/29/3.html (04.10.2009) Politisch Verfolgte in Hamburg 1933–1945, http://www.politisch-verfolgte.de (14.03.2009) Stolpersteine in Elmshorn, http://www.stolpersteineelmshorn.de/themen/juden/hasenberg/hasenberg.htm (25.06.2009) Stolpersteine in Stuttgart, http://www.stolpersteine-stuttgart.de/index.php?docid=196 (11.06.2009) Verfolgte der Hamburger SPD, http://verfolgte.spdhamburg.de/gedenkbuch/Gedenkbuch_G-H.pdf (03.11.2008) Zeichen der Erinnerung: Schicksale und Lebensläufe, http://www.zeichen-dererinnerung.org/n5_1_adler.htm (16.04.09) Straßen mit Hausnummern, an denen in Barmbek und Uhlenhorst Stolpersteine verlegt oder geplant sind. Nicht alle zerstörten Gebäude wurden nach dem Krieg wieder aufgebaut, alte Hausnummern sind teilweise verändert. Adlerstraße 12 Adolph-Schönfelder-Straße 31 Averhoffstraße 22 Barmbeker Markt 37 Bendixensweg 3, 11, 15 Bramfelder Straße 23 Dennerstraße 15 Detmerstraße 28 Diesterwegstraße 4 Elsastraße, gegenüber Mesterkamp 246 216-247 Gloss-App:Glossar - für alle 30.08.10 10:15 Seite 247 Fraenkelstraße 6 Framheinstraße 4 Friedrichsberger Straße 35 Genslerstraße 16 Gluckstraße 24 Gustav-Freytag-Straße 7 Halbenkamp 16 Hamburger Straße 164 Hans-Henny-Jahnn-Weg 8 Hartwicusstraße 2, 3 Heinrich-Hertz-Straße 19 Heinskamp 20 Heitmannstraße 68 Herbert-Weichmann-Straße 51 Höltystraße 15 Hofweg 6, 9, 31 Hufnertwiete 2 Humboldtstraße 56, 122 Immenhof 10 Kanalstraße 2 Karlstraße 2 Langenrehm 14 Lerchenfeld 2, 10 Mozartstraße 6a Mundsburger Damm 26, 38, 65 Oertzgarten 15a Otto-Speckter-Straße 1 Papenhuder Straße 22, 27, 32, 40, 42, 53 Prechtsweg 15 Richardstraße 11 Rübenkamp 78 Schenkendorfstraße 19, 25, 30 Schwanenwik 29 Uhlenhorster Weg 39 Vogteiweg, gegenüber Haus Nr. 11 Von-Essen-Straße 53, 82 Wachtelstraße 4, 48 Weidestraße 125 Wiesendamm 20 Winterhuder Weg 86 Zimmerstraße 47 247 248-256 Personenregister:Personenregister Stolpersteine 30.08.10 09:12 Seite 248 Personenregister Abrahamssohn, Joel 214 Abrahamssohn, Pauline, geb. Meyer 214 Abshagen, Adelheid, geb. Heidenreich 46 Abshagen, Agnes 46 Abshagen, Albert 46 Abshagen, Elfriede 46 Abshagen, Louise 46 Abshagen, Manja (Minna), geb. Hildebrandt 47 f. Abshagen, Robert Carl Albert 46 ff., 56, 238 Acker, Eva Maria 53 f. Acker, Franz Josef 49–53, 114, 117 Acker, Heinrich 49 Acker, Helmut 49 ff., 53 f., 191 Acker, Hermann 49 Acker, Lissi, geb. Kaufmann 49–54, 113–117, 191 Adler, Berta (jun.) 55f. Adler, Bertha, geb. Heymann 55 Adler, Eva Amarand Friederike 55 Adler, Eva Senta, geb. Stern 56 Adler, Frieda, geb. Fabisch 55 Adler, Friedrich 54 ff. Adler, Hermann 55 Adler, Ingeborg Elisabeth 55 Adler, Kurt Jack Michael 56 Adler, Max Wolfgang 55 Adler, Paul Wilhelm 55 f. Alsberg, Ernst 211 Alsberg, Gertrud 211 Amberger, Ferdinand 223 Ambos, Clara, geb. Mansfeld 141f. Ambos, Fritz 142 Anasch, Ingeborg 56 Anasch, Käthe, geb. Clasen 56 Anasch, Lothar 56 Anasch, Norbert 56 Anasch, Peter 56 Anasch, Rita 56 Anasch, Robert 56 f. Anasch, Waltraut 56 André, Bernhard 57 André, Etkar (Edgar) Joseph 57–65 André, Sofie, geb. Koch 57 Aronstein, Betty, geb. Borgzinner 75 Bach, Frieda Gretchen, geb. Klages 65 Bach, Louise Grete 65 Bach, Paul Karl 65 Bachert, Grete Ella, geb. Schulz 66f. Bachert, Hanna 67 248 Bachert, Heidi Henny 66 f. Bachert, Henriette, geb. Levy 66 f. Bachert, Otto 66 f. Bachert, Paul Heinrich Wilhelm 66 f. Bachert, Wilhelm 66 Bajohr, Frank 216 Bargeboer, Benjamin Biene 141 Bargeboer, Sophie, geb. David 141 Bästlein, Bernhard 46 ff., 56, 225, 238 Baum, Herbert 225 Baum, Carl 67, 69 Baum, Hannelore 67, 69 Baum, Hedwig Bernhardine, geb. Hirschfeld 67ff. Baum, Johanna, geb. Salomon 67 Baum, Leopold 67 Baum, Wilhelm 67ff. Baumann, Marie-Augustine 207 Baumgart, Karl 77 Baumgartl, Marianne 191 Baumgartl, Marie Sophie 191 Bausch, Viktor 107 Beck, Fritz 223 Becker, Ursula 79 Behr, Adelheid 193 Behr, Charlotte, geb. Meyer 171 Behr, Hildegard, geb. Holland 192 f. Behr, Joseph (José) 191ff. Behr, Louise 191, 193 Behr, Ludwig 191, 193 Berg, Martha, geb. Schmidt 59, 61–64 Bernstein, Arnold 206 Bernstein, Aaron 71 Bernstein, Dorothea Henriette 70 ff. Bernstein, Sophie 71 Bertram 161 Bertram, Friedrich 80 Beust, Ole von 14 Bezen, Anna, geb. Wilder 72 Bezen, Aron 72 ff. Bezen, Bernhard 72 Bezen, Bilha Erna 72 f. Bezen, Erna Berta, geb. Hecht 72 f. Bezen, Frieda, geb. Bleiweiss 73 f. Bezen, Hannelore 73 f. Bezen, Heinrich 72 Bezen, Josef 72 Bezen, Leonhard 72 f. Bezen, Noa 72 Bezen, Salomon 72 Biedermann, Adolf 237 Bielefeld, Hermann 136 Bielefeld, Jeanette 136 Blum, Else, geb. Eisenstein 92 f. Blum, Jonas 92 Blum, Karl 92 f. Blum, Manfred Blum, Zerline, geb. Goldschmidt 92 Bohne, Walter 48 Bonn 160 Borchling, Conrad 123 Borgzinner, Minna, geb. Kempenich 74, 76 Borgzinner, Paul 74 ff. Borgzinner, Rudolf 74 ff. Bramfeld, Rudolf 86 f. Braunschweiger, Auguste, gen. Agnes 178 f. Braunschweiger, Betty, geb. Benjamin 164 Braunschweiger, Louis 164 Braunschweiger, Moses 178 Bretschneider, Hein 47 Bröckler, Christine, geb. Lüsing 77 Bröckler, Heinrich 77 Bröckler, Maria, geb. Greve 77 Bröckler, Willi Ferdinand 77 f. Brose, Johann 113 Bruhn, Gustav 48 Bruns, Otto 79 Bruns, Carl August 79 f. Buchholz, Bertha 86 Buchholz, Helmuth 86 Burchard, Bertha, geb. Goldzieher 81 Burchard, Ernst Valentin 81ff. Burchard, Ernst Valentin (jun.) 81f. Burchard, Gabriele Olga 81, 83 Burchard, Marianne Lilly 81ff. Burchard, Martin 81 Burchard, Martin Otto 81f. Burchard, Olga, geb. Jonas 81f. Burmester, Carl 84 f. Burmester, Charlotte, geb. Clausen 84 f. Burmester, Franz 84 Burmester, Greta 84 f. Burmester, Jens Peter 84 f. Busse, Marta 79 Carlebach, Joseph 229 Cassirer, Ernst 123 Christoffers, Hans 47 Citreck, Hermann 168 Citreck, Michael 168 Cohn, Abraham Joachim 113 248-256 Personenregister:Personenregister Stolpersteine 30.08.10 09:12 Seite 249 Cohn, Catharina, geb. Brose 113 Corten, Martin-Heinrich 219 Cramer 178 Czeschka, Carl Otto 144 Dahms, Heinrich 86 Dahms, Helene, geb. Sassarath 86 Dahms, Max Heinrich Werner 86 f. Danner, Paul 157 David, Ascher 139 David, Jette 141 David, Mina, geb. Leeser 139 Decker, Anton Carl Engelbert 88 ff. Decker, Joseph 88 Decker, Maria, geb. Wachtmeister 88 Demnig, Gunter 72, 204 Dirlewanger, Oskar 218 Dreckmann 61 Drescher 64 Drews, Claus-Heinz 90 f. Drews, Richard 90 f. Drews, Selma, geb. Schönfeld 90 Düe 87 Duhne 72 Dusenschön, Willi 220 Eckmann, Erich 173 Ehlers 199 Eichmann, Adolf 230 Eisenstein, Emmi, geb. Meyer 92f. Eisenstein, Günther 92 Eisenstein, Gustav 92 f. Eisenstein, Hildegard 92 Eisenstein, Ruth 92 f. Ellerhusen, Paul 220, 238 Epstein, Hanan 175 Fahr, Theodor 75 Fehr, Johanna, geb. Behrens 131 Fehr, Salomon 131 Firgau 210 Flashar 73 Forsthoff, Ernst 160 Fränkel, Benjamin 206 Freisler, Roland 108 Freschel, Adolf 93 Freschel, Erwin 94 Freschel, Eva 93 f. Freschel, Heinrich 93 ff. Freschel, Heinz Leon 93, 95 Freschel, Henny, geb. Urich 93 ff. Freschel, Herbert 94 Freschel, Kurt 94 Freschel, Leon (Leib) 93 Freschel, Maier (Max) David 93 ff. Freschel, Michael 93, 95 Freschel, Schajndel 93 Freundlich, Berthold 134 Fridman, Roger 48 Friedländer, Oscar 82 Friedrich, Gerda 96 Friedrich, Kurt Albin 96 Fromm, Raymond 183 Funder, Walter 144 ff. Geiershoefer, Anton 97 Geiershoefer, Else Amalie, geb. Kann 96–99 Geiershoefer, Erik Ludwig 97, 99 Geiershoefer, Herbert Theodor 97, 99 Geiershoefer, Magda 99 Geiershoefer, Otto 96 f. Geiershoefer, Rita 99 Geiershoefer, Susanne 99 Gerlach, Willi 102 Gilardi, Jacob 97 Giordano, Ralph 38, 40 f. Goerdeler, Carl Friedrich 107 Goldschmidt, Hilde 127 Goldschmidt, Irma 127 Goldschmidt, Johanna, geb. Mayer 127 Goldschmidt, Moses 178, 181, 183 Goldschmidt, Natan 127 Gorden, Elisabeth, geb. Wolfers 211f., 214 Gorden, Felix 214 Gorden, Herbert 214 Gorden, Hildegard 214 Göring, Hermann 230, 234 Gottberg, Martha, geb. Mansfeld 141f. Göttsche, Claus 222f. Götze 223 Griem, Martha 120 Griem, Max 120 Grisebach 61, 63 Gröber, Walter 65 Gröpler 64 Gross, Heinrich 190 Grote, Berta, geb. Westmeier 100 f. Grote, Hilde 100 Grote, Max August 100 f. Grünhut, Adele 122 f. Grünhut, Alice 122 Grünhut, Gisela 122 Grünhut, Johanna, geb. Jetmar 122 Grünhut, Selma 122 Grünhut, Simon 122 Grynszpan, Herschel 234 Gutmann, Hermann 97 Haack 199 Haberland, Auguste Karoline Luise 147 Hacker, Irmgard, geb. Enke 101f. Hacker, Karl Johann August 101f. Hacker, Peter 101 Hagenow, Betty Adolphine Berta, geb. Dittmann 103 Hagenow, Curt Siegmund 103 Hagenow, Erna 102 f. Hagenow, Helene 102 f. Hagenow, Ida 103 Hagenow, Wolff William 102 f. Halberstadt, Siegfried 128 Halle, Henry 129 Hammerschlag 223 Hänel, Albert 158 Hansen, Adalbert 116 Hannes, Berthold 132 Hartmann, Egon 152 Hasenberg, Gertrud, geb. Meyer 104 Hasenberg, Henny, geb. Lippstadt 104 Hasenberg, Irene 104 Hasenberg, John 104 f. Hasenberg, Julius 104 Haubach, Theodor 105–109 Häussler, Helmi 109 Häussler, Karl 109 Häussler, Wilhelm 109 ff. Häussler, Wilhelmine (Mimi) 110 f. Hausmann, John 82 Hecht, Arthur 73 Hecht, Rosalie, geb. Löwenthal 73 Heidtmann, Auguste, geb. Schmidt 112 Heidtmann, Gustav 112 Helms, Paul 144 Henning, Ernst 60 Hermann, Hans-Christian 165 Hermann, Liselotte 85 Hess, Sigrid, geb. Wolfers 212 Heyen 146 Hilcken, Otto 99 Himmler, Heinrich 238 f. Hippa 186 f. Hirsch, Arthur 150 Hirsch, Hermann 150 Hirsch, Johanna, geb. Lehmann 150 Hirsch, Käthe 150 Hirsch, Leopold 150 Hirschfeld, Amalie, geb. Weinthal 67 f. Hirschfeld, Julius 67 ff. Hirschfeld, Liselotte 67, 69 Hitler, Adolf 28, 107, 160, 220, 225, 227 f., 235 f. Hoge, Hans-Walter 70 Holland, Eugen 193 Holland, Lisette, geb. Stock 193 Hubschmid, Maris 70 Jacob, Franz 46 ff., 56, 225, 238 Jacobson, Carsten 206 Jacoby 178 Jaffé, David Abraham 209 Jaffé, J. 209 Jaspers, Karl 106 Jastram, Wilhelm Karl Ferdinand 112 f. Jauch 199 Jolowicz, Julius 178 Jonas, Emma, geb. Jonas 81 Jonas, Emmy 82 Jonas, Otto Nathan 81 Judelowitz, Oskar 129 Kalmann 172 Kann, Charles 97 Kann, Mayer 96 249 248-256 Personenregister:Personenregister Stolpersteine 30.08.10 09:12 Seite 250 Kann, Pauline, geb. Dreyfuss 96 Katz, Heinrich 178 Katzenstein 137 Kaufmann, Franziska, geb. Cohn 113–118 Kaufmann, Gertrud, geb. Stock 113 Kaufmann, Jacob 50, 113–118 Kaufmann, Karl 27, 28, 35, 212, 237 Kaufmann, Käthe Selma 113–116 Kaufmann, Moses 113 Kaufmann, Paula, geb. Gumpertz 124 Kaufmann, Samuel 118 Kaufmann, Simon 124 Keitel, General 239 Kern 36 Keutgen, Friedrich 123 Kiefer 51 Kistenmacher, Ernst 211f. Kister 199 Kitz, Leon 94 Klages, Wilhelm 65 Klein, Auguste, geb. Schusster 120 Klein, Franz 118 f. Klein, Fritz 120 Klein, Gustav 120 Klein, Inge Karla 120 Klein, Käthe, geb. Binner 114 Klein, Malwine, geb. Freud 118 Klein, Marie, geb. Braker 118 f. Klein, Mariechen Dorothea Elisabeth, geb. Griem 120 Klein, Maximilian 118 Knuth 108 Kobritz, David Herz Hermann 121f. Kobritz, Heinrich 121 Kobritz, Juliette 121 Kobritz, Katharina (Katja) 121f. Kobritz, Leonora (Eleonore) 121 Kobritz, Maximilian 121 Kobritz, Richard 121 Kobritz, Rosalia, geb. Kleinmann 121f. Kohn, Gertrud 122ff. Kohn, Ida, geb. Grünhut 122ff. Kohn, Isidor 123 Koopmann, Carl 169 Koppel, Walter 53 Körner 204 Kosemund, Antje, geb. Sperling 189 f. Krahn, Paul 86 Kramer, Natalie, geb. Wolfers 212 Krause, Erwin 88 Krogmann, Carl Vincent 28 Kühn, Hermann 223 L’Aigle, Alma de 108 Lampa 143 Lauffer, Otto 123 Ledig 87 Lehr, Abraham 124 Lehr, Bertha 124 250 Lehr, Fritz Herbert 124 f. Lehr, Gabriel (Georg) Jakob 124 ff. Lehr, Hans Walter 124f. Lehr, Hedwig, geb. Kaufmann 124 f. Lenz, Max 123 Leow, Willy 64 Lessmann, M. 192 Lessner 191 Leva, Joseph 168 Levie, Hannah, geb. RicardoRocamora 126 Levie, Hertha, geb. Goldschmidt 126 f. Levie, Iwan 126 f. Levie, Jon 126 f. Levie, Tanchum (Theodor) 126 Levisohn, Albert 128, 130 Levisohn, Bertha 128 Levisohn, Cilly, geb. Magnus 128–131 Levisohn, Rolf William 128–131 Levisohn, Ruth Lotte 128 f. Levisohn, William 128 Levy, Anna 132 Levy, Nachmann Jacob 131f. Levy, Rosa 172f. Levy, Sara, geb. Fehr 131f. Levy, Sophie, geb. Rosenbacher 131 Lewandowski, Erna 181 Lewandowski, Hermann 178 Lewinsohn, Richard 178 Lichtenstein, Abraham 178 Lichtenstein, Marianne, geb. Braunschweiger 178 Lieber, Hans 132 ff. Liebknecht, Karl 231 Linder 78 Lindley 23 Litzmann, General 225 London, Adolf 134 London, Andreas 134 f. London, Dora, geb. Plackmeyer 135 London, Elise 134 London, Marianne, geb. Os 134 London, Moritz 134 London, Ottilie 134 London, Sophie 134 f. Löwenstein, Carl 135 f. Löwenstein, Cecilie, geb. Esberg 135 Löwenstein, Emilie 135 f. Löwenstein, Ilse 136 f. Löwenstein, Jacob 135 Löwenstein, Julius 136 f. Löwenstein, Margot 136 f. Löwenstein, Marianne Martha, geb. Bielefeld 136 f. Löwenstein, Moses 136 Löwenstein, Sara 136 Löwenstein, Selma 135 f. Lübcke, Friederike, geb. Krüger 138 Lübcke, Georg 138 Lübcke, Max Bernhard Kurt 138 f. Lübeck, Hannchen, geb. Lilienfeld 146 Lübeck, Wilhelm 146 Lucht, Paul 138 Luppy, Carl 127 Luxemburg, Rosa 231 Magnus, Adolf 128 Magnus, Jenny 128 Mamelok, Hans Norbert 165, 167, 169 Mamelok, Julius 165, 169 f. Mamelok, Nathan 165 Mamelok, Rahel, geb. Marcus 165 Mamelok, Recha, geb. Rieder 165, 169 Manes, Georg 178 Mansfeld, Albert 139 ff. Mansfeld, Marcus Paul 140 Mansfeld, Otto 141f. Mansfeld, Paul 140f Mansfeld, Thea 141. Mansfeld, Esther (Elise), geb. David 139 ff. Manuel, Helene, geb. Nitschke 160 Matthes 147 Mause, Gustav 109 Mecklenburg, Walter 223 Meier, Friedrich Theodor Christian Heinrich 143 Meier-Thur, Annemarie 144 Meier-Thur, Hans Hugo 144 Meier-Thur, Hugo 143–146 Meier-Thur, Lina 144 f. Melhausen, Auguste Karoline Luise, geb. Ha(l)berland 147 ff. Melhausen, Edith 147 Melhausen, Hertha, geb. Lübeck 146 Melhausen, Isaak 146 Melhausen, Jonni 146 ff. Melhausen, Käthe 147 Melhausen, Kurt 146 Melhausen, Louis 146 Melhausen, Marianne 146 Melhausen, Max 146 f. Melhausen, Walter 146 Mendelssohn-Bartholdy, Albrecht 159 Mertens 88 Meyer, Gabriel 14 Meyer, Margarete, geb. Kaufmann 49, 113–116 Meyer, Richard 143 Michelsohn, Adele, geb. Lilienfeld 150 Michelsohn, Bertha, geb. Hirsch 150 Michelsohn, Simon Arye 150 Michelsohn, Waldemar 150 Mierendorff, Carlo 105 ff. Milee, Erika 150 Mittell-Redlich 194 f. Moltke, Helmuth James Graf von 107, 225 Müller, Herbert 151 248-256 Personenregister:Personenregister Stolpersteine 30.08.10 09:12 Seite 251 Müller, Luise, geb. Wichmann 151 Müller, Rudolf Albert 151f. Müller, Th. 165 Müller, Wilhelm 151 Nathan, Alfred 152–156 Nathan, Elna, geb. Leopold 152–156 Nathan, Emma, geb. Schürmann 152, 156 Nathan, Max Carl 152–156 Nathan, Nanni 152, 154, 156 Neuhaus, Julius 136 Nevermann, Paul 85 Nieland, Hans 237 Note, Franz 198, 202 Note, Lothar 202 Oberdörffer 129 Oberländer 50 Oettinger 178 Offenstadt, Agnes 76 Offenstadt, Leo 76 Olsson, Adolf 86 Oppenheimer, Alice, geb. Oppenheim 209 f., 214 Oppenheimer, Ernst 214 Oppenheimer, Philipp 209 Orgler, Franziska 157 Orgler, Heinrich Georg 157 Orgler, Irma, geb. Lehmbecker 157 Papen, Franz von 107 Paustian, Max 198 Pels, Henry 211 Pels, Wolf 211 Perels, Anna, geb. Volkmar 157 Perels, Ernst 157 f., 160 Perels, Ferdinand 157 f. Perels, Friederike 157 Perels, Friedrich-Justus 160 Perels, Kurt Ferdinand Lothar 157–160 Perels, Leopold 157 f. Philipp, Bertha, geb. Hirschfeld 67 f. Philipp, Heinz 68 Philipp, Kurt 68 Philipp, Robert 68 Piltz, Max 92 f. Plath 23 Plaut, Max 53, 83, 119, 219, 222 Plüschau 204 Podeyn, Hans Karl Louis Hermann 160 f. Podeyn, Johannes 160 Podeyn, Marie, geb. Schuldt 160 Raphaeli, Gisela, geb. Gollerstepper 162 f. Raphaeli, Leo Julius, gen. Willy Hagen 162 f. Rath, Ernst vom 234 Rehder, Erich 68 Rehder, Ernst 68 Reincke, Oskar 47 f. Riebow, Günther 77 Rieder, Aaron 165, 170 Rieder, Alice 166 f. Rieder, Ellen 166 Rieder, Eva 166 Rieder, Giska 165 Rieder, Grete Recha 164, 167, 169 f. Rieder, James 164–167, 169 Rieder, Joseph 164 Rieder, Markus 164 f., 167 ff. Rieder, Max 164, 166, 169 f. Rieder, Rachel, geb. Goldenberg 164 Rieder, Ruth 166, 168 Rieder, Simon 165, 170 Rieder, Sophie, geb. Braunschweiger 164 f., 167–170 Rieder, Werner 166 Rodowinsky 199 Rosen, Dennis Winston 137 Rosen, Kurt 137 Rosen, Margot Jeanette, geb. Löwenstein 136 f. Rosenbacher-Levy, Jacob 131 Rosenblum, Siegfried 92 f. Rosenbrook, Gerda 145 Rosenfeld, Benjamin 170 f. Rosenfeld, Charlotte 170 f. Rosenfeld, Theresia, geb. Meyer 170 f. Roth, Heinrich 80 Roth, Otto 62 Rothenburg, Rosa 213 Rückriem, Ulrich 226 Russèl 101 Rutherford 101 Samson 132 Sander, Alfred 152–156 Sander, Wilhelm 152–156 Sauerbruch, Ferdinand 236 Schacht, Emil 177 Schallert, Willibald 147 Schanze, Emmi 188 Schellhase, Anneliese 108 Schildt, Otto 80 Schindler, Kurt 123 Schindler, Mary 123 Schlumbom, Peter Christoph 212 f. Schmedemann, Walter 238 Schmitt, Carl 160 Schnee, Marie Elise Frieda Helene 198 Schoeps, Anneliese 172 Schoeps, Anneliese, geb. Todtenkopf 175 Schoeps, Eva Pauline 172 f., 175 Schoeps, Hermann 171 Schoeps, Irma, geb. Levy 171ff., 175 Schoeps, Jakob (Jacques) 171–175 Schoeps, Max 172 Schoeps, Pauline, geb. Brinn 171 Schoeps, Walter Max Ludwig 172, 175 Schönfeld, Bertha 90 f. Schönfeld, Frieda 90 Schönfeld, Johann 90 Schönfeld, Katharina 90 f. Schönfeld, Melanie 90f. Schönfeld, Moses Salomon 209 Schönfeld, Serine 90 Schönfeld, Therese 90 Schrage, Adolf 176 f. Schrage, Annemarie, geb. Thiessen 176 Schrage, Carl Ludwig 175 Schrage, Emma, geb. Arend 175 Schrage, Heinrich Friedrich Karl 175 f. Schreiber, Wolfgang 79 Schröder, Heinrich 153 Schubert, Hermann 64 Schulze, Franziska, geb. Wolfsberg 199, 203 Schulze, Friedrich (Fiete) 62 Schulze, Otto 199, 203 Schumacher, Auguste (Agnes), geb. Lichtenstein, adopt. Braunschweiger 169 f., 178 f., 181, 183 Schumacher, Fritz 21 Schumacher, Isaak (Iwan) 169 f., 178 f., 181, 183 Schumacher, Jacob Isaac 178 Schumacher, Johanna (Hannchen), geb. Lewandowski 178 Schumann, Carl 183 Schumann, Karl 183 ff. Schumann, Manfred 185 Schumann, Margarethe 183 Schumann, Margarethe, geb. Stolten 183 Schumann, Wolfgang 183 Seifert, Margarethe 127 Seld, Alexander Freiherr von 145 Seld, Alexander von (jun.) 145 Seligmann, Bianka, geb. Diek 185 f. Seligmann, Carl 185 Seligmann, Harald 185 f. Seligmann, Harald (jun.) 185 ff. Seligmann, Johanna, geb. Peine 185 Seligmann, Willi 104 Sello, Heinrich 188 Sello, Noemi Carola, geb. Weil 188 Sieveking, Heinrich 123 Silberberg, Gertrud, geb. Kaufmann 113, 116 Silberberg, Peter, geb. Binner 114, 116 Silberberg, Siegfried 114, 116 Silmain, Adéle 207 Simon 125 Sonntag 87 Spaeter, Carl 22, 31 Spaethe 204 Sperling, Anna Katharina Helene, geb. Pappermann 189 Sperling, Bruno 189 Sperling, Irma 189 f. Stauffenberg, Claus Schenk Graf von 107, 225 251 248-256 Personenregister:Personenregister Stolpersteine 30.08.10 09:12 Seite 252 Stein, Edith 13 Steinfeld, Louise 196 Steinfeld, Margarethe 194 Stephan, Hans 223 Stern, Hertha 205, 207 Stern, Martha, geb. Elias 205 Stern, Bernhard 205 ff. Stock, Adelheid 191 Stock, Erna Marie Sophie, geb. Baumgartl 191f. Stock, Helena 191, 193 Stock, Louise 191 Stock, Marianne 191 Stock, Walter Wolfgang 191ff. Stockmann, Werner 86 Strauß, Agnes, geb. Steinfeld 193, 196 Strauß, Edith Hilde 193 f., 196 Strauß, Elisabeth 193, 195 f. Strauß, Hermann 195 Strauß, Hugo 193, 196 Strauß, Selig 193 Streckenbach, Bruno 238 Szodrzynski, Joachim 63 Thälmann, Ernst 59 f., 64, 224 f. Thoma, Richard 158 Uhsadel, Walter 99 Unger, Erna 198 Unger, Frida, geb. Hopp 197 Unger, Wilhelm 197 Unger, Willy Erich Georg 197 f. Urich, Anita, geb. Italiener 93, 95 Urich, David 93 Urich, Hermann 93 Urich, Jacob 93 252 Uterhardt, Alice 92 f. Uterhardt, Edith Ilse 92 f. Uterhardt, Erwin Albert Carl 92 Vaernet, Carl 239 Veffer, Joseph 212 Vogeler, Heinrich 84 Wagner, Bruno 109 Wagner, Frieda, geb. Schnee 198–203 Wagner, Gustav 198–202 Wagner, Johannes 215 Wagner, Mary, geb. Nathan 198 Wagner, Moritz 198 Wehner, Richard Herbert 85 Weil, Ada, geb. Wodiska 188 Weil, Henri 188 Weinsztock, Marthe 207 Weise, Martin 48 Welschen, Arnold Adolf Wilhelm 141 Welschen-Bargeboer, Bertha, geb. Mansfeld 141f. Wetzstein, Anna Auguste, geb. Hardt 203 Wetzstein, Christian Carl Heinrich 203 Wetzstein, Ernst Friedrich 203 f. Wetzstein, Heinrich 203 Wetzstein, Marietta Dorothea, geb. Wrage 203 Wilckens, Malve 144 ff. Wilhelm, Lina, geb. Schröder 153, 156 Winterfeld, Bruno 204, 206 f. Winterfeld, Ilse 205 ff. Winterfeld, Julius 204 Winterfeld, Leopold 204–207 Winterfeld, Lissi Helena, geb. Stern 204–208 Winterfeld, Louise 204, 207 Winterfeld, Marianne, geb. Nissel 204 Winterfeld, Ruth 205 Winterfeld, Werner Martin 204 ff. Wirlander, Elisabeth, geb. Strauß 195 f. Wirlander, Stefan 196 Wohlers, Walter 223 Wohlwill, Gretchen 210 Wolfers, Alice 213 Wolfers, Eduard 208 f., 211 Wolfers, Ellen 210 f. Wolfers, Gertrud, geb. Fränkel 211f. Wolfers, Grete, geb. Abrahamssohn 210, 214 Wolfers, Gustav 209 f. Wolfers, Heinz 213 Wolfers, Hugo 208–214 Wolfers, Natalie, geb. Alsberg 209, 211 Wolfers, Olga, geb. Oppenheimer 208 ff., 213 f. Wolfers, Samuel Philipp 208 Wolff, Adelheid, geb. Kaufmann 118 Wolff, Alexander 118 Wolfson, Wilhelm 118 Wulff, Theodor 215 Zille 22 Zimmermann, Eugenie, geb. Isaacs 213 248-256 Personenregister:Personenregister Stolpersteine 30.08.10 09:12 Seite 253 Mit diesem Buch entstand die Projektidee ... Beate Meyer (Hrsg.) Die Verfolgung und Ermordung der Hamburger Juden 1933–1945 Geschichte. Zeugnis. Erinnerung* Inhalt Teil I Geschichte Die Verfolgung der Hamburger Juden 1933–1938 Beate Meyer Das „Schicksalsjahr 1938“ und die Folgen Beate Meyer Die Deportation der Juden: Initiativen und Reaktionen aus Hamburg Frank Bajohr Die Deportation der Hamburger Juden 1941–1945 Beate Meyer Die Entscheidung zur Deportation der deutschen Juden | Die Organisation der Transporte in Hamburg | Die Arbeit des Jüdischen Religionsverbandes zur Zeit der Deportationen | In den „Freitod“ getrieben | Die Deportationen nach Lodz, Minsk und Riga | Die Deportationen nach Auschwitz | Die Deportationen nach Theresienstadt Fragwürdiger Schutz – Mischehen in Hamburg (1933–1945) Beate Meyer „Sie bringen uns wohl nach Warschau“. Die Lebensgeschichte des deportierten Hamburger Juden Alfred Pein Beate Meyer Keine Zuflucht. Verfolgungserfahrungen emigrierter Hamburger Juden Linde Apel Teil II Zeugnis Rosa und Koppel Friedfertig aus Hamburg, Bericht über ihre Abschiebung aus Hamburg Edgar Eichholz, Brief an seinen Sohn über den Novemberpogrom Max Plaut, Die Deportationsmaßnahmen der Geheimen Staatspolizei in Hamburg Ingrid Wecker, Helferin der Jüdischen Gemeinde bei den Deportationsvorbereitungen Fritz Sarne, Bericht über seine Deportation nach Lodz Heinz Rosenberg, Das Getto von Minsk Rita Springfield, Brief an eine Klassenkameradin über ihre Deportation nach Riga Martin Starke, Bericht über seine Schreckensjahre in den Konzentrationslagern Fuhlsbüttel und Auschwitz Alice Kruse, Aufzeichnungen über unseren Transport nach Theresienstadt Walter Zwi Bacharach, G’tt hat mich geleitet. Emigration – Deportation – Überleben Teil III Erinnerung „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“. Die Aktion Stolpersteine Interview mit Peter Hess Rundgang: Stolpersteine im Grindelgebiet Beate Meyer Liste der in Hamburg verlegten Stolpersteine (Stand Februar 2006) * Gegen eine Bereitstellungspauschale von 2 Euro erhältlich über: Landeszentrale für politische Bildung, Dammtorstraße 14, 20354 Hamburg, oder im Informationsladen Dammtorwall 1, 20354 Hamburg. 253 248-256 Personenregister:Personenregister Stolpersteine 30.08.10 09:12 Seite 254 In der Reihe „Stolpersteine in Hamburg – Biographische Spurensuche“ sind bisher erschienen*: Hildegard Thevs Stolpersteine in Hambug-Hamm Biographische Spurensuche Dezember 2007, 212 Seiten Birgit Gewehr Stolpersteine in Hambug-Altona Biographische Spurensuche April 2008, 174 Seiten Astrid Louven/ Ursula Pietsch Stolpersteine in HamburgWandsbek mit den Walddörfern Biographische Spurensuche Mai 2008, 228 Seiten Ulrike Sparr Stolpersteine in HamburgWinterhude Biographische Spurensuche November 2008, 323 Seiten * Gegen eine Bereitstellungspauschale von 2 Euro erhältlich im Infoladen der Landeszentrale für politische Bildung, Dammtorwall 1, 20354 Hamburg, Öffnungszeiten: Mo.–Do. 13:30–18:00 Uhr, Fr. 13:30–16:30 Uhr. 254 248-256 Personenregister:Personenregister Stolpersteine 30.08.10 09:12 Seite 255 Christiane Jungbluth/ Gunhild Ohl-Hinz Stolpersteine in Hamburg-St. Pauli Biographische Spurensuche August 2009, 256 Seiten Benedikt Behrens Stolpersteine in Hambug-St. Georg Biographische Spurensuche November 2009, 244 Seiten Christa Fladhammer/ Maike Grünwaldt Stolpersteine in der Hamburger Isestraße Biographische Spurensuche Mai 2010, 294 Seiten 255 Ca. 3300 Stolpersteine erinnern inzwischen in Hamburg an Menschen, die während der NS-Zeit ermordet worden sind: an Juden, Sinti, Homosexuelle, politisch Verfolgte, „Euthanasie“-Ermordete, Zeugen Jehovas oder andere. Carmen Smiatacz und ihre Mitautorinnen und -autoren haben die Biographien von mehr als siebzig Personen aus Barmbek und Uhlenhorst recherchiert, für die Stolpersteine verlegt worden sind. Ihre Lebens- und Leidensgeschichten sind hier nachzulesen. Stolpersteine in Hamburg-Barmbek und Hamburg-Uhlenhorst Biographische Spurensuche Umschlag v+r:. 30.08.10 10:00 Seite 1 Stolpersteine in Hamburg-Barmbek und Hamburg-Uhlenhorst Biographische Spurensuche Carmen Smiatacz Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung Amt für Bildung Landeszentrale für politische Bildung