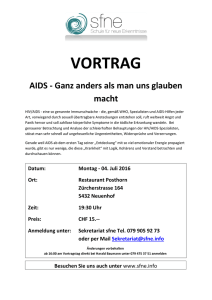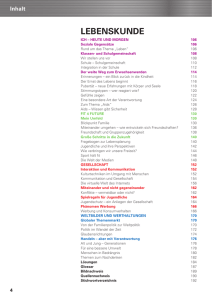- Universität Regensburg
Werbung

140 Jürgen Merz von Gruppenübungen und _Rollenspielen die notwendigen Einstellungs- und Verhal­ _ tensanderungen eingeü t Anderung des Sexualverhaitens, gesunde Ernährung, etc. ). . . Dane en erf ?lgt eme Emfuhrung m Entspannungsübungen. Im 3.Teil schließlich ste­ hen dIe erwahnten Visualisie�ungsübungen ynd Meditationen im Vordergrund. Die . PatIenten werden dazu angeleltet,derartige Ubungen zunehmend auch außerhalb der � ( � 141 AIDS-relevante Verhaltensweisen bei jungen Erwachsenen Die Verbreitung AIDS-relevanter Verhaltensweisen bei jun­ gen Erwachsenen Helmut Lukesch Gruppenstunden in eigener Regie zu machen. � U se�e bisherigen Erfahrungen z�igen �indrucksvoll, daß durch die "Positiven-Grup­ pe Angste abgebaut werden. DIe PatIenten lernen mit 'ihrer Krankheit konstrukti­ ver umzugehen �nd diese als Herausforderung anzunehmen. Wenn sie Angst oder . HoffnungslosIgkeIt oder anderer emotionaler Streß "überfällt", haben sie in den Vorstellungs- und Entspannungsübungen offensichtlich ein hilfreiches Gegenmittel � Außerdem aben wir wiederholt beobachtet, daß sich auch der Immunstatus verbes . . sert. EmpIrIsch abgesIcherte Effektivitätsprüfungen stehen aber noch aus. � 1. Problemstellung Die Rahmenbedingungen für die AIDS-Problematik sind weitgehend bekannt. Die Krankheit AIDS wird durch einen Lentivirus ausgelöst, der sich in der Regel erst lange Jahre nch der HIV-Infektion in Krankheitssymptomen äußert. Auch ohne manifeste Symptomatik kann der Infizierte den Virus weitergeben. Der Virus selber ist schwer übertragbar, nur bei direkten Kontakten mit Körperflüssigkeiten Infizierter (z.B. Blut, Samen) kommt es zu Ansteckungen. HIV -Infektionen und AIDS-Erkrankungen sind in der Bundesrepublik noch weitgehend auf sog. primäre Risikogruppen beschränkt Literaturverzeichnis (homo- und bisexuelle Männer, i.v. Beitel, E., et al (1983). Bochumer Gesun dheitstraining. Bochum: Ruhr- Unive rsität. Boerner,M. (1989). Die Chance Aids. München. Juchheim,J. & Poschet,J. (1989). Immu n - das Ernährungsprogramm zur Stärku ng des Immunsystems. München. Simonton, O.C., Matthews-Simonto n ' St. werden. Hamburg: Rowohlt. & Creighton, J. (1982). W ieder gesund Personen, Hämophile). Drogenkonsumenten, Prostituierte oder hwg­ Eine Ausbreitung der Epidemie über diese Risikogruppen hinaus auf andere Bevölkerungssegmente wird aufgrund vorliegender Simulationsstu­ dien als sicher prognostiziert, ist z . T . bereits eingetroffen (BGA, 1988). Ein effektives Heilmittel gegen die Infektion ist ebenso wenig in Sicht wie ein Impfstoff, durch den eine vorbeugende Immunisierung erzielt werden könnte. Denkbare Wege zur Eindämmung weiterer Infektionen sind neben seuchenhygienischen Maßnahmen Aufklärungs- und Informationskampagnen (in Einzelfällen auch psychologische Trai­ nings), um Verhaltensweisen, die für die Weiterverbreitung des V irus als besonders gefährlich gelten, zu ändern. In einigen Studien (vorwiegend an Homosexuellen) konnte in der Tat gezeigt werden, daß durch Aufklärung Verhaltensänderungen zustande kommen können, daß aber auch bestimmte Konstellationen solchen Veränderungen entgegenstehen. Besondere Schwierigkeiten bilden der Zusammenhang von Sexualität und Alkoholkonsum (Isra· elstam & Lambert, 1986), die Drogenszene (Görgens, Kathke & Krahnke, 1987; Stall et. al, 1986) sowie die Prostitution. Da nach Simulationsstudien die jüngere Alterskohorte (sog. Disco Jugend) als das Bevölkerungssegment angesehen werden muß, in der sich die HIV -Epidemie in Zu­ kunft verstärkt ausbreiten wird, wenn nicht die eingeschlagenen Maßnahmen greifen (Dörner, 1986; Hein, 1987; Runkel, 1986), war es für uns von Interesse zu untersu· ehen, welche Verhaltensweisen, die für die Verbreitung des HIV von Bedeutung sind, in welcher Häufigkeit in diesem Bevölkerungssegment vorkommen. 2. Methode Die Untersuchung fand gruppenweise im Rahmen von Studio-Tests über die Bewer· tung 20 in- und ausländischer AIDS-Spots statt (Lukesch et al. , 1988, 1989). Ins· gesamt wurden 322 Probanden in die Untersuchung einbezogen. Die Befragung fand in 22 Gruppensitzungen statt. Die Probanden bildeten eine anfallende Stichprobe und setzten sich aus Universitäts- oder Fachhochschulstudenten (n=61), Mitgliedern 142 Helmut Lukesch der Landjugend (n=71), Bundeswehrangehörigen (n=119), Schülern aus Fachakade­ mien bzw. anderer Schulen (n=41) bzw. Besuchern von Freizeiteinrichtungen (n=30) zusammen. demographischen Merkmalen Variable Geschlecht Konjessionszugehörigkeit männlich 66,7% Alter (in Jahren) aM katholisch 67,0% evangelisch 17,8% andere/keine 6,2% 21,39 s 3,82 Religiöse Überzeugung überzeugt Herkunft 42,3% unentschieden/ Landgemeinde 44,7% Klein- bis Mittelstadt 34,1% Großstadt 21,2% Schulabschluß Volks-, Haupt-, gleichgültig 29,3% ablehnend 28,4% Politische Orientierung CDU/CSU 21,2% SPD 14,8% FDP Berufsschule 35,6% Grüne Realschule 14,0% weiter "links" Gymnasium 15,9% weiter "rechts" Fach-, Fachhoch- keine schule 14,9% Universität 19,6% Auch riskante Verhaltensweisen sind in dieser Gruppe in beträchtlicher Häufigkeit an­ zutreffen. Nach Eichner und Habermehl (1978, S. 338) gaben von den homosexuellen Männern 69% an, im vergangenen Jahr aktiv anal-genitalen Verkehr ausgeführt zu haben, 57% hatten passiv anal-genitalen Verkehr, fast ubiquitär war oral-geni- taler Verkehr (aktiv 95%, passiv: 97%). In der vorliegenden Studie bezeichneten 7,3% der männlichen Befragten ihre sexuelle Tabelle 1: Beschreibung der Stichprobe nach sozioVariable 143 AIDS-relevante Verhaltensweisen bei jungen Erwachsenen Orientierung als nicht ausschließlich heterosexuell (vgl. Tab. 2). Im Vergleich zu den an einer studentischen Stichprobe gewonnenen Ergebnissen von Clement (1986, S. 1126) sind dies relativ wenig Befragte. Zieht man jedoch Untersuchungen unter Einschluß der erwachsenen Allgemeinbevölkerung heran, so scheinen die vorliegenden Daten bekannten Gegebenheiten zu entsprechen. So hatten bei Wottawa (1979, S. 569) 4,7% der männlichen Befragten homosexuellen Geschlechtsverkehr angegeben (1,5% ausschließlich homosexuell, 3,2% homo- und heterosexuell). Auch bei Clement (1986, S. 125) sind aktuelle homosexuelle Kontakte bei 5% der männlichen Befragten vorhanden. Aus der Erhebung von Eichner und Habermehl (1978, S. 332) läßt sich der Anteil homosexueller Männer auf ca. 3,5% schätzen. Damit bestätigen sich seit langem gefundene Verteilungen, hatte doch schon Hirschfeld (1920, zit. n. Kinsey et al., 1970) 2,3% homo- und 3,4% bisexueller Männer festgestellt. Tabelle 2: Sexuelle Orientierungen männlicher Befragter (Angaben in %) Autor N 2,3% 17,0% nur hete- vorwie- bise- vorwie- aussch!. ro-sexu- gend he- xuell gend homo- eil tero-se- homo- sexuell 7,4% 3,2% 34,1% Clement 1068 78 18 2 1 1 215 92,7 2,0 1,0 1,0 3,4 74,3 11,4 :.1,9 5,7 5,7 (1986) Untersuchungs- 3. Ergebnisse sexuell xuell (der männ- daten lichen (1988) Befragten) 35 (nur Studenten) 3.1. Homo- und bisexuelle Orientierung der männlichen Befragten Es steht nach den Angaben des Bundesgesundheitsamtes fest, daß knapp drei Viertel der AIDS-Kranken aus homo- oder bisexuellen Männern besteht. In der Geschichte der HIV-Epidemie ist diese Gruppe wiederholt als besonders gefährdet bezeichnet worden, wobei je nach Untersuchungszeitpunkt und -ort beträchtlich hohe Durchseu­ chungsgrade ?efunden wurden (Koch, 1987). Es bedeutet auch nur eine marginale AkzentverschIebung, wenn anstatt von Risikogruppe von Risikoverhalten gesprochen wIrd (Caruso & Halg, 1987), da gerade die für die HIV -Verbreitung riskanten Verhal­ tensw�isen in dieser � ruppe eine besonders hohe Verbreitung besitzen. Dazu gehört zu� emen hoch pro lskes Sexu�lverhalten, von Dannecker und Reiche (1974) wurde � bel Homosexuellen eme BandbreIte an Sexualpartnern zwischen 4 und 3 000 gefunden. Etwas höher sind die Angaben bei der Frage nach sexuellen Kontakten zu Homosexu­ ellen in den letzten 12 Monaten. Hier geben in der vorliegenden Untersuchung 11,7 % der männlichen Befragten an, solche Kontakte gehabt zu haben. F ür die AIDS-Problematik bedeutet dies insgesamt, daß die von der Krankheit ausge­ hende Bedrohung nicht zu einer Umpolung der grundlegenden sexuellen Orientierung geführt hat, was im Grunde auch nicht zu erwarten war. Auch die homosexuellen Kontakthäufigkeiten sind sicherlich nicht rückläufig. Daß es einen Austausch zwischen der homo- und der heterosexuellen Sexualszene gibt, ist lange vor dem Aufkommen der AIDS-Thematik belegt worden; so hatten 144 Helmut Lukesch � AIDS-relevante Verhaltensweisen bel jungen Brwachsenen 145 iche (1974) unter den von ihnen befragten Homosexuellen 5% ge­ Dannecke� und funden, die verheiratet waren, 4% waren geschieden bzw_ verwitwet und 1% lebte ge­ bestehen in der Häufigkeit von Risikokontakten zwischen den Geschlechtern, wobei trennt von ihrenFrauen. Dieses spezielle Problem ist auch nach den vorliegenden Da­ männlicheBefragte z. T. zehn Mal häufiger mit Risikogruppen verkehren als Frauen. gruppen liegt die Kontakthäufigkeit zwischen 7% und 8%. Gravierende Unterschiede ten in den 4% bisexueller junger Männer zu sehen (Zusammenfassung der Kategorien Junge Männer setzen sich demnach häufiger Gefährdungen aus, reichen diese dann vorwiegend heterosexuell bis vorwiegend homosexuell), da von diesen möglicherweise aber wieder an junge Frauen weiter. wichtige Sexualimporte aus der homosexuellen Szene zu jungenFrauen ausgehen. Er­ Schulartzugehörigkeit signifikante Differenzen; durchgängig auffällig ist, daßBefragte fahrungsberichte, wonach ca. die Hälfte der Homosexuellen bisexuelle Phasen durch­ mit niedrigerem Schulabschluß im Vergleich zu Studenten zwei- bis viermal so häufig gemacht haben, liegen auch aus Dänemark vor (Ebbensen,Biggar & Melby, 1984). Risikokontakte eingehen. 3.2. Risikogruppenkontakte Ein Vergleich mit früherenBefunden kann vor allem in bezug auf den Kontakt mit Eine weitere Frage bezog sich auf die sexuellen Risikogruppenkontakte. Ein solcher Kontakt ist allerdings nur eine Vorbedingung, für ein eigenes Risiko, denn für die S. 552) ca. tatsächliche Gefährdung müßte naheliegenderweise hinzukommen, daß bei der ande­ ren Person eine HIV- Infektion vorliegt. Risikogruppenkontakte Bluter Homo- Pro- Drogenstit. kons. Kunden v. hwg- Prostit. Pers. Prostituierten zurück, bis 45 Jahre hatten 69% der von ihm befragten US-Bürger zumindest einmal Kontakt zu Prostituierten. Nach Eichner und Habermehl (1978, Prostituierten gekommen. Unter Studenten ist nach Clement (1986, S. 113) eine noch geringere Erfahrungshäufigkeit gegeben, nämlich nur 13% hatten jemals einen solchen Kontakt, dabei ist außerdem ein Rückgang im Vergleich von vier Studenten­ generationen festzustellen. Nach den vorliegenden Daten ist im Vergleich hierzu ein Jahr einem solchen Kontakt ausgesetzt. Da bei der Prostitution die Verwendung von Kondomen nur bedingt durchsetzbar war (Maiworm, 1988), ist in diesemBereich ein Bedarf für weitergehende Aufklärung zu sehen. 7,4 8,2 7,0 7,4 7,2 13,5 Kontakte zuBlutern und Drogenkonsumenten werden in 7,4% derBefragten berichtet. Hinsichtlich der Drogenkonsumentenkontakte müßte noch zwischen den F ixern und anderen unterschieden werden. Geschlecht männlich (N==210) (1970, weiterer Rückgang gegeben. Allerdings hat sich jeder zehnteBefragte im vergangenen Gesamt (N==322) So geht nach dem Klassiker Kinsey et al. 4% der männlichen "Gesamt-Triebbefriedigung" auf Beziehungen mit S. 326) sind in derBundesrepublik allerdings nur 39% der Männer in Kontakt mit Tabelle 3: Häufigkeit von Sexualkontakten zu AIDS-Risikogruppe n in den letzten 12 Monaten, aufgeteilt nach soziodemographischen Kriterien (Angaben in %) sex. Prostituierten gemacht werden. Nach dem Geschlecht erbringt nur noch die Nur bei ersteren besteht bei Weitergabe nicht steriler Spritzen ein erhöhtes InEek­ 10,8 11,7 10,2 10,3 10,4 17,0 tionsrisiko, für die Gesamtgruppe ist aufgrund intensiverer In-Group-Beziehungen (N=105) 1,1 3,2 1,1 * 1,1 ** 6,4 beziehungen zuBlutern, da zwei Drittel dieser Personengruppe als HIV-infiziert gilt, P ** 2,1 * ** * weiblich Schulabsch/uß (N==114) 12,6 16,5 11,6 RS (N==45) 11,6 12,8 12,8 12,5 10,3 20,0 GY(N==51) 12,8 2,1 2,1 13,5 4,2 14,6 2,1 2,1 14,6 FH,FHS 0,0 2,3 0,0 Univ. (N==63) p wiewohl erst 3% der Infizierten an AIDS erkrankt sind (Mölling, 1988). 3.3. Sexuelle Lib e ral ität VS, S,BS (N==48) ein erhöhtes Kaskadenrisiko gegeben. Hoch risikobehaftet sind ungeschützte Sexual­ 0,0 0,0 9,1 5,0 3,3 5,0 * 6,7 ** 3,4 ns 5,0 * * ns Es gehört in der Regel zur sexuellen Entwicklung, daß Sexualität nicht nur mit einem oder einer Partner(in), sondern mit mehreren erlebt wird. Auch wenn nicht davon ausgegangen werden kann, daß Promiskuität - im Sinne des Fehlens jeglicher verhal­ tenssteuernder Normen - als Modalverhalten vorkommt, so zeigf'n doch die vorliegen­ den Erfahrungen, daß strikt monogameBeziehungen keineswegs das ausschließliche Beziehungsmuster darstellen. Noch weniger kann dies für junge Erwachsene gelten, die erst in der Phase der Partnerfindung und der Erprobung ihrer Sexualität sind. Selbst in relativ festen Beziehungsformen kommen nach Wottawa (1979, S. 589) ge­ legentliche Seitensprünge bei 55% der Männer und 34% der Frauen vor; wobei die Am häufigsten geben dieBefragten an (vgl. Tab. 3), sie hätten sexuellen Kontakt zu Bereitschaft dazu um ca. 10% höher ist als die tatsächliche Erfahrung. In der studen­ Personen mit häufig wechselnden Sexual partnern. Mit Angehörigen anderer Risiko- tischen Population haben nach Clement (1986, S. 125) immerhin 28% der Studenten 146 Helmut Lukesch und 23 % der Studentinnen sexuelle Außenbeziehungen in festen Partnerschaften er­ probt. Auch ungewöhnliche Sexualpraktiken sind nicht so ungewöhnlich, wie es den Anschein hat (Wottowa 1979, S. 589; Eichner & Habermehl, 1978, S. 332 und 181). In der untersuchten Stichprobe haben erst 46,9% eine feste Beziehung gefunden, 35,8% sind noch ohne Partner(in) und die restlichen 17,3% sind in eine bzw. mehrere 147 AIDS-relevante Verhaltensweisen bei jungen Erwachsenen eine dieser Gruppe sind auch mehr als drei Viertel davon überzeugt, daß Präservative von einem Drittel. Ge­ Schutzmöglichkeit darstellen, benützt werden diese aber nur einzelner nerell zeigt sich, daß in fast allen F ällen mehr Befragte von der Effizienz Verhaltensweisen wissen, diese aber dennoch nicht in ihrem Sexualleben realisieren (vgl. auch Schmitt & Israel, 1986). (lockere) Beziehungen involviert. Als Momentaufnahme betrachtet, sind also mehr als die Hälfte der Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren auf Partnersuche und selbst bestehende Beziehungen können nicht als Endpunkt angesehen werden. Sexuelle Treue wird von 56,7% der Befragten als unbedingt notwendig angesehen und etwa gleich viele meinen, außerehelicher Geschlechtsverkehr sei bei Männern oder Frauen nicht zulässig. Sexuelle Liberalität nimmt mit dem Alter zu, ist naheliegenderweise unter religiös gleichgültigen bzw. ablehnend eingestellten weiter verbreitet und weist auch eine deutliche parteipolitische Affinität auf. \ geändert hat (vgl. hierzu auch Runkel, 1986). Grundlegende sexuelle Orientierungeo sind gleich geblieben, mit ca. 7% ist der Anteil der bisexuellen männlichen Befragten der Befragten ist die Partnersuche ein aktuelles T hema und selbst für die in einer festen Beziehung sind Änderungen bzw. Außenbeziehungen möglich. Obwohl gleich­ Art der gegebenen Partnerbeziehung (N = 278) nur Befragte mit zeitig sexuelle Beziehungen zu mehreren Partnern nur von jedem sechsten angegeben heterosexueller Orientierung (Angaben in % der Ja-Antworten) werden kann die sexuelle Partnerschaftsform mehrheitlich als sukzessiv monogam, r' mit de Option auf gelegentliche Drittkontakte, gekennzeichnet werden. Art der Partnerbeziehung Maßnahme Sexualverhalten unter der lebensbedrohenden Gefahr von AIDS nicht gravierend partement der Homosexuellen und dem der Heterosexuellen. F ür mehr als die Hälfte beim Geschlechtsverkehr vor AIDS zu schützen, aufgeteilt nach eingehaltene Rückblickend läßt sich aufgrund der gefundenen Ergebnisse feststellen, daß sich das relativ hoch; diese Befragten besorgen einen sexuellen Austausch zwischen dem Com­ Tabelle 4: Befürwortete und tatsächlich eingehaltene Maßnahmen, um sich Befürwortete/ 4. Diskussion keine Partner- eine feste sex. mehrere sex. beziehung Beziehung Beziehungen N=94 N=134 N=50 Risikogruppenkontakte sind in beträchtlichem Ausmaß gegeben, wobei mit solchen Kontakten auch die Selbstzurechnung zur AIDS-Risikogruppe zunimmt (signifikante p immer nur mit 68,8 69,9 60,0 ns einem einzi- 30,0 76,3 36,0 ** Unterschiede bei Sexualbeziehungen zu Homosexuellen, Drogenkonsumenten und hwg-Personen), aber keineswegs jeder mit solchen Kontakten sich selbst den Risi­ kogruppen zurechnet (vgl. auch Kreutz, 1986). Diskrepanzen sind feststellbar zwischen den generell befürworteten und den tatsäch­ gen Partner zu- lich eingehaltenen Schutzmaßnahmen vor AIDS. Vor allem der Verzicht auf Kondome sammensein (ab- in nicht festen Beziehungen und der trotz besseren W issens weiterhin vorhandene solut treu sein) sexuelle Kontakt zu Risikogruppen geben zu Bedenken Anlaß. Präservative 77,4 79,3 78,0 ns benutzen 26,7 23,7 32,0 ns Die Einstellungs-Verhaltens-Diskrepanz ist z. T. mit Wissenslücken über AIDS zu erklären. Obwohl das W issen über Übertragungswege und das Wesen der Krankheit ganz auf Sex 8,6 3,8 8,0 os prinzipiell gut ausgebildet ist, sind hier noch Verbesserungen denkbar (vgl. verzichten 4,4 3,8 4,0 os keinen Kontakt 53,8 45,9 54,0 ns zu Risikogruppen 33,3 23,7 40,0 ns hierzu auch Emmons et al., 1986). Im besonderen müßte auf die Tatsache hingewiesen wer­ den, daß eine Weitergabe der mV -Infektion auch bei Nichtsymptomträgern möglich ist, daß AIDS nicht auf die sog. Risikogruppen beschränkt ist und daß AIDS in ab­ sehbarer Zukunft nur durch Verhaltensänderungen, nicht aber durch Medikamente bekämpft werden kann. Vergleicht man die Antwortmuster zu den Einstellungsfragen mit den Angaben zu den bestehenden Partnerformen, so werden von wesentlich mehr Befragten in sexueller Hinsicht liberale Positionen vertreten als tatsächlich gelebt. Das Potential an sexueller Freizügigkeit scheint also auch in diesem Bevölkerungssegmeot wesentlich größer zu sein,als es gemessen an der realisierten Form der Partnerbeziehung ist. In eine andere Richtung diskrepant sind befürwortete und tatsächlich realisierte Maß­ nahmen, um sich beim Geschlechtsverkehr vor AIDS zu schützen (vgl. Tabelle 4). Z.B. meinen von den Befragten, die ihren Angaben gemäß in mehrere sexuelle Bezie­ hungen involviert sind, immerhin 60%, daß absolute Treue vor AIDS schütze. Von Neben deo bereits eingeschlagenen Maßnahmen der Aufklärung über das Fernse­ hen, der Verteilung von Broschüren für bestimmte Zielgruppen oder Plakatierungs­ aktionen ist zu überlegen, ob nicht verstärkt von Trainings- (Kelly & Lawrence, 1987) oder Gruppendiskussionen als Aufklärungsstrategie Gebrauch gemacht wer­ den sollte (Valdiserri et al., 1987). Bekanntlich hat schon Lewin (1947) nachweisen können, daß Entscheidungen, die in der Auseinandersetzung mit den Meinungen an­ derer in einer Kleingruppe erarbeitet werden, im Gegensatz zu anonym angewandten Aufklärungsstrategien eine größere Verhaltensrelevanz besitzen. Solche Methoden werden bereits im Schulunterricht (DiClemente, Zorn & Temoshok, 1987) oder bei 148 H<>lmllt Lukescll der Bundeswehr angewandt, sie müßten aber auch in Universitäten im Rahmen der Gesundheitserziehung praktiziert werden (Caruso & Haig, 1987). Kinsey, A.C., Pomeroy, W.B. & Martin, C.C. (1970). Mannes. Kreutz, H. (1986). Bundesgesundheitsamt (1988). BGA-Zahlen vom 30.11.1988. AIDS-Forschung, 3, 708. �.�. & Haig, J R.(1987). Aids on campus: A survey of college health service .' . : pnontJes and poltcles. Journal 0/ American College Health, 36 (1), 32 - 36. Sexualität im sozialen Wandel. Eine empirische Vergleichsstudie an Studenten 1966 und 1981. Stuttgart: Enke. Dannecker,M. & Reiche,R. (1974). F ischer. Der gewöhnliche Homosexuelle. Frankfurt a.M.: DiCleme�t�, R.J., Zorn, J. & Temoshok, 1. (1987). The association of gender, . ethmclty and length of resldence in the Bay area to adolescents' knowledge and attitudes abo t Acquired Immune Deficiency Syndrome. Special Issue: Acquired � Immune Deficlency Syndrome (AIDS). Journal 0/ Applied Social Psychology ' 17 (3), 216 - 230. Dörner,D. (1986). Ein Simulationsprogramm für die Ausbreitung von AIDS. randum Lehrstuhl /ür Psychologie 1I, No. 40. Memo­ Ebbensen,P.,Melbye, M. & Biggar,R.J. (1984). Sex habits recent disease and drug use in two groups of Danish male homosexuals. Archiv s 0/ Sexual Be avior' 13 m ,291 - 300. � Eichner,K. & Habermehl, W. (1978). Der RALF-Report. Deutschen. Hamburg: Hoffmann & Campe. Emmons, h Das Sexualverhalten der' � .-A., Joseph, J.G., Kessler, R.C. & Wortman, C.B. et al (1986). Psy­ . chosoclal predlctors of reported behavior change in homosexual men at risk for AIDS. Health Education Quarterly, 13 (4), 331 - 345. Görgens, K., Kathke, N. & K �ahnke, H. (1987). Psychosoziale Problemfelder. . Gesundheitserziehung und Anderung im Sexualverhalten bei HIV-Infekt ionen. AIDS-Forschung, 2 171 - 175. Hein, K. (1987). AIDS in adolescents: A rationale for concern. Special Issue: Acquired immunodeficiency syndrome. New York State Journal 0/ Medicine, 87 (5) , 290 - 295. Hirschfeld, M. (1920). AIDS. Vom Molekül zur Pandemie. Heidelberg: Spektrum der W issenschaft. Literaturverzeichnis Clement,U. (1986). Das sexuelle Verhalten des Frankfurt: F ischer. Koch, M.G. (1987). Caruso 149 AIDS-relevante Verhaltensweisen bei jungen Erwachsenen Die Homosexualität des Mannes und des Weibes. handlung. Berlin: 1. Marcus. Verlagsbuch­ Israelstarn,St. & Lambert, S. (1986). Homosexuality and alcohol: Observations and research after the psychoanalytic era. International Journal 0/ the Addictions' 21, 509 - 537. Kelly, J.A. & Lawrence, J.S. (1987). The prevention of AIDS: Roles for behavior intervention. Scandinavian Journal 0/ Behaviour Thempy, 16 (1) ,5- 19. Der pragmatische Wert von Umfragedaten und das Problem der Heterogenität von Populationen. Einige methodische und ideologie--kritische Bemerkungen zur aktuellen AIDS-Diskussion. (2 - 3), Angewandte Sozial/orschung, 14 129 - 131. Lewin, K. (1947). Hartley (Eds.). Group decision and social change. Readings in Social Psychology, In T.M. Newcomb & E.L. 330 - 344. New York: Holt. Lukesch, H. Aumeier,R., Bachhuber,R.,Baisi,M.,Bauer,M.,Brandl, A.,Ingrisch, M.,Köglmeier,E.,Linner,A.,Riedinger,N.,Stiebler,J. & WeinzierI, M. (1988). AIDS-Aufklärung im Fernsehen. Eine Untersuchung über Rezeption und Bewer­ tung bundesdeutscher und ausländischer Aids-Spots sowie über aidsbezogene Ver­ haltensweisen, Maßnahmenkatalog und Wissensbestände bei der Disko-Jugend, Teil I. Regensburg: Unveröffentlichter Projektbericht. Lukesch,H.,Aumeier,R.,Bachhuber,R.,Baisi, M.,Bauer, M.,Brandl, A.,Ingrisch, M.,Köglmeier,E.,Linner,A.,Riedinger, N., Stiebler,J. & WeinzierI,M. (1989). AIDS-Aufklärung im Fernsehen. Eine Untersuchung über Rezeption und Bewer­ tung bundesdeutscher und ausländischer Aids-Spots sowie über aidsbezogene Ver­ haltensweisen, Maßnahmenkataloge und Wissensbestände bei der Disko-Jugend, TeilII: Auswertung der offenen Fragen. Regensburg: Unveröffentlichter Projekt­ bericht. Maiworm, H. (1988). Diskussionsbeitrag über AIDS-Prävention bei weiblichen Pro­ stituierten aus der Sicht eines "Bordell- betreibers". AIDS-Forschung, 3, 432 - 471. Mölling, K. (1988). Das AIDS- Virus. Weinheim: Edition Medizin, VCH. Runkel, G., (1986). AIDS und das Sexualverhalten der Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Eine vorläufige Auswertung. 3), Angewandte Sozial/orschung, 14 (2 - 133 - 14l. Schmitt, B. H. & Israel, D. (1986). Conceptions, misconceptions, contraception - what do young people know about AIDS. Interactive paper presented at the 21st International Congress 0/ Applied Psychology, Jerusalem, Israel, July 13 - 18, 1986. Stall, R., McKusick, L, Wiley, J. & Coates, T.J. et al. (1986). Alcohol and drug use during sexual activity and compliance with safe sex guidelines for AIDS: The AIDS behavioral research project. Health Education Quarterly, 13 (4), 359 - 371. Statistisches Bundesamt (1988). land. Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Deutsch­ Stuttgart: Kohlhammer. 150 Helmut Lukesch Valdiserri, R. 0., Lyter, D. W., Kingsley, L.A. & Leviton, 1. C. et aL 151 (1987). Krankheitsverarbeitung The effect of group education in improving attitudes about AIDS risk reduction. Special Issue: Acquired immunodeficiency syndrome. New York State Journal of Medicine, Wottawa, W. 87 (5), 272 (1979). Das - 278. sexuelle Verhalten der Deutschen. Rastatt: Moewig. Der ersteBeitrag im Themenblock Krankheitsverarbeitung beschäftigt sich mit grund­ lagenbezogenen Überlegungen zur Diagnostik derBelastungsverarbeitung. Dr. M•.:h­ ad Reicherts (UniversitätFribourg) stellt nach einer Systematik:tu belastungsdiagn.Js­ tischen Personmerkmalen eine neue, computergestützte Methode zur Erhebung von Selbstbeobachtungsdaten vor. Dr. Georg Jungnitsch (Rheuma-Klinik Oberarnmergau) berichtet über die Entwick­ lung eines Krankheitsbewältigungstrainings für Patienten mit chronischer Polyarthri­ tis. Im Unterschied zu konventionellen Programmen handelt es sich dabei um ein Behandlungskonzept, das nicht nur psychologische Unterstützung zur Bewältigung von Schmerzen, sondern auch für die vielfältigen Probleme, die mit der Erkrankung einhergehen, beinhaltet. Zwei weitereBeiträge beschäftigen sich ebenfalls mit Personen, die an chronischer Po­ lyarthritis (cP) erkrankten. DieBedeutung der Persönlichkeitsvariable Geschlechts­ identifikation für das Bewältigungsverhalten von cP-Erkrankten untersucht Barbara Gaukler (Universität Regensburg). Dabei zeigt sich, daß "androgyneU Patient(inn)en vielfältigere Copingstrategien verwenden und damit über eine erhöhte Verhaltensflexi­ bilität verfügen. Mit dem Einfluß der Qualität einer Partnerschaft auf das körperliche und psychosoziale Wohlbefinden von cP-Patienten beschäftigt sich die Studie von Regina Schuier (Universität Regensburg). Lediglich spezifische Aspekte der Partner­ schaft, wie ein geringes Ausdrücken von Gefühlen in der Partnerschaft, standen in einerBeziehung zur körperlichenBeeinträchtigung und erlebten Depression. Basierend auf einer Analyse der veränderten Lebenssituation von Dialysepatienten in den Lebensbereichen Beruf, Familie und Freizeit geht Ingrid Schön (Universität Regensburg) insbesondere darauf ein, welche kognitivenBewältigungsstrategien diese Personengruppe benützt. Bedingt durch das intensiveBehandlungssetting stellt für Dialysepatienten der Umgang mit dem medizinischen System (Personal-Patient­ Beziehung) eine bedeutsame Quelle für Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit dar. ZweiBeiträge zu Aspekten der Krankheitsbewältigung bei Typ-II- Diabetikern run­ den diesenThemenblock ab. Dabei zeigt Dipl.-Psych. Bernhard Kulzer (Fachklinik für Diabetes, Bad Mergentheim), daß der Umgang mit verschiedenen krankheits­ bedingten Anforderungen (z.B. regelmäßige Einnahme vonTabletten oder Diätplan einhalten) abhängig ist von der Wahl bestimmter Bewältigungsformen. Insbeson­ dere die Gewichtsreduktion sowie das Einhalten eines Diätplanes sindBereiche, in denen psychologische Konzepte noch stärker in eine umfassende Diabetesbehand­ lung einbezogen werden müssen. Ludwig Hartmannsgruber widmet sich den kogniti­ ven Repräsentationen, dieT yp-II-Diabetiker von ihrer Krankheit haben (subjektive Krankheitstheorie). Das Auftreten mangelnder Compliance bei Diabetikern wird da­ bei als Folge kognitiver Verzerrungen, insbesondere hinsichtlich Ernährung und Be­ deutung der Spätfolgen, gesehen.