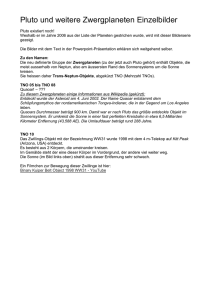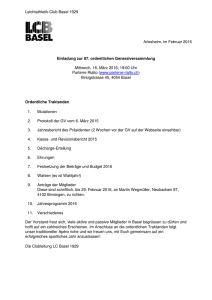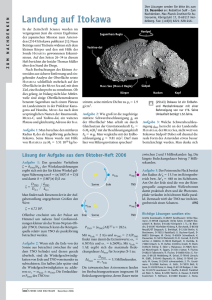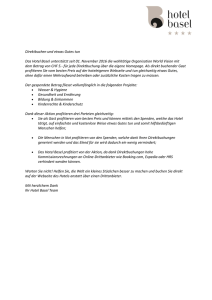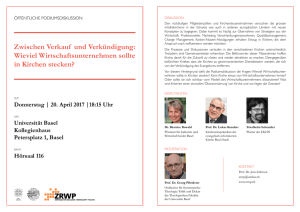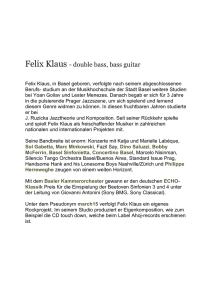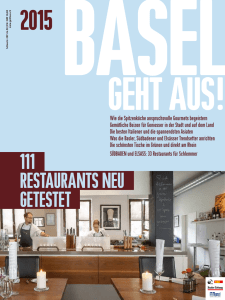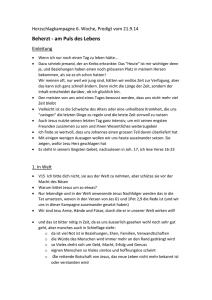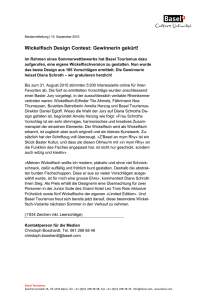Nachnutzung der Liegenschaft Rittergasse 4, Basel
Werbung

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Hochbau- und Planungsamt Nachnutzung der Liegenschaft Rittergasse 4, Basel Potentialanalyse Teilprojekt 1 Ernst Spycher, Dipl. Architekt HBK | SIA, St Johanns-Vorstadt 15, 4056 Basel MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Management Summary Die Rittergasse 4 liegt an einem gut erschlossenen und repräsentativen Ort inmitten einer historisch gewachsenen Umgebung. Die Lage zählt zu den privilegierten Lagen der Basler Altstadt und gilt daher als attraktiver Standort verschiedenster Nutzungen. Die Hülle und das Innere des Gebäudes sind intakt und in gutem Zustand, wenn auch teilweise etwas in die Jahre gekommen. Die Struktur der ursprünglichen Nutzung als Schulhaus ist immer noch ablesbar und bleibt bestimmend für allfällige Umnutzungen. Einschränkungen ergeben sich auch durch die Auflagen des Denkmalschutzes. An der Fassade können nur marginale Anpassungen realisiert werden. Ebenfalls ist mit zusätzlichen Massnahmen bezüglich Brandschutzvorschriften (Fluchtwege) zu rechnen. Ebenfalls ist mit zusätzlichen Massnahmen aufgrund von Brandvorschriften (Fluchtwege) und anderer gültiger Gesetze und Normen (z. B. Richtlinien BWG Erdbebengefährdung) zu rechnen. Die zukünftige Nutzung der Rittergasse 4 sollte mit denjenigen des Teilprojekts 2, der Rittergasse 2, Münsterplatz 10/11/12 kompatibel sein. Die Nähe beider Gebäudekomplexe erfordert eine Gesamtbetrachtung aller möglichen Nutzungen und ihrer gegenseitigen Auswirkungen. Die Analyse der verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten hat folgende Erkenntnisse hervorgebracht: Ein Schulhaus kann in den bestehenden Gebäudestrukturen einfach und mit wenigen Anpassungen realisiert werden. Die Platzierung einer Sekundarschule, wie es das Erziehungsdepartement vorschlägt, ist nach ersten Abschätzungen möglich. Ein Verwaltungsbau (Nutzung wie heute) mit Büronutzung funktioniert gut. Je nach Art der Arbeitsplatzorganisation, Einzelbüros oder Gruppenbüros, sind grössere Eingriffe in die Struktur des Gebäudes notwendig. Die bestehende Primärstruktur und Raumhöhe wären z.B. prädestiniert für Gruppenbüros. Eine Umwandlung der Rittergasse 4 in ein Wohnhaus wäre nur mit Einschränkungen bezüglich Wohnqualität möglich. Die einseitige Ausrichtung der meisten Wohnungen ist bezüglich Belichtung, Möblierbarkeit und Raumgefühl negativ zu bewerten. Weiter sind private Aussenräume wie Terrassen und Balkone aus heutigem Wissensstand nicht möglich. Die Erschliessungsflächen sind für eine Wohnnutzung zu hoch. Bezüglich Parkierung gibt es keine grossen Möglichkeiten Plätze anzubieten, was sich bei Wohnungen im oberen Preissegment nachteilig auswirken könnte. Ein Stadtmuseum hätte bezüglich Standort und Lage auf dem Münsterhügel und Nähe zu anderen Museen eine gewisse Logik. Je nach Ausgestaltung des Museums wären unterschiedliche Eingriffstiefen notwendig. Es stellt sich aber grundsätzlich die Frage der Trägerschaft. Diese müsste zuerst geklärt werden. Ein Hotel wäre in der näheren Umgebung ein Novum und es bedarf weiterer genereller Abklärungen bezüglich Eingliederung im Umfeld und Standort. Insbesondere ist auch die Art und Klassifizierung des Hotelbetriebs von grosser Bedeutung, da die Anforderungsprofile in Bezug auf Räumlichkeiten, Zugänglichkeit, betrieblichen Gegebenheiten, etc sehr unterschiedlich ausfallen können. Strukturelle Anpassungen MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel und Massnahmen im Bereich der Haustechnik wären teilweise sehr gross aber realisierbar. Bei einer Wohnhaus- oder Hotelnutzung müsste auch die Frage bezüglich Abgabe im Baurecht, mit einer vorgängigen Umwidmung vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen, diskutiert werden. Eine Rangierung würde, unter Berücksichtigung der Potentialanalyse folgende Rangliste ergeben. 1 Ein Schulhaus ist aus heutiger Sicht eine einfach zu realisierende Lösung. Die Aussenflächen (Pausenhof) sind aber, je nach Auslegung der Normen, eher zu knapp und könnte je nach Nutzung der Nachbarliegenschaften zu gegenseitigen Beeinträchtigungen führen. Ein Verwaltungsbau mit Büros funktioniert sehr gut. Für eine optimale Benutzbarkeit wären gewisse Anpassungen nötig. 2 Eine Wohn- oder Hotelnutzung wäre vorstellbar, beide verursachen jedoch grosse Anpassungen und bedürfen einer vertieften Betrachtung. Die Variante eines Stadtmuseums wäre möglich, jedoch sind dazu grundsätzliche Fragen bezüglich Trägerschaft, genauer Inhalt und Art des Museums zu klären. Basel, im April 2010 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 7 1.1 Gegenstand der Untersuchung 7 1.2 Auftrag 8 1.3 Ausgangslage 9 1.4 Rahmenbedingungen 9 1.5 Denkmalschutz 1.6 Vorgehen und Kriterien 10 2. Nutzungsvarianten 11 2.1 Potentialanalyse 13 2.2 Bewertung 14 3. Beschreibung und Darstellung der Varianten 15 3.1 Schulhaus 17 3.2 Bürohaus 21 3.3 Wohnhaus 24 3.4 Museum für Stadtgeschichte 27 3.5 Kunsthotel 30 4. Schlussfolgerung 33 5. Zusammenfassung 36 6. Beschreibung und Darstellung Reinacherhof, Münsterplatz 18 38 6.1 Schulhaus 39 6.2 Wohnhaus 41 7. Historische Entwicklung 43 7.1 Rittergasse 4 – Untere Realschule 44 7.2 Photos – Archiv Denkmalpflege 48 7.3 Pläne von Architekt Heinrich Reese 51 7.4 Photos – Flachdach 1887 | Satteldach 1915 57 7.5 Reinacherhof, Münsterplatz 18 60 7.6 Photos – Archiv Denkmalpflege 66 8. Anhang 69 8.1 Grundrisse Bestand 9 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 1. Einleitung 1.1 Gegenstand der Untersuchung In der vorliegenden Studie sollen zukünftige Nutzungsmöglichkeiten der ehemaligen „Unteren Realschule“ an der Rittergasse 4 untersucht werden.* Das L-förmige Schulhaus wurde in den Jahren 1885-1887 geplant und gebaut. Seit Mitte der achtziger Jahre wird das Gebäude als Bürohaus benutzt. Nach dem Umzug des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD), der voraussichtlich Mitte 2013 erfolgt, steht die Liegenschaft für andere Nutzungen zur Verfügung. In einem ersten Schritt werden 11 Nutzungsvarianten (öffentliche und private) untersucht, die im zweiten Schritt auf fünf Varianten reduziert werden. In den folgenden Kapiteln werden die Nutzungsvarianten auf ihr Potential hin analysiert und bewertet. Fünf ausgewählte Varianten werden im Hauptteil der Studie beschrieben, zeichnerisch dargestellt und in der Schlussfolgerung einander gegenübergestellt. Am Schluss folgt eine Zusammenfassung als Matrix und eine historische Würdigung der „Unteren Realschule“, ergänzt mit Photos und Plänen des Architekten Heinrich Reese. Im Anhang sind die Grundrisse des heutigen Bestandes aufgeführt. Die vorliegende Studie stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit bezüglich der untersuchten Möglichkeiten einer Nachnutzung der Liegenschaft Rittergasse 4. Vielmehr soll anhand der ausgewählten Varianten ein Weg für spätere Nutzungen, auch im Zusammenhang mit der Umnutzung weiterer Liegenschaften am Münsterplatz, dem Teilprojekt 2: Nachnutzung der Liegenschaften Rittergasse 2, Münsterplatz 10/11/12, aufgezeigt werden. * Der Planungsperimeter wurde im Laufe der Bearbeitung um die Liegenschaft Münsterplatz 18 (Primarschule Münsterplatz) erweitert. (siehe Seiten 62-70) 7 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 1.2 Auftrag Durch den Umzug des Bau- und Verkehrsdepartements werden am Münsterplatz mehrere Liegenschaften frei für andere Nutzungen. Das Finanzdepartement hat einen Vorgehensplan für die künftige Nutzung der freiwerdenden Liegenschaften vorgelegt. Ab Mitte 2013 werden durch den möglichen Umzug des BVD folgende Liegenschaften am Münsterplatz für andere Nutzungen verfügbar: TP1: Rittergasse 4 TP2: Rittergasse 2, Münsterplatz 10, 11,12 Gemäss RRB vom 19.8.2008 wird das Finanzdepartement beauftragt, einen Vorgehensplan für die künftige Nutzung der freiwerdenden Liegenschaften am Münsterplatz vorzulegen. Im Folgenden ist ausschliesslich das TP1 – Rittergasse 4 Gegenstand der Betrachtung. Das Ziel der Potentialanalyse ist es, unter nachfolgenden Gesichtpunkten differenzierte Aussagen zu unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes zu machen. 1. Welche Nutzungen eignen sich aufgrund der Gebäudestruktur, Nachbarschaft, Grösse etc. Die Möglichkeiten sind anhand von Text, Graphik und einer Matrix mit Wertung übersichtlich darzustellen. 2. Definieren und dokumentieren von Nutzergruppen bei möglichen Nutzungen und grobe Verifizierung auf deren Kompatibilität mit Gebäude, Nachbarschaft, Aufgabenstellung etc. Auftraggeber: Bau- und Verkehrdepartement des Kantons Basel-Stadt Hochbau- und Planungsamt Hauptabteilung Hochbau Münsterplatz 11 4001 Basel Auftragnehmer: Ernst Spycher Dipl. Architekt HBK | SIA St. Johanns-Vorstadt 15 4056 Basel Basel, im März 2010 8 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 1.3 Ausgangslage Das Schulhaus an der Rittergasse 4 wurde in den Jahren 1885 – 87 als “Untere Realschule” für Knaben gebaut. Sie war Teil einer grösseren Zahl von Schulbauten die in den Jahren 1873 bis 1903 errichtet wurden, da die Zahl der Stadtbewohner zwischen 1850 und 1900 stark gestiegen war. Ausserdem wurde 1875 an den Basler Schulen der kostenlose Unterricht eingeführt. Im neuen Schulhaus wurde Raum für 18 Klassen, Klassengrössen 36 – 48 Kinder, geschaffen. An Stelle einer dichten Bebauung an der Westseite der Rittergasse entstand ein Schulhaus für 784 Kinder. Der Neubau war mit einem Flachdach versehen, was seinem Charakter als florentinischer Renaissance-Bau entsprach. Dies geschah auch mit Rücksicht auf die Höhe der umgebenden Bauten. 1915 wurde das Gebäude aufgestockt und mit einem Satteldach versehen. Um 1983 ist das ehemalige Schulhaus zum Verwaltungsgebäude umgebaut worden. Durch Ergänzungen im rückwärtigen Bereich und dem Einbau eines Aufzuges, wurde das Gebäude aussen wie innen stark verändert. 1.4 Rahmenbedingungen Nach dem Umzug des BVD per Mitte 2013 sollen anschliessend die Umbauarbeiten für die neue Nutzung der Liegenschaft erfolgen. Der Umzug ist abhängig vom Auszug der BKB an der Spiegelgasse. Das Gebäude gehört zum Verwaltungsvermögen, und müsste im Falle einer Abgabe im Baurecht, nach vorgängigem Grossratsbeschluss, ins Finanzvermögen umgewidmet werden. 1.5 Denkmalschutz Die Liegenschaft Rittergasse 4 steht nicht unter Denkmalschutz, sie ist aber der Schutzzone zugeordnet. Für die Planungs- und Bauphase ist somit die Denkmalpflege einzubeziehen. Zonenrechtlich sind kein Anpassungen notwendig, die Liegenschaft befindet sich in der „Stadt- und Dorfbild-Schutzzone”. Gesetz über den Denkmalschutz vom 20. März 1980: Schutzzone und Schonzone §13. In der Stadt- und Dorfbild-Schutzzone sind die nach aussen sichtbare historisch oder künstlerisch wertvolle Substanz und der entsprechende Charakter der bestehenden Bebauung zu erhalten. Fassaden, Dächer und Brandmauern dürfen nicht abgebrochen werden. 9 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel In der Stadt- und Dorfbild-Schonzone darf der nach aussen sichtbare historisch oder künstlerisch wertvolle Charakter der bestehenden Bebauung nicht beeinträchtigt werden; insbesondere sollen Baukubus und Massstäblichkeit gewahrt bleiben. Im Übrigen gelten die Zonenvorschriften des Bau- und Planungsgesetzes. 1.6. Vorgehen und Kriterien Es ist abzuklären, für welche Nachnutzung das Gebäude Rittergasse 4 am besten geeignet ist, wobei in erster Linie kantonsinterne Verschiebungen beachtet werden sollen. Da sich die Rittergasse 4 für Wohnen nur bedingt eignet, sind Verschiebungen von Interesse, bei denen zum einen kantonale Stellen in Gebäuden domiziliert sind, welche in attraktiven Wohnraum umgebaut werden könnten (z.B. Münsterplatz 18) und zum anderen, wo die Gebäudestruktur der Rittergasse 4 zu den Anforderungen der kantonalen Stelle passt (Investitionsbedarf). Dabei sind ebenfalls die Investitionskosten und das Ertragspotenzial für die Umnutzung der frei werdenden Liegenschaften zu untersuchen. In dieser Studie wird der Umzug der Primarschule am Münsterplatz 18 in die Rittergasse 4 untersucht. Beurteilungskriterien: - Die frei werdenden Liegenschaften sollen die Schaffung von attraktivem Wohnraum in adäquater Menge zur genutzten Fläche in der Rittergasse 4 ermöglichen. - Attraktives Verhältnis von Investitionskosten vs. Ertragspotenzial Wohnen Eignung der Gebäudestruktur an der Rittergasse 4 für die neue Nutzung (Investitionskosten, Nutzbarkeit) 10 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 2. Nutzungsvarianten 11 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 2. Nutzungsvarianten 2.1 Potentialanalyse 2.2 Bewertung 12 sehr gut C Bürohaus Verwaltung sehr gut sehr gut sehr gut gut H Kunsthotel (privat) I Kulturhaus (öffentlich - privat) K Studentenhaus (öffentlich - privat) gut sehr gut G Kunstgalerie (öffentlich - privat) F Theologisches Seminar Universität E Museum für Stadtgeschichte gut gut B Wohnhaus D Atelierhaus sehr gut Potentialanalyse Lage A Schulhaus 2.1 Gebäudestruktur gut gut gut sehr gut gut gut sehr gut sehr gut genügend sehr gut interne Erschliessung genügend gut gut gut gut gut gut gut genügend gut Grundrissdisposition gut gut ungen. sehr gut gut genügend gut sehr gut genügend sehr gut Grundrissflächen sehr gut gut gut sehr gut gut genügend gut gut gut gut Raumtiefen gut gut genügend sehr gut gut gut sehr gut gut genügend gut Geschosshöhen sehr gut gut gut gut gut sehr gut gut sehr gut sehr gut sehr gut Fensterachsen gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut natürl. Raumbelichtung gut gut gut gut gut genügend genügend gut gut gut extere Erschliessung genügend genügend genügend genügend gut gut gut sehr gut genügend sehr gut Eingriff in Bausubstanz viel viel viel viel viel viel wenig wenig viel wenig Erweiterbarkeit kein keine keine keine kein keine keine keine keine keine Ausbauresrve kein keine keine keine kein keine keine keine keine keine Freiflächen - Umgebung sehr gut gut gut gut gut gut sehr gut gut gut gut Wirkung auf Umgebung gut gut gut gut gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut Repräsentation sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut Auffindbarkeit (Adresse) sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut Akzeptanz gut sehr gut sehr gut gut genügend gut genügend gut gut gut Realisierbarkeit gut genügend genügend genügend genügend ungen. gut sehr gut genügend sehr gut Gesamtbeurteilung Baukosten 2 1 2 1 1 1 1 1 2 B Wohnhaus C Bürohaus Verwaltung D Atelierhaus E Museum für Stadtgeschichte F Theologisches Seminar Universität G Kunstgalerie (öffentlich - privat) H Kunsthotel (öffentlich - privat) I Kulturhaus (öffentlich - privat) K Studentenhaus (öffentlich - privat) 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 Gebäudestruktur Bewertung: 1 = sehr gut | 2 = gut | 3 = genügend | 4 = ungenügend 1 Bewertung Lage A Schulhaus 2.2 interne Erschliessung 3 1 2 2 2 2 1 1 3 1 Grundrissdisposition 2 2 4 1 1 3 2 1 3 1 Grundrissflächen 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 Raumtiefen 2 2 3 1 1 2 1 2 3 2 Geschosshöhen 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 Fensterachsen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 natürl. Raumbelichtung 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 extere Erschliessung 3 3 3 3 4 2 2 1 3 1 Eingriff in Bausubstanz 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 Erweiterbarkeit 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ausbauresrve 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Freiflächen - Umgebung 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 Wirkung auf Umgebung 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Repräsentation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Auffindbarkeit (Adresse) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Akzeptanz 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 Realisierbarkeit 2 3 3 3 3 4 2 1 3 1 41 41 45 39 43 43 37 32 46 32 Gesamtbeurteilung Baukosten MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 3. Beschreibung und Darstellung der Varianten 15 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 3. Beschreibung und Darstellung der Varianten Für die weitere Bearbeitung wurde die Liste der untersuchten Nutzungsmöglichkeiten auf fünf Varianten reduziert. Folgende Varianten wurden nicht weiterverfolgt: - Die Umwidmung des ehemaligen Schulhauses zu einen Atelierhaus wäre zwar ohne grossen Aufwand möglich, erscheint aber von der zentralen Lage her unbegründet und wirtschaftlich nicht vertretbar. - Eine Nutzung als Theologisches Seminar der Universität hätte den Vorteil der Lage zum Münster, wäre aber von anderen Einrichtungen der Universität weitgehend isoliert. Eine Kombination mit einem Gästehaus der Universität für Gastprofessoren oder Gastdozenten wäre möglich. - Von der Gebäudestruktur und den Raumgrössen wäre ein Umbau zu einer öffentlichen oder privaten Kunstgalerie möglich, die Lage hat, auch unter Sicherheitsaspekten, nicht nur Vorteile. Für die Belebung der Kulturachse Rittergasse-Augustinergasse-Rheinsprung wäre das Einrichten einer Kunstgalerie beinahe ideal. - Ein Kulturhaus mit Räumen für die Herstellung und die Präsentation von kulturellen Erzeugnissen, mit einer starken Einbeziehung der Öffentlichkeit, wäre nur auf privater Basis zu führen, und ökonomisch wohl nicht selbsttragend. - Für ein Studentenhaus (Wohnen – Kultur – Gastronomie) mit internationalem Charakter wäre das Gebäude wohl gut geeignet, es liegt aber zu abseitig zu den bestehenden universitären Einrichtungen. Die folgenden fünf Varianten werden eingehender untersucht: 3.1 Schulhaus 3.2 Bürohaus 3.3 Wohnhaus 3.4 Museum für Stadtgeschichte 3.5 Kunsthotel 16 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 3.1 Schulhaus 1. Beschreibung Gebäudestruktur Das Gebäude an der Rittergasse 4 wurde als Schulhaus errichtet. Die Klassenraumgrössen von ca. 50 m2 + 60 m2 entsprechen nicht mehr den heutigen Anorderungen. Die vorhandene Gebäudestruktur lässt im Bereich aller Fensterachsen Anpassungen zu. Statische Eingriffe sind notwendig, sie scheinen realisierbar, sind aber nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Interne Erschliessung Die interne Erschliessung entspricht nicht den heutigen Regeln des Brandschutzes, die Erschliessung mit einer Treppe ist nur zulässig für maximal 600 m2 Bruttogeschossfläche, eine 2. Treppe muss eingebaut werden. (siehe Grundrisse Seite 20) Grundrissdisposition Die Grundrisse lassen sich mit vertretbarem Aufwand an heutige Raumbedürfnisse eines Schulhauses anpassen. Grundrissflächen Die nutzbare Fläche beträgt pro Geschoss ca. 410 m2 bis 445 m2, und beläuft sich für das gesamte Gebäude auf ca. 1700 m2 (ohne Keller- und Dachgeschoss). Raumtiefen – Geschosshöhen Für Klassenzimmer ist die Raumtiefe (ca. 6.50 m) eher knapp, die Geschosshöhen (ca. 3.80 m) entsprechen auch den heutigen Anforderungen an ein Schulhaus. Fensterachsen - natürliche Belichtung Mit Bezug auf die bestehenden Fensterachsen können an zahlreichen Punkten neue Zwischenwände eingebaut werden. Die vorhandenen Fenster bringen genügend Tageslicht in die Innenräume. Externe Erschliessung Für den Betrieb eines Schulhauses sind keine neuen externen Erschliessungen notwendig. Eine Anlieferung für Material ist auch nach einer allfälligen Umwidmung der Aussenräume möglich. Eingriff in die Bausubstanz - Ausbaureserve Der Eingriff in die vorhandene Bausubstanz hält sich in vertretbarem Rahmen. Die haustechnischen Anlagen, wie Elektro- und Sanitärinstallationen, müssen den heutigen Anforderungen angepasst werden. Es sind keine Reserven für einen späteren Ausbau vorhanden. Anbauten sind aus heutiger Sicht nicht möglich. 17 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Freiflächen Die vorhandenen Freiflächen sind, vor allem in Pausen, eher knapp bemessen, sofern Teile der Freiflächen zu den Gebäuden zum Münsterplatz nicht mitbenutzt werden könnten. Realisierbarkeit Aus heutiger Sicht ist die Umwidmung, oder Rückführung des Gebäudes zu einem Schulhaus mit einem vertretbaren Aufwand zu realisieren. Akzeptanz – Wirkung auf den Ort Es ist von einer hohen Akzeptanz für das neue Schulhaus auszugehen. Während den Schulzeiten wirkt sich ein Schulhaus sehr belebend auf die nähere und weitere Umgebung aus. 2. Bewertung Nicht allein durch seine Lage ist das Gebäude an der Rittergasse 4 sehr gut geeignet für eine schulische Nutzung. Mit geringen Eingriffen kann das Gebäude den heutigen Anforderungen an ein Schulhaus angepasst werden. Eine Nutzung als Schulhaus würde voraussichtlich auf grosse Akzeptanz stossen, und wäre der Belebung des Münsterplatzes sicher dienlich. Im Gegensatz zum gehobenen Wohnen stellt die Parkplatzfrage kein Problem dar. Die Nachfrage im Ressort Schule* hat ergeben, dass seitens des Erziehungsdepartementes die Einrichtung einer Sekundarschule an der Rittergasse geplant ist. Die als Pausenflächen nutzbaren Aussenräume für die Sekundarschule Ritter 4 liegen unter den geforderten Richtwerten für eine Schule mit ca. 360 Schülern. Gesamtbewertung: 1 (sehr gut) * Auskunft vom 12.11.2009: Stephan Hug, ED Ressort Schulen, Raumbewirtschaftung Raumbedarf gemäss Ratschlag: Gesamtschweizerische und regionale Harmonisierung der Schulen (Harmos) (der Ratschlag wir voraussichtlich am 15.12.2009 in der Regierung behandelt) Rittergasse 4 (Standortvariante) Sekundarschule: 18 Klassen 2 x 3 Züge à drei Klassen = 18 Klassen à 20 Schüler 18 Klassenzimmer 9 Gruppenräume 12 Spezialräume Die Räume des Untergeschosses (Raumhöhe-Belichtung-Belüftung) und Dachgeschosses (kaum direkte Belichtung der Räume) sind nur beschränkt als Klassenzimmer nutzbar. Andere Nutzungen (Bibliothek, Zeichnungsräume, Aufenthalt, etc) sind jedoch gut möglich. Die Raumverhältnisse dürften eher knapp sein. Genauere Abklärungen bezüglich des Raumprogramms müssen noch erfolgen. 18 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Pausenflächen: Richtwert 5-8 m2 pro Kind Pausenflächen (Richtwerte) Sekundarschule Rittergasse 4: 18 Klassen à 20 Schüler = 360 Schüler x 5 m2 = 1800 m2 18 Klassen à 20 Schüler = 360 Schüler x 8 m2 = 2880 m2 Die als Pausenflächen nutzbaren Aussenräume von ca. 1700 m2 für die Sekundarschule Ritter 4 liegen unter den geforderten Richtwerten für eine Schule mit ca. 360 Schülern. Skizze Pausenflächen Fläche A = Fläche B = Pausenfläche 700 m2 800 m2 1500 m2 Fläche C = 400 m2 (zweiter Ausgang, Anlieferung, etc., keine direkte Pausenfläche) 19 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Nutzfläche 440 m2 Nutzfläche 467 m2 Verkehrsfläche 224 m2 Verkehrsfläche 198 m2 Erdgeschoss 2. Obergeschoss 1. Obergeschoss Nutzfläche 467 m2 Nutzfläche 467 m2 Verkehrsfläche 198 m2 Verkehrsfläche 198 m2 3. Obergeschoss MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Schulhaus - Grundrisse 1:500 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 3.2 Bürohaus 1. Beschreibung Gebäudestruktur Das Gebäude an der Rittergasse 4 wurde als Schulhaus errichtet, und Anfangs der achtziger Jahre in ein Verwaltungsgebäude umgestaltet. Die vorhandene Gebäudestruktur lässt im Bereich aller Fensterachsen weitere Anpassungen zu. Das Gebäude eignet sich grundsätzlich sehr gut für eine Büronutzung bei gleicher Struktur wie heute. Interne Erschliessung Die interne Erschliessung entspricht nicht den heutigen Regeln des Brandschutzes, die Erschliessung mit einer Treppe ist nur zulässig für maximal 600 m2 Bruttogeschossfläche, eine 2. Treppe muss eingebaut werden. (siehe Grundrisse Seite 23) Grundrissdisposition Die Grundrisse lassen sich mit vertretbarem Aufwand den heutigen Raumbedürfnissen an ein Bürohaus anpassen. Grossraumbüros lassen sich gut einbauen, für Einzelbüros ist die Raumtiefe zu gross. Grundrissflächen Die nutzbare Fläche beträgt pro Geschoss ca. 410 m2 bis 445 m2, und beläuft sich auf ca. 1700 m2 für das Gebäude (ohne Keller- und Dachgeschoss). Raumtiefen – Geschosshöhen Die Raumtiefe (ca. 6.50 m) ist eher üppig, die Geschosshöhen (ca. 3.80 m) übertreffen die heutigen Anforderungen an ein Bürohaus. (Raumakustik – Raumgefühl) Fensterachsen - natürliche Belichtung Mit Bezug auf die bestehenden Fensterachsen können an zahlreichen Punkten neue Zwischenwände eingebaut werden. Die vorhandenen Fenster bringen genügend Tageslicht in die Innenräume. Externe Erschliessung Für den Betrieb eines Bürohauses sind keine neuen externen Erschliessungen notwendig. Eine Anlieferung ist auch nach einer allfälligen Umwidmung der Aussenräume möglich. Eingriff in die Bausubstanz - Ausbaureserve Der Eingriff in die vorhandene Bausubstanz hält sich in vertretbaren Grenzen. Die haustechnischen Anlagen, wie Elektro- und Sanitärinstallationen, müssen den heutigen Anforderungen angepasst werden. Es sind keine Reserven für einen späteren Ausbau vorhanden, Anbauten sind aus heutiger Sicht nicht möglich. 21 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Freiflächen Die vorhandenen Freiflächen sollten zusammen mit den Freiflächen der Nachbarliegenschaften (zulasten der heutigen Parkplätze) öffentlich genutzt werden können. Realisierbarkeit Aus heutiger Sicht ist die weitere Benutzung des Gebäudes als Bürohaus mit einem vertretbaren Aufwand zu realisieren. Akzeptanz – Wirkung auf den Ort Die weitere Nutzung als Bürohaus dürfte auf eine hohe Akzeptanz stossen. Während den Bürozeiten wirkt sich ein Bürohaus belebend auf die nähere und weitere Umgebung aus. 2. Bewertung Nicht allein durch seine Lage ist das Gebäude an der Rittergasse 4 gut geeignet für eine öffentliche oder private Büronutzung. Mit geringen Eingriffen kann das Gebäude den heutigen Anforderungen einer Büronutzung gerecht werden. Die Belebung des Münsterplatzes wäre tagsüber gegeben, nachts und an Wochenenden würde sie ausbleiben. Ob an diesem Ort, nach der Umnutzung der anliegenden Verwaltungsbauten weiterer Büroraum sinnvoll ist, muss noch abgeklärt werden. Die heutige Struktur des Gebäudes ist gut geeignet für eine Nutzung mit Gruppenbüros und Einzelbüros. Pro Arbeitsplatz stehen mit der heutigen Nutzung des BVD ca. 14.5m2 (Spannweite von 9m2 bis 27m2) zur Verfügung. Aktuell sind 96 Arbeitsplätze eingerichtet (Auskunft IBS). Gesamtbewertung: 1 (sehr gut) Die Raumbedürfnisse des Gesundheitsdepartement und der Gerichte des Kantons Basel-Stadt wurden in Rahmen dieser Studie nicht geklärt. Weisung über die Raumbewirtschaftung vom 25.11.1997: Fünfter Abschnitt: Normen für Arbeitsflächen §8 In der kantonalen Verwaltung werden grundsätzlich Gruppenbüros zugeteilt. 2 Gruppenbüros enthalten zwei bis acht Arbeitsplätze. 3 Wer die Hälfte der Normalarbeitszeit oder weniger dienstlich in seinem Büro verbringt oder zur Hälfte oder weniger teilzeitbeschäftigt ist, hat keinen Anspruch auf einen individuellen Arbeitsplatz. 4 Die Bürogrösse beträgt als Richtzahl für den ersten Arbeitsplatz 11 m2 und für jeden folgenden zusätzlich 9 m2. Die Anzahl der Arbeitsplätze pro Büroraum ist so festzulegen, dass unter Berücksichtigung der Gebäuderaster die Richtzahlen möglichst nicht übertroffen werden. In Neubauten gelten die Richtwerte als Obergrenze. 22 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Nutzfläche 440 m2 Nutzfläche 467 m2 Verkehrsfläche 224 m2 Verkehrsfläche 198 m2 Erdgeschoss 2. Obergeschoss 1. Obergeschoss Nutzfläche 467 m2 Nutzfläche 650 m2 Verkehrsfläche 198 m2 Verkehrsfläche 215 m2 3. Obergeschoss MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Bürohaus Bestand - Grundrisse 1:500 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 3.3 Wohnhaus 1. Beschreibung Gebäudestruktur Das Gebäude an der Rittergasse 4 wurde als Schulhaus errichtet. Aus den früheren Klassenräumen lassen sich durch Wandeinbauten Wohnungen unterschiedlicher Grössen erstellen. Die vorhandene Gebäudestruktur lässt im Bereich aller Fensterachsen Anpassungen zu. Statische Eingriffe sind notwendig, sie scheinen realisierbar, sind aber nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Ein grosser Teil der Wohnungen lassen sich nur einseitig ausrichten. Interne Erschliessung Die Erschliessung mit einer Treppe ist nur zulässig für maximal 600 m2 Bruttogeschossfläche, eine 2. Treppe muss eingebaut werden. (siehe Grundrisse Seite 26) Die Erschliessungsflächen sind für ein Wohnhaus sehr gross, das Verhältnis Nutzflächen – Verkehrsflächen ist ungünstig. Grundrissdisposition Die Grundrisse lassen sich mit vertretbarem Aufwand den heutigen Raumbedürfnissen an ein Wohnhaus anpassen. Die Orientierung der meisten Wohnungen ist nur einseitig möglich. Grundrissflächen Die nutzbare Fläche beträgt pro Geschoss ca. 410 m2 bis 445 m2, und beläuft sich auf ca. 1700 m2 für das Gebäude (ohne Keller- und Dachgeschoss). Raumtiefen – Geschosshöhen Für Wohnungen ist die Raumtiefe (ca. 6.50 m) eher knapp, die lichten Geschosshöhen (ca. 3.80 m) sind für gehobenen Wohnungsbau ideal, jedoch ermöglichen die überhohen Räume (ca. 3.80 m) grosszügige Wohnungen. Fensterachsen - natürliche Belichtung Mit Bezug auf die bestehenden Fensterachsen können an zahlreichen Punkten neue Zwischenwände eingebaut werden. Die vorhandenen Fenster bringen genügend Tageslicht in die Innenräume. Externe Erschliessung Für den Betrieb eines Wohnhauses sind keine neuen externen Erschliessungen notwendig. Die Fragen der Zufahrt und der oberirdischen Parkierung müssen geklärt werden und ist schwierig zu realisieren. Eingriff in die Bausubstanz - Ausbaureserve Der Eingriff in die vorhandene Bausubstanz ist hoch. Die haustechnischen Anlagen, wie Elektro- und Sanitärinstallationen (Installationsschächte), müssen den heutigen Anforderungen angepasst werden. 24 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Es sind keine Reserven für einen späteren Ausbau vorhanden, und das Hinzufügen von Aussenräumen (Balkone, Terrassen) ist aus heutiger Sicht nicht möglich. Freiflächen Die vorhandenen Freiflächen lassen eine private Nutzung zu, sofern Teile der Freiflächen zu den Gebäuden zum Münsterplatz mitbenutzt werden können. Realisierbarkeit Aus heutiger Sicht ist die Umwidmung des Gebäudes zu einem Wohnhaus möglich. Akzeptanz – Wirkung auf den Ort Es ist von einer hohen Akzeptanz für ein Wohnhaus auszugehen. Ein Wohnhaus wirkt sich vor allem tagsüber belebend auf die nähere und weitere Umgebung aus. 2. Bewertung Eine Umwandlung der Rittergasse 4 in ein Wohnhaus wäre nur mit gewissen Einschränkungen möglich. Die Gebäudestruktur lässt vorwiegend einseitig belichtete Wohnungen zu. Der Anteil an Erschliessungsflächen ist für eine Wohnnutzung sehr hoch. Weiter sind private Aussenräume wie Terrassen und Balkone aus denkmalpflegerischen Gründen nicht möglich. Bezüglich Parkierung gibt es keine grossen Möglichkeiten Plätze anzubieten, was sich bei Wohnungen im oberen Preissegment nachteilig auswirken könnte. Eine Mischung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. Wohnen/Kultur oder Wohnen/Schule, ist möglich. Gesamtbewertung: 3 (genügend) 25 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Nutzfläche 440 m2 Nutzfläche 467 m2 Verkehrsfläche 224 m2 Verkehrsfläche 198 m2 Erdgeschoss 2. Obergeschoss 1. Obergeschoss Nutzfläche 467 m2 Nutzfläche 467 m2 Verkehrsfläche 198 m2 Verkehrsfläche 198 m2 3. Obergeschoss MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Wohnhaus - Grundrisse 1:500 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 3.4 Museum für Stadtgeschichte 1. Beschreibung Gebäudestruktur Das Gebäude an der Rittergasse 4 wurde als Schulhaus errichtet. Die früheren Klassenräume eignen sich sehr gut für Ausstellungsräume unterschiedlicher Grössen. Die vorhandene Gebäudestruktur kann im Bereich aller Fensterachsen baulich angepasst werden. Statische Eingriffe sind notwendig, sie scheinen realisierbar, sind aber zur Zeit nicht Gegenstand der Untersuchung. Interne Erschliessung Die interne Erschliessung entspricht nicht den heutigen Regeln des Brandschutzes, die Erschliessung mit einer Treppe ist nur zulässig für maximal 600 m2 Bruttogeschossfläche, eine 2. Treppe muss eingebaut werden. (siehe Grundrisse Seite 29) Grundrissdisposition Die Grundrisse lassen sich mit einem vertretbaren Aufwand den Raumbedürfnissen an ein Museum für Stadtgeschichte anpassen. Grundrissflächen Die nutzbare Fläche beträgt pro Geschoss ca. 410 m2 bis 445 m2, und beläuft sich auf ca. 1700 m2 für das Gebäude (ohne Keller- und Dachgeschoss). Raumtiefen – Geschosshöhen Die Raumtiefen (ca. 6.50 m) sind fast ideal, die Geschosshöhen (ca. 3.80 m) entsprechen auch den heutigen Anforderungen an ein Museum. Fensterachsen - natürliche Belichtung Mit Bezug auf die bestehenden Fensterachsen können an zahlreichen Punkten neue Zwischenwände eingebaut werden. Die vorhandenen Fenster bringen genügend Tageslicht in die Innenräume. Externe Erschliessung Für den Betrieb eines Museum ist möglicherweise eine neue externe Erschliessung notwendig. Eine sachrechte Anlieferung ist auch nach einer allfälligen Umwidmung der Aussenräume möglich. Eingriff in die Bausubstanz - Ausbaureserve Der Eingriff in die vorhandene Bausubstanz ist hoch. Die haustechnischen Anlagen, wie Heizung-, Lüftung-, Elektro- und Sanitärinstallationen, müssen den heutigen Anforderungen angepasst werden. Die Sicherheitsaspekte müssen später abgeklärt werden. Es sind keine Reserven für einen späteren Ausbau vorhanden, Anbauten sind aus heutiger Sicht nicht möglich. 27 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Freiflächen Die vorhandenen Freiflächen sollten zusammen mit den Freiflächen der Nachbarliegenschaften (zulasten der heutigen Parkplätze) öffentlich genutzt werden können. Realisierbarkeit Aus heutiger Sicht ist die Umwidmung des Gebäudes zu einem Museum für Stadtgeschichte mit einem vertretbaren Aufwand zu realisieren. Akzeptanz – Wirkung auf den Ort Es ist von einer hohen Akzeptanz für ein neues Museum für Stadtgeschichte auszugehen, es würde sich vor allem tagsüber sehr belebend auf die nähere und weitere Umgebung auswirken. 2. Bewertung Durch seine Lage ist das Gebäude an der Rittergasse 4 gut geeignet für eine museale Nutzung. Mit teilweise aufwändigen Eingriffen kann das Gebäude den heutigen Anforderungen an ein Museum für Stadtgeschichte angepasst werden. Eine Nutzung als Museum für Stadtgeschichte würde voraussichtlich auf grosse Akzeptanz stossen, würde aber nur tagsüber zur Belebung des Münsterplatzes beitragen. Im Erdgeschoss müssten Räume für vielfältige, öffentliche Nutzungen angeboten werden. Die Vielfalt und Bedeutung der kulturellen Mitte Basels würde durch ein Museum für Stadtgeschichte gestärkt. Eine Zusammenarbeit mit Museen und anderen kulturellen Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung wäre gegeben. Am Weg vom Kunstmuseum zum Münsterplatz könnte im neuen Museum für Stadtgeschichte, an historisch wichtiger Stelle, eine Auseinandersetzung mit der reichen Geschichte der Stadt anhand von Modellen und anderen Mitteln stattfinden. Eine Mischung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. Museum/Schule oder Museum/Stadtinformation, ist möglich. Bezüglich Finanzierung und Trägerschaft stellen sich einige Fragen, die an dieser Stellen nicht beantwortet werden können. Gesamtbewertung: 2 (gut) 28 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Nutzfläche 440 m2 Nutzfläche 467 m2 Verkehrsfläche 224 m2 Verkehrsfläche 198 m2 Erdgeschoss 2. Obergeschoss 1. Obergeschoss Nutzfläche 467 m2 Nutzfläche 467 m2 Verkehrsfläche 198 m2 Verkehrsfläche 198 m2 3. Obergeschoss MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Museum für Stadtgeschichte Grundrisse 1:500 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 3.5 Kunsthotel 1. Beschreibung Gebäudestruktur Das Gebäude an der Rittergasse 4 wurde als Schulhaus errichtet. Aus den früheren Klassenräumen lassen sich durch Wandeinbauten Hotelzimmer und die dazugehörigen Serviceräume in unterschiedlichen Grössen erstellen. Die vorhandene Gebäudestruktur lässt im Bereich aller Fensterachsen Anpassungen zu. Statische Eingriffe sind notwendig, sie scheinen realisierbar, sind aber zur Zeit nicht Gegenstand der Untersuchung. Interne Erschliessung Die interne Erschliessung entspricht nicht den heutigen Regeln des Brandschutzes, die Erschliessung mit einer Treppe ist nur zulässig für maximal 600 m2 Bruttogeschossfläche, eine 2. Treppe muss eingebaut werden. (siehe Grundrisse Seite 30) Grundrissdisposition Die Grundrisse lassen sich mit vertretbarem Aufwand Raumbedürfnissen an ein Kunsthotel anpassen. Grundrissflächen Die nutzbare Fläche beträgt pro Geschoss ca. 410 m2 bis 445 m2, und beläuft sich auf ca. 1700 m2 für das Gebäude (ohne Keller- und Dachgeschoss). Raumtiefen – Geschosshöhen Die Raumtiefe (ca. 6.50 m) der früheren Klassenzimmer ist ausreichend, die Geschosshöhen (ca. 3.80 m) entsprechen auch den heutigen Anforderungen an ein Hotelgebäude, sie sind allerdings eher zu hoch. Fensterachsen - natürliche Belichtung Mit Bezug auf die bestehenden Fensterachsen können an zahlreichen Punkten neue Zwischenwände eingebaut werden. Die vorhandenen Fenster bringen genügend Tageslicht in die Innenräume. Externe Erschliessung Für den Betrieb eines Kunsthotels sind eventuell neue externe Erschliessungen notwendig. Eine Anlieferung für den täglichen Bedarf ist auch nach einer allfälligen Umwidmung der Aussenräume möglich. Eingriff in die Bausubstanz - Ausbaureserve Der Eingriff in die vorhandene Bausubstanz wäre teilweise sehr massiv. Die haustechnischen Anlagen, wie Heizung-, Lüftung-, Elektro- und Sanitärinstallationen, müssen den Anforderungen an ein Hotelgebäude angepasst werden. Es sind keine Reserven für einen späteren Ausbau vorhanden, Anbauten sind aus heutiger Sicht nicht möglich. 30 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Freiflächen Die vorhandenen Freiflächen können den Freiflächen zu den Gebäuden am Münsterplatz (ev. öffentlich) mitbenutzt werden können. Realisierbarkeit Aus heutiger Sicht ist die Umwidmung des Gebäudes zu einem Kunsthotel nur mit einem erheblichen Aufwand zu realisieren. Akzeptanz – Wirkung auf den Ort Es ist von einer hohen Akzeptanz für das neue Kunsthotel auszugehen. Es würde sich sehr belebend auf die nähere und weitere Umgebung auswirken. 2. Bewertung Durch seine Lage ist das Gebäude an der Rittergasse 4 sehr gut geeignet für eine Hotellerie-Nutzungen. Mit starken Eingriffen kann das Gebäude den Anforderungen an ein Hotel, das sich vor allem an Besucher mit kulturellen Interessen richtet, angepasst werden. Eine Nutzung als Kunsthotel würde voraussichtlich auf grosse Akzeptanz stossen, und wäre, mit entsprechender öffentlicher Erdgeschossnutzung, der Belebung des Münsterplatzes dienlich. Eine Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum (Übernachten im kulturellen Zentrum der Stadt) und andern kulturellen Einrichtungen in der näheren Umgebung wäre wünschenswert. Eine Mischung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. Hotel/Büro oder Hotel/Wohnen, ist zu prüfen. Massive Änderungen und Ergänzungen im haustechnischen Bereich verursachen sehr hohe Kosten. Bezüglich Finanzierung und Trägerschaft stellen sich einige Fragen, die an dieser Stellen nicht beantwortet werden können Gesamtbewertung: 2-3 (gut - genügend) 31 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Nutzfläche 440 m2 Nutzfläche 467 m2 Verkehrsfläche 224 m2 Verkehrsfläche 198 m2 Erdgeschoss 2. Obergeschoss 1. Obergeschoss Nutzfläche 467 m2 Nutzfläche 467 m2 Verkehrsfläche 198 m2 Verkehrsfläche 198 m2 3. Obergeschoss MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Kunsthotel - Grundrisse 1:500 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 4. Schlussfolgerung 33 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 4. Schlussfolgerung Das 1885-1887 von Heinrich Reese geplante und gebaute L-förmige Schulhaus, das sich städtebaulich auf die Westfassade des Münsters bezieht, wurde nach Prinzipien, wie sie seit Karl Friedrich Schinkels Bauakademie in Berlin (1832-1836) Schule machten, errichtet. Der viergeschossige Bau orientiert sich in der klassischen Formensprache an italienischen Stadtpalästen der Renaissance, das flachgeneigte Dach unterstreicht diese klare Sprache. Das über sieben Meter hohe Satteldach, das 1915 hinzugefügt wurde, hat den Charakter des Schulhauses stark verändert, es war der Kraft und Eindeutigkeit des Baukörpers nicht entsprechend, und stellt sowohl feinmassstäblich aber auch bezogen auf die weitere Umgebung keine gute Lösung dar. Bauliche Anpassungen, ausgelöst durch eine neue Nutzung, bieten die Chance für eine Rückführung des Baukörpers auf sein ursprüngliches Volumen, das heisst Abbruch des Dachaufbaus, sowie der angefügten Bauteile an der Südwestfassade, und die Entfernung des Aufzugs im Treppenhaus. Damit würde das markante Gebäude, diese starke Setzung des späten 19. Jahrhunderts, wieder eindeutiger erfahrbar. Eine Nutzung als Schulhaus würde voraussichtlich wenig bauliche Eingriffe zur Folge haben. Eine Anpassung der früheren Klassenzimmer an die heutigen Anforderungen bezüglich Raumgrössen wäre mit vertretbarem Aufwand realisierbar. Es wäre möglich, an der Südwest-Ecke einen neuen Erschliessungskern mit Nebenräumen für sanitäre Anlagen einzufügen. Um dem Raumbedarf einer zukünftigen Sekundarschule gerecht zu werden, ist im Stadtmodell zu überprüfen, ob an Stelle des heutigen Dachgeschosses, welches für schulische Zwecke nicht geeignet erscheint, eine Aufstockung gestalterisch eine taugliche Variante ist. Grundsätzlich sind die Raumbedürfnisse für eine Sekundarschule an diesem Standort ausreichend. Zu prüfen sind die knappen Aussenflächen als Pausenflächen und die Nutzung der Anlage als archäologisches Denkmal. Ebenfalls ist die Nähe zu den Gebäuden am Münsterplatz 10-12 und Rittergasse 2 zu berücksichtigen, welche je nach zukünftiger Nutzung zu gegenseitigen Störungen führen kann. Aus Sicht des Erziehungsdepartementes ist die Rittergasse 4 eine von zwei Standortvarianten für eine zukünftige Sekundarschule. Die vorhandene Gebäudestruktur ist als Bürohaus geeignet, sie ermöglicht Gruppenräume wie Einzelbüros. Die räumlichen Voraussetzungen an neue zeitgemässe Büronutzungen sind gegeben. Die heutige Nutzung funktioniert gut und ist einzig bei kleineren Einzelbüros mit einer kleinen Fläche in Bezug auf Raumhöhe problematisch (Raumgefühl, Akustik). Ein Nutzung als Wohnhaus ist nur zusammen mit den Liegenschaften Münsterplatz 1012 und Rittergasse 2 sinnvoll. Dies ergäbe eine stattliche Zahl neuer Wohnungen an ausgezeichneter Lage, welche aber die strukturellen Mängel in Bezug auf Wohntypologie (Ausrichtung, Raumgefüge, Verhältnis Wohn- zu Verkehrsfläche, private Aussenräume, etc) nicht aufwiegen kann. Eine gemeinsame Nutzung des zentralen Aussenraumes würde die Qualität der Wohnanlage unterstreichen. 34 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Aus archäologischen und städtebaulichen Gründen erscheint es nicht empfehlenswert, diesen Aussenraum zu unterbauen, nur um einige wenige Parkplätze einzurichten. Die gemeinsame (Teilprojekt 1 + Teilprojekt 2) Nutzung der Erdgeschossflächen, teilweise als öffentliche nutzbare Räume, bedarf einer weiteren Abklärung. Da die Gebäudestruktur, wie oben schon erwähnt, vorwiegend einseitig belichtete Wohnungen zulässt, ist eine Umnutzung in ein Wohnhaus problematisch. Aus denkmalpflegerischen Gründen können aus heutigem Wissensstand keine Aussenräume (Balkone – Terrassen) hinzugefügt werden. Eine Nutzung als Museum für Stadtgeschichte würde zur Belebung des Münsterplatzes beitragen. Im Erdgeschoss müssten Räume für vielfältige, öffentliche Nutzungen (Vortragssaal/Shop/Café/Restaurant) angeboten werden. Die Vielfalt und Bedeutung der kulturellen Mitte der Stadt würde durch ein Museum für Stadtgeschichte gestärkt, eine Zusammenarbeit mit den städtischen Museen und anderen kulturellen Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung wäre gegeben. Die zukünftige Nutzung als Kunsthotel würde voraussichtlich auf grosse Akzeptanz stossen und wäre, bei entsprechender öffentlicher Erdgeschossnutzung, der Belebung des Münsterplatzes sicher dienlich. In Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum (Übernachten im kulturellen Zentrum der Stadt) und anderen kulturellen Einrichtungen in der näheren Umgebung wäre eine Nutzung als Kunsthotel, das sich vor allem an kulturell engagierte Touristen wendet, und entsprechende Angebote führt, sicherlich möglich. 35 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 5. Zusammenfassung 36 Kunsthotel (privat) Museum für Stadtgeschichte Wohnhaus (privat) Bürohaus Verwaltung + + - + - + Die interne Erschliessung muss den Regeln des Brandschutzes angepasst werden. Aus den Klassenräumen lassen sich durch Wandeinbauten Hotelzimmer und Serviceräume in unterschiedlichen Grössen erstellen. + Die interne Erschliessung muss den Regeln des Brandschutzes angepasst werden. Die früheren Klassenzimmer eignen sich sehr gut für Ausstellungsräume unterschiedlicher Grössen. Eingriffe in die Statik sind notwendig. - Die interne Erschliessung muss den Regeln des Brandschutzes angepasst werden. Aus den Klassenräumen lassen sich durch Wandeinbauten Wohnungen in unterschiedlichen Grössen erstellen. (einseitig belichtete Wohnungen) ++ Die interne Erschliessung muss den Regeln des Brandschutzes angepasst werden. Anfangs der achtziger Jahre wurde das Schulhaus in ein Verwaltungsgebäude umgestaltet. Eine neue Büronutzung löst kleine Umbauarbeiten aus. ++ Die interne Erschliessung muss den Regeln des Brandschutzes angepasst werden. Die Klassenraumgrössen ententsprechen nicht mehr den den heutigen Anforderungen. Gebäudestruktur / interne Erschliessung Zusammenfassung Schulhaus 5. + + + - - + pro Geschoss ca. 410 m2 bis 445 m2. Die nutzbaren Flächen betragen Die Grundrisse lassen sich mit hohem Aufwand den heutigen Raumbedürfnissen anpassen. + pro Geschoss ca. 410 m bis bis 445 m2. 2 Die nutzbaren Flächen betragen Die Grundrisse lassen sich mit vertretbarem Aufwand den heutigen Raumbedürfnissen anpassen. - (hoher Verkehrsflächenanteil) pro Geschoss ca. 410 m2 bis 445 m2. Die nutzbaren Flächen betragen Die Grundrisse lassen sich mit hohem Aufwand den heutigen Raumbedürfnissen anpassen. ++ pro Geschoss ca. 410 m bis 445 m2. 2 Die nutzbaren Flächen betragen Die heutige Bürostruktur eignet sich grundsätzlich gut für eine Büronutzung. Anpassungen sind mit geringem Aufwand möglich. ++ pro Geschoss ca. 410 m bis 2 445 m . 2 Die nutzbaren Flächen betragen Die Grundrisse lassen sich mit vertretbarem Aufwand den heutigen Raumbedürfnissen anpassen. Grundrissdisposition / Grundrissflächen + + ++ - - Die haustechnischen Anlagen (Heizungs-, Lüftungs-, Elektround Sanitärinstallationen) müssen den Anforderungen an ein Kunsthotel angepasst werden. - Die Geschosshöhen sind mit ca. 3.80m für ein Kunsthotel mit vielfältigen Nutzungen geeignet. Der Eingriff in die Bausubstanz ist sehr hoch. + Die Raumtiefen sind für Hotelzimmer ausreichend. + Die haustechnischen Anlagen (Heizungs-, Lüftungs-, Elektround Sanitärinstallationen) müssen den Anforderungen an ein Museum angepasst werden. - Die Geschosshöhen sind mit ca. 3.80m für ein zeitgemässes Museum ideal. Der Eingriff in die Bausubstanz ist sehr hoch. ++ Die Raumtiefen sind für Ausstellungsräume gut geeignet. - Die haustechnischen Anlagen (Heizungs-, Lüftungs-, Elektround Sanitärinstallationen) müssen den Anforderungen an ein Wohnhaus angepasst werden + Die Geschosshöhen sind mit mit ca. 3.80m für gehobenen Wohnungsbaustandard sehr gut. ++ Die haustechnischen Anlagen (Heizungs-, Lüftungs-, Elektround Sanitärinstallationen) müssen den Anforderungen an ein Bürohaus angepasst werden. Der Eingriff in die Bausubstanz ist sehr hoch. + + Für eine Büronutzung ist kein Eingriff in die Bausubstanz notwendig. Für Wohnungen ist die Raumtiefe (ca. 6.50m) eher knapp. + Die Geschosshöhen sind mit ca. 3.80m auch für ein zeitgemässes Bürohaus sehr hoch. (Akustik + Raumgefühl ?) Für Büros ist die Raumtiefe (ca. 6.50m) eher üppig. ++ Die haustechnischen Anlagen (Heizungs-, Lüftungs-, Elektround Sanitärinstallationen) müssen den Anforderungen an ein Schulhaus angepasst werden. Die Geschosshöhen entsprechen den heutigen Anforderunungen an ein Schulhaus. + Der Eingriff in die Bausubstanz hält sich in vertretbaren Grenzen. Eingriff in die Bausubstanz Für Klassenzimmer ist die Raumtiefe knapp. Raumtiefen / Geschosshöhen + ++ + + + + Die vorhandenen Freiflächen sollten zusammen mit den Freiflächen der Nachbarliegenschaften (zu Lasten der Parkplätze) öffentlich genutzt werden können. Für den Betrieb eines Hotels muss die externe Erschliessung angepasst werden. + Die vorhandenen Freiflächen sollten zusammen mit den Freiflächen der Nachbarliegenschaften (zu Lasten der heutigen Parkplätze) öffentlich genutzt werden können. Für den Betrieb eines Museums muss die externe Erschliessung angepasst werden. ++ Die vorhandenen Freiflächen lassen eine private Nutzung zu, sofern die Freiflächen zu den Gebäuden zum Münsterplatz mitbenutzt werden können. Für ein Wohnhaus ist die vorhandene Erschliessung ausreichend. (oberirdische Parkplätze?) + Die vorhandenen Freiflächen sollten zusammen mit den Freiflächen der Nachbarliegenschaften (zu Lasten der heutigen Parkplätze) öffentlich genutzt werden können. Für den Betrieb eines Bürohauses ist die vorhandene Erschliessung ausreichend. + Die vorhandenen Freiflächen sind vor allem in den Pausen eher knapp bemessen, sofern nicht Teile der Freiflächen zu Gebäuden zum Münsterplatz mitbenutzt werden können. Für den Betrieb eines Schulhauses ist die vorhandene Erschliessung ausreichend. externe Erschliessung / Freiflächen - Umgebung + + + + + ++ Es ist von einer hohen Akzeptanz für ein Kunsthotel auszugehen. Ein Kunsthotel (ev. mit Restaurant) wirkt sich tags und nachts belebend auf die nähere und weitere Umgebung aus. ++ Es ist von einer hohen Akzeptanz für ein Museum für Stadtgeschichte auszugehen. Während der Öffnungszeiten wirkt sich das Museum belebend auf die nähere Umgebung aus. aus. ++ Es ist von einer hohen Akzeptanz für ein Wohnhaus auszugehen. Ein Wohnhaus wirkt sich tagsüber belebend auf die nähere und weitere Umgebung aus. (Wohnumfeld) ++ Es ist von einer hohen Akzeptanz für ein Bürohaus auszugehen. Während den Bürozeiten wirkt sich das Bürohaus belebend auf die nähere und weitere Umgebung aus. ++ Es ist von einer hohen Akzeptanz für ein neues Schulhaus auszugehen. Während der Schulzeiten wirkt sich das Schulhaus, vorallem tagüber, belebend auf die nähere und weitere Umgebung aus. Wirkung auf Umgebung / Akzeptanz + + -- -- -- -- Die Umwandlung des Gebäudes in ein Kunsthotel ist mit einem technisch und ökonomisch sehr hohen Aufwand von privater Seite (im Baurecht) realisierbar und zu betreiben. -- Die Umwandlung des Gebäudes in ein Museum für Stadtgeschichte ist mit einem technisch und ökonomisch hohen Aufwand zu realisieren und zu betreiben. -- Aus heutiger Sicht ist die Umwandlung des Gebäudes in ein Wohnhaus mit einem technisch und ökonomisch eher hohen Aufwand von privater Seite (im Baurecht) zu realisieren. Balkone oder Terrassen können aus denkmalpflegerischen Gründen nicht angefügt werden. ++ Aus heutiger Sicht ist die Umwandlung des Gebäudes in ein Bürohaus mit einem technisch und ökonomisch vertretbaren Aufwand zu realisieren. ++ Die Rückführung des Gebäudes zu einem Schulhaus ist mit einem vertretbaren Aufwand zu realisieren. Realisierbarkeit / Baukosten + + - + - + Die Umnutzung in ein Hotel ist nur mit grossem Aufwand möglich. Es braucht sehr grosse Anpassungen bezüglich Haustechnik und auch strukturell wären grosse Veränderungen notwendig. Nicht geprüft wurden die Fragen bezüglich Finanzierung und Trägerschaft und Betrieb (Anlieferung, Küche, etc). - Die Gebäudestruktur lässt eine Nutzung als Museum zu. Jedoch sind sehr grosse Anpassungen an der Gebäudetechnik notwendig. Nicht geprüft wurden die Fragen bezüglich Finanzierung und Trägerschaft. - Eine Umnutzung in ein Wohnhaus ist problematisch. Die Gebäudestruktur lässt vorwiegend einseitig belichtete Wohnungen zu. Die Verkehrsflächen sind im Verhältnis zu den Wohnflächen zu hoch. Eine unter- oder oberirdische Parkierung ist nur begrenzt, beziehungsweise gar nicht möglich. Aus denkmalpflegerische Gründen sind keine privaten Aussenräume (Balkone, Terrassen) denkbar. + Ein Verwaltungsbau ist grundsätzlich ohne grosse Anpassungen möglich und wirkt sich tägsüber belebend auf die Umgebung aus. Grossraumbüros lassen sich gut integrieren. + Die Freiflächen sind knapp bemessen und liegen unter den Richtwerten. Ein Schulhaus kann in den bestehenden Räumlichkeiten einfach und mit wenig Anpassungen realisiert werden. Bezüglich Raumgrössen, der Erschliessung und der Kompatibilität zur angrenzenden Liegenschaft sind vertiefte Abklärungen notwendig. Fazit MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 6. Beschreibung und Darstellung Reinacherhof, Münsterplatz 18 38 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 6.1 Primarschulhaus Reinacherhof, Münsterplatz 18 Das Eckhaus Münsterplatz-Schlüsselberg, bei dem es sich um eine Zusammenfassung von vier gotischen Häusern handelt, wird seit vielen Jahren als Schulhaus genutzt. Zurzeit wird im Haus eine Primarschule geführt, in der ca. 30 Schüler, verteilt auf vier Klassen, unterrichtet werden. Die 5 Klassenzimmer, und die Gruppenräume sind von geringer Grösse und können nur von kleinen Gruppen benutzt werden. Die Primarschule Münsterplatz weist zwar den Charme einer dörflichen Schule auf, für die Schulkinder ist es doch ein ziemlich isolierter Ort, mit wenig Beziehung zu Ihrem Wohnumfeld. Einzelne Räume werden zur Zeit von der WBS genutzt. Im Jahr 1943 erfolgten eine gründliche Aussenrenovation, sowie Umbauarbeiten im Inneren. Falls im Rahmen einer Harmonisierung der Schulen im Gebäude Rittergasse 4 (Standortvariante) die Einrichtung einer Sekundarschule mit 18 Klassen ansteht, wird die Primarschule ins Haus Mücke umziehen. Die Standortvariante sieht vor, im Haus Mücke 6 Primarschulklassen und zwei Kindergartengruppen unterzubringen. Der dreigeschossige Reinacherhof kann einer neuen Nutzung zugeführt werden, die Gebäudestruktur lässt eine Nachnutzung mit Wohnungen geeignet erscheinen. Der Schulhof der zukünftigen Primarschule mit ca. 120 Schülern, der im Süden liegt, stellt möglicherweise eine Beeinträchtigung der erdgeschossigen Nutzung dar. 39 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel U43 MATERIAL U46 PU U50 GARD. U44 VORPLATZ WC H U48 WC D U49 U45 TEXTIL U47 TEXTIL NEBENR. Klasse I Int. Klasse I Material Lehrerzimm Inform. Untergeschoss er itsplatz it Lehrerarbe Erdgeschoss LUFTRAUM AULA Primarsch. Schulleit. ule Primarsch 1. Obergeschoss Primar. ule Primarsch Lehrer. ule Primarsch ule Primarsch 2. Obergeschoss MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Primarschulhaus Münsterplatz 18 Grundrisse 1:500 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 6.2 Wohnhaus Reinacherhof, Münsterplatz 18 Es wird angenommen, dass der ca. 26 m lange Bau aus vier gotischen Vorgängerbauten entstand. Die innere Trennwand des kleinsten, an den Andlauerhof anschliessenden Hauses ist noch durch alles Geschosse hindurchgehend erhalten. Dieses und das nächste Haus sind nicht unterkellert, während die beiden anderen Bauten einen gemeinsamen Keller aufwiesen. In den oberen Geschossen, die im Laufe der Zeit erhebliche Veränderungen erfahren habe, sind diese Mauern nicht mehr vorhanden. Das dreigeschossige Haus am Münsterplatz 18 ist eher für kleinere Wohnungen geeignet. Gründe dafür sind die Nord-Süd-Orientierung des Baukörpers, die Gebäudetiefe und die Laubengangerschliessung, welche im Süden angeordnet ist. Die Nutzfläche der Geschosse beträgt je ca. 225 m2. Die bestehenden Erschliessungsflächen sind sehr grosszügig bemessen, und schränken die Gestaltungsmöglichkeiten zusätzlich ein. Der Dachraum, der durch einen markanten Dachstuhl gebildet wird, steht aus denkmalschützerischen Gründen nicht zum Ausbau zur Verfügung. Pro Geschoss wären beispielsweise drei kleine Wohnungen, die eine Fläche zwischen ca. 45 m2 und 80 m2 aufweisen, möglich. Die beiden Wohnungen westlich der durchgehenden Brandmauer könnten zu einer grossen Wohnung zusammengelegt werden. Jedoch sind die Belichtung und die Erschliessung nicht optimal, zumal die Eingriffe in die denkmalgeschützte Substanz möglicherweise zu gross wären. Der Südflügel könnte unterschiedlich genutzt werden. im Erdgeschoss wäre Abstellraum für Velos und andere Geräte, z. B. für die Primarschule, möglich. Das 1. Obergeschoss könnte als Kleinwohnung und im der 2. Obergeschoss ausserhalb der Wohnung liegende Raum als Kammer genutzt werden. Ob im Erdgeschoss eine andere, eventuell öffentliche Nutzung sinnvoll wäre, hängt auch von der zukünftigen Nutzung der Erdgeschosszonen der umgebenden Bauten ab. Der im Süden gelegene Schulhof der zukünftigen Primarschule im Haus Mücke lässt sich kaum abtrennen und wäre für eine Wohnnutzung eher schwierig. Es sind keine Reserven für einen späteren Ausbau vorhanden. Das Hinzufügen von Aussenräumen (Balkone, Terrassen) ist aus heutiger Sicht nicht möglich. Ausserdem gibt es keine Möglichkeit, Parkplätze anzubieten. 41 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel U43 MATERIAL U46 PU U50 GARD. U44 VORPLATZ WC H U48 WC D U49 U45 TEXTIL U47 TEXTIL NEBENR. Geräte Velos Abst. Bad Bad Zimmer Zimmer Zimmer Untergeschoss Küche Zimmer Zimmer Erdgeschoss LUFTRAUM AULA Atelier Zi. Bad Zimmer Zimmer Küche Zimmer 1. Obergeschoss Küche Bad Zimmer Zimmer Bad Zimmer Küche Zimmer Zimmer Zimmer Küche Bad Zimmer Zimmer Zimmer 2. Obergeschoss MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Wohnhaus Münsterplatz 18 Grundrisse 1:500 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 7. Historische Entwicklung 43 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 7. 7.1 Historische Entwicklung Rittergasse 4 – Untere Realschule Der mächtige Baukörper unterbricht die Abfolge feingliedriger Barockfassaden vor der Einmündung der Rittergasse in den Münsterplatz. Seine übersteigerten Dimensionen und seine Blockhaftigkeit reduzieren die Kubaturen der benachbarten historischen Bebauung ins Zwergenhafte. Der mit einem Eisenzaun umfriedete „Solitär“ steht zurückversetzt im ehemaligen Schulhof (Bild 1). Geschichte und bauliche Entwicklung Die dicht aneinander gereihte Bebauung an der Westseite der inneren Rittergasse musste 1885-1887 dem neuen Schulhausbau weichen. Zwischen 1861 und 1885 wurden hier fünf Liegenschaften sowie die zwischen ihnen liegende Sackgasse, das sogenannte Hasengässlein, aufgehoben. Die Bebauung am Hasengässlein sowie die Ulrichskirche an der östlichen Seite der Rittergasse standen in und auf der Ruine des spätkeltischen Walles, des „murus gallicus", und teilweise auch direkt über den Resten der darin fundamentierten, auf annähernd derselben Achse verlaufenden, spätrömischen Wehrmauer. Verschiedene Planierungen, Strassenkorrektionen und der Abbruch der Vorgängerbauten haben die auf dieser Befestigungslinie vorhandenen antiken bis mittelalterlichen Siedlungsschichten stark beeinträchtigt. Dies führte dazu, dass an jenen Stellen bei baulichen Eingriffen spätkeltische und römische Funde unter dem heutigen Asphaltbelag zum Vorschein kamen. Seit 1993 gewähren im Hof Rittergasse 4 drei mit Glasdächern gedeckte Schächte einen Blick auf die keltischen und römischen Wehranlagen des „murus gallicus“. Vorgängerbauten Auf dem Areal standen das Kapitelhaus (Münsterhof 4), der Schönauerhof, beidseits des Hasengässleins das Obersthelferhaus, das Haus zum Gelben Löwenkopf, und der Diesbacherhof. Der Schönauerhof war eine ehemalige Domherrenkurie. Das ausgedehnte Anwesen erhob sich auf dem Eckgrundstück Rittergasse/Hasengässlein. Entlang des Hasengässleins standen remisenartige Nebengebäude. Die andere Seite des Hasengässleins säumten die Häuser der Prädikatur, zum Gelben Löwenkopf und mit der Schmalseite auch der Diesbacherhof. In der Prädikatur hatte seit 1469 der Münsterprediger seinen Wohnsitz. Nach der Reformation bezog sie der zweite Pfarrer am Münster, der so genannte Obersthelfer, weshalb das Haus auch „Obersthelferhaus“ genannt wurde. Das geräumige Haus wurde 1885 abgerissen. Das angrenzende Gebäude zum Gelben Löwenkopf bezog um 1530 Thomas Platter mit seiner Familie. In der 2. Hälfte des 16.Jahrhunderts wohnte darin der Chronist Christian Wurstisen. Bis ins 19.Jahrhundert wurde das Haus an Lehrer des Gymnasiums auf Burg vermietet. Das im Vergleich zu den Nachbarhäusern kleine Anwesen grenzte westlich an den Hof des Obersthelferhauses und östlich an den Diesbacherhof. Es wurde 1885 abgebrochen. 44 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Der Diesbacherhof, benannt nach dem Domherrn Nicolaus von Diesbach, stand auf der südlichen Eckparzelle Hasengässlein/ Rittergasse. Er wurde 1860 abgebrochen. Untere Realschule 1874 schrieb das Baukollegium einen Wettbewerb für ein Realgymnasium an der Rittergasse aus. Wegen der bevorstehenden Neuorganisation der Schulen wurde das Projekt storniert. Nach Annahme des neuen Schulgesetzes 1880 erstellte 1883 Kantonsbaumeister Heinrich Reese elf Projektvarianten. Das Projekt X wurde weiterbearbeitet und das Baudepartement beauftragt, dafür die Fassaden zu projektieren. Geplant und ausgeführt wurde 1885-1887 ein L-förmiges Schulhaus, dessen zurückversetzte Front in der Flucht der Westfassade des Münsters lag. Auf der gegenüberliegenden Seite der Rittergasse stand die 1888 errichtete und 1971 abgebrochene Turnhalle. 1957 wurden in den prunkvollen, mit Täferwerk ausgestatteten Examenssaal Zwischendecken eingezogen, über denen 1991 die Reste der originalen Dekoration zum Vorschein kamen und wiederhergestellt werden konnten. Seitdem wird das Schulhaus als Verwaltungsgebäude genutzt. Beschreibung Äusseres Das Schulhaus besteht aus einem parallel zur Rittergasse stehenden Hauptbau, einem Flügelbau für Unterrichtsräume im Süden und einem kurzen Flügel mit den sanitären Einrichtungen im Norden. Es wurde im Stil der florentinischen Renaissance errichtet. Das viergeschossige Gebäude erhebt sich über einem rustizierten Sockel, der Erd- und erstes Obergeschoss umgürtet. Die Aussenwände aus Bruchsteinmauern wurden mit behauenem, grauem Strassburger- und grünlichem Berner Sandstein verkleidet. Die aufwändige Instrumentierung der Hauptfassade mit gekuppelten Säulen und Pilastern sowie die betonten Horizontalen verleihen dem Schulpalast Würde und Ernst. Die Fassaden sind entsprechend der Grundrissaufteilung unterschiedlich instrumentiert. In der streng axialen Hauptfassade ist die Mittelachse durch ein säulengerahmtes Hauptportal, das erhöht auf einem fünfstufigen Sockel steht, hervorgehoben. Im Dreiecksgiebel über dem Portal kennzeichnet ein reliefierter Baselstab das Gebäude als staatliches Eigentum. Die Rustikageschosse gliedern im Rhythmus 1:5:1 sieben Achsen mit Zwillingsfenstern. Fünf geschossübergreifende Rundbogenfenster im zweiten Obergeschoss verleihen der Fassade ein palastartiges Aussehen. Die Arkaden zieren gekuppelte Säulen zwischen den Bogenfenstern. Darüber liegen querrechteckige Schmuckfelder mit roten Steinfüllungen. Nur das Mezzanin der Hauptfassade weist rote Steinplatten aus. Das Schmuckmotiv verstärkt den Horizontalakzent, der durch das ausladende, von Konsolen gestützte Dach noch gesteigert wird. Profilierte Gesimse gliedern die Fassaden in der Horizontalen. Im Unterschied dazu ist die sandsteinfarben verputzte Hofseite flächig gehalten. An der Südfassade fassen korinthische Doppelpilaster die oberen beiden Geschosse zusammen. Im kurzen Nordflügel variiert die Anzahl der Fenster in den beiden Rustikageschossen. Mit Rücksicht auf seine beträchtli- 45 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel che Höhe erhielt das Schulhaus ein Flachdach aus Zementholz. 1915 erhielt es nach dem Ausbau des Dachstocks ein Satteldach. In den Hof wurde 1906 der Stockbrunnen aus dem Falkensteinerhof (Münsterplatz 11) versetzt. Seine Dekoration mit Lorbeerfestons kennzeichnet ihn als Werk des Louis-XVI. Den Trog lieferte 1786 der Solothurner Steinmetz Josef Müller. Der Brunnenstock wurde von Daniel Bruckner nach einem Entwurf von Samuel Werenfels in rotem Buntsandstein ausgeführt. Er besteht aus einem Säulenstumpf, den eine Urne überhöht. Das Wasser fliesst aus zwei Röhren, die dem Maul eines Fauns entspringen. Inneres Die Gliederung des Äusseren lässt die ursprüngliche innere Einteilung des Gebäudes erkennen. Der südliche Seitenflügel enthielt die Unterrichtsräume, der nördliche die Spezial- und Verwaltungsräume. Im Hauptgebäude befand sich hinter den fünf hohen Rundbogenfenstern ein anderthalb Stockwerke hoher Examenssaal und darüber der Modellsaal. An der Rückseite treffen sich rechtwinklig die Gänge des Hauptbaus und des südlichen Traktes im Treppenhaus. Von der originalen Ausstattung sind im Treppenhaus die Granitstufen, die gusseisernen Antrittspfosten und Säulen sowie das Geländer erhalten. Turnhallen 1886 wurden für die Turnhallen auf der gegenüberliegenden Seite der Rittergasse die Ulrichskirche abgebrochen und Arrondierungen vorgenommen. Heinrich Reese entwarf rechtwinklig zueinander stehende Gebäude. Die vordere, 1888 eingeweihte Turnhalle stand parallel zur Rittergasse neben dem Roten Schulhaus. Sie diente der Unteren Realschule. Die hintere, im rechten Winkel angrenzende Turnhalle wurde 1892 für das Gymnasium errichtet. Die eingeschossigen Bauten hatten grosse Fenster mit Schlusssteinen in den Stichbogen. Über umlaufendem Konsolgesims trugen sie auf eisernen Dachstühlen Krüppelwalmdächer. Die rustizierten Pilaster zwischen den Fenstern und das Baumaterial aus grauem Sandstein bezogen sich auf die Gestaltung der Unteren Realschule. Die Hallen wurden 1971 zugunsten eines zweistöckigen Turnhallenneubaus abgebrochen. Aus: Die Kunstführer des Kantons Basel-Stadt – Band 7 46 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Bild 1 Rittergasse 4, Untere Realschule. Der 1887 vollendete Neurenaissancebau mit dem ursprünglichen Flachdach. Foto um 1890 Bild 2 Rittergasse 4, Untere Realschule. 1. Obergeschoss. der 1957 aufgehobene Examenssaal mit Wandbildern von Rudolf Schweizer-Keller, 1887. Foto um 1890 47 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 7.2 Photos – Archiv Denkmalpflege 48 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 49 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Luftaufnahme 1886 50 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 7.3 Pläne von Architekt Heinrich Reese - Staatsarchiv 51 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Situationspläne 52 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Grundrisse 53 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Schnitt AB – Schnitt CD 54 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Schnitt EF – Fassaden Süd-West und Nord-West 55 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Fassaden Nord-Ost und Süd-Ost 56 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 7.4 Photos – Flachdach | Satteldach 57 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Bild 1a – Flachdach 1887 Bild 2a – Satteldach - 1915 58 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Bild 1b – Flachdach 1887 Bild 2b – Satteldach 1915 59 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 7.5 Reinacherhof, Münsterplatz 18 Das klassizistisch überformte Eckhaus schliesst die Reihe der spätbarocken Fassaden an der Westseite des Münsterplatzes neben der Einmündung des Schlüsselbergs ab. Geschichte und bauliche Entwicklung Es wird angenommen, dass der 26 m lange Bau aus vier gotischen Vorgängerbauten entstand. Diese Vermutung stützten Beobachtungen im Kellerbereich sowie im Inneren des Hauses. Die schriftliche Überlieferung erlaubt keine derartigen Rückschlüsse. Bischof Berthold II. von Pfirt (1248-1262) ist als erster Besitzer der nach ihm „Pflrterhof“ benannten Kurie überliefert. Der Bischof bewohnte sie von 1249 bis zu seinem Tod, weil die angestammte bischöfliche Residenz 1247 zerstört worden war. Wurstisen nannte ihn auch als Erbauer einer der hl. Katharina geweihten Kapelle, ohne zu erwähnen, wo sich diese befand („In die selbige capell gieng auß dem Hof hinauf eine steinerne stegen, ward im September 1578 abgebrochen und weg gethon“). Die „capella vero, quam in curia, in qua manemus“, stattete der Bischof 1257 mit einer jährlichen Vergabung aus. Nahezu lückenlos sind zwischen 1275 und 1525 die Inhaber ihrer Pfründe überliefert. Zudem gehörte seit etwa 1420 das Haus Luftgässlein 9 als Pfrundhaus zur Kapelle „S. Catharina in curia“. Der Domherrenhof fand von 1275 an unter dem Namen seiner späteren Bewohner Erwähnung, als „curia domini de Ellerbach“ nach dem Domherrn Werner von Eribach und um 1290 jals „curia prebendi de domini de Gundoltzheim“ nach dem Domherrn Heinrich von Gundoltzheim. 1356 erlitt die Kapelle durch das Erdbeben Schaden. Der Domherr Heinrich von Hohenstein liess sie neu bauen. Auch das Vorderhaus war beschädigt. Romanische Werkstücke, die in der Fassade und in der Rückseite 1943 zum Vorschein kamen, fanden darin nach dem Erdbeben als Spolien Verwendung. Spätestens 1420 wurden die gotischen Vorgängerbauten vereint, als das Gebäude am Münsterplatz den noch vorhandenen Dachstuhl erhielt. Zinszahlungen belegen, dass die Liegenschaft auch weiterhin von Angehörigen des Domkapitels bewohnt wurde. Der Domherr Jost von Reinach, dessen Namen das Haus bis heute trägt, erwarb nach der Reformation seine ehemalige „curia canonicalis“. 1603 übernahm der Kaufmann, Bankier, Diplomat und Chronist Andreas Ryff das Anwesen. Den von ihm begonnenen Umbau vollendete sein Schwiegersohn Daniel Burckhardt-Ryff. Das Haus wurde repariert und erfuhr an der Rückseite eine Erweiterung durch den Anbau einer dreigeschossigen Laube. Rechtwinklig im Hof daran anschliessend wurde wahrscheinlich auch der südliche Flügel gebaut. Andreas Ryff und seine Erben verbauten 2000 Gulden und machten aus dem „in ruin“ gehenden „Hooff ein Hauß“. In der Folge erhielten nur hohe Magistraten das Anwesen zu lebenslänglichem Lehen. Die jeweiligen städtischen Domprobsteischaffner sorgten für den Unterhalt. Als einziges Gebäude an der Westseite des Münsterplatzes behielt das Eckhaus bis zum Beginn des 19.Jahrhunderts sein spätgotisches Aussehen, so wie es Matthäus Merian auf dem Vogelschaubild von 1617 und Emanuel Büchel in der Ansicht des Münsterplatzes 1746 wiedergegeben haben. Im sockelartigen Erdgeschoss befanden sich zweiteilige Fensterchen und ein Rundbogentor. Die Ecke gegen den Schlüsselberg 60 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel war im Erdgeschoss verstärkt. Über einem Sohlbankgesims öffneten sich im ersten Obergeschoss sieben grosse Fenster, von denen die zwei nördlichen als dreiteilige Staffelfenster ausgebildet waren. Das zweite Obergeschoss wies kleine zweiteilige Fensterchen auf. Aus dem wie heute nach Norden abgewalmten Dach ragten zwei spätgotische Kamine. Am Schlüsselberg schloss eine hohe Mauer, die links neben dem Eingang in das Haus zur Mücke endete, den Hof ab. 1782/83 erwog man, die altertümliche Fassade stilistisch an die spätbarocken Schauseiten der Nachbarhäuser anzupassen. Johann Jakob Fechter und Samuel Werenfels wurden für Baupläne bezahlt. Es kam jedoch zu keinem Auftrag. 1805 ging die Liegenschaft in den Besitz der Allgemeinen Lesegesellschaft über, die das Haus 1808 von Achilles Huber umbauen liess. Die Fassade wurde reguliert, die Fenster vergrössert und die Dachuntersicht geschlossen (Bild 1). Im Inneren stattete man den Saal im ersten Geschoss mit einer Kassettendecke und Wandtäfern aus. Der Hof erhielt einen neuen Brunnen aus Solothurner Kalkstein. Als Mieterin für drei Räume im Erdgeschoss wurde die neu gegründete Casinogesellschaft gewonnen, die sich verpflichtete, die Kosten für die Anfertigung der Sockelplatten und der Haustür zu übernehmen. Sie betrieb im hofseitigen Zimmer ein Billard und im Hof eine Kegelbahn. 1831 verkaufte die Lesegesellschaft ihr erstes Gesellschaftshaus an die Regenz der Universität, die beabsichtigte, darin ihre Kunstsamm1ung und Bibliothek aufzustellen. Nach 1836 wurde der Reinacherhof mehr und mehr als Schulhaus verwendet. 1921 errichtete das Hochbauamt auf dem rückwärtigen Areal von Nrn. 17 und 18 die letzte Erweiterung der Schulhausbauten mit einem Laubengang als Verbindung zum Haus zur Mücke, Schlüsselberg 14. Beschreibung Äusseres Das Eckhaus erhebt sich dreigeschossig über einer niedrigen Sockelzone, die im nördlichen, rechten Teil zwei Kellerfenster unterbrechen. Acht Rechteckfenster mit Steingewänden, Sohlbänken und Schlagläden rhythmisieren den lang gestreckten Baukörper. Ihre unterschiedlich breiten Intervalle gehen auf die Vorgängerbauten zurück. Die markante spätmittelalterliche Eckverstärkung aus roten Buntsandsteinquadern gegen den Schlüsselberg weist auf ältere Bauzusammenhänge, während das asymmetrisch in die dritte Achse eingefügte PortaI mit horizontalem Sturz und profilierter Verdachung sowie die äusserst schlicht gehaltene Putzfassade von Achilles Huber stammen. Drei Dachgauben besetzen das grossflächige, nach Norden abgewalmte Satteldach. Die Giebelmauer am Schlüsselberg verstärken im Erdgeschoss neben dem Eckquader zwei Wandvorlagen. Im Unterschied zur rege1mässigen, zweiachsigen Fenstereinteilung dieser Front manifestiert sich an der Rückseite, dass der Reinacherhof aus mehreren Bauten zusammengefügt wurde. Der geschlossene nördliche Teil weist im Erdgeschoss zwischen zwei Ausgängen kleinere und grössere und in den beiden Obergeschossen zwei- und dreiteilige Rechteckfenster mit Steingewänden auf. Das zweite Obergeschoss tritt über vorstehenden Balkenköpfen als verputzte Fachwerkkonstruktion in Erscheinung. Die südlich anschliessende Laube setzt die Bauflucht des 61 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel nördlichen Hausteils fort. Sie wurde 1603 von einem anonymen Baumeister im Auftrag von Andreas Ryff errichtet und ist der zurückspringenden Rückwand des Hauses vorgeblendet. Die verdeckte spätmittelalterliche Wand enthält in den beiden oberen Geschossen Staffelfenster sowie im ersten ein romanisches RundbogenportaI. Die dreigeschossige, ursprünglich offene Laube erhebt sich über vier Quertonnen mit eingeschnittenen Stichkappen, deren Last im Erdgeschoss. vier ungleiche Arkaden auf verstärkte Rechteckpfeiler übertragen. Die Arkade mit der grössten Spannweite befindet sich in der Portalachse des Hauses. Im 1. Obergeschoss treten in der gemauerten Brüstung über den Erdgeschosspfeilern mit Rauten ornamentierte Steinpfeiler hervor, während über den Bogenscheiteln schmale, mit Rosetten verzierte Stützen stehen. Im zweiten Geschoss erheben sich auf einem hölzernen, rückseitig geschlossen Balustergeländer Holzsäulen, die einem Knauf entspringen (Bild 1). Bemerkenswert an der schönen Renaissanoe1aube sind ihre ausserordentliche Zierlichkeit und Eleganz. Im Erdgeschoss bindet an das Hauptgebäude der Südflügel an. Der fünfachsige Trakt ist massiv gebaut und enthielt einst Wirtschaftsräume (Bild 2). Er entstand wahrscheinlich ebenfalls beim Umbau von Andreas Ryff und seinen Erben, wofür die beachtliche Summe spricht, die 1603/04 für Mauersteine, Kalk, Sand, Ziegel, Holz und Dielen ausgegeben wurde. Auch an diesem vollständig in Mauerwerk errichteten Bau verstärken zwei Wandpfeiler das Erdgeschoss. Zwischen ihnen befindet sich ein weiteres, allerdings versetztes romanisches Rundbogenporta1 mit umlaufendem Wulst. Über dem ersten Obergeschoss durchbricht ein dreigeschossiger, mit einem Pyramidendach gedeckter Abortturm das Dach. Vor dem Flügel steht der 1808 erneuerte Brunnen, dessen rechteckiges Kalksteinbecken mit einem niedrigeren Nebentrog versehen ist. Das Brunnenrohr entspringt einer rechteckigen, der Wand vorgeblendeten Kalksteinplatte, die ein Dreiecksgiebel abschliesst. Den heute von Nebengebäuden befreiten. Hof begrenzt an der Westseite der Erweiterungsbau der Schulhäuser von 1921, während an der Nordseite das Haus zur Mücke steht. Inneres. Das Haus ist nur im nördlichen Teil unterkellert. Rückseitig führt eine neue Treppe in zwei modern ausgebaute Kellerräume. Zwischen beiden Räumen stehen noch Teile der ehemaligen Brandmauer der zwei nördlichen Vorgängerbauten. Ein Kellerhals ist in der mächtigen westlichen Abschlussmauer ablesbar. Im Erdgeschoss führt das Portal in den die ganze Haustiefe durchmessenden Gang bis zum Hofausgang. Die Breite des südlichen Vorgängerbaus nimmt ein vollständig mit Knietäfer ausstaffiertes Gemach ein, das beidseitig von Brandmauern begrenzt wird. Die innere Brandmauer zieht sich durch alle Geschosse. Eine geradläufige Treppe führt vom Gang in das erste Obergeschoss. Ihr Antrittspfosten mit klassizistisch ovalen Füllungen entstand um 1808. Das zeitgleiche Geländer aus sich kreuzenden Vierkantstäben ist nur am oberen Treppenlauf erhalten. Die Ausstattung der zwei platzseitigen Räume im ersten Obergeschoss, die sich über sechs Fensterachsen erstrecken, stammt vom Innenausbau 1808 für die Lesegesellschaft. Im nördlichen Eckzimmer gehört ein Brusttäfer dazu, das zwischen Sockelund Frieszone in hochrechteckige Felder unterteilt ist. Der dreiachsige südliche Raum 62 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel weist eine gleichzeitig geschaffene Leistendecke auf, deren langrechteckige Felder sich dreireihig über den Raum ziehen und seiner asymmetrischen Grundform angepasst sind. Eine ältere Ausstattung aus der 2. Hälfte des 18.Jahrhunderts bewahren die beiden südlichen Zimmer: Im platzseitigen Gemach befinden sich Vertäferungen an Tür und Fenster, Knietäfer an den Wänden und eine tiefe Deckenkehle. Ein Cheminée im hofseitigen Vorzimmer mit einer bandwerkverzierten, geschwungenen Buntsandsteinfassung und einer zweiflügeligen Tür gehört ebenfalls zu dieser Ausstattungsphase. Im zweiten Obergeschoss befinden sich, verborgen von den Gipsdecken aus dem 19.Jahrhundert, quer zum First verlegte Balken, die in den hofseitigen sowie in zwei platzseitigen Zimmern bemalt sind. Nur im kleinen Raum neben der Treppe liegt die bemalte Balkendecke aus der 1. Hälfte des 18.Jahrhunderts frei. Üppige braune Blattranken mit weissen Höhungen überziehen den ockerfarbenen Grund der Deckenfelder. Im Dachaufgang wurden die Bretter einer älteren, ebenfalls weiss gehöhten Deckenbemalung mit grosszügigen Rosetten und Blattranken als Wandverkleidung wieder verwendet. Das dendrochronologisch um 1420 datierte Dachwerk stützt sich auf ein Pfettengerüst mit abgestrebtem Stuhl, dessen Binder durchgehende Firstsäulen aufweisen. Die Hölzer der Binderkonstruktion sind mit Abbundzeichen nummeriert. Aus: Die Kunstführer des Kantons Basel-Stadt – Band 7 63 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Bilder 1+2 Münsterplatz 18, Reinacherhof. Ansicht der Fassade von Achilles Huber vor dem Umbau 1808 – Grundriss des Erdgeschosses 64 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Bild 3 Münsterplatz 18, Reinacherhof. Die Laube ab der Rückseite des Haupthauses, errichtet um 1605. Foto 2006 65 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 7.6 Photos – Archiv Denkmalpflege 66 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 67 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 68 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 8. Anhang 69 MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 8.1 Grundrisse Bestand 70 Leit ung en MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel n ge itun Le DS DS DS MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Untergeschoss 1:500 - Bestand MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel MÜN_TP1 MÜN_TP1Rittergasse Rittergasse44 HUB 4. 4.Obergeschoss Obergeschoss 1:200 1:200 -- Bestand Bestand HUB MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel Erdgeschoss 1:500 - Bestand Dam WC en HUB MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel HUB MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 1. Obergeschoss 1:500 - Bestand FAX 9345 Dam WC en EL HUB XEROX HUB MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel HPA-H HPA-H HPA-H HUB MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 2. Obergeschoss 1:500 - Bestand HUB Öffn Estricung zu h MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel STERCHI A B E F D G C MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 3. Obergeschoss 1:500 - Bestand MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel MÜN_TP1 Rittergasse 4, Basel 4. Obergeschoss 1:500 - Bestand