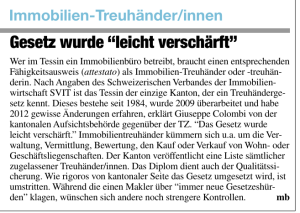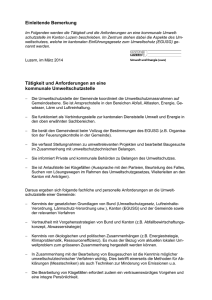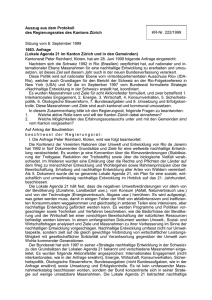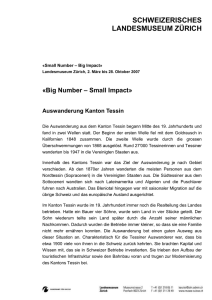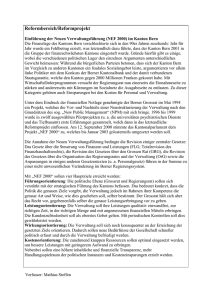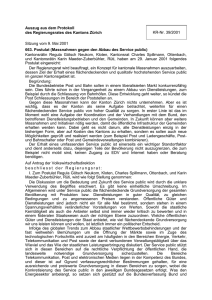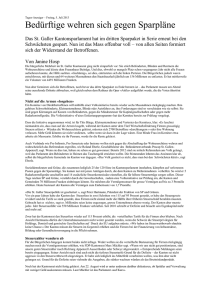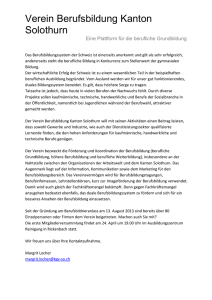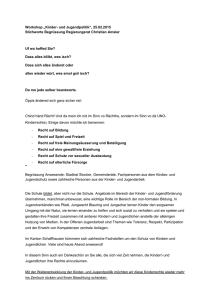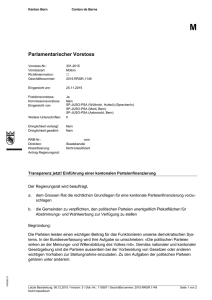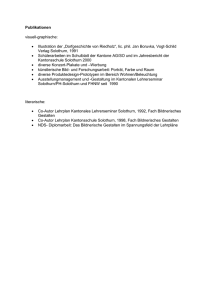Ergänzungsleistungen für Familien - Schweizerische Konferenz für
Werbung

Universität Bern Wirtschafts‐ und Sozialwissenschaftliche Fakultät Institut für Politikwissenschaft Prof. Dr. Christine Trampusch Ergänzungsleistungen für Familien Wenn die Kantone können, was auf Bundesebene nicht gelingt. Lizentiatsarbeit von Franziska Ehrler Scheibenstrasse 16 3014 Bern [email protected] Matrikelnummer 04‐114‐138 August 2010 „Familienpolitik findet im Kopf statt – aber dann muss sie konkretisiert werden!“ Chiara Simoneschi‐Cortesi, Nationalrätin Inhaltsverzeichnis Einleitung ............................................................................................................................ 1 1. Familienpolitik in der Schweiz ...................................................................................... 4 1.1 Familien in der Schweiz – einige Zahlen und Fakten ............................................................... 4 1.2 Familienpolitik in der Schweiz ................................................................................................. 7 1.3 Ergänzungsleistungen für Familien in der Schweiz ............................................................... 11 1.4 Zusammenfassung ................................................................................................................. 19 2. Theoretische Ansätze und aktueller Stand der Forschung .......................................... 20 2.1 Funktionalistische Ansätze .................................................................................................... 21 2.2 Interessen‐ und konflikttheoretische Ansätze ...................................................................... 24 2.3 Institutionalismus .................................................................................................................. 28 2.4 Fazit ....................................................................................................................................... 32 3. Methodik ................................................................................................................... 33 3.1 Prozessanalyse....................................................................................................................... 34 3.2 Die Mill’schen Methoden als Methoden des systematischen Vergleichs ............................. 35 3.3 Fallauswahl ............................................................................................................................ 37 3.4 Daten ..................................................................................................................................... 39 4. Analyse und Ergebnisse ............................................................................................. 41 4.1 Tessin ..................................................................................................................................... 43 4.2 Solothurn ............................................................................................................................... 55 4.3 Obwalden .............................................................................................................................. 65 4.4 Vergleich anhand der Mill’schen Methoden ......................................................................... 77 Schlussfolgerung und Ausblick .......................................................................................... 83 Literatur ............................................................................................................................ 86 Anhang ............................................................................................................................. 94 Einleitung Die Schweiz gilt im internationalen Vergleich als verspäteter Wohlfahrtsstaat (Armingeon 2001). Und obwohl der schweizerische Wohlfahrtsstaat inzwischen zu den westeuropäischen Wohlfahrts‐ staaten aufgeschlossen hat, wird er in den gängigen Wohlfahrtsstaatstypologien nach wie vor dem liberalen oder konservativen Typ mit stark liberalen Eigenschaften zugeordnet (Esping‐Andersen 1990, Armingeon 2001). Konservativ in Bezug auf ein Sozialversicherungssystem, das primär auf Statuserhaltung und tiefe Beschäftigungsquoten für Mütter ausgerichtet ist (Bonoli/Kato 2004:211). Und obschon dem schweizerischen Sozialstaat immer weniger vorgeworfen werden kann, vor allem Risiken abzudecken, die Männer betreffen, folgt insbesondere die Familienpolitik weitgehend einem traditionellen Familienbild (Moser 2008:155). Durch ökonomischen und sozialen Wandel haben sich seit der Konsolidierung der westlichen Wohlfahrtsstaaten neben der traditionellen Familienform jedoch neue Familienformen und Erwerbsbiografien entwickelt, denen der konservativ geprägte Wohlfahrtsstaat nicht gerecht wird. Die dadurch verursachten Schwierigkeiten werden in der Forschung gemeinhin unter dem Titel „neue soziale Risiken“ zusammengefasst. Während Huber/Stephens (2006:145) in ihrer Definition neuer sozialer Risiken auf Armut fokussieren und insbesondere auf das Armutsrisiko alleinerziehender Frauen hinweisen, von dem infolge abnehmender Stabilität der Familienstrukturen immer mehr Menschen betroffen sind, hat Bonoli (2005:433ff.) ein breiteres Verständnis neuer sozialer Risiken und nennt deren sechs: schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, alleinerziehend zu sein, Externalisierung der Betreuung pflege‐ bedürftiger Angehöriger, ein geringes Ausbildungsniveau, sowie eine ungenügende Sozialver‐ sicherungsabdeckung durch Teilzeitarbeit und Unterbrüche in der Erwerbsbiografie. Die Heterogenität dieser Risiken zeigt, dass der schweizerische Wohlfahrtsstaat auf verschiedenen Ebenen modernisiert werden muss, um ausreichenden Schutz vor neuen sozialen Risiken gewährleisten zu können. Dabei hinkt er aber im internationalen Vergleich insbesondere in der Familienpolitik hinterher. Nach einem Anpassungsschub in den 1990er Jahren (vor allem im Bereich der Arbeitslosenversicherung) verbleiben nach wie vor grosse Baustellen (Häusermann 2008:217f.). In Bezug auf die Familienpolitik wurde in den letzten Jahren einiges unternommen. Die Kinderzulagen wurden angehoben, eine Mutterschaftsversicherung eingeführt und ein Gesetz zur Anstoss‐ finanzierung von Kinderkrippen beschlossen, wobei vor allem die letzten beiden Massnahmen zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen (Häusermann 2008:214). Doch trotz diesen Anpassungen auf nationaler Ebene, konnte das Problem des erhöhten Armutsrisikos für Alleinerziehende und kinderreiche Familien nicht gelöst werden. Von allen Haushaltstypen tragen diese beiden mit Abstand das höchste Risiko in eine Working‐Poor‐Situation zu geraten, das heisst 1 trotz Erwerbseinkommen in einem armen Haushalt zu leben (Eidgenössisches Departement des Innern 2004a:39). Diese Familien leben in Armut oder beziehen Sozialhilfe. Die Sozialhilfe als subsidiäres, letztes Netz der sozialen Sicherheit, das die Menschen in momentanen, individuellen Notlagen unterstützen soll, muss dadurch zunehmend strukturelle Risiken auffangen und sich dauerhaft engagieren; eine Rolle, der sie nicht vollständig gewachsen ist (SKOS 1999). Eine mögliche längerfristige Lösung, um eine der genannten Risikogruppen durch ein vorgelagertes System aufzufangen, wäre die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien. Die Debatte zu den Ergänzungsleistungen für Familien auf nationaler Ebene verläuft jedoch schleppend, die Sozial‐ kommission hat ihr Projekt 2009 sistiert und bei der Verwaltung einen Alternativvorschlag bestellt. Eine Fristverlängerung um zwei Jahre wurde zwar vom Parlament bewilligt, es kann aber davon ausgegangen werden, dass auf nationaler Ebene in nächster Zukunft keine Ergänzungsleistungen für Familien auf nationaler Ebene eingeführt werden (SDA 2009). Hier setzt nun die zentrale Bedeutung der Kantone ein. Im Föderalismus der Schweiz spielen die Kantone eine wichtige Rolle bei der Ausgestaltung des Sozialstaates. Die Sozialversicherungen nehmen ihren Ursprung auf lokaler und kantonaler Ebene (Obinger 1998:64‐76), für die Sozialhilfe als letztes Netz der sozialen Sicherheit gibt es bis heute kein Bundesrahmengesetz, sämtliche Rege‐ lungen finden über die kantonale Gesetzgebung statt. Den Kantonen kommt damit grosse Bedeutung bei der Entwicklung und Weiterentwicklung des Sozialstaates zu; was sich in einzelnen Kantonen bewährt, findet später nicht selten auf Bundesebene Anwendung. Als Beispiel seien die inzwischen auf nationaler Ebene geregelten Familienzulagen genannt oder die Impulswirkung des Kantons Genf bei der Einführung der Mutterschaftsversicherung (Wolfensberger 2007, Moser 2008:140). Diese Tendenz zeigt sich auch in Bezug auf die Ergänzungsleistungen für Familien. Während die Debatte über Ergänzungsleistungen für Familien auf nationaler Ebene erst 1999 durch die parlamentarischen Initiativen von Jacqueline Fehr und Lukrezia Meier‐Schatz ins Rollen gebracht wurde und bisher zu keinem konkreten Ergebnis geführt hat, hat der Kanton Tessin bereits 1997 Familienzulagen in Anlehnung an das System der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV eingeführt. Inzwischen hat auch der Kanton Solothurn ein dahingehendes Gesetz verabschiedet, andere Kantone befinden sich auf dem Weg dazu. Es gibt aber auch Kantone, in denen solche Ansinnen geplant waren, jedoch im politischen Prozess gescheitert sind. In wieder anderen fand bis anhin gar keine Debatte statt. Diese Varianz erstaunt nicht, weisen doch verschiedene Studien auf die grossen Unterschiede in der kantonalen Sozialpolitik hin (Thoenen 2006, Moser 2003, Knupfer et al. 2007, Armingeon 2004). Dass die Kantone in die sozialpolitische Bresche springen, ist aber alles andere als selbstverständ‐ lich. Menschen, die von den Ergänzungsleistungen für Familien profitieren, entsprechen mehrheitlich dem Profil der Betroffenen neuer sozialer Risiken. Während die klassische Arbeiterbewegung als eher 2 homogene, gut organisierte Gruppe mit klaren Forderungen auftrat, verfügen die Betroffenen der neuen sozialen Risiken zwar über klar abgegrenzte Präferenzen und eine effektive Interessen‐ vertretung, sind aber eine sehr heterogene Gruppe mit tiefer Präsenz und geringer Partizipation (Bonoli 2005). Daraus ergibt sich folgende Frage: Warum gelingt die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien auf kantonaler Ebene trotzdem? Und weshalb gelingt sie in den einen Kantonen und in anderen nicht? Die Analyse determinierender Faktoren für die Einführung von Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien soll einen Beitrag auf zwei Ebenen leisten. Anhand eines qualitativen Vergleichs der Kantone Tessin, Solothurn und Obwalden soll zum einen eine Aussage gemacht werden zu erfolgversprechenden Strategien zur Einführung finanzieller Transferleistungen für Familien, zum anderen soll ein Beitrag zur theoretischen Diskussion der Familienpolitik im Beson‐ deren und der schweizerischen Wohlfahrtsstaatsforschung im Allgemeinen geleistet werden. Die Expansion des schweizerischen Wohlfahrtsstaats im Bereich der Familienpolitik wurde schon mehrfach diskutiert. Während sich mehrere Studien im Rahmen von Einzelfallstudien auf einzelne Bereiche oder die Familienpolitik auf Bundesebene als Ganzes konzentrieren (Moser 2008, Bonoli/Ballestri 2003, Wolfensberger 2007, Häusermann 2006a/b), haben bisher lediglich Thoenen (2006) und Binder et al. (2003) die Familienpolitik auf kantonaler Ebene vergleichend untersucht. Erstere setzt sich mit universellen Transferleistungen auseinander, Binder et al. untersuchen die Familienpolitik im Allgemeinen. Durch den qualitativen Vergleich in Bezug auf eine bestimmte Policy können diese Erkenntnisse erweitert werden. Im ersten Teil der folgenden Analyse wird ein Überblick über die Problemlage und die Familienpolitik in der Schweiz gegeben, mit besonderem Blick auf Vorstösse zu Ergänzungsleistungen für Familien. Im zweiten Teil werden die theoretischen Konzepte, die der Untersuchung zugrunde liegen, sowie der aktuelle Forschungsstand dargelegt. Der dritte Teil beschäftigt sich mit der Methodik. Dann folgt im vierten Teil die empirisch‐vergleichende Analyse drei ausgewählter Kantone, bevor das Schlusskapitel die Ergebnisse zusammenfasst und einen Ausblick wagt. 3 1. Familienpolitik in der Schweiz 1.1 Familien in der Schweiz – einige Zahlen und Fakten 1.1.1 Wandel der Familienformen Die Haushaltsstrukturen und Familienformen in der Schweiz unterliegen seit den 1970er Jahren einem fundamentalen Wandel. Während noch Anfang der 1970er Jahre Familienhaushalte die Hälfte aller Haushalte ausmachten, beträgt deren Anteil heute nur noch ein Drittel (67% aller Haushalte in der Schweiz sind Nichtfamilienhaushalte). Da die Familienhaushalte grösser sind als die Nicht‐ familienhaushalte, lebt aber nach wie vor eine Mehrheit aller Menschen in der Schweiz in Familien (Bundesamt für Statistik 2008a:7f.). Diese Familien sind in den letzten Jahrzehnten kleiner geworden, die meisten Kinder wachsen heute in Paarhaushalten mit einem, zwei oder höchstens drei Kindern auf, wobei der Anteil der Familien mit mehr als drei Kindern stark gesunken ist. Der Anteil der Alleinerziehenden ist hingegen stabil geblieben. 13.5% aller Kinder in der Schweiz lebten 2007 mit nur einem Elternteil zusammen (Bauer et al. 2003:46, Bundesamt für Statistik 2008a:8). Einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung in der Schweiz hat die ausländische Wohnbevölkerung. Die Zahl der Familien, in denen ein oder beide Elternteile keinen Schweizer Pass haben, hat seit 1970 stark zugenommen. Im Jahr 2007 hatte jedes vierte Kind in der Schweiz keinen Schweizer Pass. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass AusländerInnen in der Gruppe der Erwachsenen im Familienalter übervertreten sind; zum anderen leben Ausländerinnen eher in Familienhaushalten und bringen mehr Kinder zur Welt als Schweizerinnen (Bundesamt für Statistik 2008a:11). Das bürgerliche Familienmodell mit einem Vollzeit erwerbstätigen Mann und einer Frau, die nicht oder Teilzeit erwerbstätig ist, dominiert in der Schweiz. Der Anteil der Frauen, die Teilzeit arbeiten, hat sich zwischen 1970 und 1990 jedoch beinahe verdoppelt (Bauer et al. 2004:49f.). Im inter‐ nationalen Vergleich ist die Erwerbsquote der Frauen leicht höher als der EU‐Durchschnitt, wobei die Frauen in der Schweiz vermehrt Teilzeit arbeiten, während ihre europäischen Nachbarinnen viel häufiger Vollzeit arbeiten. Weil die Mütter oft tiefe Erwerbspensen innehaben, bleibt auch ihr Beitrag zum Familienbudget bescheiden. In mehr als 65% aller Haushalte trägt die Frau weniger als einen Viertel zum Erwerbseinkommen bei. Was die Betreuung der Kinder anbelangt, nimmt die Hälfte aller Familien mit einem Kind unter vier Jahren familienergänzende Kinderbetreuung in Anspruch, wobei in der Schweiz den Verwandten nach wie vor eine wichtigere Rolle zukommt als Kinderkrippen und Tagesfamilien (Bundesamt für Statistik 2008a:20ff.). 4 1.1.2 Kinderbedingte Kosten und Leistungen für Familien Kinder verursachen einer Familie direkte und indirekte Kosten. Auf der einen Seite fallen die direkten Konsumkosten für die Kinder an. Auf der anderen Seite ergeben sich durch die Zeitkosten, die infolge der Kinderbetreuung durch die Eltern entstehen, indirekte Kosten. Hinzu kommen Kosten für Sozialversicherungen und teilweise für familienergänzende Kinderbetreuung. Allein die direkten Kinderkosten (Konsumausgaben) belaufen sich für ein Paar mit einem Kind pro Monat auf rund 820 Franken (Bundesamt für Statistik 2008a:34). Familien mit Kindern werden aber auch vom Staat unterstützt und entlastet, wobei die Schweiz nur 1.3% des BIP für Sozialleistungen für Familien ausgibt, was im europäischen Vergleich sehr tief ist. Nur die Niederlande, Italien, Spanien und Polen geben noch weniger für finanzielle Leistungen an Familien aus. Der grösste Teil dieser Leistungen wird in der Schweiz in Form von Kinderzulagen ausbezahlt. Neben den Kinderzulagen bilden steuerliche Entlastungen das zweite zentrale Instrument, das Familien finanziell entlastet. Ein Vergleich der Bruttoeinkommen zeigt jedoch, dass die Einkommen der Schweizer Familien trotz Transferleistungen und anderen Entlastungen nicht höher sind als die Einkommen von Paaren bzw. Alleinstehenden ohne Kinder (Bundesamt für Statistik 2008a:16, Eidgenössisches Departement des Innern 2004a:42). 1.1.3 Familienarmut „Nicht mehr das Alter, sondern das Grossziehen von Kindern ist in der Schweiz die Lebensphase mit dem grössten Armutsrisiko“ (Bundesamt für Statistik 2008a:44). Trotz diverser Transferleistungen wie Kinderzulagen, Alimentenbevorschussung und Prämienverbilligung sind Familien in der Schweiz häufiger von Armut betroffen als kinderlose Haushalte. Das Armutsrisiko differiert nach Familientyp. Grafik G1 zeigt die Armuts‐ und Working‐Poor‐Quote für die verschiedenen Haushaltstypen, wobei ins Auge fällt, dass insbesondere Alleinerziehende und Familien mit mehr als drei Kindern ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko tragen. Jeder vierte Haushalt alleinerziehender Personen in der Schweiz lebt unter der von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) festgelegten Armutsgrenze und kinderreiche Familien tragen ein fast ebenso hohes Risiko in Armut zu leben. Ein nicht ganz so deutliches, aber ähnliches Bild zeigt sich in Bezug auf die Working‐Poor‐Quote. Hier sind insbesondere Familien mit mehr als drei Kindern stark betroffen. Fast ein Fünftel dieser Familien befinden sich in einer Working‐Poor‐Situation, das heisst ihr Haushalt weist insgesamt ein Arbeits‐ zeitvolumen von mindestens 36 Stunden pro Woche auf und der Lohn vermag die Ausgaben trotzdem nicht zu decken (Bundesamt für Statistik 2008a:13). Ein Blick auf die Sozialhilfestatistik zeigt denn auch, dass Kinder in der Schweiz viel öfter von Armut betroffen sind als Erwachsene. Kinder weisen eine deutlich höhere Sozialhilfequote auf als 5 Erwachsene: 4.9% aller Kinder in der Schweiz werden von der Sozialhilfe unterstützt, aber nur 3.3% aller Erwachsenen (Bundesamt für Statistik 2008a:48). In den grossen Schweizer Städten ist es gar jedes zehnte Kind (Salzgeber/Neukomm 2008:19). Es zeigt sich aber auch, dass das Armutsrisiko mit zunehmendem Alter der Kinder abnimmt, woraus sich schliessen lässt, dass die indirekten Kosten infolge des entgangenen Verdienstes aufgrund der Betreuungsaufgaben stärker ins Gewicht fallen als die direkten Kosten (Bauer et al. 2004:55). G 1 Armuts‐ und Working‐Poor‐Quote nach Haushaltstyp, 2007 30% 26.3 23.9 25% 20% 18 15% 11.4 10% 8.8 9.9 8.7 9.1 7.6 6 5% 5.2 4.4 2.2 1.9 0% sämtliche Haushalte Einpersonen‐ haushalte Eineltern‐ haushalte allgemeine Armutsquote Paar ohne Kind Paar mit 1 Kind Working‐Poor‐Quote Paar mit 2 Paar mit 3 und Kindern mehr Kindern Quelle: SAKE BFS 2007 Neben den direkten und indirekten Kosten ist vor allem das Haushaltseinkommen ausschlag‐ gebend für die finanzielle Situation einer Familie. Das Bundesamt für Statistik nennt die Haushalts‐ zusammensetzung, die Nationalität und das Ausbildungsniveau als drei zentrale Faktoren für die Höhe des Haushaltseinkommens. Eine vertiefte Analyse hat gezeigt, dass ausländische Familien mit drei oder mehr Kindern und einem tiefen Ausbildungsniveau sich im tiefsten Einkommensspektrum wiederfinden, während im höchsten Einkommensspektrum ebenfalls ausländische Personen, aber ohne Kinder und mit hoher Ausbildung anzutreffen sind. Personen schweizerischer Nationalität befinden sich vor allem im mittleren Einkommensbereich. In diesem Bereich entscheidet primär die Familienform darüber, ob ein unter‐ oder überdurchschnittliches Einkommen erzielt wird (Bundesamt für Statistik 2008a:45f.). 6 1.2 Familienpolitik in der Schweiz 1.2.1 Definition und Kompetenzen „Familienpolitik in modernen, industrialisierten Staaten besteht aus anerkannten Aktivitäten staatlicher und nichtstaatlicher Träger, mit denen bezweckt wird, Leistungen, die in der Familie und durch die Familie erbracht werden bzw. erbracht werden sollen, zu beeinflussen und solchermassen gesellschaftspolitische Ordnungsvorstellungen durchzusetzen.“ So definiert die Arbeitsgruppe zum Familienbericht von 1982 die Familienpolitik der Schweiz (1982:26). Familienpolitik wird dabei als Querschnittspolitik verstanden, welche sich in vielen Politikbereichen auswirkt und von den verschiedensten Politikbereichen beeinflusst wird. Zusätzlich geprägt durch den schweizerischen Föderalismus und das Prinzip der Subsidiarität, ist die Familienpolitik in der Schweiz stark frag‐ mentiert. Neben den öffentlichen Stellen sind viele parastaatliche und private Akteure in die Familienpolitik involviert, was den Fragmentierungsgrad zusätzlich erhöht (Sieber et al. 2004:109, Vatter et al. 2004:81). Grundsätzlich liegt die Familienpolitik in der Kompetenz der Kantone. Entsprechend beschränkt sind die familienpolitischen Kompetenzen des Bundes, festgelegt in Artikel 116 der Bundes‐ verfassung. Darin sind Regelungen im Bereich der Familienzulagen und die Einrichtung der Mutter‐ schaftsversicherung explizit erwähnt. Des Weiteren kann der Bund Massnahmen zum Schutz der Familie unterstützen, das heisst er kann Finanzhilfe leisten und die Voraussetzungen dafür festlegen (Sieber et al. 2004:109). Aber auch die Definition der Familienpolitik als Querschnittspolitik fand Eingang in die Verfassung, indem ebenfalls in Artikel 116 festgehalten wird, dass der Bund die Bedürfnisse der Familien bei der Erfüllung all seiner Aufgaben zu berücksichtigen habe. Neben Bund und Kantonen sind aber auch die Gemeinden mehr als nur Vollzugsorgane. Während die Kantone in erster Linie für ökonomische Massnahmen zuständig sind, zeichnen sich die Gemeinden für die Bereitstellung familienergänzender Kinderbetreuung verantwortlich (Binder/Kübler 2004:346). 1.2.2 Historischer Abriss der schweizerischen Familienpolitik Als Ausgangspunkt einer gesamtschweizerischen Familienpolitik kann die Tagung zum Thema „Wirtschaftlicher Schutz der Familien“ der Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik im Jahre 1931 betrachtet werden, an der über 40 Verbände teilnahmen. Das zeigt, dass die Familienpolitik in der Schweiz von Beginn an unter starkem Einbezug privater und parastaatlicher Akteure stattfand. In dieser ersten Phase standen sozialpolitische Motive und mit ihnen die Aufnahme eines Familien‐ schutzartikels in die Bundesverfassung im Zentrum (Lüscher 2003:29f, Huber 1991:148f.). 1945 war es dann soweit, das Volk akzeptierte den Gegenvorschlag zur Volksinitiative „Für die Familie“ und 7 sagte damit JA zum Verfassungsartikel, der bereits die Forderung nach einer Mutterschafts‐ versicherung und die Kompetenzen zur Regelung der Familienzulagen enthielt. In der Zwischenzeit hatten einige Kantone die Kinderzulagen bereits gesetzlich geregelt, andere Kantone hingegen nicht. Daneben existierten private Regelungen in Gesamtarbeitsverträgen oder durch Branchenverbände (Huber 1991:152‐155). In der nächsten Phase bis 1970 standen vor allem die Aktivitäten der Familienverbände im Zentrum der Familienpolitik. Trotz verschiedener Vorstösse kam es aber weder zu einer bundesrechtlichen Regelung der Familienzulagen (ausser für die Landwirtschaft), noch zur Einrichtung einer Mutterschaftsversicherung (Lüscher 2003:30). Auch in den 70er und 80er Jahren blieb die Familienpolitik ein Randthema, obwohl geprägt durch vermehrte Vorstösse im Parlament. Aufgrund dieser Aktivitäten entstand der Familienbericht von 1982, der zwar positiv aufgenommen wurde, dessen Forderungen nach einer koordinierten, konzeptuellen und praktischen Förderung familienpolitischer Anliegen aber nicht umgesetzt wurden (Lüscher 2003:30, Moser 2008:135f.). Bewegung in die Familienpolitik kam dann in den 1990er Jahren. Als Impulse dafür können sicherlich das 1994 von der UNO ausgerufene „Internationale Jahr der Familie“ und die daraus resultierende Gründung der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF) betrachtet werden (EKFF 2004:6, Lüscher 2003:31). In den folgenden Jahren wurden verschiedene familienpolitische Vorstösse und Initiativen lanciert und es konnten bereits jahrzehntelang dis‐ kutierte Projekte wie beispielsweise die Mutterschaftsversicherung zum Abschluss gebracht werden, so dass die Familienpolitik zu einem eigentlichen Expansionsfeld des schweizerischen Wohlfahrts‐ staats wurde (Moser 2008:154f.). Ein Trend, der bis heute anhält und im nächsten Kapitel detaillierter beschrieben werden soll, indem die Reformfelder der letzten Jahre kurz erläutert werden. 1.2.3 Familienpolitische Reformfelder der letzten Jahre Anstossfinanzierung für Krippenplätze Innert kürzester Zeit wurde die Initiative zur Anstossfinanzierung für Krippenplätze lanciert und verabschiedet. 2002 beschloss das Parlament insgesamt 200 Mio. Franken, verteilt über vier Jahre, zur Förderung familienergänzender Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen (Stutz 2004:103). Das Programm wurde um vier weitere Jahre verlängert und läuft nun bis 2011. Eine Evaluationsstudie attestiert dem Programm eine nachhaltige Wirkung, weshalb der Bundesrat eine Verlängerung des Programms bis 2015 mit einem Finanzrahmen von 80 Mio. Franken vorschlägt (Bundesamt für Sozialversicherungen 2010). 8 Einführung einer Mutterschaftsversicherung Nach 60 Jahren und mehreren Anläufen hat die Schweiz seit 2004 eine Mutterschaftsversicherung. Nachdem die Vorlage 1999 noch gescheitert war, bejahte das Volk 2004 die Neuauflage der Mutterschaftsversicherung, die auf Vorschlag des freisinnigen Nationalrates Pierre Triponez zustande kam und anders als die Vorlage von 1999 nicht erwerbstätige Mütter vom Anspruch ausschliesst. Seither haben erwerbstätige Frauen in der Schweiz während 14 Wochen Anspruch auf bezahlten Mutterschaftsurlaub (Moser 2008:140‐143). Vereinheitlichung der Kinder‐ und Ausbildungszulagen Wie auch die Mutterschaftsversicherung war eine bundesrechtliche Regelung der Kinderzulagen seit ihrer Aufnahme in die Verfassung im Jahre 1945 ein Thema. 1991 forderte die Initiative Fankhauser Kinderzulagen von mindestens 200 Franken für jedes Kind und Ausbildungszulagen von mindestens 250 Franken. Diese Ansätze orientierten sich an den höchsten auf kantonaler Ebene bereits existierenden Ansätzen. Ausserdem wurde im Parlament ausgehandelt, dass neu auch Nichterwerbstätige und Teilzeiterwerbstätige die vollen Kinderzulagen erhalten sollten. Ausge‐ schlossen bleiben die selbstständig Erwerbenden. Die Vorlage wurde 2006 vom Volk mit grosser Mehrheit angenommen (Moser 2008:147‐152). Verbilligung der Krankenversicherungsprämien für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung Im Jahr 2005 wurde im Parlament im Zuge der Revision der Krankenversicherung eine Neu‐ regelung der Prämienverbilligung verabschiedet. Seither sind die Kantone verpflichtet, die Krankenversicherungsprämien von Kindern bis 18 Jahre und jungen Erwachsenen in Ausbildung bis 25 Jahre aus Familien mit tiefen und mittleren Einkommen um mindestens 50% zu verbilligen (Moser 2008:123). Familienbesteuerung 2004 hat das Volk eine Steuerreform abgelehnt, die Familien steuerlich entlasten wollte. Die Vorlage kam unter Beschuss, weil sie vor allem besser verdienende Familien entlastet hätte, einkommensschwache Familien aber nur in geringem Ausmass. Ausserdem hätte sie auch verheiratete Paare ohne Kinder entlastet, Konkubinatspaare mit Kindern hingegen nicht (Stutz 2004: 102f.). Eine weitere Steuerreform, die Familien entlasten soll, wurde schliesslich 2009 vom Parlament verabschiedet und wird 2011 in Kraft treten. Durch die Einführung eines Elterntarifs und eines Abzugs für die familienergänzende Kinderbetreuung wird die Steuergerechtigkeit zwischen Personen 9 mit und ohne Kinder verbessert, bei gleichzeitiger steuerlicher Gleichbehandlung von Eltern mit und ohne externe Kinderbetreuung (Parlamentsdienste 2009a). Ergänzungsleistungen für Familien Die Ergänzungsleistungen für Familien auf Bundesebene stellen ebenfalls eines dieser aktuellen Reformfelder dar, werden aber in Kapitel 1.3.3 gesondert behandelt. 10 1.3 Ergänzungsleistungen für Familien in der Schweiz 1.3.1 Das schweizerische System der Ergänzungsleistungen als bewährtes Mittel gegen Armut Die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV stellen eine wichtige Komponente des schweizerischen Sozialstaats dar. Die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV wurden 1966 eingeführt, da AHV und IV ihren in der Verfassung verankerten Auftrag, das Existenzminimum ihrer Klientel zu garantieren, nicht erfüllen konnten. Die Ergänzungsleistungen wurden ursprünglich als Zwischenlösung eingeführt und sollten wieder abgeschafft werden, sobald die AHV und die Invalidenversicherung entsprechend entwickelt gewesen wären, um die Leistungsbeziehenden vor Armut bewahren zu können. Dieser Fall trat nicht ein und die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV wurden fester Bestandteil des schweizerischen Sozialstaates. 2008 fanden sie schliesslich Eingang in die schweizerische Verfassung. Die Ergänzungsleistungen haben sich als sehr wirkungsvolle Massnahme in der Armutsbekämpfung erwiesen. Sie brachten die Armut im Alter und infolge Invalidität in der Schweiz praktisch zum Verschwinden (Carigiet/Koch 2009:10,40). Finanziert werden die Ergänzungsleistungen ausschliesslich aus öffentlichen Mitteln von Bund, Kantonen und Gemeinden. Eine Finanzierung über Lohnprozente ist nicht gestattet. Die Höhe des Bundesbeitrags ist abhängig von der Finanzkraft des Kantons. Wie die Kantone ihren Teil der Kosten zwischen Kanton und Gemeinden aufteilen, bleibt ihnen überlassen (Hüttner/Bauer 2003:32) Die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV sind zwischen dem System der Sozialversicherungen und der Sozialhilfe anzusiedeln. Anspruch auf Ergänzungsleistungen hat grundsätzlich, wer eine Rente der AHV oder der IV bezieht. Damit orientiert sich die Leistung am Versicherungsprinzip (Carigiet/Koch 2009:40). Betagte, Hinterbliebene und Behinderte, denen Rente und Einkommen nicht ausreichen um den minimalen Lebensbedarf zu decken, können einen rechtlichen Anspruch auf Ergänzungs‐ leistungen geltend machen. Es handelt sich infolge des Rechtsanspruches nicht um Sozialhilfe, obwohl die Leistung bedarfsabhängig ausgerichtet wird, indem wie in der Sozialhilfe Ausgaben und Einnahmen einander gegenübergestellt werden und der Ausgabenüberschuss durch die Ergänzungsleistungen abgedeckt wird (Hüttner/Bauer 2003:30). Beziehende von Ergänzungs‐ leistungen sind aber besser gestellt als Sozialhilfebeziehende, da sich die Ergänzungsleistungen an einem höheren Existenzminimum orientieren. Ausserdem erreichen die Ergänzungsleistungen einen höheren Abdeckungsgrad als die Sozialhilfe, da sie eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz geniessen und deshalb die Bezugsquote höher ist (Carigiet/Koch 2009:25). Da sowohl die Mehrheit der Sozialversicherungen (z.B. Arbeitslosenversicherung, Kranken‐ und Unfallversicherung), als auch die Sozialhilfe auf kurzfristige Einkommensausfälle bzw. vorüber‐ 11 gehende Notlagen ausgerichtet sind, bietet sich die Ausdehnung des Systems der Ergänzungsleistungen als mögliches Modell für das Auffangen neuer struktureller Risiken wie Langzeitarbeitslosigkeit, Einkommensschwäche, Pflegebedürftigkeit im Alter oder eben Familien‐ armut an; Risiken also, die nicht nur kurzfristiger Natur sind (Carigiet/Koch 2009:26f.). Die Ergänzungsleistungen würden im Falle der Ergänzungsleistungen für Familien eine neue Dimension erlangen, da sie nicht mehr an eine Rente anknüpfen, sondern ein ungenügendes Erwerbsein‐ kommen ergänzen. Bevor über die konkreten politischen Vorstösse gesprochen wird, soll zuerst diskutiert werden, inwiefern Familienarmut ein neues strukturelles Risiko darstellt und inwiefern Ergänzungsleistungen für Familien als Antwort eines modernen Wohlfahrtsstaats gesehen werden können. 1.3.2 Ergänzungsleistungen für Familien, eine traditionelle Antwort auf ein neues soziales Risiko Durch ökonomischen und sozialen Wandel haben sich seit der Konsolidierung der westlichen Wohlfahrtsstaaten neben der traditionellen Familienform neue Familienformen und Erwerbs‐ biografien entwickelt, denen der gegenwärtige Wohlfahrtsstaat nicht gerecht wird. Die dadurch verursachten Schwierigkeiten werden in der Forschung gemeinhin unter dem Titel „neue soziale Risiken“ zusammengefasst. Während die alten Risiken wie Arbeitslosigkeit, Invalidität, Krankheit und Alter zu einem grossen Teil durch den heutigen Wohlfahrtsstaat abgedeckt werden, sind es die neuen sozialen Risiken wie die schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das Armutsrisiko alleinerziehender Frauen, die Externalisierung der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger, ein tiefes Ausbildungsniveau oder eine ungenügende Sozialversicherungsabdeckung durch Teilzeitarbeit und Unterbrüche in der Erwerbsbiografie nicht oder nur teilweise (Huber/Stephens 2006:145, Bonoli 2005:433ff.). Alte und neue soziale Risiken sowie die politischen Antworten darauf unterscheiden sich hinsichtlich verschiedener Faktoren. Während alte soziale Risiken im Lebenszyklus jedes Bürgers auftauchen, treffen neue soziale Risiken eher junge Menschen und Minderheiten, da den neuen sozialen Risiken weniger ausgesetzt ist, wer im Arbeitsmarkt integriert ist und Strategien zur Externalisierung von Betreuungsaufgaben entwickelt hat (Taylor‐Gooby 2004:7ff.). Policies im Bereich der alten Risiken basieren viel mehr auf horizontalen finanziellen Transfers als Massnahmen im Bereich der neuen sozialen Risiken, die eher die Mobilisierung der Betroffenen ins Zentrum rücken, indem diesen Wahlmöglichkeiten geboten werden und bestimmte Verhaltensmuster gefördert werden sollen. Es ist auch einfacher, gesellschaftliche Solidarität für die Betroffenen der alten sozialen Risiken zu mobilisieren, da während seines Lebenszyklus jeder diesen Risiken ausgesetzt ist. Ausserdem verschieben staatliche Antworten auf neue soziale Risiken die klassische 12 Grenze zwischen öffentlichem und privatem Bereich, indem familienpolitische Massnahmen in einen Bereich eindringen, der bis anhin als privat galt (Taylor‐Gooby 2004:7ff.). Zu welcher Risikogruppe gehören nun die Beziehenden von Ergänzungsleistungen für Familien? Und ist diese Sozialleistung eher eine traditionelle oder eine moderne Antwort auf ein Wohlfahrts‐ risiko? Ergänzungsleistungen sind eine bedarfsabhängige Leistung, die sich an einkommensschwache Familien richtet. Profitieren davon werden primär Alleinerziehende und kinderreiche Familien, da diese Familienformen ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko aufweisen (Eidgenössisches Departement des Innern 2004a:39). In diesem Sinne richten sich die Ergänzungsleistungen an zwei Gruppen, die in der heutigen Gesellschaft Minderheiten darstellen. Zudem ist die Einelternfamilie eine Familienform, die in diesem Ausmass erst durch die im Gegensatz zu früher deutlich höheren Scheidungsraten, entstanden ist (Bundesamt für Sozialversicherung 2004:25f.). Das heisst die Beziehenden von Ergänzungsleistungen für Familien sind von einem neuen sozialen Risiko betroffen. Die politische Antwort in Form von bedarfsabhängigen monetären Leistungen ist jedoch eine eher traditionelle politische Antwort auf ein Wohlfahrtsrisiko. Je nach Ausgestaltung fördern die Vorlagen über Arbeitsanreize die Erwerbstätigkeit von Frauen und ermöglichen durch den Einbezug der Krippenkosten eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Doch obwohl diese Elemente als Weiterentwicklung des Wohlfahrtsstaats in Richtung eines working mother model1 betrachtet werden können, stehen die monetären Transfers im Sinne des traditionellen male breadwinner model, wie es den industriellen Wohlfahrtsstaaten zugrunde liegt, ganz klar im Vordergrund (Häusermann 2006:35). 1.3.3 Ergänzungsleistungen für Familien auf Bundesebene Die Initiativen und Entwicklungen im Bereich der Ergänzungsleistungen für Familien sind Teil einer Reihe verschiedenster Vorstösse in der Familienpolitik, die eine Besserstellung der Familien und einen Ausbau des Wohlfahrtsstaats fordern. So forderte die Nationalrätin Franziska Teuscher 1998 eine kostendeckende Kinderrente für alle Kinder, die jedoch abgelehnt wurde. Mehr Erfolg war der Initiative von Jacqueline Fehr zur Anstossfinanzierung für Kinderkrippen beschieden, die sie im Jahr 2000 initiiert hat. Parallel zum Prozess im Bereich der Ergänzungsleistungen verlief auch die Diskussion zur Vereinheitlichung der Kinderzulagen. Überdies wurde 2009 von Nationalrat Reto Wehrli ein Vorstoss eingereicht, der eine Neugestaltung des sozialen Sicherungssystems unter Einbezug der Sozialhilfe fordert. Die politische Debatte um die Einführung von Ergänzungsleistungen 1 Häusermann (2006b) diskutiert im Zusammenhang mit der Untersuchung von Koalitionen der schweizerischen Familien‐ politik, drei verschiedene Wohlfahrtsstaatsmodelle, die das male breadwinner model ablösen könnten und sich durch unterschiedliche Beziehungen und Werthaltungen bezüglich Arbeit und Betreuungsaufgaben auszeichnen. Das working mother model zielt dabei auf die Gleichstellung der Geschlechter ab, indem Rahmenbedingungen für eine höhere Frauenerwerbstätigkeit geschaffen werden sollen. Betreuungsarbeit wird dabei nur in der Form von familienexterner Kinderbetreuung als „Arbeit“ wahrgenommen (Häusermann 2006b:7). 13 für Familien wurde denn auch immer wieder durch die Diskussion anderer familienpolitischer Mass‐ nahmen beeinflusst (SGK 2009:3). Erstmals auf Bundesebene thematisiert wurden die Ergänzungsleistungen für Familien mit der Einreichung einer entsprechenden parlamentarischen Initiative von Jacqueline Fehr (SP) 1999. Die Ausrichtung der Ergänzungsleistungen für Eltern, wie sie damals genannt wurden, sollte so ausgestaltet werden, dass ein Anreiz zur Aufrechterhaltung der Erwerbstätigkeit besteht und die egalitäre Aufteilung der Erwerbsarbeit gefördert wird. Die Eltern‐EL sollten von den Kantonen ausgerichtet und durch den Bund mitfinanziert werden, wobei die Höhe des Bundesbeitrags unter anderem von der Anzahl Krippenplätze in einem Kanton abhängig gemacht werden sollte. Diese Initiative wurde im Jahr 2000 im Parlament ganz knapp abgelehnt (Parlamentsdienste 2009b). Nur wenig später reichte Fehr erneut eine parlamentarische Initiative ein mit der Forderung nach Ergänzungsleistungen für Familien analog zum System der Ergänzungsleistungen für Familien, wie es der Kanton Tessin 1996 eingeführt hat. Wiederum sollte die Vorlage mit der Anzahl an Betreuungs‐ plätzen verknüpft werden. Fast zeitgleich reichte Lucrezia Meier‐Schatz (CVP) eine parlamentarische Initiative mit fast demselben Wortlaut ein, die von 24 CVP‐Parlamentariern mitunterzeichnet war, verzichtete aber auf die Forderung nach der Verknüpfung mit der Anzahl Betreuungsplätze in einem Kanton. Beiden Initiativen wurde Folge gegeben, worauf die Kommission für Soziales und Gesundheit des Nationalrates (SGK‐N) eine Subkommission „Familienpolitik“ ins Leben rief, die sich mit den Anliegen der Initiativen beschäftigen sollte (SGK 2005:3). Im Jahr 2003 wurde ein erstes Mal eine Fristverlängerung von zwei Jahren gewährt für die Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage gewährt, weil aufgrund der Initiative Fehr zur Anstoss‐ finanzierung von Krippenplätzen keine Zeit für diese Vorlage blieb. Ende 2003 schlug die Subkommission drei Modelle von Ergänzungsleistungen für Familien vor, worauf sich die Kommission schliesslich für ein Modell entschieden und das Vernehmlassungsverfahren eröffnet hat (SGK 2007:3). Dabei wurde die Gesetzesvorlage von den Vernehmlassungsteilnehmenden im Allgemeinen begrüsst. Auch eine grosse Mehrheit der Kantone sprach sich für die Einführung einer derartigen Leistung durch den Bund aus (Eidgenössisches Departement des Innern 2004b:8). Im Anschluss an das Vernehmlassungsverfahren wurde das Projekt 2004 zugunsten der Vorlage zur Vereinheitlichung der Familienzulagen sistiert. Zu einer erneuten Verzögerung kam es, weil die Kommission die Ergebnisse der Volksabstimmung über die Verfassungsbestimmungen des nationalen Finanzausgleichs NFA abwarten wollte (SGK 2009:3). 14 Im Sommer 2005 nahm die Subkommission ihre Arbeit schliesslich wieder auf, sistierte diese 2007 aber erneut, weil die Beratung des Vorentwurfs im Parlament nicht stattfinden sollte, bevor das Parlament seine Arbeit zum dritten Teil des NFA abgeschlossen hatte. So wurde die Vorlage 2008 wieder aufgenommen, worauf die Kommission (SGK‐N) zum Ergebnis kam, dass aufgrund der Entwicklungen in der EU Ergänzungsleistungen für Familien auch exportiert werden müssten, worauf entschieden wurde, die bisherigen Vorschläge zu sistieren und die Ausarbeitung einer alternativen Vorlage der Verwaltung in Auftrag zu geben. Damit ist die Einführung von Ergänzungsleistungen auf Bundesebene nach einem fast zehnjährigen Prozess in weite Ferne gerückt (SGK 2009:3f.). Wie obenstehende Beschreibung zeigt, haben sich verschiedene Phasen der Entwicklung mit Blockaden abgewechselt, wobei davon ausgegangen werden kann, dass die Kantone das Geschehen auf Bundesebene verfolgt und ihre eigene Politik danach ausgerichtet haben. Grafik G2 gibt einen Überblick über den Wechsel zwischen Vorankommen und Blockade. G 2 Entwicklung der Bundeslösung im Zeitverlauf (= Blockade=Weiterentwicklung) 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Quelle: Hüttner/Bauer 2003, SGK 2005,2007,2009, eigene Darstellung 1.3.4 Kantonale Initiativen Da in der Schweiz für viele Bereiche der Familienpolitik die Kantone zuständig sind, werden auch je nach Kanton unterschiedliche Leistungen für Familien angeboten. Alle Kantone richten Familien‐ und Ausbildungszulagen aus, jedoch in unterschiedlicher Höhe. Das Bundesrahmengesetz von 2006 hat in diesen zwei Bereichen Mindestansätze festgelegt, die aber von diversen Kantonen überschritten werden. Ausserdem richten einige Kantone einmalige Geburts‐ oder Adoptionszulagen von bis zu 3000 Franken aus (Bundesamt für Sozialversicherungen 2009a). Des Weiteren existieren beispiels‐ weise in den Kantonen Waadt und Wallis kantonale Familienfonds, die einkommensschwachen Familien einmalig oder periodisch finanzielle Unterstützung gewähren. Neben diesen Leistungen kennen momentan 13 Kantone Bedarfsleistungen für einkommens‐ schwache Familien. Diese Bedarfsleistungen unterscheiden sich stark, sowohl hinsichtlich Anspruchs‐ berechtigung und Bezugsdauer als auch in Bezug auf die Höhe der Leistung. Während in den Kantonen Zürich, Tessin, Graubünden und Solothurn Bedarfsleistungen an Eltern ausgerichtet werden, sind in den Kantonen Luzern, Zug, Freiburg und St. Gallen nur die Mütter anspruchs‐ berechtigt. Im Kanton Schaffhausen werden nur Alleinerziehende unterstützt. Abgesehen von den Kantonen Tessin und Solothurn werden ausschliesslich Leistungen an Familien mit Kleinkindern bis zu 15 einem Alter von maximal zwei Jahren ausbezahlt. Ein Blick auf die Ausgaben zeigt, dass im System des Kantons Tessin mit Abstand am meisten Leistungen ausgeschüttet werden. Genau die Hälfte aller Ausgaben für bedarfsabhängige Familienleistungen in der Schweiz wurde im Jahr 2000 im Kanton Tessin ausbezahlt. Ein weiteres Viertel der Ausgaben wurde im Kanton Zürich ausbezahlt, der Rest verteilt sich auf die anderen Kantone mit Bedarfsleistungen. Bei einigen Kantonen können keine Aussagen zu den Ausgaben gemacht werden, weil diese im Jahr 2000 noch nicht in Kraft waren. Dies ist aber nicht der Fall im Kanton Glarus, wo die Erwerbsersatzleistungen für einkommensschwache Eltern 1991 eingeführt wurden, aber kaum zur Anwendung kommen (Hüttner/Bauer 2003:17‐19). T 1 Übersicht über die kantonalen Bedarfsleistungen für Familien Kanton Leistung Jahr der Anspruchsdauer Einführung nach der Geburt Jährliche Ausgaben 2000 in 1000 Fr. ZH Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern 1992 2 Jahre 11‘600 LU Mutterschaftsbeihilfe 1991 1 Jahr 2‘900 GL Erwerbsersatzleistung für einkommensschwache Eltern 1991 1 Jahr ‐ ZG Mutterschaftsbeiträge 1989 1 Jahr 550 FR Allocation de maternité 1992 1 Jahr 1‘300 SH Erwerbsersatzleistungen für Alleinerziehende 2009 (1982) 2 Jahre 500 SG Mutterschaftsbeiträge 1986 6 Monate 1‘300 GR Mutterschaftsbeiträge 1992 10 Monate 1‘200 AG Elternschaftsbeihilfe 2003 6 Monate ‐ TI Assegni di prima infanzia 1997 3 Jahre 7‘600 Assegni integrativi per i figli 1997 15 Jahre 16‘600 VD Allocation de matérnité 2009 9 Monate ‐ SO Ergänzungsleistungen für Familien 2010 6 Jahre ‐ Quelle: Bundesamt für Sozialversicherungen 2009b, Hüttner/Bauer 2003:17 Wie die Tabelle T1 zeigt, lassen sich verschiedene Phasen der Einführung von Bedarfsleistungen für Familien auf kantonaler Ebene identifizieren. Während der Kanton Schaffhausen 1982 als erster Kanton Bedarfsleistungen eingeführt hat, folgte kurz darauf der Kanton St.Gallen. Eine zweite Phase folgte Anfang der 1990er Jahre, als die Kantone Zug, Glarus, Graubünden, Zürich und Luzern Bedarfs‐ 16 leistungen einführten. 1997 trat das Gesetz im Kanton Tessin nach zehnjähriger Vorbereitungsphase in Kraft und führte damit ein zweistufiges System von Ergänzungsleistungen für Familien ein, das in der Schweiz bisher einmalig geblieben ist und den Lebensbedarf der Kinder bis zum 15. Altersjahr deckt. Im Anschluss daran wurde eine ähnliche Lösung auf Ebene Bund ins Auge gefasst (siehe vorhergehendes Kapitel), die mehrmals vorangetrieben und wieder blockiert wurde, so dass die Kantone anfingen eigene Vorlagen zu entwickeln. Nach einer erneuten Blockade 2009 werden zurzeit in verschiedenen Kantonen Projekte ausgearbeitet oder entsprechende Vorstösse lanciert. Der erste Kanton, der in Anlehnung an das Tessiner Modell Ergänzungsleistungen für Familien eingeführt hat, ist Solothurn. Die Kantone Waadt, Genf und Bern haben inzwischen eigene Modelle ausgearbeitet, die nun auf politischer Ebene diskutiert werden. In anderen Kantonen wurden Vorprojekte lanciert, aber wieder sistiert. Im Kanton Zürich ist 2007 eine Volksinitiative gescheitert, welche die Bedarfs‐ leistungen auf Kinder im Vorschulalter ausweiten wollte. Tabelle T2 gibt einen Überblick über den aktuellen Stand in den Kantonen im Sommer 2009. 17 T 2 Gesamtübersicht über den aktuellen Stand des politischen Prozesses zu den Ergänzungs‐ leistungen für Familien in den Kantonen* Vorstoss eingereicht Vorstoss überwiesen Gesetzesvorlage wird erarbeitet Vernehm‐ Gesetz an‐ lassung genommen Gesetz in Kraft Hängige oder umgesetzte Projekte TI Einführung 1997 SO Einführung per 01/2010 Eröffnet 06/2009 GE BE Auftrag an Regierungsrat durch Motion Steiner‐Brütsch (EVP), überwiesen 01/2009 FR Auftrag gegeben durch neue Verfassung, Erarbeitung erfolgt zweite Hälfte 2009 VD Auftrag aufgrund von 2 Postulaten und Bericht zur Familienpolitik 2009 ZG Motion von Egler (SP) und Zeiter (Alternative) 06/2009 NE Postulat Angst (Grüne) 09/2008 BS Postulat Schiavi Schäppi (BastA) 03/1994 BL Parl. Motion der SP‐ Fraktion 05/2009 LU Postulat Stadtrat, Motion Reusser (Grüne) 03/2009, Motion Mennel (SP) 05/2009 AG Volksinitiative SP, lanciert 01/2009 SG Motion der SP‐Fraktion, 06/2009 Sistierte Projekte ZH Volksinitiative „Chancen für Kinder“ gescheitert 2007 Nach Abschluss der Vernehmlassung aus Gesetzgebungsprogramm gestrichen 2009 SZ JU OW Vorprojekt zugunsten Bundeslösung nicht weiterverfolgt 2006 Im Parlament abgelehnt 2006 *Stand Juli 2009 Quelle: SKOS 2009 18 1.4 Zusammenfassung Ein Blick auf die Familien in der Schweiz hat gezeigt, dass nach wie vor die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung in Familien lebt, wobei die Familienformen in den letzten Jahrzehnten einem starken Wandel unterworfen waren. Es zeigt sich aber auch, dass Familien überdurchschnittlich von Armuts‐ und Working‐Poor‐Situationen betroffen sind, was aus den direkten und indirekten Kinderkosten sowie den Haushaltseinkommen der Familien resultiert. Besonders betroffen sind dabei Allein‐ erziehende und kinderreiche Familie. Um die Situation der Familien zu verbessern, braucht es eine aktive Familienpolitik. Während die Schweiz in dieser Beziehung nur wenig unternahm und sich die nationale Familienpolitik während Jahrzehnten nur langsam entwickelte, gab es in den letzten 20 Jahren einen familienpolitischen Schub, so dass einige seit langem lancierten Grossprojekte wie die Mutterschaftsversicherung oder die Vereinheitlichung der Kinderzulagen zum Abschluss gebracht werden konnten. Trotzdem konnte das Problem der Familienarmut nicht gelöst werden. Eine Möglichkeit, die sich dafür anbietet, ist die Ausdehnung des Systems der Ergänzungsleistungen, das sich als sehr wirksam im Kampf gegen die Altersarmut in der Schweiz erwiesen hat. Als monetäre Transferleistung würden die Ergänzungsleistungen eine traditionelle Lösung für ein neues soziales Risiko darstellen. Ein entsprechender Vorstoss wurde auf Bundesebene aus Kreisen der sozial‐ und christdemokratischen Parteien lanciert, hat aber in einem mittlerweile zehn Jahre dauernden Prozess bisher zu keinem Ergebnis geführt. Deshalb sind nun die Kantone gefragt, die teilweise schon Erfahrung mit Bedarfsleistungen für Familien haben. Ein Pionier in diesem Bereich ist der Kanton Tessin, dessen Modell der Ergänzungsleistungen für Familien auch dem Vorstoss auf Bundesebene als Referenz diente. Vor diesem Hintergrund wird ein vertiefter Blick auf die Vorgänge in den Kantonen geworfen, um zu analysieren, wie es diesen gelingt eine Leistung einzuführen, die einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der Familienarmut in der Schweiz leisten kann, deren Einführung auf Bundesebene jedoch bisher kein Erfolg beschieden war. Um dem Wohlfahrtsstaatsausbau in Form der Ergänzungs‐ leistungen für Familien auf die Spur zu kommen, werden als erstes der aktuelle Forschungsstand erfasst und die theoretischen Grundlagen erarbeitet. 19 2. Theoretische Ansätze und aktueller Stand der Forschung Durch das qualitative Forschungsdesign ergibt sich eine gewisse theoretische Offenheit. Der Theorientest steht nicht im Vordergrund, sondern die Identifikation determinierender Faktoren. Die Theorie dient dazu, den Blick zu schärfen für bestimmte Zusammenhänge und daraus abgeleitete Faktoren sollen als Anhaltspunkte für die Untersuchung dienen. Der Blick soll dabei aber bewusst offen gehalten werden und die Faktoren im Verlauf der Analyse jederzeit erweitert oder weiter ausdifferenziert werden können. Zur Erarbeitung der theoretischen Grundlage wird zum einen auf klassische Theorien der Wohlfahrtsstaatsforschung zurückgegriffen (für eine Übersicht siehe Schmidt 2000, Van Kersbergen 2002, Starke 2006), zum anderen werden aber auch neuere Ansätze einbezogen, die in den letzten Jahren als Antwort auf ein sich veränderndes Umfeld sozialstaatlicher Politik und die Entstehung neuer sozialer Risiken entwickelt wurden (Levy 1999, Bonoli 2005, Häusermann 2006a). Um die verschiedenen Ansätze und Theorien der Wohlfahrtsstaatsforschung zu systematisieren, werden in der Literatur unterschiedliche Unterteilungen vorgenommen. So argumentiert Pierson (1996), dass die Entwicklung des Wohlfahrtsstaats nach dem Ende der boomenden Nachkriegsjahre nicht mit den gleichen Theorien erklärt werden kann, wie jene im „goldenen Zeitalter“. Er impliziert damit eine Unterscheidung nach alten und neuen Ansätzen. Schmidt (2000) dagegen unterscheidet sechs klassische Theoriebereiche der Staatstätigkeitsforschung: die sozio‐ökonomische Schule, die Machtressourcentheorie, die Parteiendifferenzthese, politisch‐institutionalistische Theorien, die internationale Hypothese und die Lehre vom politischen Erbe. Für diese Arbeit sind jedoch nicht alle sechs Theoriebereiche nach Schmidt relevant und einige können sinnvoll zusammengefasst werden. Eine strikte Unterteilung in alte und neue theoretische Ansätze gemäss dem Argument von Pierson erscheint ebenfalls problematisch, da die Schweiz ein wohlfahrtsstaatlicher Nachzügler ist und anders als andere Länder den Wohlfahrtsstaat nach den Boomjahren noch erheblich ausgebaut hat. Deshalb fasst diese Arbeit die verschiedenen Theorien und Ansätze in Anlehnung an die Unter‐ suchung des schweizerischen Wohlfahrtsstaats von Moser (2008) entlang von drei grossen Theorie‐ strängen der Politikwissenschaft zusammen. Unterschieden werden dabei funktionalistische, interessen‐ und konflikttheoretische Ansätze sowie institutionelle Ansätze. Diese Strukturierung erscheint am sinnvollsten, um sich ergänzende neuere und ältere Ansätze zu beschreiben und eine umfassende Darstellung der Theorie und des aktuellen Forschungsstandes zu ermöglichen. Da die drei Theoriebereiche aber nicht vollständig voneinander getrennt betrachtet werden können, gibt es teilweise Überschneidungen. 20 Parallel zur Darstellung der theoretischen Ansätze werden die Ergebnisse von Studien im Bereich der schweizerischen Wohlfahrtsstaatsforschung und der Familienpolitik berücksichtigt, um den aktuellen Forschungsstand abzubilden. Zur Familienpolitik in der Schweiz existieren verschiedene Analysen und Studien. Einerseits liegt eine Reihe konzeptioneller Arbeiten vor, die sich ausgehend von einem Inventar bestehender Massnahmen und Programme mit Anforderungen an eine schweizerische Familienpolitik auseinandersetzen und verschiedene Konzepte und Möglichkeiten aufzuzeigen versuchen (Grossenbacher 1987, Despland 1999, Bauer et al. 2004). Diese Studien sind insofern interessant für diese Arbeit, als sie teilweise auch die familienpolitischen Ziele und Positionen der Akteure erfasst haben. Daneben gibt es eine Reihe politikwissenschaftlicher Untersuchungen, die sich mit den determinierenden Faktoren des Wohlfahrtsstaatsausbaus im Bereich der Familienpolitik auseinandersetzen (Ballestri/Bonoli 2003, Häusermann 2006a/b, Thoenen 2006, Wolfensberger 2007, Moser 2008). An der Schnittstelle zwischen diesen zwei Ausrichtungen liegen die Studien, die von der schweizerischen Bundesverwaltung anlässlich des Familienberichts von 2004 in Auftrag gegeben wurden (Binder et al. 2003, Gerlach et al. 2004, Vatter et al. 2004). Neben dieser inhaltlichen Differenzierung können die Studien auch danach unterschieden werden, ob sie sich mit der Familienpolitik auf Bundesebene (Ballestri/Bonoli 2003, Bauer et al. 2004, Vatter et al. 2004, Häusermann 2006a/b, Wolfensberger 2007, Moser 2008,) oder auf kantonaler Ebene auseinandersetzen (Binder et al. 2003, Thoenen 2006). 2.1 Funktionalistische Ansätze Die Schule der sozio‐ökonomischen Determination begreift staatliches Handeln als Antwort auf strukturelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen, politisch‐institutionellen Faktoren wird nur eine untergeordnete Rolle zugeschrieben (Schmidt 2000:23, Moser 2008:20). Es wird davon ausgegangen, dass die historische Entwicklung der westlichen Länder mit ihren sozio‐ökonomischen Konsequenzen zu einer Überlastung der bestehenden Sicherungssysteme geführt hat. Die Korrektur dieser Überlastung fällt dem Staat zu, indem die Politik gezwungen wird, die durch diese Entwicklungen hervorgerufenen Aufgaben zu übernehmen, um schwere Funktionsstörungen im System zu verhindern (Schmidt 2000:23‐24). Ursprünglich rückten Vertreter der funktionalistischen Ansätze Prozesse wie die Industrialisierung, die Modernisierung oder die Entstehung kapitalistischer Gesellschaftsformen ins Zentrum ihrer Analysen, konnten damit aber gerade in Bezug auf sozial‐ staatliche Spätzünder wie die Schweiz keinen wesentlichen Erklärungsbeitrag leisten. Trotzdem konnten sie auf Entwicklungen hinweisen, die im Rahmen des Neofunktionalismus wieder aufge‐ griffen wurden. Indem die Vertreter des Funktionalismus die die Globalisierung und den Übergang zur postindustriellen Gesellschaft ins Zentrum ihrer Forschung rückten, erlebte der Funktionalismus im silbernen Zeitalter des Wohlfahrtsstaats ein Comeback (Moser 2008:20). Politischer Wandel 21 wurde damit wieder verstärkt als Antwort auf sozio‐ökonomischen Wandel und sowohl exogenen als auch endogenen Problemdruck verstanden (Starke 2006). Für die Untersuchung des Wohlfahrtsstaatsausbaus auf kantonaler Ebene dürfte vor allem endogener Problemdruck eine Rolle spielen, wie die demographische Entwicklung, der Wandel in den Familienformen und die Transformation des Arbeitsmarktes (Moser 2008:23, Bertozzi et al. 2005:38). Gauthier (2004:2) sieht die Wirkung der demographischen Entwicklung auf die Familienpolitik auf zwei Ebenen. Auf der Makroebene setzen eine sinkende Geburtenrate und die Alterung der Bevöl‐ kerung den Wohlfahrtsstaat unter Druck. Dadurch kann es für einen Staat von Interesse sein, die Kinderkosten mit Hilfe von Transfers zu senken, um der zunehmenden Alterung der Bevölkerung entgegen zu wirken und damit das Arbeitskräftepotential und das ökonomische Wachstum zu erhalten (Wennemo 1994 zit. nach Ferrarini 2006:74). Aber obwohl einige Länder als Antwort auf die Abnahme der Geburtenzahlen und die zunehmende Alterung der Bevölkerung pronatalistische Massnahmen eingeführt haben, konnte im internationalen Vergleich kein statistisch signifikanter Einfluss der Geburtenrate auf die Einführung familienpolitischer Massnahmen nachgewiesen werden (Gauthier 2002:455). Die zunehmende Alterung der Bevölkerung kann aber auch einen negativen Effekt auf den Ausbau des Wohlfahrtsstaats haben, weil die bestehenden Leistungen immer mehr Kosten verursachen und damit der finanzielle Spielraum für neue Leistungen begrenzt ist. Neben diesen Auswirkungen auf der Makroebene kann sich demografischer Wandel aber auch auf der Mikroebene auswirken, indem er zu einem Wandel in den Familienformen führt, die nach mehr oder veränderter Unterstützung durch den Staat verlangen, um der Familienarmut entgegenzuwirken (Gauthier 2004:2). Eng verknüpft mit dem Wandel der Familienformen ist auch die Transformation des Arbeits‐ marktes. Die Deindustrialisierung und der massive Eintritt der Frauen in den Arbeitsmarkt hat die Instabilität der Familienstrukturen und die Destandardisierung der Beschäftigung verstärkt. Diese beiden Faktoren und das damit verbundene Armutsrisiko dürften deshalb einen expansiven Effekt auf die Familienpolitik haben (Moser 2008:23). Wolfensberger (2007:39f.) findet in seiner Unter‐ suchung zur Vereinheitlichung der Familienzulagen in der Schweiz Evidenz für den Einfluss des strukturellen Faktors der zunehmenden Familienarmut während des Policyprozesses. Einen Effekt konnte die international vergleichende Forschung zudem in Bezug auf den Modernisierungsgrad nachweisen. Es wird ein positiver Zusammenhang zwischen dem Niveau der ökonomischen Entwick‐ lung und des wirtschaftlichen Wachstums und monetären Leistungen im Bereich der Familienpolitik nachgewiesen (Gauthier 2002:455). Zum selben Ergebnis kommt Thoenen (2006:37) in Bezug auf die Steuerabzüge für Familien in den Kantonen. Aus diesen Ansätzen und Ergebnissen wird ein erster determinierender Faktor für die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien abgeleitet: 22 F1: Endogener Problemdruck in der Form einer erhöhten Armutsbetroffenheit von Familien, resultierend aus der demografischen Entwicklung oder der Transformation des Arbeitsmarktes, begünstigt die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien. Aber auch rein ökonomische Faktoren wie eine erhöhte Arbeitslosigkeit oder Rezessionen können das Armutsrisiko und damit den Druck zur Einführung familienpolitischer Massnahmen erhöhen (Gauthier 2004:449). Auch hier kann jedoch ein gegenteiliger Effekt entstehen, wenn der finanzielle Spielraum durch eine zusätzliche Belastung der bestehenden Sozialwerke eingeschränkt wird (Starke 2006:107). Ballestri/Bonoli (2003:52) argumentieren aber, dass die gute Konjunkturlage Ende der 90er Jahre und die damit einhergehende gute Lage der öffentlichen Finanzen den Handlungsspiel‐ raum für expansive Massnahmen in der Schweiz erweitert hat. Und auch Binder et al. (2003) verweisen auf den Einfluss der konjunkturellen Situation, indem sie zeigen, dass sich die wirtschaft‐ liche Entwicklung der 90er Jahre in der kantonalen Familienpolitik niedergeschlagen hat. Konkret kommen sie zum Ergebnis, dass sich die soziale Frage in den Kantonen Waadt und Tessin aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung stärker gestellt hat als in den beiden anderen untersuchten Kantonen und zu einem staatlichen Engagement in der Familienpolitik geführt hat (Binder/Kübler 2004:346). Aus diesen Überlegungen ergibt sich der zweite determinierende Faktor: F2: Wird die Armutsproblematik aufgrund einer Rezession verschärft, kann dies einen expansiven Effekt auf die Familienpolitik haben. Wird durch die Rezession der finanzielle Spielraum stark eingeschränkt, wird ein beschränkender Effekt auf die Familienpolitik erwartet. Aufgrund des Forschungsstandes wird aber davon ausgegangen, dass der expansive Effekt überwiegt. Es gibt aber auch Autoren, die davon ausgehen, dass Problemdruck nicht vollständig unabhängig vom politischen Prozess ist (Starke 2006:111). Dabei wird unterstellt, dass der sozio‐ökonomische Kontext keinen direkten Einfluss auf die Politikformulierung hat, sondern einen indirekten Einfluss über die Akteure im politischen Prozess. Diesen Zusammenhang postuliert auch Gauthier (2004:200), wenn sie auf die Komplementarität von funktionalistischen und akteurzentrierten Ansätzen verweist mit dem Argument, dass demografische Veränderungen eine Aufforderung an Nichtregierungs‐ organisationen darstellen. Dieser Argumentation liegt die Überlegung zugrunde, dass ein Problem im politischen Prozess zuerst als solches erkannt und definiert werden muss, damit es überhaupt aufgegriffen wird. So können Statistiken oder Studien auf eine Problematik hinweisen oder Eva‐ luationen von bereits bestehenden Programmen zeigen eine ungenügende Implementierung oder eine schlechte Performanz auf. Solche Ereignisse können ein sogenanntes Window of Opportunity kreieren, wenn sie mit anderen begünstigenden Faktoren zusammenfallen. Der Ansatz des Window of Opportunity wurde von Kingdon(1995) begründet und besagt, dass ein Window of Opportunity entsteht, wenn drei verschiedene Politikströme (problems, policies und politics) zusammentreffen. In 23 diesem Zeitfenster eines begünstigenden Kontexts ist die Einführung neuer politischer Massnahmen durch sogenannte ‚policy entrepreneurs‘ möglich. ‚Policy entrepreneurs’ sind dabei „advocats who are willing to invest their resources – time, energy, reputation, and money – to promote a position in return for anticipated gain in the form of material, purposive, or solidary benefits“ (Kingdon 1995:179). Dabei kann es sich um Personen innerhalb oder ausserhalb der Regierung handeln, gewählte oder berufene, um Interessengruppen oder Forschungsinstitutionen (Kingdon 1995:122). Ballestri/Bonoli (2003) zeigen in ihrer Untersuchung, dass beim Zustandekommen der Vorlage zur Anstossfinanzierung von Kinderkrippen in der Schweiz das Zusammenfallen verschiedener begünstigender Faktoren2 ein Window of Opportunity kreiert hat. Die Rolle des ‚policy entrepreneurs‘ wurde in diesem Fall von den Arbeitgebern übernommen. Und auch Vatter (2002:377) geht in seiner Analyse der Determinanten sozialstaatlicher Ausgaben davon aus, dass sozio‐ökonomische Variablen eher über einen indirekten Einfluss auf die Akteure wirken. Aufgrund dieser Überlegungen und Evidenzen wird davon ausgegangen, dass kantonale sozio‐ökonomische Gegebenheiten zur Öffnung eines Window of Opportunity beitragen können, die es einem ‚policy entrepreneur‘ ermöglicht, Ergänzungsleistungen für Familien auf die politische Agenda zu bringen und durchzusetzen. F1 und F2 werden deshalb folgendermassen erweitert: F3: Sozio‐ökonomische Faktoren haben einen indirekten Einfluss. Sie führen zur Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien, wenn der sozio‐ökonomische Problemdruck als solcher erkannt und definiert wird und ein ‚policy entrepreneur‘ die Ergänzungsleistungen als mögliche Lösung lanciert. 2.2 Interessen‐ und konflikttheoretische Ansätze Interessen‐ und konflikttheoretische Ansätze fokussieren auf die Machtverteilung innerhalb eines Systems. Vertreter dieses Theoriestrangs begreifen Wohlfahrtsstaaten „als Ergebnisse von und Arenen für Konflikte zwischen klassenbezogenen sozioökonomischen Interessengruppen“ (Moser 2008:27). Unter dem Label „politics matter“ waren diese Ansätze Ende der 1970er Jahren prominent. Es können zwei hauptsächliche Theoriebereiche identifiziert werden. Die Vertreter des Macht‐ ressourcenansatzes führen politische Ergebnisse auf die Interessen sozialer Klassen, deren Organi‐ sations‐ und Konfliktfähigkeit, Kräfteverhältnisse zwischen gesellschaftlichen Klassen und ihren Organisationen, institutionelle Bedingungen der Regulierung des Verteilungskonfliktes sowie strategisches Handeln von Regierungseliten zurück. Ein ausgebauter Wohlfahrtsstaat mit hoher Egalität ist gemäss diesem Ansatz der Verdienst einer starken, gut organisierten Arbeiterbewegung 2 Begünstigende Faktoren waren in diesem Fall eine gute konjunkturelle Lage, hohe Steuereinnahmen, die Angst der Arbeit‐ geber vor Arbeitskräftemangel und nicht zuletzt die Struktur der vorgeschlagenen Policy (limitiert in der Dauer) (Ballestri/ Bonoli 2003:52f.). 24 (Schmidt 1993:377f.). Die Vertreter der Parteiendifferenzthese betrachten vor allem die in Legislative und Exekutive vertretenen Parteien als entscheidend, unter der Annahme, dass diese die Präferenzen der jeweiligen Wählermilieus abbilden (Schmidt 2000:25f.). Dabei gelten Links‐ und Mitteparteien traditionell als Befürworter eines starken Wohlfahrtsstaats, während konservative und liberale Parteien sich eher für einen wenig umfassenden Wohlfahrtsstaat aussprechen (Moser 2008:28). Parteien, die sich für den Ausbau des Wohlfahrtsstaats einsetzen, sind somit sozial‐ demokratische und christlich‐demokratische Parteien, sie tun dies jedoch unter anderen Vorzeichen. Während sozialdemokratische Parteien stärker staatliche Eingriffe wünschen und sich für universelle Leistungen aussprechen, setzen sich die Christdemokraten stärker für die Erhaltung des Status quo ein und betonen die soziale Verantwortung der Familie und kommunaler Organisationen (Bleses/ Seeleib‐Kaiser 2004:98f.). Im Bereich der interessen‐ und konflikttheoretischen Ansätze lohnt sich nun der Blick auf neuere Ansätze, da die Anspruchsgruppen von Ergänzungsleistungen für Familien in verschiedener Hinsicht nur über bescheidene Machtressourcen verfügen. Personen, die neuen sozialen Risiken ausgesetzt sind, partizipieren grundsätzlich weniger an Wahlen und Abstimmungen. Ausserdem sind sie in demokratischen Institutionen (Regierung, Parlament, Gewerkschaften) schlecht repräsentiert und alles andere als eine homogene Gruppe mit einheitlichen Präferenzen, was die Organisierbarkeit des Interesses erschwert (Bonoli 2005: 236‐440). Gemäss der klassischen Theorie ist es demnach unwahrscheinlich, dass sich die Interessen armutsbetroffener Familien aufgrund ihrer Macht‐ ressourcen durchsetzen lassen oder dass ihre Anliegen von den politischen Parteien aufgenommen werden. Trotzdem kann die Klientel neuer sozialer Risiken die Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten entscheiden, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, so das Postulat neuerer Ansätze und Analysen in diesem Bereich. So haben Policies im Bereich der neuen sozialen Risiken eine Chance, wenn sie kostenneutral oder kostengünstiger als bestehende Programme sind. Levy (1999) argumentiert, dass Wohlfahrtsstaatsmodernisierer eine Umverteilung hin zu Armutsbetroffenen erreichen können, indem sie ökonomisch ineffiziente, bestehende Wohlfahrtsstaatsprogramme reformieren und damit Ressourcen freimachen für neue Programme. Ausserdem können Policies im Bereich der neuen sozialen Risiken interessant sein für linke Parteien, die zunehmend Mühe bekunden ihre bestehende Wählerschaft zu befriedigen, weil die Kosten für den Ausbau bestehender Programme zu hoch sind. Policies im Bereich der neuen sozialen Risiken sind vergleichsweise günstig, treffen damit auf weniger Opposition und können der Partei zumindest eine kleine Gruppe neuer Wähler zuführen (Bonoli 2005:445). Eine andere Möglichkeit ist die Verbindung von neuen und alten Risiken in derselben Vorlage, ein sogenannter modernisierender Kompromiss, um möglichst viele Interessen abzudecken und so Erfolg zu haben. Lösungen dieser Art basieren auf einem politischen Tausch, ohne eine Konvergenz der Interessen zu erreichen (Bonoli 2004:178). 25 Aber auch eine Interessenkonvergenz ist möglich und eröffnet hinsichtlich der neuen sozialen Risiken im Vergleich zu den alten Risiken neue Möglichkeiten in der Koalitionsbildung. In der Forschung liegen zwei unterschiedliche Erklärungen für diese neuen Allianzen vor. Häusermann (2006a) identifiziert neben der traditionellen Konfliktlinie zwischen Kapital und Arbeit eine zusätzliche Konfliktachse zwischen libertären und autoritären Werten. Während auf der tradi‐ tionellen Konfliktlinie die sozialdemokratischen Parteien den konservativen und liberalen Parteien gegenüberstehen und sich die christlich‐demokratischen Parteien in der Mitte befinden, rücken auf der neuen Achse auch die liberalen Parteien in die Mitte. Damit ergeben sich Möglichkeiten für neue sozialdemokratisch‐liberale Allianzen, wenn die neue Konfliktlinie in den Vordergrund rückt, was bei Themen wie Gleichstellung, Individualisierung und freie Wahl des Lebensstils der Fall sein dürfte. Häusermann (2006a) kann zeigen, dass diese neue Allianz bei der 10. AHV‐Revision eine Rolle gespielt hat, und Ballestri/Bonoli (2003) führen den Erfolg der Vorlage zur Anstossfinanzierung für Kinderkrippen ebenfalls teilweise auf das Zustandekommen einer solchen Koalition zurück. Eine zweite Erklärung bietet Kübler (2007) an. Er führt die neuen Allianzen auf kognitive Prozesse zurück, indem er den Wechsel der liberalen Akteure in die neue Koalition mit den Sozialdemokraten auf eine Änderung der grundsätzlichen Werthaltungen zurückführt, die sich durch Framing‐Strategien der Geschlechtergleichstellungskoalition ergeben hat. Obwohl die Ergänzungsleistungen für Familien eine Antwort auf ein neues soziales Risiko sind, sind sie doch eine eher traditionelle Antwort, wie in Kapitel 1.3.2 argumentiert wird, und erfüllen weder die Bedingungen für einen politischen Tausch, noch für eine Konvergenz der Interessen und daraus resultierende neue Allianzen. Die Ergänzungsleistungen für Familien eine neue Leistung dar, die finanzielle Mittel bindet. Es kann zwar mit Einsparungen bei der Sozialhilfe gerechnet werden, aber dadurch werden nicht genügend Ressourcen freigemacht, um die Ergänzungsleistungen ohne zusätzliche Kosten einführen zu können. Damit dürfte das Argument von Levy eher nicht auf die Ergänzungsleistungen für Familien anwendbar sein. Und auch die Verbindung von neuen und alten Risiken in derselben Vorlage ist bei den Ergänzungsleistungen nicht gegeben. Während beispiels‐ weise bei der Revision einer Sozialversicherung Zugeständnisse an die bisherige Klientel gemacht werden können und dafür auch modernisierende Elemente zur besseren Abdeckung der neuen sozialen Risiken eingebracht werden können, stellen die Ergänzungsleistungen für Familien eine klare Forderung nach einer neuen Leistung für eine bestimmte Klientel dar. Mit diesen Überlegungen stimmt auch die Beobachtung von Moser (2008:229) überein, dass politischer Tausch in verschie‐ denen Reformen des schweizerischen Wohlfahrtsstaats eine Rolle gespielt hat, nicht aber in der Familienpolitik. Aber auch neue Allianzen sind eher unwahrscheinlich. Da es sich bei den Ergänzungs‐ leistungen für Familien um eine monetäre Transferleistung handelt, dürfte der Konflikt eher auf der Umverteilungsachse angesiedelt sein als auf der Konfliktlinie zwischen libertären und autoritären 26 Werthaltungen. Auch Häusermann (2006b:35) erwartet eine klassische Koalition von SP, CVP, Familienorganisationen und Gewerkschaften für die Ergänzungsleistungen für Familien, da sie als Bedarfsleistungen für arme Familien grundsätzlich dem male breadwinner model entsprechen, auch wenn modernisierende Elemente wie die Vergütung von Krippenkosten und Arbeitsanreize enthalten sind. Diese Überlegung wird unterstützt von Sieber et al. (2004). Sie finden in der schweizerischen Familienpolitik sowohl klassische als auch neue Allianzen. Und wie es der diskutierten Theorie entspricht, stellen sie fest, dass sich die klassische sozialdemokratisch‐wertkonservative Allianz aus SP und CVP primär für den sozialen Ausgleich von Familienlasten durch Familienzulagen und Ergänzungsleistungen einsetzt, während die neue sozialdemokratisch‐liberale (und zum Teil christlich‐wertkonservative) Allianz, getragen von SP, FDP und teilweise CVP, sich für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzt (z.B. Mutterschaftsversicherung, Krippensubventio‐ nierung). Genauer untersucht wurden die einzelnen Positionen der Bundesratsparteien von Bauer et al. (2004). Sie zeigen, dass sich in der Schweiz die CVP am stärksten mit der Familie befasst. Obwohl ihr die Erhaltung und Förderung der traditionellen Familie am Herzen liegt, anerkennt sie den Familienpluralismus und unterstützt auch weniger traditionelle Familienformen. Die CVP fordert denn auch zusammen mit der SP die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien auf nationaler Ebene. Die FDP hingegen stellt mehr auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ab und will die Ergänzungsleistungen für Familien in der Kompetenz der Kantone belassen. Die SVP, die sich gegen staatliche Eingriffe in die Familie ausspricht, lehnt Ergänzungsleistungen für einkommens‐ schwache Familien ab. Auch auf der Ebene der Verbände zeigt sich auf Bundesebene die klassische Konfliktlinie. Der Arbeitgeberverband ist gegen eine Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien, die Gewerkschaften sind dafür (Bauer et al. 2004:128‐134). Aufgrund dieser Überlegungen zu Machtressourcen und Parteien stützen sich die Ausgangs‐ hypothesen für die Analyse, welche auf der Grundlage der interessen‐ und konflikttheoretischen Ansätze formuliert werden, auf die traditionellen Ansätze der Parteiendifferenzthese: F4a: Bei den Ergänzungsleistungen für Familien ergibt sich eine Koalition der traditionellen Wohl‐ fahrtsstaatsparteien. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die Vertretung von SP und CVP im Parlament entscheidend ist für die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien. Trotzdem sollten in der Untersuchung die neuen Koalitionen nicht ausser Acht gelassen werden. Es ist durchaus vorstellbar, dass die FDP eine Schlüsselrolle spielen kann, wenn in einer Vorlage bzw. der Debatte darüber die modernisierenden Elemente (Arbeitsanreize, Vereinbarkeit von Familie und Beruf) stark betont werden. Ausserdem muss ein besonderes Augenmerk auf die Regierung gelegt werden. Die Regierung wird auf kantonaler Ebene vom Volk gewählt. Damit verfügt sie über eine höhere Legitimation und ist stärker der Wählerschaft als dem Parlament verpflichtet. Zudem wird der 27 Regierungsrat im Majorzverfahren gewählt3, ist also eher eine Personen‐ als eine Parteienwahl (Vatter 2002:31,46f.). Deshalb wird F4 folgendermassen erweitert: F4b: Die Ergänzungsleistungen für Familien werden eingeführt, wenn die sozialdemokratischen und christlich‐demokratischen Parteien im Regierungsrat eine Mehrheit innehaben und insbesondere wenn ein Regierungsrat dieser Parteien das zuständige Departement innehat. Auch die Verbände und Organisationen sollen nicht vollständig ausgeblendet werden. Denn obwohl armutsbetroffene Familien aufgrund der oben diskutierten Gegebenheiten nur über eingeschränkte Machtressourcen verfügen, ist es denkbar, dass sich familienpolitische Organi‐ sationen oder Gewerkschaften und Arbeitgeber im Rahmen ihres Engagements für die Familie im Allgemeinen des Themas annehmen. In Bezug auf die Arbeitgeber kann ausserdem auch wieder davon ausgegangen werden, dass diese für eine Vorlage gewonnen werden können, wenn die modernisierenden Elemente stark betont werden und eine Lösung sie kostenneutral ausfällt. Es wird deshalb folgende Ausgangshypothese in die Analyse einbezogen: F5: Gibt es einflussreiche familienpolitische Organisationen oder nehmen sich die Gewerkschaften und oder Arbeitgeber des Themas an, können diese den Gesetzgebungsprozess positiv beeinflussen. Allerdings dürfte der Einfluss der Parteien auf kantonaler Ebene deutlich stärker sein als jener der Verbände und Organisationen. Denn zum einen gibt es auf kantonaler Ebene weniger Parteien und auch weniger Kleinparteien als auf Bundesebene und zum anderen ist der Einfluss der Verbände auf kantonaler Ebene grundsätzlich geringer als auf nationaler Ebene, da auf kantonaler Ebene wirtschaftliche Interessen bei Gesetzesvorlagen weniger tangiert werden und sich die Wirtschafts‐ verbände deshalb auf die nationale Ebene konzentrieren. Zudem ist das vorparlamentarische Vernehmlassungsverfahren nicht so stark formalisiert wie auf Bundesebene, das heisst die Möglich‐ keiten der Einflussnahme für Verbände und Organisationen sind beschränkter (Vatter 2002:34). Allgemein muss der Handlungsspielraum der Akteure in Abhängigkeit von den institutionellen Rahmenbedingungen betrachtet werden, wie sie das nächste Kapitel diskutiert. Diesen Aspekt betont der im nächsten Unterkapitel diskutierte Institutionalismus. 2.3 Institutionalismus „Richtung und Inhalt der Staatstätigkeit hängen eng mit politisch‐institutionellen Bedingungen zu‐ sammen. Das ist die Kernthese der traditionellen Institutionenkunde und des Neo‐institutionalismus“ (Schmidt 2000:28). Der Begriff Institutionen bezieht sich in diesem Zusammenhang auf zwei Arten 3 Eine Ausnahme bilden die Kantone Tessin und Zug, wo der Regierungsrat im Proporzverfahren gewählt wird. 28 von Institutionen. Zum einen sind damit formelle politische Institutionen oder anders gesagt die Spielregeln des politischen Konflikts gemeint. Zum anderen umfasst der Begriff die wohlfahrts‐ staatlichen Institutionen, also die existierenden Strukturen sozialer Leistungen, welche gemeinhin auch als Wohlfahrtsstaatsregime beschrieben werden. Hier spielen neben der Grosszügigkeit von Leistungen auch Universalität, Selektivität, Finanzierungsstrukturen usw. eine Rolle (Starke 2006:109). Der Einfluss der formellen politischen Institutionen wird dabei oft aus der Perspektive der Vetospielertheorie betrachtet (Moser 2008:33). Grundsätzlich gilt, dass eine hohe Anzahl Vetopunkte ein System langsamer machen und Veränderungen bescheidener ausfallen (Tsebelis 1995). Als institutionelle Vetopunkte gelten dabei unter anderem der Föderalismus, das vorparlamentarische Vernehmlassungsverfahren, die Konkordanz, ein Zweikammersystem im Parlament, eine starke Verfassungsgerichtsbarkeit, ein Präsident und direktdemokratische Instrumente (Starke 2006:109, Häusermann 2008:205, Moser 2008:33). Für die kantonale Ebene dürften vor allem das vor‐ parlamentarische Vernehmlassungsverfahren und die direktdemokratischen Elemente sowie das Verhältnis von Regierung und Parlament eine Rolle spielen. Der Föderalismus hat in der Schweiz auf Bundesebene zu einem schwach ausgebauten Wohlfahrtsstaat geführt. Auf der Ebene der Kantone wird ihm aber eher eine Innovationsfunktion attestiert und eine ‚competitive deregulation‘ aufgrund des interkantonalen Wettbewerbs, wie es die Theorie vermuten liesse4, hat auch nicht stattgefunden (Moser 2003). Damit kann der Föderalismus auf kantonaler Ebene nicht als Vetopunkt identifiziert werden. Auf das Verhältnis von Regierung und Parlament wurde im vorhergehenden Kapitel bereits kurz eingegangen, weshalb im Folgenden ausschliesslich das vorparlamentarische Vernehmlassungs‐ verfahren und die direktdemokratischen Elemente thematisiert werden. Das vorparlamentarische Vernehmlassungsverfahren muss in den weiteren Kontext des schweizerischen Konkordanzsystems gestellt werden, in dem eine Machtteilung durch politische Institutionen angestrebt wird. Dazu gehören neben dem Föderalismus und der proportionalen Repräsentation in Parlament und Regierung auch die Einbindung referendumsfähiger Gruppen in den Entscheidungsprozess. Daraus ergibt sich „eine Politik der Konsensfindung durch Verhandeln unter möglichst vielen politischen Kräften“ (Linder 2005:371). Diese Einbindung aller referendumsfähigen Gruppen und Interessen in den vorparlamentarischen Prozess kann sich in den Kantonen unterschiedlich gestalten, da auf kantonaler Ebene der vorparlamentarische Prozess weniger formalisiert ist als auf nationaler Ebene. Je stärker die verschiedenen Interessen in den vorparlamen‐ tarischen Prozess eingebunden werden, desto mehr steht der Konsens im Vordergrund. Ob diese 4 Da die unterschiedliche Ausgestaltung der Sozialleistungen einen für die grosszügigen Kantone unerwünschten Sozial‐ tourismus auslösen könnte, wird davon ausgegangen, dass der Wettbewerb zu einem ‚race to the bottom‘ führt. 29 Konsensorientierung für den Ausbau des Wohlfahrtsstaats förderlich ist oder nicht, wird kontrovers diskutiert. Bonoli (2004:175f.) argumentiert in diesem Zusammenhang, dass die institutionellen Gegebenheiten der Schweiz das Zustandekommen von Policies im Bereich der neuen sozialen Risiken eher hemmen und dass parlamentarische Initiativen mehr Erfolg haben, weil konsensorientierte Strukturen nicht fähig sind mit solch umstrittenen Themen umzugehen. Häusermann (2008:216f.) hingegen geht davon aus, dass die Eigenschaften des politischen Systems der Schweiz die Modernisierung des Wohlfahrtsstaats begünstigen, „weil sie die Verknüpfung verschiedener Reform‐ strategien, die Bildung von breiten Koalitionen und das Aushandeln von Kompromissen begünstigen“ (Häusermann 2008:205). Damit sagt Häusermann, dass ein Kompromiss möglich ist und dass es dieser Kompromiss ist, der eine Reform möglich macht, während Bonoli einen Kompromiss nicht für möglich hält und deshalb den Erfolg einer Reform in einer raschen parlamentarischen Behandlung sieht. Es kann also einen Unterschied machen, ob eine Vorlage zu den Ergänzungsleistungen für Familien eher in konsensorientierten Gremien behandelt wird oder die Diskussion stärker im konfliktiven Umfeld des Parlaments stattfindet. Da die Argumentation von Häusermann in eine andere Richtung weist als jene von Bonoli, wird die folgende Hypothese entsprechend offen formuliert und soll dann in der Analyse konkretisiert werden: F6: Es macht einen Unterschied für den Erfolg der Vorlage, ob die Debatte zu den Ergänzungs‐ leistungen für Familien in einem stark konsensorientierten Gremium des vorparlamentarischen Prozesses stattfindet, oder ob die Politikformulierung primär im Umfeld des Parlaments stattfindet. Mit der Wirkung der direkten Demokratie auf die Sozialpolitik haben sich Obinger/Wagschal (2000) vertieft auseinandergesetzt. Ausgehend von Public Choice Modellen und verschiedenen Plausibilitätserklärungen kommen sie zum Ergebnis, dass die direkte Demokratie den Ausbau des Wohlfahrtsstaats beschränkt und ausserdem einen Zeitverzögerungseffekt nach sich zieht. Dieses Ergebnis bestätigt sich in der Untersuchung. In Bezug auf die Schweiz kann aber auch gezeigt werden, dass die verschiedenen Elemente der direkten Demokratie unterschiedlich wirken. Während das obligatorische und das fakultative Referendum am Output des politischen Prozesses ansetzen, liefert die Volksinitiative einen Input. Das Referendum hat damit eine Vetofunktion, während die Volks‐ initiative unter Umgehung des vorparlamentarischen Raums die politischen Entscheidungsträger mobilisieren kann. Grundsätzlich hat das Referendum bremsende Wirkung, während die Volksinitia‐ tive eher für Schub und Innovation steht (Obinger/Wagschal 2000:493f.). Moser (2008:228) erkennt in der Familienpolitik der Schweiz denn auch die Volksinitiative als institutionellen Weichensteller, zumeist genutzt von Gewerkschaften oder Interessengruppen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Volksinitiative auf kantonaler Ebene den Prozess zur Einführung von Ergänzungs‐ leistungen für Familien initiieren oder vorantreiben kann. Bezüglich Referenden sind die Regelungen 30 in den Kantonen unterschiedlich. Alle Kantone kennen entweder das obligatorische oder fakultative Gesetzes‐ und Finanzreferendum. In einigen Kantonen können zudem Parlamentsbeschlüsse dem Referendum unterstellt werden. Die Referendumsmöglichkeiten sind damit weitreichender als auf Bundesebene (Linder 2005:159). Die Wahrscheinlichkeit eines Referendums ist demnach auf Kantonsebene grösser und kommt ein Referendum zustande, so wird gemäss Obinger/Wagschal (2000) eher eine bremsende Wirkung auf die Einführung der Ergänzungsleistungen für Familien erwartet. Allerdings werden diese Befunde für die kantonale Ebene von Vatter (2002) in Frage gestellt, der in seiner Untersuchung zum Ergebnis kommt, dass nicht die Institutionen der direkten Demokratie einen Einfluss auf die Wohlfahrtsstaatsausgaben haben, sondern deren effektiver Gebrauch. Er zeigt, dass ein „generell intensiver Gebrauch aller Volksrechte (Volksinitiativen, obligatorische und fakultative Referenden) einen expansiven Einfluss auf die Sozialausgaben ausübt“ (Vatter 2002:379f.). Da in dieser Untersuchung aber auf konkrete Einzelfälle abgestellt wird und nicht der generelle Gebrauch der Volksrechte im Fokus der Arbeit steht, orientiert sich die Formulierung von F7 trotzdem an der Erklärung von Obinger/Wagschal. F7: Kommen Elemente der direkten Demokratie zur Anwendung, kann dies die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien verhindern oder vorantreiben. Es wird davon ausgegangen, dass die Volksinitiative eine Schubwirkung hat, während das Referendum bremsend wirkt. Neben der Theorie der Vetopunkte wird vor allem im Zusammenhang mit den wohlfahrts‐ staatlichen Institutionen oft das Konzept der Pfadabhängigkeit zur Erklärung von unterschiedlichen Entwicklungen in den verschiedenen Regimen beigezogen (Taylor‐Gooby 2004). Diese These besagt, dass politische Entscheidungen und staatliches Handeln geprägt sind durch intendierte oder nicht intendierte Auswirkungen früherer politischer Entscheidungen (Schmidt 2000:31). Ein oft genanntes Beispiel ist die Altersvorsorge nach dem Umlageverfahren, wobei die Renten einer Generation durch die nächste Generation finanziert werden. Die Einführung eines Kapitaldeckungsverfahrens ist in Ländern mit diesem Altersvorsorgemodell praktisch unmöglich, da sonst eine Generation doppelt zahlen müsste (Moser 2008:34). Aufgrund des Föderalismus hat sich die kantonale Sozialpolitik unterschiedlich entwickelt, so unterschiedlich dass Armingeon et al. (2004) in ihrer Untersuchung gar die kantonalen Wohlfahrtsstaaten anhand der gängigen Wohlfahrtsstaatstypologie von Esping‐ Andersen kategorisieren, mit dem Argument, dass die kantonalen Unterschiede fast ebenso gross sind wie die Unterschiede zwischen nationalen Regimen. Ebenso unterschiedlich wie die Sozialpolitik im Allgemeinen ist auch die Familienpolitik. Dabei dürfte auch die Pfadabängigkeit eine grosse Rolle spielen. Zum einen kann in einem Kanton, der bereits viele Leistungen für Familien kennt, der Spielraum für neue Leistungen gering sein. Andererseits ist die Verschiebung der Familie von der privaten in die öffentliche Verantwortlichkeit von grosser Bedeutung. Ein Kanton, der diese Debatte 31 schon früher geführt hat und in dem die Familienpolitik als Staatsaufgabe bereits etabliert ist, dürfte damit eher eine neue Leistung einführen. Binder et al. (2003) zeigen, dass die Kantone Waadt und Tessin in Bezug auf die Familienpolitik innovativer sind als die Kantone Zürich und Luzern. Während in den Kantonen der lateinischen Schweiz ein interventionistischeres familienpolitisches Modell etabliert ist, in welchem dem Staat in einer selbstverständlicheren Weise Verantwortung im Bereich der Familienpolitik zugesprochen wird, betonen die Kantone der Deutschschweiz verstärkt das Prinzip der Subsidiarität. Die familienpolitische Tradition kann damit einen weiteren determinieren‐ den Faktor darstellen: F8: Verfügt ein Kanton über ein interventionistisches familienpolitisches Modell, d.h. Staatseingriffe in der Familienpolitik sind bereits etabliert, werden neue Leistungen für Familien eher eingeführt. 2.4 Fazit In diesem Kapitel wurde das theoretische Fundament gelegt und der aktuelle Forschungsstand aufgearbeitet, um der Frage nach determinierenden Faktoren für die Einführung von Ergänzungs‐ leistungen für Familien nachzugehen. Dabei konnten drei Theoriebereiche der Wohlfahrtsstaats‐ forschung als relevant erkannt werden. Es wurden funktionalistische Ansätze, interessen‐ und konflikttheoretische Ansätze sowie Theorien des Institutionalismus dargelegt und mit dem aktuellen Forschungsstand zur schweizerischen Wohlfahrtsstaatsforschung und zur Familienpolitik in Ver‐ bindung gebracht. So konnten acht teilweise rivalisierende, teilweise sich ergänzende Faktoren abgeleitet werden, die der folgenden Untersuchung als Ausgangspunkt dienen sollen. 32 3. Methodik Diese Arbeit ist aufgrund von Fragestellung und Erkenntnisinteresse dem qualitativen Forschungs‐ paradigma verpflichtet. Das qualitative Paradigma betont das interpretative Verstehen, das Erkenntnisinteresse folgt einer ideografischen Perspektive, die das Verstehen des Falles betont und sich durch das Interesse am Einzelfall auszeichnet. Die „Erklärung zielt typischerweise darauf ab, warum ein Ereignis eingetreten ist oder nicht“ und es wird mit wenigen Fällen gearbeitet (Jahn 2006:163). Das Ziel ist nicht die Generalisierbarkeit der Resultate, sondern das Verständnis der untersuchten Fälle. Die soziale Realität wird dabei verstanden als komplexes Konstrukt, das in einen bestimmten zeitlichen und räumlichen Kontext eingebettet ist, der berücksichtigt werden muss. Daraus ergibt sich ein induktiver Erklärungsansatz, das heisst es wird vom Einzelfall auf die Allgemeinheit geschlossen, von der Beobachtung auf die Theorie (Lamnek 1995:225f.). Damit steht die Generierung von Hypothesen aus der Beobachtung im Vordergrund, während auf einen Hypothesentest verzichtet wird. Hier wird aber nicht eine rein induktive Vorgehensweise gewählt, sondern es wird theoriengeleitet gearbeitet, indem theoretische Vorannahmen zu Kausalzusammen‐ hängen als Ausgangspunkt der Analyse dienen (Blatter et al. 2007:29). Ausserdem ist bei qualitativen Untersuchungen das Kausalitätsverständnis ein anderes als bei Analysen, die sich am quantitativen Paradigma orientieren. Die qualitative Forschung sucht nach notwendigen und hinreichenden Bedin‐ gungen für das Auftreten eines Phänomens. Dabei können auch Konfigurationen mehrerer Faktoren erfasst werden, was oft über die INUS‐Kausalität gemacht wird, wobei eine Bedingung einen „insufficient, but nessecary part of an unnessecary but sufficient condition“ für das zu erklärende Phänomen darstellt. So können auch multivariate Erklärungen erfasst werden. Zudem geht das qualitative Kausalitätsverständnis von Äquifinalität aus, das heisst mehrere kausale Pfade können ein Phänomen erklären. Es wird aber gleichzeitig davon ausgegangen, dass jeder Pfad eine spezifische Verbindung einzelner Faktoren ist und dass es nur wenige solche Pfade gibt (Mahoney/ Goertz 2006:237). Innerhalb des qualitativen Forschungsparadigmas bietet sich eine vergleichende Methode an, da aufgezeigt werden soll, warum die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien in einigen Kantonen gelingt und in anderen nicht. Aufgrund des ideografischen Erkenntnisinteresses und einer induktiven Vorgehensweise werden dazu die Konkordanz‐ und die Differenzmethode als Methoden des qualitativen Vergleichs nach Mill gewählt, um Faktoren zu eruieren, welche zur Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien führen. Um den Vergleich anhand der Mill’schen Methoden ausführen zu können, braucht es zuerst eine detaillierte Analyse der einzelnen Fälle. Dazu werden die Mill’schen Methoden mit der Prozessanalyse kombiniert. Die acht aus der Theorie abgeleiteten 33 Faktoren dienen dabei als Ausgangspunkt. Um das methodische Vorgehen genauer zu beschreiben, wird im Folgenden zuerst auf die Prozessanalyse eingegangen, anschliessend werden die Mill’schen Methoden vorgestellt, bevor die Fallauswahl begründet wird. Im letzten Abschnitt wird schliesslich auf die konkrete Ausgestaltung der Datenerhebung eingegangen. 3.1 Prozessanalyse Gemäss George/Bennet (2005:206) zielt die Prozessanalyse grundsätzlich darauf ab „to identify the intervening causal process – the causal chain and causal mechanism – between an independent variable (or variables) and the outcome of the dependent variable“. Die Prozessanalyse unterscheidet sich damit fundamental von Methoden, die auf Kovarianz oder Vergleiche zwischen Fällen abstellen. Denn anders als bei Methoden dieser Art geht es bei der Prozessanalyse nicht um die Zahl der Beobachtungen pro Variable, sondern um eine detaillierte Darstellung der Verbindung zwischen den einzelnen Variablen (Blatter et al. 2007:158). Dabei können verschiedene Ziele verfolgt werden. Zum einen kann die Prozessanalyse dazu genutzt werden, um kausale Mechanismen und Kausalketten empirisch nachzuweisen, die zu einem bestimmten Prozessergebnis führen. Eine zweite Möglichkeit ist das Aufzeigen von sequentiellen und situativen Interaktionseffekten zwischen Einflussfaktoren. Schliesslich kann die Prozessanalyse auch zur Aufteilung von Untersuchungs‐ einheiten in einzelne Phasen genutzt werden (Blatter et al. 2007:157). Für diese Arbeit ist das erste Ziel von Bedeutung. Es wird nach Kausalketten gesucht, die zu einem bestimmten Prozessergebnis führen, in diesem Fall die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien. Dabei sollen aber auch Interaktionseffekte berücksichtigt werden. Entsprechend den verschiedenen Zielen, gibt es auch verschiedene Varianten der Prozessanalyse, die verschiedene Formen kausaler Prozesse erfassen können. Die Herausforderung besteht darin, eine Variante zu wählen, die mit der Art kausaler Prozesse übereinstimmt, die man untersuchen möchte (George/Bennet 2005:213). In dieser Arbeit wird in einem ersten Schritt die Variante des ‚detailed narrative‘ gewählt. Dabei präsentiert sich die Prozessanalyse in der Form einer detaillierten chronologischen Erfassung der Geschehnisse, die aufzeigen soll, wie es zum vorliegenden Ergebnis kam. Eine solche Erfassung ist sehr spezifisch, es wird kein expliziter Bezug zur Theorie gemacht (George/Bennet 2005:210). In Bezug auf die Ergänzungsleistungen für Familien werden dabei in diesem ersten Schritt die verschiedenen Phasen der kantonalen Gesetzgebungsprozesse (Agenda Setting, Politikformulierung, Entscheidung) und der Kontext, in dem jene stattfanden, deskriptiv erfasst. Erst in einem zweiten Schritt wird diese detaillierte Schilderung der Vorgänge in eine theoriengeleitete Analyse überführt, um kausale Faktoren und Interaktionseffekte zu erfassen (George/Bennet 2005:210f.). 34 3.2 Die Mill’schen Methoden als Methoden des systematischen Vergleichs Mill hat, mit dem Ziel eine logische Fundierung für die induktiv orientierte Forschung zu schaffen, in A system of Logic vier Methoden des Vergleichs dargelegt. Die Konkordanzmethode, die Differenz‐ methode, die indirekte Differenzmethode und die Variationsmethode. Im Folgenden wird nur auf die ersten beiden eingegangen, die in der Analyse angewendet werden. Die Konkordanzmethode wird von Mill folgendermassen beschrieben: „If two or more instances of the phenomenon under investigation have only one circumstance in common, the circumstance in which alone all the instances agree, is the cause (or effect) of the given phenomenon“ (Mill 1874:280). Ein Kausalzusammenhang wird also dadurch bestimmt, dass bei Fällen, die dasselbe Ergebnis auf‐ weisen, nach Erklärungsfaktoren gesucht wird, die ebenfalls in allen Fällen auftreten (Blatter et al. 2007:142). Umgekehrt ist es bei der Differenzmethode, die von Mill so definiert wird: „If an instance in which the phenomenon under investigation occurs, and an instance in which it does not occur, have every circumstance in common save one, that one occuring only in the former; the circumstance in which alone the two instances differ, is the effect, or the cause, or an indispensable part of the cause, of the phenomenon“ (Mill 1874:280). Bei dieser zweiten Methode nach Mill wird der Kausalfaktor dadurch identifiziert, dass bei Fällen mit unterschiedlichem Ergebnis nach Faktoren gesucht wird, die parallel dazu variieren (Blatter et al. 2007:142). Folgende Tabelle zeigt den Unterschied zwischen diesen beiden Methoden nochmals auf: T 3 Konkordanz‐ und Differenzmethode nach Mill Konkordanzmethode Differenzmethode Fall 1 Fall 2 Fall 1 Fall 2 Phänomen (Ergebnis) Y Y Y nicht Y Faktor 1 ja nein ja ja Faktor 2 nein ja ja ja Faktor 3 ja ja ja nein Quelle: Darstellung in Anlehnung an Blatter (2007:143) Bei beiden Methoden kann Faktor 3 als kausaler Faktor bestimmt werden. Bei der Konkordanz‐ methode, weil er der einzige ist, der in beiden Fälle auftritt. Bei der Differenzmethode, weil er der 35 einzige ist, der ebenfalls variiert. Beide Methoden funktionieren über das Eliminieren von Faktoren (Mill 1874:281). Die Konkordanzmethode geht davon aus, dass alle Faktoren, die eliminiert werden können, in keinem kausalen Zusammenhang zum Effekt stehen. Die Differenzmethode folgt der Logik, dass jeder Faktor, der nicht eliminiert werden kann, in einem kausalen Zusammenhang zum Ergebnis steht. Damit können mit der Konkordanzmethode mögliche notwendige Bedingungen eliminiert werden, während mit der Differenzmethode mögliche hinreichende Bedingungen ausgeschlossen werden können. Die Mill’schen Methoden eignen sich insbesondere aufgrund dieser Logik des Eliminierens sehr gut für diese Arbeit. Da die theoretische Basis mit acht teilweise rivalisierenden Bedingungen bzw. Faktoren relativ breit ist, können die Konkordanz‐ und die Differenzmethode dazu genutzt werden, um mögliche Faktoren zu eliminieren, und damit einen entscheidenden Beitrag zur Identifizierung von kausalen Bedingungen leisten. Die Mill’schen Methoden haben aber auch Schwächen. Eine erste wird von Mill selber erwähnt, indem er darauf verweist, dass die Konkordanzmethode der Differenzmethode unterlegen ist. Bei der Differenzmethode ist die Art der zu eruierenden Kombinationen strikter definiert, deshalb kann man eigentlich nur mit der Differenzmethode mit Sicherheit auf die Ursache eines Phänomens schliessen (Mill 1874:281f.). Aber anstatt die beiden Methoden gegeneinander abzuwägen, kann es fruchtbar sein, sie zu kombinieren, wie verschiedene Studien zeigen. Skocpol sucht in ihrer Studie von 1979 nach Bedingungen für Volksrevolutionen. Dazu vergleicht sie die sozialen Revolutionen in China um 1911, in Frankreich Ende des 18. Jh. und in Russland im Jahr 1917 anhand der Konkordanzmethode. Die daraus resultierenden Kausalzusammenhänge untermauert sie durch Anwendung der Differenzmethode, indem sie die drei Fälle mit ausgewählten Fällen vergleicht, in denen keine Revolution stattgefunden hat. Die negativen Fälle werden dabei als Kontrollfälle und jeweils nur in Bezug auf einen spezifischen Teil des Kausalzusammenhangs beigezogen. Moore zeigt unter Verwendung der Mill’schen Methoden, dass es drei verschiedene Wege gibt (einen faschistischen, einen demokratischen und einen kommunistischen), die eine Transition des politischen Systems auslösen können. Er benutzt die Konkordanzmethode, um innerhalb jedes Weges aufzuzeigen, warum ein Land diesen Weg eingeschlagen hat. Dazu vergleicht er jeweils zwei bis drei Länder miteinander, die denselben Weg genommen haben. Um den Kausalzusammenhang innerhalb eines Weges zu validieren, vergleicht er diese mittels Differenzmethode mit Fällen aus den zwei anderen Wegen (Skocpol/Somers 1980:183f.). Auch in der vorliegenden Analyse wird eine Kombination der Konkordanz‐ mit der Differenzmethode angestrebt. In einem ersten Schritt werden zwei positive Fälle entlang der acht theoretischen Faktoren anhand der Konkordanzmethode verglichen, um determinierende Faktoren (notwendige Bedingungen) für die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien identifizieren zu können. Um das Ergebnis zu vertiefen, werden die zwei positiven Fälle anschliessend anhand der Differenzmethode mit einem negativen Fall kontrastiert. Dabei werden 36 jene Faktoren verwendet, die unter Anwendung der Konkordanzmethode als Kausalfaktoren identifiziert werden konnten. So kann festgestellt werden, ob diese Faktoren eine hinreichende Erklärung für die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien darstellen. Eine zweites Problem der Mill’schen Methoden ist der strikte Determinismus. So bieten die Mill’schen Methoden zwar eine gute Möglichkeit, um mögliche notwendige und hinreichende Bedingungen zu eliminieren, aufgrund des strikten Determinismus sind sie aber blind für multiple Kausalität und Interaktionseffekte (Ragin 1987:40f., Mahoney 2003:341). Werden die beiden Methoden in einer strikten Weise angewandt, muss der Einfluss der identifizierten Faktoren häufig zurückgewiesen werden. Wenn der Forschende diese Ereignisse aber nicht als solche stehen lässt, sondern als Ausgangspunkt nimmt zur Verfeinerung eines Arguments, zur Suche nach weiteren Faktoren oder zu einer genaueren Betrachtung oder Typologisierung der Fälle nutzt, können diese Methoden auch einen substantiellen Beitrag leisten, um multipler Kausalität und Interaktions‐ effekten auf die Spur zu kommen. Es ist deshalb wichtig, zwischen den formalen Charakteristika der Mill’schen Methoden und deren konkreter Anwendung zu unterscheiden (Ragin 1987:42f.). Gute Beispiele dafür sind wiederum die beiden Studien von Skocpol und Moore. So zeigt Skocpol Interaktionseffekte auf, die den Erfolg sozialer Revolutionen ausmachen, und Moore verweist auf Multikausalität, indem er drei unterschiedliche kausale Pfade nachweist, die eine Transition des politischen Systems auslösen (Ragin 1987:50). In dieser Arbeit wird bereits im Rahmen der Prozess‐ analyse das Fundament gelegt, um Multikausalität oder Interaktionseffekte zu erkennen und so den strikten Determinismus von Mill aufzuweichen. 3.3 Fallauswahl Bei den Mill’schen Methoden findet die Fallauswahl nach der abhängigen Variable statt, da ein bestimmtes Phänomen erklärt werden soll. In dieser Analyse ist die abhängige Variable die Ein‐ führung von Ergänzungsleistungen für Familien. Um erklären zu können, warum einige Kantone Ergänzungsleistungen einführen, werden zuerst zwei positive Fälle verglichen, das heisst zwei Kantone, welche Ergänzungsleistungen für Familien eingeführt haben. Anschliessend werden die zwei Fälle mit einem negativen Fall kontrastiert, um die Ergebnisse des ersten Vergleichs zu vertiefen und gegebenenfalls zu differenzieren. Die Fallzahl wird bewusst klein gehalten, um eine vertiefte Analyse zu ermöglichen. Es werden dementsprechend zwei positive Fälle und ein negativer Fall ausgewählt. Die Fallauswahl kann dabei nach dem Ausschluss‐ oder nach dem Einschlussprinzip erfolgen. Ersteres schliesst alle Fälle von der Untersuchung aus, die nicht adäquat erscheinen, zweiteres schliesst Fälle aufgrund bestimmter Aspekte ein (Jahn 2006:230). Die Fallauswahl für diese Analyse folgt einem zweistufigen Verfahren, das beide Prinzipien beinhaltet. 37 In einem ersten Schritt wird nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen, indem in Anlehnung an die Argumentation von Mahony/Goertz (2004) für diese Arbeit irrelevante Fälle von der Analyse ausgeschlossen werden. Mahony/Goertz argumentieren, dass neben den positiven Fällen nur jene negativen Fälle relevant sind, bei denen ein Outcome möglich gewesen wäre, aber nicht aufgetreten ist. Für die Gesamtheit der Kantone bedeutet dies, dass alle Fälle ausgeschlossen werden, in denen bis anhin keine Debatte lanciert wurde oder der Gesetzgebungsprozess noch im Gang ist und der Outcome deshalb noch nicht absehbar ist. Es verbleiben damit die Kantone Tessin, Solothurn, Obwalden, Zürich und Jura in der Untersuchung. Während die ersten beiden einen positiven Outcome zeigen, sind Projekte in Obwalden, Zürich und Jura gescheitert. Projekte in den Kantonen Bern, Waadt und Genf sind bereits fortgeschritten, haben den politischen Prozess aber noch nicht vollständig durchlaufen5. In Schwyz wurde ein erstes Projekt sistiert. Dieselbe Vorlage wurde jetzt aber im Rahmen einer Volksinitiative wieder aufgenommen, weshalb auch dieser Fall als nicht abgeschlossen betrachtet wird. Der zweite Schritt der Fallauswahl soll diese fünf verbleibenden Fälle auf drei reduzieren. Mit Tessin und Solothurn verbleiben zwei positive Fälle, mit Obwalden, Zürich und Jura drei negative Fälle. Wie bereits begründet, sollen zwei positive und ein negativer Fall in die Untersuchung ein‐ bezogen werden. Damit werden der Kanton Tessin und der Kanton Solothurn ausgewählt. Diese Fälle sind von besonderem Interesse, weil sie die beiden einzigen Kantone der Schweiz darstellen, die bisher ein Modell von Ergänzungsleistungen für Familien eingeführt haben. Das ist insofern überraschend, als die beiden Kantone vordergründig nicht viel gemeinsam haben. Der Kanton Tessin als Grenzkanton südlich der Alpen kennt ganz andere sozio‐ökonomische Bedingungen und blickt auf eine andere familienpolitische Tradition zurück als der Kanton Solothurn im schweizerischen Mittelland, umgeben von den grossen Zentren Zürich, Bern und Basel. Als negativer Fall wird der Kanton Obwalden gewählt. Zum einen, weil in Zürich kein eigentlicher Prozess stattfand, sondern eine Volksinitiative lanciert und in der Abstimmung abgelehnt wurde. Zum anderen wird der Kanton Obwalden dem Kanton Jura vorgezogen, weil in letzterem das Projekt zugunsten der Bundeslösung auf Eis gelegt wurde, während es im Kanton Obwalden definitiv abgelehnt wurde. Ausserdem ist es erstaunlich, dass ein landwirtschaftlich geprägter Kleinkanton der Deutschschweiz einen neuen sozialpolitischen Trend verhältnismässig früh aufnimmt. Natürlich wäre es auch interessant zu analysieren, warum die Volksinitiative in Zürich chancenlos war und wieso der Kanton Jura ent‐ schieden hat, auf die Bundeslösung zu warten, während in anderen Kantonen zu diesem Zeitpunkt bereits davon ausgegangen wurde, dass diese nicht kommen wird. Aber die Beschränkung auf einen negativen Fall ist unumgänglich, um eine dichte Analyse gewährleisten zu können. 5 Siehe S.18 für eine Übersicht über den aktuellen Stand des politischen Prozesses in den Kantonen. 38 Somit werden die Gesetzgebungsprozesse und der unmittelbare Kontext zur Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien für die drei Kantone Tessin, Solothurn und Obwalden anhand einer Prozessanalyse für jeden Kanton detailliert erfasst. Dabei wird in einem ersten Schritt der Prozess chronologisch‐deskriptiv nachgezeichnet, bevor die detaillierte Darstellung anhand der acht aus der Theorie abgeleiteten Faktoren in einen analytischen Rahmen überführt wird. Anschliessend werden die Kantone Solothurn und Tessin mittels Konkordanzmethode unter Einbezug der acht erwähnten Faktoren verglichen. Dann werden die Kantone Tessin und Solothurn dem Kanton Obwalden anhand der Differenzmethode gegenübergestellt, wobei nur noch jene Faktoren analysiert werden, die sich im Vergleich der Kantone Solothurn und Tessin als erklärungskräftig erwiesen haben. 3.4 Daten Um die Prozesse und Kontexte in den drei Kantonen detailliert darstellen zu können, wird auf unterschiedliche Quellen zurückgegriffen. Da die Ergänzungsleistungen für Familien abgesehen vom Tessin erst im Verlauf der letzten Jahre Teil der politischen Agenda in den Kantonen wurden, existieren kaum Untersuchungen dazu. Um die notwendigen Daten zu erheben wird zum einen eine Dokumentenanalyse durchgeführt, zum anderen werden Experteninterviews geführt. 3.4.1 Dokumentenanalyse Die Dokumentenanalyse wird auf mehreren Ebenen ansetzen. Um den politischen Prozess nachzuzeichnen und die involvierten Institutionen zu identifizieren, wird auf Berichte der Verwaltung, die Wortprotokolle der Kantonsparlamente und bereits bestehende Studien (falls diese existieren) zurückgegriffen. Um die sozio‐ökonomischen Gegebenheiten in einem Kanton zu beschreiben, wird statistisches Material des Bundesamtes für Statistik beigezogen. Gerade im Bereich von Armut und Sozialhilfe sind systematische Erhebungen aber eher jüngeren Datums, während beispielsweise für den Kanton Tessin die Situation in den späten 80er Jahren von Interesse ist. Deshalb wird wenn nötig auf kantonale und nationale Armutsberichte und ‐studien zurück‐ gegriffen. Um die Positionen der Akteure und Parteien zu untersuchen, werden wiederum die Wortprotokolle der Parlamentsdebatten beigezogen, aber auch die Vernehmlassungsberichte sowie Angaben zu den Unterstützungskommitees und die Parolen der Verbände und Parteien in den kantonalen Volksabstimmungen zu den Ergänzungsleistungen für Familien. Ausserdem werden die Positionspapiere der kantonalen Parteien analysiert, soweit diese verfügbar sind. Um Unterschiede in den kantonalen Vorlagen ausmachen zu können, werden die entsprechenden Gesetzestexte bzw. Vorlagen angeschaut. In den Fällen Solothurn und Tessin die verabschiedeten Vorlagen, im Kanton Obwalden der letzte Stand der Ausarbeitung. Zeitungsartikel werden nur punktuell beigezogen, da 39 eine systematische Analyse aufgrund der grossen Untersuchungszeiträume und der sehr unter‐ schiedlichen Abdeckung wenig Sinn macht (Obwalden verfügte über keine eigene kantonsinterne Tageszeitung, der Kanton Tessin hat mehrere). 3.4.2 Experteninterviews Im Anschluss an die Dokumentenanalyse werden leitfadengestützte Experteninterviews durch‐ geführt, um die Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse zu verifizieren, zu erweitern und zu vertiefen. Die Experteninterviews werden dabei aber sekundär zur Dokumentenanalyse verwendet und Aussagen aus den Interviews werden nach Möglichkeit auf weitere Dokumente abgestützt. Leitfadengestützte Experteninterviews stellen eine Mischung aus episodischem und problem‐ zentriertem Interview dar. Sowohl das episodische als auch das problemzentrierte Interview werden entlang eines Leitfadens geführt mit einer aktiven Rolle des Interviewers. Während das episodische Interview einem induktiven Vorgehen entspricht, in dem der Interviewer das erzählende Gespräch mit gezielten Interventionen und Nachfragen steuert, wird das problemzentrierte Interview komplementär zu anderen Methoden verwendet, wobei der Interviewer seine theoretischen Annahmen und aus der vorhergehenden Analyse resultierenden Hypothesen zur Diskussion stellt. Bei einer Mischung der beiden Methoden in Form eines Experteninterviews werden „auf der Basis eines durch Vorstudien und theoretische Vorüberlegungen informierten Interviewleitfadens […] Hintergrundinformationen über Sachverhalte und Geschehnisse, aber auch Informationen über Handlungsmotive und Kooperationsbereitschaften und Ein‐ schätzungen über Entwicklungen und Veränderungen erhoben“ (Blatter et al. 2007:62). Dabei wechseln sich narrative Phasen, in denen der Experte von seinen Erfahrungen berichtet, mit fokussierten Phasen ab, während denen gezielt Informationen abgefragt werden (Blatter et al. 2007:61f.). Im Rahmen dieser Arbeit werden sechs Experteninterviews durchgeführt, in jedem Kanton deren zwei. Es wird jeweils ein Vertreter der Verwaltung (Sozialdepartement) und wenn möglich ein Mitglied der parlamentarischen Kommission befragt. Damit soll sichergestellt werden, dass sowohl die politischen als auch die verwaltungsinternen Abläufe genauer beleuchtet werden können und dass zwei Personen interviewt werden können, die den ganzen Prozess aus jeweils unterschiedlicher Perspektive verfolgt haben6. Die Informationen aus den Interviews werden vertraulich behandelt und anonymisiert in die Analyse einfliessen. 6 Die Liste der interviewten Personen sowie die Interviewleitfaden finden sich im Anhang. 40 4. Analyse und Ergebnisse Die Fallstudien der Kantone Tessin, Solothurn und Obwalden gliedern sich in mehrere Teile. Als erstes wird jeweils ein Überblick gegeben über den sozio‐ökonomischen und familienpolitischen Kontext, danach werden die involvierten Akteure und Institutionen sowie ihre Positionen und Einflussbereiche genauer beleuchtet. Anschliessend werden die Ausgestaltung der jeweiligen kantonalen Vorlage, soweit diese ausgearbeitet wurde, und Finanzierungsmodalitäten dargelegt, bevor der Gesetzgebungsprozess rekonstruiert wird. Jede Fallstudie wird schliesslich entlang der aus der Theorie abgeleiteten Faktoren analysiert. Teilweise wird schon innerhalb der Fallstudien auf die anderen Kantone verwiesen, der systematische Vergleich wird aber im Anschluss daran vorge‐ nommen. Bevor jedoch zu den Fallstudien übergegangen wird, soll ein schematischer Überblick über den kantonalen Gesetzgebungsprozess gegeben werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein An‐ liegen auf die politische Agenda zu tragen. Dies kann entweder über eine Volksinitiative von aussen kommen oder durch Anträge aus dem Parlament. Daraufhin ist der Regierungsrat gefordert, einen Bericht oder ein Gesetz auszuarbeiten, das anschliessend zuerst in der parlamentarischen Kommis‐ sion und dann im Parlament beraten wird. Dabei steht es dem Regierungsrat in den drei unter‐ suchten Kantonen frei, ob er vorher ein formales Vernehmlassungsverfahren durchführen will oder nicht (Schweizerische Bundesbehörden 2010). Wird das Gesetz angenommen, kennen alle Kantone das fakultative und/oder obligatorische Gesetzesreferendum (Linder 2005:159). 41 G 3 Gesetzgebungsprozess in den Kantonen Agenda Setting Politikformulierung Parlament Parlamentarische Initiative, Auftrag o.ä. Volk Gesetzesinitiative Regierungsrat Einsetzung einer Kommission oder Arbeitsgruppe Vorentwurf Vernehmlassung Botschaft Entscheidung Parlamentarische Kommission Parlament Verabschiedeter Gesetzestext Volk Gesetzesreferendum ‐ obligatorisch (SO, OW) ‐ fakultativ (TI, SO, OW) Quellen: Linder 2005, Parlamentsdienste 2010, Schweizerische Bundesbehörden 2010 (kantonale Verfassungen), eigene Darstellung 42 4.1 Tessin Der Kanton Tessin hat im Rahmen des Kinderzulagengesetzes (Legge cantonale sugli assegni familiari LAF) von 1996 als erster Kanton ein umfassendes System der Ergänzungsleistungen für Familien geschaffen. Er hat dabei zwei neue Leistungen eingeführt: Die assegni di prima infanzia, die den Bedarf von Familien mit Kindern unter 3 Jahren decken, und die assegni integrativi per i figli, die den Lebensbedarf von Kindern bis 15 Jahre garantieren. Initiiert wurde die Vorlage 1987; der Zeit‐ raum der Untersuchung umfasst damit die Jahre 1987‐1996, sowie relevante Ereignisse, die diesem Zeitraum unmittelbar vorausgingen. Das Gesetz hat 2002 eine Revision erfahren, die wesentliche Elemente verändert hat. Auf diese Revision wird aber nur deskriptiv eingegangen, sie ist nicht mehr Teil der Analyse. Für die Fallstudie des Kantons Tessin konnte auf die Arbeit von Binder et al. (2003) zurückgegriffen werden, welche den Prozess der Einführung der Ergänzungsleistungen sowie die Positionen der Akteure im Rahmen der deskriptiven Erfassung der Tessiner Familienpolitik schon ziemlich detailliert erfasst hat. 4.1.1 Sozio‐ökonomischer Kontext Der Kanton Tessin zählte im Jahr 2000 306‘800 Einwohner, das sind 44‘800 mehr als noch 1980 und dies obwohl die Geburtenrate im Kanton Tessin ausserordentlich tief ist und die Geburtenzahl in den 80er Jahren zeitweilig sogar tiefer war als die Zahl der Todesfälle (Bundesamt für Statistik 2010a). Der Zuwachs ist damit primär auf Immigration zurückzuführen (Binder et al. 2003:112). Die Bevölkerung des Kantons Tessin verteilte sich im Jahr 1990 auf 120‘000 Haushalte, davon waren 48‘500 Haushalte mit Kindern. Die Anzahl der Haushalte mit Kindern ist zwischen 1980 und 2000 nur geringfügig angestiegen, primär durch die steigende Zahl der Haushalte Alleinerziehender (Bundes‐ amt für Statistik 2010a). Was die ökonomische Situation anbelangt, ist der Kanton Tessin als Grenzkanton, der durch die Alpen vom Rest der Schweiz getrennt ist, in einer besonderen Situation. Gemessen an den Wirtschaftssektoren hat der Kanton Tessin einen vergleichsweise hohen Modernisierungsgrad erreicht. Nur in den Regionen Zürich und Genfersee arbeiten anteilsmässig mehr Menschen im Dienstleistungssektor als im Kanton Tessin (Bundesamt für Statistik 2010a). Trotzdem ist die finan‐ zielle Ressourcenstärke des Kantons Tessin im nationalen Vergleich unterdurchschnittlich (Hegglin 2009). Die Arbeitslosenquote des Kantons Tessin ist stets überdurchschnittlich hoch und erreichte während der Wirtschaftskrise der 90er Jahre ein schweizweites Rekordhoch von 7.8% im Jahr 1997. Ausserdem hat der Kanton Tessin das tiefste Lohnniveau der Schweiz, die Löhne im Tessin sind durchschnittlich 10‐15% tiefer als in der restlichen Schweiz. Ebenfalls unterdurchschnittlich ist die Frauenerwerbstätigkeit (Bundesamt für Statistik 2010a). 43 Als einer der ersten Kantone hat der Kanton Tessin 1986 eine kantonale Armutsstudie verfasst, die aufgezeigt hat, dass im Kanton Tessin zu diesem Zeitpunkt 15.7% aller Menschen in Armut lebten. Damit waren im Kanton Tessin deutlich mehr Menschen von Armut betroffen als andernorts in der Schweiz. Besonders betroffen waren zu dieser Zeit junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren und ledige Frauen zwischen 18 und 40 (Dipartimento delle opere sociali 1986). 4.1.2 Familienpolitischer Kontext Der Kanton Tessin war und ist ein innovativer Kanton im Bereich der Familienpolitik. Er hat 1953 neben den Kantonen der französischen Schweiz als einer der ersten Kantone ein kantonales Gesetz zur Einführung von Kinderzulagen verabschiedet (Binder et al. 2003:114). Ein Vergleich der Höhe der Kinderzulagen Anfang der 90er Jahre hat gezeigt, dass der Kanton Tessin mit den zweithöchsten Kinderzulagen schweizweit nach wie vor führend war in diesem Bereich7. Inhaltlich entwickelt sich die Familienpolitik des Kantons Tessin entlang von drei Bereichen: finanzielle Absicherung von Familien durch Ergänzungsleistungen, organisatorische Unterstützung zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Massnahmen zum Schutz von Kindern. Auf gesetzlicher Basis regeln das Legge cantonale sugli assegni familiari und das Legge per le famiglie die Tessiner Familienpolitik in umfassender Weise. Auch strukturell ist die Familienpolitik im Kanton Tessin parteipolitisch wie auch institutionell breit abgestützt, beachtliche fachliche und personelle Ressourcen zur Gestaltung der Familienpolitik werden bereitgestellt. Im Kanton Tessin herrscht ein interventionistisches familienpolitisches Modell vor, dem Staat wird in selbstverständlicher Weise eine Rolle in der Familienpolitik zugedacht (Binder/Kübler 2004:346f.). Die Sozial‐ und Familienpolitik wurde im Kanton Tessin immer als Sache des Kantons betrachtet, die Rolle der Gemeinden war traditionell schwächer als in den Kantonen der Deutschschweiz (Interview A). Dass die Familienpolitik im Kanton Tessin gut verankert ist in den Aufgaben, die dem Staat zugedacht werden, zeigt sich auch daran, dass innerhalb des Sozial‐ und Gesundheitsdepartements eine von drei Abteilungen für Sozialhilfe und Familie (Divisione dell‘azione sociale e delle famiglie) zuständig ist. 4.1.3 Institutionen und Akteure Das Parlament des Kantons Tessin (Gran Consiglio) besteht aus 90 Mitgliedern. Die mit Abstand grössten Fraktionen bilden seit jeher die FDP und die CVP. Bis Ende der 80er Jahre hielt die FDP 33, die CVP 28 und die SP 11 Sitze. Die restlichen Sitze teilten sich Parteien am linken Rand mit einer sehr schwachen SVP. Die SVP ist im Kanton Tessin bis heute eine Randpartei mit nur marginalem Einfluss. 1991 hielt mit der LEGA eine neue Partei des rechten Spektrums Einzug ins Parlament und eroberte auf Anhieb 12 Sitze, einen Sitzanteil, den die LEGA in den darauffolgenden Legislaturperioden gar 7 Meldung des Corriere del Ticino vom 03.02.1990. Assegni familiari: Ticino generoso. 44 noch steigern konnte. Daneben gab es in den 80er Jahren zwei kommunistische Parteien, die sich 1988 zusammenschlossen und sich 1992 als kantonale Sektion der PdA (Partei der Arbeit) an‐ schlossen, Mitte der 90er Jahre im Kanton Tessin aber an Bedeutung verloren. Gemäss Ladner (2004) lässt sich der Kanton Tessin trotzdem als stabiles links‐zentriertes Mehrparteiensystem bezeichnen. T 4 Kräfteverhältnisse im Tessiner Parlament zwischen 1987 und 1999 Wahljahr 1987 1991 1995 FDP CVP SP LEGA 33 29 30 28 27 25 11 9 15 0 12 16 Kommunistische Parteien 9 9 0 andere 9 4 4 Quelle: Segreteria del Gran Consiglio 2010 FDP, CVP und SP nehmen in der Familienpolitik die gleichen Positionen ein wie auf nationaler Ebene. Während die FDP eine liberale, nicht‐etatistische Linie vertritt und die Familie eher der privaten Domäne zuschreibt, sind CVP und SP die aktivsten Parteien in der Familienpolitik. Die CVP setzt den Akzent auf den ethischen Wert der Familie und ihre zentrale Rolle, sie hat sich dem Anliegen der Familienarmut angenommen. Die SP ist näher bei den Themen der Gleichstellung von Mann und Frau, der Emanzipierung der Frau, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie dem Schutz von Minderjährigen. Die Mobilisierung der CVP‐Frauen hat in den 80er Jahren begonnen, während sich die Frauen der SP erst seit Beginn der 90er Jahre mobilisieren (Binder et al. 2003:133). Binder et al. (2003) bezeichnen CVP und SP im Kanton Tessin als ‚convergence parallèle‘ und nicht unbedingt als Koalition, weil sie oft das gleiche fordern, aber andere Werthaltungen dahinter stehen. Eine Spezialität des Tessiner Parteiensystems bildet die LEGA dei Ticinesi, eine Partei, die als populistische Protestbewegung bei den Kantonsratswahlen von 1991 auf Anhieb 12.8% der Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte. Bis heute gibt es die Partei ausschliesslich im Kanton Tessin, auf nationaler Ebene bildete sie zeitweilig zusammen mit den Schweizer Demokraten eine Fraktion. Aber obwohl die Lega dei Ticinesi grundsätzlich am rechten Rand politisiert, vertritt sie in der Sozialpolitik linke Positionen. So setzt sie sich auf kantonaler Ebene für eine Reduktion der Krankenkassenprämien ein und spricht sich im Parteiprogramm von 1991 für die Ausdehnung der Kinderzulagen auf selbstständig Erwerbende aus. Auch auf nationaler Ebene hat die LEGA oft Vor‐ lagen der Linksparteien unterstützt (Année politique 2010, LEGA Tessin 1991). Der Regierungsrat des Kantons Tessin hat fünf Mitglieder und setzte sich von 1971‐1995 mit einer Ausnahme aus jeweils zwei Mitgliedern der CVP, zwei Mitgliedern der FDP und einem Mitglied der SP zusammen. Seit 1991 hat die LEGA einen Regierungsratssitz auf Kosten der CVP erobert, den sie bis heute hält. Das Dipartimento della sanità e della socialità, das für Familienfragen zuständig ist, wird 45 jeweils vom Vertreter der SP geleitet, 1983‐1991 von Rossano Bervini, anschliessend von Pietro Martinelli bis 1999, seither von Patricia Pesenti (Regierungsrat Tessin 2010). Damit haben sozial‐ und christdemokratische Parteien eine starke Position in der Regierung, insbesondere in Bezug auf die Sozialpolitik. Neben den institutionellen Akteuren gibt es eine Reihe von Verbänden und Organisationen, die im Feld der Familienpolitik aktiv sind. Von den Gewerkschaften ist es vor allem die christlich‐soziale Gewerkschaft (Organizzazione cristiano‐sociale ticinese). Zum einen agiert sie als Gewerkschaft, zum anderen über ihre Vertreter im Parlament. Daneben gibt es mehr als 30 Interessengruppen, die sich direkt mit dem Thema Familie befassen, teilweise subventioniert vom Kanton. Andere werden unterstützt, indem sie konsultiert werden. Eine der wichtigsten ist die Comunità Familiare, die von Bund und Kanton und vom Lotteriefonds unterstützt wird. Ihr Einfluss auf die kantonale Politik war massgeblich. Daneben gibt es mit Caritas Ticino eine weitere Organisation mit christlicher Orien‐ tierung, die im Bereich Sozialhilfe und Familie sehr aktiv ist. Die ehemalige Präsidentin der Caritas sass ausserdem von 1983‐1994 für die CVP im Tessiner Parlament (Parlamentsdienste Tessin 2010, Binder et al. 2003:131f.). 4.1.4 Das Tessiner Modell der Ergänzungsleistungen für Familien Ziele Die Freiheit zur Fortpflanzung garantieren. Den Eltern die Möglichkeit geben, die Kinder (0‐3 Jahre) selber zu betreuen oder zu arbeiten und die Kinder Dritten anzuvertrauen. Die freie Wahl zu garantieren, ob die Betreuungs‐ arbeit von beiden Elternteilen oder von einem alleine übernommen wird. Verhindern, dass die Kinderkosten Armut verursachen. Die Familienpolitik von der Sozialhilfe lösen (Binder et al. 2003:114). Anspruch assegni di prima infanzia für Eltern mit Kindern unter 3 Jahren und assegni integrativi per i figli für Familien mit Kindern unter 15 Jahren. Der Anspruch ist unabhängig von einem Erwerb und schliesst damit auch die selbstständig Erwerbenden und Erwerbslosen nicht aus. Einelternfamilien dürfen höch‐ stens 50% arbeiten, Zweielternfamilien insgesamt höchstens 150% (2002 abgeschafft) (Binder et al. 2003:115). Höhe der Leistung Die Höhe der Leistung berechnet sich analog zu den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Bei Familien mit Kindern unter 3 Jahren wird der Lebensbedarf der ganzen Familie gedeckt, bei Familien mit Kindern unter 15 Jahren wird nur der Lebensbedarf des jeweiligen Kindes gedeckt (Binder et al. 2003:115). 46 Finanzierung Die assegni integrativi per i figli werden durch Einsparungen bei den Kinder‐ und Ausbildungszulagen (aufgrund des nicht mehr vorgenommenen Teuerungsausgleichs), 0.15% der AHV‐Beiträge und Beiträge des Kantons finanziert. Die assegni di prima infanzia werden vollumfänglich durch den Kanton finanziert (Regierungsrat Tessin 1994:850f.). 4.1.5 Gesetzgebungsprozess 1986 Die Armutsstudie des Kantons Tessin (Povertà in Ticino) erscheint als eine der ersten kantonalen Armutsstudien in der Schweiz. Wie oben bereits beschrieben, zeigt die Studie, dass der Kanton Tessin eine relativ hohe Armutsquote aufweist und dass davon viele Alleinerziehende und grosse Familien betroffen sind. Ausserdem wird die Problematik der Working Poor aufgegriffen. Diese Studie hat ein grosses Echo ausgelöst und kann als Agenda Setting Moment betrachtet werden. Die Studie wurde vom Dipartimento della socialità e delle famiglie herausgegeben. Initiiert wurde die Studie vom Regierungsrat und Vorsteher des Departements Rossano Bervini, der 1983 ins Amt gewählt worden war. Dies kann als aussergewöhnlich betrachtet werden, da bis dahin die meisten Studien im Kanton Tessin vom Istituto di ricerche economiche durchgeführt wurden, auch im Auftrag von anderen Departementen (Universität und Fachhochschule existierten zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Kanton Tessin) (Interview A). 21.9.1987 Die parlamentarische Initiative von Paolo Donadini (CVP, Gewerkschaftssekretär) für die CVP‐Fraktion fordert eine Revision des Kinderzulagengesetzes mit dem Ziel, die Zulagen zu generalisieren (Angestellte, Selbständige, Erwerbslose) und eine Differenzierung der Zulagen in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Situation einer Familie und der Anzahl Kinder vorzunehmen. Dabei ist der Bedarf eines Haushalts zu berücksichtigen. Ausserdem soll das Gesetz an die Verfassungsvorgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau angepasst werden. Die Initiative wird vom Parlament der Commissione della gestione e delle finanze überwiesen (Parlament Tessin 1987). 15.12.1987 Paolo Donadini (CVP, Gewerkschaftssekretär) reicht eine Motion ein, die einen Entwurf für eine kantonale Mutterschaftsversicherung fordert. Dies im Anschluss an die eidgenössische Abstimmung zur Mutterschaftsversicherung, die gesamtschwei‐ zerisch abgelehnt wurde, im Kanton Tessin aber Zustimmung gefunden hatte. Diese Initiative trug zur Entwicklung der assegni di prima infanzia bei (Interview A). 47 Ebenfalls 1987 beauftragt der Regierungsrat das Istituto de ricerche economiche, das System der Einkommensverteilung zu evaluieren und Vorschläge zur Ver‐ besserung zu machen (Interview A). 16.5.1988 Der Bericht der Kommission (Commissione della gestione e delle finanze) vom 28. April 1988, der die Initiative Donadini zur Annahme empfiehlt, wird vom Parlament einstimmig angenommen. In der Debatte wird von der CVP die sozio‐ökonomische Problemlage angeführt (Working‐Poor‐Problematik, tiefe Geburtenrate, tiefe Einkommen im Kanton Tessin). Ausserdem wird darauf verwiesen, dass die Umsetzung kostenneutral zu erfolgen habe und nicht die Kosten für die Arbeitgeber erhöhen dürfe. Zudem wird Bezug genommen auf andere Kantone und die Studie der Universität Freiburg zur Höhe der Kinderkosten, die zu diesem Zeitpunkt erschienen ist. Die FDP zeigt sich etwas kritischer als CVP und SP und verweist auf einige Probleme der geplanten Revision. Der Sprecher der parlamentarischen Kommission weist überdies darauf hin, dass die Ausweitung auf Nicht‐Erwerbs‐ tätige problematisch sein könnte und dass der Einbezug der Gewerkschaften und Arbeitgeber notwendig sei (Parlament Tessin 1988). 24.10.1988 Mimi Lepori‐Bonetti (CVP) reicht eine parlamentarische Initiative ein, welche auf die schwierige finanzielle Lage Alleinerziehender hinweist. Gefordert wird ein Bericht zur Situation und den Bedürfnissen der Alleinerziehenden im Kanton Tessin und die finanzielle Unterstützung der Bedürftigen unter ihnen. Der Bericht wird 1993 fertiggestellt und von den Medien aufgenommen. Initiative und Bericht haben dazu geführt, dass die Problematik der Alleinerziehenden diskutiert wurde und auch in Zusammenhang mit der Reform der Kinderzulagen gebracht wurde. Dies hat unter anderem dazu beigetragen, dass die assegni di prima infanzia vor allem auch als wirksames Instrument gegen die Armut Alleinerziehender betrachtet und nicht nur für Erwerbstätige ausgerichtet werden (Binder et al. 2003:126, Interview A). 20.12.1988 Infolge des Berichts der parlamentarischen Kommission (Commissione della gestione e delle finanze) zur Initiative Donadini, beruft der Regierungsrat eine ausserparlamentarische Kommission ein, die eine Reform der Gesetzgebung zu den Familienzulagen ausarbeiten soll. Auch der Auftrag resultierend aus der Initiative Lepori‐Bonetti wird dieser Kommission übertragen (Binder et al. 2003:126). Die Kommission arbeitet anschliessend etwas mehr als vier Jahre an der Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage. Sie umfasst mehr als 20 Mitglieder der politischen Parteien, der Verwaltung, der Arbeitgeberverbände, der Gewerkschaften und auch zwei 48 Vertreter von Familienorganisationen. Einige Mitglieder vertreten mehrere Inte‐ ressen, beispielsweise Mimi Lepori‐Bonetti, die einerseits Kantonsrätin der CVP ist, aber als Präsidentin der Caritas Tessin auch als Interessenvertreterin ebendieser Organisation und der Kirche betrachtet werden kann. In der Kommission sass zudem Martino Rossi, seinerzeit Forscher am Istituto di ricerche economiche, das 1988 den Auftrag für die Evaluation und Verbesserung der Einkommensverteilung gefasst hatte und im Rahmen dieses Auftrags eine Anzahl an Studien produzierte, die in die Kommissionsarbeit einflossen. So entstanden bis Ende 1991 sechs Studien, die sich mit dem Äquivalenzeinkommen und den verschiedenen Existenz‐ minima auseinandersetzten, Modelle für die Differenzierung der Ergänzungs‐ leistungen simulierten und die finanziellen Auswirkungen prüften. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde von einer Differenzierung der bereits bestehenden Kinderzulagen ausgegangen. Diese hätten aber für die hohen Einkommen voll‐ ständig gestrichen werden müssen, um für die tiefen Einkommen existenzsichernde Kinderzulagen finanzieren zu können. Da damit das Prinzip der horizontalen Gerechtigkeit verletzt worden wäre und ausserdem ein sehr hoher administrativer Aufwand resultiert hätte, kam man von dieser Idee ab. Im Dezember 1991 erschien zum ersten Mal eine Studie, die zwischen Grundzulagen und Ergänzungszulagen unterschied. Ende 1992 erschien eine Studie, die als Abschluss und Zusammen‐ fassung der Kommissionsarbeit verstanden werden kann. Die Studie analysiert das Instrument der Familienzulagen, untersucht unter anderem die Effekte in Bezug auf Arbeitsanreize und Geburtenrate und schlägt abschliessend als ideales Modell jenes Modell vor, das nachher mehr oder weniger als Gesetz verabschiedet wurde. Die Kommission hat somit Schritt für Schritt ein neues Kinderzulagenmodell entwickelt und einen breiten Kompromiss erreicht. Eine Gegnerin des Projekts blieb Marina Masoni (FDP), die als Vertreterin einer neo‐liberalen Sichtweise das Modell negativer Einkommenssteuern propagierte und den fehlenden Arbeitsanreiz kritisierte. Die Arbeitsanreize waren Thema in der Kommission, aber infolge der hohen Arbeitslosigkeit und der damit einhergehenden mangelnden Nachfrage nach Arbeitskräften blieb das Thema sekundär (Interview A). 24.03.1993 Die ausserparlamentarische Kommission reicht ihren Bericht beim Regierungsrat ein. Der Bericht präsentiert zwei Modelle, die beide neben den bereits bestehenden Kinder‐ und Ausbildungszulagen die zwei neuen Ergänzungsleistungen für Familien vorsehen. Das erste Modell sieht die universelle Einführung der vier Leistungen vor, 49 das zweite Modell beschränkt alle vier Leistungen auf unselbstständig Erwerbende (Binder 2003:126). 19.01.1994 Der Regierungsrat schlägt das Gesetzesprojekt vor, welches eine Mischform der beiden von der Kommission vorgeschlagenen Modelle vorsieht. Während die Kinder‐ und Ausbildungszulagen auf die unselbstständig Erwerbenden reduziert werden, sind die beiden neuen Zulagen universell. Die Kosten werden auf 23.7 Millionen jährlich geschätzt (Binder 2003:126f., Regierungsrat Tessin 1994). 01./02.1995 Die parlamentarische Kommission (Commissione della gestione e delle finanze), die den regierungsrätlichen Vorschlag prüft, nimmt einige gewichtige Änderungen (z.B. tiefere Leistungsobergrenzen) vor. Eine Kommissionsmehrheit bestehend aus FDP, SP und LEGA beschliesst dem Parlament diese geänderte Gesetzesvorlage zur Annahme zu empfehlen. Eine Minderheit der Kommission bestehend aus Mit‐ gliedern der CVP empfiehlt dem Kantonsrat, das Gesetz in seiner von der Kommissionsmehrheit festgelegten Form abzulehnen, weil sie mit den neuen Leistungsobergrenzen nicht einverstanden ist (Kommission für Verwaltung und Finanzen Tessin 1994) . Die parlamentarische Kommission entscheidet aber, aus wahlstrategischen Gründen davon abzusehen, dem Parlament die definitive Vorlage vor den kantonalen Wahlen am 2. April 1995 zu unterbreiten. Infolge dieser Suspendierung hat Pietro Martinelli (SP‐Regierungsrat und Vorsteher des Departements für Soziales und Familie) zusammen mit seiner Partie zur Unterstützung des Begehrens eine Volksinitiative mit dem gleichen Inhalt wie die Vorlage lanciert, weil er befürchtete, dass es mit dem neuen Regierungsrat schwierig sein könnte (Marina Masoni (FDP) wurde in den Regierungsrat gewählt), das Gesetz dem Parlament vorzulegen (Binder et al. 2003:127, Interview A). Aufgrund dieser Initiative (die schlussendlich 7923 Unterschriften erreichte) war das Parlament gezwungen, innerhalb eines Jahres das neue Gesetz anzunehmen oder dem Volk vorzulegen (Binder et al. 2003:127). 11.06.1996 Bei der Beratung im Kantonsrat werden die beiden Kommissionsanträge (Minder‐ heit und Mehrheit) debattiert. Alle Parteien erachten das neue Gesetz als notwendig. Von SP und CVP wird der rechtliche Anspruch auf die neue Leistung gelobt, aber auch darauf verwiesen, dass es eine globale Familienpolitik braucht. Die SP erwähnt ausserdem die hohen Arbeitslosenzahlen als neue Entwicklung, die berücksichtigt werden muss. Die FDP unterstreicht den experimentellen Charakter und verweist auf allfällige Risiken des Missbrauchs. Grundsätzlich erntet die Vorlage 50 aber auch von der FDP Lob, weil sie die Chancengleichheit verbessert, ähnlich wie eine negative Einkommenssteuer funktioniert und damit den Ideen der FDP ent‐ spricht, nicht nach dem Giesskannenprinzip funktioniert und für die Arbeitgeber kostenneutral ist. Es steht gar nicht mehr zur Debatte, das Gesetz als solches abzulehnen, und es wird schnell klar, dass der Antrag der Minderheit chancenlos ist. Der Kantonsrat stimmt schliesslich mit nur einer Gegenstimme der Reform des Familienzulagengesetzes gemäss dem Vorschlag der Mehrheit zu, die eine Ein‐ führung der Ergänzungsleistungen für Familien in Form der assegni integrativi per i figli und der assegni di prima infanzia vorsieht (Parlament Tessin 1996). 1996‐2002 Verschiedene Evaluationen und parlamentarische Initiativen, primär aus den Reihen der SP, führen zu einer erneuten Revision des Familienzulagengesetzes. Die Revision bringt einige substantielle und modernisierende Änderungen. So ist es beispielsweise nicht mehr vorgeschrieben, dass das Kind zu mindestens 50% selber betreut werden muss, und neu werden die Kosten für die externe Kinderbetreuung abgegolten (Binder et al. 2003:118). 4.1.6 Analyse der determinierenden Faktoren für die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien im Kanton Tessin Sozio‐ökonomische Faktoren F1 (sozio‐ökonomischer Wandel): Binder et al. (2003:125) halten fest, dass die sinkende Geburtenrate, die zunehmende Instabilität der Familien und die Diversifizierung der Familienformen sowie die finanzielle Bedürftigkeit der Familien unter anderem dazu beigetragen haben, dass familienpolitische Reformen in die Wege geleitet wurden. Dem kann aufgrund dieser Analyse nur zugestimmt werden. Es zeigt sich, dass das Armutsrisiko für Familien im Kanton Tessin substanziell höher ist als in anderen Kantonen. Dies ist auch auf das tiefe Lohnniveau und die tiefe Frauen‐ erwerbstätigkeit8 zurückzuführen (Interview A). Der Problemdruck im Kanton Tessin der 80er und 90er Jahre war aufgrund dieser verschiedenen, kumulierenden sozio‐ökonomischen Faktoren höher als in anderen Jahren und höher als in anderen Kantonen. 8 Durch die tiefe Frauenerwerbstätigkeit hatten viele Familien nur ein Einkommen. Die tiefe Frauenerwerbstätigkeit erklärte sich einerseits durch die kulturelle Dimension mit Betonung des traditionellen Familienbildes, andererseits durch die Lage als Grenzkanton mit einem grossen Arbeitskräfteangebot, sodass die Frauen auf dem Arbeitsmarkt nicht unbedingt gebraucht wurden (Interview A). 51 F2 (konjunkturelle Lage): Die parlamentarische Diskussion um die Ergänzungsleistungen für Familien wurde zur Zeit einer Wirtschaftskrise geführt, die mit hohen Arbeitslosenzahlen einherging. Damit ist die Möglichkeit der Armutsverhinderung noch unrealistischer geworden (Interview A). Die Armutsbekämpfung in Form von Ergänzungsleistungen für Familien wurde damit noch notwendiger. F3 (Problem erkannt und definiert): Wie unter F1 gezeigt wurde, ist der sozio‐ökonomische Problemdruck oder einfacher gesagt die Familienarmut im Kanton Tessin hoch. Ins Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt wird diese Tatsache aber erst durch die 1986 erschienene kantonale Armutsstudie. Während des politischen Prozesses verstärkt sich der Problemdruck in zunehmendem Mass durch die Wirtschaftskrise. Zudem wird die Mutterschaftsversicherung auf Bundesebene abgewiesen und im Kanton Tessin wird die Diskussion um die Probleme alleinerziehender Mütter lanciert. Im Kanton Tessin kann damit von einem Window of Opportunity für neue politische Ideen gesprochen werden. Als ‚policy entrepreneur‘ von seiten der christlichensozialen Gewerkschaften macht sich Paolo Donadini diese Chance zunutze und bringt die Revision des Familienzulagengesetzes auf die politische Agenda. Interessen‐ und konflikttheoretische Faktoren F4a (Stärke von SP und CVP im Parlament): Im Kanton Tessin verfügen CVP und SP zusammen mit den kommunistischen Parteien ganz knapp nicht über eine Mehrheit. Für die Einführung der Ergänzungsleistungen für Familien im Kanton Tessin war jedoch nicht primär die absolute Stärke der sozial‐ und christdemokratischen Parteien entscheidend, da sich schlussendlich alle Parteien für das neue System der Kinderzulagen aussprachen. Aber verschiedene Parlamentarier, vor allem von der CVP, haben das Vorhaben initiiert und vorangetrieben. So hat der CVP‐Kantonsrat und Gewerk‐ schafter Paolo Donadini die Armutsproblematik in die politische Arena getragen und mit der Revision des Kinderzulagengesetzes in Verbindung gebracht. Unterstützt wurde sein Vorhaben durch Mimi Lepori‐Bonetti (CVP), die zur gleichen Zeit die Probleme Alleinerziehender auf die politische Agenda gebracht hat. Ausserdem haben die Vertreter von CVP und SP in der Kommission den Kompromiss gesucht, um alle Interessen zufrieden zu stellen (Interview A). F4b (Stärke von SP und CVP im Regierungsrat, Departementsvorstand): CVP und SP verfügten nur bis 1995 über eine Mehrheit im Regierungsrat. Aber das zuständige Departement blieb weiterhin in der Hand der SP, was für die Einführung der Ergänzungsleistungen für Familien entscheidender war als die zahlenmässige Vertretung der Wohlfahrtsstaatsparteien im Regierungsrat. So waren die SP‐ Regierungsräte Rossano Bervini und sein Nachfolger Pietro Martinelli als Vorsteher des zuständigen Departements wichtige Akteure für die Einführung der neuen Leistung. Bervini hatte mit dem Auftrag zur kantonalen Armutsstudie massgeblich zum Agenda Setting beigetragen und Martinelli war eine 52 der treibenden Kräfte für das Vorankommen der Vorlage, nicht zuletzt, indem er durch die Lancie‐ rung einer Volksinitiative zusammen mit seiner Partei eine rasche Behandlung der Vorlage im Parlament erreichte. F5 (Verbände und Organisationen): Der Kanton Tessin verfügt über ein grosses Netz familien‐ politischer Verbände und die Vorlage wurde von einem Gewerkschafter lanciert. Die Verbände und Organisationen waren durch ihren Einsitz in der ausserparlamentarischen Kommission auch stark in die Ausarbeitung der Gesetzesrevision eingebunden. Institutionelle Faktoren F6 (konsensorientierte/konfliktive Gremien): Durch die Einberufung einer ausserparlamen‐ tarischen Kommission zur Ausarbeitung des revidierten Kinderzulagengesetzes überträgt der Regierungsrat die Aufgabe einem konsensorientierten Gremium, in welchem mehr als 20 Personen und alle wichtigen Akteure und Interessen vertreten sind. So kommt in fünf Jahren Arbeit ein Kompromiss zwischen allen grossen Parteien, Arbeitgebern und Gewerkschaften, sowie den Interessenverbänden zustande, bevor das Thema im Parlament behandelt wird. In der Kommission stellt man fest, dass das Problem nicht über einkommensabhängige Kinderzulagen und auch nicht kostenneutral zu realisieren ist. In der ausserparlamentarischen Kommission wird auch die Debatte über Arbeitsanreize und die Finanzierung geführt. Es kann also von einem eigentlichen Lernprozess innerhalb dieser Kommission gesprochen werden, der durch zahlreiche Studien unterstützt wurde. F7 (direkte Demokratie): Mit der Überweisung an die parlamentarische Kommission wird die Vorlage einem weitaus konfliktiveren Klima ausgesetzt und droht aufgrund von parteipolitischem Kalkül blockiert zu werden. Dies wird mit der Lancierung einer Volksinitiative verhindert. Die Volksinitiative wird dabei eingesetzt, um den parlamentarischen Prozess voranzutreiben, und nicht unbedingt, um eine Volksabstimmung herbeizuführen. Die Initiative hat die gewünschte Schub‐ wirkung, das Parlament behandelt und verabschiedet die Vorlage zügig. F8 (familienpolitische Tradition): Der Kanton Tessin verfügt über eine weit zurückreichende, gut verankerte Familienpolitik. Ob der Staat in die Familie eingreifen soll, war denn auch kein Thema in der Debatte. 53 4.1.7 Fazit Die Analyse hat gezeigt, dass die kantonale Armutsstudie zur Erkennung und Definition von Familienarmut als Problem beigetragen hat. Daraufhin übernimmt ein Vertreter der CVP die Rolle des ‚policy entrepreneur‘ und bringt das Projekt der Ergänzungsleistungen für Familien ins Rollen, indem er einkommensabhängige Kinderzulagen vorschlägt. Unterstützt wird die Vorlage durch gleichzeitig lancierte Vorstösse im Bereich der Familie (Alleinerziehende, Mutterschaftsversicherung) und eine Verschärfung der wirtschaftlichen Situation. Durch die Einsetzung einer grossen ausserparlamen‐ tarischen Kommission unter Berücksichtigung aller Interessen wird ein fünf Jahre dauernder Kompromissfindungsprozess eingeleitet, begleitet von verschiedenen wissenschaftlichen Studien, der die Entwicklung eines neuen, in der Schweiz bisher einzigartigen Modells zur Absicherung einkommensschwacher Familien ermöglicht. In der parlamentarischen Kommission ist die Situation dann konfliktiver, was sich auch daran zeigt, dass sich die Kommission nicht einigen kann und eine Minderheit den Vorschlag der Mehrheit dem Parlament zur Ablehnung empfiehlt. Ausserdem droht das Projekt aufgrund parteipolitischen Kalküls auf die lange Bank geschoben zu werden, was mit einer Volksinitiative der SP verhindert wird. Schliesslich setzt sich der breite Kompromiss durch, die Vorlage wird von allen Parteien angenommen. Der Kanton Tessin führt damit 1996 ein Modell der Familienergänzungsleistungen ein, das sich an einem eher traditionellen Familienbild orientiert, indem das Erwerbspensum eines Elternteils beschränkt wird. Dieses traditionelle Element wird in der Revision von 2002 modernisiert. Die Analyse hat auch gezeigt, dass eine Debatte über Kosten und Finanzierung geführt wurde und zu diversen Beschränkungen führte (Einschränkung der Anspruchs‐ gruppen, Herabsetzung der Leistungsobergrenze), die Einführung der neuen Leistungen aber nicht grundsätzlich gefährdet hat. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im Kanton Tessin vor allem der sozio‐ökonomische Problemdruck, der über verschiedene Anträge in die politische Arena getragen wurde, und ein mehrjähriger Prozess in einem grossen ausserparlamentarischen Gremium unter Einbezug aller relevanten Interessen die Einführung der Ergänzungsleistungen für Familien ermöglicht haben. 54 4.2 Solothurn Der Kanton Solothurn hat 2009 im Rahmen einer Volksabstimmung ein System von Ergänzungs‐ leistungen für Familien eingeführt, das sich in den Grundzügen am Tessiner Modell orientiert, daneben aber auch Elemente der vom Bund ausgearbeiteten Modelle übernimmt und neue Aspekte einbringt. Das Solothurner Modell kann deshalb ebenfalls als Innovation betrachtet werden, die nun von verschiedenen Kantonen als Referenz in die Überlegungen zu eigenen Modellen einbezogen wird. Der Untersuchungszeitraum für den Kanton Solothurn erstreckt sich von 2005‐2009, Startpunkt bildet der parlamentarische Vorstoss der CVP, Schlusspunkt die Volksabstimmung. Damit zeigt sich bereits, dass im Kanton Solothurn der politische Prozess im Vergleich zum Kanton Tessin relativ kurz war. Um den Kontext zu erfassen, werden aber auch für den Kanton Solothurn Ereignisse der vorangehenden Jahre einbezogen, soweit sie relevant sind. 4.2.1 Sozio‐ökonomischer Kontext Der Kanton Solothurn hatte 2008 250‘200 Einwohner, das sind 20‘000 mehr als im Jahr 1991. Im Jahr 2000 existierten im Kanton Solothurn 104‘200 Haushalte, davon waren 31‘600 Zweieltern‐ familien und 5‘000 Alleinerziehende. Damit ist die Zahl der Alleinerziehenden seit 1990 leicht angestiegen, die Zahl der Zweielternfamilien ist leicht zurückgegangen. Die Geburtenzahlen im Kanton Solothurn sind rückläufig wie in der gesamten Schweiz, die Geburtenziffer liegt sogar leicht unter dem schweizerischen Durchschnitt (Bundesamt für Statistik 2010a). Die Bevölkerungszunahme ist damit primär auf Immigration zurückzuführen, jedoch fand diese in geringerem Ausmass statt als im Kanton Tessin (Bundesamt für Statistik 2010c). Die ökonomische Situation im Untersuchungszeitraum präsentiert sich besser als in den 90er Jahren. Seit 2004 befand sich die Schweiz in einer konjunkturell guten Situation, bevor sich 2008 die ersten Zeichen der Finanzkrise bemerkbar machten. Diese wirkte sich aber im Untersuchungs‐ zeitraum nicht dermassen gravierend auf die Arbeitslosenquote aus wie die Krise der 90er Jahre (Bundesamt für Statistik 2010a, Bundesamt für Statistik 2010b). Solothurn liegt in Bezug auf die Arbeitslosenquote jeweils im Durchschnitt, seit dem Jahr 2000 fast immer leicht darunter (Bundes‐ amt für Statistik 2010a). Im Kanton Solothurn arbeiten im Jahr 2005 weniger Beschäftigte im Dienstleistungssektor als im Schweizer Durchschnitt (2010a). Der Kanton Solothurn ist demnach noch stärker industriell geprägt als andere Kantone. Die Frauenerwerbsquote ist zwischen 1980 und 2000 um 12 Prozentpunkte gestiegen und liegt im Schweizer Durchschnitt (Sozialbericht 2003). In Bezug auf die finanzielle Ressourcenstärke liegt der Kanton Solothurn unter dem Durchschnitt und verfügt über ein geringeres Ressourcenpotential als der Kanton Tessin (Hegglin 2009). Allerdings ist die finanzielle Lage im Kanton Solothurn für den Untersuchungszeitraum entspannter als in den vorher‐ 55 gehenden Jahren. Mitte der 1990er Jahre musste die Solothurner Kantonalbank Konkurs anmelden und riss ein grosses Loch in die Staatskasse, weshalb im Kanton Solothurn der finanzielle Spielraum über einige Jahre hinweg sehr stark eingeschränkt war (Interview C). Was die Armut anbelangt, ist der Kanton Solothurn eher weniger betroffen als andere Kantone. Sowohl die Sozialhilfe‐ als auch die Armutsquote liegen unter dem schweizerischen Durchschnitt (Bundesamt für Statistik 2008b:6, Departement des Innern Solothurn 2005:212). Allerdings zeigt der Sozialbericht von 2005 auf, dass der Kanton Solothurn eine überdurchschnittliche Working‐Poor‐ Quote aufweist und dass Familien in der Sozialhilfe stark übervertreten sind (Departement des Innern Solothurn 2005:204). 4.2.2 Familienpolitischer Kontext Die Familienpolitik des Kantons Solothurn in den letzten zwanzig Jahren kann in zwei Phasen unterteilt werden. Zu Beginn der 90er Jahre wurde ein Elternbeitragsgesetz erarbeitet, eine Fachstelle für Familien wurde angedacht und ein Bericht zu den bestehenden Leistungen und Massnahmen erstellt. Umgesetzt wurde nichts. Das Elternbeitragsgesetz war fertig ausgearbeitet, wurde dann aber nicht weiterverfolgt9. Aber diese erste familienpolitische Debatte hat dazu geführt, dass die Familie als öffentliche Angelegenheit wahrgenommen wird. Nach dieser ersten Phase gab es vereinzelte Vorstösse, umgesetzt wurde wenig. Der Kanton Solothurn war somit kein Pionier in der Familienpolitik, die Leistungen eher auf unterdurchschnittlichem Niveau (z.B. Kinderzulagen). Ein zweiter Schub in der Familienpolitik des Kantons Solothurn ergab sich seit 2005 mit dem Sozialgesetz, den Ergänzungsleistungen für Familien und dem Familienleitbild (Interview B/C). 4.2.3 Institutionen und Akteure Das Parlament des Kantons Solothurn (Kantonsrat) wurde 2005 von 144 auf 100 Mitglieder verkleinert. Bei dieser Umstellung haben alle Parteien Sitze verloren, die FDP als bisher klar stärkste Partei hat aber mit Abstand am meisten Sitze eingebüsst. Im Kanton Solothurn sind alle vier Grossparteien, die auch auf nationaler Ebene die Hauptrolle spielen, mit einem hohen Sitzanteil im Parlament vertreten. Ladner (2004) ordnet den Kanton Solothurn in seiner Untersuchung der Parteiensysteme den links‐zentrierten Mehrheitsparteiensystemen zu. Eine Analyse der Kräftever‐ hältnisse im Parlament zeigt, dass eine Koalition aus CVP und SP zusammen mit den Grünen über eine Mehrheit verfügt. Allerdings kennt Solothurn das obligatorische Gesetzesreferendum. Neue Gesetze, denen nicht zwei Drittel aller anwesenden Parlamentsmitglieder zustimmen, müssen dem Volk vorgelegt werden (Schweizerische Bundesbehörden 2010, Verfassung Kanton Solothurn). 9 Die Solothurner Vorlage wurde schliesslich von einem anderen Kanton übernommen und umgesetzt (Interview C). 56 T 5 Kräfteverhältnisse im Solothurner Parlament zwischen 2005 und 2009 Wahljahr FDP CVP SP SVP 2005 2009 30 27 23 25 25 21 17 18 Grüne/GLP 4 8 EVP 1 1 Quelle: Parlamentsdienste Solothurn 2010 Die Positionen der vier grossen Kantonalparteien in der Familienpolitik entsprechen jenen der nationalen Parteien. Für die CVP und die SP bildet die Familienpolitik ein Schwerpunkt ihres Engage‐ ments. Beide Parteien fordern in ihren Parteiprogrammen für die Legislaturperiode 2005‐2009 die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien (CVP Solothurn 2004, SP Solothurn 2010). Für die FDP hingegen stellt die Familie kein Schwerpunktthema dar, die Partei setzt sich aber für moderne schulische Tagesstrukturen und die Chancengleichheit der Geschlechter ein. Ergänzungsleistungen für Familien lehnt sie ab, da sie diese nicht für ein zielführendes Instrument hält, um das Problem der Working Poor zu lösen, und hohen administrativen Aufwand befürchtet (FDP Solothurn 2008, Kantonsrat Solothurn 2009). Grundsätzlich gegen Ergänzungsleistungen für Familien ist die SVP (Kantonsrat Solothurn 2009). Die drei Kleinparteien Grüne, GLP und EVP sprechen sich für die Vor‐ lagen aus (Überparteiliches Komitee Solothurn 2010). Damit kann zusammengefasst werden, dass CVP, SP, EVP, Grüne und GLP die Ergänzungsleistungen unterstützen, während FDP und SVP die Vorlage ablehnen. Es zeigt sich damit eine klassische Spaltung zwischen links und rechts in dieser Frage. Der Regierungsrat des Kantons Solothurn hat fünf Mitglieder. Davon gehen traditionellerweise drei Sitze an CVP und SP und zwei Sitze an die FDP. Die SVP hat den Sprung in die Solothurner Regierung bis anhin nicht geschafft. Seit 2005 stellt die CVP zwei Regierungsräte, die SP einen und die FDP ebenfalls zwei. Damit verfügen CVP und SP auch in der Regierung über eine Mehrheit. Der Bereich Familienpolitik ist im Amt für soziale Sicherheit innerhalb des Departements des Innern angesiedelt. Das Departement wird seit 2005 von Peter Gomm (SP) präsidiert (Regierungsrat Solo‐ thurn 2010). In Bezug auf die Verbände sind, neben den Gewerkschaften und den Arbeitgebern, der Bauern‐ verband und vor allem der Verband Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) von Bedeutung. Dies zeigt sich auch daran, dass der VSEG als einziger Verband in die Erarbeitung der Vorlage einbezogen wurde. Alle anderen Verbände konnten sich nur im Vernehmlassungsverfahren äussern. Während sich die Gewerkschaften grundsätzlich für die Einführung der Ergänzungsleistungen aussprechen, lehnen die Handelskammer und der Gewerbeverband als die zwei wichtigsten Arbeitgeberverbände im Kanton Solothurn die Vorlage ab. Etwas weniger klar ist die Lage beim Bauernverband und beim VSEG. Beide Verbände sind parteiübergreifend organisiert. Der Bauernverband äussert sich kritisch 57 zur Vorlage, beschliesst aber Stimmfreigabe für die Abstimmung (Interview B). Der VSEG gibt keine Abstimmungsempfehlung ab, was üblich ist bei Vorlagen, die nicht direkt die Gemeinden betreffen. Der VSEG hat sich aber in der Vernehmlassung und auch im Anschluss an die Abstimmung kritisch geäussert, es wurden Mehrkosten für die Gemeinden befürchtet (VSEG 2010, Regierungsrat Solo‐ thurn 2008a). Daneben gibt es eine Reihe von privaten Organisationen, die sich mit der Familien‐ politik befassen. Diese sind teilweise in der Fachkommission Familie vertreten, die vom Regierungsrat gewählt wird. Diese Kommission wurde aber erst 2007 gegründet und konnte auf den Prozess zu den Ergänzungsleistungen für Familien keinen Einfluss nehmen, weil sie sich erst selber konstituieren musste (Interview C). Grundsätzlich ist der politische Einfluss der Familienorganisationen gering im Kanton Solothurn, es wird keine konsequente Lobbyarbeit geleistet (Interview B). 4.2.4 Das Solothurner Modell der Ergänzungsleistungen für Familien Ziele Verringerung der Armut von Working‐Poor‐Familien. Entlastung der Sozialhilfe. Anspruch Familien mit Kindern unter 6 Jahren, die im Minimum 2 Jahre im Kanton wohnhaft sind und im Minimum einen Bruttolohn von 30‘000 Franken im Jahr erzielen (resp. 15‘000 für Einelternfamilien mit Kindern über 3 Jahren, und 7‘500 Franken für Einelternfamilien mit Kindern unter 3 Jahren). Höhe der Leistung Die Höhe der Leistung berechnet sich analog zu den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, wobei die Betreuungskosten für Kinder bis zu einem Betrag von 6‘000 Franken berücksichtigt werden. Anreizelemente Um einen Arbeitsanreiz zu setzen, wird je nach Bruttolohn ein hypothetisches Einkommen anstelle des effektiven Einkommens angerechnet oder ein Erwerbsfreibetrag gewährt. Finanzierung Für die Finanzierung werden öffentliche Mittel bereitgestellt. Die Gemeinden tragen nur jenen Betrag bei, den sie bei der Sozialhilfe einsparen können. Die restlichen Kosten trägt der Kanton (Regierungsrat Solothurn 2008b). 4.2.5 Gesetzgebungsprozess 14.12.2005 Der Kantonsrat beschliesst, den Legislaturplan 2005‐2009 um die Massnahme ‚Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien‘ zu erweitern (Regie‐ rungsrat Solothurn 2008b). Dieser Beschluss wird auf Antrag der CVP‐Fraktion gefasst mit Unterstützung der Fraktion SP/Grüne und der EVP. Die FDP‐Fraktion 58 enthält sich der Stimme. Der Regierungsrat empfiehlt den Antrag zur Ablehnung, aber eher, weil damit eine Änderung des Legislaturplans einhergegangen wäre, denn aus grundsätzlicher Opposition (Interview B). Ein weiterer Antrag der SP, der umfassendere Massnahmen fordert, aber u.a. auch bedarfsabhängige Unter‐ stützung für einkommensschwache Eltern, findet keine Mehrheit (Kantonsrat Solothurn 2005). Zur gleichen Zeit fasst auch die parlamentarische Kommission für Soziales und Gesundheit die Prüfung einer Aufnahme der Ergänzungsleistungen für Familien ins Sozialgesetz ins Auge (Regierungsrat Solothurn 2008b:7). 19.12.2006 Der Regierungsrat beschliesst die Einsetzung einer Steuergruppe und einer Projektgruppe zur Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs. Die Steuergruppe um‐ fasst die Regierungsräte Peter Gomm (SP) und Esther Gassler (FDP), sowie den Vorsteher des Amtes für Soziales und den Geschäftsleiter der Ausgleichskasse. Die Projektgruppe besteht aus Vertretern der verschiedenen Verwaltungseinheiten sowie einem Vertreter des VSEG. Damit sind bis auf die zwei Regierungsräte und den Vertreter des VSEG ausschliesslich Personen aus der Verwaltung involviert. Parteien und Interessengruppen bleiben aussen vor. Der Auftrag des Regierungs‐ rates gibt den Rahmen für die Ausarbeitung eines Solothurner Modells vor, indem er festlegt, dass nur eine Leistung eingeführt werden soll, welche sich an der Tessiner Ergänzungszulage (assegni integrativi per i figli) orientiert, und ver‐ schiedene Altersgrenzen zu prüfen sind (Regierungsrat Solothurn 2006:10ff.). Die Projektgruppe orientiert sich bei ihrer Ausarbeitung einer Vorlage jedoch nicht nur am Tessiner Modell, sondern auch an den Modellen des Bundes. Ziel ist ein Modell, das mit einer möglichen Bundeslösung kompatibel wäre. Die Projekt‐ gruppe hat denn auch dem Bundesamt für Sozialversicherungen einen Besuch abgestattet (Interview C). 01.07.2008 Der Regierungsrat beauftragt das Departement des Innern über Botschaft und Entwurf zu den Ergänzungsleistungen für Familien, ein öffentliches Vernehm‐ lassungsverfahren durchzuführen (Regierungsrat Solothurn 2008b). 30.09.2008 Das Vernehmlassungsverfahren ist abgeschlossen. 19 Organisationen haben eine Vernehmlassung eingereicht, wobei von allen Vernehmlassungsteilnehmern grundsätzlich anerkannt wird, dass Working‐Poor‐Familien unterstützt werden sollen. Grundsätzlich ablehnend gegenüber Ergänzungsleistungen für Familien 59 äussern sich die FDP sowie die Arbeitgeberverbände. Grundsätzlich begrüsst wird die Vorlage aus linken und christdemokratischen Kreisen. Die SVP hat sich als einzige der vier grossen Parteien nicht an der Vernehmlassung beteiligt (Regie‐ rungsrat Solothurn 2008a). 11.11.2008 Der Regierungsrat nimmt Kenntnis vom Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens und beauftragt das Departement des Innern, die Vorlage dem Kantonsrat vor‐ zulegen unter angemessener Berücksichtigung der Vernehmlassungsantworten (insbesondere hinsichtlich der Forderung nach Abgeltung der familienexternen Kinderbetreuungskosten) (Regierungsrat Solothurn 2008a:6). 01.12.2008 Der Regierungsrat überweist Botschaft und Entwurf zu den Ergänzungsleistungen für Familien dem Kantonsrat. Innerhalb des Regierungsrates macht sich vor allem Gomm (SP) als Vorsteher des Departements des Innern stark für die Vorlage, geht viele kleine Kompromisse ein und forciert das Geschäft, um es noch vor den Parlamentswahlen verabschieden zu können. Auch Esther Gassler, Regierungs‐ rätin der FDP und Mitglied der Steuergruppe, ist eine vehemente Befürworterin des Geschäfts, obwohl ihre Partei eine ablehnende Haltung einnimmt (Interview B/C). Die Vorlage findet damit im Regierungsrat eine solide Mehrheit. 01.2009 Die parlamentarische Kommission für Soziales und Gesundheit behandelt Botschaft und Entwurf in zweimaliger Lesung und empfiehlt den Gesetzes‐ vorschlag zur Annahme, wobei sich SVP und FDP in der kommissionsinternen Abstimmung enthalten haben. Das Eintreten auf das Geschäft wurde aber einstimmig von allen Mitgliedern der Kommission beschlossen. In der Kommission hat sich die SVP eher passiv verhalten, die FDP wollte mit Änderungsanträgen eine finanzielle Steuerung erreichen. Die Änderungsanträge hatten aber keinen Erfolg oder wurden zurückgezogen. Ebenfalls abgelehnt wurden Anträge von SP und CVP. Erstere forderte eine Ausweitung der Leistung auf Familien mit Kindern bis 16 Jahre, letztere wollte auch familieninterne Kinderbetreuungskosten abgelten. Eine fundamentale Oppositionsposition gegen die Vorlage wurde innerhalb der Kommission weder von der FDP noch von der SVP vertreten. Die Opposition der FDP bezog sich ausschliesslich auf die Finanzierung (Interview B). Neben der Kommission für Gesundheit und Soziales hat sich auch die Finanz‐ kommission mit dem Geschäft auseinandergesetzt. Die Finanzkommission hat der Vorlage mit 10 zu 2 Stimmen zugestimmt (Kantonsrat Solothurn 2009). In Anbe‐ 60 tracht der Zusammensetzung der Finanzkommission muss sich auch hier zumin‐ dest ein Teil von FDP und SVP für die Vorlage ausgesprochen haben. Die Haltung der Finanzkommission ist in der parlamentarischen Debatte nicht unwesentlich, ein Geschäft, das von der Finanzkommission abgelehnt wird, hat im Parlament kaum eine Chance (Interview B). 04.03.2009 Anders als in der Kommission, wollen die Fraktionen der FDP und der SVP im Parlament gar nicht auf das Geschäft eintreten. Nachdem schliesslich doch be‐ schlossen wurde, auf die Vorlage einzutreten (mit 48 zu 44 Stimmen), bringt die FDP Änderungsvorschläge und verlangt überdies, die Vorlage dem Volk zu unter‐ breiten, sollte sie denn angenommen werden. Die SVP lehnt mit Verweis auf die wirtschaftliche Lage die Einführung neuer Sozialleistungen kategorisch ab. SP, CVP und die Kleinparteien setzen sich weiterhin vehement für die Vorlage ein und weisen darauf hin, dass gerade in Zeiten der Krise eine solche Leistung konjunk‐ turpolitisch sinnvoll ist, weil die Kaufkraft der Familien erhöht wird (Kantonsrat Solothurn 2009). Der Kantonsrat verabschiedet die Gesetzesänderung schliesslich mit 47 zu 43 Stimmen. Der Kantonsrat beschloss in diesem Fall, das Geschäft der Volksab‐ stimmung zu unterstellen. Dies wäre aber ohnehin geschehen, da im Kanton Solo‐ thurn Gesetze der Volksabstimmung unterstellt werden müssen, wenn sie keine Zweidrittelmehrheit erreichen. Das Geschäft wurde ganz knapp vor den Parla‐ ments‐ und Regierungsratswahlen verabschiedet. Der Wahlkampf dürfte sich insofern auf die Parlamentsdebatte ausgewirkt haben, als dass die Opposition moderater ausfiel (Interview B). 17.05.2009 Der Abstimmungskampf fand direkt nach den Parlamentswahlen statt, trotzdem waren die Ergänzungsleistungen für Familien nicht Wahlkampfthema. Die Parteien und Verbände haben sich im Abstimmungskampf unterschiedlich engagiert. Sowohl die Pro‐ als auch die Kontraseite haben ein Komitee gegründet. Auf der Seite der Gegner hat sich vor allem die FDP engagiert, jedoch ohne ihre Regierungsrätin Esther Gassler, die sich auch im Abstimmungskampf für die Annahme der Vorlage einsetzte. Aber auch davon abgesehen waren die Reihen der Opposition nicht geschlossen. So lehnten zwar Handelskammer und Gewerbe‐ verband die Vorlage ab, der Präsident der Handelskammer sass aber zur gleichen Zeit für die CVP im Kantonsrat und hatte in dieser Funktion dem Gesetz zugestimmt. Die SVP verhielt sich auch im Abstimmungskampf passiv (Interview 61 B/C). Die Änderung des Sozialgesetzes wird schliesslich in der Volksabstimmung mit 57.4% Ja‐Stimmen angenommen (Staatskanzlei Solothurn 2010). 4.2.6 Analyse der determinierenden Faktoren für die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien im Kanton Solothurn Sozio‐ökonomische Faktoren F1 (sozio‐ökonomischer Wandel): Das Modell der Ergänzungsleistungen für Familien des Kantons Solothurn ist auf Working‐Poor‐Familien ausgerichtet. Dass die Unterstützung dieser spezifischen Gruppe ins Auge gefasst wurde, ergibt sich aus dem sozio‐ökonomischen Kontext mit einer überdurchschnittlichen Working‐Poor‐Quote in einem Kanton, der ansonsten bezüglich ökono‐ mischer und sozialer Lage in etwa dem Schweizer Durchschnitt entspricht. F2 (konjunkturelle Lage): Die Lancierung der Vorlage fiel in eine konjunkturell gute Phase, die Debatte im Parlament fand während der Finanzkrise statt. Diese hat aber nicht zu einer Verschärfung der Armutsproblematik im Untersuchungszeitraum geführt. Der finanzielle Spielraum wurde zwar von einigen Parteien thematisiert, entscheidend war aber der Entscheid der Finanzkommission, die den finanziellen Spielraum als gegeben erachtete. Grundsätzlich war der finanzielle Spielraum zu diesem Zeitpunkt grösser als in den Jahren nach der Kantonalbankkrise im Kanton Solothurn. F3 (Problem erkannt und definiert): Mit der Problematik der Working Poor und der damit einhergehenden Familienarmut setzt sich auch der kantonale Sozialbericht 2005 auseinander, auf den in der parlamentarischen Debatte mehrfach hingewiesen wurde. Der Sozialbericht wurde nur sechs Tage vor dem CVP‐Antrag publiziert, die Ergänzungsleistungen für Familien waren aber schon vorher auf den Legislaturprogrammen von SP und CVP (CVP Solothurn 2004, SP Solothurn 2010). Ausserdem hat der Sozialbericht kein grosses Medienecho und auch keine Debatte zwischen den Parteien ausgelöst (Interview C). Es kann deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass der Sozial‐ bericht ein bisher nicht als solches erkanntes Problem ins öffentliche Interesse gerückt und damit ein Problembewusstsein geschaffen hat. Es wäre deshalb übertrieben, in diesem Zusammenhang von einem Window of Opportunity zu sprechen. Aber die erhöhte Zahl von Working Poor wurde als Problem wahrgenommen, was durch den Sozialbericht unterstützt und noch einmal betont wurde. Interessen‐ und konflikttheoretische Faktoren F4a (Stärke von SP und CVP im Parlament): Bei der Debatte um die Ergänzungsleistungen für Familien zeigten sich im Parlament die klassischen Koalitionen der Sozialpolitik. Auf der Befürworter‐ seite die sozial‐ und christdemokratischen Parteien, auf der Gegnerseite die liberalen und wert‐ konservativen Kräfte. Obwohl die Vorlage stark auf Arbeitsanreize abstellt und mit dem Einbezug der 62 Krippenkosten auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern will, kam keine sogenannt neue Allianz entlang der Wertachse libertär‐autoritär zustande, d.h. die FDP konnte nicht für die Vorlage gewonnen werden. Aufgrund ihrer stärkeren Position im Parlament konnte sich die Koalition aus SP, CVP und Grünen in einer äusserst knappen Abstimmung durchsetzen. Es zeigt sich also, dass im Kanton Solothurn die Stärke der klassischen Wohlfahrtsstaatsparteien ausschlaggebend war für die Einführung der neuen Leistung. Allerdings war die Gegnerseite im Parlament konsequent und wortstark, nicht aber in den Kommissionen. Dort verhielt sich die SVP sehr passiv und sowohl Vertreter der SVP als auch der FDP enthielten sich der Stimme oder stimmten der Vorlage gar zu. F4b (Stärke von SP und CVP im Parlament, Departementsvorstand): CVP und SP verfügten über eine Mehrheit im Regierungsrat des Kantons Solothurn, das zuständige Departement wurde von SP‐ Regierungsrat Peter Gomm präsidiert. Aber auch FDP‐Regierungsrätin Esther Gassler hat sich für die Vorlage stark gemacht. Gomm hat die Vorlage vorangetrieben, um sie noch vor den Kantonsrats‐ wahlen ins Parlament zu bringen. Das hat zwar nicht ganz geklappt, aber trotzdem wurde das Gesetz in relativ kurzer Zeit erarbeitet und behandelt. Dass FDP‐Frau Esther Gassler eine konsequente Befürworterin der Vorlage war, hat sicher zu deren Akzeptanz beigetragen. Ihre Argumente basierten dabei durchaus auf liberalem Gedankengut (Interview B/C). Die Rolle von Gassler zeigt auch ihre Unabhängigkeit als vom Volk gewählte Regierungsrätin, die es ihr erlaubt, sich gegen ihre Partei zu stellen. Damit war nicht unbedingt die Mehrheit im Regierungsrat von Bedeutung, sondern die beiden Persönlichkeiten Gomm (SP) und Gassler (FDP). F5 (Verbände und Organisationen): Im Kanton Solothurn gibt es keine Organisationen, die zum Zeitpunkt der Vorlage im Bereich der Familienpolitik Lobbyarbeit leisteten. Die Gewerkschaften äusserten sich im Vernehmlassungsverfahren positiv, spielten ansonsten aber keine Rolle. Die Arbeit‐ geber konnten trotz Anreizelementen und Kostenneutralität für die Arbeitgeber nicht für die Vorlage gewonnen werden. Ihr Einfluss kann aber auch als eher gering eingestuft werden. Institutionelle Faktoren F6 (konsensorientierte/konfliktive Gremien): Im Kanton Solothurn fand die Verhandlung über die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien anders als im Tessin primär innerhalb parlamen‐ tarischer Gremien statt, die von parteipolitischen Interessen geprägt sind. F7 (direkte Demokratie): Im Kanton Solothurn kam die direkte Demokratie in Form eines obliga‐ torischen Gesetzesreferendums zum Zug. Dabei hat sich aber nicht die gemäss der Theorie zu erwartende Bremswirkung eingestellt. Vielmehr ergab sich nach dem sehr knappen Entscheid im Parlament ein komfortabler Ja‐Stimmenanteil von 57%. Dabei ist dieses Resultat nicht nur auf ein 63 parteiübergreifendes Prokomitee von CVP, SP, EVP, Grünen und GLP zurückzuführen (Überpar‐ teiliches Komitee Solothurn 2010), sondern auch auf die lückenhafte Opposition. Die SVP verhielt sich im Abstimmungskampf sehr passiv und die FDP trat gegen ihre eigene Regierungsrätin an. F8 (familienpolitische Tradition): Der Kanton Solothurn hat im Bereich der Familienpolitik bisher nur sehr wenig umgesetzt. Aber die familienpolitische Diskussion wurde bereits im Rahmen des Elternbeitragsgesetzes geführt und führte zu einer Wahrnehmung der Familie als öffentliche Angelegenheit (Interview C). Bei der Vorlage zu den Ergänzungsleistungen wurde die Problematik von Staatseingriffen in die Familie nur noch von der SVP aufgegriffen und blieb ein Randthema (Kantons‐ rat Solothurn 2009). Einen direkten Einfluss hatte das Elternbeitragsgesetz von 1993 aber nicht. Obwohl es ebenfalls eine Bedarfsleistung für einkommensschwache Familien vorsah, wurde weder in der Debatte noch bei der Ausarbeitung der neuen Vorlage Bezug genommen auf das Eltern‐ beitragsgesetz. Der konkrete Inhalt des Elternbeitragsgesetzes war der Arbeitsgruppe nicht bekannt (Interview C). 4.2.7 Fazit Die Fallstudie des Kantons Solothurn zeigt, dass die Vorlage vor dem Hintergrund einer hohen Working‐Poor‐Quote lanciert wurde. Im Rahmen der Legislaturplanung von der CVP initiiert, beauftragte der Regierungsrat eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung eines Gesetzesvorschlags. Bereits in der Vernehmlassung zeichnete sich eine klassische links‐rechts Koalition ab. Die eigentliche Debatte fand aber primär in parlamentarischen Gremien statt. Während die FDP in den parlamentarischen Kommissionen das Gesetz noch nicht konsequent ablehnte, nahm sie im Parlament eine klare Gegenposition ein. Das Gesetz konnte sich schliesslich dank der Stärke der linken Parteien in einer knappen Abstimmung durchsetzen, musste aber dem Volk unterbreitet werden. Die SVP verhielt sich während des ganzen Prozesses sehr passiv, so dass auch der Ab‐ stimmungskampf primär von der FDP geführt wurde. Diese traf aber auf parteiinterne Opposition und die Vorlage wurde schliesslich vom Volk angenommen. Entscheidenden Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess hatten die Regierungsräte Gomm (SP) und Gassler (FDP). Während ersterer die Vorlage konsequent vorangetrieben hat, setzte sich letztere gegen die Haltung ihrer Partei für die Vorlage ein. Damit kann abschliessend festgehalten werden, dass im Kanton Solothurn primär die Stärke von SP und CVP, sowie engagierte Regierungsräte vor dem Hintergrund einer gut dokumen‐ tierten sozio‐ökonomischen Notwendigkeit dazu beigetragen haben, dass Ergänzungsleistungen für Familien eingeführt werden konnten. 64 4.3 Obwalden Der Kanton Obwalden hat sich bereits vor dem Kanton Solothurn mit den Ergänzungsleistungen für Familien auseinandergesetzt. Lanciert wurde das Thema infolge einer Volksinitiative im Jahr 2000. Eingebettet in den breiteren Rahmen eines Familienleitbildes, wurde das Projekt der Ergänzungs‐ leistungen 2006 aber vom Parlament beerdigt. Der Kanton Obwalden wollte sich ebenfalls am Tessiner Modell orientieren, wobei das Gewicht aber schon bald auf die Einführung einer Klein‐ kinderbetreuungszulage analog zu den assegni di prima infanzia gelegt wurde. Da im Kanton Obwalden nicht der Begriff der Ergänzungsleistungen gebraucht wurde, sondern von einer Klein‐ kinderbetreuungszulage (und zu Beginn auch noch von einer Familienzulage) gesprochen wurde, soll im Folgenden auch diese Begrifflichkeit verwendet werden. 4.3.1 Sozio‐ökonomischer Kontext Der Kanton Obwalden hatte im Jahr 2006 33‘800 Einwohner. Im Jahr 2000 waren es 32‘400 in 12‘700 Haushalten, wovon 5‘000 Haushalte mit Kindern waren. Die Geburtenziffer im Kanton Ob‐ walden entspricht seit 2000 dem Schweizer Durchschnitt, während sie vorher stets darüber lag (Bundesamt für Statistik 2010a). Der Kanton Obwalden ist stark landwirtschaftlich geprägt, was sich in einem tiefen Urbanisierungs‐ grad und einem vergleichsweise hohen Anteil an Arbeitnehmenden im ersten Sektor zeigt. Obwalden hat eine der tiefsten Arbeitslosenquoten der Schweiz, abgesehen von den Krisenjahren der 90er stieg die Arbeitslosigkeit nie über 2%. Der Kanton Obwalden hat damit nie viel gespürt von den konjunkturellen Schwankungen der schweizerischen Wirtschaft. Jedoch ist das Einkommen pro Kopf im schweizerischen Vergleich relativ tief, was teilweise auf den hohen Landwirtschaftsanteil zurück‐ zuführen ist (Bundesamt für Statistik 2010a/b, Interview D). Die schweizerische Sozialhilfestatistik liefert erst seit dem Jahr 2005 Daten. Frühere Daten mit Hinweisen auf das Ausmass der Armut im Kanton Obwalden liegen nicht vor. In der Sozialhilfestatistik weist Obwalden zusammen mit dem Nachbarkanton Nidwalden stets die schweizweit tiefste Sozial‐ hilfequote auf (Bundesamt für Statistik 2008b:6). 4.3.2 Familienpolitischer Kontext Bereits in den 1970er Jahren hat der Kanton Obwalden ein Jugendhilfegesetz eingeführt, das damals als fortschrittliches Gesetz wahrgenommen wurde und auf die Beratung von Jugendlichen abstellte, um die Familien zu unterstützen. Abgesehen davon und insbesondere in Bezug auf die 65 finanzielle Unterstützung von Familien, bestand die Familienpolitik des Kantons Obwalden im Vollzug der Bundesgesetze (Interview D). Die Initiative zu den Ergänzungsleistungen für Familien markierte damit zusammen mit anderen Vorstössen den Beginn einer kantonalen Familienpolitik in Obwalden. Da auch im Kanton Nidwalden verschiedene Vorstösse vorlagen, beschlossen die Regierungen der Kantone Ob‐ und Nidwalden, gemeinsam Familienleitsätze zu formulieren und eine Konzeption für die Umsetzung einer kohä‐ renten Familienpolitik zu erarbeiten (Kommission Familienleitbild Ob‐ und Nidwalden 2003: 4f.). Das Familienleitbild erschien 2003 und postuliert ein familienpolitisches Dreisäulenmodell, wobei die soziale Sicherheit, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Familienberatung je eine Säule darstellen. Die Kleinkinderbetreuungszulage im Kanton Obwalden war damit eingebettet in den breiteren Kontext des Familienleitbildes, das eine ganze Reihe von Massnahmen vorsah, wobei die Kleinkinderbetreuungszulage zusammen mit der Forderung nach einer Fachstelle für Familienfragen das Herzstück des Familienleitbildes bildete (Interview D/E). 4.3.3 Institutionen und Akteure Das Parlament des Kantons Obwalden (Kantonsrat) zählt 55 Mitglieder. Die traditionell stärkste Partei ist die CVP, die beinahe die Hälfte der Sitze auf sich vereinigen kann. Die restlichen Sitze teilen sich die FDP, die SP und die SVP mit der CSP. Die CSP Obwalden entstand als Partei der christlichen Gewerkschaften. Bis 2002 war sie Mitglied der CVP Schweiz, wo sie sich im linken Flügel der CVP engagierte. Heute ist sie assoziiertes Mitglied der CSP Schweiz. Der Wechsel erfolgte, weil die CSP im eigenen Kanton gegen die CVP antrat und sich zu wenig unterstützt fühlte in Bezug auf ihre Nationalratskandidaturen (CSP Obwalden 2007). Dadurch, dass die CSP die linke Wählerklientel der CVP bedient, ist die CVP Obwalden innerhalb der CVP Schweiz eher am rechten Rand anzusiedeln (Interview D). SP und SVP sind eher schwach vertreten, beide Parteien sind im Kanton Obwalden noch jung. Die SVP wurde 1999 gegründet, die SP ebenfalls zu dieser Zeit (SVP Obwalden 2009, Interview D). Gemäss Ladner (2004) gehört das Parteiensystem des Kantons Obwalden wie alle Inner‐ schweizer Parteiensysteme in die Gruppe der rechts‐zentrierten Zweieinhalbparteiensysteme. T 6 Kräfteverhältnisse im Obwaldner Parlament zwischen 1998 und 2010 Wahljahr 1998 2002 2006 CVP FDP CSP SP 25 21 23 13 11 10 8 10 10 7 8 6 Quelle: Staatskanzlei Obwalden 2006:10 66 SVP 0 7 6 Die Bedeutung der Familienpolitik wird von den Parteien im Kanton Obwalden unterschiedlich gewichtet und auch die Perspektiven sind unterschiedlich. Die CVP ist abgesehen von einigen Exponentinnen in ihren familienpolitischen Positionen eher zurückhaltend, während es im Kanton Obwalden die CSP ist, die sich verstärkt für die Familien einsetzt (Interview D). Die Familienpolitik bildet bei der CVP seit 1998 eines von vielen Themenfelder, die Einführung der Kleinkinder‐ betreuungszulage wird aber im Parteiprogramm für 2006‐2010 erstmals explizit als Ziel der CVP angeführt (CVP Obwalden 2006, 2002, 1998). Die FDP plädiert für Eigenverantwortung und Soli‐ darität im privaten Rahmen, ist aber auch überzeugt, dass es staatliche Rahmenbedingungen braucht, um die Situation von Zweielternfamilien und Alleinerziehenden zu verbessern. Für die FDP stehen Massnahmen im Vordergrund, welche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Sie unterstützt aber auch die Einführung der Kleinkinderbetreuungszulage, wobei sie mit dem Finan‐ zierungsmodell nicht einverstanden ist (FDP Obwalden 2004). SP und SVP nehmen ihre traditionellen familienpolitischen Positionen ein. Die SP sieht Familienfreundlichkeit als zentrales Anliegen und spricht sich von allen Parteien am stärksten für die Einführung der Kleinkinderbetreuungszulage aus, sie hat das Thema auch lanciert (Kantonsrat Obwalden 2005a:19). Die SVP schreibt die Familie grundsätzlich dem privaten Bereich zu und betont die Eigenverantwortung, spricht sich aber für steuerliche Erleichterungen für Familien aus (SVP Obwalden 2001:9, 2006:10). Der Regierungsrat des Kantons Obwalden hat fünf Mitglieder und setzte sich vor 2002 aus zwei Vertretern der FDP, zwei Vertretern der CVP und einem Vertreter der CSP zusammen. Seit 2002 gingen jeweils zwei Sitze an CVP und CSP und ein Sitz an die FDP. Erst infolge Ersatzwahlen ist die FDP zu einem zweiten Sitz im Regierungsrat gekommen. Ein eigentliches Departement für soziale Angele‐ genheiten gibt es nicht. Die Sozialversicherungen sind dem Volkswirtschaftsdepartement unterstellt, während das kantonale Sozialamt dem Sicherheits‐ und Justizdepartement angegliedert ist. Das Familienleitbild und die Kleinkinderbetreuungszulage unterstanden dem Sicherheits‐ und Justizde‐ partement, das bis 2006 von Elisabeth Gander (FDP) und anschliessend von Esther Gasser (ebenfalls FDP) geleitet wurde (Rechtsdienst Obwalden 2010). Gasser kam aber erst, als die neue Kosten‐ schätzung bereits vorlag (Interview E). Die Verbände und Organisationen haben im Kanton Obwalden keinen oder nur geringfügig Einfluss genommen auf den Prozess zur Einführung der Kleinkinderbetreuungszulage. Die Arbeit‐ geberseite war über den Gewerbeverband in der Kommission Familienleitbild vertreten, wobei dieser Vertreter die Kleinkinderbetreuungszulage stark unterstützt hat, Lobbying wurde allerdings von der Arbeitgeberseite nicht betrieben. Die Gewerkschaften haben sich nicht geäussert (Interview E, Regierungsrat Obwalden 2005:6). Die Familienorganisationen sind auf politischer Ebene kaum von Bedeutung (Interview D). 67 4.3.4 Die Obwaldner Vorlage zur Einführung einer Kleinkinderbetreuungszulage Ein konkretes Obwaldner Modell wurde nicht ausgearbeitet. Die folgenden Angaben wurden denn auch nicht explizit in einem Gesetzesentwurf festgehalten, sondern ergeben sich aus Berichten oder den Ausführungen des Regierungsrats oder des Kommissionspräsidenten im Parlament und bleiben zuweilen vage. Prävention von Kinderarmut (Kommission Familienleitbild Ob‐ und Nid‐ Ziele walden 2003:39). Anspruch Im Familienleitbild wird vom vollendeten vierten Altersjahr gesprochen, im Bericht des Regierungsrates wird schliesslich der Kindergarteneintritt und somit das vollendete fünfte Altersjahr als Bedingung definiert. Ausserdem muss die Familie mindestens drei Jahre im Kanton wohnhaft sein (Kantons‐ rat Obwalden 2005b). Höhe der Leistung Die Höhe der Leistung soll sich an den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV orientieren (Kommission Familienleitbild Ob‐ und Nidwalden 2003:39). Bei den Kostenschätzungen wurden aber verschiedene Modelle geprüft, die sich auch an anderen Sozialleistungen orientieren. So wurden Modelle ge‐ schätzt, die sich am Existenzminimum der Sozialhilfe orientieren oder sich an die Alimentenbevorschussung oder die Mutterschaftsbeihilfe anlehnen (Regierungsrat Obwalden 2006). Finanzierung Für die Finanzierung sind Einsparungen in der Sozialhilfe und bei den allgemeinen Kinderzulagen vorgesehen. Weiter ist eine Finanzierung durch den Kanton vorgesehen (Sozialamt Obwalden 2003:13). Die Modell‐ schätzungen im Jahr 2006 zeigen, dass es einer massiven Finanzierung durch Kanton und Gemeinden bedürfte (Regierungsrat Obwalden 2006). 4.3.5 Gesetzgebungsprozess 03.07.2000 Die SP reicht eine Volksinitiative ein, welche die Einführung von Ergänzungsleis‐ tungen für einkommensschwache Familien fordert. Die vorberatende Kommission beschliesst darauf eine vertiefte Prüfung der Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien gemäss Tessiner Modell und reicht ein entsprechendes Postulat ein (Regierungsrat Obwalden 2005:1). 68 21.09.2000 Kantonsrätin Susanne Gasser‐Scheuermeier (CVP) reicht ein Postulat zur Situation der Familien in Obwalden ein, welches verschiedene konkrete Fragen auflistet. Es wird am 27.10.2000 vom Kantonsrat für erheblich erklärt (Regierungsrat Obwalden 2005:1). 15.3.2001 Das Postulat zum Tessiner Modell wird angenommen, worauf die Initiative zurückgezogen wird (Regierungsrat Obwalden 2005:1). Das Thema wird nicht vor dem Hintergrund der Familienarmut lanciert, Entlastung der Sozialhilfe ist auch kein Thema, vielmehr soll etwas getan werden um Familien, am liebsten klassische Familienformen, zu unterstützen. Dafür engagierten sich vor allem starke Exponent‐ innen von CVP und SP, die auch national gut vernetzt und informiert waren, wie Paula Halter (CVP), Susanne Gasser‐Scheuermeier (CVP), Heidi Wernli Gasser (SP) (Interview D). 24.09.2001 Da im Kanton Nidwalden zur selben Zeit verschiedene familienpolitische Vorstösse hängig waren, beauftragt der Regierungsrat das Gesundheits‐ und Sozial‐ departement, ein Familienleitbild zu verfassen und zwar in Zusammenarbeit mit der Gesundheits‐ und Sozialdirektion des Kantons Nidwalden. Um das von der vor‐ beratenden Kommission Familieninitiative beschlossene Postulat erfüllen und eine Prüfung von Bedarfsleistungen nach dem Tessiner Modell vornehmen zu können, erteilt der Regierungsrat zudem den Auftrag, einen Bericht zum Tessiner Modell für den Kanton Obwalden zu erstellen (Regierungsrat Obwalden 2005:1f.). Um diese Aufträge auszuführen, werden zwei neue, kantonsübergreifende Gremien einbe‐ rufen. Zum einen die Kommission Familienleitbild, bestehend aus 13 Personen, darunter die Leiter der Sozialämter sowie Vertreter der Ämter für Volksschulen der beiden Kantone. Ausserdem je eine Vertreterin des katholischen Frauenbundes, zwei Gemeinderäte und Vertreter der Arbeitgeberseite. Diese Kommission befasste sich mit den gesellschaftlichen Werten und den familienpolitischen Zielen, sowie mit der Abklärung der aktuellen Situation. Für das Erarbeiten des Inventars, die Beurteilung der Versorgung sowie die Formulierung von Massnahmen war eine departements‐ übergreifende Arbeitsgruppe der Verwaltung zuständig. Darin vertreten waren die Ausgleichskassen, die Finanzdepartemente und Sozialämter beider Kantone. Verant‐ wortlich für die Verfassung von Leitbild und Grundlagenbericht war die Kommission Familienleitbild. Für den Bericht zur Umsetzung des Tessiner Modells war die Arbeits‐ gruppe zuständig (Kommission Familienleitbild Ob‐ und Nidwalden 2003:3‐6). 69 02‐10.2002 Die Kommission Familienleitbild nimmt die Analyse der Situation der Familien in Ob‐ walden und Nidwalden vor, während die Arbeitsgruppe Grundlagen zeitgleich das Inventar und die Beurteilung der Versorgung vornimmt (Kommission Familienleitbild Ob‐ und Nidwalden 2003:7). 31.01.2003 Die Regierungsräte Elisabeth Gander (FDP) und Leo Odermatt (Regierungsrat Nid‐ walden), sowie die Mitglieder der Kommission Familienleitbild und die Mitglieder der Arbeitsgruppe besuchen den Kanton Tessin, um die Familienpolitik vor Ort kennen‐ zulernen (Kommission Familienleitbild Ob‐ und Nidwalden 2003:7). Dabei ist auch bereits die operative Umsetzung einer möglichen Bedarfsleistung nach dem Tessiner Modell ein Thema (Interview E). 11.02‐06.2003 Die Kommission Familienleitbild formuliert die Leitsätze, während die Arbeitsgruppe Massnahmen ausarbeitet (Kommission Familienleitbild Ob‐ und Nidwalden 2003:7). 10.2003 Das Familienleitbild und der Grundlagenbericht können von der Kommission Familienleitbild abgeschlossen werden. Zeitgleich wird der Bericht zum Tessiner Modell vorgelegt (Regierungsrat Obwalden 2005:2). Im Bericht zum Tessiner Modell wird die Einführung einer Kleinkinderbetreuungs‐ zulage analog zum Tessiner Modell vorgeschlagen für Familien mit Kindern unter 4 Jahren. Der Aufwand wird auf 450‘000‐600‘000 Franken geschätzt. Zudem wird die Einführung einer Familienzulage für Familien mit Kindern über 4 Jahren und unter 15 Jahren als wünschenswert bezeichnet. Die Kommission weist aber darauf hin, dass die Einführung der Kleinkinderbetreuungszulage prioritär zu behandeln sei (Regierungsrat Obwalden 2005:4f.). Es wird empfohlen das Gesetz auf sieben Jahre zu beschränken. Ausserdem wird darauf hingewiesen, dass bei der Übernahme dieses Modells der Kindergartenbesuch ab 4 Jahren möglich sein muss. Zur Finan‐ zierung wird vorgeschlagen, die allgemeine Kinderzulage nicht mehr zu erhöhen. Die restliche Finanzierung muss über Steuern erfolgen (Sozialamt Obwalden 2003:13). Das Familienleitbild10 listet Massnahmen in den drei Bereichen finanzielle Sicherheit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Beratung auf. Als Einführung in den Massnahmenteil wird die Tessiner Familienpolitik dargestellt als Beispiel einer univer‐ sellen Familienpolitik. Das Familienleitbild übernimmt die Empfehlungen aus dem 10 Obwohl das Familienleitbild von beiden Kantonen gemeinsam ausgearbeitet wurde, erfolgte die anschliessende Be‐ handlung völlig unabhängig, weshalb die Vorgänge im Kanton Nidwalden für diese Untersuchung nicht beachtet werden müssen (Interview D). 70 Bericht zum Tessiner Modell. Neben der Einführung der Kleinkinderbetreuungszulage wird auch hier die Familienzulage als wünschenswert empfohlen, Priorität wird aber der Kleinkinderbetreuungszulage zugeschrieben, wofür gesetzliche Grundlagen ge‐ schaffen werden sollen (Kommission Familienleitbild Ob‐ und Nidwalden 2003). Frühling 2004 Familienleitbild und Grundlagenbericht werden in die Vernehmlassung geschickt. Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden (18 Zustimmungen, 4 teilweise Zu‐ stimmungen, bei 27 Teilnehmenden) spricht sich für die Einführung von Kleinkinder‐ betreuungszulagen aus und betrachtet diese mehrheitlich als vordringlich gegenüber anderen Massnahmen. Eher kritisch wird die Finanzierung beurteilt (Regierungsrat Obwalden 2005:5f.). 01.02.2005 Der Kantonsrat erklärt das Postulat von Heidi Wernli Gasser (SP) für erheblich, das in der Familienpolitik „Taten statt Worte“ fordert und den Regierungsrat dazu aufruft, das Familienleitbild noch im Jahr 2005 mit Bericht und Antrag dem Kantonsrat zu unterbreiten (Regierungsrat Obwalden 2005:1). 21.06.2005 Der Regierungsrat empfiehlt in seinem Bericht zur Familienpolitik, auf die Einführung einer Kleinkinderbetreuungszulage zu verzichten. Zum einen führt er an, dass die Altersgrenze der Kinder problematisch sei, weil im Kanton Obwalden der Kinder‐ gartenbesuch nicht mit 4 Jahren möglich ist. Zudem würde die Sozialhilfe nicht umfassend entlastet. Ausserdem sei durch die Erhöhung der Kinderzulagen durch den Bund der finanzielle Spielraum für neue Leistungen nicht mehr gegeben. Zu guter Letzt wird darauf hingewiesen, dass die weiteren diesbezüglichen Vorgänge auf Bundesebene abzuwarten seien. Neben der Kleinkinderbetreuungszulage wird aber auch eine Reihe anderer Massnahmen negativ bewertet, grundsätzlich sieht der Regierungsrat wenig Handlungsbedarf (Regierungsrat Obwalden 2005:10f.,17). 22.09.2005 Die vorberatende parlamentarische Kommission bewertet den Bericht des Regierungsrates kritisch, sie findet die Anträge zu wenig konkret und hat den Eindruck, dass der Regierungsrat nicht schnell genug vorgehen will. Ausserdem ist die Kommission nicht damit einverstanden, dass auf die Einführung der Kleinkinder‐ betreuungszulage verzichtet und auch kein Fachgremium eingesetzt werden soll. Die Kommission ist überzeugt, dass auf Bundesebene nichts zu erwarten ist. Trotzdem spricht sich die Kommission mit 12 zu 1 Stimmen für das Eintreten auf den regierungsrätlichen Bericht aus, beschliesst aber, gleichzeitig beim Kantonsrat eine Motion einzureichen, die den Regierungsrat zu einer aktiven Familienpolitik ver‐ 71 pflichtet. Die Motion beinhaltet unter Verweis auf die breite Abstützung in der Vernehmlassung auch den Auftrag, die nötigen Schritte für die Einführung einer Kleinkinderbetreuungszulage einzuleiten (Kantonsrat Obwalden 2005a). Die Motion fordert konkret die Ausarbeitung einer gesetzlichen Grundlage unter Berück‐ sichtigung bestimmter von der Kommission festgelegter Eckwerte. Diese fordern die Anlehnung an das Berechnungssystem der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und die Ausrichtung der Leistung bis zum Eintritt in den Kindergarten, sowie eine dreijährige Wohndauer im Kanton als Anspruchsbedingung. Ausserdem ist die Finanzierung zu prüfen und die Frage der Anknüpfung an einen Erwerb zu klären (Kantonsrat Obwalden 2005b). 18.10.2005 Die schriftliche Antwort des Regierungsrats auf die Motion der vorberatenden Kom‐ mission verweist auf die Arbeit des Regierungsrats im Bereich der Familienpolitik (Prämienverbilligung, Erhöhung der Kinderzulagen, neue Bildungsgesetzesvorlage, Steuerabzüge). Ein Drittel der Antwort bezieht sich auf die Kleinkinderbetreuungs‐ zulage. Der Regierungsrat argumentiert, dass eine derartige Leistung volkswirt‐ schaftlich in die falsche Richtung geht, weil sie nicht dazu beiträgt, dass Frauen Kinder haben und zugleich erwerbstätig bleiben. Der Kanton Obwalden wäre der einzige Kanton in der Zentralschweiz mit einer derartigen Leistung, es wird Sozial‐ tourismus befürchtet. Der Regierungsrat schätzt die Kosten auf 820‘000 Franken und verweist auf die kritische Frage nach der Finanzierung. Trotz dieser Bekräftigung der bereits im Bericht gemachten Einwände, ist der Regierungsrat einverstanden, den Motionsauftrag entgegen zu nehmen (Kantonsrat Obwalden 2005a:34f.). 27.10.2005 Der Kantonsrat diskutiert das Familienleitbild und die Motion der vorberatenden Kommission. Bis auf die SVP kritisieren alle Parteien den Bericht des Regierungsrates zur Familienpolitik massiv und sprechen sich sehr klar für die Einführung der Kleinkinderbetreuungszulage aus. Dabei wird vor allem auf die Anerkennung und Wertschätzung von Familien hingewiesen, aber auch darauf, dass den Eltern die Möglichkeit gegeben werden soll, ihre Kinder selber zu betreuen. Die SP sieht die Familienpolitik auch als Standortvorteil im interkantonalen Wettbewerb. Trotz Kritik wird ohne Gegenstimme beschlossen, das Familienleitbild zur Kenntnis zu nehmen und die darin enthaltenen Anträge des Regierungsrates zu genehmigen. Die Motion der vorberatenden Kommission, die den Regierungsrat beauftragt, die Einführung einer Kleinkinderbetreuungszulage vorzubereiten, wird mit 45 zu 7 Stimmen 72 angenommen. Damit haben alle Parteien bis auf die SVP der Motion zugestimmt (Kantonsrat Obwalden 2005). 17.10.2006 Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat den geforderten Bericht zur Einführung der Kleinkinderbetreuungszulage. Dabei wird aber nicht eine ausge‐ arbeitete Gesetzesgrundlage präsentiert, sondern es werden vier Modelle vorgestellt und deren geschätzte Kosten ausgewiesen. Die Kosten fallen dabei massiv höher aus, als aufgrund der ersten Schätzungen von 2003 angenommen wurde. Der Regierungs‐ rat beantragt deim Kantonsrat, auf die Einführung der Kleinkinderbetreuungszulage zu verzichten und „den Regierungsrat vom Auftrag zu entlasten, eine gesetzliche Grundlage […] zu erarbeiten“ (Regierungsrat Obwalden 2006:1). Neben den uner‐ wartet hohen Kosten, begründet der Regierungsrat seinen Antrag auch mit der Ungleichbehandlung aufgrund der Exportierbarkeit der Leistung, der Befürchtung von Sozialtourismus und ausserdem einem Anreiz in die falsche Richtung. Zu unterstützen seien vielmehr Vorlagen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zudem wird auf die vorgesehenen steuerlichen Entlastungen für Familien verwiesen (Regierungsrat Obwalden 2006:5f.). Das Parlament beschliesst mit 41 zu 8 Stimmen, auf den Bericht einzutreten, wobei sich die SP dagegen ausspricht. Abgesehen von der SVP, die ein weiteres Mal darauf verweist, dass sich der Staat nicht in die Familie einmischen soll, bedauern alle Parteien die neue Ausgangslage sehr, aber erachten die Vorlage als nicht finanzierbar. So argumentiert auch die vorberatende parlamen‐ tarische Kommission. Sie betont die gute Qualität der Kostenschätzung und überlegt bereits, wie man Familien anders entlasten könnte. Mit 31 zu 0 Stimmen wird schlussendlich dem Bericht des Regierungsrates zugestimmt. Der Motionsauftrag vom 27. Oktober 2005 für die Schaffung einer Grundlage für die Ausrichtung einer Kleinkinderbetreuungszulage wird abgeschrieben (Kantonsrat Obwalden 2006). 4.3.6 Analyse der determinierenden Faktoren für die Ablehnung der Kleinkinderbetreuungszulage im Kanton Obwalden Sozio‐ökonomische Faktoren F1 (sozio‐ökonomischer Wandel): Im Kanton Obwalden ist der sozio‐ökonomische Problemdruck eher tief. Die Debatte nahm zwar Bezug auf neue Familienformen, die Einführung einer Kleinkinder‐ betreuungszulage wurde aber nicht mit konkreter sozio‐ökonomischer Notwendigkeit im Kanton Obwalden begründet. Vielmehr wollte man etwas für die Familien tun und zwar am ehesten für die traditionelle Familie (Interview D, Kantonsrat Obwalden 2005a:17‐20). 73 F2 (konjunkturelle Lage): Während des ganzen Untersuchungszeitraumes war die konjunkturelle Lage gut. Ausserdem haben sich auch wirtschaftliche Krisen im Kanton Obwalden jeweils nur un‐ wesentlich auf Arbeitslosigkeit und Armutsproblematik ausgewirkt. F3 (Problem erkannt und definiert): Im Kanton Obwalden herrschte keine sozio‐ökonomische Notwendigkeit und es gab auch keine gravierenden Veränderungen oder neue Erkenntnisse, die ein Problem sichtbar gemacht hätten (Interview E). Die grosse Diskrepanz zwischen der ersten und der zweiten Kostenschätzung hat auch gezeigt, dass die finanzielle Situation der Familien im Kanton Obwalden zu Beginn des Gesetzgebungsprozesses nicht richtig eingeschätzt wurde. Jedoch wurden zur gleichen Zeit andere familienpolitische Vorstösse eingereicht, so dass der Handlungsbedarf im Bereich der Familienpolitik zusätzlich unterstrichen wurde und das Projekt der Kleinkinder‐ betreuungszulage schlussendlich in eine grundlegendere familienpolitische Debatte eingebettet war. Interessen‐ und konflikttheoretische Faktoren F4a (Stärke von SP und CVP im Parlament): CVP, CSP und SP verfügen im Parlament des Kantons Obwalden über eine stabile Mehrheit. Die Vorlage ist denn auch nicht an der Schwäche sozial‐ demokratischer und christdemokratischer Parteien gescheitert. Vielmehr herrschte bis 2006 ein breiter Konsens über die Notwendigkeit einer Kleinkinderbetreuungszulage. Bis auf die SVP sprachen sich alle Parteien klar für die Einführung einer solchen Leistung aus. Als dann die neue Kosten‐ schätzung vorlag, waren sich wiederum alle einig, dass die Vorlage nicht umsetzbar ist und deshalb bedauerlicherweise fallengelassen werden muss. Im Fall des Kantons Obwalden ergab sich also keine klassische links‐rechts Spaltung. Vielmehr herrschte ein breiter Konsens, der aufgrund zusätzlicher Information ins Gegenteil kippte. F4b (Stärke von SP und CVP im Regierungsrat, Departementsvorstand): CVP und CSP verfügen über drei von fünf Sitzen in der Regierung, die SP ist gar nicht vertreten. Damit herrscht im Regierungsrat eine christdemokratische Mehrheit. Das zuständige Departement hat aber die FDP inne. Dabei gilt es nun aber zwei Dinge hervorzuheben. Die Departementsvorsteherin der FDP setzte sich für die Kleinkinderbetreuungszulage ein, indem sie Lobbyarbeit in der Regierung leistete und die Vorlage vorantrieb. Ausserdem war sie gut vernetzt (Interview E). Trotzdem hat sich der Gesamt‐ regierungsrat konsequent gegen die Kleinkinderbetreuungszulage ausgesprochen und musste vom Parlament mehrmals aufgefordert werden, eine Vorlage auszuarbeiten. Und auch dann wurde zuerst eine Kostenschätzung gemacht, die das Projekt schliesslich zum Scheitern verurteilte. 74 F5 (Verbände und Organisationen): Familienpolitische Organisationen sind auf politischer Ebene nicht von Bedeutung im Kanton Obwalden und auch die Gewerkschaften nahmen keinen Einfluss. Die Arbeitgeber waren der Vorlage gegenüber aber, anders als in anderen Kantonen, positiv eingestellt. Institutionelle Faktoren F6 (konsensorientierte/konfliktive Gremien): Im Kanton Obwalden haben sich im Rahmen des Familienleitbildes eine ausserparlamentarische Kommission, in der alle relevanten Interessen vertreten waren, sowie eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe mit der Kleinkinderbetreuungszulage und der Übertragung des Tessiner Modells auf den Kanton Obwalden beschäftigt. Die Behandlung der Kleinkinderbetreuungszulage lag aber mit dem Bericht zum Tessiner Modell eher bei der Arbeits‐ gruppe. Konkrete Eckwerte zur Ausgestaltung und zur Anpassung an die Obwaldner Verhältnisse wurden von der parlamentarischen Kommission mittels einer Motion vorgegeben. Eine konkrete Vorlage wurde nicht erarbeitet, die Kostenschätzung war Sache der Verwaltung. Die Debatte über eine mögliche Ausgestaltung fand damit primär in parlamentarischen Gremien statt, soweit sie denn stattfand. F7 (direkte Demokratie): Im Kanton Obwalden kam das Thema infolge einer Volksinitiative auf die politische Agenda. Die Volksinitiative hatte damit zu Beginn des politischen Prozesses eine Schub‐ wirkung. F8 (familienpolitische Tradition): Die Lancierung der Vorlage zu den Ergänzungsleistungen für Familien markiert zusammen mit anderen familienpolitischen Vorstössen, die zum selben Zeitpunkt eingereicht wurden, den Startpunkt einer Obwaldner Familienpolitik. Familienpolitik war davor, abgesehen von einer Beratungsstelle für Jugendliche, kein Thema im Kanton Obwalden. Trotzdem war es auch hier nur die SVP, die sich grundsätzlich gegen staatliche Eingriffe in der Familienpolitik gewehrt hat. 4.3.7 Fazit Die Vorlage zu den Ergänzungsleistungen für Familien wurde im Kanton Obwalden mittels einer Volksinitiative der SP lanciert. Eine sozio‐ökonomische Notwendigkeit dazu bestand nicht oder war nicht bekannt. Das Projekt markiert zusammen mit anderen Vorstössen den Beginn einer Obwaldner Familienpolitik und wurde schliesslich im Rahmen des Familienleitbildes weiterverfolgt. Die Ein‐ führung von Ergänzungsleistungen für Familien in Form einer Kleinkinderbetreuungszulage wurde von einer breiten Koalition aus SP, CVP, CSP und FDP mitgetragen. Konsequent dagegen ausgespro‐ chen hat sich hingegen der Regierungsrat. Argumentiert wurde mit Fehlanreizen, Sozialtourismus, dem Warten auf die Bundeslösung und Schwierigkeiten bei der Finanzierung. Das Parlament hat 75 diese Bedenken aber nicht geteilt und den Regierungsrat mehrmals aufgefordert, eine konkrete Vorlage auszuarbeiten und dem Parlament zu unterbreiten, worauf der Regierungsrat schliesslich eine detaillierte Kostenschätzung präsentiert hat. Diese Kostenschätzung wies weit höhere Kosten aus, als im Parlament erwartet wurde, und hat in allen Parteien ein Umdenken ausgelöst. Das Ar‐ gument der Finanzierung war durch diese Kostenschätzung stark in den Vordergrund gerückt worden und alle Parteien waren sich einig, dass die neue Leistung nicht finanzierbar ist. Schliesslich hat das Parlament die Kleinkinderbetreuungszulage ohne Gegenstimme abgeschrieben. Es zeigt sich damit, dass sich im Kanton Obwalden nicht unbedingt die verschiedenen Parteien als Befürworter und Gegner gegenüberstanden, sondern viel eher Parlament und Regierung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kleinkinderbetreuungszulage in Obwalden primär an der Finanzierung gescheitert ist. Inwiefern die ablehnende Haltung des Regierungsrates entscheidend war, ist schwierig zu beurteilen. 76 4.4 Vergleich anhand der Mill’schen Methoden 4.4.1 Vergleich der Kantone Tessin und Solothurn anhand der Konkordanzmethode Nachdem nun die Fälle im Detail erfasst und analysiert wurden, sollen in einem ersten Schritt die Kantone Tessin und Solothurn anhand der Konkordanzmethode nach Mill verglichen werden. Diese Methode funktioniert über das Eliminieren von Faktoren, konkret können mögliche notwendige Bedingungen für ein Ereignis eliminiert werden. Ist eine Bedingung notwendig, muss sie immer vorliegen, wenn das Ereignis (Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien) vorliegt (Blatter et al. 2007:193). Indem für die Konkordanzmethode Fälle ausgewählt wurden, in denen das Ereignis vorliegt, können alle Faktoren, die nicht in beiden Fällen vorliegen, als notwendige Bedingung ausgeschlossen werden. Beim folgenden Vergleich muss beachtet werden, dass die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien als vorliegendes Ergebnis betrachtet wird, wobei die effektiv eingeführten Modelle aber nicht identisch sind. Sie unterscheiden sich bezüglich Anspruchsgruppe, Höhe der Leistung, Ausgestaltung und Finanzierung. Diese Unterschiede ergeben sich teilweise auch aus unterschiedlichen Kontexten und Debatten. Im Folgenden werden die beiden Kantone einander tabellarisch gegenübergestellt und entlang der acht aus der Theorie abgeleiteten Faktoren verglichen. In einer dritten Spalte wird festgehalten, ob ein Faktor als notwendige Bedingung identifiziert werden kann oder nicht. Anschliessend werden die Ergebnisse diskutiert. T 7 Vergleich Tessin und Solothurn anhand der Konkordanzmethode Solothurn Ereignis Sozio‐ökonomische Faktoren F1: erhöhte Familienarmut aufgrund von sozio‐ ökonomischem Wandel F2: erhöhte Familienarmut aufgrund von Rezession F3: Problem erkannt und definiert Interessen‐ und konflikttheoretische Faktoren F4a: Mehrheit sozial‐ und christdemokratischer Parteien im Parlament F4b: Mehrheit von CVP und SP im Regierungsrat + Departementsvorstand 77 Tessin notwendige Bedingung FamEL eingeführt 2009 FamEL eingeführt 1996 Ja Ja Ja Nein Ja Nein Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja Ja Ja F5: starke Verbände und Familienorganisationen Nein Ja Nein Institutionelle Faktoren F6: Kompromissfindung in ausserparlamentarischem Gremium Nein Ja Nein F7: Schubwirkung durch Volksinitiative Nein Ja Nein F8: familienpolitische Tradition (Ja) Ja (Ja) Sozio‐ökonomische Faktoren Der Vergleich der sozio‐ökonomischen Faktoren zeigt, dass der sozio‐ökonomische Wandel (F1) als notwendige Bedingung identifiziert werden kann. Während der Kanton Tessin aufgrund verschie‐ denster Aspekte generell stark von Armut betroffen ist, steht im Kanton Solothurn die Working‐Poor‐ Problematik im Zentrum. Dies zeigt sich auch in der Ausgestaltung der Vorlagen. Wirtschaftliche Krisen (F2) werden als notwendige Bedingung ausgeschlossen. Sie liegen zwar in beiden Fällen vor, jedoch hat die Analyse gezeigt, dass die Finanzkrise im Kanton Solothurn im Untersuchungszeitraum nicht zu einer Verschärfung der Armutsproblematik geführt hat und auch den finanziellen Spielraum nicht erheblich beschränkt hat. Allerdings zeigt sich, dass in beiden Kantonen der sozio‐ökonomische Problemdruck in einem kantonalen Armuts‐ bzw. Sozialbericht erfasst und als solcher definiert wurde (F3). Damit können F1 und F3 als kausale Bedingungen identifiziert werden, was die These stützt, dass der sozio‐ökonomischer Problemdruck (F1) eine indirekte Wirkung entfaltet, indem er über einen Bericht oder eine Studie zuerst als solchen erfasst und definiert werden muss (F3), bevor die Politik das Thema aufnimmt. Interessen‐ und konflikttheoretische Faktoren Von den Interessen‐ und konflikttheoretischen Faktoren kann einzig die Bedeutung von SP und CVP im Regierungsrat (F4b) als notwendige Bedingung identifiziert werden. Es hat sich gezeigt, dass in beiden Kantonen SP und CVP im Regierungsrat eine Mehrheit haben und dass das zuständige Departement von der SP geleitet wird. In beiden Kantonen haben sich die Departementsvorstehen‐ den vehement für die Ergänzungsleistungen für Familien eingesetzt und den Gesetzgebungsprozess vorangetrieben. Die beiden anderen Faktoren stellen gemäss der Untersuchung nach Mill keine notwendigen Bedingungen dar für die Einführung der Ergänzungsleistungen für Familien. Während im Parlament des Kantons Solothurn die sozial‐ und christdemokratischen Parteien zusammen mit den linken Kleinparteien über eine Mehrheit verfügen (F4a), ist dies im Kanton Tessin nicht der Fall, und trotzdem haben beide Parlamente der Einführung der Ergänzungsleistungen für Familien zugestimmt, die Tessiner gar einem umfassenderen Modell als die Solothurner und mit Einstim‐ migkeit. Daneben kann auch der Einfluss der Verbände und Organisationen (F5) als notwendige 78 Bedingung ausgeschlossen werden, da diese im Kanton Tessin zwar gut organisiert sind und über Einfluss verfügen, im Kanton Solothurn aber keine Lobby familienpolitischer Organisationen und Verbände existiert und auch die Gewerkschaften, abgesehen vom Vernehmlassungsverfahren, nicht auf den politischen Prozess Einfluss genommen haben. Institutionelle Faktoren Bei den institutionellen Faktoren kommt einzig die familienpolitische Tradition (F8) als notwendige Bedingung in Frage. Hier wurde die Antwort für den Kanton Solothurn in Klammern gesetzt, weil die Analyse des familienpolitischen Kontexts gezeigt hat, dass der Kanton Solothurn in der Familien‐ politik bisher nur sehr wenig umgesetzt hat und deshalb die Vorreiterrolle im Bereich der Ergän‐ zungsleistungen für Familien eher überrascht. Auf den zweiten Blick zeigt sich aber, dass die familienpolitische Diskussion in die 1990er Jahre zurückreicht und deshalb die Verschiebung der Grenze zwischen öffentlich und privat in Bezug auf die Familie schon vor längerem stattgefunden hat und staatliche Interventionen im Bereich der Familie nicht als eine abzulehnende Neuheit betrachtet wurden. Damit verfügt der Kanton auf der Ebene der Politikformulierung über eine familienpolitische Tradition, in Bezug auf die Umsetzung allerdings nicht. Eine familienpolitische Tradition im Sinne einer andauernden Debatte über familienpolitische Interventionen kann damit als notwendige Bedingung für die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien identifiziert werden. Die beiden anderen institutionellen Faktoren stellen hingegen keine notwendigen Bedingungen dar. In beiden Kantonen kamen Elemente der direkten Demokratie (F7) zum Tragen, jedoch in unterschiedlicher Form. Im Kanton Tessin war es eine aus taktischen Gründen lancierte Volksinitiative, die dann auch tatsächlich die ihr in der Theorie zugeschriebene Schubwirkung hatte. Im Fall des Kantons Solothurn war es ein obligatorisches Referendum. Die direkte Demokratie hat damit in beiden Fällen der Vorlage zum Durchbruch verholfen, im Fall von Solothurn jedoch nicht unbedingt gemäss den theoretischen Vorannahmen. Ein weiterer Unterschied ergibt sich im vorparlamentarischen Prozess (F6). Während im Kanton Solothurn die Politikformulierung vor allem verwaltungsintern stattfand und die Debatte auf parlamentarische Gremien konzentriert war, fand die eigentliche Debatte im Kanton Tessin innerhalb der vorbereitenden Kommission statt, in einem langen, kompromiss‐ orientierten Prozess unter Einbezug aller Parteien und Interessen. Damit fällt dieser Faktor als Kausalbedingung weg. Zusammenfassend können damit nur F1, F3, F4b und F8 als notwendige Bedingungen identifiziert werden. Dieses Resultat wurde nun aber als Ausgangspunkt genommen, um die Resultate der Prozessanalyse noch einmal einer genaueren Betrachtung zu unterziehen, damit mögliche Inter‐ aktionseffekte oder Multikausalitäten identifiziert werden können. 79 Zwei Wege führen zum Ziel Ausgehend von der Annahme, dass das Parlament ein entscheidender Akteur ist, wurde der Gesetzgebungsprozess noch einmal unter die Lupe genommen. Dabei hat sich gezeigt, dass in den Kantonen Tessin und Solothurn unterschiedliche Wege ans Ziel geführt haben, die sich aus einem Interaktionseffekt zwischen Parlament und vorparlamentarischem Entscheidungsprozess ergeben. So hat sich gezeigt, dass im Kanton Tessin die Stärke der sozial‐ und christdemokratischen Parteien im Parlament nicht entscheidend war, aufgrund der stark konsensorientierte Organisation des vorparlamentarischen Prozesses. Dagegen fand im Kanton Solothurn die Erarbeitung der Vorlage primär in der Verwaltung statt und es wurde kein Kompromiss gefunden, so dass schlussendlich die Stärke der Wohlfahrtsstaatsparteien im Parlament ausschlaggebend war. Kurz gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten die Vorlage durchs Parlament zu bringen. Wird ein konsensorientiertes Gremium (F6) unter Einbezug aller Interessen mit der Ausarbeitung der Vorlage betraut, kann ein von allen Parteien getragener Kompromiss erreicht werden. Ist dies nicht der Fall, so ist die Stärke der Wohlfahrts‐ staatsparteien (F4a) notwendige Bedingung für den Erfolg im Parlament. 4.4.2 Vergleich der Kantone Tessin, Solothurn und Obwalden mittels Differenzmethode Um die Ergebnisse der Konkordanzmethode zu vertiefen, werden die beiden Fälle in einem zweiten Schritt anhand der Differenzmethode mit einem negativen Fall kontrastiert. Dabei werden jene Faktoren verglichen, die sich mittels der Konkordanzmethode als notwendige Bedingungen identifizieren liessen (F1, F3, F4b, F8). Zudem werden die zwei Faktoren hinzugenommen, die sich unter dem Gesichtspunkt der Multikausalität ebenfalls als kausale Faktoren herausgestellt haben (F4a, F6). Die Differenzmethode funktioniert ebenfalls über das Eliminieren von Bedingungen, anders als die Konkordanzmethode können damit aber mögliche hinreichende Bedingungen eliminiert werden. Eine Bedingung ist hinreichend, wenn das Ergebnis immer dann vorliegt, wenn die Bedingung vorliegt. Es kann also keinen Fall geben, wo die Bedingung vorliegt, aber nicht das Ergebnis (Blatter et al. 2007:192). 80 T 8 Vergleich Solothurn, Tessin und Obwalden anhand der Differenzmethode Solothurn Ereignis Tessin Obwalden hinreichende Bedingung FamEL eingeführt 2009 FamEL eingeführt 1996 FamEL abgelehnt 2006 Sozio‐ökonomische Faktoren F1: erhöhte Familienarmut aufgrund von sozio‐ökonomischem Wandel Ja Ja Nein Ja F3: Problem erkannt und definiert Ja Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Ja (Ja) Nein Institutionelle Faktoren F6: Kompromissfindung in ausserparlamentarischem Gremium Nein Ja Nein Nein F8: familienpolitische Tradition (Ja) Ja Nein (Ja) Interessen‐ und konflikttheoretische Faktoren F4a: Mehrheit linker und christdemokratischer Parteien im Ja Parlament F4b: Mehrheit von CVP und SP im Regierungsrat + Departementsvorstand Bei der Diskussion der Ergebnisse aus Tabelle 8 müssen die beiden Faktoren F4a und F6, die als interagierende Faktoren erkannt wurden, gesondert betrachtet werden, da hier nicht einfach die Ausprägung des einzelnen Faktors mit Obwalden verglichen werden kann. Als erstes soll aber auf die anderen vier Faktoren eingegangen werden: F1 und F3 (sozio‐ökonomische Faktoren): Im Vergleich mit Obwalden bestätigt sich der kausale Einfluss der sozio‐ökonomischen Faktoren, sie stellen damit nicht nur eine notwendige, sondern auch eine hinreichende Bedingung für die Einführung der Ergänzungsleistungen für Familien dar. Im Gegensatz zu den Kantonen Tessin und Solothurn ist im Kanton Obwalden keine sozio‐ökonomische Notwendigkeit erkennbar aufgrund der gängigen Indikatoren. Eine kantonale Armutsstudie oder Ähnliches existiert nicht, sollte es also eine Armutsproblematik geben, wurde sie bisher nicht als Problem erkannt und sichtbar gemacht. F4b (Regierungsrat, Departementsvorstand): Hier wird das Resultat von Obwalden in Klammern gesetzt, weil die christdemokratischen Parteien zwar eine Mehrheit in der Regierung innehaben, die SP jedoch nicht an der Regierung beteiligt ist und ausserdem das zuständige Departement von der FDP präsidiert wird. Die Stärke der sozial‐ und christdemokratischen Parteien kann demnach nicht als 81 hinreichende Bedingung identifiziert werden. Jedoch führten die kantonalen Analysen auch zur Erkenntnis, dass im Regierungsrat Persönlichkeiten wichtiger sein können als ihre Parteizugehörigkeit und dass unter Umständen die Zustimmung der Regierung als solche der entscheidende Faktor ist, wobei sich die Zustimmung nicht über die Parteizugehörigkeit erklären lässt. Die drei Fallstudien haben gezeigt, dass sich in den Kantonen Tessin und Solothurn der Regierungsrat für die Vorlage eingesetzt hat, während sie im Kanton Obwalden von diesem konsequent abgelehnt wurde. Wird Faktor 4b also hinsichtlich der konkreten Haltung des Regierungsrates ausdifferenziert, kann die Zustimmung des Regierungsrates als hinreichende Bedingung für die Einführung von Ergänzungs‐ leistungen für Familien identifiziert werden. F8 (familienpolitische Tradition): Auch die familienpolitische Tradition kann als hinreichende Bedingung identifiziert werden. Im Gegensatz zu den Kantonen Solothurn und Tessin, wurde die familienpolitische Diskussion im Kanton Obwalden erst mit den familienpolitischen Vorstössen zu Beginn der Untersuchungsperiode lanciert. Allerdings spielte dabei das Argument der Öffentlich‐ machung der Familie in Obwalden keine grosse Rolle, ähnlich wie in Solothurn wurde es nur von der SVP thematisiert. Damit wird die Bedeutung dieses Faktors relativiert. In Bezug auf die Faktoren F4a und F6 zeigt sich im Kanton Obwalden dieselbe Konfiguration wie im Kanton Solothurn. Diese Konfiguration kann damit als notwendig, aber nicht hinreichend identifiziert werden. Im Kanton Obwalden hat der Regierungsrat mit der Präsentation der Kostenschätzung eine ablehnende Haltung des gesamten Parlaments erreicht, so dass die Stärke der Wohlfahrtsstaats‐ parteien nicht zum Tragen kam. 4.4.3 Fazit Der Vergleich der drei Kantone hat gezeigt, dass verschiedene Wege und Faktoren zum Ziel führen. Zum einen muss der sozio‐ökonomische Problemdruck vorhanden sein und als solcher definiert und dargestellt werden. Findet die Debatte in einem ausserparlamentarischen Gremium unter Einbezug aller Interessen statt, ist die Stärke der sozial‐ und christdemokratischen Parteien im Parlament nicht entscheidend. Wird die Debatte allerdings primär innerhalb der parlamentarischen Gremien geführt, ist die Stärke der traditionellen Wohlfahrtsstaatsparteien entscheidend. Für den Erfolg einer Vorlage ist zudem die Zustimmung des Regierungsrates von Bedeutung. Er kann eine Vorlage vorantreiben und in Parlament und Öffentlichkeit dafür lobbyieren, andererseits den Prozess auch verzögern und die Meinungsbildung im Parlament zu Ungunsten einer Vorlage beeinflussen, wie es sich im Kanton Obwalden gezeigt hat. Auch eine familienpolitische Tradition konnte als notwendige und hin‐ reichende Bedingung identifiziert werden, dürfte aber von untergeordneter Bedeutung sein. 82 Schlussfolgerung und Ausblick Kinder stellen in der Schweiz ein Armutsrisiko dar. Eine Möglichkeit, um die Familienarmut zu bekämpfen, ist die Einführung von Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien in Anlehnung an die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, die dazu beigetragen haben, die Altersarmut in der Schweiz praktisch zum Verschwinden zu bringen. Auf Bundesebene wurden die Ergänzungs‐ leistungen für Familien vor zehn Jahren auf die politische Agenda gesetzt, eine Umsetzung ist bisher aber nicht gelungen und wird in nächster Zeit auch nicht erwartet. Damit liegt der sozialpolitische Spielball bei den Kantonen, der von diesen unterschiedlich aufgenommen wird. Während einige Kantone bereits Ergänzungsleistungen für Familien eingeführt haben, haben andere bisher nichts gemacht. In vielen Kantonen sind aber momentan entsprechende Vorstösse hängig oder bereits Gesetzesvorlagen in Erarbeitung, was der Thematik eine hohe Aktualität verleiht. Diese hohe Aktivität in den Kantonen kann aber nicht als selbstverständlich betrachtet werden, da armuts‐ betroffene Familien eine Minderheit darstellen und nur über geringe Machtressourcen verfügen. Vor diesem Hintergrund wurde der Frage nachgegangen, warum die Einführung von Ergänzungs‐ leistungen für Familien auf kantonaler Ebene gelingt und weshalb sie in den einen Kantonen gelingt und in anderen nicht. Auf der Basis von Theorien der Wohlfahrtsstaatsforschung sowie Studien zur Sozialpolitik der Schweiz im Allgemeinen und zur Familienpolitik im Besonderen konnten verschiedene sozio‐ökono‐ mische, interessen‐ und konflikttheoretische und institutionelle Faktoren aus der Theorie hergeleitet werden. Mit Hilfe von Prozessanalysen wurden die Gesetzgebungsprozesse und der Kontext, in dem sie stattfanden, in den drei Kantonen Tessin, Solothurn und Obwalden detailliert erfasst. An‐ schliessend wurden die drei Kantone anhand der Konkordanz‐ und Differenzmethode nach Mill verglichen. Dabei haben sich Faktoren aus allen drei Theoriebereichen als erklärungskräftig erwiesen. Es konnte gezeigt werden, dass eine erhöhte Familienarmut, ausgelöst durch sozio‐ökonomischen Wandel, entscheidend ist für die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien in einem Kanton. Der sozio‐ökonomische Problemdruck muss dabei aber nicht nur gegeben sein, sondern er muss auch als solcher wahrgenommen werden. Dazu tragen Studien und Bericht bei, die das Thema aufnehmen und darstellen. Neben den sozio‐ökonomischen Faktoren hat sich im Rahmen der konflikt‐ theoretischen Faktoren die Zustimmung des Regierungsrates als wichtige Bedingung erwiesen. Hier hat die Untersuchung gezeigt, dass engagierte Regierungsräte wichtig sind für die Einführung der Ergänzungsleistungen für Familien, dass sich in den drei Kantonen aber nicht unbedingt nur die Regierungsräte der sozial‐ und christdemokratischen Parteien für die Vorlage einsetzten. Schliesslich konnten verschiedene Wege nachgewiesen werden, um eine Vorlage im Parlament umzusetzen, und 83 dass dabei institutionelle und Interessen‐ und konflikttheoretische Faktoren zusammenspielen. So scheint die Stärke der klassischen Wohlfahrtsstaatsparteien CVP und SP im Parlament vor allem von Bedeutung zu sein, wenn die Politikformulierung primär verwaltungsintern stattgefunden hat und die Debatte darüber deshalb vornehmlich im Parlament stattfindet. Andererseits kann auch der Weg über eine ausserparlamentarische Kommission unter Einbezug aller relevanten Interessen gegangen werden. So kann ein breiter Kompromiss angestrebt werden, so dass die absolute Stärke von SP und CVP an Bedeutung verliert. Des Weiteren konnte eine familienpolitische Tradition als Bedingung für die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien identifiziert werden. Die Fallstudien haben aber auch gezeigt, dass eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Faktoren notwendig ist, um Erfolg oder Misserfolg der Ergänzungsleistungen für Familien in einem Kanton zu verstehen. So hat die Fallstudie des Kantons Obwalden ergeben, dass das Projekt lange auf gutem Weg war und breite Unterstützung genoss, schlussendlich aber zu einem grossen Teil an der Finanzierbarkeit gescheitert ist. Die drei Fallstudien haben gezeigt, dass die Prozesse in den Kantonen sehr unterschiedlich ver‐ liefen, in einen ganz unterschiedlichen Kontext eingebettet waren und auch unterschiedlich lange dauerten, weshalb der Vergleich zuweilen schwierig ist. Ausserdem haben alle drei Kantone ein Modell entwickelt, das auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Je nach sozio‐ ökonomischer Problemlage und institutionellen Gegebenheiten wie dem Alter des Schuleintritts, haben sich so ganz unterschiedliche Modelle ergeben, womit die Ergänzungsleistungen für Familien ein Beispiel für das Innovationspotential der Kantone in der Sozialpolitik liefern. Andererseits ergeben sich aus dem unterschiedlichen Stand des politischen Prozesses und den unterschiedlichen Modellen auch neue Ungleichheiten für die einkommensschwachen Familien in der Schweiz. Ein weiterer spannender Aspekt hat sich in der Analyse mehrfach gezeigt, nämlich dass die Kann‐ tone nicht unabhängig voneinander handeln und dass auch die Bundesebene einen Einfluss hat. So haben sich sowohl der Kanton Solothurn als auch der Kanton Obwalden am Tessiner Modell orientiert, wobei eine Delegation aus dem Kanton Obwalden auch in den Kanton Tessin gereist ist, um sich zu informieren. Und obwohl man sowohl im Kanton Solothurn als auch im Kanton Obwalden überzeugt war, dass im Bereich der Ergänzungsleistungen für Familien kantonale Lösungen gefragt sind, hat sich der Kanton Solothurn um Kompatibilität mit einem möglichen Bundesmodell bemüht und sich auch am Projekt des Bundes orientiert. Dafür hat die Arbeitsgruppe dem Bundesamt für Sozialversicherungen einen Besuch abgestattet. Diese Beispiele zeigen, dass die Kantone unter‐ einander und auch mit dem Bund Informationen austauschen und voneinander lernen. Es wäre deshalb spannend, diese sogenannten Diffusionseffekte in einer weiterführenden Studie einer genaueren Betrachtung zu unterziehen, um aufzeigen zu können, ob, wie und über welche Kanäle die 84 Kantone Informationen und Innovationen austauschen und inwiefern auf diese Weise politische Lernprozesse initiiert werden (Braun/Gilardi 2006). Aber auch inwiefern die Aufnahme eines Themas auf Bundesebene zur Verbreitung einer kantonalen Innovation wie dem Tessiner Modell beitragen kann. Es wird auf jeden Fall interessant sein, die Debatten in den anderen Kantonen zu verfolgen, insbesondere in den Kantonen Genf, Waadt und Bern, die ihre Projekte in Bezug auf die Ergänzungs‐ leistungen für Familien in den nächsten Jahren zum Abschluss bringen werden. Zum einen wird es spannend sein, zu sehen, inwiefern sich die Modelle gleichen oder welche neuen Aspekte einge‐ bracht werden. Andererseits können durch das Vorliegen neuer Fälle, die Erkenntnisse dieser Arbeit gegebenenfalls erweitert oder vertieft werden. 85 Literatur Année politique suisse (2010). Dossier Politische Parteien in der Schweiz (ab 1987). www.annee politique.ch – 12.02.2010. Arbeitsgruppe Familienbericht des Eidgenössischen Departements des Inneren (Hrsg.) (1982). Familienpolitik in der Schweiz. Bern: Eidgenössische Drucksachen‐ und Materialzentrale. Armingeon, Klaus (2001). Institutionalising the Swiss Welfare State. West European Politics 24(2). S. 145‐168. Armingeon, Klaus, Fabio Bertozzi und Giuliano Bonoli (2004). Swiss Worlds of Welfare. West Euro‐ pean Politics 27(1). S. 20‐44. Ballestri, Yuri und Giuliano Bonoli (2003). L'État social suisse face aux nouveaux risques sociaux. Genèse et déterminants de l'adoption du programme d'impulsion pour les structures de garde pour enfants en bas age. Swiss Political Science Review 9(3). S. 35‐58. Bauer, Tobias, Silvia Strub und Heidi Stutz (2004). Familien, Geld und Politik. Von den Anforderungen an eine kohärente Familienpolitik zu einem familienpolitischen Dreisäulenmodell für die Schweiz. Zürich: Rüegger. Bertozzi, Fabio, Guliano Bonoli und Benoît Gay‐des‐Combes (2005). La réforme de l’État social en Suisse. Vieillissement, emploi, conflit travail‐famille. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes. Binder, Hans‐Martin, Daniel Kübler, Cornelia Furrer, Oliver Bieri, Marc Helbling und Jenny Maggi (2003). Familienpolitik auf kantonaler und kommunaler Ebene. Familienpolitische Programme und Advocacy‐Koalitionen in vier Kantonen und acht Gemeinden der Schweiz. Forschungsbericht Nr. 9/04. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen. Binder, Hans‐Martin und Daniel Kübler (2004). Familienpolitik in Kantonen und Gemeinden. Soziale Sicherheit CHSS 6/2004. S. 345‐347. Blatter, Joachim K., Frank Janning und Claudius Wagemann (2007). Qualitative Politikanalyse. Eine Einführung in Forschungsansätze und Methoden. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Bleses, Peter und Martin Seeleib‐Kaiser (2004). The dual transformation of the German welfare state. New York: Palgrave Macmillan. Bonoli, Giuliano (2004). Switzerland: Negotiating a New Welfare State in a Fragmented Political System. In New Risks, New Welfare. The Transformation of the European Welfare State. Hrsg. Peter Taylor‐Gooby. Oxford: Oxford University Press. S. 157‐180. Bonoli, Giuliano (2005). The politics of the new social policies: providing coverage against new social risks in mature welfare states. Policy and Politics 33(3). S. 431‐449. Bonoli, Giuliano und Junko Kato (2004). Social policies in Switzerland and Japan: Managing Change in Liberal‐Conservative Welfare States. Swiss Political Science Review 10(3). S. 211‐232. Braun, Dietmar und Fabrizio Gilardi (2006). Taking ‚Galton's Problem’ Seriously: Towards a Theory of Policy Diffusion. Journal of Theoretical Politics 18(3). S. 298 – 322. 86 Braun, Dietmar und Fabrizio Gilardi (2006). Taking ‚Galton's Problem’ Seriously: Towards a Theory of Policy Diffusion. Journal of Theoretical Politics 18(3). S. 298 – 322. Bundesamt für Sozialversicherungen (2009a). Arten und Ansätze der Familienzulagen nach dem FamZG, dem FLG und den kantonalen Gesetzen 2009. www.bsv.admin.ch/themen/zulagen – 20.09.2009. Bundesamt für Sozialversicherungen (2009b). Bedarfsleistungen an Eltern in den Kantonen. Stand 1. Januar 2009. www.bsv.admin.ch – 20.09.2009. Bundesamt für Sozialversicherungen (2010). Verlängerung des Impulsprogramms für familien‐ ergänzende Kinderbetreuung: Botschaft verabschiedet. Medienmitteilung. www.bsv.admin.ch – 15.07.2010. Bundesamt für Statistik (2008a). Familien in der Schweiz. Statistischer Bericht 2008. Neuchâtel. Bundesamt für Statistik (2008b). Die Sozialhilfestatistik. Resultate 2006. Neuchâtel. Bundesamt für Statistik (2009). Inventar der bedarfsabhängigen Sozialleistungen. www.portal‐ stat.admin.ch/soz‐inventar/files/de/index0.xml – 16.10.2009. Bundesamt für Statistik (2010a). Statistisches Lexikon. www.bfs.admin.ch – 20.06.2010. Bundesamt für Statistik (2010b). Volkswirtschaft: Panorama. www.bfs.admin.ch – 20.06.2010. Bundesamt für Statistik (2010c). Die Regionen. www.bfs.admin.ch – 20.06.2010. Carigiet, Ernst und Uwe Koch (2009). Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Zürich: Schulthess. CSP Obwalden (2007). Geschichte der Christlichsozialen Partei Obwalden. www.csp‐ow.ch – 24.03.2010. CVP Obwalden (1998). Schwerpunkte und Ziele 1998‐2002. Für eine Politik „Mit Herz und Verstand“. Kerns. CVP Obwalden (2002). CVP Programm 2002‐2006. Taten ‐ nicht nur Worte. CVP Obwalden (2006). Programm CVP Obwalden 2006‐2010. CVP Solothurn (2004). Menschen. Und was sie verbindet. Programm 2005‐2009. Solothurn: Sekre‐ tariat CVP. Departement des Innern Solothurn (2005). Sozialbericht 2005 Kanton Solothurn. Solothurn: Druck‐ sachenverwaltung/Lehrmittelverlag. Despland, Béatrice und Jean‐Pierre Fragnière (Hrsg.) (1999). Politiques familiales. L’impasse? Lausanne: Éditions EESP. Dipartimento delle opere sociali (1986). La povertà in Ticino. Bellinzona. Eidgenössisches Departement des Innern (2004a). Familienbericht 2004. Strukturelle Anforderungen an eine bedürfnisgerechte Familienpolitik. Bern. 87 Eidgenössisches Departement des Innern (2004b). Zusammenfassung der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens zum erläuternden Bericht zu den Parlamentarischen Initiativen Ergänzungsleistungen für Familien. Tessiner Modell (Fehr Jaqueline und Meier‐Schatz). www.sodk.ch – 20.09.2009. EKFF, Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (2004). Zehnjähriges Jubiläum des Internationalen Jahres der Familie 1994. Die Eidgenössische Koordinationskonferenz zieht Bilanz. Familie & Gesellschaft 4/September 2004. Esping‐Andersen, Gosta (1990). The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity Press. FDP Obwalden (2004). Familienleitbild und Tessiner Modell: Vernehmlassung. www.fdp‐ow.ch – 16.03.2010. FDP Solothurn (2008). Das freisinnige Manifest. Unser Versprechen an die Öffentlichkeit. www.fdp‐ so.ch – 12.12.2009. Ferrarini, Tommy (2006). Families, States and Labour Markets. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar. Gauthier, Anne H. (2002). Family Policies in Industrialized Countries. Is There Convergence?. Population 57(3). S. 447‐474. Gauthier, Anne H. (20042). The State and the Family. A comparative Analysis of Family Policies in Industrialized Countries. Oxford : Clarendon Press. George, Alexander L. und Andrew Bennet (2005). Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge/London: MIT Press. Gerlach, Irene, Susanne von Hehl, Oliver Richter, Bernd Stinsmeier und Pia Wetzorke (2004). Familienpolitik der Schweiz im Ländervergleich. Forschungsbericht Nr. 10/04. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen. Grossenbacher, Silvia (1987). Familienpolitik und Frauenfrage in der Schweiz. Grüsch: Verlag Rüegger. Häusermann, Silja (2006a). Changing coalitions in social policy reforms. The politics of new social needs and demands. Journal of European Social Policy 16(1). S. 5‐21. Häusermann, Silja (2006b). Different paths of family policy modernization in continental welfare states. Changing dynamics of reform in German and Swiss family policies since the mid‐70s. Paper prepared for the annual conference of the Swiss Political Science association, Balsthal. Häusermann, Silja (2008). Ist das politische System der Schweiz in der Lage, den Sozialstaat zu modernisieren? In Les nouveaux défis de l'État social. Hrsg. Giuliano Bonoli und Fabio Bertozzi. Bern: Haupt. S. 205‐222. Hegglin, Peter (2009). Wirtschaftskrise, NFA/ZFA und Steuergesetzrevisionen. CVP‐Fraktionsseminar Frauental, 5. Juni 2009. www.peter‐hegglin.ch – 15.07.2010. Huber, Doris (1991). Familienpolitische Kontroversen in der Schweiz zwischen 1939 und 1984. In Familien in der Schweiz. Hrsg. Thomas Fleiner‐Gerster, Pierre Gilliand und Kurt Lüscher. Freiburg: Universitätsverlag. S. 147‐166. 88 Huber, Evelyne und John D. Stephens (2006). Combating old and new social risks. In The Politics od Post‐Industrial Welfare States. Adapting post‐war social policies to new social risks. Hrsg. Klaus Armingeon und Giuliano Bonoli. London/New York: Routledge. S. 143‐168. Hüttner, Eveline und Tobias Bauer (2003). Massnahmen zur gezielten Unterstützung von einkommensschwachen Familien. Bericht des Büro BASS zuhanden der SODK. www.sodk.ch – 11.12.2009. Jahn, Detlef (2006). Einführung in die vergleichende Politikwissenschaft. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Kantonsrat Obwalden (2005a). Bericht über die Familienpolitik, 32.05.05. In Wortprotokoll der Sitzung des Kantonsrats vom 27.10.2005. www.ow.ch – 15.12.2009. S. 15‐35. Kantonsrat Obwalden (2005b). Motion zur Umsetzung der Familienpolitik, 52.05.04. Kantonsrat Obwalden (2006). Bericht und Antrag zur Einführung einer Kleinkinderbetreuungszulage, 32.06.08. In Wortprotokoll der Sitzung des Kantonsrats vom 30.11/01.12.2006. www.ow.ch – 15.12.2009. S. 42‐48. Kantonsrat Solothurn (2005). Antrag Fraktion CVP. In Wortprotokoll der Session VII des Kantonsrats vom 14.12.2005. www.so.ch/parlament/protokolle.html – 12.12.2009. Kantonsrat Solothurn (2009). Ergänzungsleistungen für Familien; Änderung des Sozialgesetzes, RG 172/2008. In Wortprotokoll der Session 50 II. des Kantonsrats vom 3./4. März 2009. www.so.ch/parlament/protokolle.html – 12.12.2009. Kingdon, John W. (1995). Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: Longman. Knupfer, Caroline, Nathalie Pfister und Oliver Bieri (2007). Sozialhilfe, Steuern und Einkommen in der Schweiz. Bern: Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Kommission Familienleitbild Ob‐ und Nidwalden (2003). Leitbild und Grundlagenbericht zur Familienpolitik der Kantone Obwalden und Nidwalden. Kommission für Verwaltung und Finanzen Tessin (1996). Bericht der Kommissionsmehrheit und ‐minderheit (Rapporto di maggioranza /di minoranza) zur Botschaft des Regierungsrates bezüglich Einführung des neuen Kinderzulagengesetzes. In Archivio verbali e deputati GC 1803‐2003. www.ti.ch – 03.12.2009. S.857‐933. Kübler, Daniel (2007). Understanding the Recent Expansion of the Swiss Family Policy: An Idea‐ Centred Approach. Journal of Social Policy 36(2). S. 217‐237. Ladner, Andreas (2004). Typologien und Wandel: Die kantonalen Parteiensysteme im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Swiss Political Science Review 10(4). S. 3‐32. Lamnek, Siegfried (1995). Qualitative Sozialforschung. Band 1, Methodologie. Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union. LEGA Tessin (1991). Programma politico. www.legaticinesi.ch/programmi – 15.06.2010. Levy, Jonah D. (1999). Vice into Virtue? Progressive Politics and Welfare Reform in Continental Europe. Politics & Society 27(2). S. 239‐273. 89 Linder, Wolf (20052). Schweizerische Demokratie. Institutionen, Prozesse, Perspektiven. Bern: Haupt. Lüscher, Kurt (2003). Warum Familienpolitik? Argumente und Thesen zu ihrer Begründung. Bern: Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF). Mahoney, James (2003). Strategies of Causal Assessment in Comparative Historical Analysis. In Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. Hrsg. James Mahoney und Dietrich Rueschemeyer. Cambridge: University Press. S. 337‐372. Mahoney, James und Gary Goertz (2004). The Possibility Principle: Choosing Negative Cases in Comparative Research. American Political Science Review 98(4). S. 653‐669. Mahoney, James und Gary Goertz (2006). A Tale of Two Cultures. Contrasting Quantitative and Qualitative Research. Political Analysis 14. S. 227‐249. Mill, John S. (1874). A System of Logic. Ratiocinative and Inductive. New York: Harper & Brothers. Moser, Julia (2003). Die Sozialpolitik der Schweizer Kantone im Vergleich. Oder die Kunst, so viel wie möglich selbst und so wenig wie möglich gemeinsam zu entscheiden. Diplomarbeit an der Universität Bremen. Moser, Julia (2008). Der schweizerische Wohlfahrtsstaat. Zum Ausbau des sozialen Sicherungssystems 1975‐2005. Schriften des Zentrums für Sozialpolitik, Band 16. Frankfurt/New York: Campus Verlag. Obinger, Herbert (1998). Politische Institutionen und Sozialpolitik in der Schweiz. Frankfurt: Peter Lang. Obinger, Herbert und Uwe Wagschal (2000). Der Einfluss der Direktdemokratie auf die Sozialpolitik. Politische Vierteljahresschrift 41(3). S. 466‐497. Parlament Tessin (1987). Diskussion der ‚Iniziativa parlamentare in forma generica Donadini C. per il PPD‘. In Wortprotokoll der Herbstsession des Tessiner Parlaments vom 21.09.1987, Archivio verbali e deputati GC 1803‐2003. www.ti.ch – 03.12.2009. S.562. Parlament Tessin (1988). Diskussion des ‚Rapporto commissionale sull’iniziativa parlamentare (…) che propone la revisione e la modifica della legge cantonale sugli assegni familiari’. In Wortprotokoll der Frühlingsession des Tessiner Parlaments vom 16.05.1988, Archivio verbali e deputati GC 1803‐ 2003. www.ti.ch – 03.12.2009. S.363‐370. Parlament Tessin (1996). Diskussion der ‚Assegni di famiglia: introduzione di una nuova legge‘. In Wortprotokoll der Frühlingssession des Tessiner Parlaments vom 10./11.06.1996, Archivio verbali e deputati GC 1803‐2003. www.ti.ch – 03.12.2009. S.720‐776. Parlamentsdienste (2009a). Dossier 09.045, Steuerliche Entlastung von Familien mit Kindern. www.parlament.ch/d/dokumentation/dossiers – 15.07.2010. Parlamentsdienste (2009b). Curia Vista, Geschäftsdatenbank. www.parlament.ch – 30.10.2009. Parlamentsdienste (2010). Dossiers. www.parlament.ch/d/dokumentation/dossiers/ – 05.08.2010. Parlamentsdienste Solothurn (2010). Kantonsratswahlen. www.so.ch – 02.02.2010. Parlamentsdienste Tessin (Segreteria del Gran Consiglio) (2010). Parlamento (Gran Consiglio). www.ti.ch – 06.11.2010. 90 Pierson, Paul (1996). The New Politics of the Welfare State. World Politics 48(2). S. 143‐179. Ragin, Charles C. (1987). The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press. Rechtsdienst Obwalden (2010). Abstimmungen und Wahlen. www.ow.ch – 15.12.2009. Regierungsrat Obwalden (2005). Bericht des Regierungsrats zur Familienpolitik vom 21.06.2005, 32.05.05. Regierungsrat Obwalden (2006). Bericht des Regierungsrats über die Einführung einer Kleinkinderbetreuungszulage vom 17.10.2006, 32.06.08. Regierungsrat Solothurn (2006). Sozialversicherungen: Ergänzungsleistungen für einkommens‐ schwache Familien; Projektorganisation vom 19.12.2006. Regierungsratsbeschluss 2006/2373. Regierungsrat Solothurn (2008a). Ergänzungsleistungen für Familien; Kenntnisnahme vom Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens vom 11.11.2008. Regierungsratsbeschluss 2008/1974. Regierungsrat Solothurn (2008b). Ergänzungsleistungen für Familien; Änderung des Sozialgesetzes. Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 01.12.2008. Regierungsratsbeschluss 2008/2127. Regierungsrat Solothurn (2010). Regierung. www.so.ch – 02.03.2010. Regierungsrat Tessin (1994). Messagio relativo all’introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia (Botschaft des Regierungsrates). In Archivio verbali e deputati GC 1803‐2003. www.ti.ch – 03.12.2009. S.777‐856. Regierungsrat Tessin (2010). Elenco dei Consiglieri di Stato dal 1893. www.ti.ch – 06.11.2010. Salzgeber, Renate und Sarah Neukomm (2009). Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in Schweizer Städten, Berichtsjahr 2008. Bern: Städteinitiative. www.staedteinitiative.ch – 14.07.2010. Schmidt, Manfred G. (1993). Theorien in der international vergleichenden Staatstätigkeitsforschung. Politische Vierteljahresschrift Sonderheft 24/1993. S. 371‐393. Schmidt, Manfred G. (2000). Die sozialpolitischen Nachzüglerstaaten und die Theorien der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung. In Der gezügelte Wohlfahrtsstaat. Sozialpolitik in reichen Industrienationen. Hrsg. Herbert Obinger und Uwe Wagschal. Frankfurt/New York: Campus Verlag. S. 22‐36. Schweizerische Bundesbehörden (2010). Dokumentation Landesrecht (kantonale Verfassungen). www.admin.ch – 05.08.2010. SDA (2009). Gegen die Familienarmut. Kommission sistiert Projekt für neue Ergänzungsleistungen. SDA Meldung zur Medienkonferenz SDK‐N vom 18.2.2009. www.parlament.ch – 30.10.2009. SGK (2005). Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 28. April 2005 bezüglich der parlamentarischen Initiativen Fehr und Meier‐Schatz. www.parlament.ch – 30.10.2009. SGK (2007). Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 27. April 2007 bezüglich der parlamentarischen Initiativen Fehr und Meier‐Schatz. www.parlament.ch – 30.10.2009. 91 SGK (2009). Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 4. Mai 2009 bezüglich der parlamentarischen Initiativen Fehr und Meier‐Schatz. www.parlament.ch – 30.10.2009. Sieber, Corinne, Hector Schmassmann und Ueli Mäder (2004). Die Familienpolitik in der Schweiz. In Familienbericht 2004. Strukturelle Anforderungen an eine bedürfnisgerechte Familienpolitik. Hrsg. Eidgenössisches Departement des Innern. Bern. S. 108‐139. Skocpol, Theda und Margaret Somers (1980). The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry. Comparative Studies in Society and History 22(2). S. 174‐197. SKOS (1999). Braucht die Schweiz eine neue Sozialhilfe? Positionspapier. www.skos.ch – 20.09.2009. SKOS (2009). Die Armut könnte deutlich reduziert werden. Zeitschrift für Sozialhilfe (ZESO) 3/2009. S. 8‐10. Sozialamt Obwalden (2003). Das Tessinermodell: Legge sugli assegni di famiglia LAF (Familienzulagen). Bericht zum Tessinermodell für den Kanton Obwalden. SP Solothurn (2010). Legislaturziele 2005 ‐ 2009. www.sp‐so.ch – 02.02.2010. Staatskanzlei Obwalden (2006). Statistik zur Gesamterneuerungswahl des Kantonsrats für die Amtsdauer 2006‐2010. www.ow.ch – 16.03.2010. Staatskanzlei Solothurn (2010). Wahlen/Abstimmungen. www.so.ch – 20.02.2010. Starke, Peter (2006). The Politics of Welfare State Retrenchment: A Literature Review. Social Policy and Administration 40(1). S. 104‐120. Stutz, Heidi (2004). Familienpolitik heute – Was beinhaltet sie? In Familienbericht 2004. Strukturelle Anforderungen an eine bedürfnisgerechte Familienpolitik. Hrsg. Eidgenössisches Departement des Innern. S. 88‐107. SVP Obwalden (2009). Geschichte der SVP Obwalden. www.svp‐ow.ch – 16.03.2010. SVP Obwalden (2001). Parteiprogramm der SVP Obwalden, Version 2001. SVP Obwalden (2006). Parteiprogramm SVP Obwalden, Legislatur 2006‐2010. Taylor‐Gooby, Peter (Hrsg.) (2004). New Risks, New Welfare. The Transformation of the European Welfare State. Oxford: University Press. Thoenen, Olivia (2006). Familienpolitik in der Schweiz – ein kantonaler Vergleich. Lizentiatsarbeit am Institut für Politikwissenschaft Bern. Tsebelis, George (1995). Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parlia‐ mentarism, Multicameralism and Multipartyism. British Journal of Political Science 25. S. 289‐325. Überparteiliches Komitee Solothurn (2010). Tun wir jetzt endlich gemeinsam etwas für die Familien. Überparteiliches Komitee aus CVP/EVP/Glp/SP/Grüne zur Einführung der EL für Familien. www.el‐ so.ch – 20.05.2010. Van Kersbergen, Kees (2002). The Politics of Welfare State Reform. State of the Art Article. Swiss Political Science Review 8(1). S. 1‐20. 92 Vatter, Adrian (2002). Kantonale Demokratien im Vergleich. Entstehungsgründe, Interaktionen und Wirkungen politischer Institutionen in den Schweizer Kantonen. Opladen: Leske + Budrich. Vatter, Adrian, Simone Ledermann, Fritz Sager und Lukas Zollinger (2004). Familienpolitik auf Bundesebene. Forschungsbericht Nr. 8/04. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen. VSEG (2010). Jahresbericht 2009. www.vseg.ch – 15.07.2010. Wolfensberger, Beat (2007). Der bundesrechtliche Ausbau der Familienzulagen 2006. Analyse des Policy‐making‐Prozesses des Bundesgesetzes über die Familienzulagen 1991‐2006. Lizentiatsarbeit am Institut für Politikwissenschaft Bern. 93 Anhang 94 Liste der befragten Personen Rossi Martino* ehemaliger Direktor der Divisione dell’azione sociale e delle famiglie im Kanton Tessin Sandrinelli Roberto* Koordinator Familienpolitik der Divisione dell’azione sociale e delle famiglie im Kanton Tessin Pfleger Anton Leiter kantonales Sozialamt im Kanton Obwalden Wyrsch Walter Präsident der parlamentarischen Kommission Familienleitbild im Kanton Obwalden Brügger Peter Präsident der parlamentarischen Sozial‐ und Gesundheitskommission im Kanton Solothurn Walser Guido Projektleiter der Vorlage Ergänzungsleistungen für Familien im Amt für soziale Sicherheit im Kanton Solothurn *Diese beiden Personen wurden gleichzeitig interviewt. Da nicht bei jeder Aussage rekonstruiert werden kann, von welcher der beiden sie stammt, werden die Interviews in der Analyse als eines behandelt. Interviewleitfaden** Interviewleitfaden für die Interviews im Kanton Tessin 1) Binder et al. disent qu’il y a plusieurs facteurs qui ont conduit à des différentes réformes. Peut‐ on constaté que l’étude sur la pauvreté était le facteur principal pour le lancement et le succes de l’initiative de Donadini? Qui a initié l’étude sur la pauvreté au Tessin? Quel était la réaction des différents acteurs sur l’étude? 2) Le Tessin connaissait un taux de naissance plus bas que le moyen de la Suisse et un des buts de la loi était de garantir la liberté de choix de procréation. Était l’effet pronatalist un sujet important du débat sur les prestations complémentaires familiales? 3) Dans les années 1980, a‐t‐on discuté des propositions différentes comment résoudre le problème des familles pauvres au parlement du Canton de Tessin? 4) Ce groupe de travail qui a élaboré le modèle des prestations, comment a‐t‐il développé ce modèle précurseur? Était cette idée déjà développé dans le tiroir? Avaient‐ils s’orienté à un autre modèle? 5) Le débat et l’étude sur les familles monoparentales, ont‐ils eu un effet favorable sur le projet de loi sur les allocations familiales? Comment l’étude, était‐elle liée aux femmes PPD? 95 6) Que‐ce qui c’est passé entre 1988 et 1993? Comment est‐on arrivé à cette proposition de loi? Quels étaient les positions des différents acteurs? 7) Peut‐on constater que le débat était plutôt sur le niveau comment faire, mais jamais sur le niveau, s’il faut ou faut pas introduire ces prestations? 8) La question de financement? L’impact de la crise sur la question de financement? Est‐ce qu’on a discuté déjà avant le problème de financement? Dans le contexte de financement: A‐t‐on aussi évoqué l’argument que les prestations complémentaires sont moins chères que des autres mesures pour familles parce qu’elles sont une prestation en cas de besoins? 9) Quel étaient les causes de la coalition majoritaire de la PLRT, LEGA et PS contre la minorité de la PPD dans la commission ? 10) Ce n’est pas étonnant que la PS et le PPD ont soutenu la nouvelle loi sur les prestations familiales. Mais quels étaient les arguments des Libéraux et de la LEGA pour qu’ils aient finalement soutenu la nouvelle loi ? 11) Quel était le rôle des personnalités particulières (membres du parlement, chercheurs, Conseil d’État, Directeur du département de l’action social et des familles Bervini/Martinelli/Pesenti) ? 12) L’initiative de la PS, dans quel mesure était‐elle décisive pour la décision finale en 1996? Interviewleitfaden für die Interviews im Kanton Solothurn 1) Welche Leistungen konnten Familien im Kanton Solothurn vor der Einführung der Ergänzungsleistungen beziehen? 2) Was sah die Vorlage des Elternbeitragsgesetzes von 1993 vor? 3) Was passierte familienpolitisch zwischen 1993 und 2005? 4) Welche Gesetze bzw. Gesetzesprojekte unterstützen Familien finanziell oder anders? Hat Familienpolitik Tradition im Kanton Solothurn? 5) Wie kam die CVP auf die Idee? Welche Rolle spielten der Familienbericht vom Bund und der Sozialbericht von Solothurn für die Initiierung des Antrags der CVP? Hat sich die Working‐Poor‐ Problematik verschärft? 6) Finanzielle Situation: 1993 hat die finanzielle Situation von Gemeinden und Kanton das Elternbeitragsgesetz verunmöglicht. Inwiefern hat sich die finanzielle Situation seither verändert? Wie ist die wirtschaftliche Situation des Kantons Solothurn? 7) Wie hat sich die Arbeitsgruppe informiert über das Tessiner Modell? Inwiefern hat man auf das Elternbeitragsgesetz zurückgegriffen? Wurden selber Studien gemacht während der Erarbeitung? 8) Wie waren die Positionen innerhalb der parlamentarischen Kommission? 9) Hat die Möglichkeit, das Gesetz dem Referendum zu unterstellen, die Vorlage gerettet? Wird das oft gemacht? 96 10) Welchen Einfluss haben Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände? Wie waren ihre Positionen? Haben sie sich abgesehen vom Vernehmlassungsverfahren geäussert? Abstimmungskampf? 11) Gibt es Interessengruppen, die im Bereich Familienpolitik aktiv sind? Wie und wo nehmen sie Einfluss? 12) Was war die Rolle einzelner Persönlichkeiten? Frauen? 13) Was war die Rolle des Regierungsrates? Was war die Rolle des Vorstehers des Sozialdepartements? Hat im Regierungsrat ein Umdenken stattgefunden? 14) Fand eine öffentliche Debatte statt? Wann? 15) Inwiefern war die Bundeslösung ein Thema? Interviewleitfaden für die Interviews im Kanton Obwalden 1) Der Kanton Obwalden hat keine hohe Arbeitslosigkeit, eine sehr tiefe Sozialhilfequote, die Geburtenzahl ist zwar gesunken, aber stabil im Schweizer Durchschnitt. Ist Armut ein Problem im Kanton Obwalden? Gibt es überhaupt Familienarmut? War man sich vor den Berechnungen des Regierungsrates im Klaren darüber, in welchem Ausmass es einkommensschwache Familien gibt im Kanton Obwalden? 2) Wie sah die Familienpolitik vor dem Leitbild aus? War Familienpolitik überhaupt ein Thema? Warum dieses gehäufte Auftreten von Vorstössen? Ist das der Startpunkt einer OW‐ Familienpolitik? 3) Vor welchem Hintergrund hat die SP die Familieninitiative, die die Einführung von Ergänzungsleistungen für Familien fordert, initiiert? Wurde das Anliegen der Ergänzungsleistungen als linke Forderung betrachtet? 4) Enthielt die Studie zur Situation der Familien im Kanton Obwalden auch Angaben zur Armut im Kanton Obwalden? 5) Wie kam man im Kanton Obwalden auf das Tessiner Modell? Wie hat sich der Kanton Obwalden über das Tessiner Modell informiert? Hat es Kontakte gegeben? 6) Welchen Stellenwert haben die Ergänzungsleistungen für Familien innerhalb des Familienleitbildes? 7) Inwiefern war die Ausgestaltung der Vorlage ein Thema? Inwiefern wurde eine Anpassung der Vorlage diskutiert (Arbeitsanreize, Einschränkung der Anspruchsgruppen)? 8) Wer war alles in der Kommission vertreten? Was waren die Positionen innerhalb der Kommission? 9) Gibt es Organisationen, Interessengruppen, die im Bereich der Familie aktiv sind? Lobbying betreiben? 97 10) Welchen Einfluss haben Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände? Was war ihre Position hinsichtlich Kleinkinderbetreuungszulage? 11) Im Regierungsrat sitzen CSP, CVP und FDP? Alle drei Parteien sprachen sich ziemlich lange für die Einführung von KKBZ aus? Warum gibt es diese Diskrepanz zu ihren Regierungsmitgliedern? Was ist die grundsätzliche Haltung der Parteien? Inwiefern ist ihnen Familienpolitik ein Anliegen? Wo steht die CSP in der Familienpolitik? Was sind die Positionen von CSP/CVP? Eher für Staatsinterventionen oder dagegen? 12) Wurde im Rahmen der Debatte zu den KKBZ auch über die Rolle des Staates debattiert? 13) Hat die Diskussion der Kleinkinderbetreuungszulage eine Modernisierungsdebatte ausgelöst? 14) Kosten: Wurde auch argumentiert, dass keine neuen Leistungen eingeführt werden, weil die bestehenden viele Mittel binden? Wie ist die finanzielle Situation des Kantons Obwalden? 15) Wie wurde der Bericht zum Tessiner Modell erarbeitet? Wann und warum wurde die Familienzulage nicht weiterverfolgt? 16) Wie entscheidend waren die beiden verantwortlichen Regierungsrätinnen (Gander, Gassler)? 17) Inwiefern war die Einführung auf Bundesebene ein Thema? War die gleichzeitige Vereinheitlichung der Kinderzulagen auf Bundesebene ein Thema (beschränkter finanzieller Spielraum)? 18) Unterscheidet sich die Position der Frauen von derjenigen der Männer im Kanton Obwalden stark? Gab es eine Mobilisierung der Frauen einer bestimmten Partei? **Der Leitfaden wurde jeweils vor und während den Interviews situativ angepasst. Es wurden nicht allen Befragten dieselben Fragen gestellt und es wurden spontan ergänzende Fragen eingebaut, wenn es für das Verständnis notwendig oder für die weitere Arbeit interessant schien. Das Interview im Tessin wurde auf Französisch geführt. 98 Selbstständigkeitserklärung „Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Mir ist bekannt, dass andernfalls der Senat gemäss Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe o des Gesetzes vom 5. September 1996 über die Universität zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist.“ Bern, 28. August 2010 Franziska Ehrler