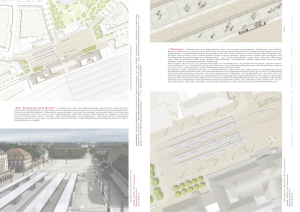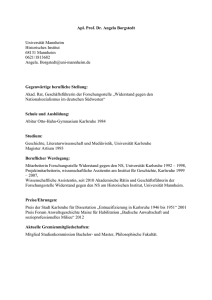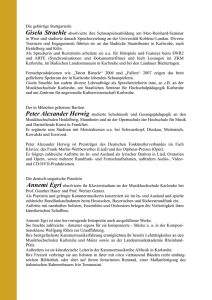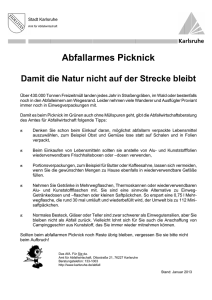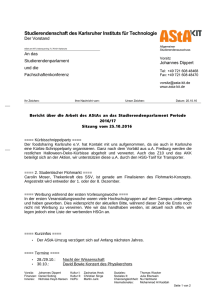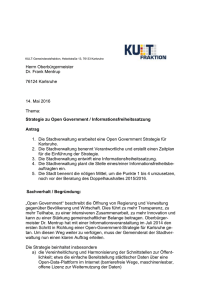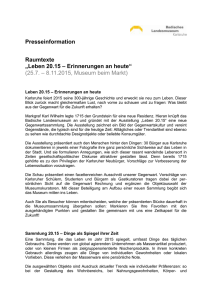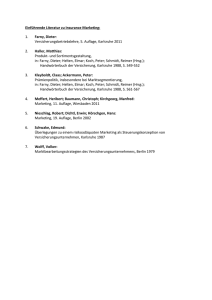Näher dran. - Hochschule Karlsruhe
Werbung
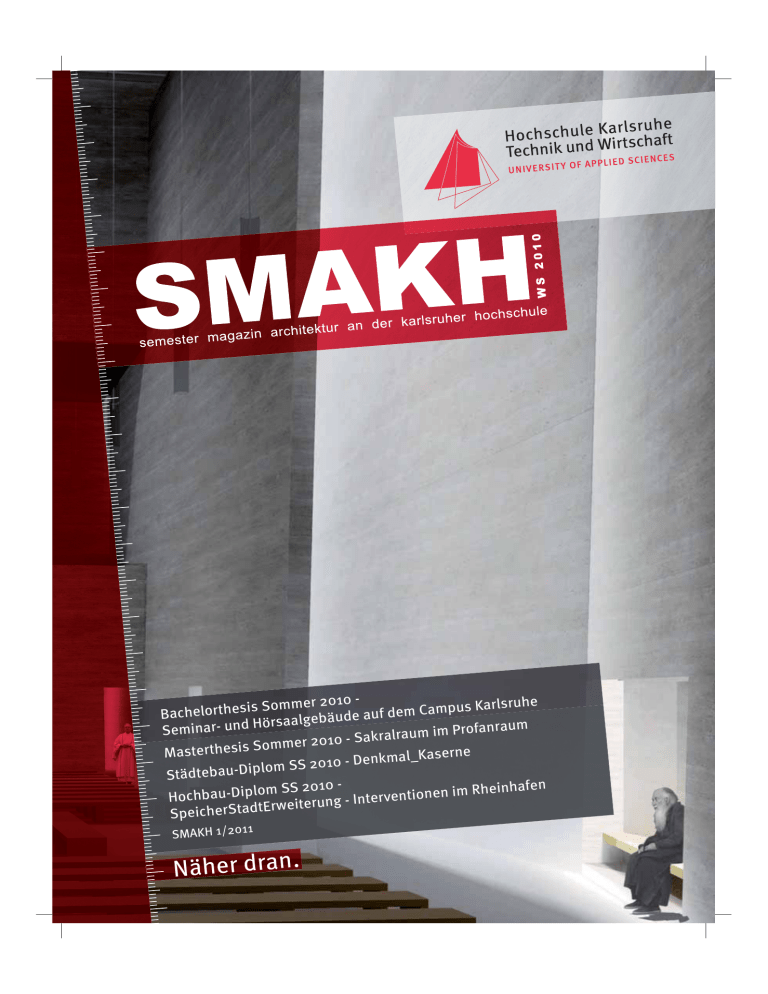
Sommer 2010 s Karlsruhe u is s p e m h a rt C lo m e e h d c f a B e au örsaalgebäud H d n u ra in m Profanraum Se im m u a lr ra k a -S Sommer 2010 rne Masterthesis enkmal_Kase D 0 1 0 2 S S lom Städtebau-Dip m SS 2010 Rheinhafen lo im ip n -D e u n a o b ti h n c e o H terv rweiterung - In tE d ta rS e h ic e Sp SMAKH 1/2011 Näher dran. Liebe Leserinnen und Leser, herzlich Willkommen zu SMAKH6 – der sechsten Ausgabe unseres Semestermagazins für Architektur. Diese Ausgabe kommt zu ganz besonderen Ehren: Die Absolventin Nina Scholten vom Studiengang Technische Redaktion der Hochschule Karlsruhe widmet SMAKH ihre Bachelorthesis. Basierend auf einer Analyse bereits erschienener Ausgaben beschäftigt sie sich sowohl mit der Dramaturgie als auch mit der Definition von Layout und Corporate Design. Das Ergebnis der Thesis spiegelt sich im Layout von SMAKH6, wir sind sehr zufrieden mit diesem Resultat. Wir berichten auf Seite 4 von unserer Sommerreihe HORIZONTE, der Vortragsreihe zum Studienprojekt ArchitektenImage. Die Reihe erlaubte uns einen inspirierenden Blick über den „Tellerrand“ und zeigte vielversprechende Einsatzmöglichkeiten weit außerhalb der altbewährten Baukunst. SMAKH6 widmet sich verstärkt dem Masterstudiengang Architektur Form und Experiment, auf den Seiten 18 - 21 präsentieren wir eine Masterthesis zum Thema Sakralraum im Profanraum. Hans Peter Weber befasste sich mit einem Areal am Frankfurter Gallus, zwischen Messe und Hauptbahnhof liegend, umgeben von Wolkenkratzern, Verkehrslärm und Hektik – mit der Erkenntnis, Sakralität dort am ehesten zu spüren, wo der Kontrast zum Profanen besonders deutlich besteht. Auf Seite 35 wird SMAKH zur Plattform einer Selbstdefinition, wir erläutern den Begriff Experiment für das Integrale Projekt im Master. Bedanken möchten wir uns wieder für die Unterstützung durch Werkbund, BDA und AKBW sowie bei den Firmen Armstrong DLW und Feederle. Wenn wir Sie neugierig gemacht haben und Sie noch mehr über unseren Studiengang erfahren möchten, besuchen Sie die Homepage der Hochschule www.hs-karlsruhe.de und die Seiten unseres Studiengangs. Karlsruhe, April 2011 Prof. Florian Burgstaller Studiendekan Alke Hickel Wissenschaftliche Mitarbeiterin Konzeption und Redaktion des Magazins SMAKH Editorial WS 2010/11 _ 1 2 _ WS 2010/11 Inhalt Bachelorthesis Sommer 2010 Seminar- und Hörsaalgebäude auf dem Campus Karlsruhe 12 Masterthesis Sommer 2010 Sakralraum im Profanraum 18 Städtebau-Diplom SS 2010 Denkmal_Kaserne 22 Hochbau-Diplom SS 2010 SpeicherStadtErweiterung Interventionen im Rheinhafen 28 Standards Editorial Impressum Master 1 60 Horizonte MittwochabendVortrag 2010 4 Standpunkt Fachschaft Sag uns deine Meinung! 6 Reingeschaut Raumpilot 9 Städtebau-Diplom Denkmal_Kaserne 22 Hochbau-Diplom SpeicherStadtErweiterung Interventionen im Rheinhafen 28 10 Bachelor 12 Experimentelles Bauen Anmerkungen zum Integralen Projekt MA3 im Wintersemester 10/11 „Ein Haus kann nur leise zu uns sprechen...“ Bestandsaufnahme Vom Städtebau bis zum Detail Großer Entwurf einer Sporthalle 3. und 4. Bachelorsemester 42 Vertiefung Frauenalb Synergie Strukturen Programm Pro Studium 46 Dialog Lehre Exkursion Bachelorthesis Seminar- und Hörsaalgebäude auf dem Campus Karlsruhe 18 Diplom Aktuelles Exkursion nach Rom Architekturzeitreise Masterthesis Sakralraum im Profanraum Entwurf 35 38 Persönlich SMAKH im Gespräch mit Prof. Dr. Bernhard Lenz 52 6 Fragen an Thomas Fabrinsky 56 Kooperation Was ist eigentlich... das Architekturschaufenster? 58 Inhalt WS 2010/11 _ 3 Horizonte MittwochabendVortrag 2010 Das Studentenprojekt ArchitektenImage, gegliedert in die 3 Module Situation, Perspektiven, Visionen, war Anlass für die Vortragsreihe Horizonte, die der Studiengang im Sommersemester 2010 veranstaltete. Die Studierenden Bachelor 6, betreut von Martina Ruff und Alke Hickel, definierten ihr „ArchitektenImage“ im Rahmen einer Analyse von Qualifikationen und Kernkompetenzen. Horizonte lud ein zum „Blick über den Tellerrand“ und lies sich sicher dank der inhaltlich breit angelegten Architektenausbildung hierzulande noch durch weitere anregende Beiträge ausbauen. Der klassische Idealtypus Architekt ergänzt sich schon lange durch mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten weit außerhalb der altbewährten Baukunst. Wir danken den Firmen Paul Feederle und Armstrong DLW für die Unterstützung dieser Veranstaltungsreihe. Im Ersten der fünf Vorträge referierte der Architekturpsychologe und -theoretiker Prof. Dr. Riklef Rambow über Wahrnehmung von Architektur und Schnittstellen auf Augenhöhe zwischen Architekten und Laien. Was ist Architektur? Was macht Architektur? Was macht der Architekt? Der promovierte Diplompsychologe forscht seit einigen Jahren im Bereich Architekturkommunikation. Architektur umgibt uns überall, jeder wird davon beeinflusst, denn sie ist sichtbarer Ausdruck kulturellen Schaffens. Rambow sieht die Architekturvermittlung als wesentlichen Faktor, der nicht nur Auswirkungen auf das Verständnis von Architektur, sondern vor allem auf die dadurch resultierende Baulandschaft nach sich zieht. Rambow stellte in seinem Vortrag „Psychologische Grundlagen der Architektur“ interessante, aber auch alltägliche Lösungen vor, Architektur in der Öffentlichkeit, auf Augenhöhe mit Laien, zu vermitteln. 4 _ WS 2010/11 Aktuelles raumPROBE, gegründet von Hannes Bäuerle und Joachim Stumpp, versteht sich als Recherche-Pool und Moderator zwischen innovativer Industrie, Architekten und anderen Planern. Die Leidenschaft zum Material war Inspiration und Antrieb zum Projekt raumProbe und machte für Hannes Bäuerle und Joachim Stumpp die Sammelleidenschaft zum Beruf. In seinem Vortrag setzt der Innenarchitekt Hannes Bäuerle die Faszination des Materials in den Mittelpunkt. Das Katalogisieren und Erstellen von übersichtlichen und wahrheitsgetreuen Online-Datenbanken bringt vielfältige Möglichkeiten erfolgreich an die Öffentlichkeit. Heute kann man die Materialsammlung von raumPROBE in Stuttgart auf 400 m² Ausstellungsfläche anschauen und anfassen. Optik und Haptik werden hier direkt erlebbar, Funktionalität und technische Materialeigenschaften sind genau dokumentiert. Jeder kann sich ein direktes Bild machen und so ein Gespür für Stofflichkeit entwickeln. Architekturpsychologe Dr. Riklef Rambow Raumprobe Hannes Bäuerle A Space Odyssey Andreas Voigt Architekturbild Wilfried Dechau A Space Odyssey war Titel der Veranstaltung - „Spaces“, „Räume“, stellte Andreas Voigt in seinem Vortrag dar, diese wurden von Studierenden der HFG Karlsruhe und der TU Berlin bearbeitet. Themenstellung war „Räume temporär für kurze Zeit zu schaffen“ und ermöglicht so in anderer Hinsicht den Blick über den Tellerrand der meist für länger andauernde Zeitspannen angelegten Architektur. Mit dem Ziel, verschiedene künstlerische Studiengänge, wie z.B. Mediendesign, Produktdesign oder Architektur, zusammenzuführen, wurden Geschichten graphisch dargestellt und baulich umgesetzt. Die Bandbreite der Studienprojekte beeindruckte das Publikum, von der Herstellungsmethodik wie beispielsweise der Fertigung in einer Glaserei, bis hin zur inhaltlichen Umsetzung, dem Nachbau von Messingteilen aus verschiedenen Materialien und einem Ankündigungsplakat, dessen Entwurf durch eine herausgerissenen Seite inspiriert wurde. Auch brachte Voigt das Auditorium den Grenzen zwischen Design und Architektur näher. So wurden kreativ-abstrakte Darstellungen von Geschichten vor- und dargestellt. „Gute Architekturfotographie dokumentiert die Qualität eines architektonischen Entwurfs und kann länger bestehen, als das schönste Bauwerk“, so der studierte Architekt und jahrelange Chefredakteur der „Deutschen Bauzeitung“, Wilfried Dechau, der den letzten Vortrag, Architektur ist gedruckt am schönsten hielt. Um das künstlerische Niveau der Architekturfotographie zu fördern, gründete er neben dem Architektur- Fotographiepreis „Architekturbild“ den gleichnamigen Verein. Er beschäftigt sich unter Anderem mit den Fragen „Was kann ein Foto transportieren?“ oder „Inwieweit ist ein Foto Täuschung?“. Dabei ist seine eigene Vorstellung einfach: „Möglich ist alles, verboten ist nichts“. Für die Augen der teilweise erstaunten Zuhörer gab es einige Gegenüberstellungen retuschierter und originaler Bilder zu bewundern, welche deren grundsätzliche Prinzipien unterstrichen. „Photoshop täuscht? Eher nicht – es versucht nur erlebtes auf Papier zu bringen!“ Fotographie wird immer eine gewisse Art der Täuschung bleiben, die einen Besuch und das erlebbare, z.B. bestimmte Blickwinkel am Ort des Objekts, nicht ersetzt. Aber die Phantasie jedes Einzelnen bringt auch ein Bild der Wirklichkeit ein Stück näher. Abgerundet wurde die Vortragsreihe HORIZONTE durch das Podium ArchitektenImage im Architekturschaufenster, eine Abschlussveranstaltung des Studienprojektes „Der Architekt in der Gesellschaft“. Wer wissen möchte, über welche Themen diskutiert wurde, kann das in der nächsten Ausgabe von SMAKH nachlesen. ein Beitrag von Adriano Bruno Bilder: Seminar Vorträge SS 2010, Gruppe Presse und Öffentlichkeit Aktuelles WS 2010/11 _ 5 Standpunkt Fachschaft Sag uns deine Meinung! In Kooperation mit der Fachschaft will SMAKH deine Meinung zur Fachschaft wissen. Nimm dir ein paar Minuten Zeit und fülle den beigefügten Fragebogen aus. Den Fragebogen bis zum 31. Mai 2011 bitte in die Motzbox vor dem Fachschaftsraum einwerfen. Der Testlauf der Umfrage im Voraus hat schon einige Standpunkte aufgezeigt, wie du auf der nächsten Seite nachlesen kannst. Als e zu gewinnen! Anreiz zum Mitmachen gibt es tolle Preise 1. Preis: zwei CDs der Diplom- und Masterarbeiten aus dem Sommersemester 2010 2. Preis: eine CD der Diplomarbeiten aus dem Sommersemester 2010 3.-5. Preis: ein Jahressatz 2009 der Zeitschriften DBZ, db oder Baumeister 6.-10. Preis: jeweils ein Freigetränk auf der nächsten Bauhouse-Party Für das Bereitstellen der Preise 1 und 2, bedanken wir uns beim Studiengang Architektur der HS Karlsruhe. Die DokumentationsCDs der Abschlussarbeiten können bei den Mitarbeitern der Fakultät für 5,- € das Stück erworben werden. Die Preise 3 - 5 wurden freundlicherweise von der Firma Uni-Star, Experten für Fachmedien gesponsort. Ein Ansprechpartner von Uni-Star, bei dem ihr Zeitschriftenabos erwerben könnt, ist in regelmäßigen Abständen vor dem Fachschaftsraum anzutreffen. Bei der Preisverleihung ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 6 _ WS 2010/11 Aktuelles Georg Weinreich BA4 „Ich selbst bin nicht in der Fachschaft tätig, da ich einfach keine Zeit dafür finde, aber ich finde es gut, dass es eine Fachschaft gibt, da sie als Kommunikationsorgan zwischen den Studenten, Professoren und der Hochschule wichtig ist. Sie wertet das Campusleben durch das Organisieren von verschiedenen Events auf, sollte sich aber mehr für die Verteilung der Studiengebühren einsetzen und mit der ASTA kooperieren.“ Nik Beiler BA4 „Ich bin in die Fachschaft gekommen, um zu sehen, was da so los ist. Wichtig für mich, dass die Mitarbeit freiwillig ist. Die Fachschaft ist meiner Meinung für die Studenten, nicht für die Professoren. Sie ist ein Ort, wo sich Studenten aller Semester treffen und austauschen. Trotzdem sollten in der Fachschaft noch mehr studiennahe Themen besprochen werden, die Architektur kommt hier zu kurz.“ Marc Friedrich BA4 „Als Fachschaftsvorsitzender würde ich die Fachschaft als Zusammenschluss engagierter Studenten bezeichnen. Sie organisiert hauptsächlich Events, die die Studenten unserer Fakultät zusammenbringen und setzt sich als anonyme Institution für Einzelne ein. Problematisch ist, dass sie zu wenig Präsenz hat und wenige Kommilitonen selbst aktiv werden. Toll wäre es, wenn die Hochschule den Mitgliedern der Fachschaft die Mitarbeit bescheinigen würde.“ ein Beitrag von Vanessa Dettenberg und Florian Keim Bilder: V. Dettenberg, F. Keim G E R S TA E C K E R Künstlerbedarf Grafikbedarf Architektur Modellbau Zeichenbedarf Zuschnitt Künstlermaterial – das Beste für Ihre Kunst Gerstäcker Bauwerk GmbH · Adlerstraße 30-32 (Nähe C& A) 76133 Karlsruhe Telefon 07 21 / 38 77 03 www.gerstaecker.de Wir sind für Sie da: Mo bis Fr 9.00-18.30 Uhr Sa 10.00-16.00 Uhr Reingeschaut Raumpilot Die Bibliothek in unseren Räumen in der Daimlerstraße wird fortlaufend ergänzt durch Neuanschaffungen unterschiedlichster Themengebiete rund um die Architektur. SMAKH hat reingeschaut und hier über ein interessantes neues Buchprojekt berichtet. Autor: Institute der Universitäten Stuttgart und Darmstadt sowie der Hochschule Weimar Das Buch: „Raumpilot“, vier Bände im Schuber uber Herausgeber: Wüstenrot Stiftung Seitenanzahl: 1.591 Seiten Umschlag: Hardcover (22cm x 22mc) Preis: 49,50 € [D] Erscheinungsjahr: 2010 ISBN: 978-3-7828-1544-4 Raumpilot bietet einen lehrreichen Rundumblick durch die aktuelle Gebäudelehre. Ein Grundlagenband und drei Vertiefungsbände „Arbeiten“, „Wohnen“, „Lernen“ liefern Architekten und denen, die es mal werden wollen, Daten, Fakten und Erkenntnisse. Diese werden verständlich visualisiert durch Planungsbeispiele und Zeichnungen, die für diese Buchreihe maßstabsgerecht angefertigt wurden. Die optisch klassisch und haptisch angenehm gestalteten Bücher sind im passenden quadratischen Schuber aufgestellt. Das Werk ist übersichtlich strukturiert, die pastelligen bis kräftigen Farben der Bilder, Zeichnungen, Tabellen und Schaubilder machen das Studieren der Bücher zu einem angenehmen Zeitvertreib. Die Vorstellung, dass Kommilitonen anderer Architekturfakultäten die Buchinhalte mit erarbeitet haben, hat uns bei der Lektüre inspiriert und motiviert. Uns gefällt auch der Ansatz, Raum- und Organisationskonzepte nicht als starre Formen zu erschaffen, sondern die damit verbundenen Funktionen und damit Tätigkeiten l A i h zugrunde d zu llegen. der formalen Ausprägung d dynamisch Über die Kategorisierung der Reihe lässt sich lange philosophieren – wir diskutierten über die Rubrik-Zuordnung der Themen Schwimmbad, Museum, Krankenhaus oder auch Kirche: Gehört das etwa zu „Wohnen“, „Arbeiten“ oder vielleicht doch zum Thema „Lernen“? Dank der ausklappbaren Legende und dem umfassenden Register der Bauten lässt sich auch diese Fragestellung leicht beantworten. SMAKH gefällt diese sorgfältig und detailgenau gearbeitete Buchreihe, wir empfehlen sie als Nachschlagewerk für eure Entwurfsarbeiten. ein Beitrag von Natalia Stüf und Alke Hickel Bilder: Max Seegmüller Aktuelles WS 2010/11 _ 9 Exkursion nach Rom Architekturzeitreise Christoph Schwarzkopf Tempietto di Bramante und Karlsruher Reisende im März 2010 Blick von der Laterne der Petersdomkuppel zum Petersplatz Jede Reise hat ein Ziel. Mal treibt die Abenteuerlust, mal Neugier einen an, dem Ziel nahe zu kommen. Es zu betrachten, zu erleben oder einfach nur mal was Neues kennen zu lernen. Manchmal auch Altes. Es ist von Vorteil, wenn ein Architekt zum Nutzen seiner Tätigkeit in verschiedensten Fachgebieten bewandert ist. Darunter in Mathematik, Geometrie, Kunst sowie Geschichte. Der Griff zu einem dieser Werkzeuge ist Architekturalltag. Ohne Geschichte keine Gegenwart. Deshalb stellt das Wissen über die Architekturentwicklung einen wichtigen Kern, der im Bachelorstudiengang Architektur vermittelten Inhalte dar. Zum Abschluss einer Vorlesungsreihe findet jedes Jahr im vierten Semester eine Exkursion nach Rom statt. Rom ist seit Jahrtausenden immer wieder ein Zentrum der Kunst und beherbergt als eine der großen Kulturstädten Europas zahlreiche Denkmäler von der Zeit der Etrusker bis hin zur Gegenwart. Besonders umfangreich sind die Hinterlassenschaften aus der Epoche des Römischen Reiches. Das Ziel - Motivation - der Reise ist, zeitepochenübergreifend die Architekturentwicklung vor Ort zu betrachten. Aller guter Dinge sind drei. So das Sprichwort. Zum dritten Mal führt in diesem Jahr die Fahrt im Fach „Exkursionsvorbereitung“ nach Rom. Rom, die „Ewige Stadt“. Sehnsuchtsort unzähliger Menschen, gepriesen und gescholten zu allen Zeiten. Für Bildungsreisende seit Jahrhunderten einer der wichtigsten Orte. Baugeschichte, ein für die meisten zu „trockenes“ Fach, findet in Rom durchaus seine nasse Seite: Mit ihrer Abwesenheit an manchen Führungstagen glänzten einige Studenten vor zwei Jahren. Und brachten mir danach bei, dass Rom relativ dicht am Strand liegt…. So ist es immer wieder ein Wagnis, in ein paar Tagen in einer großen Gruppe wesentliches von Rom erfassen zu wollen. Das ist aber nur ein Ziel der Reise. Ein anderes, einmal die Bandbreite der Architektur, die in den Vorlesungen dargestellt wird, in bedeutenden Werken mit eigenen Augen zu sehen. Weniger wichtig ist dabei eine detaillierte Aneignung von Fakten, als vielmehr, Spaß am Sehen zu haben, und vielleicht ein wenig mehr zu verstehen, wenn man sich auf die Reise etwas vorbereitet hat. Dazu zählen die Baugeschichtsvorlesungen, mehr aber die Mitarbeit an dem Reiseführer, der seit diesem Jahr jeweils eine Verbesserung des „Es liegt in der Natur des Menschen sich weiter zu bilden und weiter zu entwickeln.“ Dabei hat die Stadt selbst schier unendlich viel zu bieten. Dem Reisenden vor allem Kunst, Bauten, die im Verlauf von 2500 Jahren ununterbrochener Besiedlung entstanden sind. Der Bildhauer Thorvaldsen hat einmal gesagt: So langsam beginne ich Rom zu verstehen. Ich lebe jetzt hier seit 14 Jahren. vorangegangenen sein soll, um so in einigen Jahren vielleicht sogar gedruckt werden zu können. Aller guter Dinge sind drei. Ja. Aber für Reisen nach Rom kann das kaum gelten. Christoph Schwarzkopf ein Beitrag von Sergej Michailow und Christoph Schwarzkopf Bilder: Christoph Schwarzkopf Exkursion WS 2010/11 _ 11 Bachelorthesis Sommer 2010 Seminar- und Hörsaalgebäude auf dem Campus Karlsruhe Prof. Armin Günster Zur Erweiterung der Hörsaalkapazitäten, sowie der Seminar- und Übungsräume soll in zentraler Lage auf dem Campusgelände der Hochschule Karlsruhe ein Hörsaal- und Seminargebäude mit möglichst flexibler und logisch organisierter Nutzung entstehen. Standortfaktoren Als Ergebnis städtebaulicher Voruntersuchungen, betreut von Prof. Susanne Dürr, befindet sich das Erweiterungsgebiet im Nordwesten des parkartigen Campus. Es stellt ein ideales Bindeglied zwischen Campus und den umliegenden Stellplatzflächen dar. Das Gelände wird zur Zeit geprägt durch einen starken Waldbewuchs, der für die gewünschte Nutzung zum Teil aufgegeben werden kann. An der Ostseite schließt unmittelbar das Gebäude für Architektur und Bauwesen an, südlich liegen die Bauten für Maschinenbau, Wirtschaftsinformatik sowie Labore für das Ingenieurwesen. Dazwischen befindet sich eine Wegebeziehung, die sich aus der fächerförmigen Stadtstruktur von Karlsruhe ergibt. Sinn und Zweck Durch den Entwurf sollte ein zentrales und fachübergreifendes Ensemble entstehen, das als Ort der Begegnung für Studierende, Lehrende und Forschende fundiert. In Verbindung mit der potentiellen baulichen Erweiterung wurden die Beiträge sowohl städtebaulich, gestalterisch, funktional und unter den Aspekten der Nachhaltigkeit untersucht. Die Übereinstimmung von Gestaltung, Gebäudekonzeption und der Konstruktion mit ökologischen, ökonomischen und energetischen Aspekten sollte dabei ein wichtiges Kriterium darstellen. Der Zeitgeist erwartet einen Lösungsvorschlag, der diese Anforderungen berücksichtigt und eine zeitgemäße architektonische Antwort liefern könnte. „Der Standort ist ideal für die Nutzer der unterschiedlichen Fakultäten.“ Raumprogramm Mit einem Gesamtprogramm von circa 2000 Quadratmeter Hauptnutzfläche, einschließlich einem großen Hörsaal mit 450 Quadratmeter und zwei kleinen Hörsälen mit jeweils 180 Quadratmeter, mehreren Seminarräumen sowie Nebenräume für Verwaltung und Rechner- und Netzwerktechnik, sollte das Gebäude durch klare eindeutige Strukturen, Funktionalität und der Realisierbarkeit bestechen. ein Beitrag von Mariane Löser Bilder: Studiengang Architektur Bachelorthesis WS 2010/11 _ 13 Isabell Doll. Cube Die exponierte Position ermöglicht zum einen eine interne Nutzung durch die Hochschule und dient zum anderen als Begegnungspunkt für Besucher. Als Reaktion auf die streng geometrische Gebäudestruktur der Bestandsgebäude wird ein 30 mal 30 Meter Würfel als Gebäudegrundform vorgesehen. Er stellt einen Gegenpol zum R-Gebäude dar. Während das R-Gebäude als Eingangspunkt des Campusgeländes fungiert, stellt der Neubau den Endpunkt dar. Der Würfel ist abgerückt von den Bestandsgebäuden und von der Bewaldung umschlossen, was den Parkcharakter des Bestands unterstützt. Die Aussenhülle wird zum massiven Sichtbetonrahmen, welcher hauptsächlich als Gestaltungselement dient und in den ein vollverglaster Funktionskörper eingeschoben wird. Dieser Körper ist seitlich abgerückt, um ein Wechselspiel aus Innenraum und Aussenraum zu schaffen. Das statische Konzept sieht einen 20 Meter langen Betonkern für den eingeschobenen Glaskörper vor. Isabell Doll 14 _ WS 2010/11 Bachelorthesis Kathrin Dröppelmann. Science Center Karlsruhe Das Gebäude besteht aus zwei Körpern, die in jeweils drei Ebenen unterteilt sind. Die Verbindung der drei Ebenen durch das offene und Licht durchflutete Atrium sorgt für Kommunikation und Austausch innerhalb des Baukörpers. Die erste Ebene soll wie ein Marktplatz des Wissens verstanden werden. Die Seminarräume auf der zweiten Ebene sind bewusst ins Innere des Baukörpers gerückt. Die dritte Ebene dient dem konzentrierten Lernen, sowie der Ruhe. Eine besondere Relevanz für kreatives Arbeiten ist die Balance von Konzentration und Kommunikation. Der neue Baukörper bietet das ideale Begegnungsfeld, er prägt die öffentliche Gesamtwirkung des Wissensquartiers und wird zu einem neuen Anziehungspunkt für den Campus. Die Oberfläche der Fassade aus Corian Platten verleiht dem Science Center seine individuelle Ausstrahlung. Das haltbare und witterungsbeständige Material eignet sich perfekt für die Fassade, da es eine weiche, homogene Oberfläche mit wenig sichtbaren Fugen schafft. Zur Beheizung und Kühlung der Hörsäle und Seminarräume dienen die bauteilaktivierten, mit Wasser durchspülten Stahlbetondecken. Eingespannte Stützen bilden gemeinsam mit Trägern ein Rahmentragwerk und werden durch Stahlbetonverbunddecken, sowie fünf Massivkerne und weitere Massivwände in den Ebenen ausgesteift. Kathrin Dröppelmann Bachelorthesis WS 2010/11 _ 15 Daniel Nieb. Betonskulptur auf Glas Das Baugrundstück als Randstein des Campus bringt prinzipiell eine Ecksituation mit sich. Es ergibt sich ein Baukörper, der erstens hohe Zugänglichkeiten, zweitens als Randstein den Campus abschliessen, aber gleichzeitig eine Durchwegung zulassen muss, und drittens zukünftige Entwicklungen nicht einschränken darf. Grundidee um diese Anforderungen zu erfüllen, ist das Hochheben der Funktionsbereiche, als massiver Körper, auf zwei Glaskörper. So wird maximaler Raumfluss 16 _ WS 2010/11 und eine Durchwegung des Gebäudes im Erdgeschoss erreicht. Ferner wird sich die Steigung der Hörsaalsitzreihen zunutze gemacht, um damit eindeutige Eingangsperspektiven zu formulieren und sich in Richtung des Campus und zur Natur zu öffnen. Gleichzeitig wird so ein Platz im Süden eingefasst, der das Gebäude über den öffentlichen Weg hinweg mit dem Campus verbinden soll. Die Hörsäle funktionieren mit den zugehörigen Boxen als statische Einheit. Daniel Nieb Bachelorthesis Maxim Winkler. Raumfluss mit Weitblick Ein Baukörper, der den Durchgang versperrt wird negativ gesehen, somit muss das Gebäude um ein Geschoss angehoben werden. Nun hat man einen freien Blick durch das Gebäude. Aus dem Inneren heraus, bedingt durch die ansteigenden Sitzreihen im Hörsaal, entsteht an der Front die Schräge, die auch gleichzeitig den Haupteingang definiert und dem Gebäude eine Richtung gibt. Die Schräge vom Hörsaal und die Schotten verstärken den Durchfluss und das Anheben des Gebäudes. Unter der Auskragung betritt man das grosse offene Foyer und erreicht über die Treppenanlage die im ersten Obergeschoss liegenden Hörsäle und Seminarräume.Im zweiten Obergeschoss liegen weitere Seminarräume sowie die Verwaltung und ein PC-Pool für die Studierenden. Die drei Hörsäle liegen alle nebeneinander und das Tragwerkskonzept ermöglicht allen drei Hörsälen eine Verbindung zu einem grossen Saal. Die Hörsäle sind in dem vorderen Teil des Gebäudes, mit der Nähe zum Campus angelegt. Mit Blickrichtung auf den Campus befindet sich südlich ein Balkon, durch seine Tiefe wird die direkte Sonneneinstrahlung im Sommer vermieden. Der Seminarbereich befindet sich im hinteren Teil des Gebäudes, näher zur Natur und frei von direkter Sonneneinstrahlung. Durch die Deckenöffnungen in beiden Geschossen ist die Kommunikation geschossübergreifend und bis zum Foyer möglich. Durch den Balkon, das offene Foyer im Erdgeschoss sowie durch weitere funktionale Vorteile, wurde der Campuscharakter aufgenommen. Maxim Winkler Bachelorthesis WS 2010/11 _ 17 Sakralraum im Profanraum Masterthesis Sommersemester 2010 Hans-Peter Weber Lage: Gebäude in Frankfurt Gallus Grundgedanken: In einer Zeit, in welcher das Profane durch die Beschleunigung von Wissenschaft und Technik immer stärker angetrieben wird, ist das Individuum Mensch „auf der Flucht“. Es sucht etwas. Erholung, Entspannung, Entschleunigung. Der hippe Import asiatischer Kultur zur Suche nach dem Ich wird genutzt, um unsere FastFood Kultur für wenige Augenblicke beiseite zu schieben. Das beweist, dass sich der Mensch bewusst oder unbewusst nach einer „inneren Heimat“ sehnt: Dem Ich - mit oder ohne Gott. Profane Orte wie Büro, Bahnhof, Straßenbahn, Einkaufszentren, Flughäfen und Messehallen eignen sich hierfür nicht. Und doch oder genau deshalb werden hier, an enorm säkularen Orten, Räume geschaffen, an welchen man sich für wenige Minuten vom Alltag losreisen kann, um neue Kraft zu schöpfen, Mitgefühl zu fördern oder zu beten. Sakrale Orte wie etwa Kirchen, Moscheen, Synagogen, Kapellen, Friedhöfe und Aussegnungshallen dienen neben Andachtsräumen, Meditationsräumen und Räumen der Stille als solche Orte. Man kann zu sich selbst sprechen, man kann zu Gott sprechen, man lässt die Außenwelt Außenwelt sein. Intension und Ziel war es durch eben diese Parameter ein sakrales Zentrum an einem geeigneten Ort zu schaffen, welcher von vielen Konfessionen und Kulturen für die erwähnten Bedürfnisse als Ort der Stille genutzt werden kann. Stadtperspektive: Blick über Frankfurt Ort: Frankfurt Gallus, zwischen Messe und Hauptbahnhof liegend, umgeben von Wolkenkratzern, Verkehrslärm und Hektik, bietet das optimale profane Umfeld für den Sakralraum, denn Sakralität ist dort am ehesten spürbar, wo der stärkste Kontrast zum Profanen auftritt. Entwurf: Der Bau sollte den verglasten Hochhausbauten bewusst entgegentreten. Es bedarf einer enormen Baumasse, um im städtischen Sinn eine Positivraum darzustellen. So kommt der Entwurfsgedanke einem Steinblock als Kontrast zu den dort üblichen Glasfassaden, gleich, welcher sich nach außen hin nur bedingt öffnet. Er wird durch einen großzügigen Innenhof in zwei Teile aufgegliedert: Den Sakralbau und das Gemeindezentrum. Beide Bauten werden durch eigene Erschließungszonen getrennt. Der Kirchenraum ist durch eine hohe schluchtenartige Vorzone vom Profanraum abgetrennt. Die Fassade ist durch ein Kreuz gekennzeichnet, durch welches man hindurch gehen muss, um den Kirchenraum zu erschließen. Der Sakralraum bietet zum einen der vorhandenen evangelischen Matthäusgemeinde Raum für Gottesdienste. Darüber hinaus dient ein weiterer Raum, welcher dem großen Kirchenraum bei entsprechenden Veranstaltungen zugeschalten werden kann, als ökumenischer Meditations- und Betraum. Die Wand zum Innenhof hin ist gen Osten ausgerichtet, um auch Muslimen und Orthodoxen Gläubigen ein Raum für Gebet zu bieten. Alle Wände, mit Ausnahme die des Eingangs, sind geneigt, sodass sich der Raum zum Himmel hin öffnet. Kleine Gebetsnischen bieten dem Ruhesuchenden genügend Privatsphäre. Der Kontrast von hellen Lichteinflüssen und dunklem Raum verleihen dem Sakralbau eine besondere Atmosphäre. Der Altar, als der Opfertisch Jesu, wird besonders hervorgehoben. Die Decken bestehen aus teilweise geöffnet und geschlossenen Rippen in welchen der Schall entsprechend absorbiert wird. Die Orgel und der Chor(raum) befinden sich über dem Erdgeschoss und bringen somit den Klang von oben über die Gemeinde. Große Lamellen können den Kirchenraum mit dem Innenhof verbinden. Dieser soll ebenfalls zu gottesdienstlichen Zwecken genutzt werden. Der Innenhof, welcher als zentraler Vorplatz zum Erreichen aller Eingänge des Zentrums dient, wird um 85 Zentimeter angehoben, um sich bewusst vom Profanraum zu lösen. Das Zentrum wird in drei Geschosse unterteilt. Im Erdgeschoss befinden sich ein Hofladen sowie ein großzügiges Refektorium. Letzteres ist ebenfalls durch große Lamellen mit dem Innenhof verbunden. Im mittleren Geschoss bietet ein Mehrzweckraum sowie weitere Ausstellungsräume mit Galerie Platz für kulturelle Veranstaltungen. Das Obergeschoss dient ausschließlich als Kindergarten und Kinderhort. Masterthesis WS 2010/11 _ 19 Perspektive: Blick in Refektorium Grundriss: Erdgeschoss mit Gottesdienstraum Die Schüler der benachbarten Schulen werden hier mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung versorgt. Ein großzügiger Innenhof, welcher sich durch Verglasungen mit den Räumlichkeiten des Kindergartens verbindet und den Himmel rahmt, bietet geschützte Spielmöglichkeit für die Kinder. Zur Südseite hin orientiert befinden sich über die drei Geschosse verteilt Pfarramt im ersten Obergeschoss sowie Wohnungen für Pfarrer und Küster im Erdgeschoss und zweiten Obergeschoss. Durch die hohen Decken in allen Teilen des Kirchenzentrums wird auch hier sakrale Atmosphäre spürbar. 20 _ WS 2010/11 Masterthesis Perspektive: Gesamtgebäude von außen Die Masterthesis bildet den Abschluss eines zehnsemestrigen Studiums und sollte eine Art von konzentrierter „Essenz“ aus der Fülle dessen bieten, was fünf Jahre an Erfahrung gebracht haben. In der Arbeit soll eine grundsätzliche, übergreifende Fragestellung behandelt werden. Sie setzt sich in der Regel aus einem theoretischanalytischen und einem praktischem Teil in Form eines Entwurfsprojekts zusammen. Die Masterthesis markiert einen Übergang; man könnte das Bild eines Tores verwenden, das einerseits abschließt (und damit vermeintlich Sicherheit bietet), andererseits sich öffnet und damit den Weg freigibt, Neues zu entdecken. Es führt aus der tendenziell introvertierten, (einigermaßen) geordneten Welt des Studiums mit seinen Regeln und Rezepten hinaus. In der Konsequenz unterscheidet sich die Masterthesis damit in zwei wesentlichen Punkten von der bisherigen Diplomarbeit: 1. Die Studierenden wählen ihre Themen selbst. Dies bietet die Möglichkeit, eigene Interessen (die im Zuge der Themenfindung oft erst „entdeckt“ werden) zu vertiefen und auf diese Weise vielleicht schon einen ersten Schritt hin zur Selbständigkeit zu tun, sich zumindest seine Grenzen selbst zu setzen. 2. Die Arbeiten werden von uns Dozenten begleitet und während des Entstehungsprozesses in mehreren Kolloquien vorgestellt und diskutiert. Prof. F. Burgstaller ein Beitrag von Melanie Hüther Bilder: Hans-Peter Weber Text: Prof. F. Burgstaller, Hans-Peter Weber Städtebau-Diplom SS 2010 Denkmal_Kaserne Prof. Susanne Dürr 22 _ WS 2010/11 Diplom Städtebauliche Analyse der Artillerie-Kaserne von Katharina Übereck Motivation Aus der Vergangenheit der Residenzstadt Karlsruhe sind Militärbrachen ein wichtiges und großes Flächenpotenzial des heutigen städtischen Wandels. Verwaltungszentren (Grenadierkaserne), die modellhafte Nachverdichtung der amerikanischen Nordstadt, neue Wohnmodelle (MIKA, Smiley West), Baugemeinschaftsquartiere oder Bildungs- und Freizeitschwerpunkte (Dragonerkaserne) sind nach Abzug der Truppen ab 1991 über den Flächen vergangener Kriegsführung entstanden und wurden Teil der heutigen Stadt. Aber immer noch warten militärische Flächen und Gebäude auf eine neue Zweckbestimmung, das „Verdauen“ braucht Zeit, Bedarf, Finanzen und Planungskräfte. Die Artilleriekaserne an der Moltkestraße blieb eine dieser Reserven. Situation Im Westen der Stadt, zwischen Moltkestraße im Süden, Kußmaulstraße im Osten und Norden und Hertzstraße im Westen liegt die Artilleriekaserne mit einer Größe von mehr als fünf Hektar. Das Areal befindet sich westlich des städtischen Klinikums, südlich der Bundeswasseranstalt, in der Nähe der Westhochschule / KIT. Die Straßenbahnlinie 2 in der Moltkestraße führt an der Kaserne vorbei, die Haltestellen Kußmaulstraße und Hertzstraße garantieren den direkten Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr. Die Nutzungen an der Kußmaulstraße werden sich wohl nicht verändern. Die parallele schmale Seitenstraße führt in eine von Mauern umschlossene improvisierte Welt. Hier existieren Freiräume, die nach Neuordnung, Nachverdichtung und Überbauung rufen. Aufgabe Die Artilleriekaserne ist ein Kulturdenkmal. Ihre Nachbarn besitzen besondere Ausstrahlung und es haben sich viele Gewerbetreibende niedergelassen. Das Wohnangebot ist ausgewogen, die Möglichkeiten der Stadt Arbeitsflächen anzubieten sind dagegen begrenzt. Anhaltspunkte für die Neustrukturierung könnten beispielsweise Bildungsfunktionen, das Krankenhaus ergänzende Funktionen sowie kulturelle Nutzungen sein. Dabei ist zu beachten, dass der Wandel der Stadt kontinuierlich geschieht: die phasenweise Inbesitznahme ist daher eine realistische Option. Grundlegende Forderungen im Entwurf sind Energieeffizienz und sparsamer Resourceneinsatz sowie die Überprüfung, in wie weit der Denkmalschutz den neuen Lebensabschnitt des Stadtquartiers beeinflussen sollte. Diplom WS 2010/11 _ 23 Andreas Ramsteiner. Fundament Wissen Entwurfsmotto: Auf dem Gelände der Artilleriekaserne entsteht eine interdisziplinäre Forschungs- und Unternehmenslandschaft, welche die Synergieeffekte der Umgebung nutzt. Im Innern der Gebäude wird ein hohes Maß an Kommunikation unter den einzelnen Nutzern gefördert. Freiraum: Das Areal hat insgesamt drei Höfe. Den Auftakt zu den Höfen bilden die Plätze Richtung Klinikum und KIT, welche durch ihre ruhige und zurückhaltende Gestaltung bestechen. Lediglich Beleuchtungselemente bilden die Möblierung. Einer der beiden großen Höfe erhält ein Holzdeck, welches als Ruhezone zum Aufhalten und Kommunizieren dient. Der zweite Hof besitzt große Freiflächen, die für Veranstaltungen genutzt werden können. Der Innenhof der Blockrandbebauung dient mit seinen Grünflächen und Sitzmöglichkeiten der Erholung. Baustruktur: Das Gebiet wird bis auf seine historische Struktur rückgebaut. Um die Ausnutzung der Flächen zu erhöhen wird der geschichtsträchtige Bestand der Kaserne aufgestockt. Dies gewährleistet auch die Erhaltung der historischen Strukturen und Höfe in ihrer ursprünglichen Form. Zwei neue Baukörper definieren den südlichen Eingang des Areals. Im Norden wird die Blockrandbebauung geschlossen. Eine Hauptachse, von Fußgängern und Radfahrern benutzbar, verknüpft KIT und Klinikum. Richtung Stadt wird das Areal markiert durch den Gästeturm, welcher an der Schnittstelle zwischen Klinikum und dem Baufeld entsteht. Funktionsmischung: In der Schnittstelle des Areals befindet sich das zentrale Gebäude, welches zum Gedankenaustausch in verschiedenen Räumen einlädt. Außerdem bietet es allen Nutzern Entspannungs- und Fitnessräume. Das Gebäude ist mit den einzelnen Homebases verbunden, welche je nach Bedarf Labore oder Büros beinhalten. Zwischen den einzelnen Einheiten liegen Plätze die zum Austausch von Ideen und Gedanken einladen. Fazit: Durch die Verkleidung der Aufstockungen mittels eines Metallgewebes entstehen ruhige Baukörper, welche den geschichtsträchtigen Bestand nicht dominieren. Die mittels Beleuchtung betonte KIT-Klinikum-Achse leitet den Besucher durch das Areal. Diplom WS 2010/11 _ 25 Laura Dierks. 26 _ Urbane Matrix WS 2010/11 Diplom Entwurfsmotto: Die Artilleriekaserne ist schon heute ein potentieller Anlaufpunkt und hat die Chance die umliegenden Strukturen perfekt zu verbinden und die Menschen zusammen zu bringen. Der Entwurf nimmt sich der besonderen Begebenheiten des geschichtsträchtigen Ortes an und belebt diese durch neue Elemente. In Zukunft soll die Kaserne sowohl als Denkmal als auch eine neue zeitgenössische Landmarkierung fungieren. Freiraum: Die drei Höfe werden miteinander verbunden. Eine neu eingefügte Skulptur, das Rückgrat – ein alles verbindendes Band, soll eine spannende interaktiv zu erlebende Raumfolge entstehen lassen. Auf der einen Seite bietet das Rückgrat Hofplätze für Schüler, Studenten und Eltern. Auf der anderen Seite fächert sich das Band in skulpturale Freibereiche mit Rückzugsmöglichkeiten und Liegewiesen aus. Baustruktur: Die neuen Bauvolumen fügen sich modelliert in den städtischen Kontext ein und beleben den urbanen Kontext. Es werden neue Verknüpfungen hergestellt, doch eine Invasion vermieden. Die Bauvolumen konzentrieren sich an den sichtbaren, prägnanten Stellen auf die Straßenanbindung, wodurch die Kanten geschlossen werden. Funktionsmischung: Die im neuen Zentrum angesiedelten Nutzungen verbinden die Funktionen der Nachbarschaft miteinander. Ein für jedes Publikum ansprechendes Angebot an Kommerz, Bildung und Kunst wird geschaffen, so dass das Denkmal zu einem Erlebnis für jedermann wird. Fazit: Durch das vielfältige Angebot und die dadurch entstehende hohe Aktivitätsdichte wird ein interaktives Ereignis in mitten dynamischer und vielfältig genutzter Stadträume geschaffen. Die alte Kaserne wird zur zukunftsweisenden aufregenden Urbanen Matrix. ein Beitrag von N. Hellriegel und A. Mersljakow Bild / Text: Prof. S. Dürr, A. Rammsteiner, L. Dierks K. Übereck Diplom WS 2010/11 _ 27 Diplom Hochbau SpeicherStadtErweiterung Interventionen im Rheinhafen Prof. Florian Burgstaller Gegenstand der Diplomarbeit im Sommer 2010 war der 1899-1901 erbaute Karlsruher Rheinhafen, mit Gebäuden wie der Werfthalle 1, Werfthalle 3, Elektrizitätswerk und dem Getreidelagerhaus. Nach wie vor werden diese Gebäude für das Wirtschaftsunternehmen Rheinhafen gebraucht, jedoch gab es in den letzten fünf Jahren Umbauten, Abrisse und Neubauten, die unter architektonischen, städtebaulichen und denkmalpflegerischen Aspekten einen bitteren Beigeschmack hatten. Daraus entstand die Aufgabe, den Funktionsbereich des Rheinhafens zu erweitern, um somit den Erhalt des historischen Ensembles nicht nur vom Nutzen für den Hafenbetrieb abhängig zu machen. Durch das Schaffen weiterer Nutzungsmöglichkeiten (die Invention) und somit das Eingreifen und Hinzufügen weiterer Bauteile in den heutigen Bestand (die Intervention), sollten neue Akzente gesetzt werden, die eine lebendige, multifunktionale Speicherstadt entstehen lassen. Wichtig dabei war, die Nutzung des Hafenbetriebes nicht zu ersetzen, sondern zu erweitern. Die einzige weitere Einschränkung war, eine Mischung aus Kunst und Kommerz zu schaffen, um eine realistische Basis für das Projekt zu schaffen. Dabei wurde kein konkretes Raumoder Funktionsprogramm vorgegeben, was für die Studenten zwar viele Fragen offen ließ, damit jedoch auch enorm viele Ideen und einen weiten Horizont eröffnete. Das Ziel war es, den Funktionsmix architektonisch charakterisierend einzusetzen, um das Ensemble in seiner Prägnanz zu steigern. Diplom WS 2010/11 _ 29 Mona Madina. portovelo portovelo entfaltet seine Wirkung zuerst außen, dann innen. Der Bau gibt sich auf den ersten Blick als Ikone - wie ein geschliffener Edelstein, der sich gegen die Backsteinarchitektur des Rheinhafens stellt und eine eigene Figur in das Ensemble einbringt, womit er sich und den Rheinhafen zugleich zum Markenzeichen macht. Das Nutzungsangebot für den Neubau ist durchdacht und bewusst gewählt. Im Inneren entwickelt sich eine Erlebniswelt, die den Zeitgeist aufgreift. Durch bewusstes Abrücken und Drauflegen des Neubaus auf den Bestand, werden die Wände freigestellt und in ihrer Architekturgliederung erlebbar. Der Wechsel von offenen Emporen und introvertierten Räumen erzeugt ein spannendes Raumerlebnis. Das Durchschreiten des portovelos über Stege, Rolltreppen und Rampen ist ein Erlebnis wert. Es entsteht ein offenes Haus mit vielfältigem Angebot und unterschiedlich bespielbaren Orten. Form und Materialität lassen einen Ort mit Atmosphäre entstehen, der neugierig macht – der einen Besuch wert ist. Mona Madina Diplom WS 2010/11 _ 31 32 _ WS 2010/11 Rubrik Cora Lutz. Alte Lotte Die autonome Bauform ergänzt den Bestand, indem es sich in zwei Gebäude hinein schiebt. Obwohl relativ aufwendig konstruiert, wirkt es, als ob es sich über Nacht in die Gebäude gepflanzt hat. So steht es als Kontrast zum ehrlichen Mauerwerksbau. Der Neubau steht für sich als eigenständige For, bildet jedoch trotzdem drei unterschiedliche Zonen: Es gibt die beiden Räume an den Seiten, die rechts im Getreidespeicher die Silos erlebbar machen und links die Erfahrung der bestehenden Dachkonstruktion ermöglichen. Der mittlere Teil ist ein neu entstandener Raum, der für jegliche Veranstaltungen, wie Tanz, Empfang, Versammlung im Allgemeinen genutzt werden kann. Ein typischer Name für Frachtschiffe war seit jeher die „alte Lotte“. Der Entwurf liegt ruhig im Lagerhafen wie ein Schiff und ist schön wie eine Frau. Die alte Lotte ist auch bekannt als abgelegte Freundin. Somit hat sie etwas Nostalgisches. Der Rheinhafen mit seiner langen Tradition als Lagerhafen zeugt noch heute von vergangener Zeit. Die alten Gemäuer stehen im Kontrast zu modernen Hafentechniken und muten eher romantisch als fortschrittlich an. Cora Lutz Diplom WS 2010/11 _ 33 Modelle von Markus Popp, Mona Madina, Ann-Sophie Jarvis, Verena Hartbaum, Cora Lutz, Claudia Nitsche Fazit Wie man nicht nur an den aufgezeigten Beispielen sehen kann, bietet auch das Aufgabenfeld „Bauen im Bestand“ eine Vielzahl möglicher Entwurfsansätze. Das zeigt, dass Bauen im Bestand nicht unbedingt Einschränkung, sondern vielmehr Herausforderung und damit auch Chance darstellt. Nichtsdestotrotz verlangt der Umgang mit dem schon Vorhandenen dem Architekten eine gewissen Feinfühligkeit ab, was diese Aufgabe umso interessanter macht. Des Weiteren gewinnt dieser Bauzweig in unserer heutigen, urbanen Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Diese Tatsache und die relativ offene Aufgabenstellung forderten ein hohes Maß an 34 _ WS 2010/11 Diplom Kreativität. Das mündete, wie man auch an den oben dargestellten Modellfotos sehen kann, in 36 Arbeiten, die ihre Individualität durch Formensprache, Nutzungsart und mehr oder weniger starkes Eingreifen in den Bestand deutlich machen. Zusammenfassend war diese Aufgabe mit ihren Lösungen ein Schritt in die richtige Richtung. Die komplette Dokumentation aller Diplomarbeiten „SpeicherStadtErweiterung“ ist auf einer DVD bei den Assistenten der Fakultät Architektur erhältlich. ein Beitrag von Andreas Hormuth und Simon Bläsi Bilder: Studiengang Architektur, Max Seegmüller, Dominik Burkard Experimentelles Bauen Anmerkungen zum Integralen Projekt MA3 im Wintersemester 10/11 Prof. Florian Burgstaller Der Begriff Experiment im Architekturentwurf Unser Masterstudium steht unter dem Motto Form und Experiment. Der Integrale Entwurf des dritten Mastersemesters – und damit des letzten vor der Abschlussarbeit, der Masterthesis – soll laut Studienplan das Experimentelle Bauen in den Mittelpunkt stellen. Der Begriff des Experiments taucht also doppelt auf, und die Fächerbeschreibung des Integralen Projekts (verfasst 2006, als der Master noch in weiter Ferne lag), die sich wie die Kurzfassung eines Forschungsprojekts liest, interpretiert ihn tendenziell technologisch: Ein Schwerpunkt des Masterstudiums stellt die angewandte Forschung innerhalb der architektonischen Planung dar. Auf Basis experimenteller Studien hinsichtlich Materialität und deren Anwendungsmöglichkeiten, Statik und deren technologischen Zusammenhänge, Bauphysik in Bezug zu Umwelt und Klima und Realisierung von einfachen Baustrukturen soll praxisnah die Umsetzung von Entwurfslösungen in die Realität oder in Modellen größeren Maßstabs geübt werden. Dieser Text ist angesichts unserer aktuellen Erfahrungen sicherlich zu überarbeiten. Die mit der ersten Master-Generation Hülle und Fülle mittlerweile eingetretene Realität zeigt, dass das Forschen innerhalb des Architekturstudiums sinnvollerweise als ein entwerfendes Forschen, ein Forschen an der (städte-) baulichen Struktur und der architektonischen Gestalt zu verstehen ist – im Unterschied zu einer vom Entwerfen losgelösten, rein wissenschaftlich ausgerichteten Forschung. Dennoch scheinen die 2006 formulierten Lernziele nach wie vor aktuell: Das Aneignen von Methodenkompetenzen des Einzelnen sowie Sozialkompetenzen der Arbeitsgruppenmitglieder, resultierend aus den Voraussetzungen der Teamarbeit, sind die wesentlichen Lernziele im Fach Experimentelles Bauen. Selbständiges Planen, Durchführen und Auswerten des praktischen Projekts dienen hierbei sowohl als Vehikel als auch als Dokumentation der erreichten Ziele. Bei allen Diskussionen über erweiterte, generalistische Berufsbilder der Architekten und das sicher notwendige Aneignen von zusätzlichen (Management-) Kompetenzen sollten wir jedoch nicht aus den Augen verlieren, dass unsere Kernkompetenz immer noch das Gestalten von Körpern und Räumen ist. Dieser Gedanke steht letztlich auch hinter dem Motto des Masters – Form und Experiment. Man könnte es auch so ausdrücken: Die Form ist das Ziel, der Weg dazu das Experiment. Der experimentelle Charakter des Integralen Projekts liegt demnach nicht in erster Linie in der Themenstellung, sondern in der Arbeitsweise; Ziel ist die „Emanzipation“ der Studierenden von Rezepten, Lehrsätzen und Wahrheiten und damit von der Gewissheit, dass immer jemand da ist, der weiß, „wie es geht“. Der methodische Ansatz ist nicht mehr der Frontalunterricht des Bachelor, sondern ein ergebnisoffener Prozess, in dem Studierende und Lehrende gemeinsam sowohl an aktuellen wie zeitlosen Architekturthemen arbeiten. Dass das Begleiten dieses Prozesses durch mehrere Dozenten (z.T. unterschiedlicher Disziplinen) bei den Studierenden auch zu einer gewissen Verunsicherung führt, ist dabei kein Systemfehler, sondern sinnvoll und notwendig. Es geht in diesem Stadium darum, sich endgültig vom „Schülerdasein“ zu verabschieden und das Bewusstsein für die Eigenverantwortlichkeit zu entwickeln. Lehre WS 2010/11 _ 35 Experimentelles Bauen / Bauen im Bestand – ein Widerspruch? Das Integrale Projekt, das die Studierenden im 3. Mastersemester zu bearbeiten hatten, trägt den Titel „Hülle und Fülle“ – ein Bild, das einerseits unbegrenzte Möglichkeiten assoziiert, andererseits dieses Schöpfen aus dem Vollen jedoch nachdrücklich einschränkt durch bereits Vorhandenes, mit dem umzugehen ist, das also gefüllt oder eingehüllt werden soll. Tragstruktur, die mit einer neuen Hülle versehen werden soll, im anderen um eine vorhandene historische Hülle, die ein neues Innenleben (Haus im Haus) erhält. Der Bestand liegt also einmal innen, einmal außen. Das Neue entsteht im intensiven Dialog mit dem Alten. Was unsere Aufgabenstellung hier als Reiz der Kombination von Vorhandenem und Hinzugefügtem beschreibt, trägt gleichzeitig die latente Gefahr einer Ideenbremse Das Neue entsteht im intensiven Dialog mit dem Alten. Unter dem Motto Hülle und Fülle werden zwei exemplarische Situationen im Bestand einer Metamorphose unterzogen: Im einen Fall geht es um eine bestehende 36 _ WS 2010/11 Lehre in sich, könnte sich also möglicherweise als Hemmschuh für die Entfaltung kreativer Gedanken auswirken. Diese Einschätzung des Planens im bzw. mit Bestand als Entwerfen mit angezogener Handbremse ist bekannt und immer noch weit verbreitet; sie wird jedoch mit jedem spannenden und intelligenten Konzept, von denen in den letzten Jahren unzählige realisiert und veröffentlicht wurden, einmal mehr widerlegt – nicht zuletzt auch durch die Ergebnisse der ebenfalls in diesem Heft dokumentierten Diplomarbeit im Karlsruher Rheinhafen. Alle namhaften Architekten haben den vorhandenen Kontext als Chance erkannt, ihren Projekten eine unverwechselbare Note zu geben, die zwischen leisem, sensiblem Weiterbauen und lautem, aggressivem Kontrast changiert. Das Bauen im Bestand hat dem Neubauen, nicht nur, was die Zahl der Bauaufträge betrifft, den Rang abgelaufen. Diese Erkenntnis muss sich auch in den Entwurfsthemen unseres Studiums niederschlagen; andernfalls würden wir Gefahr laufen, sowohl von der aktuellen Entwicklung im Bauwesen, als auch von der spannenden ästhetischen Diskussion des kontextuellen Entwerfens, abgehängt zu werden. Wie steht es aber nun mit dem Verhältnis der beiden Parameter, die dieses Masterprojekt bestimmen – Bestand und Experiment? Liegen die Bereiche des Bauens im Bestand und des experimentellen Bauens nicht meilenweit auseinander, sind die beiden also letztlich unvereinbar? Dass diese landläufige Sichtweise heute überholt ist, zeigen zahlreiche Beispiele Der experimentelle Gedanke erstreckt sich also auf alle Ebenen des Entwurfs, er bestimmt letztlich über die Schlüssigkeit und Überzeugungskraft der Arbeit. intelligenter, zeitgemäßer und spannungsvoller Arbeiten in und mit vorhandenen Strukturen, denen ein spezifisch experimenteller Ansatz zugrunde liegt (Objekte u.a. von Piano, Herzog&de Meuron, Zumthor, Hadid, Lacaton+Vassal, Nieto Sobejano, Staab, Chipperfield ...). Der bauliche Bestand bringt zunächst Einschränkungen der entwurflichen „Freiheit“ mit sich, regt aber umso mehr zu besonderen, eigenständigen und nicht austauschbaren Lösungen an. Die Herausforderung besteht darin, das Vorhandene durch das neu Hinzugefügte zu stärken, spannungsvoll zu kontrastieren, dabei jedoch nicht zu degradieren. Der experimentelle Charakter des Projekts liegt im Fehlen eines Rezeptes, eines passenden Vorbildes, einer Standardlösung (…). Gesucht sind Ideen, die das Vorhandene prototypisch weiterentwickeln. Die Herausforderung besteht in der Integration unterschiedlichster Aspekte – Struktur, Konstruktion, Form, Raum, Material, Licht, Energie, Klang, Atmosphäre, Zeichenhaftigkeit usw. – zu einem stringenten Ganzen. Der experimentelle Gedanke erstreckt sich also auf alle Ebenen des Entwurfs, er bestimmt letztlich über die Schlüssigkeit und Überzeugungskraft der Arbeit. Mit diesem Auszug aus unserer Aufgabenstellung beziehen wir also dezidiert Position: Bauen im Bestand und experimentelles Bauen sind kein Widerspruch; im Gegenteil - sie bedingen und ergänzen einander in exemplarischer Weise. Dass das Thema Experiment im Masterstudium in den nächsten Jahren vertieft, variiert und präzisiert werden muss, steht für uns außer Frage. Wir als Dozenten lernen an diesem Prozess mindestens genauso viel wie die Studierenden. Die spannende Vielfalt der Lösungsansätze, die das Projekt „Hülle und Fülle“ hervorgebracht hat, dokumentiert jedoch, dass wir auf einem guten Weg sind. ein Beitrag von Kristina Dentzel Bilder: D. Crehner (Fotolia), Kristina Dentzel Text: Prof. Florian Burgstaller Lehre WS 2010/11 _ 37 Aufgemessen und gezeichnet von: Markus Bähr, Christian Eichhorn, Dominik Fieser, Benjamin Genter „Ein Haus kann nur leise zu uns sprechen...“ Bestandsaufnahme Robert Crowell Robert Crowell, geboren in Morehead City, North Carolina (USA), studierte an der Universität Karlsruhe, an der er 1982 diplomierte. Seine Ehefrau Barbara KolliaCrowell, geboren in Athen, studierte ebenfalls an der Universität Karlsruhe, wo sie promovierte. 1985 gründeten sie das Architekturbüro „Crowell-Architekten“ in Karlsruhe. Das Interesse und die Faszination für die Baugeschichte führten dazu, dass sich das Büro Crowell immer mehr Aufgaben rund um das Thema „Bauen im Bestand“ widmete, beispielsweise der Erweiterung des Schlosses Schwetzingen, dem Firstständerhaus Zeutern und dem Grasseggerhaus Neuburg. 1992 begann zunächst Barbara Crowell an der Hochschule Karlsruhe zu unterrichten bis 1998 Robert Crowell das Fach „Bestandsaufnahme“ übernahm. 38 _ WS 2010/11 Lehre Fachwerkhaus in Au am Rhein Das Rathaus Calw ist eines der vielen Exkursionsziele Objekt: Das unscheinbar wirkende Fachwerkhaus in Au am Rhein wurde 1719 errichtet und nach mehreren Bauphasen im 19.Jahrhundert erweitert und umgebaut. Soweit bekannt war es damals ein Schulhaus, wie früher üblich mit einer Wohnung für den Lehrer. Im Laufe der Zeit diente es auch anderen Zwecken: einmal als Rathauskomplex, alte Forststelle und später als Wohnhaus. Es ist, nach Crowells Auffassung, sehr gut geeignet, weil es in der Nähe der Hochschule ist, leer steht und sich 20 Studenten problemlos zur gleichen Zeit darin aufhalten und bewegen können. Auch gibt es im und an dem Haus viel zu entdecken. „Es ist wie eine Philosophie: Wir müssen einen anderen Blick entwickeln!“ „Sind Risse in der Fassade, wölben sich die Wände, welcher Teil wurde zuerst errichtet, gibt es historische Besonderheiten?“ Viele Mängel findet man nur durch gründliches Forschen und präzises Vorgehen, je besser die Vorarbeit, desto effektiver kann die Planung und die Ausführung vorangetrieben werden. „Es gibt kein Gebäude, das keine Überraschung bietet.“ „Es ist wie eine Philosophie: Wir müssen einen anderen Blick entwickeln!“, so Crowell. Bauen im Bestand nimmt inzwischen einen Großteil der Architektenaufgaben ein und wird, besonders in Deutschland, immer wichtiger. Inhalte/Motivation: Die Studierenden lernen genauer hinzusehen, nur dann wird erkennbar welche Stützen am Fußpunkt morsch, welche Deckenbalken durchgebogen sind oder Bruchstellen aufweisen, wo Spuren aufsteigender Feuchte erkennbar und wo Stahlträger korrodiert sind. Das Gebäude wird gründlich erforscht und untersucht. Lehre WS 2010/11 _ 39 Baunaht – erst auf den 2.Blick erkennbar Methodik/Techniken: Das Pflichtfach Bestandsanalyse findet im Bachelorstudiengang im 5. Semester als einwöchiges Blockseminar statt. Die Woche gliedert sich in drei Teile: Theorie, Bestandserfassung vor Ort und Exkursion. Im Theorieteil bereitet Herr Crowell die Studenten auf die Praxis vor mit Hintergrundwissen über Baugeschichte und Haftungsfragen anhand von eigenen Beispielen. Im praktischen Teil des Seminars heißt es für die Studenten anschauen, messen, zeichnen, analysieren, entdecken, Schwachstellen und ihre Ursachen finden und dokumentieren, versuchen das Gebäude zu begreifen. Doch wie misst man ein über die Jahrhunderte verzerrtes Gebäude auf, das keinen rechten Winkel mehr hat? In der Vermessungstechnik gibt es viele moderne und traditionelle Praktiken, eine altbewährte Methode ist das Spannen einer Schnur, mit der man sich eine bekannte Gerade erzeugt. Von dieser Geraden aus kann man in alle Richtungen messen und hat immer einen Anhaltspunkt. Crowells Meinung nach ist es wichtig für das Erfassen und Begreifen eines Bauwerkes, dass ein Architekt solche einfachen Methoden der Vermessung selbst beherrscht und ausführt. Eine Exkursion am letzten Tag rundet den Workshop ab. Bisher wurde u.a. schon das ehemalige Deutschorden Wasserschloss in Elztal-Dallau, der Rathauskomplex in Calw, 40 _ WS 2010/11 Lehre Details geben Rückschluss auf die Entwicklung des Hauses die Jugend-Musikschule in Ubstadt-Weiher Zeutern und die ehemalige Hirsau‘sche Zehntscheune aus dem Jahre 1563 in Friolzheim besichtigt. „Bauen im Bestand ist eine faszinierende Herausforderung!“ Ziel: Kernziel des Seminares ist die Sensibilisierung der Studierenden auf das aufmerksame Arbeiten im Bestand sowie die Befähigung zu einer professionell strukturierten, überlegten Vorgehensweise. Crowell stellt folgende Fragen seiner Arbeit voran: „Was habe ich vor mir?“, „Warum wurde das Gebäude ursprünglich errichtet?“, „Wie ist es entstanden?“ „Jedes Gebäude bietet eine Überraschung“, sagt Crowell, „man muss nur genau hinhören, denn es kann nur leise zu uns flüstern.“ ein Beitrag von Hatice Erol und Adriano Bruno Bilder: Nadine Hellriegel Zoom auf den Dachstuhl Sparren mit „bewegter“ Vergangenheit Studenten beim Aufmessen und Aufzeichnen Aufgemessen und gezeichnet von: Isabelle Doll, Johannes Heil, Waldemar Weis, Maxim Winkler Einblick, der unter die Haut geht Grundlagen und Analysen Konzepte Vorentwurf Vom Städtebau bis zum Detail Großer Entwurf einer Sporthalle 3. und 4. Bachelorsemester Prof. Andreas Meissner Entwurf Integration Tragwerk Integration Haustechnik Lehrkonzept Zu den wichtigen Erfahrungen im Architekturstudium gehört es, einen Entwurf vom Städtebau angefangen über Funktion und Konstruktion bis hin zum Detail zu entwickeln, sich dabei auch intensiv mit statischen, energetischen, haustechnischen, bauphysikalischen und nicht zuletzt bauökonomischen Fragestellungen auseinander zu setzen und so die Wechselwirkung der verschiedenen Themenfelder zu erfahren. Dieser komplexe und aufs Ganze ausgerichtete Ansatz wird mit dem Großen Entwurf im 3. und 4. Bachelorsemester, bei dem mehrere Fächer integriert sind, verfolgt. Auf diese Weise entsteht eine fundierte Basis für das anschließende Praxissemester. Konzeptionelles Arbeiten - Analyse und Intuition Um bei der Vielzahl der Fragestellungen am Ende zu eindeutigen, auf allen Ebenen funktionalen Entwürfen mit hohem Gestaltwert zu kommen, ist die Entwicklung einer klaren konzeptionellen Arbeitsweise unabdingbar. Die Entwicklung von Konzepten basiert auf der analytischen Auseinandersetzung mit Ort und Kontext sowie der Aufgabenstellung selbst gepaart mit einem auch intuitiv entwickelten Gestaltwillen Aufgabe Konkret war eine Dreifeld-Sporthalle zu planen, die dem Schul-, Wettkampf und Vereinssport einen angemessenen Rahmen bieten soll. Diese steht an einer sehr prominenten Stelle, nämlich der Nahtstelle zwischen einem zukünftigen Landesgartenschaugelände und wichtigen Detaillierung Zufahrtsstraßen in die Innenstadt von Lahr. So galt es zunächst die Sporthalle in eine sinnfällige Beziehung zur zukünftigen Landesgartenschau, den Einfallstraßen sowie Parkierungsflächen und Zufahrtswegen zu setzen. Neben der Dreifeldhalle selbst war Platz für ca. 700 Zuschauer, eine Gymnastikhalle und einen Kraftraum sowie die erforderlichen Nebenflächen vorzusehen. Bearbeitung Die Bearbeitung erfolgt in mehreren Phasen analog zu den Leistungsphasen der HOAI von der Grundlagenermittlung mit intensiver analytischer Auseinandersetzung mit Ort und Kontext (hier dem zukünftigen Landesgartenschaugelände am Stadteingang von Lahr) sowie der Aufgabenstellung selbst (hier dem Raumprogramm für eine Dreifeldsporthalle) über Vorentwurf und Entwurf bis hin zur Werk- und Detailplanung. Die Bearbeitung des Vorentwurfes erfolgt im Vorfeld von konkreten Wettbewerben oder Beauftragungen. In dieser Phase sind die äußeren Rahmenbedingungen noch nicht exakt definiert. Dadurch ist es möglich grundsätzliche Möglichkeiten auszuloten und auch unkonventionelle Lösungen zu entwickeln. Diese Entwurfsarbeit in einem noch weitgehend undefinierten Umfeld stellt hohe Anforderungen an die Bearbeiter, schult aber konzeptionelles Denken und die Entwicklung einer eigenen Entwurfshaltung. Einen hohen Praxisbezug bot die Aufgabe durch die Möglichkeit, die Entwürfe vor wichtigen Vertretern der Stadt zu präsentieren. In der weiteren Vertiefung, insbesondere im sogenannten Konstruktiven Entwurf, werden dann unter ständiger Baumanagement Präsentation Am Ende der Projektphasen wurden die Entwurfsergebnisse vor dem Gemeinderat der Stadt Lahr von den Studierenden präsentiert. Rückkopplung und Weiterentwicklung des Entwurfskonzeptes auch Konstruktion und Tragwerk bis ins Detail entwickelt. Eine Besonderheit in diesem Zusammenhang stellt die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Architekturstudenten und Bauingenieurstudenten dar, die gemeinsam das statisch-konstruktive Konzept zu entwickeln hatten. Letztere wurden von Prof. Robert Pawlowski betreut. Die Sporthalle wurde auch in den Fächern Darstellungsmethodik, Technischer Ausbau, Bauphysik und Baumanagement bearbeitet. Die Arbeitsergebnisse waren in den Entwurf zu integrieren. Fazit Durch eine über zwei Semester reichende Laufzeit eines Entwurfsthemas sowie die Integration verschiedener Fachdisziplinen ist es möglich, eine Entwurfsaufgabe mittlerer Größe so zu bearbeiten, dass die zahlreichen Facetten des Planens und Bauens realitätsnah abgebildet werden und eine sehr hohe Bearbeitungsdichte entsteht. Die nachfolgend auszugsweise dargestellte Arbeit soll dies beispielhaft zeigen. Entwurf WS 2010/11 _ 43 Carolin Baur, Anna Droege, Shirin Jorjani und Sara Karim. Meilenstein „ ... ein Meilenstein, der sich anfügt an eine Allee, der Etappenziel ist, Wegemarke, der vereint und bedeutsam ist ...“ 44 _ WS 2010/11 Lehre Umsetzung Das signifikante Konzept wurde folgerichtig aus der Analyse des städtebaulichen Umfeldes abgeleitet: ein geschlossener metallisch schimmernder Winkel an der südlichen Einfallstraße bietet nicht nur Lärm- und Sonnenschutz, sondern stellt auch einen markanten Meilen- bzw. Stadtbaustein dar. Die vollkommen verglasten Seiten zum Gelände der Landesgartenschau verbinden Innen- und Außenraum und bieten den Besuchern auf den erhöht angeordneten Tribünen einen sehr guten Blick über und in den Park. Das große Foyer gibt Raum für viele Aktivitäten z.B. bei Sportveranstaltungen. In das Konzept aus geschlossenem Winkel und gläsernen Fassaden wurden die Themen Tragwerk, Haustechnik, Energie und Detailplanung so integriert, dass ein schlüssiges Ganzes entstand: der geschlossene Winkel ist mit flächig angebrachten Metallplatten mit schmalen Fugen bekleidet und nimmt das aus Fachwerkträgern konstruierte Tragwerk, sowie Technik und Leitungsführung auf. Die Glasfassade wurde von diesem Winkel abgehängt und erhält so eine äußerst filigrane Struktur. Insofern zeigt diese Arbeit sehr gut, wie verschiedene Detailentscheidungen aus einer Gesamtkonzeption abgeleitet werden und umgekehrt auf diese zurückwirken können. ein Beitrag von Sandra Töpperwein Text: Prof. Andreas Meissner Bilder: Studiengang Architektur Lehre WS 2010/11 _ 45 Frauenalb Synergie Strukturen Programm Pro Studium Prof. Dr. Robert Pawlowski, Prof. Dr. Tillman Müller Prof. Dr. Hermann Hütter, Prof. Florian Burgstaller Planen und Bauen verlagert sich seit Jahren zunehmend vom „klassischen“ Neubaubereich hin zur Sanierung. Zeitgemäße Nutzungen von Bestandsgebäuden können aufgrund der hohen technischen, ökonomischen und ökologischen Anforderungen nur in einer interdisziplinären Zusammenarbeit aller beteiligten Fachgebiete beantwortet werden. 46 _ WS 2010/11 Vertiefung Giebelfassade der Klosterkirche Projekt Frauenalb Das Thema „Frauenalb“ wurde in den letzten drei Jahren im Zusammenhang mit dem Projekt „Synergie Strukturen“ innerhalb des Programmes Pro Studium bearbeitet. Das Projekt richtete sich an Studierende der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft. Die Studierenden lernten mit komplexen Problemstellungen innerhalb eines praxisbezogenen Projektes umzugehen und interdisziplinär zu arbeiten. Durch die reale Projektaufgabe und die fächerübergreifende Arbeitsweise werden die Studierenden optimal auf die berufliche Zukunft vorbereitet. Die Anwendung neuester Materialien und Techniken ermöglicht den Studierenden außerdem Einblick in die aktuelle Forschungsarbeit. Im Laufe dieses Projektes haben viele verschiedene Fakultäten der Hochschule Karlsruhe mitgewirkt. Unter anderem hat der sich der Fachbereich Geomatik unter Leitung von Prof. Dr. Tillman Müller mit der Geometrieerfassung des gesamten Geländes rund um Frauenalb beschäftigt. Studierende der Geomatik haben in diesem Zusammenhang ein 3D Modell erstellt. Von dieser Vorarbeit profitierten die Architekturstudierenden und entwickelten ihre Entwürfe aufbauend auf die daraus gewonnenen Erkenntnisse. Unter der Leitung von Prof. Dr. Robert Pawlowski untersuchten Studierende des Faches Bauingenieurwesen die Bauten des Klosters. Sie erstellten eine Durchgang Kirche Konvent Bauwerksdiagnostik der einzelnen Gebäude, erforschten in erster Linie Statik und Standfestigkeit der Ruine, aber auch Akustik und Brandschutz wurden in die Untersuchung mit einbezogen. Im weiteren Verlauf des Projekts betreute Professor Florian Burgstaller vom Studiengang Architektur unterschiedliche Entwurfsaufgaben rund um das Ensemble der Klosterkirche. Eine der ersten Aufgaben war die Entwicklung eines Dachtragwerks in Gruppenarbeit mit Studenten des Fachbereichs Bauingenieurwesen. Im Anschluss daran gab es mehrere Entwürfe zur Umnutzung vorhandener Strukturen. Eine Kunstakademie und eine Sommerakademie wurden im Bereich des Kreuzganges entwickelt. Varianten zur Umnutzung der Gesamtanlage wurden konzeptioniert, beispielsweise die Umnutzung des ehemaligen Abteigebäudes oder der Klosterkirche zum Konzertsaal. Das Projekt wird umfassend dokumentiert, im Frühjahr veranstaltet der Studiengang außerdem eine Ausstellung in den Räumen des Landratsamtes Karlsruhe. Ort und Geschichte Am Rande des nördlichen Schwarzwaldes in der Mitte des Albtales liegt das Kloster Frauenalb, das von der barocken Kirche und dem Konventgebäude dominiert wird. Um den weitgehenden ummauerten und eingerahmten Komplex gruppierten sich einst Wirtschaftsbauten wie Ställe, Mühle, Sägemühle, das Wirtschaftshaus und der Garten der Äbtissinnen. Der heute aus Ruinen bestehende Komplex, zeigt den Baubestand nach der barocken Bauphase. Zwei um 1800 entstandene Zeichnungen zeigen barocke , die einzigen Bilder, die es vom unversehrten Kloster gibt. Grundrisse von Konvent und Kirche, die anlässlich der Säkularisation angefertigt wurden, ergänzen die Kenntnisse. Eberhard III. von Eberstein stiftete mit seiner Mutter Uta 1180/85 das Kloster Frauenalb. Das Freiadelsstift nahm nur Töchter aus adligen Familien auf. 1508 brach in dem gotischen Klosterbau ein Brand aus, der Abtei und Konvent mit Dormitorium und Refektorium verzehrte. 1605 verließ die letzte Stiftsfrau das Kloster. Ab dem Dreißigjährigen Krieg belegten Benediktinerinnen das Kloster. Es entstand ein neues Konventgebäude und die neue doppeltürmige Klosterkirche. Nach Aufhebung des Klosters wurde das Anwesen erst Militärlazarett und später privat versteigert. In den Gebäuden richteten sich Fabriken ein, viermal brach Feuer aus. Die Firmen verließen den Komlex wieder, seit 1853 steht die Klosteranlage leer. Neben dem Förderverein für die Kultur, der sich mit Klassikkonzerten einen Namen gemacht hat, finden verschiedene Events wie Gospelauftritte, klassische Konzerte und Theaterstücke der badische Landesbühne statt. Diese sorgen für kulturelles Leben in und um das Kulturdenkmal. Vertiefung WS 2010/11 _ 47 Steffi Mahl (Architektur), Cem Kalkan (Bauingenieurwesen) Die Entwurfsaufgaben Im Kirchenschiff und der ehemaligen Klosteranlage finden im Sommer regelmäßig Konzerte und Ausstellungen statt. Ein langfristiges Erhaltungs- und Nutzungskonzept wird seit längerem von der Stiftung Frauenalb diskutiert. Im Sommersemester 2009 entwarfen die Studierenden ein Konzept zur Überdachung des Kirchenraumes im Wintersemester 2009/2010 wurde der Fokus auf die gesamte ehemalige Klosteranlage erweitert. Ziel der Entwurfsarbeit ist ein Gesamtkonzept für den baulichen Umgang mit der Klosterruine Frauenalb. Dabei geht es auch um eine grundsätzliche Stellungnahme zu der Frage des Umgangs mit Ruinen in der Denkmalpflege. Die romantische 48 _ WS 2010/11 Vertiefung Ausstrahlung des Ortes und ihre Erlebbarkeit ist also ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Auseinandersetzung mit der Aufgabe. Ein weiterer Aspekt ist der materielle Zeugniswert der bestehenden baulichen Anlage, der im Sinne der Denkmalpflege möglichst unverändert zu erhalten ist. Dem gegenüber steht zum einen die Notwendigkeit, die Bausubstanz vor dem weiteren Verfall zu bewahren. Zum anderen besteht der Wunsch nach einer kulturellen Nutzung des Ortes, dies macht ein gewisses Maß an baulicher Veränderung unumgänglich. Das Spektrum der baulichen Eingriffe lässt zwischen den beiden extremen Haltungen viele unterschiedliche Möglichkeiten und Vorgehensweisen zu. Projekte Teil 01 Dachtragwerk Olga Gurev (Architektur), Julie Ferrazzi (Bauingenieurwesen) Vertiefung WS 2010/11 _ 49 Gloria Vielmeier. Arbeiten_Wohnen_Flanieren_Genießen Die Anlage wird an der Ostseite komplett verglast und die Ruine wird „eingerahmt“. Im östlich entstandenen Riegel befinden sich Gastronomie, Arbeitsräume und Ateliers für Künstler, die Wohnbereiche liegen auf der gegenüberliegenden Terrassenseite. Beide Gebäude sind über das durchgehende Dach und die vorgehängte Lamellenkonstruktion verbunden. Drehbare Holz-Lamellen-Elemente verleihen der Fassade ein lebendiges Erscheinungsbild. 50 _ WS 2010/11 Vertiefung Projekte Teil 02 Sommerakademie Olga Gurev Die Ruine Frauenalb bleibt als Zeitdokument erhalten. Dennoch entsteht ein Ort, der für völlig neue Nutzungen zulässt. Die neu geschaffenen Baukörper fügen sich auf natürliche Weise in den Bestand ein. Die ehemalige Klosterstruktur wird mittels moderner „Holzboxen“ nachempfunden, die fragmentierten Ruinenreste werden so optisch gefasst. Ein harmonisches Gesamtbild aus alt und neu entsteht. ein Beitrag von Kristina Dentzel und Sandra Töpperwein Bilder: Dipl. Ing. (FH) Monika Stefen Vertiefung WS 2010/11 _ 51 SMAKH im Gespräch mit Prof. Dr. Bernhard Lenz 1968 geboren in Frankfurt / Main 1991-1995 Studium des Interior-Design in Mainz Studienschwerpunkt: Furniture Design / Ausbaukonstruktion 1995-1999 Architekturstudium in Köln Studienschwerpunkt: Ressourcenschonendes Bauen / Hochbaukonstruktion 1999-2003 Masterstudium am Institut für Technologie in den Tropen Studienschwerpunkt: Energieeffiziente Entwurfsstrategien für Extremklimate 2005-2009 Promotion an der TU-Darmstadt Promotionsthema: Entwicklung eines neuartigen solarthermischen Klimatisierungssystems für arid-heiße Regionen. Beurteilung: Mit Auszeichnung 2009-2010 Karlsruher Institut für Technologie - KIT Vertretungsprofessur für Technischen Ausbau + Bauphysik seit 2010 an der Hochschule Karlsruhe - Technik & Wirtschaft Professur für Energieoptimiertes Planen + Gestalten Sieht man sich Ihr Architektur- und Masterstudium sowie Ihr Promotionsthema an, so wird deutlich, dass sich das Thema Energie und Nachhaltigkeit wie ein roter Faden durch Ihre berufliche Entwicklung zieht. Wie entstand bei Ihnen dieses Interesse? Energieoptimierung und Nachhaltigkeit erfordern oftmals innovative Kombinationen aus Technik und Gestaltung. Eine Kombination aus Themenbereichen, die mich schon immer besonders interessierten. Vertieft hat sich das Interesse an diesen Gebieten bereits innerhalb meines Architekturstudiums, in dem zur damaligen Zeit u.a. exotisch klingende Fächer wie <ressourcenschonendes Bauen> und <Tageslichttechnik> unterrichtet wurden. Als ich nachfolgend innerhalb meines Masterstudiums mit unterschiedlichsten traditionellen und innovativen Planungsstrategien für Extremklimate in Kontakt kam, war eines schnell klar: Ich hatte meine Passion gefunden. Vor Ihrem Architekturstudium haben Sie Interior-Design studiert. Was hat Sie bewegt, nach Ihrem Erststudium noch Architektur zu studieren? Der Wunsch nach mehr. Das Studium des Interior-Designs basierte auf einem baukünstlerischen, sehr weitgefächerten Ansatz. Es beinhaltete neben den klassischen Lehrinhalten der Innenarchitektur und der Architektur ebenso große Anteile aus den Bereichen der bildenden Kunst und des Produktdesigns. Durch dieses breit angelegte Studium erhielt ich Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche und spürte schnell, dass eine ganzheitliche, ästhetisch-sinnfällige Gestaltungslösung nur erzielbar ist, wenn verschiedenste Aspekte gleichermaßen Berücksichtigung finden. Da sich die gestalterische Qualität 52 _ WS 2010/11 Dialog „Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“ [Molière] Mitentwicklung der innovativen Fassaden- und Tragkonstruktion aus glasierter Keramik am New-York Times Building in NY. Die Fassade trägt zum Corporate Identity bei und schützt den Gebäudeinnenraum vor zu hohen solaren Einstrahlungen. eines Gebäudes für mich aus einem gleichwertigen Zusammenspiel von innenräumlicher Wirkung und architektonischer Erscheinungsform ergibt, entschied ich mich relativ schnell, nach Abschluss des Studiums zusätzlich noch Architektur zu studieren. Sie haben in den Jahren 2000 bis 2005 in unterschiedlichen Büros in Paris, u.a. bei Renzo Piano gearbeitet. Was hat Sie dort besonders geprägt? Insbesondere die Zusammenarbeit mit Menschen aus unterschiedlichsten Teilen der Erde. So waren beispielsweise in der Zeit, in der ich im Büro von Renzo Piano in Paris gearbeitet habe, etwa 40 Architekten aus mehr als 15 Nationen angestellt. Architekten aus unterschiedlichsten Kulturkreisen mit mannigfachen Ausbildungsschwerpunkten. Aufgrund der unterschiedlichen Sprachkenntnisse erfolgte ein Großteil der Kommunikation über das skizzieren. Da sich die unterschiedlichen architektonischen Haltungen und Schwerpunkte insbesondere über das gemeinsame skizzieren sehr gut zum Ausdruck bringen lassen, führte diese Form der internationalen Zusammenarbeit zu einer enormen Bereicherung aller beteiligten Architekten. Dialog WS 2010/11 _ 53 Entwicklung des Klimatisierungskonzeptes zweier Gebäude mit 20.000 m² neben der Stadtautobahn in Paris. Eine starke Lärmbelastung verhindert eine natürliche Fensterlüftung, weshalb passiv beheizte Solarkamine zur Entwärmung und natürlichen Klimatisierung des Gebäudes genutzt werden. Ihr Lebenslauf ist sehr vielfältig. Von selbstständigen Tätigkeiten bis hin zu Lehraufträgen, von Vorträgen, Wettbewerben und Buchpublikationen bis hin zu Forschungsaufträgen. Woher nehmen Sie Ihre Energie und was motiviert Sie, sich auch auf Randgebieten der Architektur zu bewegen? Der Wunsch, etwas zu verändern. Sicherlich wäre es wesentlich einfacher und weniger anstrengend, sich ausschließlich auf das zu konzentrieren, was man bereits weiß oder sich in Fachbüchern für Architekten nachlesen lässt. Ich denke jedoch, dass wir Architekten viel von anderen Disziplinen lernen können und das nur aus einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit anderen Fachplanern eine innovative, energieoptimierte und gestalterisch hochwertige Architektur entstehen kann. Ein Ziel, das Zusatzwissen erfordert und ein Ziel, zu dem ich einen Beitrag leisten möchte. Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Bewusstsein zum energieeffizienten und nachhaltigen Bauen bei Architekten und Nutzern entwickelt? Die Notwendigkeit der Veränderung ist inzwischen sicherlich jedem bewusst. Leider ist einigen Architekten und auch Gebäudenutzern jedoch noch nicht klar, dass sich die gesteckten Ziele nicht über altbewährte Herangehensweisen erreichen lassen. Nur mittels neuer Gebäudekonzepte und innovativer gebäudeintegrierter Technologien, die auch zu neuen ästhetischen Ausdrucksformen führen, lassen sich diese Ziele meiner Meinung nach realisieren. Ein Mehr an Effizienz und eine Anpassung an sich verändernde klimatische Bedingungen erfordern zwangsläufig auch eine Weiterentwicklung unserer architektonischen Sprache. Ein Vorankommen, das in manchen Bereichen auch eine Abkehr von Altbewährtem und eine Akzeptanz gegenüber neuen Funktionen und Ausdrucksformen erfordert. Was wollen Sie Ihren Studenten vermitteln und was sind Ihre Ziele in der Lehre? Gute Architektur stellt eine Herausforderung dar, für die es individuelle Lösungen für alle Problemstellungen zu entwickeln gilt. Neben den städtebaulichen und räumlichen Anforderungen ist es mir sehr wichtig, dass Architekten den gestalterischen Ausdruck ihrer Bauten stärker in Relation zu den sich stark unterscheidenden klimatischen Standortbedingungen entwickeln. Nur unter Berücksichtigung der mikro- und mesoklimatischen Aspekte kann ein sinnvolles und energieoptimiertes architektonisches Konzept mit 54 _ WS 2010/11 Dialog Entwicklung eines neuartigen Gebäude- und Klimatisierungskonzeptes für ein Rechenzentrum am Standort Dubai, bei dem solare Energie zur Kühlung und Lüftung der Serverräume genutzt wird, woraus sich enorme energetische Einsparpotentiale ergeben. minimierter Technik entstehen. Auch ist mir wichtig, dass unsere Architekturstudenten erkennen, dass die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen als Voraussetzung für die Entwicklung innovativer Lösungen gesehen werden muss. Nur durch das gemeinsame Beschreiten neuer Wege ist es meiner Meinung nach möglich, die anstehenden Probleme unserer Gesellschaft zu lösen. Welche Forschungsprojekte haben Sie zuvor am Karlsruher Institut für Technologie – KIT verfolgt und wie würden Sie Ihre zukünftigen Hauptschwerpunkte an der Hochschule beschreiben? Am KIT habe ich ein Forschungsprojekt geleitet, dem ein Verfahren zugrunde liegt, das für zwei sehr unterschiedliche Anwendungen geeignet ist. Einerseits zur solaren Gebäudeklimatisierung und andererseits zur Wassergewinnung aus Außenluft. Die Gebäudeklimatisierung stellt in trocken-heißen Regionen eine große Herausforderung dar, sofern nicht auf konventionelle stromverbrauchende Kompressionskältesysteme zurückgegriffen werden soll. Derzeit bekannte solare Klimatisierungssysteme verbrauchen generell Wasser oder müssen bei hohen Außentemperaturen unter Wasserverbrauch rückgekühlt werden. Wasser stellt in diesen Regionen jedoch eine knappe und sehr teure Ressource dar. Das von mir entwickelte solarthermische Klimatisierungssystem kann in trocken heißen Regionen ohne Wasserverbrauch eingesetzt werden, wodurch sich eine völlig neuartige Alternative zu konventionellen Klimatisierungslösungen ergibt. Alternativ kann der Prozess auch zur Wassergewinnung aus Luft genutzt werden. Im Unterschied zu derzeit bekannten Systemen kann eine Wassergewinnung ohne starke Abkühlung der Luft erfolgen, wodurch sich ebenso ein enorm hohes Innovations- und Anwendungspotential ergibt. Aufgrund der Komplexität habe ich in dieses Projekt ebenso einen Maschinenbauer, einen Physiker und einen Meteorologen eingebunden. Im Rahmen meiner Tätigkeit an der Hochschule Karlsruhe möchte ich an der zukünftig immer wichtiger werdenden Problematik der Gebäudeklimatisierung weiterarbeiten und insbesondere auch adaptive Fassadensysteme in den Fokus meiner Forschungsaktivitäten stellen. ein Beitrag von Hatice Erol Bilder: Prof. Dr. Bernhard Lenz Dialog WS 2010/11 _ 55 6 Fragen an Thomas Fabrinsky Zu Besuch in seinem Architekturbüro in der Karlsruher Südweststadt führten wir ein persönliches Gespräch mit Thomas Fabrinsky, Lehrbeauftragter des Studienganges Architektur und erlangten so einen Einblick in seine praktische Arbeit SMAKH: Sie unterrichten nun schon seit einigen Jahren das Fach Baustoffkunde hier an der Hochschule Karlsruhe. Baustoffe sind das tägliche Brot eines Architekten. Was empfinden Sie als so besonders wichtig in diesem Fach, es schon im ersten Semester zu erlernen? Fabrinsky: Man kann nicht früh genug damit beginnen ein Gefühl für Materialien und Baustoffe zu entwickeln, da letztendlich die Wahl der Materialien ein wesentliches Gestaltungsmerkmal für ein Gebäude ist. Mir war es deshalb immer wichtig die Baustoffe im ersten Semester aus Sicht des Architekten als Entwerfer zu betrachten. Erst mit dem zweiten Blick sollten die spezifischen, technischen, ökologischen und sonstigen Eigenschaften hinzu kommen. ein Beitrag von Florian Eberz Bilder: Max Seegmüller, Dominik Burkard, Architekturbüro Fabrinsky SMAKH: Im WS 2010/2011 haben Sie erstmals Teil an der Lehre im Fach Entwerfen/Konstruktiver Entwurf und unterstützen da Prof. Armin Günster. Was ist für Sie die Herausforderung nun über das Fach Baustoffe auch beim Entwurfsprozess lehrend teilzuhaben? Fabrinsky: Im Gegensatz zu den reinen Entwurfsaufgaben bei denen ich in den letzten Jahren mitwirken konnte, liegt der Reiz des Konstruktiven Entwurfs darin, dass man die Entwurfsidee nun durch das Detail herausarbeiten und umsetzen muss. Somit kommt es zwangsläufig zur Frage welches Material, welcher Baustoff eingesetzt werden soll und für mich wieder zum Fach „Baustoffe“. SMAKH: Welche didaktischen Ziele verfolgen Sie? Auch im Hinblick auf die Verknüpfungen zwischen Baustoffe und Entwerfen/Konstruktiver Entwurf? Fabrinsky: Ziel sollte sein, den Studenten den Zusammenhang von Entwurf, konstruktiver Umsetzung des Entwurfs und materialgerechtem Entwurf zu zeigen. Das Ineinandergreifen verschiedener Disziplinen, das Zusammenfügen und Übereinanderlegen und anschließendem Auseinanderdröseln von Ideen, Anforderungen und Alternativen ist in dieser Fächerkonstellation wunderbar darstellbar. SMAKH: Man spricht häufig von der „Handschrift des Architekten“, inwieweit kann oder darf man diese Individualität ihrer Meinung nach beeinflussen und inwiefern liegt ihrer Meinung nach eine Beeinflussung durch die Baustoffauswahl beim Entwurfsprozess vor? Fabrinsky: Eine „Handschrift“, man kann auch sagen eine eigene Haltung zu haben ist mit Sicherheit keine schlechte Eigenschaft, ich würde sogar sagen, sie ist anstrebenswert. Es bedarf i.d.R. aber vieler Versuche und ebenso vieler Fehlversuche, man könnte auch einfach von Erfahrungen sprechen, um diese zu erlangen. Die Kunst besteht darin, durch die 56 _ WS 2010/11 Dialog „Handschrift“ nicht zum Sklaven seiner selbst zu werden. Ob man bei einem Studenten in den ersten Semestern schon von „Handschrift“ reden kann, wage ich zu bezweifeln. Ich durfte schon erleben, dass in diesem Zusammenhang die „individuelle Handschrift“ mit Beratungsresistenz verwechselt wurde. SMAKH: Wie gehen Sie genau diesen Balanceakt zwischen zu viel und angemessener Beeinflussung der Entwicklung der Studierenden an? Fabrinsky: Man spürt sehr schnell welcher Student wieviel Führung, Sie sagen Beeinflussung, benötigt. Ich finde das Wort in diesem Zusammenhang nicht ganz richtig. Grundsätzlich lasse ich natürlich den Studenten seine Idee bearbeiten, gebe nur Hilfestellung, versuche durch Hinterfragen den Entwurf auf den Punkt zu bringen. Ich lege gern den Finger in die Wunde, weise auf die z.B. konstruktiven Probleme hin, bin aber im Gegenzug sofort bereit mit meinem Wissen dazu beizutragen, die Schwachstellen auszumerzen. SMAKH: Die Hochschule Karlsruhe ist Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung. In diesem Zusammenhang steht Sie in Konkurrenz mit der Universität, die wissenschaftlicheres Arbeiten impliziert, wohingegen an der ehemaligen Fachhochschule doch wesentlich „praktischer“ studiert und gelehrt werden soll. Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen auch im Bezug auf Ihr eigenes Architekturbüro? Fabrinsky: Da ich selbst an der ehemaligen Fachhochschule studierte bin ich in dieser Frage etwas vorbelastet, trotzdem versuche ich eine objektive Antwort zu geben: In meinem Büro arbeiten Studenten und Architekten von beiden Hochschulen. Ich bin mit meinen Leuten sehr zufrieden, egal von wo sie kommen. Ich schaue mir die Bewerber jedoch persönlich an und versuche über das Gespräch und den gezeigten Arbeiten mir ein Bild von der Persönlichkeit, der Einstellung zur Arbeit im Allgemeinen, zur Architekturhaltung und dem zu erwartenden Engagement zu machen. Bei den Arbeiten steht meistens von Seiten der Bewerber der Entwurf im Vordergrund, bei mir in der Regel nicht. Ich schaue mir lieber den konstruktiven Teil etwas genauer an, da ich hier mehr über die oben genannten persönlichen Punkte herauslesen kann. An dieser Stelle hatten die FH- Absolventen öfter die Nase vorn, da hier offensichtlich praxisbezogener und tiefer im Detail gearbeitet wurde. Es kommt hinzu, dass nach meiner Erfahrung die Studenten der FH öfter schon eine Berufsausbildung vorweisen konnten und somit zusätzliche Erfahrungen einbringen konnten. Bis jetzt habe ich über den FH-Diplomstudiengang gesprochen, mit dem neu eingeführten Bachelor- Studiengang möchte ich mich noch nicht final festlegen. Die ersten Jahrgänge deuten aber darauf hin, dass ein Teil der Ausbildung nun in die Büros verlagert wird. Ob das der Sinn des neuen Studiengangs ist, kann hinterfragt werden. SMAKH bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und die umfangreiche Beantwortung der Fragen. Dialog WS 2010/11 _ 57 Was ist eigentlich... das Architekturschaufenster? Der Studiengang Architektur schätzt die Kooperation zu dieser etablierten Institution der Karlsruher Architektenszene. Die gewonnenen Synergien und Schnittstellen sind mannigfaltig, etwa als Fenster zu breiterem Publikum, Raum für Gespräche und Grundlage zum Experiment klassischer Gestaltungsprinzipien. Seit wann gibt es das Architekturschaufenster? Die Gründung des Architekturschaufenster e.V. fand im September 2007 statt. Was waren die Hintergründe der Entstehung? Die Bundesinitiative Baukultur (http://www.architektur-baukultur.de) und Prof. Karl Ganser riefen zur Gründung lokaler Initiativen in Architektur und Baukultur auf. Die Räumlichkeiten der AKBW sollen neben den regelmäßigen IF Bau Seminaren mit Leben erfüllt werden und eine Anlaufstelle sein für Bürger und Fachleute und Alle, die sich für Architektur und Baukultur interessieren. Wer hat das Architekturschaufenster gegründet? Einige engagierte Mitglieder der Kammergruppe Karlsruhe Stadt der AKBW. Welche Ziele verfolgt die Institution? Das Architekturschaufenster ist Adresse und Programm: Hier ist die Bezirksgeschäftsstelle der Architektenkammer Baden-Württemberg zu finden, hier ist Raum für Aktivitäten zur Förderung der Baukultur, hier gibt es ein Schaufenster, über das die Öffentlichkeit erreicht werden kann. Der gleichnamige, gemeinnützige Verein will mit Ausstellungen, Tagungen, Seminaren und Informationsveranstaltungen das Bewusstsein für die Qualität der gestalteten Umwelt stärken. Das Spektrum von Architektur, Städtebau, Kunst und Design und die Vielfalt wissenschaftlicher und praxisbezogener Themen garantiert ein abwechslungsreiches und lebendiges Programm. Die zentrale Lage in der Waldstraße 8 – in direkter Nachbarschaft zu Kunsthalle, Kunstverein und Schloss – verspricht gute Erreichbarkeit und lädt auch zu einem spontanen Besuch ein. (http://www.architekturschaufenster.de/) Ist das Konzept erfolgreich? Ja, die Besucherzahlen zu den verschiedensten Veranstaltungen sowie die Mitgliederzahlen im Verein steigen stetig. Dies zeigt, dass es der richtige Weg ist und spornt uns aber auch ständig zu neuen Überlegungen an. Vor kurzem wurden verschiedene Arbeitsgruppen gegründet, die sich mit sehr konkreten Themen befassen; die Ergebnisse der Arbeiten werden im Laufe des Jahres präsentiert. 58 _ WS 2010/11 Kooperation Wie groß ist die Akzeptanz in der Bevölkerung? Bei Karlsruhe- bezogenen Themen (wie Wettbewerbsergebnisse Kaiserstraße, Werk von Erich Schelling u.a.) sehr gut. Auch an Podiumsdiskussionen nehmen die Bürger teil. Wie groß ist die Akzeptanz bei den Architekten? Das Architekturschaufenster ist inzwischen ein fester Anlaufpunkt für Fachleute aus den verschiedenen Berufsorganisationen, die hier regelmäßig zusammenkommen (KG, BDA, BDIA, Energiearbeitskreis, „Architektur macht Schule“ u.a.) Im Rahmen von Vernissagen und Podiumsdiskussionen treffen sich die Kollegen hier zum Austausch. Welche Potentiale sehen Sie für die Zukunft? Wir wollen die Kooperationen mit ähnlichen Einrichtungen bundesweit und international weiter ausbauen. Kooperationen mit Unternehmen aus dem Bereichen Baustoffe, Haustechnik, Design usw. werden angestrebt. Aktuelle Themen der Stadtplanung in Karlsruhe sollen kurzfristig thematisiert werden. Was bedeutet es für Studenten und Hochschulen? Die Studenten können hier in einem ungezwungenen Rahmen mit Architekten aus der Region in Kontakt treten. Die Lehrkräfte werden regelmäßig über unsere Veranstaltungen informiert und können es entsprechend an die Studierenden weitergeben. Welche Formen von Kooperationen wurden bisher praktiziert? Es gibt zwischen Hochschule und Verein gegenseitige Einladungen zu verschiedenen Veranstaltungen wie Diplomübergaben, Ausstellungen von Studentenarbeiten (Modelle, Diplomarbeiten), Vorträgen und Vernissagen. Wir arbeiten auch mit anderen Partner zusammen z.B. die Galerien Am Weisenhof und Galerie f75 in Stuttgart, der Fa. ROMA in Burgau, dem DAM Deutsches Architekturmuseum Frankfurt, dem KIT u.a. ein Beitrag der SMAKH-Redaktion Bilder: Stefan Baumann Text: Alke Hickel, Hubert Schmidtler Kooperation WS 2010/11 _ 59 Impressum SMAKH Mitarbeit ist eine nicht kommerzielle Dokumentation des Studiengangs Architektur der Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft Moltkestraße 30 76133 Karlsruhe Redaktion Alke Hickel Layout Titelbild Masterthesis Hans-Peter Weber Druck woge druck gmbh Ettlinger Straße 30 76307 Karlsbad-Langensteinbach Auflage: 1000 WS 2010/11 Simon Bläsi, Adriano Bruno, Kristina Dentzel, Vanessa Dettenberg, Florian Eberz, Hatice Erol, Nadine Hellriegel, Andreas Hormuth, Melanie Hüther, Florian Keim, Mariane Löser, Anna Mersljakow, Sergej Michailow, Natalia Stüf, Sandra Töpperwein Wir bedanken uns für die Unterstützung bei allen Lehrenden, Mitarbeitenden und Studierenden. Nina Scholten 60 _ Studierende des Seminars Dokumentationsprojekt SMAKH: Impressum DER ALLROUNDER SERIES 7 TM 3107 | BY ARNE JACOBSEN 1955 waldstraße 89-91 76133 karlsruhe tel. 0721 91322-0 [email protected] www.burger.de Das Erfolgsmodell Serie 7 ist eines der modernen Klassiker mit denen das 20. Jahrhundert sich schmücken darf. Die Besonderheit, durch die sich der Stuhl von anderen abhebt, ist die schlichte Eleganz, die der Stuhl durch seine ungewöhnliche Form mit schmaler Taille erhält. Aber auch wegen seiner Ruhe ausstrahlenden durchgehenden Sitzfläche aus Formsperrholz. Eben diese Attribute machen ihn zu einem Stuhl, der viele Anwendungsbereiche vom Konferenzraum bis hin zum Esszimmer erschließt. FRITZHANSEN.COM