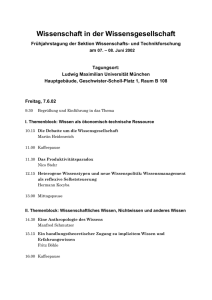Wissenschaft in der Wissensgesellschaft
Werbung
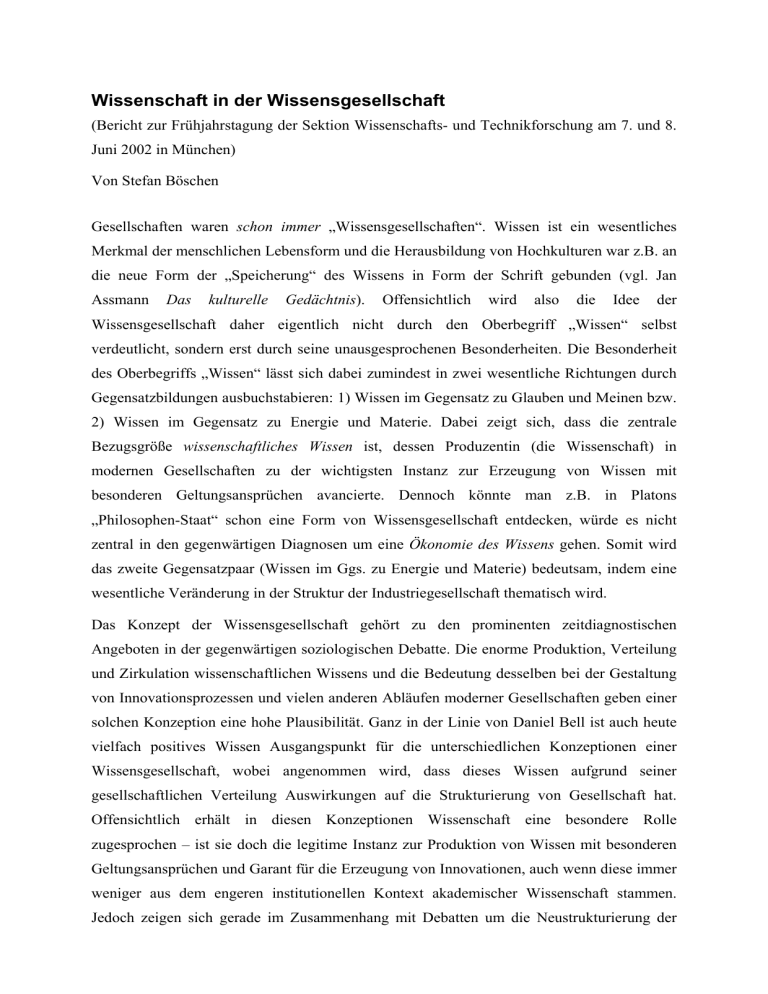
Wissenschaft in der Wissensgesellschaft (Bericht zur Frühjahrstagung der Sektion Wissenschafts- und Technikforschung am 7. und 8. Juni 2002 in München) Von Stefan Böschen Gesellschaften waren schon immer „Wissensgesellschaften“. Wissen ist ein wesentliches Merkmal der menschlichen Lebensform und die Herausbildung von Hochkulturen war z.B. an die neue Form der „Speicherung“ des Wissens in Form der Schrift gebunden (vgl. Jan Assmann Das kulturelle Gedächtnis). Offensichtlich wird also die Idee der Wissensgesellschaft daher eigentlich nicht durch den Oberbegriff „Wissen“ selbst verdeutlicht, sondern erst durch seine unausgesprochenen Besonderheiten. Die Besonderheit des Oberbegriffs „Wissen“ lässt sich dabei zumindest in zwei wesentliche Richtungen durch Gegensatzbildungen ausbuchstabieren: 1) Wissen im Gegensatz zu Glauben und Meinen bzw. 2) Wissen im Gegensatz zu Energie und Materie. Dabei zeigt sich, dass die zentrale Bezugsgröße wissenschaftliches Wissen ist, dessen Produzentin (die Wissenschaft) in modernen Gesellschaften zu der wichtigsten Instanz zur Erzeugung von Wissen mit besonderen Geltungsansprüchen avancierte. Dennoch könnte man z.B. in Platons „Philosophen-Staat“ schon eine Form von Wissensgesellschaft entdecken, würde es nicht zentral in den gegenwärtigen Diagnosen um eine Ökonomie des Wissens gehen. Somit wird das zweite Gegensatzpaar (Wissen im Ggs. zu Energie und Materie) bedeutsam, indem eine wesentliche Veränderung in der Struktur der Industriegesellschaft thematisch wird. Das Konzept der Wissensgesellschaft gehört zu den prominenten zeitdiagnostischen Angeboten in der gegenwärtigen soziologischen Debatte. Die enorme Produktion, Verteilung und Zirkulation wissenschaftlichen Wissens und die Bedeutung desselben bei der Gestaltung von Innovationsprozessen und vielen anderen Abläufen moderner Gesellschaften geben einer solchen Konzeption eine hohe Plausibilität. Ganz in der Linie von Daniel Bell ist auch heute vielfach positives Wissen Ausgangspunkt für die unterschiedlichen Konzeptionen einer Wissensgesellschaft, wobei angenommen wird, dass dieses Wissen aufgrund seiner gesellschaftlichen Verteilung Auswirkungen auf die Strukturierung von Gesellschaft hat. Offensichtlich erhält in diesen Konzeptionen Wissenschaft eine besondere Rolle zugesprochen – ist sie doch die legitime Instanz zur Produktion von Wissen mit besonderen Geltungsansprüchen und Garant für die Erzeugung von Innovationen, auch wenn diese immer weniger aus dem engeren institutionellen Kontext akademischer Wissenschaft stammen. Jedoch zeigen sich gerade im Zusammenhang mit Debatten um die Neustrukturierung der Erwerbsarbeit oder Risiko- und Umweltkonflikten spezifische Begrenzungen in der Leistungsfähigkeit wissenschaftlichen Wissens, was sich in einer Ausweitung der Kommunikation über Ungewissheit oder gar Nichtwissen bzw. anderen Formen des Wissens (Alltagswissen, Erfahrungswissen) äußert. Vor diesem Hintergrund sich differenzierender Wissens- und Nichtwissensformen wird die vormals hegemoniale Bedeutung wissenschaftlichen Wissens angefochten, sodass die Rolle von Wissenschaft in der Wissensgesellschaft neu ausgelotet werden muss. Ziel der Tagung war zweierlei: zum einen unterschiedliche Konzeptionen von Wissensgesellschaft zu diskutieren und dabei die Bedeutung von wissenschaftlichem Wissen sowie anderer Wissensformen in den Blick zu nehmen; zum anderen war sie Anlass, kontrastierend dazu Befunde aus dem Theoriehorizont reflexiver Modernisierung zu diskutieren. I. Themenblock: Wissen als ökonomisch-technische Ressource In vielen etablierten Konzepten zur Wissensgesellschaft werden wesentlich Verteilungs- und Verwendungsfragen wissenschaftlichen Wissens diskutiert. Unter einer ökonomischen Perspektive erscheint Wissen dann als Ware bzw. Produktivkraft, wobei die Aufgabe darin besteht, Strukturen für eine möglichst effiziente Nutzung dieser Ware zu entwickeln. Die Lösung wird dann in Formen des Wissensmanagements gesehen. Allerdings beginnen sich hier auch die Diskurslinien zu verschieben und gerade im Kontext der Arbeits- und Industriesoziologie wird das Problem aufgeworfen, wie denn die konzeptionelle Leerstelle des Erfahrungswissens gefüllt werden könnte. Die drei Vorträge in diesem Block waren einerseits als Überblick über den Stand der Diskussion, andererseits als Vertiefung von bestimmten Fragestellungen angelegt. Martin Heidenreich (Bamberg) eröffnete mit einem vielschichtigen Überblick unter dem Titel Die Debatte um die Wissensgesellschaft das Programm. Ausgehend von der Beobachtung zunehmender, auf die Diagnose der Wissensgesellschaft zugeschnittener politischer Programmatik (z.B. in der EU) verdeutlichte er zunächst einige Bereiche, in denen die Wissensbasierung zunehme. Im Grunde weise der Prozess eine gewisse ‚Totalisierung‘ auf. Um die weitere Argumentation zu strukturieren diskutierte er unterschiedliche Wissensgebegriffe und legte sich auf die Definition von Luhmann fest, wonach Wissen veränderungsbereite kognitive Schemata bezeichnen. Somit sei die Wissensgesellschaft durch die Institutionalisierung einer Bereitschaft zu Veränderung charakterisiert. Eingebettet wurde diese Argumentation schließlich mit einem Rückgriff auf die Klassiker, die sich ja nicht nur mit Verteilungsfragen, sondern ebenso mit dem Problem der Verwissenschaftlichung beschäftigt haben. Zentrale Intention war dabei eine kritische Auseinandersetzung mit Konzepten der Wissensgesellschaft im Anschluss an die Studie von Bell. Schließlich diskutierte er für die aktuelle Situation vier Perspektiven (Globale Reichweite, lernende Organisationen, Wissensarbeit, Fragilität und Risiken in der Wissensgesellschaft) für die Institutionalisierung reflexiver Mechanismen, die zu neuen Formen struktureller Kopplung führen würden. Nico Stehr (Essen) diskutierte in seinem Vortrag das Produktivitätsparadox ein besonderes Problem, das mit den Erwartungen an die Produktion und Verteilung von Wissen einhergeht. Denn mit der Entwicklung der Computertechnik und deren breiten Einsatz in Unternehmen war die Erwartung verbunden, dass sich enorme Zuwachsraten der Produktivität einstellen würden. Dies ist allerdings so nicht eingetreten. Zur Erklärung schloss er sich dabei einer These von Peter Drucker an, wonach in der Wissensgesellschaft die Dynamik des Wissens nicht nachfrageorientiert, sondern vielmehr angebotsorientert induziert sei. Daher sei offenkundig, dass eine Erklärung nicht allein durch ökonomisch-strategische Indikatoren vorgenommen werden könne. Sondern es sei zu berücksichtigen, dass sich die ‚Gewichte‘ von manueller und geistiger Arbeit zu einer neuen Arbeitsteilung verschieben würden, dass die Technologie zu einer neuen Emanzipation der Subjekte beitrage und schließlich dass sich die Technologie dereguliere. Hermann Kocyba (Frankfurt) problematisierte in seinem Vortag Heterogene Wissenstypen und neue Wissenspolitik: Wissensmanagement als reflexive Selbststeuerung schließlich die Pluralität von Wissensformen in zwei Dimensionen. Es sei nicht nur eine Pluralisierung wissenchaftlichen Wissens zu beobachten, sondern ebenso eine Pluralität von Wissensformen überhaupt, die sich in der wachsenden Bedeutung anderer als wissenschaftlicher Wissensformen manifestiere. Nach einer pragmatischen Unterscheidung zwischen den Begriffen Daten, Information und Wissen leitete er zu Beobachtungen der Heterogenität von Wissenstypen über. Dabei zeige sich, so seine These, die Koexistenz von heterogenen Wissensformen, die nicht in einer epistemischen Weise aneinander angeglichen werden könnten. Dies erhellte er an Beispielen aus der Industriesoziologie, wo seine Untersuchungen eine zunehmende Akzeptanz von Erfahrungswissen, dessen Nicht-Subsumierbarkeit und in der Folge neue Formen des Umgangs mit diesem Wissenstyp zeigen. So wird z.B. über ein Kennziffernmanagement die Frage nach dem relevanten Wissen organisatorisch abzuarbeiten versucht. II. Themenblock: Wissenschaftliches Wissen, Nichtwissen und anderes Wissen Die von Hermann Kocyba vorgestellten Überlegungen leiteten direkt zum zweiten Themenblock dieser Tagung über, welcher der Differenzierung unterschiedlicher Wissenstypen gewidmet war. Wie schon angedeutet, nehmen im öffentlichen und politischen Diskurs Probleme der Ungewissheit und des (auch wissenschaftlichen) Nichtwissens immer größeren Raum ein. Manche Autoren sprechen sogar schon von einer „Unwissensgesellschaft“ (H. Hegmann). Den Anfang setzte dabei Manfred Schmutzer (Wien) mit seinen Überlegungen zu Eine(r) Anthropologie des Wissens. Diese sehr grundlegenden Ausführungen, die sich historischen Beispielen aus den letzten 400 Jahren bedienten, waren der Klärung der Frage gewidmet, was überhaupt da sei, dass das Wissen als Wissen erscheine. Wissen müsse als relationale Größe aufgefasst werden, wobei sich Wissensgruppen typisieren ließen. Offensichtlich seien es Werte, Werthaltungen, Kultur, die für die Organisation von diesen unterschiedlichen Wissenskulturen sorgen. In Anlehnung an Überlegungen von Mary Douglas (Grid/Group-Schema) und O. Mayr (Uhr und Waage als Metaphern für die beiden modernen Formationen von Wissenschaft und politischer Entscheidung) unterschied er schließlich die Wissenschaftskulturen von Deutschland, England und Frankreich. Nach diesem generellen Konzept unterschiedlicher Wissenschaftskulturen gab Fritz Böhle (Augsburg) ein Plädoyer für die Untersuchung anderer Wissensformen ab. In seinem Vortrag zu Ein handlungstheoretischer Zugang zu implizitem Wissen und Erfahrungswissen begründete er die Notwendigkeit und die Perspektive, unter der die sogenannten anderen Wissensformen einer soziologischen Analyse zugänglich gemacht werden könnten und sollten. Industrie- und techniksoziologische Untersuchungen zeigten, dass Erfahrungswissen immer weniger als traditionaler Restbestand zu begreifen sei, sondern zunehmend als eine unverzichtbare anerkannt Wissensgrundlage werde. Das bedeute gerade in allerdings hochtechnisierten nicht, dass Produktionsprozessen Rationalisierung und Verwissenschaftlichung zum Erliegen kämen; vielmehr zeichne sich ab, dass das Erfahrungswissen in rationalisierbare und nicht-rationalisierbare Bestandteile aufgespalten werde. Den Schlusspunkt dieses Teils setzte Wolfgang Krohn (Bielefeld) mit seinen Überlegungen zu Das Risiko des Nichtwissens. Zunächst stellte er heraus, dass die Hypothetizität des Wissens als zentrales Moment wissenschaftlichen Wissens angesehen werden müsse. Im Gegensatz dazu zeichne sich das technische Modell durch sein Funktionieren aus: Wissenschaft schafft Handeln, Technik verknüpft Handeln. Das Risiko des Nichtwissens entstehe dadurch, dass die experimentelle Haltung generalisiert werde und damit die Gesellschaft zunehmend mit der Hypothetizität des Wissens konfrontiert werde. Als Antwort auf das Risiko des Nichtwissens böten sich rekursive Lernprozesse an, in denen die Folgen von Innovationen beobachtet und auf die Ausgangsannahmen zurück bezogen werden.. III. Themenblock: Wissenschaft und reflexive Modernisierung Im gesellschaftstheoretischen Angebot der Theorie reflexiver Modernisierung spielt das Spannungsverhältnis von Wissen und Nicht-Wissen eine bedeutende konzeptuelle Rolle. So ließ sich die Frage diskutieren: Ist die „Wissensgesellschaft“ eine Erscheinungsform oder Phase reflexiver Modernisierung oder muß die Theorie reflexiver Modernisierung nicht vielmehr tatsächlich von einer „Nichtwissensgesellschaft“ sprechen? Den Anfang machte Peter Wehling (Augsburg) mit seinen Ausführungen zu dem Thema Wissenschaftliches Nichtwissen in der Wissensgesellschaft. Ausgehend von der Diagnose der wachsenden Durchdringung aller gesellschaftlicher Sphären mit wissenschaftlichem Wissen und den dadurch entstehenden Spannungen ergäbe sich die Notwendigkeit, eine komplementäre Perspektive anzulegen und die wachsende Bedeutung wissenschaftlichen Nichtwissens zur Kenntnis zu nehmen. Diese artikuliere sich in einer zunehmenden Konfrontation von Gesellschaft und Politik mit kognitiver Ungewissheit und normativer Uneindeutigkeit und den daraus folgenden Problemen ihrer möglichen Verarbeitung. Für die weitere Analyse seien die Unterscheidungen zwischen Nichtwissen und Risiko sowie Nichtwissen und Irrtum von Bedeutung. Zielpunkt müsse in diesem Zusammenhang die Frage nach der Möglichkeit von Wissen um die Grenzen des Wissens sein. Unter welchen Umständen ist es vertretbar, Realexperimente durchzuführen? Damit kommen die Voraussetzungen für Lernen überhaupt in den Blick. Ein besonderes Problem sei dabei, dass man in vielen Fällen im vorhinein über die Anwendbarkeit von Wissen und den Zeithorizont, in denen sich Folgen manifestieren, keine Aussage treffen könne. Vor diesem Hintergrund komme der Reflexion des Nichtwissens ein besonderer Stellenwert zu. Ulrich Wengenroth (München) fokussierte in seinem Vortrag Das Aushandeln von Wissensformen in der Konstruktion auf eine bestimmte Disziplin, der Konstruktionswissenschaft, die er als die reflexive Disziplin des Maschinenbaus kennzeichnete. Von besonderer Bedeutung sei hier der Wechsel von der Codierung wahr/falsch hin zur Codierung funktioniert/funktioniert nicht, wobei das Funktionieren unter verschiedensten (und damit fast: beliebigen) Bedingungen sichergestellt sein müsse. Bei der Konstruktion komme es zu einem Aushandeln zwischen den unterschiedlichsten Wissensformen. Zentral seien hierbei das wissenschaftliche Wissen, ästhetisches Wissen und implizites Wissen. Vor diesem Hintergrund diskutierte Wengenroth ein Mehrebenensystem der Wissensformen in der Technik. Als Besonderheit in der Gegenwart hob er dabei hervor, dass nach der lange Zeit vorherrschenden Idee der Verwissenschaftlichung allen Konstruktionswissens ein Wandel insofern beobachtbar sei, als dass der Verwissenschaftlichungsgedanke nicht-wissenschaftlichen Wissens zunehmend aufgegeben würde. Vielmehr würde es jetzt um eine methodologische Verknüpfung zur Optimierung der Anwendungsbedingungen der unterschiedlichen Wissensformen gehen. Abschließend eröffnete Stefan May (München) mit seinem Vortrag zu Entgrenzung durch Nichtwissen. Institutionentheoretische Überlegungen zur Theorie reflexiver Modernisierung den Blick auf unterschiedliche Institutionen. Hatten bisher Wissenschaft und Politik im Vordergrund gestanden, so rückten in diesem Vortrag die Professionen und das Recht ins Zentrum. Zunächst diskutierte May anhand des Beispiels der Humangenetik einige Besonderheiten der medizinischen Profession und ihrer Veränderungen durch die Anwendung wissenschaftlichen Wissens. Dabei würde die Codierung krank/gesund überlagert, da es einen Wechsel von manifest zu wahrscheinlich krank und in der Folge von einer kurativen zu einer prädiktiven Medizin gebe. Darin zeigten sich Formen reflexiver Professionalisierung. Die Veränderungen in den Wissensbedingungen brächten darüber hinaus aber auch ganz besondere Herausforderungen für die rechtliche Verarbeitung mit sich. Juristische Wissensregeln ermöglichten eine Verhältnisbestimmung zwischen wissenschaftlichem Wissen und rechtlicher Organisation. Allerdings entstünden hier durch die Zunahme von Nichtwissen neue und besondere Probleme. Diese verdeutlichte May anschließend an den Beispielen der Sterbehilfe und der Haftungsproblematik bei fehlerhafter genetischer Diagnostik, um schließlich noch auf einen neuen Typus von Risiken in diesem Kontext aufmerksam zu machen: Personalitätsrisiken. IV. Schluss Die Tagung hat verdeutlicht, dass frühere wissenschaftszentrierte Konzeptionen der Wissensgesellschaft (Daniel Bell und andere) heute nicht mehr greifen. Stattdessen sind die gegenwärtigen Wissensgesellschaften durch eine Vielzahl von Wissensakteuren und durch eine Pluralität unterschiedlicher, heterogener Wissensformen gekennzeichnet. Dies sollte allerdings nicht dazu verleiten, den Einfluss der Wissenschaft in der Wissensgesellschaft zu unterschätzen – auch wenn dieser sich möglicherweise vom wissenschaftlichen Wissen immer mehr zum Nichtwissen verlagert.