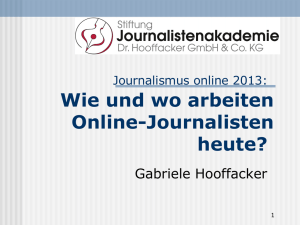Fehler über Fehler,Von der Party in die Katastrophe ,Der Affe und
Werbung

Fehler über Fehler Forschungsprojekt über Präzision und Glaubwürdigkeit im Journalismus fördert überraschende Ergebnisse zu Tage Dass Journalismus schnelllebig und damit anfällig für Fehler ist, dessen sind sich die meisten erfahrenen Medienpraktiker bewusst. Wie häufig sich indes Redaktionen irren und fehlerhafte Berichterstattung in Umlauf setzen, war zumindest in Europa bislang kaum bekannt. Jetzt gibt es für die Schweiz und Italien immerhin erste Zahlen, die aufhorchen lassen. Auch in den USA sind die Forschungsergebnisse, die zu diesem Thema dort seit Jahrzehnten erstellt wurden, vom Umfang her überschaubar. Aber sie überraschen selbst heute noch “alte Füchse” aus der Medienpraxis: ● ● Knapp die Hälfte aller untersuchten Zeitungsartikel (46%) enthalten Fehler. Zu diesem bestürzenden Befund gelangte Mitchell Charnley, ein Grenzgänger zwischen Journalismus und Publizistikwissenschaft, bereits 1936 in seiner Pionierstudie zur Glaubwürdigkeit und Fehleranfälligkeit amerikanischer Tageszeitungen. Heute wird noch schludriger als damals gearbeitet. 61 Prozent der selbst erstellten Berichte und Features in Zeitungen enthalten mindestens einen Fehler – so ermittelte Scott R. Maier (2005) von der University of Oregon in der bisher größten und letzten amerikanischen Studie. Wer verfolgt hat, wie die Glaubwürdigkeit der US-Medien sank und wie dort im letzten Jahrzehnt die Redaktionen ausgedünnt wurden, den wird das kaum verwundern. Scott Maiers Studie war Ausgangspunkt für unser eigenes Forschungsprojekt zur “Präzision und Glaubwürdigkeit der Berichterstattung von Regionalzeitungen in der Schweiz und Italien”, das der Schweizer Nationalfonds finanziert hat. Ziel war es, die Fehleranfälligkeit der Berichterstattung ausgewählter Tageszeitungen zu erfassen und herauszubekommen, wie sich die Berichterstattungsmängel auf die Glaubwürdigkeit des Journalismus auswirken. Im empirischen Teil des Forschungsprojektes wurden jeweils die Informationsquellen der Journalisten zur Genauigkeit der Berichterstattung befragt. Dafür filterten wir in fünf Regionalzeitungen aus der deutschen Schweiz und Italien je 1.000 Artikel stichprobenmäßig heraus und ermittelten die Personen, die in den Beiträgen als wichtigste Quellen genannt sind. Wir befragten diese schriftlich, um Fehler zu identifizieren und nach verschiedenen Kategorien zu klassifizieren. Um der Vergleichbarkeit der Daten willen basierte die Methodik auf den Pionierstudien von Charnley und Maier. Bemerkenswert war aber bereits der Unterschied bei der Rücklaufquote: Für die Schweiz betrug sie rund 50 Prozent, in Italien lag sie bei knapp 15 Prozent. (Angesichts der niedrigen Rücklaufquote für Italien sind die hier präsentierten Ergebnisse bestenfalls als explorativ zu betrachten.) Maier (2005) konnte dagegen in den USA 68 Prozent erzielen. Die Umfrageresultate zeigen, dass die befragten Quellen – für uns überraschend – in der Schweiz mehr Berichterstattungsmängel feststellten als in Italien oder den USA. Faktische Fehler, so genannte “hard errors” wie falsch geschriebene Namen, Angaben zum Ort des Geschehens oder verzerrt wiedergegebene Zitate, bemängeln die Befragten in 60 Prozent der untersuchten Schweizer Beiträge, dagegen in Italien in 52 Prozent und in den USA nur in 48 Prozent, also jeweils “nur” in rund der Hälfte aller Artikel. Die niedrigere Fehlerquote in den USA ist plausibel erklärbar. Sie lässt sich zum einen auf die unterschiedliche Organisation der Zeitungsredaktionen zurückführen: Journalisten in der Schweiz und Italien verfügen über eine relativ große gestalterische Autonomie, es gibt keine Arbeitsteilung zwischen “Reporters” und “Editors” wie in den USA – und damit auch weniger Kontrolle der einzelnen Journalisten. Auch die Korrekturspalten, die in den USA üblich sind, tragen zur Fehlervermeidung bei, weil sie die Journalisten sensibilisieren und weil auch kein Journalist gerne mit seinen Fehlleistungen in der Korrekturspalte und damit vor den Kollegen “am Pranger” steht. Rätsel gibt dagegen zunächst die im Vergleich zur Schweiz niedrige Fehlerquote in Italien auf. Nach allem, was wir wissen, sind Schweizer Regionalzeitungen redaktionell besser ausgestattet als italienische. Es bieten sich zwei einleuchtende Erklärungen für das unerwartete Ergebnis an: Denkbar ist, dass die italienischen Quellen deshalb weniger Berichterstattungsfehler entdeckt haben, weil die Journalisten häufiger deren PR-Texte per Copy&paste-Befehl in “Journalismus” verwandeln als ihre Schweizer Kollegen. Sollten letztere sich mehr um Eigenberichterstattung und Ergänzungen bemühen, würde ihre Arbeit zugleich fehleranfälliger. Zum anderen könnte es sein, dass die deutsch-schweizerischen Quellen bei der Bewertung pingeliger waren als die italienischen Befragten – also in punkto Berichterstattungsgenauigkeit höhere Erwartungen haben. (Da unser primäres Erkenntnisinteresse nicht auf unterschiedliche Erwartungshaltungen der Quellen zielte, war auch das Erhebungsinstrument nicht auf diese Fragestellung hin ausgerichtet. Deshalb lassen sich diesbezüglich unsererseits keine präziseren Aussagen machen.) Vier faktische Fehler wurden von den Befragten besonders häufig moniert: Reißerische Überschriften, die den Tenor des tatsächlichen Geschehens nicht widerspiegeln, entstellte Zitate, falsch wiedergegebene Zahlen und Orthografiemängel (vgl. Tabelle). In der Schweiz und in Italien monierten die Befragten in jeder Kategorie – mit Ausnahme der falschen Zahlenangaben – deutlich mehr Fehler als in den USA. Insgesamt ist es aber verblüffend, wie sich die Resultate gleichen. Die Fehleranfälligkeit des Journalismus scheint somit ein generelles Problem zu sein, und auch die Fehlertypologie ähnelt sich über die Kulturgrenzen hinweg. Der Einfluss der spezifischen journalistischen Besonderheiten des jeweiligen Mediensystems scheint deshalb weniger prägend, als von uns zunächst vermutet. Wenn die Quellen die Schwere der ermittelten Fehler beurteilen, ergibt sich neuerlich ein überraschendes Bild: Auf einer Likert-Skala von 1 (leichter Fehler) bis 7 (gravierender Fehler) gewichteten die Schweizer die Mängel mit durchschnittlich 2,5, also als weniger gravierend im Vergleich zu den Quellen in Italien (2,7) oder in den USA (2,8). Auch ist die Bereitschaft der Quellen, sich erneut als Informationslieferanten zur Verfügung zu stellen, in der Schweiz (56%) deutlich höher als in Italien (38%) oder in Amerika (36%). Zusammengenommen stützen diese beiden Befunde unsere Interpretation, dass die Schweizer Quellen es einerseits genauer nehmen und auch unwesentlichere Fehler aufgelistet haben als die Italiener – sich aber andererseits auch der Geringfügigkeit der journalistischen “Verfehlungen” bewusst sind, so dass diese offenbar die Auskunftsbereitschaft der Quellen und die Glaubwürdigkeit der Zeitungen wenig beeinträchtigen. Denn angesichts des hohen Fehleranteils ist das Vertrauen in die Zeitungen nahezu ungebrochen: Auf einer weiteren 7-Punkte-Skala, wobei 1 für unglaubwürdig und 7 für sehr glaubwürdig steht, stuften die Befragten in der Schweiz die Zeitungen trotz des höchsten Fehleraufkommens als sehr glaubwürdig ein (5,5). Die Zeitungen in den USA erzielten 5,1, die in Italien 5,2 Punkte. Das Fazit der Studie fällt bezüglich der Fehleranzahl deutlich negativ aus: Jeder zweite Beitrag in den untersuchten Ländern enthält mindestens einen Fehler – und damit einen zuviel. Nicht alle Fehler sind aber offenbar so gravierend, dass sie sich direkt und negativ auf die Glaubwürdigkeit der Zeitungen auswirken. Trotzdem sollten sich die Redaktionen deutlich intensiver mit der Berichterstattungs-Akkuratesse auseinandersetzen, vor allem in Zeiten zunehmender Digitalisierung. Unfraglich ist es die beste Lösung, Fehler zu vermeiden. Gerade in der schnelllebigen digitalen Welt zeichnet sich seriöser Journalismus indes auch dadurch aus, dass Redaktionen – wie schon vor Jahren vom “Pionier” der Fehlerforschung im deutschen Sprachraum, Bernd Wetzenbacher, angeregt – endlich lernen, mit den eigenen Fehlern angemessen umzugehen. Möglichkeiten gibt es viele, angelsächsische Medien leben einige davon bereits seit langem vor: Correction Corners, in denen Fehler zuverlässig und freiwillig berichtigt werden, Editor’s Notes, mit denen man gravierende Berichterstattungsmängel zumindest nachträglich erklärt, und Ombudsleute, die als Beschwerdeinstanzen fungieren und systematisch Fehlern nachspüren, könnten erste Schritte zu einem glaubwürdigen Umgang mit Berichterstattungsfehlern sein. Literatur: ● ● ● Charnley, Mitchell (1936): Preliminary Notes on a Study of Newspaper Accuracy. In: Journalism Quarterly, 13. Jg., S. 394-401. Maier, Scott (2005): Accuracy Matters: A Cross-market Assessment of Newspaper Error and Credibility. In: Journalism and Mass Communication Quarterly, 82. Jg., S. 533-551. Wetzenbacher, Bernd (1998): So stimmt’s. Die Korrekturspalte – Teil eines innerredaktionellen Qualitätsmanagementsystems? Abschlußarbeit im Studiengang Journalisten-Weiterbildung, Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, FU Berlin 1998. Erstveröffentlichung: Journalistik Journal 2/2010 Auch erschienen als Kurzfassung in: Neue Zürcher Zeitung Von der Party in die Katastrophe Wer als Journalist über Tragödien und Trauriges berichtet, der benötigt ein dickes Fell. In solchen Fällen kann das „Dart Center für Journalismus und Trauma“ helfen. Als sich die Loveparade von Duisburg in einen Alptraum verwandelte, wurden aus Partyreportern Katastrophenberichterstatter. Reporter, Fotografen und Kameramänner waren gefordert: Sie schrieben, filmten, fotografierten – und nahmen mit, was sie bekommen konnten. Dabei reagieren Journalisten genauso emotional und aufgeregt wie normale Menschen auf derartige Situationen. Petra Tabeling ist die deutsche Koordinatorin des Dart Center für Journalismus und Trauma und hat sich intensiv mit der Berichterstattung über die Loveparade und der grenzgängerischen Rolle von Journalisten in Katastrophenmomenten auseinander gesetzt. Das „Dart Center“ versteht sich als globales Forum für Journalisten, die über Gewalt berichten. Ziel des internationalen Netzwerkes ist es, ethnisch-moralische, sensible und sachkundige Berichte über Katastrophen und Krieg zu fördern. Das „Dart Center“ wurde 1999 am „Department of Communication“ der Columbia University of Washington gegründet und wird von der privaten Stiftung der Familie Dart getragen. In diesem weltweiten Netzwerk agiert auch Petra Tabeling. Sie sitzt in einem kleinen Büro am Chlodwigplatz in Köln, nebenan arbeiten Moderatoren, freie Redakteure, Medienschaffende. Ständig steht sie per Mail, Skype oder Telefon in Kontakt mit ihren internationalen „Dart“-Kollegen in London, Washington oder aus anderen Regionen, in denen das Dart Center mit lokalen Unterstützern kooperiert. P e t r a T a beling vom Dart Center Das „Dart Center“ arbeitet seit mehreren Jahren auch mit der BBC und dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) zusammen. Tabeling setzt sich dafür ein, Journalisten schon in der Ausbildung und im Volontariat für das Thema Katastrophenberichterstattung zu sensibilisieren. „Das Thema betrifft nicht nur internationale Krisenreporter, sondern auch Lokalreporter, denn Amokläufe gibt es immer mal wieder“, sagt sie. In ihrer Aufgabe ist sie auch zu einer Beobachterin der deutschen Medienszene geworden. Mit großer Spannung hat sie die Berichte und Reportagen über die Loveparade gelesen und ausgewertet, Fernsehen geschaut und Radio gehört. Petra Tabeling über die besondere Situation der Loveparade-Berichterstattung (mp3-Format) „Mir ist dabei aufgefallen, dass viele Journalisten ihre eigene, persönliche Wut aufgegriffen haben“, sagt sie – auch Wut könne eine Reaktion auf ein Trauma sein. Gut habe ihr die Berichterstattung des WDR gefallen. Partymoderatoren wurden zu Krisenberichterstattern: Vom einen Kamera-Schwenk in den anderen änderte sich für die Moderatoren die Situation. Eine gewaltige Aufgabe, die die Moderatoren gut gemeistert hätten, wertet Tabeling. „Solche Extrem-Tage müssen eventuell auch nachbereitet werden“, weil die Arbeit bei Krisen und Katastrophen auch bei Journalisten zu Traumatisierungen, Alpträumen und Flashbacks führen kann. Petra Tabeling über die Unterschiede in der Berichterstattung (mp3-Format) Auch der Deutsche Presserat muss die Loveparade nachbereiten: Mehr als 230 Beschwerden sind dort nach der Berichterstattung über die Massenpanik bei der Loveparade eingegangen – so viele wie noch nie. Passenderweise hat der Deutsche Presserat als freiwillige Selbstkontrolle der deutschen Presse kurz nach der Loveparade einen Leitfaden für Berichte über Amokläufe veröffentlicht. Der Leitfaden umfasst viele Beispiele von Beschwerden – inklusive der Entscheidungen des Presserats und Empfehlungen, wie es anders besser geht. Besonders betont wird in diesem Zusammenhang der Schutz der Persönlichkeit. Der Presserat hat vor allem den Abdruck von Fotos der Opfer bei Amokläufen und bei der Loveparade gerügt. Der zweite Teil des neuen Leitfadens dokumentiert die Befunde von zwei Expertenkommissionen: Als Leitsatz für Journalisten heißt es darin: „Eine extensive, täterkonzentrierte und detaillierte Amokberichterstattaung ist Katalysator für Nachahmungsfantasien und -absichten amokabgeneigter junger Menschen.“ In den Seminaren des „Dart Centers“ lernen angehende Redakteure, freie Mitarbeiter, Chefredakteure, Cutter oder Kameraleute zum Beispiel, wie sie zum Beispiel Augenzeugen gegenüber treten sollen. „Man muss Pausen zulassen, Tränen zulassen, Stoppzeichen verabreden“, erklärt die deutsche „Dart“-Koordinatorin. Niemals solle der Journalist fragen, wie sich der Angesprochene fühlt. „Denn das verursacht Tränen.“ Diese dort vermittelten Erkenntnisse sind in kleinen, roten Heftchen zusammengefasst und heißen zum Beispiel „tragedies and journalists – a guide for more effective coverage“ oder „covering children and trauma – a guide for journalism professionals“. Als freie Journalistin weiß Tabeling auch, was Redaktionen in brenzligen Katastrophensituationen wollen. „Natürlich müssen die Journalisten ihre Aufgaben erledigen und Vor-Ort berichten. Es geht aber darum, behutsam vorzugehen“, sagt sie. In vielen Fällen würden Journalisten dabei alleine gelassen. Das muss aber nicht so sein. Der Affe und die Journalisten Sie lesen die Zeitung. Was Sie nicht wissen: Der Autor des Artikels ist ein Affe. Oder Sie schalten den Fernseher ein: Präsentiert werden die News von einem Roboter namens George. Sieht so die Zukunft aus? „Die bemerkenswerte Leistung von Joe Maurer hat nicht gereicht. Im Stadion von Arlington gelang es am vergangenen Montag den „Minnesota Twins“ nicht, die „Texas Rangers“ zu schlagen. Die „Rangers“ gewannen mit 8 : 5. Bei den Texanern fiel vor allem Tommy Hunter auf, der sein fünftes Match gewann“. Dies ist der Text eines Baseball-Berichtes – so wie er in Hunderten amerikanischer Zeitungen steht. Was nur wenige wissen: Geschrieben wurde dieser Artikel nicht von einem Journalisten, sondern von einem Roboter. Unter dem Text steht die Unterschrift des Verfassers: „The Machine“. Ein Computerprogramm durchkämmt das Internet. In Sekundenbruchteilen findet es Informationen zum Spiel zwischen den „Twins“ und den „Rangers“. Mit diesen Angaben verfasst es den Artikel. Dabei werden vorgegebene Textbausteine logisch zusammengeführt. „Stats Monkey“ heißt das Programm – Statistik-Affe. Nachgeäffte Intelligenz Der Text ist attraktiv geschrieben, keineswegs holperig. Er ist grammatikalisch und orthographisch perfekt. Kein einziger Journalist hat mitgewirkt. Der „Stats Monkey“ ist ein Programm der sogenannt künstlichen Intelligenz. Diese Software funktioniert ähnlich wie ausgeklügelte ComputerSchachprogramme. Entwickelt wurde das Programm von der Northwestern University in Evanston bei Chicago. Der Computer wird so programmiert, dass er eigenständig Fragen, Probleme und Gegebenheiten menschenähnlich analysieren kann und ein intelligentes Verhalten simuliert – in diesem Fall: „nach-äfft“. Affe und Journalist – kaum Unterschiede Computer-Programme und Roboter führen dazu, dass in vielen Sektoren immer mehr Arbeitsplätze abgebaut werden. Dass auch die Journalisten ersetzt werden könnten, rückt jetzt in den Bereich des Möglichen. Verleger werden jubilieren; sie können Journalisten einsparen. Journalismus ohne Journalisten. Wird der Journalismus vom Affen gebissen? Geleitet wird das Programm von den Professoren Larry Birnbaum und Kris Hammond. Sie arbeiten mit einer Gruppe sehr junger Journalisten und Informatikern zusammen. Die Texte kämen den „normalen“ Zeitungsberichten und Nachrichtenagenturmeldungen sehr nahe, sagen die Professoren. Also: Kaum Unterschiede zwischen dem Affen und dem Journalisten. Abgerufen wird eine riesige Sammlung von Textbausteinen, Halb-Sätzen, Ganz-Sätzen, Ausdrücken aus Sport und Politik, fertige Schlüsselworte. Über Jahre hinweg hat ein Computer Zeitungen und Fernsehberichte nach den gebräuchlichsten Ausdrücken abgegrast und sie gesammelt. Angepeilt werden soll in einer ersten Phase die lokale Presse. Ihr fehlt oft das Geld, Journalisten auf kleinere Ereignisse, wie lokale Sport-Events anzusetzen. Solche Sport-Veranstaltungen kommen in den Medien zu kurz. „Es gibt in den USA in den Schulen 160‘000 Baseball-Teams“, sagt einer der Promotoren des Programms. „Die Journalisten interessieren sich nicht dafür, doch Millionen von Amerikanern fiebern mit“. Also liefert der Affe einen Bericht. Am Anfang stehen Sport- und Wirtschaftsberichte Die Sport-Berichterstattung eignet sich vielleicht am besten für solche Programme: sie ist stark standardisiert, der Wortschatz ist limitiert und voller Schablonen, die Litaneien ähneln sich. Deshalb versucht man die neue Software anhand eines Baseball-Spiels zu erklären. Doch der Affe soll zu mehr fähig sein. Besonders eigne sich dieser Roboter-Journalismus auch für die Wirtschaftsberichterstattung, sagen die Professoren in Evanston. Auch der Wirtschaftsjournalismus, der sehr von Zahlen und Daten lebt, ist stark schablonisiert; man findet immer die fast gleichen Ausdrücke. „Es gibt in den USA 54‘000 Börsen-kotierte Firmen“, sagt Professor Hammond. „Jede muss ihren Aktionären einen Geschäftsbericht mit Zahlen und Daten vorlegen. Doch die Wirtschaftspresse interessiert sich höchstens für 3‘000 von ihnen“. Für die Übrigen arbeitet und schreibt „The Machine“. „Zoe“ – die attraktive Moderatorin Auch die Polit-Berichterstattung könnte so abgedeckt werden. Ein erfundenes Beispiel: In Frankreich finden Regionalwahlen statt. „The Machine“ sucht das Internet nach ersten Wahlergebnissen ab, vergleicht sie, ermittelt Sieger und Verlierer, fischt sich Zitate und Reaktionen von Politikern aus dem Netz – und verfasst einen Artikel. Die Maschine findet Bilder aus den Wahllokalen und fügt sie der Story bei. Auch eine Grafik mit den Kräfteverhältnissen der Parteien fehlt nicht. Doch nicht nur Zeitungsberichte können so verfasst werden: auch Fernseh-News. Schon heute können Computer geschriebene Texte vorsprechen. Ein männlicher Roboter namens George präsentiert die Tagesschau, ebenso eine attraktiv aussehende Moderatorin namens Zoe – beide sind allerdings nur gezeichnet. „News at Seven“ nennt man an der Universität in Evanston dieses Programm. Natürlich sucht die Maschine auch bewegte Bilder im Netz und realisiert eigene, besprochene Filmberichte. Professionelle Journalisten schaudert es Weder in der Zeitung noch in den News at Seven kommen die Texte trocken daher. Sie können so programmiert werden, dass sie den Schreibstil des einen oder andern Journalisten imitieren. Natürlich hat das System Nachteile: Was nicht im Internet auffindbar ist, wird auch nicht in der Story stehen. Zunächst schaudert es jeden professionellen Journalisten vor dieser Vision. Beim zweiten Hinsehen jedoch, kann dieser Maschinen-Journalismus durchaus Vorteile haben: Kleinere Facts-and-Figurs-Meldungen wird „The Machine“ wohl nicht anders verfassen als ein leibhafter Journalist. Wenn ein Hotel in Madrid brennt und vier Tote zu beklagen sind, werden beide Berichte gleich aussehen. So könnten kleinere Berichte von Maschinen verfasst werden; die Journalisten hätten dann vermehrt Zeit für Recherchen. Und Hand aufs Herz: Einige Artikel wären wahrscheinlich seriöser und fehlerloser, wenn sie ein Roboter geschrieben hätte. Nochmals Hand auf Herz: Viele Texte unserer Gratisanzeiger (und andern) gleichen schon heute Roboter-Texten. Programmierte Rechts- und Linkslastigkeit Sicher wird es Leute gegeben, die diesen Maschinen-Journalismus begrüssen. „Da könnt ihr uns nicht mehr manipulieren“. Doch selbst das könnte man. Man könne die Maschine wohl so einstellen, dass sie einen rechtslastigen oder einen linkslastigen Bericht fabriziert. Ein wunderbares Beispiel dafür, dass man Fakten so oder so interpretieren kann. Und der Meinungsjournalismus? Selbst da ist ein Roboter-Kommentar – theoretisch – nicht unmöglich. Der Computer könnte zum Beispiel auf „Pro Obama“ programmiert werden. Alles was nicht Obamas Credo und Politik entspricht wird von der Maschine aufgespürt und kritisiert. Doch da ist noch ein langer Weg zu gehen. Wichtig im Journalismus ist die Themenauswahl. Was interessiert die Menschen am meisten? Das können Computer längst schon eruieren, indem sie im Internet die angeklickten Berichte zählen. Solche Statistiken sind vor allem für die Boulevard-Medien ein Kompass für die Berichterstattung. Geschrieben wird über das, was eine möglichst breite Masse interessiert – nicht aber über das, was vielleicht langweilig aber politisch oder gesellschaftlich bedeutend ist. Doch der Einsatz von Computern muss nicht zu einer totalen Mainstreamisierung führen. Verfeinerungen bei der Programmierung sind möglich. Jede Zeitung hat ein spezifisches Publikum, das sich für spezifische Themen interessiert. Danach wird sich der Affe richten. Manche Zeitungs-, Radio- und Fernsehberichte werden vom Affen verfasst werden können – ohne dass jemand merkt, dass die Autorin eine Maschine ist. Manche Redaktoren werden da tatsächlich ersetzt werden können. Doch vieles wird der Affe nicht können. Der Affe sagt: Mich laust der Affe Journalismus besteht nicht nur aus dem Aufzählen von Fakten und der Beschreibung von Gegebenheiten. Journalismus heißt: brisante Themen aufgreifen, sie so oder so interpretieren, die Spreu vom Weizen trennen, Zusammenhänge aufdecken, eine Nase für mögliche Entwicklungen haben, spüren, was auf uns zukommt. Da wird sich der Affe manche Zähne ausbeissen. Auch bei bester Programmierung wird er immer hinterherhinken. Er wird auch nie Texte mit Engagement, kritischem Blick und Herzblut verfassen können. Jahrzehnte brauchten die grössten Schachcomputer bis sie den Schachweltmeistern ab und zu Paroli bieten konnten. Doch Schach ist zu achtzig Prozent Mathematik. Das Leben aber ist viel komplizierter, verrückter, überraschender. Und dieses Leben ist es, das der Journalismus abbilden soll. Da wird der Stats Monkey kapitulieren und sagen: Mich laust der Affe. Heiner Hug war “Tagesschau”-Chef beim Schweizer Fernsehen (SF), zuvor Auslandchef, Chefproduzent und Korrespondent in Genf und Paris. Ein gläubiger Diener des Mainstreams Der deutsche Wirtschaftsjournalismus sei in der Finanzkrise seiner Aufklärungspflicht nicht ausreichend nachgekommen. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Wirtschaftsjournalismus in der Krise: Zum massenmedialen Umgang mit Finanzmarktpolitik” von Hans-Jürgen Arlt und Wolfgang Storz, herausgegeben von der Otto Brenner Stiftung. Die Autoren haben in dem Zeitraum von Frühjahr 1999 bis Herbst 2009 insgesamt 822 Artikel aus den überregionalen Tageszeitungen „Handelsblatt“, „die tageszeitung“, „Süddeutsche Zeitung“, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und „Financial Times Deutschland“ analysiert. Ebenso haben sie die 141 Beiträge der „Tagesschau“ und „Tagesthemen“ sowie 212 Meldungen des Basisdiensts der „Deutschen Presseagentur“ untersucht. Die untersuchte Berichterstattung hatte einen Bezug zu 16 bedeutenden Ereignissen, die die Autoren ausgewählt hatten, wie die Schließung des Koalitionsvertrags der Großen Koalition 2005 (Ereignis 7) und der G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 (Ereignis 14) Sie unterstellten dabei, dass die tagesaktuellen Medien vor allem in Verbindung mit wichtigen aktuellen Ereignissen über schwer vermittelbare Themen wie Finanzmärkte berichten. Zudem fertigten sie zu weiteren fünf bedeutenden Ereignissen Fallstudien an, so auch zum Grundsatzreferat des DGB-Vorsitzenden Michael Sommer auf dem DGB-Bundeskongress 2006, und führten Interviews mit sieben leitenden Redakteuren und drei Wissenschaftlern. Hans-Jürgen Arlt, ehemaliger Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des DGB und nun Kommunikationsberater und Lehrbeauftragter, und Wolfgang Storz, ehemaliger Chefredakteur der Frankfurter Rundschau und nun Publizist und Lehrbeauftragter, gingen dabei von drei Ausgangsfragen aus: Hat der Wirtschafts- und Finanzjournalismus über die hier interessierenden Themenbereiche umfassend informiert? Lieferte er Orientierung? Wurde er seiner Funktion als Frühwarnsystem gerecht? Einer der wichtigsten Befunde der Studie ist, dass der tagesaktuelle deutsche Wirtschaftsjournalismus „kein kritischer Träger der Aufklärung“ ist, sondern „ein gläubiger Diener des Mainstreams“. Er habe als Beobachter, Berichterstatter und Kommentator des Finanzmarktes und der Finanzmarktpolitik bis zum offenen Ausbruch der globalen Finanzmarktkrise schlecht gearbeitet. Er biete wenig Information und verursache viel Desorientierung. Die tagesaktuellen Massenmedien hätten über Jahre hinweg das Thema Finanzmärkte und Finanzmarktpolitik ignoriert. Sie seien damit ihrer Rolle als Frühwarnsystem der Gesellschaft nicht gerecht geworden. Erst mit dem “offiziellen”, faktisch von Politik und Wirtschaftseliten ausgerufenen Beginn der Krise im September 2008 habe auch in den Massenmedien eine der Situation angemessene Berichterstattung eingesetzt. Die Studie kann als Volltext (PDF) auf der Website der Otto Brenner Stiftung heruntergeladen werden.