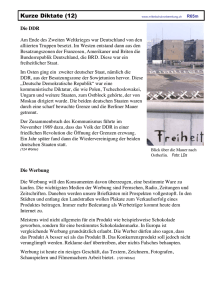20 Jahre Maueröffnung in Europa
Werbung

Reihe für Gemeinschaftskunde, Geschichte, ISSN 1864-2942 Deutsch, Geographie, Kunst und Wirtschaft DEUTSCHLAND & EUROPA Heft 58 – 2009 20 Jahre Maueröffnung in Europa Reihe für Gemeinschaftskunde, Geschichte, Deutsch, Geographie, Kunst und Wirtschaft DEUTSCHLAND & EUROPA HEFT 58–2009 „Deutschland & Europa” wird von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg herausgegeben. DIREKTOR DER LANDESZENTRALE Lothar Frick REDAKTION Jürgen Kalb, [email protected] REDAKTIONSASSISTENZ Sylvia Rösch, [email protected] BEIRAT Günter Gerstberger, Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart Dr. Markus Hoecker, Oberregierungsrat, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Prof. Dr. emer. Lothar Burchardt, Universität Konstanz Dietrich Rolbetzki, Oberstudienrat i. R., Filderstadt Lothar Schaechterle, Studiendirektor, Stetten i. R. Dr. Walter-Siegfried Kircher, Oberstudienrat i. R., Stuttgart Lothar Frick, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Jürgen Kalb, Studiendirektor, Landeszentrale für politische Bildung ANSCHRIFT DER REDAKTION Stafflenbergstraße 38, 70184 Stuttgart Telefon: 0711.16 40 99-45 oder -43; Fax: 0711.16 40 99-77 Titelbild: Jubelnde Menschen auf der Berliner Mauer am Brandenburger Tor. Am Abend des 9.11.1989 teilte das SED-Politbüromitglied Günter Schabowski in einer Pressekonferenz in Ost-Berlin mit, dass alle DDR-Grenzen in die Bundesrepublik und nach West-Berlin für DDRBürger »unverzüglich« geöffnet würden. Daraufhin strömten binnen weniger Stunden Tausende von Ost-Berlinern in den Westteil der Stadt, wo es zu volksfestartigen Verbrüderungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern aus Ost- und Westdeutschland kam. Seit ihrer Errichtung im Jahre 1961 waren an der Berliner Mauer mindestens 98 Menschen beim Versuch, die Grenzanlagen zu überwinden, ums Leben gekommen. © picture alliance, dpa SATZ Schwabenverlag Media der Schwabenverlag AG Senefelderstraße 12, 73760 Ostfildern-Ruit Telefon: 0711.44 06-0, Fax: 0711.44 06-179 DRUCK Süddeutsche Verlagsgesellschaft Ulm mbH 89079 Ulm Deutschland & Europa erscheint zweimal im Jahr. Preis der Einzelnummer: 3,– EUR Jahresbezugspreis: 6,– EUR Auflage 18 000 Namentlich gezeichnete Beiträge geben nicht die Meinung des Herausgebers und der Redaktion wieder. Für unaufgefordert eingesendete Manuskripte übernimmt die Redaktion keine Haftung. Nachdruck oder Vervielfältigung auf elektronischen Datenträgern sowie Einspeisung in Datennetze nur mit Genehmigung der Redaktion. Mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport, der Robert Bosch Stiftung sowie der Heidehof Stiftung. THEMA IM FOLGEHEFT 59 (APRIL 2010) Die Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa Inhalt Inhalt 20 Jahre Maueröffnung in Europa Vorwort des Herausgebers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Geleitwort des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 I. 20 JAHRE NACH DEN FRIEDLICHEN REVOLUTIONEN 1. 20 Jahre »Friedliche Revolutionen« – Chancen für ganz Europa (Jürgen Kalb) . . . . . . . . 3 II. 20 JAHRE MAUERÖFFNUNG IN DEUTSCHLAND 1. Die friedliche Revolution in der DDR und die Folgen (Andreas Grießinger) . . . . . . . . . . . 6 2. DDR – Das letzte Jahr war das beste. Einschätzungen eines Zeitzeugen (Frank Richter) . . 14 3. Wirtschaftliche Entwicklung in Ost- und Westdeutschland seit 1989 (Wolfgang Walla) . . 20 4. »Die DDR wird abgewickelt« – 20 Jahre deutsche Einigung (Roland Czada) . . . . . . . . . . 28 1 III. MAUERÖFFNUNG IN EUROPA 1. »Solidarnosc«, der »Runde Tisch« und erste demokratische Wahlen in Polen (Joanna Beszcynska | Ryszard Kaczmarek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2. »Es begann in Gdansk«. Rückblick und Bilanz (Manfred Mack) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3. Ungarn öffnet die Grenze – »Vom Musterknaben zum Sorgenkind« (Walter-Siegfried Kircher | Dietrich Rolbetzki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4. Autoritäre Macht in Russland: Vom Kommunismus bis zum System Putin (Benno Ennker) . . 56 5. Weltmacht auf dem Rückzug? Von der UdSSR zur Russischen Föderation (Gerd Braitmaier) 64 6. Die NATO – ein Relikt des Kalten Kriegs? (Florian Jordan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 7. Verbliebene Weltmacht: Die Europapolitik der USA vor und nach 1989 (Jürgen Kalb) . . 78 »DEUTSCHLAND & EUROPA« INTERN Angebote des Landesmedienzentrums und der LpB zum Thema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Die Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 D&E Heft 58 · 2009 Inhalt 2 Vorwort des Herausgebers Geleitwort des Ministeriums Zwanzig Jahre nach dem Mauerfall wird erneut öffentlich die Frage diskutiert, wie es zur friedlichen Revolution in der DDR im Jahre 1989 kam. Wissenschaftliche Untersuchungen unter Schülerinnen und Schülern ergaben diesbezüglich nicht nur eine erschreckende Unkenntnis in Ost und West, sondern auch eine offensichtliche Scheu, sich mit diesen Fragen im Unterricht überhaupt auseinanderzusetzen. Schon ist in den Medien von »Ostalgie« auf der einen Seite und von »Desinteresse an der DDR-Geschichte im Westen« zu lesen. Mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Jahre 1990 wurden zwei Bevölkerungsteile mit ganz unterschiedlichem politisch-kulturellem Sozialisationshintergrund und deutlich unterschiedlichen Lebensweisen zu einer neuen politischen Gemeinschaft verbunden. Sollten dabei ehemalige Ost-West-Stereotypen auch zwanzig Jahre danach weiter fortbestehen, wie diese Untersuchungen behaupten, so wäre es um die Ausbildung eines Zusammengehörigkeitsgefühls und die Entwicklung einer gemeinsamen Identität in Deutschland nicht gut bestellt. Ähnliche Kontroversen über die Bewertung der friedlichen Revolution lassen sich im Übrigen auch in anderen europäischen Nationen wie etwa Polen, Ungarn, aber auch in Russland beobachten. Der westdeutsche Schriftsteller Peter Schneider sprach bereits 1983 in seinem Roman »Der Mauerspringer« von der Beseitigung der »Mauer in den Köpfen«. Gibt es zumindest seit 1989 nicht Grund genug, auf die friedlichen Proteste in der DDR, aber auch in Polen und Ungarn gesamteuropäisch und mit Stolz zurück zu blicken? In enger Kooperation mit dem Leiter der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und unmittelbaren Zeitzeugen des Jahres 1989 Frank Richter wirft die aktuelle Ausgabe von D&E deshalb einen Blick auf diese Jahre, auf die Ereignisse in der DDR, in Polen, Ungarn und in der damaligen Sowjetunion. Weitergehend werden zudem die Folgen der Transformation in den letzten zwanzig Jahren in Europa untersucht. Für einen Abbau der »Mauer in den Köpfen« erscheinen uns Dokumentationen und Analysen wie die vorliegenden von entscheidender Bedeutung. Eine kritische Diskussion von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Einstellungen und Wertorientierungen in Ost und West ist eine Grundvoraussetzung für die von so vielen gewünschte Herausbildung einer europäischen Identität in einer freiheitlichen Gesellschaft, die schließlich mit den friedlichen Revolutionen in Mittel- und Osteuropa vor zwanzig Jahren von den Bürgerinnen und Bürgern erkämpft wurde. Die Jahrestage der deutsch-deutschen Geschichte in diesem und im nächsten Jahr bieten eine gute Gelegenheit, die Vermittlung der Geschichte der DDR und der friedlichen Revolution in den Schulen verstärkt in den Blick zu nehmen. Deshalb haben wir im Februar alle Schulen in Baden-Württemberg zu einer intensiven Befassung mit dem Thema DDR aufgerufen. Die Kultusministerkonferenz teilt diese Sicht der Dinge mit ihrer einstimmigen Beschlussfassung vom 18. Juni 2009: Sie hat allen Schulen in Deutschland vorgeschlagen, am 9. November einen Projekttag zur Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert durchzuführen. Professor Klaus Schroeder, der Leiter des Forschungsverbundes SED-Staat der Freien Universität Berlin, hat uns bei der Entwicklung der Angebote beraten, die wir in diesem Jahr bereithalten. Außerdem arbeitet das Kultusministerium anlässlich des 20. Jahrestags der friedlichen Revolution in der DDR zum Beispiel mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin und mit dem DDR-Museum in Pforzheim zusammen. Lothar Frick Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg Vorwort & Geleit wort Jürgen Kalb, LpB, Chefredakteur von »Deutschland & Europa« Das neue Heft der Reihe »Deutschland & Europa« ist ein sehr anschauliches Beispiel für die Partnerschaft mit der Landeszentrale für politische Bildung, die im Jubiläumsjahr der friedlichen Revolution besonders eng ist. Es ist wichtig, dass die Themen dieses Heftes in unseren Bildungsplänen einen festen und unverrückbaren Platz haben. Zu einer modernen historisch-politischen Arbeit im Unterricht gehört eine sachliche und ideologiekritische Auseinandersetzung mit unserer Nachkriegs- und Zeitgeschichte. Dazu will diese Publikation beitragen. »Die friedliche Revolution von 1989 und die Überwindung der deutschen Teilung zählen zu den glücklichsten Ereignissen der deutschen Geschichte«, sagt der Bundestagsabgeordnete Arnold Vaatz, der damals Pressesprecher der Bürgerbewegung Neues Forum war. In einem Rechtsstaat zu leben ist ein kostbares Gut, möchte man hinzufügen. Ein Gut, das keine bare Selbstverständlichkeit ist. Ein Gut, für das die Menschen im Osten Deutschlands vor zwanzig Jahren zu Tausenden auf die Straßen gingen. Ihr Mut wurde belohnt, davon erzählt dieses Heft. Dr. Markus Hoecker Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg D&E Heft 58 · 2009 I. 20 JAHRE NACH DEN FRIEDLICHEN REVOLUTIONEN 1. 20 Jahre »Friedliche Revolutionen« – Chancen für ganz Europa JÜRGEN KALB D ie Erinnerung an die »Friedliche Revolution« ist in den Medien zumeist eng verknüpft mit den Ereignissen der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 in Berlin, als plötzlich die seit 1961 bestehende Mauer, die Berlin und Deutschland 28 Jahre lang teilte, nach einer spektakulären Pressekonferenz des SED-Politbüromitglieds Günter Schabowski geöffnet wurde. Tausende von Ost-Berlinern nahmen Schabowski und seine reichlich unsicher wirkende Antwort auf die Frage, ab wann nun die neu angekündigte »Reiseregelungen für DDRBürger« gelten sollten, »so viel ich weiß – ab sofort« wörtlich und liefen in Richtung Grenzübergänge. Schließlich gaben dann tatsächlich die Grenzposten der DDR nach und öffneten die Absperrungen. Unbeschreibliche Szenen der Begegnung und Umarmung von Ost und West spielten sich in den darauf folgenden Stunden und Tagen ab. Diese Bilder gehen bis heute um die Welt. Schon vorher fanden aber z. B. die Montagsdemonstrationen in Leipzig ein breites Medienecho. Nicht zu vergessen sind aber auch die Ereignisse in Polen 1989 und die Bewegung der unabhängigen Gewerkschaft »Solidarnosc«. Geöffnet wurde der »Eiserne Vorhang« (Churchill) zunächst in Ungarn, auch 1989. Es waren also gleich mehrere Revolutionen, europaweit. Und natürlich spielte der seit 1985 amtierende Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow, später Friedensnobelpreisträger (1990), und seine Politik der »Perestroika« eine zentrale Rolle. Dass es aber binnen Jahresfrist auch noch zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten kommen würde, hatte wohl kaum ein Beobachter vor dem 9. November vorauszusagen gewagt. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl hatte mit Unterstützung des US-amerikanischen Präsidenten George Bush sen. das sich öffnende Zeitfenster konsequent genutzt. In den sogenannten »2+4Verhandlungen« beschlossen schließlich die Siegermächte des II. Weltkriegs und die Vertreter beider deutscher Staaten die Bedingungen und das »Wie« einer deutschen Vereinigung. 2009 und 2010 werden die Erinnerungen an diese Ereignisse der Jahre 1989 und 1990 anlässlich ihrer 20. Wiederkehr auch in den Schulen genügend Anlass zur kritischen Reflexion bieten. Jugendstudien Eine unter mehr als 5.000 Schülern in Berlin, Brandenburg, NRW und Bayern durchgeführte Untersuchung ließ im Jahr 2007, also fast 20 Jahre nach der Maueröffnung, die Medien aufhorchen. »Spiegelonline/Schulspiegel« schrieb z. B. zu den Ergebnissen dieser von Monika Deutz-Schroeder und Klaus Schroeder im Rahmen des »Forschungsverbundes SED-Staat« an der FU Berlin durchgeführten Studie, unsere Schüler wüssten so gut wie nichts von der DDR. Von »Honeckers paradiesischer Diktatur«, »SEDDiktatur als Sozialidyll« und vom »Kinder- und Umweltparadies« war hier zu lesen (9.11.2007). Diffuse Geschichtskenntnisse und krasse Fehleinschätzungen über die DDR prägten das Bild – und zwar noch mehr im Osten als im Westen. Das Fazit des SPIEGEL lautete daher: »Die erschütternden Ergebnisse lassen nur einen Schluss zu: Deutschlands Jugend braucht dringend mehr Aufklärung.« Die wichtigsten Ergebnisse der Studie finden sich online unter: www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,516462,00.html. D&E Heft 58 · 2009 Abb. 1 Hunderttausende demonstrieren am 04.11.1989 auf den Straßen um den Berliner Alexanderplatz – hier bezeichnenderweise am Palast der Republik – für Veränderungen in der DDR. Es war die größte Protestdemonstration in der Geschichte der DDR. Von diesem Tag an konnte die SED-Führung an den Forderungen der Massen nicht mehr vorbeigehen. © ddrbildarchiv.de/Willmann Wenn auch in der sich anschließenden öffentlichen Diskussion der Studie deutlich methodische Einwände laut wurden (z. B. von Borries), so bestand doch in der Kultusministerkonferenz rasch Konsens darüber, dass einer möglichen Verklärung der DDR-Diktatur entgegenzuwirken sei. So wurden die Schulen beispielsweise bundesweit aufgefordert, zum 9. November Projekttage zu veranstalten. Monika Deutz-Schroeder und Klaus Schroeder haben zur sich anschließenden breiten Debatte um die Ergebnisse ihrer 760 Seiten umfassenden Studie inzwischen ein kleines, lesenswertes Taschenbuch im Wochenschau-Verlag herausgegeben, das nicht nur die wichtigsten Ergebnisse in anschaulichen Grafiken festhält, sondern genügend Material zur kontroversen Diskussion mitliefert. Dem baden-württembergischen Kultusminister Helmut Rau war es jedenfalls ein persönliches Anliegen, über die Ereignisse des Jahres 1989 und die DDR auch in Schulen Diskurse in Gang zu bringen. In enger Kooperation mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg, dem Landesmedienzentrum, dem Studienhaus Wiesneck und der LpB in Sachsen hat hier auch die LpB in Baden-Württemberg mitgewirkt. So wurde nicht nur ein neues Internetportal erstellt (www.ddr-im-unterricht.de), sondern es fanden im September 2009 unter Mitwirkung aller Beteiligten und in der Regie des MKS gleich zwei Fachtagungen zum Thema »20 Jahre friedliche Revolution« in den Landesakademien für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen in Baden-Württemberg auf der Comburg und in Esslingen statt. Dort wurden insgesamt rund 200 Schulleiterinnen und Schulleiter, Fachberaterinnen und Fachberater, Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen und Baden-Württemberg und aus allen Schularten informiert und ins Gespräch gebracht. Kultusminister Helmut Rau (MdL) aus Baden-Württemberg und der Staatssekretär im sächsischen Kultusministerium Hansjörg König erschienen persönlich in Esslingen und hielten kurze Ansprachen: http://lehrerfortbildung-bw.de/lak/akademien/2009/30_escom_mauerfall/index.html 20 Jahre »Friedliche Re volutionen« – Chancen für ganz Europa 3 JÜRGEN KALB Abb. 2 Zeitzeugenbefragung zur »Friedlichen Revolution 1989« im Rahmen einer Lehrerfortbildungsveranstaltung der Akademie in Esslingen: (von links) Frank Richter, 1989 Kaplan in Dresden und Mitbegründer der »Gruppe der 20«, heute Direktor der sächsischen LpB, Detlef Pappermann, ehemaliger Oberleutnant der Volkspolizei und Einsatzleiter im Oktober 89 vor dem Dresdner Hauptbahnhof; Moderation: Dr. Beate Rosenzweig, stellvertretende Leiterin des Studienhaus Wiesneck; Daniela Dahn, Publizistin und Schriftstellerin, Mitbegründerin des »Demokratischen Aufbruchs« in der DDR; Oberstleutnant Henry Hölzner, 1989 Hauptmann der Nationalen Volksarmee der DDR und im Oktober 1989 vor dem Dresdner Hauptbahnhof im Einsatz. Der Lehrerfortbildungsserver stellte diese Zeitzeugenbefragungen als Videos (auch zum Download) zur Verfügung unter: http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/gkg/mauerfall/zeitzeugen © Jürgen Kalb 4 Die Vorträge und die folgenden Diskussionen sind im Übrigen ebenso über den Landeslehrerfortbildungsserver zu betrachten wie auch die interessanten Vorstellungen und Aussprachen mit Zeitzeugen der Wende und die Fachvorträge. Enger Kooperationspartner dieser Veranstaltungen war dabei Frank Richter, einst persönlich als Kaplan in die Ereignisse in Dresden involviert. Heute leitet Frank Richter als verantwortlicher Direktor die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen. Einen Widerpart stellte der Einsatzleiter der Volkspolizei in Dresden, Detlef Pappermann dar. Inzwischen arbeitet Pappermann als Kommissar bei der Kripo. Was hat sich verändert? Diese Frage beantwortete auch Henry Hölzner, einst Hauptmann bei der NVA, jetzt Oberstleutnant bei der Bundeswehr. Daniela Dahn, viel gelesene Schriftstellerin in Deutschland, war einst Mitbegründerin des »Demokratischen Aufbruchs«. Heute hält sie auch der Bundesrepublik gerne den Spiegel vor. Vieles an den Äußerungen der anderen Podiumsmitglieder schien ihr zu negativ über die DDR. Die Diskussionen entwickelten sich lebendig und kontrovers. »20 Jahre Maueröffnung in Europa« – Die neue Ausgabe von D&E In der neuen Ausgabe von D&E übernimmt zunächst Dr. Andreas Grießinger die Aufgabe, die Friedliche Revolution in der DDR vorzustellen, sie aber auch mit Blick auf den kompetenzorientierten Geschichtsunterricht aus unterschiedlichen Perspektiven zu werten. Das von ihm – aber auch das von den anderen Autorinnen und Autoren im Heft – zusammengetragene Material soll eben nicht nur Fakten vermitteln, sondern immer auch Kontroversität widerspiegeln und begründete Urteile ermöglichen. Der zweite Beitrag stammt von Frank Richter, einem der sensibelsten Beobachter und Beteiligten der Ereignisse von 1989. Dabei gelingt ihm im Unterschied zu vielen anderen Zeitzeugen stets die kritische Selbstreflexion und Abstraktion über die eigenen Erfahrungen hinweg. Außerdem stellte Frank Richter noch Auszüge aus seiner Stasi-Akte zur Verfügung, die wir im Heft abdrucken. So dokumentieren wir hier vor allem die Ereignisse in Dresden, während zum Beispiel die konkreten Ereignisse in Leipzig und Berlin eher am Rande vorkommen. Des Weiteren folgen zwei Beiträge aus der gesamtdeutschen Sicht, aber auch aus der Sicht von 20 Jahren danach. Der ehemalige Abteilungsleiter im Statistischen Landesamt Baden-Württemberg und intime Kenner verschiedenster Datenbanken Wolfgang Walla ist für uns der Frage nachgegangen, ob es nun zu den von Helmut Kohl versprochenen »blühenden Landschaften« im Osten Deutschlands gekommen ist. Sein Urteil fällt naturgemäß differenziert aus. Er vergleicht schließlich den Ost-West-Gegensatz mit dem auch nicht zu leugnenden Nord-Süd-Gefälle innerhalb Deutschlands. Dabei bietet die Fülle der dargestellten Grafiken und Tabellen Schülerinnen und Schüler besonders die Möglichkeit, ihre Kompetenzen beim Lesen und kritischen Hinterfragen von Statistiken auszubilden, gemäß dem inzwischen geflügelten Wort, das Churchill zugesprochen wird: »Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht« hast. Auch Prof. Dr. Roland Czada, Universität Osnabrück, widmet sich einer gesamtdeutschen Perspektive: »Die DDR wird abgewickelt. 20 Jahre deutsche Einigung.« fragt nicht zuletzt nach den ökonomischen und politischen Kosten und Folgen des Transformationsprozesses. In ähnlicher Form hatte Prof. Czada seine These bereits auf der Comburg-Tagung vorgetragen. Und auch dieser Vortrag liegt als Video zusammen mit den dort vorgestellten Materialien auf dem Landeslehrerfortbildungsserver zum Download bereit. Zusammenhänge zwischen historischen, ökonomischen und politischen Faktoren werden hier besonders deutlich, die Kompetenz der Statistikanalyse gezielt geschult. Stimmen aus Polen schauen manchmal kritisch auf die Feierlichkeiten zur Maueröffnung in Deutschland. Waren es nicht zuerst die Polen, die der friedlichen Revolution in Mitteleuropa den Weg ebneten? Prof. Dr. Ryszard Kaczmarek, Direktor des Historischen Instituts der Schlesischen Universität in Katowice, Polen, und seine Geschichtsdoktorandin an der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften, Joanna Beszczynska, schildern und bewerten deshalb die Umbrüche von 1980 bis 1989 aus polnischer Sicht. Manfred Mack vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt stellt als ausgewiesener Polenspezialist im Weiteren dann die bis heute andauernden Streitigkeiten über den Umbruch im Jahre 1989 in Polen dar. Hierbei geht es insbesondere um die Bewertung des »Runden Tischs«, der als Modell dann so vielen anderen Ländern als Vorbild diente. Interessant ist dabei auch der heutige Rückblick der Polen auf die vergangenen 20 Jahre. Was war positiv, was ist schief gelaufen? Dr. Walter Kircher und Dietrich Rolbetzki, die ehemaligen Redakteure und heutigen Beiratsmitglieder von D&E, untersuchen danach die ungarischen Verhältnisse. Zunächst wird ein historischer Blick auf die Niederschlagung des Ungarnaufstands durch sowjetisches Militär im Jahre 1956 geworfen, bevor die Hintergründe der Öffnung des »Eisernen Vorhangs« in Ungarn im Jahre 1989 beleuchtet wird. Und steckt das heutige Ungarn »als Sorgenkind« nun wegen oder trotz seiner frühen Öffnung zum Westen hin in der Krise? Mit Michail Gorbatschows Ansehen, der 1990 den Friedensnobelpreis bekam, scheint es im heutigen Russland nicht zum Besten zu stehen. Was bewog Gorbatschow damals zu seiner »Perestroika«? Was ist nach dem Ende der Sowjetunion aus der Russischen Revolution geworden? Dr. Benno Ennker, Osteuropahistoriker an der Hochschule St. Gallen und an der Universität Tübingen, geht diesen Fragen systematisch und mit dem Fokus auf die Innenpolitik in der Russischen Föderation nach. Wie erklärt sich heute das »System Putin« nach all den Gorbatschow- und Jelzin-Jahren? Gerd Braitmaier, Lehrer am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in StuttgartBad Cannstatt und ebenfalls Osteuropaexperte, untersucht dann den außenpolitischen Wandel der Russischen Föderation. Spätestens beim Georgienkrieg im Jahre 2008 tauchte in den Medien die Gefahr eines neuen »Kalten Krieges« wieder auf. Was bewegt die Putin- bzw. Medwedew-Administration? Wie nehmen die Russen die anderen Europäer und die USA wahr? Der Jugendoffizier der Bundeswehr in Baden-Württemberg und Kapitänleutnant Florian Jordan schildert anschließend den Stra- 20 Jahre »Friedliche Re volutionen« – Chancen für ganz Europa D&E Heft 58 · 2009 tegiewechsel der NATO. Nach dem Ende des Kalten Kriegs und dem Zusammenbruch der Sowjetunion sprachen schon manche vom Ende der Allianz. Tatsächlich hat sie sich aber inzwischen bis an die Grenzen der ehemaligen Sowjetunion ausgedehnt, ja mit den baltischen Staaten sogar Teile der ehemaligen UdSSR integriert. Mit dem neuen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Barack Obama scheint sich aktuell nun wieder eine gewisse Entspannung im Verhältnis zur Russischen Föderation anzudeuten. Florian Jordan zitiert dazu ausführlich u. a. Auszüge aus der viel beachteten Rede des amerikanischen Vizepräsidenten Joe Biden auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Zum Abschluss gibt der Redakteur von D&E einen Überblick über die Paradigmenwechsel in der US-amerikanischen Außenpolitik, die sich ablösenden Präsidenten und ihre Administrationen sowie der sie eventuell bewegenden innenpolitischen Zusammenhänge. Unter Berücksichtigung von unterschiedlichen Denkschulen in den USA sollen Schülerinnen und Schüler dadurch die Kompetenz erwerben, amerikanische Europapolitik jeweils kriteriengeleitet zu beurteilen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Wechsel vom Unilateralismus der George W. Bush-Administration hin zum erneuten Multilateralismus der Präsidentschaft Barack Obamas. Literaturhinweise Arnswald, Ulrich u. a. (2006): DDR-Geschichte im Unterricht. Schulbuchanalyse – Schülerbefragung – Modellcurriculum. Metropol Verlag. Berlin. Borries, Bodo von (2009): Zur Verarbeitung der DDR-(BRD-)Geschichte. in: Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinte Deutschland. 4/2009. S. 665–677 Abb. 3 »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben«(Michail Gorbatschow, 1989 in Ostberlin). Hier: Der polnische Ministerpräsident Wojciech Jaruzelski und der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow auf dem 10. Kongress der polnischen Arbeiterpartei am 29. Juni 1986. © picture alliance, dpa http://lehrerfortbildung-bw.de/lak/akademien/2009/30_escom_mauerfall/index.html (Baden-württembergischer Lehrer(-innen)-Fortbildungsserver mit ausführlicher Dokumentation zweier Tagungen zum Thema »Friedliche Revolution«, einschließlich einer Video- und Materialdokumentation) Behrens, Heidi, u. a. (Hrsg.) (2009): Lernfeld DDR-Geschichte. Ein Handbuch für die politische Jugend- und Erwachsenenbildung. Wochenschau-Verlag. Schwalbach/Ts. BpB (Hrsg.) (2009): »1989«. Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament. Nr. 21–22. Bonn. 5 Deutz-Schroeder, Monika / Schroeder, Klaus (2009): Oh, wie schön ist die DDR. Kommentare und Materialien zu den Ergebnissen einer Studie. Wochenschau-Verlag. Schwalbach/Ts. Hando, Saskia (2009): 1989 und wir. Geschichtsdidaktische Reflexionen. in: Geschichte für heute. Zeitschrift für historisch-politische Bildung. Nr. 2/2009, S. 5–26. Wochenschau-Verlag. Schwalbach/Ts. Landesinstitut für Schulentwicklung (Hrsg.) (2009): Zugänge zur DDR-Geschichte. Anregungen zu projektorientiertem Lernen. Autorin: Buske, Sibylle. Stuttgart. Neubert, Ehrhart (2008): Unsere Revolution. Die Geschichte der Jahre 1989/90. Piper. München. Rödder, Andreas (2009): Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte der Wiedervereinigung. C. H. Beck. München. Internetlinks http://stiftung-aufarbeitung.de/downloads/pdf/2007/Schuelerbefragung.pdf (Schülerbefragung von Arnswald u. a.) www.ddr-im-unterricht.de Ein Portal der LpB Baden-Württemberg zu 20 Jahren »Friedliche Revolution« www.politische-bildung.de/20_jahre-deutsche-einheit.html Das Informationsportal der Bundeszentrale sowie der Landeszentralen für politische Bildung zur »Friedlichen Revolution« www.stiftung-aufarbeitung.de/ (Informationsportal der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der DDR-Diktatur) Abb. 4 Chronik der friedlichen Revolutionen in Europa D&E Heft 58 · 2009 © picture alliance, dp 20 Jahre »Friedliche Re volutionen« – Chancen für ganz Europa II. 20 JAHRE MAUERÖFFNUNG IN DEUTSCHLAND 1. Die friedliche Revolution in der DDR und die Folgen ANDREAS GRIESSINGER N 6 och vor dem Jahresende 1989 fällte der Schriftsteller Martin Walser ein treffendes Urteil: »Die Deutschen in der DDR haben eine Revolution geschaffen, die in der Geschichte der Revolutionen wirklich neu ist: die sanfte Revolution.« – Die historische Singularität der »friedlichen Revolution« in der DDR, auf die Walser hier mit Recht hinweist, hat in den vergangenen 20 Jahren vielfältige, kontroverse Erklärungsversuche hervorgebracht. Obwohl im Jubiläumsjahr 2009 wieder zahlreiche Neuerscheinungen zum Thema zu verzeichnen sind, ist eine »Meistererzählung« noch immer nicht in Sicht. Eine stichhaltige historische Erklärung wird die Revolution von 1989 aus der Verknüpfung und Wechselwirkung vielfältiger Kausalreihen in unterschiedlichen politischen Handlungsfeldern verständlich machen müssen. Dabei sind strukturelle Bedingungsfaktoren ebenso zu berücksichtigen wie soziokulturelle Deutungen und personelle Leistungen bzw. Fehler, langfristige Wandlungsprozesse ebenso wie punktuelle, akute Krisenmomente. Ein moderner, kompetenzorientierter Unterricht muss Schülerinnen und Schüler befähigen, diese Vielzahl von Einflussfaktoren selbstständig ordnen und miteinander verknüpfen zu können. Die dazu nötige Begriffskompetenz wird durch kategoriales Lernen erworben, d. h. durch ein systematisches Training im Umgang mit gegenstandsbezogenen Fachbegriffen. Deshalb wird im Folgenden auf Albert O. Hirschmans Exit-Voice-Konzept zurückgegriffen. Um die notwendige Strukturierungskompetenz zu vermitteln, werden drei analytische Ebenen unterschieden und auf ihre Wechselwirkungen hin untersucht: die internationale, die europäische und die nationale Ebene. Übergeordnete Ebenen: Systemkonflikt und europäische Politik Auf der Ebene der internationalen Politik hatten sich die systemischen Rahmenbedingungen, die durch das bipolare Ordnungs- und Sicherheitsmodell der »mutually assured destruction« (MAD) definiert waren, bis in die 1980er-Jahre hinein zunehmend weiter stabilisiert. Im Rahmen dieses systemübergreifenden Konsenses zur Konfliktsteuerung und -begrenzung war es dem DDR-Regime über Jahrzehnte hin immer wieder gelungen, nicht nur die wiederkehrenden eigenen Krisen zu überwinden, sondern auch die der Nachbarländer, die stets auf das eigene Land überzugreifen drohten. Das gelang nicht zuletzt durch die »ultima ratio« der militärischen Intervention, so beim Volksaufstand 1953, dem Ungarn-Aufstand 1956, dem Prager Frühling 1968 und der Solidarnosc-Bewegung 1981. In den Jahren nach den Unruhen auf den Danziger Werften veränderten sich allerdings die internationalen Rahmenbedingungen grundlegend. Die Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion sowie Gorbatschows Reformpolitik brachten zusehends die Tektonik der internationalen Politik und mit ihr auch die Breschnew-Doktrin ins Wanken. Diese bildete aber die unverzichtbare Existenzgarantie für die DDR als einzigem Staat des Ostblocks, der – anders als etwa die sozialistischen Nationalstaaten Polen oder Ungarn – ausschließlich ideologisch legitimiert war und dem jegliche nationale Identität fehlte. Insofern geriet die DDR angesichts der Reformbewegungen innerhalb des Ostblocks seit den 1980er-Jahren unweigerlich in den Teufelskreis von Reformverweigerung und Selbstisolation. Dieser bildete auf der Ebene der internationalen Politik insofern eine wichtige Voraussetzung für Abb. 1 Die Ausreisebewegung aus der DDR wird seit Sommer 1989 als existenzielle Bedrohung für die DDR gesehen © Der SPIEGEL, 14.8.1989 das Gelingen der »friedlichen Revolution«, als es im Sommer und Herbst 1989 zu einer wachsenden Selbstblockade des SED-Machtapparats kam, der befürchtete, durch einen Militäreinsatz nach dem Muster der »chinesischen Lösung«, dem Tian’anmen-Massaker im Juni 1989, die internationale Entspannungspolitik zu gefährden. Auf der zweiten Ebene, der Ebene der europäischen Politik, ist die »friedliche Revolution« Teil der gesamteuropäischen Protestbewegung der 1980er-Jahre, bei der zivilgesellschaftliche Oppositionsgruppen in West und Ost durch gewaltfreie Aktionen gegen Aufrüstung und um mehr politische Partizipation sowie die Sicherung ihrer Lebens- und Bürgerrechte kämpften. Dazu gehörten Friedens-, Frauen- und Ökologiebewegungen genauso wie Bürgerinitiativen und Dissidentengruppen von Moskau bis Prag. Das war eine wesentliche Ursache dafür, dass die Revolutionen in den meisten Staaten des Ostblocks ohne gewaltsame Gegenmaßnahmen der Regierungen abliefen, z. B. die »samtene Revolution« in der CSSR, die in der Slowakei als »sanfte Revolution« bezeichnet wurde. Bezeichnenderweise beginnt damit 1989 eine metaphorische Begriffskontinuität, die sich bis zur »Rosenrevolution« 2003 in Georgien fortsetzt. Die Ebene der Akteure: »exit« und »voice« Zur Beschreibung der dritten Ebene, der Ebene der revolutionären Akteure in der DDR selbst, soll auf das Begriffspaar von »exit« und »voice« zurückgegriffen werden. Diese begriffliche Unterscheidung wurde von dem amerikanischen Ökonomen Albert O. Hirschman entwickelt, um zwei idealtypische Handlungsmuster zu beschreiben, mit denen Menschen auf institutionelle Desintegrationsprozesse reagieren: Abwanderung (»exit«) und Widerspruch (»voice«). Nach Hirschman beruht »exit« auf der privaten, individuellen Aufkündigung von Loyalität, »voice« dagegen auf der öffentlichen, kollektiven Gehorsamsverweigerung. Im Folgenden möchte ich zeigen, dass sich mit Hilfe des Exit-Voice-Konzepts der Wirkungsmechanismus erhellen lässt, der das Ende der DDR herbeigeführt hat. Zu diesem Zweck wird das Konzept auf die beiden entscheidenden sozialen Bewegungen übertragen, die in der DDR seit den 1980er-Jahren zunächst getrennt voneinander agierten, sich im Verlauf der Eskalation aber zusehends wechselseitig verstärkten (was Hirschmans Annahmen übrigens nicht entspricht). Die friedliche Re volution in der DDR und die Folgen D&E Heft 58 · 2009 Erste Impulse für diesen Prozess gab seit dem Beginn der 1980erJahre die Ausreisebewegung (»exit«), die mit ihrer Parole »Wir wollen raus!« das SED-Regime zusehends verunsicherte und in eine wachsende Legitimationskrise stürzte. Kreative symbolisch-demonstrative Akte der Ausreisewilligen bewegten sich auf dem schmalen Grat zwischen legitimer Interessenartikulation und politischer Dissidenz, wenn etwa seit Mitte der 1980er-Jahre in der Öffentlichkeit weiße Tücher als Erkennungszeichen getragen oder demonstrativ Finger in die Höhe gestreckt wurden – jeder Finger für einen abgelehnten Ausreiseantrag. Trotz Schikanen und Diskriminierungen wuchs ihre Zahl von 21.500 Anträgen im Jahr 1980 auf 125.000 im Jahr 1989. Diese anschwellende Massenbewegung führte zu halbherzigen Konzessionen der SED: 1984 wurde erstmals 30.000 Antragstellern die Übersiedlung genehmigt, obwohl ihre Anträge als rechtswidrig eingestuft worden waren. Die Hoffnung des Regimes auf eine Ventilfunktion trog allerdings: Das Zurückweichen der SED ermutigte im Gegenteil weitere DDR-Bürger, Ausreiseanträge zu stellen, sodass die Zahlen in den folgenden Jahren annähernd stabil blieben. So mussten 1988 erneut mehr als 25.000 Genehmigungen erteilt werden. Außerdem bildeten sich unter Berufung auf den KSZE-Prozess zusehends mehr Selbsthilfegruppen; ab 1983 gab es erste öffentliche Demonstrationen Ausreisewilliger sowie Versuche, über Botschaften die Ausreise zu erwirken. Dieser schnell wachsenden Massenbewegung, die immer stärker ins öffentliche Bewusstsein trat, stand eine zunächst kleine, aber vor allem medial wirkungsmächtige Minderheit oppositioneller Menschen- und Bürgerrechtsgruppen gegenüber. Sie setzten dem Ruf der Ausreisewilligen »Wir wollen raus!« ihre Parole »Wir bleiben hier!« entgegen und artikulierten damit ihren Glauben an die politische Transformierbarkeit des DDR-Staates durch organisierten, kollektiven Protest (»voice«), häufig in der Perspektive eines »demokratischen Sozialismus mit menschlichem Antlitz«. Sie formierten sich vor allem im Schutz der Kirchen und wuchsen zusehends, wenn auch bei weitem nicht so rasch wie die Ausreisebewegung. Ihrem eigenen Selbstverständnis nach definierten sie sich als Teil der gesamteuropäischen Friedens- und Protestbewegung, die sich gegen das neue Wettrüsten im Zeichen des »second cold war« seit den späten 1970er-Jahren wandte. Schon 1981 trugen 100.000 DDRJugendliche den von dem Jugendpfarrer Harald Brettschneider entworfenen Aufnäher »Schwerter zu Pflugscharen«. Andererseits wuchs auch die Ökologie-Bewegung in der DDR, insbesondere nach der Reaktorkatastrophe im ukrainischen Tschernobyl. Dort war 1986 nach einer Explosion im Kernkraftwerk radioaktives Material ausgetreten und über Tausende von Kilometern verbreitet worden. Obwohl Experten ca. 250.000 Opfer schätzten, reagierte die SED mit einer gezielten Desinformationspolitik und provozierte damit Proteste. Die Friedens-, Ökologie- und Menschenrechtsgruppen agierten allerdings – isoliert und ständig von StasiSchikanen bedroht – eher an der Peripherie der DDR-Gesellschaft, zumal sie, abgesehen von einigen westlichen »GRÜNEN«-Politikern, aus der Bundesrepublik kaum unterstützt wurden. Dennoch gelang es ihnen seit Ende 1987 zusehends, die Aufmerksamkeit auch der internationalen Öffentlichkeit zu erregen: zum ersten Mal im November 1987, als Stasi-Beamte eine Razzia in Räumen der Ost-Berliner Zionskirche durchführten, in deren Umweltbibliothek Bürgerrechtsgruppen Diskussionen veranstaltet und Publikationen gedruckt hatten. Aus Protest gegen die Verhaftungen wurden in der Leipziger Nicolaikirche daraufhin an jedem Montag Fürbittgottesdienste mit Mahnwachen durchgeführt. Gefordert wurde die Freilassung der Inhaftierten, unter denen sich auch Martin Hoffmann befand, der Schwiegersohn der Schriftstellerin Christa Wolf – was das Interesse der internationalen Medien weckte. Ähnliche Gottesdienste wurden in der Folge auch in anderen Kirchen der DDR abgehalten. Zuerst folgten die Zionskirche und die Gethsemanekirche in Ost-Berlin dem Leipziger Beispiel, wodurch sich die Protestbewegung über das kirchliche Kommunikationsnetz ausbreitete. Zu weiteren Festnahmen kam es im Januar 1988 bei einer vor allem von Ausreisewilligen getragenen Aktion anlässlich der par- D&E Heft 58 · 2009 Abb. 2 Auch am Tag nach der Maueröffnung vom 9. November 1989 nehmen Ost- und Westberliner Besitz von der Mauer, die die Stadt 28 Jahre teilte. © picture alliance, dpa teioffiziellen Kundgebung zum Todestag Rosa Luxemburgs in Ost-Berlin. Im Demonstrationszug tauchten Transparente auf mit dem berühmten Satz der Kommunistin und Lenin-Kritikerin, die 1919 die KPD gegründet hatte: »Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden.« Wieder waren unter den Verhafteten Prominente, z. B. Freya Klier, Wolfgang Templin und Stephan Krawczyk, was die Aktion erneut zu einem Medien-Ereignis machte, zumal westliche Fernsehteams von Stasi-Beamten behindert wurden. Die Zahl der Gedenkgottesdienste, Mahnwachen und Schweigemärsche wuchs weiter an, zunächst in Leipzig, dann auch in Dresden, Ost-Berlin und anderen Städten. 7 Das Jahr 1989: Die unvollendete Dialektik von »exit« und »voice« Zu einer weiteren Station auf dem Erfolgsweg der Protestbewegung wurden die DDR-Kommunalwahlen im Mai 1989. Aktivisten der Bürgerrechtsgruppen hatten sich an den Auszählungen beteiligt und die festgestellten Unregelmäßigkeiten publik gemacht. Bei den folgenden Protestdemonstrationen gegen den Wahlbetrug wurden Hunderte von Menschen festgenommen. In diesem Monat gewann auch die Ausreisebewegung wieder das Interesse der Öffentlichkeit, sodass die Aktivitäten der beiden Bewegungen »exit« und »voice« seit Mai 1989 zusehends synchron verliefen und sich wechselseitig verstärkten, ohne allerdings zu einer einheitlichen Bewegung zusammenzuwachsen. Ursache für das wiedererwachte Interesse an den Ausreisewilligen waren politische Veränderungen auf der internationalen und europäischen Ebene gleichzeitig. In Ungarn, der »fröhlichsten Baracke des Sozialismus«, hatte die regierende »Sozialistische Arbeiterpartei Ungarns« sich seit Mitte der 1980er-Jahre Gorbatschows Reformkurs angeschlossen, ganz im Gegensatz zur SED. Und Anfang 1989 steigerte sie das Liberalisierungstempo entschieden weiter. Sie bettete Imre Nagy, den reformkommunistischen Führer des Ungarn-Aufstands von 1956, feierlich in ein Ehrengrab um, führte ein Mehrparteiensystem ein und hob den Schießbefehl an den ungarischen Grenzen auf. Im Mai wurde dann mit dem Abbau der Grenzbefestigungen begonnen, was prompt zur »Republikflucht« von DDR-Bürgern, die in Ungarn Urlaub gemacht hatten, über das benachbarte Österreich in die Bundesrepublik führte. Am 27. Juni 1989 durchschnitten die Außenminister Ungarns und Österreichs in einer inszenierten Medien-Aktion den Stacheldraht zwischen ihren beiden Ländern und besiegelten damit demonstrativ das Ende der Teilung Europas. Damit war das Ende des Eisernen Vorhangs und zugleich auch das Die friedliche Re volution in der DDR und die Folgen ANDREAS GRIESSINGER drücklich auf, die Politik der Reformverweigerung zu beenden. Außerdem störten Demonstranten die Feier mit den Rufen »Gorbi, Gorbi« und »Wir sind das Volk«. Diese unerwartete Wendung war für die SED-Spitze ein so schwerer Misserfolg, dass sie sich zum Handeln gezwungen sah: Honecker wurde wenige Tage später unter Stasi-Beteiligung gestürzt und durch Egon Krenz ersetzt. Dieses »Wendehals«-Manöver war aber zu durchsichtig angelegt, als dass es zur Befriedung hätte beitragen können: Sowohl die Flucht- als auch die Bürgerrechtsbewegung schwollen mit Parolen wie »Demokratie unbe-krenzt« oder »Sozialismus krenzenlos« weiter bedrohlich an und mündeten Anfang November in bislang ungekannte Massendemonstrationen in Leipzig und Ost-Berlin, wo jeweils eine halbe Million Menschen auf den Straßen waren. Auch der folgende Rücktritt von Ministerrat und Politbüro kam zu spät und wirkte nicht mehr deeskalierend, sodass der Massenexodus in den ersten Novembertagen Rekordzahlen erreichte: am 8. November 500 Ausreisende pro Stunde. So kapitulierte die SED schließlich und verkündete am 9. November 1989 die Öffnung der Berliner Mauer. Die strukturelle Ebene: Ökonomie und Politik Abb. 3 »Unsere Brigade hat beschlossen, die Wartezeiten künftig sinnvoll zu © Rainer Schwalme, www.hdg.de nutzen!« Karikatur aus der DDR 1986 8 Ende der DDR eingeläutet, denn innerhalb weniger Wochen flüchteten Tausende DDR-Bürger über Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik. Trotz wachsender Konflikte im Politbüro um den richtigen Kurs hielt die SED an ihrem starren Kurs der Reformverweigerung fest, indem sie die gefälschten Kommunalwahlergebnisse offiziell bestätigte und demonstrativ die chinesische Regierung unterstützte, die im Juni 1989 regimekritische Studentendemonstrationen in Peking blutig hatte niederschlagen lassen. Das Signal an die DDR-Opposition war unmissverständlich, aber es blieb ohne Wirkung. So geriet die SED auch innenpolitisch in die Isolation und verlor ihre letzte Autorität. Vor diesem Hintergrund schnellten die Ausreiseanträge allein im Sommer 1989 hoch auf 120.000; andere DDR-Bürger verloren die Geduld und suchten eigenmächtig Zuflucht in den bundesrepublikanischen Botschaften in Ost-Berlin, Prag und Warschau. Als die »Botschaftsflüchtlinge« durch Vermittlung von Außenminister Genscher im September die Ausreisegenehmigung erhalten hatten, füllten sich die Botschaften binnen weniger Tage erneut mit Ausreisewilligen. Als auch diese in Sonderzügen ausreisen durften, kam es am Dresdner Hauptbahnhof zu gewalttätigen Konflikten zwischen Ordnungskräften und Demonstranten. Eine revolutionäre Stimmung verbreitete sich und eskalierte mit dem Beginn der allwöchentlichen »Montagsdemonstrationen« am 2. Oktober in Leipzig, bei denen – zunächst von Tausenden, später von Zehntausenden, dann von Hunderttausenden – Reiseund Versammlungsfreiheit sowie weitere innere Reformen gefordert wurden. Dem Ruf der Ausreisewilligen »Wir wollen raus!« entgegnete zum wiederholten Mal der trotzige Gegenruf der Reformwilligen: »Wir bleiben hier!« Ermutigt durch die Massenproteste kam es bald zur Gründung politischer Parteien und Organisationen wie der »Sozialdemokratischen Partei in der DDR«, dem »Demokratischen Aufbruch« und dem »Neuen Forum«. Mit dem Entstehen dieser organisierten politischen Opposition hatte die mittlerweile völlig isolierte SED ihr Macht- und Meinungsmonopol endgültig verloren, was den begonnenen revolutionären Prozess weiter beschleunigte. Entgegen den Hoffnungen der SED-Führung konnte dieser Prozess auch durch die Feierlichkeiten zum 40. Gründungstag der DDR im Oktober 1989 nicht gebremst werden – im Gegenteil: Gorbatschow forderte Honecker bei seinem Staatsbesuch nach- Protest- und Ausreisebewegung hatten das SED-Regime zu Fall gebracht, obwohl beide von einer eklatanten Fehleinschätzung der wirtschaftlichen und politischen Lage in der DDR ausgingen. Denn wer 1989 das Land verließ oder für politisch transformierbar hielt, glaubte an die Stabilität und das Fortbestehen des Staates sowie an die Funktionsfähigkeit seiner Wirtschaft. Gerade das war falsch, trug aber paradoxer Weise entscheidend zum Zusammenbruch der DDR bei. Die von Erich Honecker seit seinem Amtsantritt 1971 angestrebte »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik« konnte nämlich spätestens zu Beginn der 1980er-Jahre als endgültig gescheitert betrachtet werden. Die kostspieligen sozialpolitischen Leistungen und die 1977 begonnene, aber schnell gescheiterte mikroelektronische Offensive erzwangen reduzierte Investitionen im industriellen Sektor und schufen so neue Versorgungsengpässe im Konsumbereich. Der weitere Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise auf den Weltmärkten seit der zweiten Ölkrise von 1979 verringerte zusätzlich die Produktivität der ohnehin längst veralteten Industrieanlagen in der DDR: Schon 1983 erreichten sie nur noch 47 % der bundesrepublikanischen Arbeitsproduktivität. Angesichts der schon seit Mitte der 1970er-Jahre wachsenden Unzufriedenheit in breiten Bevölkerungsschichten hielt Honecker andererseits den volkswirtschaftlich gebotenen Subventionsabbau bei Grundnahrungsmitteln, Mieten und Sozialleistungen aus Gründen des Machterhalts für unvertretbar – zumal seit 1980 in Polen Streiks an der Tagesordnung waren und die SED ähnliche Unruhen in der DDR befürchtete. Der Versuch, stattdessen Investitionen durch westliche Kredite zu finanzieren, ließ – ohne dass die erwünschten Impulse eingetreten wären – lediglich die Staatsverschuldung weiter ansteigen: 1981 lagen die Verbindlichkeiten der DDR gegenüber westlichen Banken bei 24,2 Milliarden DM, was zur Folge hatte, dass die DDR zur Devisenbeschaffung zunehmend hochwertige Produkte in den Westen exportieren musste, die deshalb für die Versorgung der ohnehin Mangel leidenden eigenen Bevölkerung nicht zur Verfügung standen. Die Schwierigkeiten verschärften sich zusätzlich durch die ökonomische Krise in den »sozialistischen Bruderstaaten«: Der von dem US-Präsidenten Ronald Reagan ausgelöste neue Rüstungswettlauf schwächte die Sowjetunion so stark, dass sie Anfang der 1980erJahre ihre Erdöllieferungen in die DDR drastisch reduzieren musste. Als 1982 Polen und Rumänien ihre Zahlungsunfähigkeit gegenüber der DDR erklärten, war nach ökonomischen Rentabilitätsberechnungen auch die DDR am Ende. Ihr wirtschaftlicher Offenbarungseid, ähnlich dem des französischen Staates im Jahr 1789, konnte nur durch zwei Großkredite in Höhe von knapp zwei Milliarden DM verhindert werden, die der CSU-Vorsitzende Franz Die friedliche Re volution in der DDR und die Folgen D&E Heft 58 · 2009 Josef Strauß 1983/84 vermittelte und für die die Bundesregierung bürgte. Die DDR erhielt nun aufgrund der Signalfunktion, die von dem spektakulären Finanztransfer ausging, wieder internationale Devisenkredite, die sie nochmals für einige Jahre vor der Illiquidität bewahrten. Den Milliardenkrediten der Bundesregierung kommt damit – rückblickend betrachtet – die Wirkung zu, den Zusammenbruch der DDR in eine Zeit mit weltpolitisch günstigerem Klima verschoben und damit den Weg von der »friedlichen Revolution« zur deutschen Einigung geebnet zu haben. Folgen der »friedlichen Revolution« Was waren nun die wichtigsten Folgen dieser »friedlichen Revolution«? Auch hier sind wieder verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Beginnen wir auf der nationalen Ebene. Mit der deutschen Einigung endeten die »Sonderwege«, die die beiden deutschen Staaten in der Epoche von Teilung und Ost-West-Konflikt gegangen waren. Die Bundesrepublik war seit der Ära Adenauer eine »postnationale Demokratie unter Nationalstaaten« (Karl Dietrich Bracher) gewesen. Weil sie kein Nationalstaat war, konnte sie die supranationale Integration Westeuropas besonders engagiert vorantreiben. Dem postnationalen Sonderweg der BRD stand spiegelbildlich der internationalistische Sonderweg der DDR gegenüber, der als repressive Staatsdoktrin bei den Bürgern aber weder Legitimation noch Loyalität schaffen konnte. Mit der Gründung des neuen, »postklassischen Nationalstaats« (Heinrich August Winkler) am 3. Oktober 1990 sind beide Sonderwege an ihr Ende gelangt. Die »Berliner Republik« als neuer Typus eines Nationalstaats steht erkennbar in Kontinuität zum postnationalen Typus, da sie auf einige Elemente staatlicher Souveränität im »Zwei-plus-Vier-Vertrag« bewusst verzichtet hat, z. B. auf den Besitz atomarer, biologischer und chemischer Waffen. Zudem willigte sie in eine Beschränkung ihrer Streitkräfte auf 370.000 Soldaten ein und ist fest in supranationale Zusammenschlüsse wie die UNO, die Europäische Union und die NATO eingebunden. Damit sind wir wieder auf der internationalen und der europäischen Ebene angelangt, und damit schließt sich nun der Kreis. Aus internationaler Perspektive betrachtet, endete 1989 mit der »friedlichen Revolution« der Systemkonflikt des Kalten Kriegs. Die bipolare Weltordnung löste sich auf und mit ihr der diktatorische Staatssozialismus, der sich mit der Oktoberrevolution 1917 etabliert und nach 1945 in Osteuropa ausgebreitet hatte. Die Wende in Deutschland war Teil dieses welthistorischen Umbruchs, von ihm sehr viel stärker bedingt als ihn ihrerseits bedingend. Das geeinte Deutschland ist damit aus seiner Randlage im Ost-West-Konflikt in das Zentrum eines sich vereinigenden Europa gerückt. Es wird aufgrund seines gewachsenen politischen und wirtschaftlichen Gewichts zunehmend zur Übernahme von größerer Verantwortung auch in der Weltpolitik gedrängt. Dabei kann Deutschland als europäische Großmacht mit weltpolitischem Gewicht zurückgreifen auf reiche Erfahrungen aus der Zeit der Teilung. Keine zweite Regierung eines vergleichbaren Landes hat unter den Bedingungen des Kalten Krieges eine ähnliche Fähigkeit entwickeln müssen, die Grenzen der eigenen Handlungsfähigkeit anzuerkennen. Die in dieser Zeit gemachten Erfahrungen sind wichtiger denn je in einer immer dichter vernetzten, dem Globalisierungssog ausgesetzten Welt, in der kein Land künftig wird autonom und souverän Außenpolitik betreiben können. Das erklärt die Schlüsselrolle, die Deutschland im europäischen Einigungsprozess spielt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist in diesem Prozess der deutsche Nationalstaat unwiderruflich an den Westen gebunden, nachdem die Deutschen sich nicht gegen ihre Nachbarn, sondern mit deren Zustimmung 1989/90 zu einer »Einheit in Freiheit« zusammengeschlossen haben – und zwar nicht durch einen Krieg wie 1871, sondern aus der »Kraft der Selbstbefreiung« (Hartmut Zwahr), die der eigentliche Motor der »friedlichen Revolution« von 1989 gewesen ist. D&E Heft 58 · 2009 Abb. 4 Titelblatt der nicht genehmigten Zeitschrift der Bürgerbewegung »Arche – grün-ökologisches Netzwerk in der evangelischen Kirche«, 1.7.1988 © Stiftung Haus der Geschichte, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig Literaturhinweise Behrens, Heidi/ Ciupke, Paul/ Reichling, Norbert (Hrsg.)(2009): Lernfeld DDR-Geschichte. Schwalbach/Ts. (Wochenschau-Verlag). Buske, Sybille (2009): Zugänge zur DDR-Geschichte. Anregungen zu projektorientiertem Lernen. Stuttgart (Landesinstitut für Schulentwicklung BadenWürttemberg). Hirschman, Albert O.(1992): Abwanderung, Widerspruch und das Schicksal der Deutschen Demokratischen Republik, in: Leviathan 20 (1992), Heft 3, S. 330–358. Pollack, Detlef (2000): Politischer Protest. Politisch alternative Gruppen in der DDR. Opladen (Leske & Budrich). Rödder, Andreas (2009): Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte der Wiedervereinigung. München (Beck). Wehler, Hans-Ulrich (2008): Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Band 5. München (Beck). Winkler, Heinrich August (2000): Der lange Weg nach Westen. Band 2. München (Beck). Zwahr, Hartmut (1993): Ende einer Selbstzerstörung. Leipzig und die Revolution in der DDR. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht). Internetlinks www.ddr-im-unterricht.de (Portal der LpB Ba-Wü zur DDR-Geschichte, u. a. mit zahlreichen Links zu Unterrichtsmaterialien) www.hdg.de (Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland) www.stiftung-aufarbeitung.de (Bundesstiftung der Bunderepublik Deutschland zur Aufarbeitung der SED-Diktatur) www.ddr-geschichte.de (privat betriebene Website zur DDR-Geschichte) www.revolution1989.de (Website der Robert-Havemann-Gesellschaft e. V. zur friedlichen DDR-Revolution) www.jugendopposition.de (Website der Robert-Havemann-Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung) www.deinegeschichte.de (interaktive Website zur deutsch-deutschen Geschichte der Kooperative Berlin, gefördert durch: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und die Robert Bosch Stiftung) Die friedliche Re volution in der DDR und die Folgen 9 ANDREAS GRIESSINGER MATERIALIEN M 1 Rede des ZK-Sekretärs und Politbüromitglieds Joachim Herrmann vor dem ZK der SED am 22./23.6.1989 zum Massaker am Platz des Himmlischen Friedens in Peking am 4.6.1989, bei dem ca. 3000 bis 5000 Demonstranten der Demokratiebewegung von Soldaten getötet wurden: Was die jüngsten Ereignisse in der Volksrepublik China betrifft, so hat die DDR zur objektiven Information und zur Zurückweisung westlicher Horrormeldungen alle entsprechenden Verlautbarungen und Erklärungen der Partei- und Staatsführung der Volksrepublik China veröffentlicht. Die friedlichen Demonstrationen der Studenten in Peking sollten zu einem konterrevolutionären Umsturz der Volksmacht in China ausgenutzt werden. Die Volkskammer der DDR unterstrich in einer von der Fraktion der SED eingebrachten Erklärung, dass die von der chinesischen Partei- und Staatsführung beharrlich angestrebte politische Lösung innerer Probleme infolge der gewaltsamen, blutigen Ausschreitungen verfassungsfeindlicher Elemente verhindert wurde und sich deshalb die Volksmacht gezwungen sah, Ordnung und Sicherheit unter Einsatz bewaffneter Kräfte wiederherzustellen. zit. nach Volker Gransow/Konrad H. Jarausch (1991): Die deutsche Vereinigung. Dokumente zu Bürgerbewegung, Annäherung und Beitritt. Köln (Verlag Wissenschaft und Politik) S. 56 M 2 »Die Tonkrieger«, Gedicht von Volker Braun (1989) Aus den Bunkern unter dem Platz des Himmlischen Friedens fahren die Panzerwagen in die Menge. Uralte Übung der uralten Partei. zit. nach: Gransow/Jarausch, S. 85 10 M 3 Günter Lutz, Kommandeur einer Betriebskampfgruppe, schreibt am 6.10.1989 in einem »Leserbrief« an die »Leipziger Volkszeitung« anlässlich der wachsenden Leipziger Montagsdemonstrationen Werktätige des Bezirks fordern: Staatsfeindlichkeit nicht länger dulden. Die Angehörigen der Kampfgruppenhundertschaft »Hans Geiffert« verurteilen, was gewissenlose Elemente seit einiger Zeit in der Stadt Leipzig veranstalten. Wir sind dafür, dass die Bürger christlichen Glaubens in der Nikolaikirche ihre Andacht und ihr Gebet verrichten. Das garantiert ihnen unsere Verfassung und die Staatsmacht unserer sozialistischen DDR. Wir sind dagegen, dass diese kirchliche Veranstaltung missbraucht wird, um staatsfeindliche Provokationen gegen die DDR durchzuführen. Wir fühlen uns belästigt, wenn wir nach getaner Arbeit mit diesen Dingen konfrontiert werden. Deshalb erwarten wir, dass alles getan wird, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten, um die in 40 Jahren harter Arbeit geschaffenen Werte und Errungenschaften des Sozialismus in der DDR zu schützen, und dass unser Aufbauwerk zielstrebig und planmäßig zum Wohle aller Bürger fortgesetzt wird. Wir sind bereit und willens, das von uns mit unserer Hände Arbeit Geschaffene wirksam zu schützen, um diese konterrevolutionären Aktionen endgültig und wirksam zu unterbinden. Wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand! zit. nach: Gransow/Jarausch, S. 74 M 4 Chinesische Lösung auch in der DDR? Tausende Chinesen demonstrieren in Hongkong 10 Jahre nach der blutigen Niederschlagung der Studentendemonstrationen durch chinesisches Militär auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking gegen die damalige Aktion der chinesischen Staats führung © picture alliance, dpa M 5 Rede Erich Honeckers zum 40. Jahrestag der DDR am 6.10.1989 Die Deutsche Demokratische Republik hat ihren Weg mit Ergebnissen zurückgelegt, die unser Volk im Wissen um seine Kraft, um den Wert aller Mühen beim Aufbau eines neuen, eines menschenwürdigen, eines sinnerfüllten Lebens bestärken. Sozialismus und Frieden sind und bleiben die Schlüsselworte für das bisher Vollbrachte wie für das, was künftig zu leisten sein wird. Wir gehen es mit Tatkraft und Zuversicht an. Auch im fünften Jahrzehnt wird der sozialistische Staat der Arbeiter und Bauern auf deutschem Boden durch sein Handeln zum Wohle des Volkes, durch seinen Beitrag zu Frieden, Sicherheit und internationaler Zusammenarbeit ständig neu beweisen, dass seine Gründung im Oktober 1949 ein Wendepunkt war – in der Geschichte des deutschen Volkes und Europas. zit. nach: Gransow/Jarausch, S. 71 M 6 Interview mit US-Präsident George Bush sen. in der New York Times am 24.10.1989 NYT: Können Sie irgendwelche Veränderungen im Status von Deutschland voraussehen? Bush: Ja. Ich teile die Sorge mancher europäischer Länder über ein wiedervereinigtes Deutschland nicht, weil ich glaube, dass Deutschlands Bindung an und Verständnis für die Wichtigkeit des [atlantischen] Bündnisses unerschütterlich ist. Und ich sehe nicht, was einige befürchten, dass Deutschland, um die Wiedervereinigung zu erlangen, einen neutralistischen Weg einschlägt, der es in Widerspruch oder potenziellen Widerspruch zu seinen NATO-Partnern bringt. […] Und wer weiß, wie sich Herr Krenz entwickeln wird? Wird er nur eine Verlängerung des Honeckerschen Standpunkts oder etwas anderes sein? Ich glaube nicht, dass er dem Wandel völlig widerstehen kann. NYT: Wie schätzen Sie all diese Dinge vorläufig ein? Bush: […] Er kann die Uhr nicht zurückdrehen. […] Der Umschwung ist zu unaufhaltbar. zit. nach: Gransow/Jarausch, S. 81 Die friedliche Re volution in der DDR und die Folgen D&E Heft 58 · 2009 M 7 Mauermaler Karikatur aus der DDR, 1982 © Rainer Schade M 8 »Tapetenwechsel«, Gedicht von Volker Braun zur »Wende« (1989) Die Verwaltung hat mir erklärt, sie habe den Umbau längst in aller Stille vollzogen, aber das Haus ist nicht geräumiger, die Treppe unbequem. Und sind die Zimmerchen heller? Und warum ziehen die Leute aus und nicht ein? M 10 Ein neuer roter Stern, Karikatur aus der DDR-Satirzeitschrift »Eulenspiegel« 1988 © Barabara Henninger 11 zit. nach: Gransow/Jarausch, S. 84 M 11 M 9 Egon Krenz, der Nachfolger Erich Honeckers als SED Parteichef, verkündet nach einem Gespräch mit Gorbatschow in Moskau bei einer Pressekonferenz am 1.11.1989 die »Wende«: Auf entsprechende Fragen von Journalisten äußert Krenz u. a., sein unlängst mit BRD-Kanzler Kohl geführtes Telefongespräch habe in ihm den Eindruck hinterlassen, man sei sich einig, dass die Tatsache zweier deutscher Staaten genutzt werden solle, um miteinander auszukommen. Auf die Frage, ob mit der nun zugesagten Reisefreiheit für DDR-Bürger auch die Mauer abgetragen werde, sagte Krenz, solche Gründe, die zur Errichtung der Mauer führten, bestünden weiter. Man müsse reale Schritte tun und keinen Träumen nachhängen. Auch die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands stehe nicht auf der Tagesordnung. Zum Einmarsch der Truppen des Warschauer Vertrags 1968 in die CSSR sagte er, er habe nichts zu revidieren und diesen Beschluss nicht zu bedauern. Zum Führungsanspruch der SED erklärt Krenz, er werde alles dafür tun, damit dieses in der Verfassung verankerte Prinzip realisiert werde. Zur Wende in der DDR äußerte er, die Entscheidung für die Wende sei nicht von heute auf morgen getroffen worden, sie sei Ergebnis einer kollektiven Diskussion innerhalb der Partei, die die Kraft besitze, diese Wende selbst herbeizuführen zit nach: Gransow/Jarausch, S. 85 Die Schriftstellerin Christa Wolf bei einer Großdemonstration auf dem Berliner Alexanderplatz mit ca. 1 Million Teilnehmern am 4.11.1989 zum Begriff der »Wende« Mit dem Wort »Wende« habe ich meine Schwierigkeiten. Ich sehe da ein Segelboot, der Kapitän ruft: Klar zur Wende, weil der Wind sich gedreht hat oder ihm ins Gesicht bläst. (Applaus) Und die Mannschaft duckt sich, wenn der Segelbaum über das Boot fegt. Aber stimmt dieses Bild noch? Stimmt es noch in dieser täglich vorwärts treibenden Lage? Ich würde von revolutionärer Erneuerung sprechen. (Applaus) Revolutionen gehen von unten aus. Unten und oben wechseln ihre Plätze in dem Wertesystem. Und dieser Wechsel stellt die sozialistische Gesellschaft vom Kopf auf die Füße. […] Verblüfft beobachten wir, dass die Wendigen, im Volksmund »Wendehälse« genannt (Klatschen), die laut Lexikon sich rasch und leicht einer gegebenen neuen Situation anpassen, sich in ihr mit Geschick bewegen, sie zu nutzen verstehen. Sie am meisten – glaube ich – blockieren die Glaubwürdigkeit der neuen Politik. (Applaus) […] Ja, die Sprache springt aus dem Ämter- und Zeitungsdeutsch heraus, in das sie eingewickelt war, und erinnert sich ihrer Gefühlswörter. Eines davon ist: Traum. Also träumen wir mit hellwacher Vernunft: Stell dir vor, es ist Sozialismus und keiner geht weg! (Starker Applaus) Wir sehen aber die Bilder der immer noch Weg-Gehenden und fragen uns: Was tun? Und hören als Echo die Antwort: Was tun! Das fängt jetzt an […]. Unglaubliche Wandlung. Das Staatsvolk der DDR geht auf die Straße, um sich als Volk zu erkennen. Und dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen – der tausendfache Ruf: Wir sind das Volk! (Starker Applaus) zit. nach: Gransow/Jarausch, S. 87f. D&E Heft 58 · 2009 Die friedliche Re volution in der DDR und die Folgen ANDREAS GRIESSINGER M 12 »Voice« -Ansatz: Mitglieder der Umweltbibliothek der Ost-Berliner M 14 Der Oberlandeskirchenrat in Sachsen Harald Brettschneider zeigt im Jahr Zionskirche, fotografiert nach ihrer Verhaftung durch die Stasi am 25.11.1987. © Robert-Havemann-Gesellschaft, www.jugendopposition.de M 13 12 2000 das von ihm als Landesjugendpfarrer 1980 ins Leben gerufene Symbol der DDR-Friedensbewegung: Schwerter zu Pflugscharen. Am 4. Dezember 1959 schenkte die Sowjetunion der UNO eine Bronzeskulptur von Jewgeni Wutschetitsch, die das biblische Motiv bildlich-plastisch darstellt und die dem DDR-Symbol als Vorlage diente. © picture alliance, dpa, 2000 Albert O. Hirschman: »exit« und »voice« (1974) Der Gedankengang, der nun entwickelt werden soll, geht von der Firma aus, die verkäufliche Erzeugnisse für Kunden produziert; wie man jedoch feststellen wird, ist er weitgehend – und manchmal sogar hauptsächlich – auch auf Organisationen (wie etwa Vereine, Gewerkschaften oder politische Parteien) anwendbar, die ihren Mitgliedern ohne direkte Geldforderung Dienstleistungen bieten. Wir nehmen an, dass die Leistung eines Unternehmens oder einer Organisation sich aus nicht näher be-zeichneten, zufallsbedingten Ursachen verschlechtert […]. Die Unternehmensleitung erfährt dann von ihrem Versagen auf einem von zwei möglichen Wegen: 1. Eine Anzahl von Kunden hört auf, die Erzeugnisse der Firma zu kaufen bzw. eine Anzahl von Mitgliedern tritt aus der Organisation aus, dieses ist die Reaktionsweise Abwanderung (»exit«). Daraufhin gehen die Einkünfte zurück, die Mitgliederzahl sinkt, und die Unternehmensleitung wird dadurch veranlasst, nach Mitteln und Wegen zur Korrektur der Fehler zu suchen, die zur Abwanderung geführt haben. 2. Die Kunden der Firma bzw. die Mitglieder der Organisation geben ihre Unzufriedenheit kund, und zwar entweder auf direktem Wege durch Beschwerden bei der Unternehmensbzw. Organisationsleitung oder einer anderen Stelle, der diese untersteht, oder aber auf dem Wege eines allgemeinen Protestes, der an jeden gerichtet ist, der gewillt ist zuzuhören: dies ist die Reaktionsweise Widerspruch (»voice«). Daraufhin beginnt die Leitung wieder nach den Ursachen sowie den möglichen Abhilfen für die Unzufriedenheit der Kunden bzw. Mitglieder zu suchen. […] Wie bereits mehrfach festgestellt wurde, kann das Vorhandensein der Abwanderung als Reaktionsmöglichkeit die Wahrscheinlichkeit eines umfangreichen und wirksamen Einsatzes der Reaktionsweise Widerspruch stark verringern. Es wurde mit anderen Worten nachgewiesen, dass die Abwanderung den Widerspruch unterdrückt, und es entstand der Eindruck, dass der Widerspruch innerhalb von Organisationen nur unter der Bedingung eine wichtige Rolle spielen wird, dass eine Abwanderung praktisch ausgeschlossen ist. Tatsächlich ist es in zahlreichen Organisationen so, dass einer der beiden Mechanismen vollkommen dominiert.« M 15 Jürgen Habermas: Die nachholende Revolution (1990) In Polen und Ungarn, in der Tschechoslowakei, Rumänien und Bulgarien, in Ländern also, die das staatssozialistische Gesellschafts- und Herrschaftssystem nicht aufgrund autochthoner Revolutionen, sondern als Kriegsfolge mit dem Einmarsch der Roten Armee eher erhalten als errungen haben, vollzieht sich die Abschaffung der Volksdemokratie im Zeichen einer Rückkehr zu den alten nationalen Symbolen und, wo immer es sich anbietet, als eine Wiederanknüpfung an politische Traditionen und an Parteienstrukturen der Zwischenkriegszeit. Hier, wo sich die revolutionären Veränderungen zu revolutionären Ereignissen verdichtet haben, artikuliert sich auch am deutlichsten der Wunsch, verfassungspolitisch an das Erbe der bürgerlichen Revolutionen und gesellschaftspolitisch an die Verkehrs- und Lebensformen des entwickelten Kapitalismus, insbesondere an die Europäische Gemeinschaft, Anschluss zu finden. Im Falle der DDR gewinnt »Anschluss« einen buchstäblichen Sinn; denn für sie bietet die Bundesrepublik beides zugleich: eine demokratisch verfasste Wohlstandsgesellschaft westlichen Typs. […] Nachholen will man, was den westlichen Teil Deutschlands vom östlichen vier Jahrzehnte getrennt hat – die politisch glücklichere und ökonomisch erfolgreichere Entwicklung. Indem die nachholende Revolution die Rückkehr zum demokratischen Rechtsstaat und den Anschluss an den kapitalistisch entwickelten Westen ermöglichen soll, orientiert sie sich an Modellen, die nach orthodoxer Lesart durch die Revolution von 1917 schon überholt worden waren. Das mag einen eigentümlichen Zug dieser Revolution erklären: den fast vollständigen Mangel an innovativen, zukunftsweisenden Ideen. […] Verwirrend ist dieser Charakter einer nachholenden Revolution, weil er an den älteren, von der Französischen Revolution gerade außer Kraft gesetzten Sprachgebrauch erinnert – an den reformistischen Sinn einer Wiederkehr politischer Herrschaftsformen, die aufeinander folgen und wie im Umlauf der Gestirne einander ablösen. Jürgen Habermas (1990): Die nachholende Revolution: Frankfurt/Main. Suhrkamp Verlag. S. 180f. Albert O. Hirschman (1974): Abwanderung und Widerspruch. Reaktionen auf Leistungsabfall bei Unternehmungen, Organisationen und Staaten. Tübingen. Mohr. S. 3f., 65 Die friedliche Re volution in der DDR und die Folgen D&E Heft 58 · 2009 M 16 Bürgerrechtsgruppe protestiert gegen die manipulierten Ergebnisse bei den Kommunalwahlen in der DDR im Mai 1989 © Robert-Havemann-Gesellschaft, www.jugendopposition.de M 18 Hundertausende demonstrieren am 4.11.1989 auf den Straßen um den Berliner Alexanderplatz – hier Protestzug auf der Karl-LiebknechtStraße vor dem Ausstellungspavillon am Fuße des Fernsehturms – für Veränderungen in der DDR. Es war die größte Protestdemonstration in der Geschichte der DDR. © picture alliance, dpa, 1989 M 19 Parolen bei den Demonstrationen in der DDR 1989 M 17 Konrad H. Jarausch: Revolution – pro und contra (2000) Die vielfältigen Umschreibungsversuche des Umbruchs von 1989/90 deuten darauf hin, dass die Analogie mit anderen Revolutionen zwar nahe liegt, aber doch nicht recht zu greifen scheint. Gegen die Verwendung des Revolutionsbegriffs sprechen eine Reihe von Argumenten, die sich vor allem auf eine engere marxistisch-leninistische Revolutionsdefinition berufen. Erstens war die physische Macht der kleinen Opposition in allen Ländern so begrenzt, dass sie nur durch die Selbstaufgabe der herrschenden Partei und Nomenklatura einen Umsturz herbeiführen konnte, also das System mehr von innen zusammenbrach als von außen zertrümmert wurde. Zweitens verlief der Prozess außer in Rumänien gewaltfrei, da die Massendemonstrationen Verhandlungen erzwangen, sich Regierung und Opposition in Runden Tischen zusammensetzten und die Machtfrage letztlich der Entscheidung durch mehr oder weniger freie Wahlen überließen, also einen Bürgerkrieg vermieden. Drittens fehlte dem demokratischen Aufbruch trotz aller Kritik an den Privilegien der »neuen Klasse« die soziale Dimension einer ländlichen Jacquerie oder eines städtischen Arbeiteraufstands, denn es stand hauptsächlich die Wiedererlangung von Bürgerrechten im Vordergrund. Schließlich verlief die Umwälzung in Polen und Ungarn so langsam, dass sich Ash zu dem Neologismus »Refolution«, einer Zusammenziehung aus Reform und Revolution, veranlasst sah. (…) Trotz dieser gravierenden Einwände legen wichtige Gründe die Verwendung einer Revolutionsperspektive auch weiterhin nahe. Allerdings wären ihre Vorbilder eher in der auf Bürgerrechte ausgerichteten amerikanischen Revolution, der liberale mit nationalen Zielen verbindenden 1848er Revolution oder der die zaristische Autokratie brechenden Februarrevolution von 1917 zu suchen. Dafür spricht erstens die Geschwindigkeit des Ereignisablaufs in der DDR und den ihr folgenden Satellitenstaaten, die weit über eine Reform von oben hinausging. Zweitens wurde der Druck für den Wandel von wachsenden Demonstrationen erzeugt, die zwar von Dissidenten geleitet, aber mehr und mehr von den Volksmassen getragen wurden, kam also von unten aus der unzufriedenen Bevölkerung. Drittens war das Ziel der Demonstranten, das sich in witzigen Plakaten und Sprechchören äußerte, eine fundamentale Demokratisierung des realen Sozialismus durch eine Verfassungsänderung, wozu der einfache Regierungswechsel von Honecker zu Krenz in keiner Weise ausreichte. Schließlich setzte die Machtübernahme der als politische Parteien organisierten Oppositionskräfte eine grundlegende Umwälzung aller wirtschaftlichen, institutionellen und ideologischen Lebensverhältnisse in Gang, die zu tiefen Brüchen in vielen Lebensentwürfen von DDR-Bürgern führte. Hinsichtlich Tempo, Akteuren, Zielen und Ausmaß kann der Systemwandel daher zweifellos als revolutionär bezeichnet werden. Neues Forum zulassen | Offenheit und Rechtssicherheit spart Arbeitsplätze bei der Staatssicherheit | Stasi in die Produktion: nur für Arbeit gibt es Lohn | Parlamentarische Demokratie statt SED-Machtmonopol- Die Armee wird reduziert: wann folgen die Krenz-Truppen? | Wer sich nicht bewegt, fühlt seine Fesseln nicht | Reformen: aber unbekrenzt | Mein Vorschlag für den 1. Mai: Die Führung zieht am Volk vorbei! | Wir brauchen Architekten statt Tapezierer | Die Mauer im Kopf muss weg | Für die beidseitige Bemalung der Mauer | Es geht nicht mehr um Bananen, jetzt geht’s um die Wurst | Sägt die Bonzen ab, schützt die Bäume | Eure Politik war und ist zum Davonlaufen | Privilegien für alle | Missbrauchte Polizisten, wehrt euch gegen Stalinisten | Alle Macht dem Volke | Umgestaltung der Grenze zu einem Naturreservat | ZK der SED abtreten | Keine Macht für niemand! | Wir sind das Volk | Ich bin Volker | Es lebe die 1989er-Oktoberrevolution! | Pässe für alle: Laufpass für die SED | Wenden nicht winden | Wir sind ein Volk | Freie Wahlen: Neues Forum, SDP usw. | Neue Wahlen für einen neuen Weg | Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, eh’ er nicht mit der Lüge bricht. Auch wenn er jetzt ganz anders spricht. | 43 Jahre führende Rolle der SED: Einmarsch in Prag, 28 Jahre eingesperrt, Hurra zum Peking-Massaker, Machtmissbrauch, Angst, Privilegien, Rechtsunsicherheit | WiderVereinigung-Reisefreiheit statt Massenflucht | Aufruf zur Einmischung | Wir wollen raus | Wir bleiben hier | Neues Forum | Statt Knüppel Besen in die Hand | Visafrei bis Hawaii | Kein Artenschutz für Wendehälse | Partei-Machtmonopol macht hohl | Lieber eine Wanze im Bett als eine in der Steckdose | Lass dich nicht BRDigen | Deutschland einig Vaterland | Wir wollen keine Kohlplantage werden | Heim ins Reich: nein danke | Die deutsche Einheit: Hoffnung der Nation. (Zusammengestellt von A. G.) Dietrich Papenfuß/Wolfgang Schieder (Hrsg.) (2000): Deutsche Umbrüche im 20. Jahrhundert. Köln (Böhlau Vertrag), S. 556ff. D&E Heft 58 · 2009 Die friedliche Re volution in der DDR und die Folgen 13 II. 20 JAHRE MAUERÖFFNUNG IN DEUTSCHLAND 2. DDR – Das letzte Jahr war das beste. Einschätzungen eines Zeitzeugen FRANK RICHTER D 14 ie Wende kam friedlich – 20 Jahre ist das her. Vor allem die Leipziger Montags-Demonstration vom 9. Oktober 1989 leitete endgültig das Ende der DDR ein. Doch wenige Tage zuvor stand in Dresden der Umbruch im Land auf der Kippe: Dort drohte Gewalt inmitten heftiger Proteste, als Züge mit DDR-Flüchtlingen aus der deutschen Botschaft in Prag durch den Dresdener Hauptbahnhof rollten. In Prag waren rund 12.000 DDR-Bürger in die deutsche Botschaft geflüchtet, wollten so ihre Ausreise erzwingen. Nach Wochen, kurz vor dem 40-jährigen DDR-Jubiläum, ließ Honecker sie unter einer Bedingung ziehen: Die Botschaftsflüchtlinge sollten durch die DDR ausreisen, ihre Züge über Dresden fahren. Immer mehr Menschen strömten dann am 4. Oktober 1989 zusammen. Am Ende bis zu 20.000. Es wurde die bis dahin größte Demonstration in Dresden gegen den SED-Staat. Und die Proteste verliefen auch unter Anwendung von Gewalt. Der ehemalige Oberleutnant der Volkspolizei und Einsatzleiter am Dresdner Hauptbahnhof Detlef Pappermann musste sich entscheiden, als zwei Kaplane aus der Menge heraus auf die Polizeiketten zugingen. »Den ersten Schritt haben die beiden Kaplane gemacht, indem sie auf uns zugekommen sind«, berichtet Pappermann. »Haben wir gesagt: ›Okay, wir wollen mal mit den Demonstranten reden.‹ Das war zu dem Zeitpunkt sicherlich ungewöhnlich und war bestimmt nicht polizeiliches Konzept.« Noch wenige Stunden zuvor hatte Pappermann Demonstranten abführen lassen. Schließlich ließ er sich auf ein Gespräch ein, meldete sogar eigenverantwortlich über Polizeifunk weiter: »Mich sprachen soeben zwei Vertreter der Geistlichkeit an, die jetzt in die Menge zurückgegangen sind und dort Ruhe schaffen wollen. Sie wollen eine Abordnung bilden, um das Gespräch mit jemand Verantwortlichem führen zu können.« (www.3sat.de) Die Abordnung ist die Geburtsstunde der »Gruppe der 20« in Dresden – und einer der Kaplane ist der heutige Direktor der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, der hier für D&E seinen Rückblick auf das letzte Jahr DDR formuliert. (Jürgen Kalb) »Die letzten Züge – oder: Dresden im Oktober 1989, ein Beispiel. Revolutionen brauchen Auslöser. In Dresden waren es die Züge, die von Prag nach Hof fahren und den Hauptbahnhof passieren sollten. Der Deutschlandfunk machte Tag, Uhrzeit und Strecke bekannt. Vielleicht kann man die um sich greifende Verzweiflung nachvollziehen, wenn man sich vor Augen hält, dass es Tausende waren, die sich auf den Weg machten, um in diese vermeintlich letzten Züge zu gelangen. Die Sehnsucht nach Freiheit kannte nur eine Himmelsrichtung: den Westen. Tausende DDR-Bürger ließen Familien, Häuser, Freunde, Arbeitsstelle und Heimat zurück. Sie hatten die Hoffnung verloren, dass sich zu ihren Lebzeiten noch etwas zum Besseren wenden würde. Sie wollten nach Prag, in die bundesdeutsche Botschaft – und als dies nicht mehr möglich war, weil die Staatsführung die Grenze geschlossen hatte, an die Gleise und Bahnsteigkanten, um auf diese Züge aufzuspringen. Es gelang ihnen nicht. Gleise und Bahnsteigkanten waren versperrt. Der Dresdner Hauptbahnhof befand sich fest in polizeilicher Hand. Die Züge fuhren vorbei und davon. Zurück blieben Menschen ohne Hoffnung in einem Land ohne Hoffnung. Aus der Verzweiflung wurde Wut. In den Nachmittagsstunden des 4. Oktober 1989 zerstörten die um ihre letzte Hoffnung gebrachten Abb. 1 Mitglieder der oppositionellen »Gruppe der 20« bei einem Rathausgespräch mit Dresdens Oberbürgermeister Berghofer im Oktober 1989. Kaplan Frank Richter, Mitgründer der »Gruppe der 20«, vierter von links. © picture alliance, dpa Ausreisewilligen die Inneneinrichtung des Bahnhofs. Die Polizei griff ein und griff zu. Es kam zu brutalen Übergriffen und Verhaftungen, von denen es in Dresden bis zum 8. Oktober etwas mehr als 1.000 geben sollte. Die Gefängnisse der Stadt und das Gefängnis in Bautzen, wohin eine große Zahl der Inhaftierten gebracht wurde, waren voll. Es kam zu schrecklichen Szenen. Am 5. Oktober versammelten sich in der Nähe des Hauptbahnhofs tausende Neugierige, die sehen wollten, was am Vortag geschehen war. Ebenso am 6. Oktober. Mit der wachsenden Zahl wuchs die Gewissheit, dass es sich bei den in Opposition befindlichen Bürgerinnen und Bürgern keinesfalls um eine verschwindende Minderheit handelte. Es wuchs eine Erkenntnis, die in dem Ruf der Demonstranten zum Ausdruck kam, den man als den alles entscheidenden bezeichnen kann: »Wir sind das Volk.« Ich persönlich habe diesen Ruf am 7. Oktober zum ersten Mal gehört, an jenem 7. Oktober, an dem der 40. Jahrestag der Gründung der DDR gefeiert wurde und an dem Michael Gorbatschow in Ostberlin den menetekelartigen Satz gesprochen haben soll: »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben«, am 7. Oktober 1989, an dem Polizei und Armee gegen das auf den Straßen demonstrierende Volk Dresdens besonders brutal zu Werke ging. In den Abendstunden des 8. Oktober kam es durch die Gründung der »Gruppe der 20« auf der Prager Straße und durch die Bereitschaft des Oberbürgermeisters, in Verhandlungen mit dieser Gruppe einzutreten, zur gewaltlosen Wende. Am ersten Tag des 41. Jahres begann etwas Neues. Man möge dem Autor, der Theologie studiert hat, den Hinweis auf die biblische Zahl erlauben. Was hier von Dresden berichtet wurde, ist ein Beispiel für viele Städte und Gemeinden in der DDR. Das historische Ereignis, das wir heute die friedliche Revolution nennen, begann in den Kommunen. Auslöser und Abläufe waren verschieden. Überall gleich waren die Ursachen der Revolution: die ökonomischen und ökologischen, die politischen und die mentalen Verhältnisse. DDR – Da s le t z te Jahr war da s be s te. Einschät zungen eine s Zeit zeugen D&E Heft 58 · 2009 Erst wandelte sich gar nichts – dann wandelte sich alles Es war Erhardt Neubert, der bei einer im August d. J. stattfindenden Tagung der Evangelischen Akademie in Meißen den Herbst 1989 als den atemberaubend schnellen Wechsel vom Stillstand zur Beschleunigung und von engster Begrenztheit hin zur vollständigen Entgrenzung beschrieb. In der Tat. Im Sommer 1989 gab es nicht nur sengend heiße Tage, an denen die Luft still zu stehen schien. Er erschien ebenso als der Gipfelpunkt des politischen Stillstands. Aus Ostberlin hörte man nichts. Das Politbüro schien (sieht man einmal ab von der Reise des Egon Krenz nach China) in den Tiefschlaf gefallen. Auch im August, als die ungarisch-österreichische Grenze geöffnet wurde, als DDR-Bürger in solch großen Mengen in den Westen flohen, wie es dies seit 1961 nicht mehr gegeben hatte und als dem politisch aufmerksamen Beobachter klar wurde, dass das lokal begrenzte Ereignis in Wirklichkeit den Zerriss des Eisernen Vorhangs bedeutete und die Auflösung des Ostblocks einzuleiten in der Lage war, brauchte es mehrere Wochen bis zur ersten offiziellen Reaktion der DDR-Regierung. Zyniker sprachen davon, dass das als geriatrische Abteilung erscheinende und unter zunehmendem Wirklichkeitsverlust leidende Politbüro nur noch eine einzige Absicht verfolgte: die Zelebrierung des 40. Jahrestages »seiner« DDR. Als das Volk dann aber auf die Straße ging und mit der Massendemonstration am 9. Oktober in Leipzig anerkanntermaßen den »Durchbruch« erringen konnte – übrigens auch deshalb, weil der Schießbefehl nicht wie befürchtet erteilt wurde – kam ein Veränderungsprozess in Fahrt, der von Tag zu Tag an Geschwindigkeit zunahm. Erstmals war der Osten interessanter als der Westen. Es gab Städte, die sich, wie zum Beispiel Dresden, innerhalb weniger Tage demokratisierten. Das Verb »demokratisieren« ist hier in einer höchst elementaren oder auch basisdemokratischen Bedeutung gemeint. Für Sachsen belegen die Historiker einen revolutionären Flächenbrand, der innerhalb weniger Wochen das gesamte Land erfasste, das es als »Bundesland« im heutigen Sinn freilich nicht mehr, noch nicht bzw. noch nicht wieder gab. Gern weise ich darauf hin, dass die Beteiligung an der »Montagsdemo« in einer Kreisstadt mit 18.000 Einwohnern keines geringeren Mutes bedurfte als die Beteiligung an der »Demo« in einer der großen Städte mit 500.000 Einwohnern, wo sich der Einzelne in der Anonymität der Menge relativ sicher fühlen konnte. Die revolutionären Veränderungen vollzogen sich aber keineswegs nur quantitativ. Auch hinsichtlich ihrer Qualität geschahen nahezu täglich Dinge, die man noch wenige Monate vorher für schier undenkbar gehalten hätte: offizielle Verhandlungen mit oppositionellen Gruppen und deren Anerkennung, Bildung Runder Tische, zunehmend freie Berichterstattung in den Medien, Rücktritt Erich Honeckers, öffentliche Infragestellung des Führungsanspruchs der SED, Diskussion über eine neue Reisegesetzgebung usw. Der Fall der Mauer am 9. November stellte einerseits den unbestrittenen Höhepunkt der politischen Veränderungen dar, der auch sofort als solcher begriffen wurde, andererseits einen tiefen Einschnitt in den demokratischen Veränderungsprozess der DDR, ermöglichte er doch nunmehr das ernsthafte Nachdenken über die plötzlich als realistisch erscheinende Option der Wiedervereinigung Deutschlands. Der 9. November entzweite in gewisser Weise die Opposition in der DDR, wobei dies für ein paar Tage im Jubel unterging und nicht sofort erkennbar war. Einen Höhepunkt, der ausschließlich die Veränderungen in der DDR betraf, gab es noch einmal Anfang Dezember, als die Opposition, die längst die politische Meinungsführerschaft an sich gerissen hatte, zur Besetzung der Zentralen des Staatssicherheitsdienstes aufrief. Die Erstürmung dieser Bastionen des real existierenden Unterdrückungsapparates erfolgte also knapp zwei Monate nach dem Durchbruch von Leipzig. Dass die Revolution insgesamt kein einziges Todesopfer gekostet hat, mag wesentlich auch damit zusammenhängen. Als Bundeskanzler Helmut Kohl am frühen Abend des 19. Dezember eine Rede vor der angestrahlten Ruine der Dresdner Frauenkirche hielt, wurde D&E Heft 58 · 2009 Abb. 2 Demonstration zur Wende in Dresden am 23.10.89, organisiert von der »Gruppe der 20« © Fotostudio Giersch, Dresden er von schätzungsweise 60.000 Menschen frenetisch gefeiert. Noch eine Stunde zuvor hatte er mit Ministerpräsident Modrow über sogenannte konföderative Strukturen zwischen den beiden deutschen Staaten verhandelt. Nach eigenen Aussagen ist ihm an diesem Abend klar geworden, dass der Zug der politischen Veränderungen unaufhaltsam in Richtung Wiedervereinigung abgefahren war. Der Aufruf »Für unser Land«, der u. a. von Christa Wolf und Stefan Heym unterzeichnet worden war, verfehlte die erwünschte Wirkung. Auch die Diskussionen am Zentralen Runden Tisch – u. a. über eine neue Verfassung der DDR – gerieten in den Hintergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit. Der oft gebrauchte Satz: »Wenn die D –Mark nicht zu uns kommt, dann gehen wir zur D – Mark!« verdeutlichte die Schwäche einer politischen Option, die sich an einer reformierten DDR bzw. einem sogenannten »3. Weg« orientierte. Nicht zu vergessen ist, dass der Exodus der Menschen aus der DDR in Richtung Bundesrepublik im Spätherbst und Winter 1989/90 keineswegs nachließ. Viele zweifelten noch immer daran, dass die Mauer endgültig gefallen und die Welt für immer offen war. Zurück zu Erhardt Neubert: Er weist darauf hin, dass die allermeisten Menschen nicht dafür geschaffen sind, den permanenten Aufbruch auszuhalten, zumal dann nicht, wenn sich dieser so schnell und so umfassend vollzieht, wie dies im Herbst 1989 geschah. Es brauchte Stabilisatoren. Es brauchte Leitplanken, die den Fortschritt kanalisierten. So waren die aus der Bundesrepublik bekannten politischen Parteien im Vorfeld der ersten freien Volkskammerwahlen in der DDR mehrheitlich willkommen. Sie stellten die Bürgerrechtsbewegten, die die Friedliche Revolution maßgeblich bewirkt hatten, in den politischen Schatten. Die Programme dieser Parteien, aber noch viel mehr die an ihrer Spitze stehenden Personen versprachen für viele eine neue Sicherheit. Gewählt wurden vor allem die, die sich eine schnelle Wiedervereinigung auf die Fahne geschrieben hatten. Für nachdenkliche, problematisierende und differenzierende Betrachtungen war nicht die Zeit. Die Einführung der D-Mark in der noch existierenden DDR wurde ersehnt und bejubelt. Von einer tief greifenden Ernüchterung angesichts der Preise, die für die allzu lange entbehrten Produkte westlicher Herkunft zu bezahlen waren, kann für den Sommer 1990 noch keine Rede sein. Der immer deutlicher werdende wirtschaftliche Nieder- und Untergang großer Teile der DDR-Wirtschaft und die damit verbundene steigende Arbeitslosenquote drangen nur langsam ins öffentliche Bewusstsein. Viele hofften, dass es sich dabei um schnell vorübergehende Phänomene handeln würde. Die Wiedererrichtung der Länder, die 1953 aufgelöst worden waren, wurde begrüßt als ein Stück wieder gewonnener Identität. Man kann sagen, dass die Zeit vom Oktober 1989 bis zum Oktober 1990 für die Menschen in der DDR von DDR – Da s le t z te Jahr war da s be s te. Einschät zungen eine s Zeit zeugen 15 FRANK RICHTER Abb. 3 Demonstration und Polizeieinsatz am 4.10.89 am Dresdner Hauptbahnhof. Ausreisewillige DDR-Bürger versuchten, in Zügen aus der CSSR einen Platz zu finden. Nach langen Verhandlungen hatten es Botschaftsbesetzer aus der DDR in Prag erreicht, ihre Ausreise in die Bundesrepublik durchzusetzen. Die Bedingung des SED-Regimes war, dass die Züge über DDR-Territorium führen müssten. © picture alliance, dpa 16 einem tiefen und umfassenden Wandel bestimmt war, wie er in der Geschichte nur selten vorkommt. Es fand eine Revolution statt, die diesen Namen uneingeschränkt verdient. Dass sie begünstigt wurde von zahlreichen außenpolitischen Umständen ist eine wahre Erkenntnis, die die Revolutionäre damals noch nicht besaßen. Was nahezu unbemerkt und wie nebenbei zusammenbrach, war die Weltanschauung des Marxismus-Leninismus samt seiner Geschichtstheorie, die den Menschen in der DDR als die einzig wissenschaftliche vorgetragen worden war. Die Menschen, die nach dieser Theorie im Prinzip nichts anderes waren als der »Dünger der Evolution«, ebneten sich selbst die Bahn in die Geschichte. In demselben Moment, in dem sie die Macht zu suchen begonnen hatten, von der sie gelernt hatten, dass sie diese gar nicht besäßen, begannen sie dieselbe auszuüben. Sie taten dies miteinander. Die politische Subjektwerdung erfolgte solidarisch. Es wird oft daran erinnert, dass sich wildfremde Menschen in den Monaten des Herbstes 89 ansprachen, über persönlichste Erfahrungen und Ängste austauschten und gelegentlich in den Armen lagen. Diese Solidarität steckte ganz offensichtlich viele Westdeutsche an, auch solche, die vorher keine Beziehungen in den Osten unterhalten hatten. Es war ein großartiges Jahr in der deutschen Geschichte, ein Jahr, in dem die Nachkriegszeit zu Ende ging. Zwei Diktaturen hintereinander. Wie tief sind die Wurzeln der Demokratie? Das Territorium der untergegangenen DDR ist das europaweit einzige Territorium, über das zwei ideologisch aufgeladene Diktaturen unmittelbar hintereinander herrschten, Diktaturen, die sich durch einen quasi religiösen Anspruch zu legitimieren suchten. Dem Heil Hitlers folgte nach einer kurzen Phase des Überganges die Verheißung des Kommunismus, der für sich in Anspruch nahm, die einzige wissenschaftliche Weltanschauung zu sein und über die Kenntnis zu verfügen, auf welchem Weg und mit welchen Mitteln die gesamte Menschheit in den endgültigen und umfassenden Zustand individuellen und gesellschaftlichen Glücks zu führen sei. Der Marxismus-Leninismus enthielt wesentliche Kriterien, die eine Religion ausmachen. Er beschrieb den erlösungsbedürftigen Zustand der Menschen als ihre Entfremdung von der Arbeit. Er benannte den Erlöser: die Arbeiterklasse, die angeführt würde von einer Partei, die an der Spitze der revolutionären Umgestaltung stehen müsse. Und er beschrieb verheißungsvoll eben jenen Zustand, in dem alle Widersprüche Abb. 4 Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) am 19.12.1989 in Dresden. Hans Modrow (SED-PDS) war damals Ministerpräsident der DDR © picture alliance, dpa aufgelöst und alle Sehnsüchte erfüllt werden würden: die kommunistische Gesellschaft, die sich zwangsläufig am Ende der Geschichte (als Neuauflage der archaischen Urgesellschaft) wiederum einstellen würde. »Jedem nach seinen Bedürfnissen; jeder nach seinen Fähigkeiten.« – so beschrieb mir meine Geschichtslehrerin das Prinzip der schon bald anbrechenden kommunistischen Gesellschaftsordnung. Außerdem erklärte sie den Verlauf der Geschichte mit einer Metapher: der Rolltreppe. Diese rollt zwangsläufig nach oben, egal wie sich die Benutzer verhalten. Einige stellen sich drauf und lassen sich nach oben fahren (die passiven Mitglieder der Gesellschaft), andere laufen auf der ohnehin nach oben fahrenden Rolltreppe aufwärts (die fortschrittlichen Mitglieder der Gesellschaft), die dritten schließlich laufen nach unten, obwohl die Rolltreppe auch sie zwangsläufig nach oben bringen wird (die blöden oder die schädlichen Mitglieder der Gesellschaft, zu denen ich gehörte; ich durfte mir nur noch aussuchen, ob ich als blöde oder als schädlich gelten wollte). Spaß beiseite. Die Lehrerin meinte es ernst und der Mythos eines der Geschichte immanenten gesellschaftlichen Fortschritts, der unabhängig vom Handeln einzelner Menschen herrschte, wurde geglaubt. Beide Glaubenssysteme, das rote wie das braune, brachen mit den Diktaturen, zu deren ideologischen Begründung sie gedient hatten, sang- und klanglos zusammen. Zurück blieben Ruinen in den Köpfen vieler Menschen, Ruinen, in denen nun Gespenster hausen. Beide Glaubenssysteme orientierten auf den Staat als Erfüllungsorgan der vorgetragenen Verheißungen. Der Staat und die, die ihn führten, erschienen als etwas irgendwie Göttliches, dem zu widersprechen sinnlos war. Als im Jahr 1989 auch die zweite Diktatur zusammenbrach, als sich das zweite Glaubenssystem als sinn- und haltlos erwies und sich mit ihm zusammen ein Staat verabschiedete, der vor gerade mal 40 Jahre wie Phönix aus der Asche erstanden war und die Erfüllung aller menschlichen Sehnsüchte versprochen hatte, entschlossen sich viele – so nehme ich an –, von nun an erst mal an gar nichts mehr zu glauben. Andere übertrugen ihre Staatsgläubigkeit allzu schnell und allzu gern auf den neuen Staat, der nun von Westen her hereinbrach. Sie nahmen sein Manna in der Form der vom Himmel fallenden D-Mark dankbar und fromm entgegen. Sie mussten ein weiteres Mal enttäuscht werden. Ich wundere mich darüber, dass sich viele darüber wundern, wie wenig tief die Wurzeln der Demokratie ins ost- bzw. mitteldeutsche Erdreich eingedrungen sind. Wann hätten sie denn eindringen sollen? In den Jahren zwischen 1919 und 1933? Von da ab – bis zum Jahr 1989, also über 2 oder 3 Generationen, herrschten auf dem beschriebenen Gebiet diktatorische Systeme, die sich obrigkeitsstaatlich, autoritär und totalitär gebärdeten und für die große Mehrheit der Bevölkerung alternativlos und in ihren Anfängen erfolgreich erschienen. Einige prinzipielle Denk- und Verhaltensmuster, auf DDR – Da s le t z te Jahr war da s be s te. Einschät zungen eine s Zeit zeugen D&E Heft 58 · 2009 denen ein demokratisch verfasstes Gemeinwesen selbstverständlich aufbaut – wie zum Beispiel Individualität, Pluralität, Liberalität, zivilgesellschaftliches Engagement und zivile Courage – sind aufs Ganze gesehen nur schwach ausgeprägt. Diese Einschätzung scheint den vorgetragenen Einschätzungen zur friedlichen Revolution zu widersprechen. Sie widerspricht ihnen nicht, wenn man berücksichtigt, dass die Revolution von einer kleinen Minderheit der DDR-Bevölkerung vollzogen wurde. Eine große Mehrheit ließ sie mehr oder weniger über sich ergehen oder stand ihr ablehnend gegenüber. Bis sich die Demokratie im Bewusstsein der Menschen auf dem Territorium der untergegangenen DDR eingewurzelt hat, wird es wohl solange dauern, wie es nach 1945 in Westdeutschland gedauert hat, wobei wenigstens ein Unterschied zu bemerken ist. Im Osten der Republik wird es noch lange Zeit diejenigen geben, die sagen können: »Ich selbst war aktiv beteiligt an der friedlichen und demokratischen Demokratie.« – und daneben die anderen, die dies ehrlicherweise nicht sagen können und noch lange schweigen werden. Günter Schabowski Ich weiß, dass es angebracht wäre, Persönlichkeiten namentlich zu erwähnen, die die friedliche und demokratische Revolution bewirkt und für sie gelitten haben. Dies geschieht zum Glück an vielen Stellen. Wenn ich an dieser Stelle Günter Schabowski nenne, dann deshalb, weil er zu den wenigen gehört, die sich meiner Meinung nach intensiv mit der eigenen Rolle als Funktionär der Diktatur auseinandergesetzt haben. Ob man ihm die vorgetragenen Erkenntnisse zu 100 % abnehmen kann, weiß ich nicht. Wem kann man alles zu 100 % abnehmen? Immerhin wurde Schabowski aus der Partei ausgeschlossen. Immerhin hat er wegen der von ihm selbst eingestandenen Mitverantwortlichkeit am Grenzregime der DDR im Gefängnis gesessen. Immerhin erläutert er nachvollziehbar, welche persönlichen Erlebnisse ihn zum Kommunisten gemacht und welche ihn im fortgeschrittenen Alter eines Besseren belehrt haben. Es gab mehrere Veranstaltungen, die ich gemeinsam mit ihm bestreiten konnte. Immer machte sich das Interesse fest an den »berühmten drei Worten« – von ihm ausgesprochen am 9. November 1989, 18.58 Uhr: »… meines Wissens unverzüglich.« Sie betrafen zunächst nur den Beginn der neuen Reiseregelung. De facto löste Schabowski mit ihnen unwissentlich und unwillentlich – wie er immer wieder betont – die Öffnung der innerdeutschen Grenze aus, den Mauerfall, und damit letztlich das Ende der DDR. Nach einer Veranstaltung in Offenbach a. M. hatte ich ein längeres Gespräch mit ihm im Auto. Wir philosophierten über die oben bereits erwähnte religiöse Dimension des Marxismus-Leninismus. Ihm schien der Gedanke zunächst völlig abwegig. Als ich ihn jedoch auf die Bedeutung der persönlichen Glaubensüberzeugung hinwies, die ich bei vielen Kommunisten beobachtet hatte, schien er sich der Analogie zu öffnen. Von Kirchengeschichte verstand er fast nichts. Den Begriff »Konstatinische Wende« hatte er noch nie gehört. Dass das frühe Christentum mit der baldigen Rückkehr des Messias gerechnet und den bevorstehenden Anbruch des Reiches Gottes erwartet hatte, in dem die wegen des Sündenfalls verloren gegangenen paradiesischen Zustände endgültig wieder hergestellt würden, war ihm unbekannt. Dass das Christentum aber die als unbedingt wahr erkannten Glaubensdinge kodifizieren und verwalten musste, als es sich mit dem Ausbleiben der raschen Vollendung (der Parusieverzögerung) konfrontiert sah, leuchtete ihm ein. Das Gespräch endete mit dem Hinweis, dass auch viele Kommunisten mit dem Ausbleiben der noch zu Lebzeiten erwarteten kommunistischen Glückseligkeitszustände zu kämpfen hatten, und mit seinem Satz: »Dann war das Politbüro so etwas Ähnliches wie die Glaubenskongregation.« Er fügte sinngemäß hinzu: Auch wir wähnten uns im Besitz einer Wahrheit, die um des Fortschrittes der Menschheit willen auf keinen Fall verloren gehen durfte. Wir waren unfehlbar. Alles – ja, wirklich alles – was wir taten, er- D&E Heft 58 · 2009 Abb. 5 Am Abend des 9.11.1989 informierte die DDR-Nachrichtensendung »Aktuelle Kamera« die Bevölkerung der DDR über die neuen Reiseregelungen für DDR-Bürger. Zuvor hatte SED-Politbüromitglied Günter Schabowski bekannt gegeben, dass alle Grenzen zur Bundesrepublik und Westberlin ab sofort geöffnet würden. Dies war das Signal zur Maueröffnung in Deutschland. © picture alliance, dpa hielt seine Legitimität durch diese Gewissheit und durch die wiederholte (Selbst-)Vergewisserung, dass wir es doch gut meinten. Noch einmal friedliche Revolution Die politischen Veränderungen in den Jahren 1989 und 1990, die friedliche Revolution in der DDR kostete kein einziges Todesopfer. Von einem Mitglied des Politbüros ist ein Ausspruch überliefert, den ich nur sinngemäß zitieren kann: Auf alles waren wir vorbereitet. Auf friedliche Demonstranten, die mir Kerzen in ihren Händen auf uns zukamen, waren wir nicht vorbereitet. – In vielen Städten begannen die Demonstrationen nach dem Leipziger Vorbild mit Friedensgebeten in den Kirchen. Von Dresden kann ich berichten, dass sich diese Andachten fast immer mit einem Vers der Seligpreisungen Jesu aus dem Matthäusevangelium beschäftigten. Dass der Ruf der Demonstranten »Keine Gewalt!«, der als einer der ersten Rufe des Herbstes 89 belegt ist, in einem Zusammenhang gesehen werden kann mit dem Trostwort »Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben«, wird niemand bestreiten. Detlef Pappermann, Polizist, Einsatzleiter und Verhandlungspartner der Demonstranten am 8. Oktober 1989 in Dresden berichtet davon, dass er mit der Erteilung des Schießbefehls gerechnet hat. Dieser kam jedoch nicht. Von einem Umstand gingen offenbar alle aus: dass das in der DDR stationierte sowjetische Militär im Unterschied zu 1953 in den Kasernen bleiben und nicht eingreifen würde. Summa summarum hatte die Friedlichkeit der Revolution viele Väter und Mütter, viele begünstigende Umstände. Dennoch: Es gab keine erkennbare Zwangsläufigkeit. Es hätte alles auch anders verlaufen können. Das Ereignis ist zu würdigen als eine kulturelle Leistung und als ein historisches Glück. Es hat die deutsche Geschichte bereichert. Wir sollten es nicht nur untersuchen. Wir sollten es feiern.« DDR – Da s le t z te Jahr war da s be s te. Einschät zungen eine s Zeit zeugen 17 FRANK RICHTER 18 MATERIALIEN M 1 Die Ereignisse im Oktober 1989 in Dresden Die »Gruppe der 20« war die erste Vereinigung veränderungswilliger Bürger, die Gespräche mit der Staatsmacht aufnahm: Der Durchbruch zum Dialog gelang in Dresden am 8. Oktober 1989, auf der Straße. Der Spätsommer 1989 war gekennzeichnet von einer Massenflucht von DDR-Bürgern, die über Ungarn nach Österreich ausreisten bzw. die diplomatische Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin sowie deren Botschaften in Prag und Budapest besetzten. Botschaftsflüchtlingen aus der Prager Botschaft wurde am 29. September 1989 die Ausreisegenehmigung erteilt; sie wurden in Sonderzügen in die Bundesrepublik gebracht. Die Streckenführung verlief über das Gebiet der DDR: über Dresden, Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) und Plauen nach Hof. Die öffentliche Verbreitung des Fahrplans der Flüchtlingszüge, beispielsweise über die Nachrichten des westdeutschen Deutschlandfunks, führte dazu, dass sich Hunderte, später Tausende Menschen am Dresdner Hauptbahnhof versammelten, um auf die durchfahrenden Züge aufzuspringen. Die Polizei räumte zunächst den Bahnhof mehrfach, wobei Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke zum Einsatz kamen. Hunderte Menschen wurden im Sprachgebrauch der damaligen Volkspolizei »zugeführt«, d. h. festgenommen. In der Nacht vom 4. zum 5. Oktober 1989 kam es infolge des harten Vorgehens der Polizeikräfte zu massiven Zerstörungen im und vor dem Dresdner Hauptbahnhof. Nach der Eskalation änderte sich jedoch der Kurs der Dresdner SED-Führung. Hans Modrow, Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Dresden, sah nach diesen Erfahrungen nur einen Weg zur Konfliktlösung zwischen der Bevölkerung und der Staats- und Parteiführung – den der Deeskalation. Trotz dieses beginnenden Meinungswandels bei den Staatsvertretern wurde die Demonstration auf der Prager Straße am 8. Oktober 1989 von Polizeiketten eingekesselt. Ca. 1.500 Demonstranten drohte die Polizei eine gewaltsame Räumung an. Unter den Demonstranten befanden sich die Kapläne Frank Richter und Andreas Leuschner. Sie nahmen in dieser angespannten Stimmung Kontakt zur Polizeiführung auf. Der Einsatzleiter der Polizei, Detlef Pappermann, willigte ein, im Dresdner Rathaus vorzusprechen, um Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer das Gesprächsangebot der Demonstranten zu übermitteln. Derweil sammelten die Kapläne eine Anzahl Bürger um sich, die als Vertreter der Demonstranten für die Gespräche mit dem Oberbürgermeister fungieren sollten. Kaplan Richter sicherte das friedliche Verlassen des Platzes zu, wenn Berghofer das Gesprächsangebot annähme. Dies war die Geburtsstunde der »Gruppe der 20«. OB Berghofer (SED) stimmte schließlich Gesprächen zu. M 3 Volkspolizei verbarrikadiert sich im HBF Dresden am 4.10.1989 © Rigo Pohl, Dresden, heimlich fotografiert © Nagel/Ruthendorf (2009) M 2 (rechts) Bericht des Leiters der MfS-Bezirksverwaltung Dresden, Generalmajor Böhm, vom 9. Oktober 1989, (MfS = Ministerium für Staatssicherheit) © Frank Richter, Privatarchiv DDR – Da s le t z te Jahr war da s be s te. Einschät zungen eine s Zeit zeugen D&E Heft 58 · 2009 M 5 Bildung der »Gruppe der 20« in Dresden am 8.10. 1989 © Rigo Pohl, als Augenzeuge heimlich fotografiert Deutsche und europäische Geschichte denken. Zwanzig Jahre nach der Vereinigung beider deutscher Staaten. Anregungen für den Geschichtsunterricht (= Siebeneichener Diskurse), hrsg. vom Sächsischen Bildungsinstitut, bearb. und zusammengestellt von Waltraud Schreiber, Sylvia Mebus, Stefanie Serwuschok und Marcus Ventzke, Meißen. Richter, Michael/Sobeslavsky, Erich (1999): Die Gruppe der 20. Gesellschaftlicher Aufbruch und politische Opposition in Dresden 1989/90, Köln. M 4 Bericht des MfS, Auszug aus der »Stasi-Akte« Frank Richters vom 13. Oktober 1989 (BStU = Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR: www.bstu.bund.de) © Frank Richter, Privatarchiv Internetlinks www.ddr-im-unterricht.de (Portal der LpB Ba-Wü zur DDR-Geschichte, u. a. mit zahlreichen Links zu Unterrichtsmaterialien) www.chronikderwende.de (private Homepage zur Friedlichen Revolution) www.archiv-buergerbewegung.de/Texte/Zeittafel-sw.htm (Chronik der Bürgerrechtsbewegung in der DDR) Literaturhinweise Nagel, Ruth/Ruthendorf, Susanne v. (bearbeitet von Sylvia Mebus) (2009): Schüler re-konstruieren Vergangenheit und schreiben Geschichte: Die »Stasi«-Akte des Dresdner Bürgers Frank Richter (Klassenstufen 10/11), in: M 6 Bericht des Leiters der MfS-Bezirksverwaltung Dresden General Böhm am 10. Oktober 1989 an die MfS-Zentrale unter der Leitung des Armeegenerals Erich Mielke © Frank Richter, Privatarchiv D&E Heft 58 · 2009 DDR – Da s le t z te Jahr war da s be s te. Einschät zungen eine s Zeit zeugen 19 II. 20 JAHRE MAUERÖFFNUNG IN DEUTSCHLAND 3. Wirtschaftliche Entwicklung in Ostund Westdeutschland seit 1989 WOLFGANG WALLA B ei einer Vereinigung entsteht üblicherweise etwas Neues, anderes: Nach 40 Jahren Teilung in DDR und BRD mit gegensätzlichen politischen und Wirtschaftssystemen ist Deutschland nun schon wieder 20 Jahre vereint. Der Rückblick auf die letzen beiden Jahrzehnte offenbart dabei sehr viel Neues im Osten, aber nicht unbedingt anderes im Westen Amtliche Daten zeigen zudem, dass die von Gorbatschow initiierte Perestroika bereits Mitte der 1990er-Jahre in eine Entwicklung westlicher Prägung glitt. Die ökonomischen Indikatoren belegen dabei durchaus eine typische Win-Win-Situation, mit insgesamt leichten Vorteilen für den Westen. So treten räumliche Disparitäten heute deutlicher zwischen dem Norden und dem Süden als dem Osten und dem Westen sowie innerhalb der Bundesländer und Kommunen auf. »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben« 20 Unter ökonomischen Gesichtspunkten hatte die DDR den Anschluss an die westlichen Länder längst verloren. Die Zuwachsraten des »Gesamtwirtschaftlichen Gesamtprodukts« fielen seit Mitte der 1970er-Jahre stetig ab, wie dem Statistischen Jahrbuch der DDR von 1990 zu entnehmen ist, von 1985 bis 1989 wuchs es gerade noch um 8 Prozent. Im selben Zeitraum nahm in der damaligen BRD das »Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen« um 33, in den USA um 30 und in Italien (überwiegend inflationär bedingt) gar um 93 Prozent zu. Bemerkenswert ist, dass das Statistische Zentralamt der DDR die Daten veröffentlichte. Eine saturierte und kleinbürgerlich orientierte Führungsriege schien die Brisanz dieser Daten nicht wirklich verinnerlicht zu haben. Die Feierlichkeiten zu »40 Jahre DDR« sollten demgegenüber die vermeintliche Leistungskraft der DDR-Wirtschaft verdeutlichen. Die Erfolge im Wohnungsplattenbau sowie die Stärke und Präsenz der Nationalen Volksarmee gaukelten die wirtschaftliche und politische Kraft der DDR nach innen und nach außen vor. Gleichzeitig vergrößerten sich in Ungarn und in Prag die Löcher im Eisernen Vorhang, und Gerassimow, der außenpolitische Sprecher von Michail Gorbatschow und dessen Außenminister Eduard Schewardnadse, verdeutlichten Gorbatschows Meinung: »Those who are late will be punished by life itself.« Dazu Gorbatschow selbst: »Das Reformkonzept, das wir auf der JuniPlenarsitzung (Juni 1987) unterbreitet haben, … sieht fundamentale Veränderungen in allen Bereichen vor: Die Umstellung der Betriebe auf vollständige, wirtschaftliche Rechnungsführung, die grundlegende Umstrukturierung der zentralistischen Wirtschaftsführung, einschneidende Veränderung bei der Planung, eine Reform des Preisbildungssystems und des Finanzierungs- und Kreditmechanismus sowie die Neuordnung der Außenwirtschaftsbeziehungen.« (Gorbatschow, 1987, S. 104). Die DDR blieb bei den für alle verbindlichen Festpreisen, die bei geringer politischer Bedeutung betriebswirtschaftlich kalkuliert oder bei hoher politischer Relevanz niedrig (Mieten, Energie usw.) oder hoch wie bei Luxusgütern angesetzt wurden. Insofern stellten niedrige Preise einen Teil der Entlohnung und überhöhte Preise eine Art Luxussteuer dar. »Blühende Landschaften« als Wahlversprechen Bundeskanzler Kohl versprach im Juli 1990 den späteren Neuen Bundesländern schon bald die sprichwörtlichen »blühenden Land- Abb. 1 Militärparade am 7. Oktober 1989 in Ost-Berlin, mit der die Führung der DDR die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik vor 40 Jahren feierte. © picture alliance, dpa schaften« (| M 1 |). Für Jedermann sichtbar wurden die Bemühungen zunächst durch eine extrem ehrgeizige Planungs- und Bautätigkeit. Die Nord-Süd-Orientierung des Autobahnnetzes wurde durch Ost-West-Verbindungen ergänzt. Viele »Ossi-Straßen« kamen so schnell auf Westniveau und manche »Wessi-Straßen« fielen im Laufe der Jahre auf DDR-Niveau zurück. Industriebrachen und aufgelassene Gewerbegebiete erfuhren rasch eine andere Nutzung. Die Planer im Osten waren dabei mit einer ganz neuen Zielsetzung konfrontiert: Flächenoptimierung bei insgesamt sinkenden Bevölkerungszahlen und großflächigen Industriebranchen. Diese Planungen und deren Umsetzung führten zwischen 1993 und 2004 zu einer starken Ausweitung der Siedlungs- und Verkehrflächen: In den Neuen Ländern um 20, in den Alten Ländern um 12 Prozent. Täglich wurde dabei in den Neuen Ländern Bodenfläche von vergleichweise 60 Fußballfeldern und in den Alten Ländern von 140 für Verkehrstrassen, Park- und Flugplätze, für Wohn- und Gewerbegebiete oder Erholungsparks und Friedhöfe umgewidmet. Wegen des enormen »Flächenverbrauchs« avisierte schließlich die Bundesregierung in ihrer »nationalen Nachhaltigkeitsstrategie« das Ziel, die tägliche Inanspruchnahme neuer Siedlungs- und Verkehrsflächen bis zum Jahr 2020 auf 30 ha/ Tag, was 44 Fußballfeldern entspricht, zu reduzieren. Beispiellose Gründungseuphorie und Investitionstätigkeit Die Privatisierung der volkseigenen Betriebe sowie der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und Kombinate führte zu einer beispiellosen Welle von »Existenzgründungen«, wie das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) aus der amtlichen Gewerbeanzeigenstatistik nach Bereinigung um nicht gründungs- bzw. liquidationsrelevante Meldeanlässe ermittelte. Allein von 1991 bis 1993 wurden so zusammen 315.000 Unternehmen als Hauptniederlassung oder von Kleingewerbetreibenden gegrün- W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i n O s t - u n d W e s t d e u t s c h l a n d s e i t 19 8 9 D&E Heft 58 · 2009 det oder durch Erbe, Kauf oder als Pacht übernommen und im selben Zeitraum »nur« 76.000 wieder aufgegeben. Heute halten sich Unternehmensgründungen und -liquidationen in etwa die Waage – wie übrigens im Westen auch (IfM). Die Umstrukturierung der Wirtschaft führte nach dem Mauerfall zu einem enormen Investitionsschub in den Neuen Ländern. Wie der Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (AK-VGRdL)« errechnete, summierten sich dort die Bruttoanlageinvestitionen, das heißt »der Erwerb von dauerhaften und reproduzierbaren Produktionsmitteln sowie selbst erstellte Anlagen und größere Wert steigernde Reparaturen« von 1991 bis 2006 auf 1,2 Billionen EUR oder 17 % der 6,4 Billionen EUR, die in Deutschland investiert wurden. Täglich waren das 200 Mio. EUR. Die stärkste Investitionstätigkeit fiel mit jeweils fast 100 Milliarden EUR in die Jahre 1994 bis 1996, um dann stetig bis 2006 auf 55 Milliarden abzufallen. Jahr für Jahr gingen um die 80 Prozent der Investitionen in die Dienstleistungsbereiche. Gerne wird das als die Umorientierung der industriell geprägten DDR-Wirtschaft zu einer Dienstleistungswirtschaft interpretiert. Das trifft so nicht zu, denn in den Alten Ländern gestaltete sich die sektorale Investitionstätigkeit ähnlich. Eines trifft aber mit Sicherheit zu: Nutznießer des Investitionsvolumens waren zunächst vor allem westliche Unternehmen, die Anlagen in die Neuen Länder lieferten oder dort errichten ließen. Industrie: Beispiel Thüringen Die Erfolge der thüringischen Industrie basieren vor allem auf einer enormen kapitalistisch geprägten Perestroika. DDR-Unternehmen wurden liquidiert, um potenzielle Konkurrenten abzuhängen oder (re)fusioniert, um DDR-Know-how, DDR-Kontakte und Arbeitskapazität zu bewahren, Kosten-Leistungs-Gesichtspunkte lösten Versorgungsaspekte ab. Gleichzeitig wurden bis 1995 in das produzierende Gewerbe (ohne Bau) 13 Mrd. EUR investiert. Das Ergebnis war u. a. eine Halbierung der industriellen Arbeitsplätze von 1991 bis 2008, fast eine Verzehnfachung der Umsätze je Beschäftigten, eine Verdoppelung der Exportquote und eine Verdreifachung der Entlohnung (| M 4 |). Die wichtigste Änderung war jedoch die Reduzierung des Lohnkostenanteils. Wurde 1991 noch fast die Hälfte des Umsatzes an die Beschäftigten umverteilt, war es acht Jahre später nur noch ein Fünftel. Trotzdem erhöhte sich von 1991 bis 2006 die durchschnittliche Entlohnung von 7.800 auf 25.500 EUR. Im Industrieland Baden-Württemberg stiegen im selben Zeitraum die Löhne und Gehälter je Beschäftigten von 28.000 auf 42.000 EUR. Der absolute Abstand der durchschnittlichen Löhne und Gehälter zwischen Baden-Württemberg und Thüringen hat sich dabei von 17.700 auf 13.700 EUR verringert. »Glei ditscht se nei!« Zum 3. Oktober 1990 beendete der Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR die Existenz des ostdeutschen Staates. Die Bevölkerung interessierte dabei wohl eher, wofür sie ihr Haushaltsgeld ausgeben musste und verglich dies mit dem Konsumverhalten der westlichen Nachbarn. Ein gutes Fünftel wurde von vergleichbaren 4-Personen-Haushalten beiderseits der Grenze für Steuern, Versicherungen und Zinsen sowie für Kredittilgung aufgewandt. Dann kommen die großen Unterschiede: Zur Befriedigung der Grundbedürfnisse »Essen, Trinken und Bekleidung« gab ein 4-Personen-Haushalt von Arbeitern und Angestellten in der DDR 41 Prozent seines Einkommens aus, im Westen nur 21. Miete, Gas, Wasser Strom und Umlagen beanspruchten von diesem Haushaltstyp in der DDR 3 Prozent, im Westen 20 Prozent des Haushaltseinkommens (| Abb. 3 |). Mit der Wiedervereinigung fielen die indirekten Transverleistungen wie niedrige Wohnungsmieten fast vollständig weg. D&E Heft 58 · 2009 Abb. 2 DDR-Karikatur aus der Sicht der damaligen DDR-Bevölkerung: »Glei ditscht se nei!« © Louis Rauwolf, 1990, Haus der Geschichte Bonn Konvergenzprozess abgeschlossen? Bundeskanzler Kohl sagte auch: »Für das große Ziel der Einheit unseres Vaterlandes werden auch wir in der Bundesrepublik Opfer bringen müssen.« Das sollte wohl auch heißen, dass es am Ende des Prozesses den Neuen Ländern so gut gehen sollte wie den Alten Ländern. Dann würde gelten: wenn die Einkünfte zweier unterschiedlich wohlhabender Gesellschaften so aufgeteilt werden, dass alle – bezogen auf die Bevölkerungszahl – gleich viel haben, dann müsste der reichere Teil am Ende relativ weniger und der ärmere relativ mehr vom Gesamten haben. Auf den ersten Blick scheinen die amtlichen Statistiken dies auch zu bestätigen. Der Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder (AK-VGR) attestierte den Neuen Ländern ein DDR BRD 4-Personen-Haushalte von Arbeitern und Angestellten 4-Personen-Haushalte von Angestellten und Arbeitern mit mittlerem Einkommen durchschnittliche monatliche Ausgabenvolumen 2.465,– Mark davon Ausgaben in % für (1989) durchschnittliche monatliche Ausgabenvolumen BRD 4.245,– DM Verkehrsleistungen 1 1 Fremde Verkehrsleistungen Möbel, Polstermöbel 1 3 Möbel (mit Matrazen) Strom, Gas, Wasser, Heizung 1 4 Elektrizität, Gas, Heizöl, Umlagen Genussmittel (ohne Getränke) 2 1 Tabakwaren Miete 2 16 Bildung, Unterhaltung, Erholung 3 8 Bildung, Unterhaltung, Freizeit Getränke (Einzelhandel) 6 3 Getränke Textilien, Bekleidung 10 5 Bekleidung Nahrungsmittel 22 12 Nahrungsmittel Steuern, Versicherungen, Beiträge (1) 22 22 Zinsen, Steuern, freiwillige Beiträge Sozialversicherungen (2) Miete 1) Steuern, Versicherungen, Beiträge, Saldo aus Guthaben, Krediten und Bargeldbeständen 2) Zinsen, Steuern, freiwillige Beiträge zur Sozialversicherung, Prämien und Beiträge, für private Versicherungen und Pensionskassen, Beiträge, Geldspenden und sonstige Übertragungen sowie Veränderung der Vermögensbestände und Finanzkonten Abb. 3 Für was die Bürger der DDR und der BRD im Jahre 1989 ihr Haushaltsgeld ausgaben W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i n O s t - u n d W e s t d e u t s c h l a n d s e i t 19 8 9 21 WOLFGANG WALLA Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1991 bis 2008 zwischen 190 (Thüringen) und 152 Prozent (Mecklenburg-Vorpommern). Für die Alten Länder streuen die Werte zwischen 70 Prozent in Bayern und 45 Prozent in Schleswig-Holstein, Gesamt-Berlin kommt auf gerade 38 Prozent. Die äußerst positiven und von den östlichen Landesregierungen gerne zitierten Veränderungsraten basieren allerdings in erster Linie auf einem statistischen Basiseffekt, dem Startjahr 1991. Die von konjunkturellen Schwankungen und Inflationsraten unabhängigen Regionalanteile am BIP Deutschlands zeigen ein anders Bild. Für die Neuen Länder erhöhte sich der Regionalanteil von 7 Prozent im »Super-Abwicklungs-Jahr« 1991 bereits 1995 auf 12 Prozent. Danach pendelten die Anteile zwischen 11 und 12 Prozent, das heißt, der ökonomische Konvergenzprozess ist Mitte der 90er-Jahre mehr oder weniger zum Abschluss gekommen. Die dabei gern zitierte günstige Entwicklung des BIP je Einwohner in den Neuen Ländern ist aber nicht nur auf die überdurchschnittliche Entwicklung des BIP, sondern auch auf die Reduzierung der Bevölkerungszahl um – 10,6 Prozent bis Ende 2008 zurückzuführen. Der absolute Abstand der durchschnittlichen Einkünfte zwischen den Neuen und Alten Ländern und Gesamt-Berlin hielt sich seit 1992 ziemlich konstant bei 10.000 EUR je Steuerpflichtigen. Bei einer Fortsetzung der Entwicklung würden sich daher die relativen Einkommensdisparitäten zwischen Ost und West zugunsten der Neuen Länder verringern und nicht – wie manchmal behauptet – vergrößern. Ökonomische Machtkonzentrationen Abb. 5 Regionale Verteilung der größten Unternehmen Deutschlands (Firmensitz) 2007 © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Die Firmensitze der 300 größten Unternehmen und der DAX-Unternehmen konzentrieren sich auf die deutschen Metropolregio- 22 Thüringen +180 % Brandenburg +168 % Sachsen +158 % Sachsen-Anhalt +151 % Mecklenburg-Vorp. +141 % Bayern +66 % Hamburg +58 % Deutschland +58 % Hessen +53 % Baden-Württemberg +52 % Niedersachsen +47 % Bremen +45 % Saarland +45 % Nordrhein-Westfalen +43 % Rheinland-Pfalz +43 % Schleswig-Holstein +42 % Berlin +32 % Abb. 4 BIP-Wachstumsraten 1991–2008 © Wolfgang Walla, nach Daten des Statistischen Landesamts Baden Württemberg nen der »EU-Banane« und Hamburg (Eichhorn/Huter/Walla, S. 29). Die Entscheidungen, was und wo in Deutschland produziert und gehandelt wird, werden meistens im Westen gefällt. Das heißt, der Produktionsfaktor »decision making« kommt in den Neuen Ländern fast nur auf mittleren und unteren Ebenen der Großunternehmen und in mittelständischen Unternehmen vor. Wie die Bankenkrise verdeutlicht, können regionale Machtkonzentrationen sich dann in Nachteile wandeln, wenn Real- und Finanzwirtschaft auseinanderdriften, d. h. große Geldinstitute ihre Hauptaufgabe nicht mehr in der Kapitalausstattung der örtlichen Wirtschaft sehen. Zum »Solidarpakt Ost« musste 2008 über Nacht ein »Solidarpakt Banken« geschaffen werden. Die Auswirkungen in Ost und West sind bereits sichtbar: Kurzarbeit in Automobilindustrie, Investitionszurückhaltung auf breiter Front, Zerfall von Tarifgemeinschaften und reduzierte Bankmanagergehälter. Bruttowertschöpfung in Ost und West Die Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen (BWS) stieg von 1991 bis 2008 von 1,4 auf 2,2 Billionen EUR, das heißt jährlich um 47 Milliarden EUR. Dabei verschoben sich die Regionalanteile an der BWS zugunsten der Neuen Länder und zulasten der Alten Länder und Gesamt-Berlins. Am deutlichsten verlagerten sich die Anteile der BWS in jene Wirtschaftszweige, in denen alle ehemals durch einen Zentralplan gelenkten Volkswirtschaften besondere Defizite hatten, in den Bereich »Finanzierung, Vermietung und unternehmensnahe Dienstleistungen«. Erkauft wurde die insgesamt positive Entwicklung allerdings mit einem enormen Abbau von Arbeitsplätzen, mit einer bis heute anhaltenden Abwanderung in Richtung Westen und mit extrem schnell sinkenden Geburtenraten. Was kostet die Wiedervereinigung? Der für fast jeden Steuerzahler spürbare Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent auf die Einkommen-, Kapitalertrags- und W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i n O s t - u n d W e s t d e u t s c h l a n d s e i t 19 8 9 D&E Heft 58 · 2009 Körperschaftsteuer ist eine nicht zweckgebundene Zusatzsteuer, um die Kosten der deutschen Wiedervereinigung zu finanzieren. Er wird seit 1991 erhoben und steht allein dem Bund zu. Ein detaillierter und exakter Verwendungsnachweis ist nicht möglich, was unter anderem vom Bund der Steuerzahler und Teilen der Presse beklagt wird. Der »Aufbau Ost« und die Solidarpakte I und II werden auch deshalb häufig als Fässer ohne Boden dargestellt. Eine buchhalterische Darstellung der Kosten der Wiedervereinigung bzw. des Solidarpaktes ist aber auch deshalb nicht möglich, da weder die Ströme von Waren und Dienstleistungen, noch die Nutznießer hinreichend quantifizierbar sind. So kommen beispielsweise die neuen Autobahnen oder Aufwendungen für Forschung und Bildung nicht nur den Neuen Ländern zugute, sondern allen, die direkt oder indirekt die Verkehrs- oder Bildungsinfrastrukturen nutzen. Und bei Investitionsförderungen werden private und kommunale Unternehmen gefördert und nicht Bundesländer. Eigentümer vieler der »abgewickelten« volkseigenen Betriebe und Unternehmen wurden »Käufer« aus den Alten Ländern und Westeuropa. Unter diesen zählen etliche zu den größten und den DAX bzw. M-DAX – also West-Unternehmen (| Abb. 5 |). Die Aufrechnung von Sozialtransfers ist ebenso abwegig, denn die laufen auch relativ mehr in die alten Bundesländer, wie die Sozialhilfequoten beispielhaft offenbaren. Dem gesamten »Brutto« müsste ein gesamtes »Netto« gegenüberstehen, und das gibt es nicht. Verlässliche, wenn auch nur partielle Strukturdaten, für den Mitteltransfer bietet jedoch der Länderfinanzausgleich: Von 1995 bis 2007 übertrugen die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen 91 Mrd. EUR. Dabei gingen an die Neuen Länder 42 Mrd., an Gesamt-Berlin 33 Mrd. und an bedürftige Alte Länder 16 Mrd. EUR. Öffentliche und private Verschuldung im Osten und Westen Die Verschuldung der Länder, Kommunen und Zweckverbände hat sich – bezogen auf die Landesbevölkerung – in den Neuen und Alten Ländern im Laufe weniger Jahre an das »Westniveau« angepasst. Die extreme Verschuldung Berlins ist vor allem auf den Wegfall der Berlin-Förderung (West) und den Beinahezusammenbruch der Bankgesellschaft Berlin im Jahr 2001 zurückzuführen. Das private Armutsrisiko hatte 2008 in Ost und West zwar den niedrigsten Wert seit dem Mauerfall erreicht, dennoch war jeder zehnte Erwachsene 2008 nicht in der Lage, seine Schulden in absehbarer Zeit zu begleichen, da ihm weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung standen. Die Spreizung der Schuldnerquoten zwischen den Neuen und den Alten Ländern lag 2008 nur noch bei 0,1 Prozent. Ob und wie die Banken- und Wirtschaftskrise sich auf die Überschuldungsquoten auswirkt, kann derzeit statistisch noch nicht festgestellt werden. Immerhin befürchtete im November 2008 die Hälfte der hiesigen Bevölkerung sinkende Einkommen (ARD-Deutschlandtrend 07.11.2008). »Die Gründe für den aktuellen Rückgang der Verbraucherinsolvenzverfahren liegen aber weniger in einem realen Rückgang des Bedarfs, als vielmehr in einer Überlastung der Schuldnerberatungsstellen und Kürzungen bei den Beratungsmaßnahmen« (Microm u. a., 2008, S. 17). Da in den Neuen Ländern die Schuldnerberatung intensiver betrieben wird als in den Alten Ländern (Blume, Eichhorn, Walla, 2007) dürften die realen Überschuldungsquoten im Osten unter jenen im Westen liegen. Die kleinräumigen Quoten offenbaren deutlich, dass wir es heute in Deutschland weniger mit West-Ost- als mit Süd-Nord-Gefällen zu tun haben. Die regionalen Disparitäten – und nicht nur die hier dargestellten – deuten auf andere Konvergenznotwendigkeiten als die zwischen den Neuen und den Alten Ländern hin. Wirtschaftskraft, Finanzkraft, öffentliche und private Verschuldung bedürfen eines Solidaritätsbewusstseins, dessen Blicke auf klein- und kleinsträumige soziale und ökonomische Ungleichgewichte und Brennpunkte gerichtet sind. D&E Heft 58 · 2009 Abb. 6 Schuldneratlas der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2008. © Creditreform Literaturhinweise Blume, Christian; Eichhorn, Lothar; Walla, Wolfgang, (2007): Verbraucherinsolvenzen 2006 in den kreisfreien Städten und Landkreisen Deutschlands, Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg, 9/2007 BMF (Hrsg.) (2009): Der bundesstaatliche Finanzausgleich, Kap. 5.4 Daten zur horizontalen Umsatzsteuerverteilung, zum Länderfinanzausgleich und zu den Bundesergänzungszuweisungen (Aktuelle Fassung) Enkelmann, Dagmar (2006): Solidarpakt allein reicht nicht, zur Großen Anfrage »Zum Stand der Deutschen Einheit und der perspektivischen Entwicklung bis zum Jahr 2020« Pressemitteilung 18.12.2006 – (DS 16/3581) Eichhorn, Lothar/ Huter, Jessica /Walla Wolfgang (2008),: Regionalstruktur der wirtschaftlichen Machtverteilung der Sitze der Großunternehmen in Europa, Deutschland und Baden-Württemberg,: Statistisches Monatesheft Baden-Württemberg, 5/2008, Gorbatschow, Michail (1987): Perestroika – Die zweite russische Revolution, Droemer Knaur, München, S. 104 Microm, CEG, Creditreform (2008), Schuldneratlas Deutschland Jahr 2008 Internethinweise www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/ThemenAZ/AufbauOst (Informationen der Bundesregierung) www.creditreform.de/…._SchuldnerAtlas_Deutschland_2008.pdf (Schuldneratlas) www.ddr-wissen.de/wiki/ddr.pl (private Homepage zur DDR-Geschichte) www-genesis.destatis.de/genesis/ (Statistisches Bundesamt – Bund-Länder-Statistikern) www.regionalstatistik.de/genesis/online (Offizielle Regionalstatistiken) www.ifm-bonn.org (Unternehmensgründungen) W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i n O s t - u n d W e s t d e u t s c h l a n d s e i t 19 8 9 23 WOLFGANG WALLA 24 MATERIALIEN M 1 Fernsehansprache von Bundeskanzler Helmut Kohl anlässlich des Inkrafttretens der Währungs-, Wirtschaftsund Sozialunion, 1. Juli 1990 Liebe Landsleute, vor wenigen Wochen wurde der Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik unterzeichnet (…). Seit heute ist er in Kraft. Dies ist der entscheidende Schritt auf dem Weg zur Einheit unseres Vaterlandes, ein großer Tag in der Geschichte der deutschen Nation. Jetzt wird für die Menschen in Deutschland – in wichtigen Bereichen ihres täglichen Lebens – die Einheit erlebbare Wirklichkeit. Der Staatsvertrag ist Ausdruck der Solidarität unter den Deutschen. Die Deutschen in der Bundesrepublik und in der DDR sind jetzt wieder unauflöslich miteinander verbunden. Sie sind es zunächst durch eine gemeinsame Währung, durch die gemeinsame Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft. Sie werden es bald auch wieder in einem freien und vereinten Staat sein. Die Deutschen können jetzt auch wieder ungehindert zueinander kommen. Seit heute herrscht an der Grenze freie Fahrt. Wir freuen uns darüber; über 40 Jahre haben wir Deutschen darauf gewartet. (…) Der Staatsvertrag dokumentiert den Willen aller Deutschen, in eine gemeinsame Zukunft zu gehen: in einem vereinten und freien Deutschland. Es wird harte Arbeit erfordern, bis wir Einheit und Freiheit, Wohlstand und sozialen Ausgleich für alle Deutschen verwirklicht haben. Viele unserer Landsleute in der DDR werden sich auf neue und ungewohnte Lebensbedingungen einstellen müssen – und auch auf eine gewiss nicht einfache Zeit des Übergangs. Aber niemandem werden dabei unbillige Härten zugemutet. Den Deutschen in der DDR kann ich sagen, was auch Ministerpräsident de Maizière betont hat: Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor – dafür vielen besser. Nur die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion bietet die Chance, ja die Gewähr dafür, dass sich die Lebensbedingungen rasch und durchgreifend bessern. (…) Natürlich fragen sich viele, was dieser beispiellose Vorgang für sie ganz persönlich bedeutet – für ihren Arbeitsplatz, ihre soziale Sicherheit, für ihre Familien. Ich nehme diese Sorgen sehr ernst. Ich bitte die Landsleute in der DDR: Ergreifen Sie die Chance, lassen Sie sich nicht durch die Schwierigkeiten des Übergangs beirren. Wenn Sie mit Zuversicht nach vorn blicken und alle mit anpacken, werden Sie und wir es gemeinsam schaffen. Für das große Ziel der Einheit unseres Vaterlandes werden auch wir in der Bundesrepublik Opfer bringen müssen. Ein Volk, das dazu nicht bereit wäre, hätte seine moralische Kraft längst verloren. Die Deutschen in der Bundesrepublik rufe ich dazu auf, unseren Landsleuten in der DDR weiterhin zur Seite zu stehen. Denken Sie daran: Die Menschen in der DDR sind vier Jahrzehnte durch eine sozialistische Diktatur um die Früchte ihrer Arbeit betrogen worden. Sie verdienen unsere Unterstützung. Für die Menschen in der Bundesrepublik gilt: Keiner wird wegen der Vereinigung Deutschlands auf etwas verzichten müssen. Es geht allenfalls darum, Teile dessen, was wir in den kommenden Jahren zusätzlich erwirtschaften, unseren Landsleuten in der DDR zur Verfügung zu stellen – als Hilfe zur Selbsthilfe. Dies ist für mich ein selbstverständliches Gebot nationaler Solidarität. Es ist zugleich eine Investition in unsere gemeinsame Zukunft. Denn der wirtschaftliche Aufbruch in der DDR wird allen zugute kommen – den Deutschen in Ost und in West, unseren Partnern in Europa und weltweit. (…) © Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Nr. 86. 3. Juli 1990, S. 741f M 2 Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland seit 1991 Preisbereinigte Bruttowertschöpfung in den Neuen Ländern, Alten Ländern und Gesamt-Berlin nach ausgewählten Wirtschaftszweigen 1991 = 100 Neue Länder Alte Länder Gesamt-Berlin (1) Bruttowertschöpfung insgesamt 200 150 100 50 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 (2) Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 200 150 100 50 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 (3) Verarbeitendes Gewerbe 400 350 300 250 200 150 100 50 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 (4) Baugewerbe 200 150 100 50 0 91 92 93 94 (5) Finanzierung; Vermietung und Unternehmensdienstleister 400 350 300 250 200 150 100 50 91 92 93 94 95 96 97 98 99 W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i n O s t - u n d W e s t d e u t s c h l a n d s e i t 19 8 9 00 01 02 03 D&E 04 05 06 07 08 Heft 58 · 2009 Angaben zu M 2: M 4 Kenndaten zur Entwicklung in Thüringen 1991 – 2008 Die Bruttowertschöpfung umfasst den Wert der wirtschaftlichen Leistung der Wirtschaftseinheiten bzw. der Wirtschaftsbereiche innerhalb einer bestimmten Periode. Die Bruttowertschöpfung errechnet sich wie folgt: (1) Betriebe nach Größenklassen Betriebe mit 20 bis zu 249 Beschäftigten Betriebe mit 250 und mehr Beschäftigten 1750 Produktionswert zu Herstellungspreisen – Vorleistungen = Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 1500 1250 Die Produktionswerte der Unternehmen stellen den Wert der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen aus eigener Produktion sowie (Verkäufe) von Handelsware an in- und ausländische Wirtschaftseinheiten dar, vermehrt um den Wert der Bestandsveränderung an Halb- und Fertigwaren aus eigener Produktion und um den Wert der selbst erstellten Anlagen. Unter Vorleistung ist der Wert der Waren und Dienstleistungen zu verstehen, die inländische Wirtschaftseinheiten von anderen inund ausländischen Wirtschaftseinheiten bezogen und im Berichtszeitraum im Zuge der Produktion verbraucht haben. Die Vorleistungen umfassen außer Rohstoffen, sonstigen Vorprodukten, Hilfs- und Betriebsstoffen, Brenn- und Treibstoffen und anderen Materialien auch Bau- und sonstige Leistungen für laufende Reparaturen, ge-werbliche Mieten, Leiharbeitnehmer, von anderen Unternehmen durchgeführte Lohnarbeiten, Transportkosten, Postgebühren, Anwaltskosten, Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen usw. 1000 750 500 250 0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 (2) Bruttolohn und -gehalt je Beschäftigten in 1000 Eur in % des Umsatzes 25 46 38 20 M 3 Nationaleinkommen – vergleichbare Preise (Basis 1985) 27 15 Produziertes Nationaleinkommen je Berufstätigen in den produzierenden Bereichen der DDR, 1960 = 100 Nationaleinkommen Veränderung zum Vorjahr in % – Polynomischer Trend 4. Grades 24 23 22 21 20 20 21 21 22 22 21 21 20 20 20 10 350 7% 0 6% 300 5% 250 4% 25 5 91 92 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 (3) Beschäftigte und täglich geleistete Arbeitsstunden je Beschäftigten Beschäftigte in 1000 Täglich geleistete Arbeitsstunden je Beschäftigten 350 300 6,6 3% 200 93 7,0 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,4 7,3 7,2 7,2 7,1 7,2 7,2 7,3 250 2% 200 4,9 150 150 1% 100 50 100 0 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 © Wolfgang Walla, nach GENESIS Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen, Statistische Ämter der Länder, »Volkswirtschaftliche Gesamtrechungen der Länder«, 2008 0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 © Wolfgang Walla, nach Daten des Landesamts für Statistik in Thüringen, eigene Berechnungen D&E Heft 58 · 2009 W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i n O s t - u n d W e s t d e u t s c h l a n d s e i t 19 8 9 WOLFGANG WALLA 26 M 5 Bundespräsident Horst Köhler beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit am 03.10.2008 in Hamburg Die DDR ist Vergangenheit. Dabei vergessen wir nicht, dass die einzelnen Geschichten der Menschen in der DDR nicht nur vom System und seinem Unrecht geprägt waren. Die meisten haben hart gearbeitet, viel geleistet, sie haben sich umeinander gekümmert, miteinander gelebt, gelitten und gefeiert. Es gab in der DDR Glück, Erfolge und Erfüllung. Nicht wegen, sondern oft trotz der SED-Diktatur. Deshalb bitte ich um Anerkennung und Respekt für die Menschen, die in der DDR ihren Weg gegangen sind, ohne sich schuldig zu machen. Dann kam die Wende, und vieles stürzte auf uns ein. Ich war mittendrin und M 6 »Kunststück – Aufbau Ost«. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) zum Aufbau Ost. im Rückblick sage ich: Praktisch war es un© Paolo Calleri, 2004 möglich, im Vereinigungsprozess immer genau zu wissen, was die richtige Entscheidung ist. Und deshalb wollen wir nicht länger M 7 Der SPIEGEL: Arbeitsplätze im Osten so tun, als sei alles immer nur richtig gewesen. Ich stoße heute in Ostdeutschland auf viel Freude am Erreichten, auf Stolz an der eiNach jahrelanger Flaute entstehen in den neuen Ländern doch genen Leistung und auf Selbstbewusstsein. Sicher: Manches daunoch blühende Landschaften: Die Industrie wächst überdurchert länger als gedacht, es gab und gibt Härten und Enttäuschunschnittlich, die Milliardeninvestitionen zahlen sich endlich aus. gen. Doch wer die Augen aufmacht, der sieht: Wir haben viel (…) Wissenschaftler attestieren dem lang ersehnten Aufschwung erreicht. Vielleicht ist es weniger, als manche in der ersten Euphobeachtliche Robustheit. Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung rie erhofft haben. In Wirklichkeit ist es sehr viel mehr, als manche in Dresden sagt für dieses und das nächste Jahr ein stärkeres sehen – oder sehen wollen. Und ich denke: Wir sind auf dem geWachstum der ostdeutschen Industrie gegenüber der westdeutmeinsam zurückgelegten Weg erwachsener geworden. (…) Die schen voraus. Die Wertschöpfung stieg 2007 in den neuen Ländeutsche Wirtschaft hat Kraft bewiesen, hat sich erholt und kann dern bereits um 11,2 Prozent, die Umsätze um fast 10 Prozent. Die im internationalen Wettbewerb wieder gut mithalten, was uns Arbeitslosenquote sank von 14,7 auf 12,8 Prozent. Bei den Neuinauch in der aktuellen Finanzkrise hilft. Der Lohn der Anstrengung vestitionen legte der Osten um fünf Prozent zu. Dem zarten in den letzten Jahren ist nicht zuletzt ein erfreulicher Rückgang Pflänzchen kann selbst die derzeitige Flaute nicht viel anhaben. der Arbeitslosigkeit. Keine Frage: Manche Arbeitnehmerinnen Dank der rasant steigenden Exporte nach Mittel- und Osteuropa und Arbeitnehmer mussten harte Anpassungen und zum Teil sind die Werke weitaus weniger anfällig für die amerikanisch auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse akzeptieren. Unser Ziel Konjunkturschwäche. Zudem steigen die Exporte innerhalb der ist natürlich gute Arbeit für alle. Und unser Ziel bleibt es, besonEU, weil sich ders energisch die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland abzudurch niedbauen, die noch immer doppelt so hoch ist wie im Westen. Ostrige Löhne deutschland wird darum weiter unserer besonderen und längere Unterstützung bedürfen. Ich freue mich, dass es darüber einen Arbeitszeiten parteiübergreifenden Konsens gibt. (…) die WettbewerbsfähigUnsere Nation steht vor großen Aufgaben. Es geht um Arbeit, die keit verbeswir schaffen müssen; um Bildung, die allen gerechte Chancen sert hat. Das gibt; um Integration, die uns zusammenhält: Stadt und Land, Ost Institut für und West, Alt und Jung, Arm und Reich, einheimisch und mit WurWirtschaftszeln von weit her. Vor diesen Aufgaben braucht uns nicht bange forschung zu sein. Unser Land hat ja selbst in der jüngsten Geschichte weit Halle spricht größere Herausforderungen gemeistert – nach 1945, nach 1989. von einer Außerdem: Wir haben ja noch nicht einmal alle Kräfte erschlos»Re-Industrisen, die uns bei den neuen Aufgaben helfen werden. Dabei denke alisierung« ich zum Beispiel an die Vitalität und Erfahrung der Älteren unter uns, die sowohl im Arbeitsleben als auch im bürgerschaftlichen © Der SPIEGEL Engagement eine viel größere Rolle spielen können und spielen 38/2008, S. 56 sollten. Und ich denke an die Frauen in Deutschland, deren Gleichberechtigung in Familie, Beruf und Karriere noch längst nicht völlig verwirklicht ist. © www.bundespraesident.de M 8 SPIEGEL-Grafik 38/2008 © DER SPIEGEL W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i n O s t - u n d W e s t d e u t s c h l a n d s e i t 19 8 9 D&E Heft 58 · 2009 M 9 Arbeitsplätze im Osten M 12 Konvergenzentwicklung Die neuen Länder können die Liquidationsfolgen des industriellen Komplexes der DDR-Wirtschaft nicht bewältigen. Seit 1991 ging mehr als jeder 2. Industriearbeitsplatz verloren. Abweichung des Bruttoinlandsprodukts in jeweiligen Preisen je Einwohner vom Bundesdurchschnitt in % Neue Länder Alte Länder Gesamt-Berlin 20% Keine Wende in Sicht Arbeitnehmer im verarbeitenden Gewerbe Ostdeutschland (ohne Berlin) 1991 gleich 100 100 10% 0% -10% 64 -20% 54 51 50 48 47 48 47 47 48 47 47 46 46 46 48 -30% -40% -50% -60% 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 -70% © Wolfgang Walla, eigene Berechnungen, nach Angaben des SPIEGEL 38/2008 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 © Wolfgang Walla, Daten nach »Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2008 M 10 Aufschwung im Osten nicht angekommen Ostdeutschland hat nach Einschätzung des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) in den Jahren des Aufschwungs nicht aufholen können. Die Schere zwischen Ost und West gehe sogar wieder auseinander, sagte der IWH-Konjunkturchef Udo Ludwig der »Leipziger Volkszeitung« am Mittwoch. So liege das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nach wie vor bei rund 67 Prozent des Westniveaus. Das liege vor allem daran, dass der Aufschwung der vergangenen Jahre im Osten nicht voll angekommen sei. Die Ursache dafür ist laut Ludwig, dass der Impuls für das höhere Wachstum vom gestiegenen Export verursacht worden sei, der im Osten eine deutlich geringere Rolle spiele. Während die Exportquote in den alten Ländern bei über 30 Prozent liege, betrage sie in Ostdeutschland rund 23 Prozent. In den ersten sechs Monaten 2008 lag das Wirtschaftswachstum in Ostdeutschland bei 1,8 Prozent, während es in Westdeutschland 2,4 Prozent betrug, sagte der Wirtschaftsforscher der Zeitung. In diesem Jahr rechnet er für den Osten mit einer deutlich geringeren Wachstumsrate als die erwarteten 1,8 Prozent für den Westen. © dpa-Meldung vom 24.09.08 M 11 Unternehmensgründungen und Liquidationen in den Neuen Ländern 1991–2008 Gründungen Liquidationen 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 M 13 Solidarpakt allein reicht nicht Zur Großen Anfrage »Zum Stand der Deutschen Einheit und der perspektivischen Entwicklung bis zum Jahr 2020« (DS 16/3581) der Fraktion DIE LINKE erklärt deren parlamentarische Geschäftsführerin Dagmar Enkelmann: Vor den Folgen eines wachsenden sozialen Unfriedens im Osten, darunter vermehrter Fremdenfeindlichkeit warnt eine neue Studie. In den neuen Ländern zu arbeiten, heißt immer stärker, mehrere Minijobs zu kombinieren, stellt die jüngste Untersuchung aus der Bundesagentur für Arbeit fest. Diese Entwicklungen zeigen: Auch mit der kürzlichen Einigung über den sogenannten Korb 2 des Solidarpakt II hat sich die Debatte um die Zukunft der neuen Länder keineswegs erledigt. Im Gegenteil: Zwar reicht der Solidarpakt II bis 2019, die Zahlungen an die neuen Länder gehen aber schon ab 2009 drastisch zurück. Zwar wächst die Industrie im Osten, insgesamt aber klafft die Ost-West-Schere nicht nur bei der Wirtschaftsleistung weiter auseinander, sondern vor allem bei Löhnen, Renten und anderen Einkommen. Und das, obwohl der Produktivitätszuwachs in den neuen Ländern höher als im Westen ist. Von der Großen Koalition wird der Aufbau Ost – wie schon von Rot-Grün – stiefmütterlich behandelt. Union und SPD wollen sich im Wesentlichen mit einer »Weiter-So«-Politik durchmogeln. DIE LINKE hat deshalb jetzt eine Große Anfrage zum Stand der Deutschen Einheit und zu den Perspektiven der neuen Länder bis zum Jahr 2020 (DS 16/3581) auf den Weg gebracht. Die Bundesregierung steht in der im Grundgesetz verankerten Pflicht, Verantwortung für gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West zu übernehmen. Die Linksfraktion fordert die Bundesregierung deshalb auf, konkrete Konzepte vorzulegen, wie im Osten in den nächsten anderthalb Jahrzehnten eine selbsttragende wirtschaftliche Entwicklung erreicht werden kann. Und sie fordert einen Fahrplan zur Angleichung der Lebensverhältnisse. Die Antwort der Bundesregierung ist für Ende Mai angekündigt, sodass sie voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2007 im Bundestag debattiert wird. © Dagmar Enkelmann, Die Linke, 18.12.2006, www.bundestag.de © Wolfgang Walla, nach Daten des Statistischen Bundesamts, und des IFM Bonn 4/2009 D&E Heft 58 · 2009 W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g i n O s t - u n d W e s t d e u t s c h l a n d s e i t 19 8 9 27 II. 20 JAHRE MAUERÖFFNUNG IN DEUTSCHLAND 4. »Die DDR wird abgewickelt« – 20 Jahre deutsche Einigung ROLAND CZADA W eniger als ein Jahr nach dem Mauerfall wurde die nach dem 2. Weltkrieg zwischen Elbe und Oder entstandene sozialistische deutsche Republik staatsrechtlich »abgewickelt«. In einer historischen Sekunde, am 3. Oktober 1990, 0:00 Uhr, sind die auf ihrem Territorium entstandenen Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie der Ostteil Berlins der westdeutschen Bundesrepublik beigetreten. Auch wenn die DDR als Staat nicht mehr besteht, hat sie sich nicht aus der Geschichte verabschiedet. Ihr Erbe lebt fort in der Politik, in der Kultur, in Medien und politischen Einstellungen, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen der neuen »Berliner Republik«. Als besonders folgenreich und bis heute nicht abgeschlossen hat sich die wirtschaftliche Vereinigung herausgestellt. Die Übertragung der »sozialen Marktwirtschaft« in das ehemals sozialistische Beitrittsgebiet ist den in sie gesetzten hohen Erwartungen nicht gerecht geworden. Obwohl zu Beginn des Einigungsprozesses noch viele daran glauben wollten, gab es kein zweites deutsches Wirtschaftswunder. Im Gegenteil: Die immensen Kosten des »Aufbaus Ost« belasten noch heute, zwanzig Jahre nach dem Mauerfall, die Wirtschaft und die Steuerzahler in ganz Deutschland. 28 Die Spuren der DDR im vereinten Deutschland Die untergegangene DDR hat Spuren hinterlassen, die das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Leben in Deutschland bis heute und auf absehbare Zeit prägen. Der Föderalismus funktioniert mit 16 wirtschaftlich höchst unterschiedlich leistungsfähigen Bundesländern anders als in den elf alten Ländern der Bundesrepublik. Vereinigungsbedingte Veränderungen im Parteiensystem und im Wahlverhalten haben zur Komplizierung der politischen Verhältnisse beigetragen. Wirtschaftlich und sozial, das zeigen Umfrage- und Wirtschaftsdaten, ist Deutschland immer noch ein geteiltes Land. Die Frage, warum das nach vierzigjähriger Teilung vereinte Land nicht so rasch wie ursprünglich erhofft zusammenwuchs, hat weniger mit Mentalitätsbarrieren zu tun als mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Neuen Bundesländer. Bei den Eliten in Politik, Verwaltung, Kultur, Kirchen, in den Sportverbänden und Gewerkschaften ist die Integration stetig vorangeschritten. Von einem gesellschaftlichen und politischen Repräsentationsdefizit der Neubürger aus dem Osten kann keine Rede sein. Die derzeitige CDU-Vorsitzende und erste deutsche Bundeskanzlerin stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. Gleichwohl ist die Zahl der Unzufriedenen angewachsen. Offenbar sind die Erwartungen vieler Bürger enttäuscht worden, die nun Unmut und Zweifel an der Leistungsfähigkeit demokratischer und marktwirtschaftlicher Politik äußern. Der Grund liegt weniger in einer Mentalität der Übellaunigkeit, wie sie den Deutschen gelegentlich von Journalisten, Demoskopen und Parteienforschern nachgesagt wird, als in den wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen, mit denen das Land seit Mitte der 1990er-Jahre zu kämpfen hat. Sie sind großteils von den Schwierigkeiten und Kosten des »Aufbaues-Ost« verursacht. Abb. 1 »Hurra, der Neue!« © Horst Haitzinger, 18.9.1990 »Das Unmögliche wagen« Die größte Herausforderung der deutschen Vereinigung bestand darin, die sozialistische Planwirtschaft der DDR in eine soziale Marktwirtschaft nach dem Vorbild der westdeutschen Bundesrepublik umzuwandeln (| Abb. 1 |). Im Frühjahr 1990 übernahm die Berliner »Treuhandanstalt« (THA) nahezu das gesamte »Volkseigentum« der damals noch bestehenden DDR. Dies waren 45.000 Betriebsstätten in 8.000 Firmen mit vier Mio. Beschäftigten. Hinzu kamen 20.000 Gaststätten und Ladengeschäfte, nahezu 2.000 Apotheken, 390 Hotels und zahlreiche Kinos. Weiterhin übernahm die Treuhandanstalt Betriebe der Energie- und Wasserversorgung sowie des öffentlichen Nahverkehrs und 2,4 Mio. Hektar land- und forstwirtschaftliche Flächen, das Vermögen und die Liegenschaften des Ministeriums für Staatssicherheit und der Nationalen Volksarmee und nicht zuletzt eine große Zahl von Häusern und Wohnungen sowie das Vermögen der Parteien und Massenorganisationen. Man hat vor diesem Hintergrund die Treuhandanstalt als die größte Unternehmensholding der Welt bezeichnet. Sie hatte die Aufgabe, das in ihren Besitz gelangte öffentliche Vermögen so schnell wie möglich in Privateigentum überzuführen. Wo sich keine Käufer finden ließen, zumeist im Fall abgewirtschafteter, nicht mehr konkurrenzfähiger Industrieanlagen, sollten diese saniert oder, wenn auch dies keinen Erfolg versprach, endgültig abgewickelt werden. Dabei lautete die Leitlinie: »Schnelle Privatisierung – entschlossene Sanierung – behutsame Stilllegung«. Durch die zu einem Wechselkurs von 1:1 erfolgte Einführung der D-Mark war die Wirtschaft der jungen Bundesländer schlagartig der vollen Weltmarktkonkurrenz ausgesetzt. Der Großteil der dort produzierten Industriewaren war der Preis- und Qualitätskonkurrenz auf dem Weltmarkt nicht gewachsen. Um wenigstens einen Teil der Arbeitsplätze retten zu können, mussten diese Betriebe modernisiert werden. Die Treuhandanstalt begegnete dieser Herausforderung dadurch, dass sie Unternehmen nicht verkaufte, sondern verschenkte und darüber hinaus den neuen Eigentümern einen Großteil der Kosten für die Sanierung abnahm. Die Treuhandanstalt hatte nicht Unternehmen verkauft, sondern Unternehmenskonzepte gekauft: Privatisiert wurde an diejenigen Übernahmeinteressenten, deren Sanierungspläne den größten Erfolg » D ie D D R w ir d a b ge w i c k e lt« – 2 0 J a hr e d e u t s c he Eini g u n g D&E Heft 58 · 2009 versprachen. Hohe Kosten entstanden der THA darüber hinaus durch die Ausgründung von Beschäftigungsgesellschaften, die einen Großteil der im Privatisierungsprozess arbeitslos gewordenen Arbeitnehmer vorläufig aufnehmen sollten. Eine zusätzliche Belastung in Milliardenhöhe entstand durch die Beseitigung ökologischer Altlasten, die ebenfalls der THA aufgebürdet wurde. Politisch erfüllte die Treuhandanstalt eine wichtige Scharnierfunktion zwischen dem Bund als ihrem Eigentümer und den Neuen Bundesländern, deren Regierungen und Bevölkerung unmittelbar von den THA-Entscheidungen betroffen waren. Als die Treuhandanstalt zum 01.01.1995 aufgelöst bzw. in die »Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben« (BvS) überführt wurde, war der allergrößte Teil der sozialistischen DDR-Wirtschaft tatsächlich privatisiert, in Sanierung begriffen oder abgewickelt – »platt gemacht«, wie angesichts der damit einhergehenden hohen Arbeitslosigkeit und der entstehenden Industriebranchen vor allem protestierende Arbeitnehmer oft gesagt hatten (| M 1 |). Am Beginn der Treuhandtätigkeit war noch mit Privatisierungserlösen von 600 Mrd. DM gerechnet worden. Bürgerinitiativen und die Neuen Bundesländer stritten zunächst darüber, wer das DDRVermögen erhalten sollte. Bereits 1993 war indessen klar geworden, dass es keine Privatisierungserlöse geben würde, sondern stattdessen einen mehrere 100 Mrd. DM umfassenden Schuldenberg allein im Umfeld der Treuhandanstalt. Insgesamt werden die Kosten der Einheit, die vom Steuerzahler und den Beitragszahlern in der Sozialversicherung zu tragen waren, auf 1,2 bis 1,6 Bill. € geschätzt. Diese vom »Forschungsverbund SED-Staat« an der Freien Universität Berlin und dem »Hallenser Institut für Wirtschaftsforschung« ermittelte Größenordnung umfasst alle zwischen 1990 und 2004 an die ostdeutsche Wirtschaft, an die Gebietskörperschaften in Ostdeutschland und an Sozialeinkommensempfänger der Neuen Bundesländer geleisteten Zahlungen. Durch den im Jahr 2005 beginnenden Solidarpakt II werden bis ins Jahr 2019 weitere 150 Mrd. € in die Neuen Bundesländer transferiert. Hinzu kommt die interregionale Umverteilung in den Sozialversicherungssystemen. Allein die Rentenversicherungsträger überweisen pro Jahr etwa 15 Mrd. € von West nach Ost. Ein hoher Rentenanteil, insbesondere auch von Frührentnern, und eine über Jahre hinweg etwa doppelt so hohe Arbeitslosenquote wie in Westdeutschland sind die Ursachen dieser in den sozialen Sicherungssystemen versteckten interregionalen Transferleistungen. Das Durchschnittsalter von arbeitslos gewesenen Neurentnern pendelte in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre in Ostdeutschland um die 50 Jahre. »Wer soll das bezahlen?« Neben den Beitragszahlern in der Sozialversicherung, die ab Mitte der 1990er-Jahre jährlich 35 Mrd. € für Transferleistungen an Leistungsempfänger in den neuen Bundesländern aufbrachten, waren es ab 1993 das sogenannte »Föderale Konsolidierungsprogramm« und die Solidarpakte I und II, an deren Tropf die jungen Bundesländer genesen sollten. Das Föderale Konsolidierungsprogramm kann als ein Meisterwerk bundesstaatlicher Umverteilung bezeichnet werden. Die Maßnahmen – von der Aufstockung des Fonds »Deutsche Einheit« über Altschuldenhilfen für die Wohnungswirtschaft, eine Umsatzsteuerneuverteilung, Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen, Korrekturen am horizontalen Länderfinanzausgleich bis hin zur Neufassung eines Gemeindefinanzierungsgesetzes – waren so kompliziert wie der Name, den die Ministerialbürokratie dem Gesetz gegeben hatte: »Gesetz über Maßnahmen zur Bewältigung der finanziellen Erblasten im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit Deutschlands, zur langfristigen Sicherung des Aufbaus in den Neuen Ländern, zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und zur Entlastung der öffentlichen Haushalte« (BGBl 1993 I, S. 944). Bemerkenswert war, dass von diesem auf drei Jahre angelegten Programm auch die westdeutschen Kommunen mit etwa 3 Mrd. DM belastet wurden. Zur D&E Heft 58 · 2009 Abb. 2 Protestierende Arbeiter vor den Werkstoren der Märkischen Faser AG in Premnitz (Brandenburg) am 24.9.1992. Sie forderten ein neues Konzept von der Treuhand und der Landesregierung zur Erhaltung der Arbeitsplätze in dem privatisierten Betrieb. © picture alliance, dpa Finanzierung dieses Beitrags behalfen sich die Gemeinden nicht selten damit, dass sie die Kostendeckung ihrer Gebührenhaushalte in die Höhe schraubten. Die wenigsten Bürger werden erfahren haben, dass sie auf diese Weise über höhere Friedhofsund Abwassergebühren, höhere Beiträge für Kindergärten oder Teuerungen im öffentlichen Nahverkehr einen indirekten, im Gesamtrahmen allerdings eher bescheidenen Beitrag zur Finanzierung der Deutschen Einheit geleistet haben. Wenn von steuerfinanziertem West-Ost-Transfers die Rede ist, handelt es sich zumeist um Bruttobeträge. Die neuen Bundesländer und ihre Bürger weisen zu Recht darauf hin, dass sie als Steuerzahler an deren Aufbringung beteiligt sind. Aufgrund einer insgesamt schlechteren Arbeitsmarktlage und vor allem, weil die Durchschnittsverdienste im Osten immer noch deutlich unter denen im Westen liegen, bleibt allerdings dieser Eigenanteil geringer, als zunächst erwartet wurde. Neben der Verteilung der Kosten der deutschen Einheit auf die Sozialversicherungsträger und ihre Beitragszahler sowie auf den Bund und die westdeutschen Länder bzw. die Steuerzahler finden wir eine dritte Zahlergruppe, die den Löwenanteil dieser Kosten zu tragen hat: Es sind die jungen und kommenden Generationen, denen wir diese Last aufbürden. Die Staatsverschuldung ist nach 1990 steil angestiegen und hat sich im ersten Jahrzehnt der Einheit von 536 Mrd. € auf 1.198 Mrd. € verdoppelt (IM 2). Die 2005 einsetzende verstärkte öffentliche Schuldentilgung gelang vor dem Hintergrund einer Sozialstaats- und Steuerreform, die große Bevölkerungsteile als Verschlechterung ihrer sozialen Lage empfinden mussten. Blühende Landschaften ohne Wirtschaftswunder Was früher die DDR war, ist heute, 20 Jahre nach ihrem staatsrechtlichen Untergang, nicht wiederzuerkennen. Die öffentliche Infrastruktur, Straßen, Schienenwege, bürgerschaftliche Einrichtungen, Häuser, Schlösser und Parks, Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen sind tatsächlich »erblüht« und erwecken den Anschein eines insgesamt gelungenen Zusammenwachsens. Der bislang entrichtete und weiterhin anfallende Preis der Einheit gerät darüber leicht in Vergessenheit. Der Preis besteht in einer weiterhin klaffenden, wenngleich geringer werdenden Lücke zwischen dem, was von der ostdeutschen Wirtschaft produziert und von öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftsunternehmen sowie privaten Haushalten verbraucht wird. Diese Lücke, das Leistungs- » D ie D D R w ir d a b ge w i c k e lt« – 2 0 J a hr e d e u t s c he Eini g u n g 29 ROLAND CZADA wusste ebenso, dass ohne dieses Versprechen eine sofortige und massenhafte Abwanderung aus den jungen Bundesländern in die alten Bundesländer eingesetzt hätte. Dass trotz der enormen Aufbauleistung der Osten im Saldo von Zu- und Fortzügen über eine Million Einwohner an die westdeutschen Länder verloren hat, verdeutlicht das Risiko, das man bereits 1990 voraussah. Viele junge, gut qualifizierte Arbeitskräfte, vor allem junge Frauen aus Ostdeutschland, suchen nach wie vor im Westen eine berufliche Zukunft. Viele ländliche Regionen im Osten entleeren sich (| M 3 |). Die politischen und sozialen Folgen Abb. 3 Wann ist es den Deutschen am besten gegangen« in: »Superillu« © nach Daten des Demoskopischen Instituts in Allensbach. 30 bilanzdefizit der Neuen Bundesländer, betrug Mitte der 1990erJahre noch über 100 Mrd. € pro Jahr. Es ist zwischenzeitlich (2009) auf gut 40 Mrd. € gesunken, davon allein 35 Mrd. € in der Gestalt von Sozialtransfers. Diese Bilanz sieht etwas besser aus, wenn man die rund 300.000 ostdeutschen Pendler einbezieht, die im Westen arbeiten und dabei etwa 8 Mrd. € erwirtschaften. Addiert man diese Zahl zur ostdeutschen Wirtschaftsleistung – es handelt sich ja um Ostdeutsche, die diese Leistung erbringen – ist das Leistungsbilanzdefizit des Ostens sogar bereits auf gut 32 Mrd. € pro Jahr gesunken. Als der damalige Bundeskanzler Kohl in seiner Fernsehansprache zum Beginn der »Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion« dem deutschen Volk »blühende Landschaften« im Osten versprochen hatte, gab es nur wenige, die diese Zukunftsvision für übertrieben hielten. Diejenigen, die ihre Zweifel öffentlich machten, wie der damalige Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl oder der saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine, wurden »abgekanzlert« und ins vereinigungspolitische Abseits gedrängt. Dabei hatte die Europäische Kommission, von deren Präsident Jacques Delors sich Lafontaine beraten ließ, bereits im Februar 1990 ausgerechnet, dass die marktwirtschaftliche Modernisierung Ostdeutschlands den westdeutschen Steuerzahler über viele Jahre hinweg etwa zehn Prozent seines Einkommens kosten würde. Die Rechnung war einfach: Das reale mittlere Einkommen der Beschäftigten in Ostdeutschland betrug ein Viertel des westdeutschen Durchschnittslohns. Um die damalige Ost-West-Wanderung zu stoppen, hielt man es für notwendig, die Einkommen im Osten auf zwei Drittel des Westniveaus anzuheben. Zwei Drittel, so glaubte die Europäische Kommission, würden zu Anfang genügen unter der Voraussetzung, dass die DDR-Bürger auf stetige Besserung im eigenen Land hoffen konnten. Wenn man diese kräftige Einkommenssteigerung im Osten auf die weit größere Zahl der Beschäftigten im Westen verteilt, so ergibt sich eine Belastung der westdeutschen Einkommen von zehn Prozent. Die Prognose war, dass bis hin zur Jahrtausendwende der »Zehnte« entrichtet werden muss, bis Ostdeutschland auf eigenen Füßen stehen würde. Zehn Prozent Lohnabgabe entsprachen zum damaligen Zeitpunkt 6,5 Prozent des Bruttosozialprodukts, auf die 1,5 Prozent öffentliche Transfers aufgeschlagen wurden, also insgesamt acht Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung oder etwa 200 Mrd. DM pro Jahr. Heute wissen wir, dass die West-OstTransfers öffentlicher Haushalte und »Parafisci« tatsächlich etwa zehn Prozent des Bruttosozialproduktes ausmachen. Und anders als in den Vorschlägen der damaligen EG-Kommission ist davon der größte Teil nicht durch eine Einkommensabgabe, sondern durch Schulden finanziert worden. Man kann davon ausgehen, dass Bundeskanzler Kohl im Jahr 1990 wusste, dass die »blühenden Landschaften«, die er versprach, nur aus öffentlichen und parafiskalischen (z. B. »Zwangsbeiträge in der Sozialversicherung«) Mitteln finanziert werden konnten. Er Nach 1989 haben die Wirtschaftskraft und die Arbeitseinkommen in allen westlichen Industrieländern kräftig zugelegt. Allein die Bundesrepublik Deutschland ist im internationalen Wohlstandsvergleich zurück gefallen. Das Volkseinkommen pro Einwohner der Bundesrepublik erreichte in der ersten Hälfte des Jahres 1990 knapp 20.000 DM pro Einwohner. Nach der zum 1. Juli in Kraft getretenen Währungs-, Wirtschaftsund Sozialunion mit der DDR waren es für die andere Jahreshälfte – wenn man West und Ost zusammengelegt und auf die gestiegene Bevölkerungszahl umrechnet – nur noch 17.700 DM je Einwohner. Eine solche Rechnung präsentierte Bundesfinanzminister Theo Waigel am 18. Januar 1993 der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, um sie auf die Solidarpaktverhandlungen einzustimmen. Als Ziel nannte er, die sozialen Standards der verringerten ökonomischen Leistungsfähigkeit anzupassen. Er konnte damals nicht absehen, wie dramatisch sich die Wirtschaftslage in den kommenden Jahren verschlechtern würde. Während Wirtschaft und Einkommen in allen Industrieländern kräftig wuchsen, geriet die Bundesrepublik in die längste ökonomische Stagnationsphase ihrer Geschichte. In der um Schweden, Finnland und Österreich erweiterten Europäischen Union belegte sie bald nur noch den achten Rang. Zugleich wurden die Sozialleistungen eingeschränkt und – anders als in den Nachbarländern – verharrten die Realeinkommen auf der Stelle. 1995 gab es in Deutschland erstmals mehr Sozialeinkommensempfänger (Früh- und Altersrentner, Empfänger von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfeempfänger) als sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer (| M 4 |). Gewiss lässt sich die Veränderung der ökonomischen und sozialen Verhältnisse nicht allein mit der deutschen Vereinigung und ihren Folgeproblemen erklären. Sie kommt allerdings immer dann als entscheidender Erklärungsfaktor in Betracht, wenn sich die deutsche Entwicklung deutlich von der anderer, vergleichbarer Länder unterscheidet. Nachhaltige Ost-West-Unterschiede zeigen sich 20 Jahre nach der staatsrechtlichen Vereinigung nicht nur in der Wirtschafts- und Regionalstruktur, sondern auch bei den politischen Einstellungen und Wahlergebnissen. Die deutsche Vereinigung hat bei Wahlen zunächst die CDU gestärkt, die im Osten vielfach als Partei der Einheit und der sozialen Marktwirtschaft empfunden wurde. Bald zeigte sich auch, dass auf der linken Seite des politischen Spektrums nicht die SPD, sondern die Nachfolgeparteien der SED, zunächst die PDS und dann die aus ihr mit hervorgegangene Partei »Die Linke« einen Wählerzuwachs für sich verbuchen konnte (| M 5 |). Diese wahlpolitische Besonderheit korreliert mit der sozialen Entwicklung in Ostdeutschland. Noch immer liegt das durchschnittliche verfügbare Monatseinkommen je Einwohner in den meisten ostdeutschen Landkreisen deutlich unter dem in den westlichen Bundesländern (| M 6 |). Während die privaten Konsumausgaben im Westen anstiegen, nehmen sie in Ostdeutschland seit 2000 nahezu kontinuierlich ab (| M 7 |). Das ausbleibende Wirtschaftswunder in Ostdeutschland, das bislang vergebliche Warten auf den selbsttragenden Aufschwung, schlägt sich in der Sozialstruktur und im politischen Verhalten nieder. Das Vertrauen in die Problemlösungskraft des politischen Systems und die Leis- » D ie D D R w ir d a b ge w i c k e lt« – 2 0 J a hr e d e u t s c he Eini g u n g D&E Heft 58 · 2009 tungsfähigkeit der sozialen Marktwirtschaft ist im Osten deutlich geringer ausgeprägt als im Westen. Gleichwohl findet die Mehrheit der Ostdeutschen (ab 2009: 58 Prozent), dass es den Menschen im wiedervereinigten Deutschland besser geht als in der untergegangenen DDR. Ihre Kritik gilt dem vermeintlich verlorenen Gleichheitsideal des sozialistischen deutschen Staates. Die meisten Ostdeutschen bewerten die Gleichheit höher als den Wert der Freiheit. In den westlichen Bundesländern ist es umgekehrt, obgleich laut Umfrageergebnissen des Allensbacher Institutes für Demoskopie seit einigen Jahren die Forderung nach mehr Gleichheit auch dort zunehmende Unterstützung findet. Vereint und doch geteilt? Während die DDR »abgewickelt« wurde, hat Abb. 4 Arbeitskräftepotenzial, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Wohlfahrtsempfänger in sich nicht nur der Osten, sondern vereiniDeutschland (1975–2005) © Roland Czada, nach Daten des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung: gungsbedingt das ganze Land verändert. In Statistisches Taschenbuch. Arbeits- und Sozialstatistik, 2000, 2002, 2003. 2006, 2008. Berlin, BMAS. vielen Bereichen haben sich Ost und West aufeinander zu bewegt, in vieler Hinsicht gedaten und Wahlergebnisse im Zusammenhang betrachtet, sind die einst getrennten Teile Deutschlands zusammengewachganz wesentlich von den Wohlstandsdifferenzen zwischen Ost sen. Die Rechtseinheit, die Währungseinheit, die soziale Einheit und West und zunehmend auch von regionaler und sozialer Unsind schon lange Wirklichkeit. Die Spuren der DDR sind im Alltag, gleichheit in Ostdeutschland gesteuert. Jedem Versuch, diese Dyauf den Straßen, in den Häusern und in den Sektoren Handel, namik politisch zu gestalten, ist bislang der Erfolg versagt geblieBanken und Verkehr nahezu ausgelöscht. Mit Ausnahme der ben. Ob dies an der Größe, vielleicht sogar Unmöglichkeit der Landwirtschaft leiden jedoch die meisten produktiven Sektoren Herausforderung liegt oder ob die richtigen politischen Konzepte nach wie vor an der Erblast der sozialistischen Planwirtschaft. Die noch nicht gefunden und politisch in geeigneter Weise umgeaus landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und setzt wurden, ist eine Frage, über die politisch auch heute, im 20. Staatsdomänen hervorgegangenen Agrarunternehmen erweisen Jahr der deutschen Vereinigung noch leidenschaftlich gestritten sich als gegenüber den in Westdeutschland vorherrschenden Fawird, und auf die auch eine inzwischen ausufernde wissenschaftmilienbetrieben als durchaus konkurrenzfähig. Für die verarbeiliche »Vereinigungsforschung« noch keine schlüssige Antwort tende Industrie lässt sich dies leider nur sehr eingeschränkt festfinden konnte. stellen. Abgesehen von einigen mit exportstarken Industrien gesegneten Wohlstandsinseln entwickelten sich große Teile der ehemaligen DDR zur Industriebrache. Insgesamt reicht die WirtLiteraturhinweise schaftskraft nicht aus, die eigenen Rentner und Arbeitslosen zu finanzieren. Daher sind die Neuen Bundesländer auf absehbare Fischer, Wolfram/Hax, Herbert/Schneider, Hans Karl (Hrsg.) (1993): TreuZeit auf Zuflüsse aus dem Westen angewiesen. handanstalt – Das Unmögliche wagen. Berlin: Akademie-Verlag. Deutschland ist nach 1989 insgesamt heterogener geworden. Dies betrifft die Politik, die Wirtschafts- und Sozialstruktur und Czada, Roland (1995): Der Kampf um die Finanzierung der deutschen Eindie gesellschaftlich-kulturelle Entwicklung gleichermaßen. Die heit. Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung MPIFG Discussion neue »Berliner Republik« gewinnt damit mehr Ähnlichkeit mit Paper 95/1. dem Deutschen Reich oder der Weimarer Republik als mit der Czada, Roland/Gerhard Lehmbruch (Hrsg.) (1998): Transformationspfade in Ostdurch ihre besondere soziale, regionale und politische Ausgeglideutschland; Beiträge zur sektoralen Vereinigungspolitik; Ffm Campus Verlag. chenheit gekennzeichnete alte Bonner Bundesrepublik. Die heutigen Verhältnisse sind weniger überschaubar, um nicht zu sagen, Czada, Roland/Hellmut Wollmann (Hrsg.) (2000): Von der Bonner zur Berliweniger beschaulich als sie es in den ersten Nachkriegsjahren im ner Republik. 10 Jahre Deutsche Einheit. Wiesbaden, Westdeutscher Verlag. Westen gewesen waren. Zwischen fünf Parteien im Bundestag ist Ritter, Gerhard A. (2006): Der Preis der Einheit. Die Wiedervereinigung und es schwieriger, Regierungskoalitionen zu schmieden, als in dem die Krise des Sozialstaats. München, C. H. Beck Verlag. Zweieinhalb-Parteiensystem der alten Bundesrepublik. Die »Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse« im ganzen Land, wie sie das Seibel, Wolfgang (2005): Verwaltete Illusionen. Die Privatisierung der DDRGrundgesetz vor seiner Novellierung im Jahr 1993 noch gefordert Wirtschaft durch die Treuhandanstalt und ihre Nachfolger 1990–2000. Ffm. hatte, ist im größer und vielfältiger gewordenen Deutschland zu Campus Verlag. einem unerreichbaren Ziel geworden. Mit Bedacht ist daher die Weidenfeld Werner/Karl-Rudolf Korte (Hrsg.) (1999): Handbuch zur deutgemeinsame Verfassungskommission des Bundes und der Länder schen Einheit: 1949–1989–1999. Ffm, Campus Verlag. bereits in der ersten Phase des Vereinigungsprozesses von dieser Forderung abgerückt und hat stattdessen die »Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse« als neues Ziel ausgegeben. »GleichwerInternethinweise tigkeit«, kann auch heißen, dass man in einer ökonomisch rückständigen Region mit weniger Einkommen leben muss und dafür www.politik.uni-osnabrueck.de/download/dp95-1.pdf (Website der Unidie Leere des Raumes, Abgeschiedenheit und unberührte Natur versität Osnabrück, Lehrstuhl Prof. Czada) genießen kann. Die Veränderungsdynamik, die Deutschland im http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/gkg/mauerfall/vortraege/czada Zuge der Vereinigung erfasst hat, ist immer noch im vollen Gange. (Vortrag von Roland Czada auf der Comburg als Video) Sie wird, wenn man die Wirtschafts- und Sozialstatistik, Umfra- D&E Heft 58 · 2009 » D ie D D R w ir d a b ge w i c k e lt« – 2 0 J a hr e d e u t s c he Eini g u n g 31 bis unter 1290 1290 bis unter 1430 1430 bis unter 1520 M 1 »Die Vereinigung kostet die Bundesbürger den Zehnten« Kiel 1520 bis unter 1640 1640 und mehr Hamburg »Die Sanierung der DDR kostet die Arbeitnehmer in der Bundesrepublik zehn Prozent ihres Einkommens. Das müssen sie Brüsseler Berechnungen zufolge beisteuern, wenn soviel Kapital in den anderen deutschen Staat gepumpt werden soll, dass die Menschen dort keinen materiellen Grund mehr haben, ihn zu verlassen. Begleitet werden diese Transfers womöglich von einer empfindlichen Geldentwertung. Auf einer Klausurtagung am Wochenende im belgischen Gent kam die EG-Kommission zwar zu dem Schluss, dass diese Lasten geschultert werden müssten. Sie sieht in der angestrebten innerdeutschen Währungsunion jedoch ein hohes Risiko für das wirtschaftliche Wohlergehen der Bundesrepublik und somit der EG. Die Gemeinschaft, so heißt es, habe höchstes Interesse daran, die beiden deutschen Staaten in ihrem Einigungsprozess wirtschaftlich zu stabilisieren. Den 17 Kommissaren lagen in Gent Szenarien und Berechnungen vor, die von großem Verständnis, aber nicht von Optimismus geprägt waren. In den Gesprächen schälte sich heraus, dass der Übersiedlerstrom in die Bundesrepublik unbedingt gestoppt werden müsse, da er sonst noch mehr Arbeitslosigkeit erzeuge, das System der sozialen Sicherung unterminiere und die Wohnungsnot politisch unerträglich werden lasse. Eine Bundesrepublik in Schwierigkeiten könne die gesamte EG lahmlegen, von weiteren Fortschritten in der Integration ganz zu schweigen. Es führe deshalb wohl kein Weg an einer sofortigen innerdeutschen Währungsunion vorbei, in der in ihrer konsequentesten Form alle Guthaben und Verbindlichkeiten in der DDR im Verhältnis 1:1 in D-Mark umgetauscht werden. Vermutlich sei es zwar allein mit diesem Umtauschverhältnis möglich, die Einkommenserwartungen der DDR-Bürger halbwegs zu befriedigen. Es bedeute indes zugleich das Wagnis mit dem höchsten Risiko. In ihrer Rechnung über die Lasten, die auf die Bundesbürger zukommen, geht die Brüsseler Behörde davon aus, dass das reale mittlere Einkommen je abhängig Beschäftigtem in Ostdeutschland gerade ein Viertel des westdeutschen Reallohnes erreicht und auf zwei Drittel angehoben werden muss, wenn die Wanderung nach Westen zum Erliegen kommen soll. Zwei Drittel genügen, weil die Auswanderungswilligen aufrechnen müssen, was sie die Übersiedlung in die Bundesrepublik kostet, und zugleich auf Besserung im eigenen Land hoffen können. (…) Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zahl von Beschäftigten hüben Schwerin Szczecin Bremen Berlin Hannover Amsterdam Potsdam Magdeburg Düsseldorf Dresden Erfurt Liège Praha Wiesbaden Mainz Luxembourg Saarbrücken Stuttgart Strasbourg München 100 km Zürich © BBR Bonn 2009 ROLAND CZADA 32 Materialien Innsbruck M 3 Verfügbares Monatseinkommen je Einwohner, 2005 © Bundesamt für Raumordnung und Bauwesen und drüben ergibt sich der »Zehnte«, der zugunsten der Landsleute in der DDR berappt werden muss, und zwar etwa zwei, drei Jahre lang. Er nimmt dann über sieben, acht Jahre hinweg kontinuierlich ab, vorausgesetzt, die DDR entfacht tatsächlich ihr eigenes »Wirtschaftswunder«. (…) Es kann allerdings auch ganz anders kommen. Möglicherweise löst die konsequente Währungsunion mit ihren Einkommenstransfers die einen Probleme, während sie zugleich andere erst erzeugt. In Bonn wie in Brüssel veranschlagen die Sachverständigen die Produktivität in der DDR auf höchstens halb so hoch wie im westlichen Nachbarland. Folglich müssten die Löhne drüben niedrig bleiben, da Investoren sonst nicht auf hohe Rentabilität hoffen konnten. Vermutlich verlange die westliche Industrie, so meinen die Brüsseler, sogar eine zusätzliche Rentabilitätsprämie, wenn sie jenseits der Elbe Fabriken bauen sollen. Mithin ließen sich wohl am ehesten Niedriglohn-Industrien, wie die Textilbranche, anlocken. Drückt die Bundesrepublik nun aber das Lohnniveau der DDR hoch, so verlieren die neuen Unternehmen – zumal in einem Währungsgebiet harter, sich sogar aufwertender D-Mark – ihre Wettbewerbsfähigkeit, kaum dass sie angefangen haben zu produzieren. Das ist ein Teufelskreis: Bleibt die Lohntüte dünn, kommt die Industrie, aber es gehen die Menschen. © »mü«: Vereinigung kostet die Bundesbürger den Zehnten, in: Süddeutsche Zeitung, 19.2.1990, S. 21 M 2 Entwicklung des BIP je Einwohner in Ostdeutschland 1991–2006. Die Grafik zeigt deutlich die Entwicklung des Abstands zwischen West- und Ostdeutschland. © Arbeitskreis VGR der Länder, Berechnungen des ifo Instituts, zitiert aus: Ragnitz, Joachim (2009): Angleichung der Lebensverhältnisse in Ostdeutschland: Eine regional differenzierte Analyse. In: ifo Dresden berichtet 04/2009. » D ie D D R w ir d a b ge w i c k e lt« – 2 0 J a hr e d e u t s c he Eini g u n g D&E Heft 58 · 2009 M 7 Raummuster der Bevölkerungsentwicklung 2000–2008 © Leibniz-Institut für Länderkunde, Nationalatlas aktuell, Günter Herfert, http://aktuell.nationalatlas.de/Bevoelkerungsentwicklung-Ostdeutschland.2_02-2008.0.html M 4 Zweitstimmenanteil für »Die Linke« bei der Bundestagswahl 2009 © www.bundeswahlleiter.de M 5 » Der Osten hängt weiter am Tropf« 33 »Zwanzig Jahre nach dem Mauerfall liegen in Ostdeutschland derpolitik und forderte eine gezieltere Unterstützung von InnovaLicht und Schatten nah beieinander. Nach Meinung von Ökonotionen. Um der Abwanderung entgegenzuwirken, sprach sich men hat die Wirtschaft der neuen Länder in der WettbewerbsfäDIW-Präsident Zimmermann für die Anwerbung hochqualifizierhigkeit und der Produktivität erhebliche Fortschritte gemacht ter Ausländer aus, etwa aus den Nachbarländern Polen und und andere ehemalige Ostblockstaaten hinter sich gelassen. Tschechien. Der DIW-Fachmann Karl Brenke forderte eine ÜberDennoch gebe es weiter große Defizite: die hohe Arbeitslosigprüfung der Subventionen. In der Solarindustrie, deren Fertigung keit, die Abhängigkeit von Subventionen und Transfers und zu in Ostdeutschland konzentriert ist, werde jeder Arbeitsplatz mit wenig unternehmensnahe Forschung, heißt es in einer Studie des 150.000 Euro aus Steuermitteln unterstützt. »Ob dieser Aufwand »Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung« (DIW) zum Aufin angemessenem Verhältnis zum Ertrag steht, daran habe ich bau Ost. (…) Den Zahlen zufolge übersteigt die Höhe der im doch meine Zweifel.« Osten ausgezahlten Sozialleistungen noch immer das dortige © Christian Geinitz, FAZnet, 27.9.2009 Aufkommen an privater Einkommensteuer und Sozialabgaben. Noch immer ist der Anteil der Hartz-IV-Empfänger an den Erwerbsfähigen im Osten mehr als doppelt so hoch wie im Westen. In Berlin oder Sachsen-Anhalt ist jedes dritte Kind vom Arbeitslosengeld II seiner Eltern abhängig. (…) Gemessen jedoch an der wirtschaftlichen Substanz der DDR sei »das Glas mindestens zwei Drittel voll«. Den DIW-Zahlen zufolge betrug 1992 der Anteil des Ostens an der gesamtdeutschen Industrieproduktion nur 3,4 Prozent, heute sind es 10 Prozent. Die durchschnittliche Bruttowertschöpfung stieg von einem Viertel auf rund zwei Drittel des Westniveaus. Die Exportquote der ostdeutschen Wirtschaft verdreifachte sich auf 33 Prozent, was aber noch deutlich unter dem Westniveau liegt. (…) Der Magdeburger Wirtschaftsforscher KarlHeinz Paqué kritisierte die auf Infrastruktur, M 6 Entwicklung der Staatsverschuldung 1950–2009 © Bund der Steuerzahler Deutschland e. V. Maschinen und Anlagen ausgerichtete För- D&E Heft 58 · 2009 » D ie D D R w ir d a b ge w i c k e lt« – 2 0 J a hr e d e u t s c he Eini g u n g III. MAUERÖFFNUNG IN EUROPA 1. »Solidarnosc«, der »Runde Tisch« und erste demokratische Wahlen in Polen JOANNA BESZCYNSKA | RYSZARD KACZMAREK D as Jahr 1980 stellte zweifellos nicht nur in der polnischen, sondern auch in der europäischen Geschichte ein epochales Ereignis dar. Die nach 1945 von den Siegermächten des II. Weltkrieges gestaltete politische Konstellation in Europa, die vielen als äußerst stabil und unverletzlich schien, begann nunmehr zu zerfallen. Die Krise, die 1980 von Polen ihren Ausgang nahm, war dabei jedoch entgegen der Meinung der Mehrzahl der Journalisten und der westeuropäischen Politiker keineswegs nur das Ergebnis des wirtschaftlichen Zusammenbruchs des kommunistischen Polens. Die polnische friedliche Revolution war das Resultat einer Protestbewegung, die sich aufgrund 35-jähriger kommunistischer Regierungszeit in der polnischen Gesellschaft aufgestaut hatte und sich nach etlichen Niederlagen und Verbitterungen Anfang 1989 erfolgreich durchsetzen konnte. Die Krisen der Nachkriegszeit 34 Erste Proteste fanden bereits 1956 statt, als demonstrierende Arbeiter in Poznan (Posen) durch die schießende Polnische Armee auseinander getrieben wurden. Die neue Staatsführung versprach danach eine Veränderung des Regierungsstils und eine neue polnische Verfassung im Zeichen eines »realistischen Sozialismus«, verändert hatte sich aber nichts Grundlegendes. Die zweite Krise kam 1979 in der Folge der Neuregelung der deutschpolnischen Beziehungen, die in Deutschland »Ostpolitik« genannt wurde und mit dem Namen des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD) verbunden ist. Hier kam es auf den Danziger Straßen zu einem Blutbad unter Werftarbeitern, die gegen die Preiserhöhung von Lebensmitteln protestiert hatten. Das Amt des Regierungschefs bekleidete damals der Technokrat Edward Gierek, ehemaliger KP-Parteichef in Oberschlesien, der sich guter Kontakte zum Westen rühmte. Er versprach eine Modernisierung der polnischen Wirtschaft und eine Verbesserung der Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung in Polen. Dafür wurden Darlehen aus den USA aufgenommen. Ideologisch kapitulierte Gierek aber vor der UDSSR, hatte diese doch noch 1968 unter dem Staats- und Parteichef Breschnew jeden sozialistischen Sonderweg im Ostblock (»Breschnew-Doktrin«) mit Waffengewalt verhindert. 1976 wurden erneut Symptome der wiederkehrenden Krise sichtbar. Sie waren ein Ergebnis der Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, nicht zuletzt hervorgerufen durch die ausländischen Investitionen, die die sozialen Unterschiede in Polen weiter verschärften. Investitionen in den Bereichen Energie und Transport wurden sträflich vernachlässigt und der Zustand der Landwirtschaft glich einem Desaster. Die Suche nach immer höherer Effektivität in der landwirtschaftlichen Produktion, vor allem bei tierischen Produkten, führte zur Investitionskonzentration im Bereich der Mastschweinezucht. Bei fehlender Futterversorgung, die direkt aus dem Ausland bezogen werden musste, führte der trotz aller Investitionen herrschende Fleischmangel schließlich zu gesellschaftlichen Unruhen. Der Sejm, das polnische Parlament, nahm deshalb ein Gesetz zur Erhöhung der Lebensmittelpreise an, was weitere Arbeiterproteste zur Folge hatte. Wenn auch die Erhöhung der Lebensmittelpreise widerrufen wurde, initiierten die Ereignisse des Jahres 1976 doch erste Ansätze zu einer organisierten politischen Opposition, umso Abb. 1 Demonstration in Krakau am 18.10.1980: Solidarnosc-Mitbegründer Lech Walesa (Mitte) mit dem späteren ersten nichtkommunistischen Minister© picture alliance, dpa präsidenten Polens Tadeusz Mazowiecki des Jahres 1989 mehr als der wirtschaftliche Zusammenbruch gleichzeitig mit den Protesten der Intellektuellen zusammenfiel, die sich gegen eine Verfassungsänderung wehrten, mit der Polen den sozialistischen Charakter einer Volksrepublik und die Völkerfreundschaft zur UdSSR in der Verfassung festschreiben sollte. Die politische Opposition vor 1980 Ein »Komitee zur Verteidigung der Arbeiter« (Komitet Obrony Robotników – KOR) setzte sich zum Ziel, den Geschädigten und Verfolgten des Arbeiterprotests von 1976 zu helfen. Es wurde von einigen »Aktivisten für Demokratie und Unabhängigkeit« – zu denen u. a. Kuron, Michnik, Macierewicz gehörten, gegründet. Ein Jahr später entstand die »Bewegung für Verteidigung der Menschen- und Bürgerrechte« (»Ruch Obrony Praw Czlowieka i Obywatela«), eine unabhängige Vereinigung verschiedener demokratischer Strömungen, deren Mitglieder die Förderung der Menschenrechte, eine Demokratisierung des politischen Systems und den Wiederaufbau eines unabhängigen souveränen Staates in Polen forderten. Zur Unterstützung dieser nach wie vor illegalen Organisationen wurde dann noch das unabhängige Verlagshaus NOWA gegründet, das das Informationsmonopol der Kommunisten durchbrach, indem es mehrere unzensierte Zeitschriften und Bücher herausgab. Außerdem wurde mit großem Erfolg die Aktion »Fliegende Universität« umgesetzt. In diesen Vorlesungen war es erstmals möglich, kritisch philosophische, geschichtliche, politologische und ökonomische Fragen zu diskutieren, was in den regulären Vorlesungen der Universitäten undenkbar war. Internationale Impulse kamen hinzu: Seit der KSZE-Schlussakte (1975) konnte sich z. B. die polnische Opposition auf die dort formulierten und auch von den polnischen Machthabern unterschriebenen Menschenrechte berufen. Kontakte mit der Gefangenenhilfsorganisation »amnesty international« wurden aufgenommen, was nicht ohne Erfolg blieb. Festnahmen von Oppositionsangehörigen durch die politische Polizei (»Sluzba Bezpieczenstwa«) fanden zwar trotzdem statt, wurden aber in der Regel früher beendet, vor allem wenn ausländische Sender wie »Radio Freies Europa«,« BBC« oder » Stimme Amerikas« darüber »S o l id a r n o s c« , d er »Rund e Tis ch« und er s t e d e m o k r at is che Wa hl e n in P o l e n D&E Heft 58 · 2009 Abb. 2 Streikende am Eingang zur Danziger Lenin-Werft im August 1980. Der Streik erreichte am 31.8.80 die Garantie des Streikrechts, soziale Verbesserungen und die Freilassung politischer Häftlinge. © picture alliance, dpa berichteten. Eine Wende in Polen brachte dann die Nachricht über die Wahl des Krakauer Erzbischofs Karol Wojtyla zum Papst. Abb. 3 General Wojciech Jaruzelski (in Uniform) im polnischen Sejm (Parlament) im Jahre 1982. Das polnische Militär hatte am 13.12.1981 die Macht übernommen, das Kriegsrecht proklamiert und die Bürgerrechte stark eingeschränkt. Bis 1983 blieb Jaruzelski Ministerpräsident, Verteidigungsminister und Oberbefehlshaber der Streitkräfte. 1985–1989 war er Staatsratsvorsitzender, von 1989–90 Staatspräsident Polens. Seine Rolle in den 80er-Jahren ist bis heute umstritten. Sein Nachfolger im Amt des polnischen Staatspräsidenten wurde Lech Walesa. © picture alliance, dpa Karol Wojtyla wird Papst Als Johannes Paul II. begab sich Karol Wojtyla bereits vom 2. bis 10. Juni 1979 zu seiner ersten Wallfahrt in sein Vaterland. Eine tiefe Bedeutung hatten dabei seine Worte, die über Funk und Fernsehen direkt im ganzen Land ausgestrahlt wurden: »Dein Geist komme herab und verändere das Antlitz der Erde, – dieser Erde!« Für die Mehrheit der Bürger war dies eine Metapher, die nicht nur als Aufruf zur moralischen Erneuerung, sondern auch als Vorhersage der politischen Veränderungen verstanden werden musste. So war bereits 1978 eine Bewegung entstanden, die letztendlich die entschiedene politische Änderung in Polen in Gang setzen sollte. Im Februar 1978 gründete Kazimierz Switon schließlich ein »Gründungskomitee für Freie Gewerkschaften« (»Wolne Zwiazki Zawodowe«), und wenige Tagen später entstanden weitere illegale Organisationen diesen Typs wie z. B. die Initiative von Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz und Lech Walesa, die die Keimzelle der weltberühmten freien Gewerkschaftsbewegung »Solidarnosc« wurde. Im Juli 1980 brach wegen der Ankündigung von Preiserhöhungen eine neue Streikwelle aus. Die Schuldenlast des polnischen Staates bei ausländischen Banken führte schließlich zum Zusammenbruch der Marktversorgung, der Einstellung eines Großteils der Investitionen sowie zu einem nahenden Staatsbankrott. Am 16. August 1980 wurde deshalb auch auf der Danziger Lenin-Werft ein Streik ausgerufen und ein betriebsübergreifendes Streikkomitee mit Lech Walesa an der Spitze gegründet. In kurzer Zeit verbreitete sich die Streikwelle über das ganze Land. In den sogenannten Augustvereinbarungen musste die amtierende Regierung schließlich die Anerkennung einer unabhängigen, gesellschaftlich–politischen Organisation erlauben, der »Unabhängigen selbstverwalteten Gewerkschaft Solidarität«. »Solidarnosc« – »Solidarität« Die neue unabhängige Organisation »Solidarnosc« prägte von da an die öffentlichen Diskurse und unzensierte Diskussionen. Statt Zensur gab es nun einen weitgehend offenen, politischen und gesellschaftlichen Dialog in den Fabriken, den Medien und während der Kundgebungen. Stets war es ein großes Ereignis, wenn der bei einem Großteil der Bevölkerung zur Legende gewordene Lech Walesa vor Tausenden von Menschen öffentlich auftrat, sei es in Stadien, in Turnhallen oder auf Marktplätzen. Bisher verheimlichte Menschenrechtsverletzungen des sozialistischen Systems wurden an die Öffentlichkeit gebracht. Wenn auch das von »Solidarnosc« vorgeschlagene Wirtschaftsprogramm (| M 2 |) realitätsfern und die Hoffnungen auf eine Demokratisierung naiv D&E Heft 58 · 2009 waren, so lag doch das Haupthindernis für eine Realisierung dieses Reformprozesses in der starken Ablehnung durch die Sowjetunion sowie die sozialistischen Nachbarstaaten DDR und CSSR, die sich vor einer Destabilisierung auch ihrer eigenen Länder fürchteten. Aber auch die polnische Regierung, die seit 1981 durch Wojciech Jaruzelski angeführt wurde, der in seinen Händen die wichtigsten Staats- und Parteiposten hielt (Ministerpräsident, I. Sekretär des Zentralkomitees der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PZPR), Verteidigungsminister), war unfähig, einen Kompromiss mit der »Solidarnosc« zu schließen. Verhängung des Kriegsrechts über Polen Zwischen Frühling und Herbst 1981 hielten über den Sommer und Herbst hinweg die Streikwellen ungebrochen an. Erstmals seit den 50er-Jahren wurden damals Lebensmittelmarken wieder eingeführt. Jaruzelski und die PZPR warnten sodann die Streikenden beständig vor einer drohenden Intervention der sowjetischen Streitkräfte sowie des Warschauer Pakts, wie zuletzt 1968 in der CSSR praktiziert. Damit rechtfertigten sie letztlich die Verhängung des Kriegsrechts in Polen am 13. Dezember 1981. Selbst der katholischen Kirche gelang es in diesen Monaten nicht, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln. Ganz offiziell übernahm am 13. Dezember eine Militärjunta die Macht in Polen, der sogenannte »Militärrat der Nationalen Errettung« (»Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego« – WRON). Dies führte unverzüglich zu einer starken Begrenzung der Bürgerrechte, der Festnahme von Oppositionellen, der Auflösung der Mehrheit der gesellschaftlich–politischen Organisationen und darunter vor allem der Unabhängigen Selbstverwalteten Gewerkschaft, der »Solidarnosc«. Einer Tragödie kam die Unterdrückung der Bergwerkarbeiterproteste in Oberschlesien im Bergwerk »Wujek« gleich. Die Funktionäre der »Motorisierten Reserven der Miliz« (ZOMO) eröffneten das Feuer gegenüber den Protestierenden, wobei neun von ihnen getötet wurden. Ähnlich dramatisch und gewaltsam wurde der Bergarbeiterstreik im Bergwerk »Piast« in Tychy beendet, wenngleich dort keine Todesopfer zu beklagen waren. Das Regime von Jaruzelski dauerte insgesamt sechs Jahre, auch wenn offiziell der Kriegszustand bereits 1983 beendet wurde. International wurde Polen in diesen Jahren weitgehend boykottiert. Die USA verhängten gar Wirtschaftssanktionen. Der Widerstandswille der Oppositionellen war in diesen Jahren nur an nationalen Feiertagen oder bei Papstwallfahrten Johannes Pauls II. in sein Heimatland erkennbar. Internationale Aufmerksamkeit erreichte in diesen Jahren höchstens die Nachricht von der Ermordung des »Solidarnosc«-Priesters Jerzy Popieluszko. Die an- »S o l id a r n o s c« , d er »Rund e Tis ch« und er s t e d e m o k r at is che Wa hl e n in P o l e n 35 JOANNA BESZCYNSKA | RYSZARD KACZMAREK Abb. 4 Am 31.8.2980 unterzeichneten Vertreter der Regierung und der überbetrieblichen Streikkomitees eine Vereinbarung, durch die u. a. die Bildung unabhängiger Gewerkschaften ermöglicht wurde. © picture alliance, dpa dauernde Wirtschaftskrise erreichte ihren Höhepunkt im Jahre 1987. Die Regierung war zu Preiserhöhungen bei Lebensmitteln und Brennstoffe gezwungen, was wieder vor allem die ärmeren Schichten der polnischen Gesellschaft hart traf. Perestroika in Polen und erste »Runde Tische« 36 Wirtschaftliche Reformen stellten sich erst in Folge der im Kreml mit Michail Gorbatschow einsetzenden Politik von »glasnost« und »perestroika« ein. Bereits im Februar 1988 schlug Bronislaw Geremek im Namen der Opposition der Regierung einen Pakt gegen die Krise vor, was schließlich am 26. August 1988 zu ersten Gesprächen mit dem Innenminister Czeslaw Kiszczak und zur Etablierung des ersten »Runden Tisches« zur Lösung der katastrophalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation des Landes führte. Vermittelnd hatte sich hier die katholischen Kirche eingeschaltet. Ein Treffen des inzwischen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Lech Walesa mit dem Chef der politischen Polizei führte schließlich zu mehreren Gesprächsrunden. Kurz zuvor war Walesa noch verboten worden, den Friedensnobelpreis anzunehmen und das Land für die Verleihungszeremonie zu verlassen. Seit September 1988 fanden nun in der Villa Magdalenka in der Nähe von Warschau regelmäßig Gespräche zwischen General Kiszczak und Walesa statt. Kritiker fanden sich sowohl auf der Seite der orthodoxen Kommunisten als auch auf der Seite der radikalen Oppositionellen. Schon damals war die Spaltung in der Opposition sichtbar. Die radikalen antikommunistischen Aktivisten der Organisation »Die Kämpfende Solidarität« (»Solidarnosc Walczaca«) und des Unabhängigern Studentenverbandes (»Niezalezne Zrzeszenie Studentów Polskich« – NZS) vertraten die Ansicht, dass jede Vereinbarung mit der Regierungsmacht ein nationaler Verrat sei. Nach den ersten Verhandlungen rief Walesa am 3. September 1988 schließlich zur Beendigung der Streiks auf. Seit Mitte August hatten die Verhandlungen mit den Vertretern regierungsfreundlicher Gewerkschaften, dem »Gesamtpolnischen Gewerkschaftsverband« und den Regierungsparteien, der »Vereinigten Bauernpartei« (»ZSL«) und der »Demokratischen Partei« (SD) gedauert. Die ursprünglich auf November angesetzten Verhandlungen am »Runden Tisch« kamen jedoch trotz aller Fortschritte nicht zustande. Die Regierungsvertreter stimmten vor allem nicht der Beteiligung von Adam Michnik und Jacek Kuron zu, die sie als zu radikal einstuften. Im Dezember 1988 riefen die Aktivisten der Opposition schließlich ein »Bürgerkomitee« (»Komitet Obywatelski«) ins Leben, das die Gespräche mit den Regierenden organisierte und koordinierte. Kurz zuvor war Lech Walesa in einer im ganzen Land übertragenen Fernsehdebatte mit Alfred Miodowicz, dem Chef des Abb. 5 In Gesprächen am »Runden Tisch« – hier am 5.4.1989 – wurden Vereinbarungen zwischen den kommunistischen Regierungsparteien und der Opposition zur Demokratisierung Polens und den ersten halbfreien Wahlen getroffen. Die deutsche Tageszeitung »Die Welt« titelte am 4. Juni 2009: »Im Jubel um 20 Jahre Mauerfall vergessen die Deutschen oft: Den Weg ebneten die Polen fünf © picture alliance, dpa Monate davor« regierungsfreundlichen Gewerkschaftsverbandes, als klarer Sieger hervorgegangen und er genoss nun eine enorme Popularität. Das X. Plenum des Zentralkomitees der »Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei« (»KC PZPR«) traf deshalb auf Druck von General Jaruzelski und dem damaligen Ministerpräsidenten Rakowski die Entscheidung, eine Opposition im politischen System zu dulden und damit die »Solidarnosc« auch rechtlich zu legitimieren. Am 18. Januar 1989 stimmte das ZK der PVAP in einem Beschluss ganz offiziell für einen politischen und gewerkschaftlichen Pluralismus, was ohne die vorausgegangenen Verhandlungen und Vereinbarung am »Runden Tisch« unmöglich gewesen wäre. Die Schlüsselfrage der kommenden Verhandlungen war dabei das Problem künftiger Wahlen. Die Regierungsseite forderte vor allem die Schaffung einer gemeinsamen Wahlliste. Auf ihrer Seite waren vertreten: Aleksander Kwasniewski (ein zunehmend bedeutend werdender Anführer der Postkommunisten), Wladyslaw Baka (ein sachkundiger Ökonom) und Janusz Reykowski (ein kompromissbereiter Psychologe und ehemals politischer Parteiaktivist). Seitens der Opposition traten besonders hervor: Tadeusz Mazowiecki (ein unabhängiger katholischer Aktivist, der schon seit den 60er-Jahren von sich reden machte), Witold Trzeciakowski (ein sachkundiger Ökonom) und Bronislaw Geremek (ein bekannter Historiker, der sich seit den 70er-Jahren in der politischen Opposition engagierte). Als Kompromiss wurde schließlich fixiert, dass bei den kommenden Wahlen für die Regierungsseite rund 65 % der Mandate garantiert sein würden (Die Mandate sollten sich auf die »Polnische Vereinigte Arbeiterpartei« (PZPR), die »Vereinigte Bauernpartei« (ZSL), die »Demokratische Partei« (SD) sowie den »Christliche Verein« verteilen. Der Oppositionspartei wurden die weiteren 35 % zur Verfügung gestellt. Eine zusätzliche Übereinkunft bezog sich auf eine sogenannte Landesliste, die schließlich den Kommunisten zum Verhängnis werden sollte. Alle Kandidaten dieser Liste mussten im ersten Wahlgang über 50 % der Stimmen erreichen, um ein Mandat zu gewinnen. Dieses Ergebnis erzielten nur zwei Personen, der Vorsitzende des Obersten Verwaltungsgerichts Adam Zielinski und Prof. Mikolaj Kozakiewicz. »S o l id a r n o s c« , d er »Rund e Tis ch« und er s t e d e m o k r at is che Wa hl e n in P o l e n D&E Heft 58 · 2009 Eine Neuigkeit in der 40-jährigen Wahlgeschichte des kommunistischen Systems war zudem eine erneute Einführung des Amtes des Staatspräsidenten und die Etablierung einer zweiten Kammer des Parlaments – des Senats. Dies sollte demokratisch mit Hilfe des Mehrheitswahlsystems geschehen. Unabhängige Wahlen? Nach den Verhandlungen am »Runden Tisch« fing nun ein fast zweimonatiger Wahlkampf an. Das Datum der Wahlen war der 4. Juni 1989. Bereits im ersten Wahlgang hatten die SolidarnoscVertreter die ihnen zugestandenen 160 Sejm-Mandate erzielt. Im Senat eroberte Solidarnosc 92 von 100 Sitzen. Der zweite Wahlgang fand dann am 18. Juni statt und beschränkte sich auf die Vergabe der Sitze für die bisherigen Regierungsparteien. Er fand vor allem auch deshalb statt, weil man befürchtete, die Wahlen könnten ansonsten für ungültig erklärt werden. Eine deutliche Sprache stellte auch die Wahlbeteiligung dar: 62 % im ersten, nur noch 25 % im zweiten Wahlgang. Der Senat bestand als zweite Parlamentskammer fast nur noch aus den Oppositionsvertretern, nach dem zweiten Wahlgang waren es sogar 99 von 100 zugunsten der Oppositionsbewegung. Zum Sejmpräsident wurde Prof. Mikolaj Kozakiewicz (Vereinigte Bauernpartei), zum Senatspräsident Andrzej Stelmachowski (»Bürgerlicher Parlamentarischer Klub« – OKP) gewählt. Am 19. Juli ernannte die Nationalversammlung nach einer Vereinbarung mit der Opposition Wojciech Jaruzelski zum Staatspräsidenten. Er war einziger Kandidat. Die Regierung von Tadeusz Mazowiecki und der Wirtschaftsplan von Balcerowicz Nach einigem Hin und Her wurde schließlich Tadeusz Mazowiecki (»Solidarnosc«) das Amt des Premierministers übertragen. Damit ging am 12.9.1989 die Prophezeiung von Adam Michnik vom 3. Juli 1989 in Erfüllung: »Euer Staatspräsident, unser Ministerpräsident«. Die neue Regierung war nun eine Koalitionsregierung: 11 Ministern der OKP (»Bürgerlicher Parlamentarischer Klub«), 4 der ZSL (»Bauernpartei«), 3 der SD (»Demokratische Partei«) sowie 5 der PZPR (Vereinigte Arbeiterpartei«). Die wichtigste Aufgabe war die wirtschaftliche Erneuerung Polens. Hier spielte der junge Ökonom Leszek Balcerowicz eine herausragende Rolle. Und obwohl die Reformen des Balcerowicz-Plans durchaus zur Senkung der Inflation und des Staatshaushaltsdefizits führten und eine Verbesserung der Marktversorgung und die Abschaffung der Lebensmittelmarken sowie eine Währungsstabilisierung mit sich brachten, beeinflussten die negativen Folgen wie Konkurse vieler Unternehmen, steigende Arbeitslosigkeit und Vernachlässigung polnischen Dörfer stark das Befinden der Bevölkerung. Die negativen Folgen der Transformation waren dabei besonders in den bisher privilegierten Kreisen und den stark subventionierten Gruppen spürbar. Das betraf besonders die Schwer- und Rüstungsindustrie sowie die staatlichen Landwirtschaftsunternehmen. Und für die staatlich organisierten Bereiche wie Polizei, Schul- und Gesundheitswesen standen kaum genügend Mittel zur Verfügung. Abb. 6 Tadeusz Mazowiecki mit Siegeszeichen der »Solidarnosc«, nachdem er am 24.9.1989 in Warschau zum ersten nichtkommunistischen Ministerpräsidenten Polens – und eines Warschauer-Pakt- Staates überhaupt – gewählt wurde. © picture alliance, dpa tischen Vergangenheit aufrief. (2) Eine eher links-liberale Gruppe unter Adam Michnik, die sich zur Unterstützung der Regierung von Mazowiecki bereit erklärte. Im Zentrum dieses Konflikts stand abermals Lech Walesa. Beide Seiten wollten seine Popularität zu eigenen Zwecken nutzen. Aus der Solidarnosc bildete sich aber auch der (3) »Liberal- Demokratische Kongress« heraus, zu dem u. a. auch Donald Tusk, der aktuelle Ministerpräsident (2009) gehörte. Diese Gruppierung hatte zwar nur 10 Abgeordnete im Parlament, aber sie kämpfte mit großer Entschlossenheit für volle wirtschaftliche Freiheit, Dezentralisierung der kommunalen Selbstverwaltung und für den politischen Liberalismus. Zu einer Spaltung kam es in den Kreisen der Postkommunisten. Im Januar 1990 fand der XI. Parteitag der (4) »Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei« statt. Während dieser Tagung schlug der bisherige I. Sekretär des Zentralkomitees der PVAP, Mieczyslaw Rakowski, die Parteiauflösung und die Neugründung einer postkommunistischen Partei vor. So wurde am 29. Januar 1990 die »Sozialdemokratische Partei der Republik Polen« gegründet. An ihrer Spitze standen Aleksander Kwasniewski, der später zwei Wahlperioden lang das Amt des Staatspräsidenten bekleidete, Józef Oleksy und Leszek Miller, die später Ministerpräsidenten wurden. Das Verhältnis der Postkommunisten zur SolidarnoscBewegung blieb aber gespannt. Trotz aller Gegensätzlichkeiten und Streitigkeiten wurden in den Folgejahren die marktwirtschaftlichen Wirtschaftsreformen des Balcerowicz-Plans konsequent durchgeführt, auch wenn es manchen Polen große Opfer abverlangte. Die Demokratisierung ließ sich ohnehin nicht mehr zurückdrehen. Am Thema »Europa« zeigte sich die Öffentlichkeit angesichts dieser Probleme zunächst wenig interessiert. Erst die Diskussion um einen EU-Beitritt Polens, 2004 dann realisiert, führte die Debatte um Vor- und Nachteile der EU für Polen wieder ins politische Bewusstsein. Der schwierige politische Pluralismus Schon Anfang 1990 kam es dann zu einem Konflikt zwischen Lech Walesa einerseits, der damals noch als Vorsitzender der »Solidarnosc« tätig war, und der Regierung von Tadeusz Mazowiecki anderseits. Der Konflikt wurde als »Krieg an der Spitze« in Polen bekannt. Folgende Parteigruppierungen entwickelten sich: (1) Eine konservativ-nationalistische Gruppe unter Führung von Jaroslaw Kaczynski, die zur radikalen Abrechnung mit der kommunis- D&E Heft 58 · 2009 »S o l id a r n o s c« , d er »Rund e Tis ch« und er s t e d e m o k r at is che Wa hl e n in P o l e n 37 JOANNA BESZCYNSKA | RYSZARD KACZMAREK MATERIALIEN M 1 Lech Walesa (Mitte): Mitbegründer der freien Gewerkschaftsbewegung 38 »Solidarnosc« in Polen (1980) und Friedensnobelpreisträger (1983). Ehemals Elektriker und Streikführer auf der Leninwerft in Danzig (Gdansk). Von 1981–190 Vorsitzender der »Solidarnosc«. 1990–1995: Staatspräsident Polens. Walesa organisierte den politischen Wandel Polens von einer kommunistischen »Volksdemokratie« zur parlamentarischen Demokratie. © picture alliance, dpa M 2 Aus den Forderungen der Gewerkschaft »Solidarnosc« vom August 1980 der Diskussion zum Reformprogramm für alle Gesellschaftskreise und -schichten. 7. Lohnweiterzahlung an alle Streikteilnehmer für die Zeit des Streiks (…) 8. Anhebung des Grundlohns für jeden Arbeiter um 200 Zloty pro Monat als Ausgleich für den bisherigen Preisanstieg. 9. Garantie eines automatischen Lohnanstiegs parallel zu den Preissteigerungen und zum Absinken des Geldwertes 10. Sicherstellung einer vollen Versorgung des Binnenmarktes mit Nahrungsgütern (…). 12. Einführung von Auswahlkriterien für Leitungskader nach dem Qualifikationsprinzip und nicht nach ihrer Parteizugehörigkeit sowie Beseitigung der Privilegien für die Bürgermiliz, die Staatssicherheit und den Parteiapparat durch Angleichung der Familienzuschüsse, Beseitigung von Sonderverkaufsstellen u. a. 13. Einführung von Lebensmittelkarten für Fleisch und Fleischprodukte (bis die Lage auf dem Markt gemeistert ist). 14. Herabsetzung des Rentenalters für Frauen auf 50 Jahre und für Männer auf 55 Jahre oder eine Arbeitsdauer in der Volksrepublik Polen von 30 Jahren für Frauen und 35 Jahren für Männer ungeachtet des Alters. 15. Die Alters- und sonstigen Renten, die nach alter Grundlage berechnet worden sind, sind dem Niveau der gegenwärtig gezahlten anzugleichen. 16. Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, was eine volle medizinische Versorgung für die arbeitenden Menschen gewährleisten bedeutet. 17. Sicherstellung einer entsprechenden Anzahl an Krippen- und Kindergartenplätzen für Kinder von berufstätigen Frauen 18. Einführung eines bezahlten Mutterschaftsurlaubs für die Zeitdauer von 3 Jahren zur Erziehung der Kinder. 19. Verkürzung der Wartezeit auf Wohnungen. 20. Anhebung der Tagegelder von 40 auf 100 Zloty und Trennungszuschläge 21. Einführung des Samstags als arbeitsfrei Aus: Solidarnosc. Die polnische Gewerkschaft ›Solidarität‹ in Dokumenten, Diskussionen und Beiträgen 1980 bis 1982. Hrsg. v. Barbara Büscher, Ruth-Ursel Henning (= Politik und Zeitgeschichte). Köln: Bund-Verlag 1983, S. 36–43 1. Akzeptierung (…) unabhängiger freier Gewerkschaften, die sich aus der von der Volksrepublik Polen ratifizierten Konvention Nummer 87 der Internationalen Arbeitsorganisation ergibt, die die Gewerkschaftsfreiheit betrifft. 2. Garantie des Rechts auf Streik sowie der Sicherheit der Streikenden und der sie unterstützenden Personen. 3. Einhaltung der von der Verfassung der Volksrepublik Polen garantierten Freiheit des Wortes, des Drucks und der Publikation. Somit dürfen auch die unabhängigen Zeitschriften nicht unterdrückt werden. Zugang der Vertreter aller Glaubensbekenntnisse zu den Massenmedien. 4. a) Wiederherstellung der Rechte für alle Menschen, die nach den Streiks von 1970 und 1976 entlassen, für alle Studenten, die wegen ihrer Überzeugung von den Hochschulen entfernt wurden. b) Freilassung aller politischen Gefangenen (…). 5. Veröffentlichung der Informationen über die Gründung des Überbetrieblichen Streikkomitees und seiner Forderungen in den Massenmedien. 6. Schritte, um unser Land aus der KrisensiM 3 Streikposten der Gewerkschaft »Solidarnosc« am Eingang zur Lenin-Werft 1980. Die Streikwelle in tuation herauszubringen durch: a) öffentPolen, die am 1. Juli durch eine Erhöhung der Fleischpreise begann, wurde am 31.8. durch die Unterliche Bekanntgabe sämtlicher Informatizeichnung eines Abkommens zischen dem Streikkomitee und der Regierung beendet. Es enthielt die onen über die sozialökonomische Lage Garantie des Streikrechts, die Gründungsgarantie unabhängiger Gewerkschaften und die Freilasund b) Ermöglichung der Teilnahme an sung politischer Häftlinge. © picture alliance, dpa »S o l id a r n o s c« , d er »Rund e Tis ch« und er s t e d e m o k r at is che Wa hl e n in P o l e n D&E Heft 58 · 2009 M 4 18.4.1989: Arbeiterführer Lech Walesa (l.) im Gespräch mit dem polnischen Präsidenten General Wojciech Jaruzelski, Walesas Berater Bronislaw Geremek und Premierminister Mieczyslaw Rakowski in Warschau. © picture alliance, dpa M 5 Gespräch des Generalsekretärs der KPdSU Michail Gorbatschows mit dem polnischen Premierminister Mieczslaw Rakowski (21.10.1988 in Moskau) Rakowski: Wir wirken auch auf die Opposition ein. Sie müssen sich von der Vorstellung verabschieden, wir seien schwach. Für uns bedeutete ein Neuaufbau der Solidarnosc unser Ende. Das ist eine Partei der Streiks und der Demontage. Gorbatschow: Eine Partei des Ultimatum-Stellens. Rakowski: Ich habe der Opposition vorgeschlagen, sich vier Monate an der Regierung zu beteiligen. Sie haben abgelehnt. Gorbatschow: Und weiß das die Gesellschaft? Rakowski: Sie weiß es. Gorbatschow: Das heißt, sie will keine Verantwortung übernehmen. Rakowski: Sie wäre sogar gerne an der Macht, aber so, dass sie keine Verantwortung übernehmen müsste. In den Augen der Gesellschaft ging diese Runde an uns. Denen, denen, wir Plätze in der Regierung angeboten haben, werden wir das nicht mehr anbieten. Der Solidarnosc kann man keine Zugeständnisse machen. Aber man kann in eine Phase neuer Unruhen geraten. Obwohl ich mir aus meiner Intuition heraus nicht vorstellen kann, wie die Opposition die Massen mobilisieren könnte. Es gibt lokale Streiks wegen niedriger Einkommen. Aber die dauern nicht länger als 1–2 Stunden. Wenn wir die Partei am »Runden Tisch« gut in Szene setzen, dann können wir viele Menschen auf unsere Seite ziehen. Gorbatschow: Wo liegt die Grenze der Kompromisse? Wer wird am »Runden Tisch« teilnehmen und worüber wird verhandelt? Wollt ihr nicht zu viel auf einmal besprechen? Ich will wissen, worum es geht. Rakowski: Die Themen haben wir schon früher bestimmt: Unterstützung der Reformen, Umbau der politischen Strukturen, eine zweite Kammer des Sejms [des Parlaments], einen Rat der nationalen Verständigung, die Einbeziehung von vernünftig denkenden Menschen der Opposition, eine weitere Demokratisierung der Wahlen durch Vertretungsorgane. Das sind die konkreten Themen, über die wir sprechen wollen. Gorbatschow: Aber im Rahmen des sozialistischen Systems? Rakowski: Selbstverständlich! Genau hier verläuft die Trennlinie in der Opposition. Ihr extremistischer Teil spricht offen davon, dass er beabsichtigt, Schritt für Schritt das Gesellschaftssystem zu verändern. © Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w swietlie dokumentow, t. I, wybor i opracowanie A. Dudek. IPN, Warszawa 2009, s. 332–333. (dt: Die Abenddämmerung der Diktatur. Polen 1986–1989 im Spiegel der Dokumente. Bd. I. Auswahl und Bearbeitung A. Dudek. IPN. Warszawa 2009. S. 332–333. (Aus dem Polnischen von Manfred Mack) D&E Heft 58 · 2009 M 6 Der erste nichtkommunistische Ministerpräsident Polens Tadeusz Mazowiecki am 24.11.1989 mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow in Moskau. © picture alliance, dpa M 7 Bedeutung Polens als Vorreiter der ›friedlichen Revolution‹ Bis zum Jahr 1989 konnte in der Weltgeschichte fast die ›politische Regel‹ gelten, wonach ein vollkommener Wechsel eines politischen Systems nur durch eine gewaltsame Revolution, einen Staatsstreich oder als Folge eines Krieges stattfinden konnte. In den kommunistisch regierten Staaten Ost- und Mitteleuropas kam es im Jahr 1989 erstmals zu Ereignissen, die einen Wechsel von undemokratischen hin zu demokratischen Systemen auf friedlichem Wege eingeleitet haben. Die Bedeutung der Gewerkschaft »Solidarnosc« als der im ganzen Block der »Sozialistischen Staaten« zuerst legalisierten Opposition im Jahr 1980 kann dabei als überragend bezeichnet werden. Allerdings darf auch die Rolle der seit 1986 in der Sowjetunion eingeleiteten ›Perestroika‹ nicht unterschätzt werden. (…) Die Entwicklung der Protestbewegungen in Polen darf unterdessen als eine Ausnahme gelten. Die Stärke des katholischen Glaubens und seiner institutionalisierten Form, der katholischen Kirche in Polen, die eine Ausnahme unter den kommunistisch regierten Staaten darstellte, darf durchaus als ursächlich für die Widerstandsfähigkeit der Polen gegen die kommunistische, wie auch schon früher die nationalsozialistische Ideologie betrachtet werden. Teile der polnischen Gesellschaft hatten in den Jahren 1956 und 1968 auch protestiert, allerdings nicht nur aus Solidarität mit den Bewegungen in Ungarn und der Tschechoslowakei. Der Verlauf bzw. Ausgang dieser Proteste in Polen war jedoch im Vergleich zu den erwähnten Staaten gewaltloser und führte weniger zu einer Traumatisierung, sondern vielmehr zur Bildung einiger oppositioneller Organisationen, vor allem in den intellektuellen Kreisen des Landes. Diese Opposition kam nach ihren Höhen und Tiefen, also nach den Erfahrungen in Zeiten der politischen Tauwetter und der immer darauf folgenden Rückschritte, in der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre zu der Überzeugung, dass nur eine Bündelung der oppositionellen Kräfte von Intellektuellen und Arbeitern unter Mitwirkung der »legalen Oppositionskraft«, der Kirche, den gewünschten Effekt bringen kann. Die Zusammenarbeit der weiterhin heterogenen Kräfte leitete die »Solidarnosc« in die Wege. Diese Organisation, die das gesamte Spektrum der sozialen Schichten vertrat und eine Massenorganisation mit zuletzt etwa 10 Millionen Mitgliedern gewesen ist, war durchaus berechtigt, sich als Vertretung der polnischen Gesellschaft verstanden zu wissen. Beata Wloch-Ortwein: Die ›Solidarnosc‹ in Breslau. Die Entstehung einer oppositionellen gesellschaftlichen Bewegung in der Systemkrise 1980/81 und ihre Bedeutung für den Systemwechsel in Polen 1989. Berlin: Logos 2000, S. 11f »S o l id a r n o s c« , d er »Rund e Tis ch« und er s t e d e m o k r at is che Wa hl e n in P o l e n 39 III. MAUERÖFFNUNG IN EUROPA 2. »Es begann in Gdansk« – Rückblick und Bilanz MANFRED MACK M it dem Slogan »Es begann in Gdansk« warb die polnische Regierung zum 20. Jahrestag der »Friedlichen Revolution« in der ganzen Welt. Sie erinnerte damit an die landesweiten Streiks und die Zulassung der ersten unabhängigen Gewerkschaft »Solidarnosc« im August 1980. Damit – so die Botschaft – begann der Untergang des Kommunismus. Und mit der Losung »Es hat am Runden Tisch angefangen« – zu sehen u. a. auf einem Banner vor der polnischen Botschaft in Berlin – wurde medienwirksam darauf hingewiesen, dass der »Völkerfrühling« des Jahres 1989 seinen Anfang in Polen nahm, dass der polnische »Runde Tisch« zum Vorbild einer gewaltlosen, friedlichen Ablösung der herrschenden kommunistischen Parteien im gesamten damaligen »Ostblock« wurde. Zum 10. Jahrestag der denkwürdigen Ereignisse des Jahres 1989 war es vor allem der Fall der Berliner Mauer, der symbolisch für das Ende des Kommunismus und die Überwindung des Ost-West-Konflikts und des Kalten Krieges stand. Mit dem Abstand von 20 Jahren nun setzte sich in der öffentlichen Erinnerung auch außerhalb Polens die Sichtweise durch, dass der polnische Widerstand Voraussetzung, Vorbild und Inspiration der friedlichen Revolutionen des Jahres 1989 war. »Es begann in Gdansk« 40 In Polen selbst wurde allerdings heftig über die Bewertung der Ereignisse im Jahre 1989 und die darauffolgende Transformation debattiert. Nur der Slogan »Es begann in Gdansk« war unstrittig. Die Bedeutung des »Runden Tisches« vom Frühjahr 1989, der darauf folgenden halbfreien Wahlen am 4. Juni 1989 und der Umgestaltung des wirtschaftlichen und politischen Systems wurden zum Gegenstand heftiger Kontroversen zwischen dem Lager der gegenwärtigen Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk und der Opposition, angeführt vom polnischen Staatspräsidenten Lech Kaczynski. Zur Erinnerung an den Sieg der »Solidarnosc« bei den Wahlen vom 4. Juni 1989 plante die polnische Regierung eine große Feier in Danzig auf der ehemaligen Lenin-Werft, zu der Staatsgäste aus der ganzen Welt eingeladen werden sollten. Kritik kam nicht nur aus den Reihen der Kaczynski-Anhänger, sondern auch von der Gewerkschaft »Solidarnosc«, die für den Tag Demonstrationen in Danzig ankündigte, um auf die aktuelle Gefährdung des Fortbestands der Werft wegen strenger EU-Subventionsrichtlinien hinzuweisen. Aus Angst vor Ausschreitungen in Danzig vor den Augen der Weltöffentlichkeit verlegte Tusk die Feierlichkeiten nach Krakau. Während Tusk mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten Vaclav Havel und anderen europäischen Politikern in Krakau der friedlichen Revolution von 1989 gedachte, feierte Lech Kaczynski in Begleitung seines Zwillingsbruders Jaroslaw Kaczynski zusammen mit Parteifreunden und Mitgliedern der Gewerkschaft »Solidarnosc« in Danzig. Dies wirft ein charakteristisches Schlaglicht auf die innenpolitischen Diskussionen um 20 Jahre Transformation in Polen. Zum 20. Jahrestag erschienen in Polen zahllose Artikel zu diesem Thema. Während die Mehrzahl der Historiker, Publizisten und die damaligen Akteure eine sehr positive Bilanz der friedlichen Revolution und der dadurch möglich gewordenen Umgestaltung des politischen und wirtschaftlichen Systems zogen, sprachen die Anhänger des Kaczynski-Lagers von »faulen Kompromissen am Runden Tisch« zwischen den Kommunisten und einem Teil der Abb. 1 Ansprache von Polens Staatspräsident Lech Kaczynski am 4.6.2009 in Gdansk/Danzig anlässlich der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der halbfreien Wahlen 1989 in Polen. © picture alliance, dpa Opposition, die in der Folgezeit Polen gemeinsam in ein »postkommunistisches Monstrum« verwandelt hätten. Bilanz nach 20 Jahren Umgestaltung in Polen Waren es die »besten 20 polnischen Jahre in der Geschichte der letzten 300 Jahre« wie Adam Michnik, ein führender Oppositioneller, meinte, oder waren es »20 verlorene Jahre«, die lediglich die Diktatur der Kommunisten durch eine Kumpanei der Postkommunisten mit den linken Oppositionellen ersetzt hat? Ein Blick auf den schwierigen Prozess der Transformation und ein Blick auf die Ergebnisse der Meinungsforschung in Polen können hier für Klarheit in diesem ideologischen Streit sorgen. Als der neugewählte, erste nichtkommunistische Ministerpräsident in einem Land des ehemaligen Ostblocks, Tadeusz Mazowiecki, die Regierungsgeschäfte übernahm, hatte er zwei Prämissen. (1.) Durch die Berufung von Leszek Balcerowicz zum Finanzminister setzte er auf eine radikale Umgestaltung der kommunistischen Planwirtschaft zu einer freien Marktwirtschaft. »E s be g a nn in Gd a n s k« – R ü ck bl i ck und B il a n z D&E Heft 58 · 2009 Abb. 2 Die Gegenveranstaltung: Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk mit Lech Walesa und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel bei den Feierlichkeiten der polnischen Regierung zu »20 Jahre friedliche Revolution« am 4. Juni 2009 in Krakau. In Danzig wurde mit großen Demonstrationen gerechnet. © picture alliance, dpa (2.) Durch die Politik des »dicken Striches«, d. h. den Verzicht auf eine Abrechnung mit den ehemaligen politischen Gegnern, versuchte er, alle Kräfte auf die beginnende Systemtransformation zu konzentrieren. Alternativen eines möglichen »dritten Weges« zwischen »kommunistischer Planwirtschaft« und »kapitalistischer Marktwirtschaft« wurden eine Absage erteilt. Angesichts der fundamentalen Wirtschaftskrise an der Schwelle zum Staatsbankrott mit einer Inflation von bis zu 600 % und Auslandsschulden von 41,4 Milliarden US-Dollar glaubte man sich den Luxus einer Diskussion über Varianten zwischen freier und sozialer Marktwirtschaft nach deutschem oder skandinavischen Modell nicht leisten zu können (»Polen ist zu arm um zu experimentieren« Pysz 2009). Vor welchen existenziellen Herausforderungen der damalige Finanzminister Balcerowicz stand beleuchtete er in einem Interview aus dem Jahr 2009: »Es gab keine Flut von Ideen, auch nicht von Leuten, die die Rolle eines Koordinators der Wirtschaftsreformen übernehmen wollten. Und was die Richtlinien angeht, so hatte Ministerpräsident Mazowiecki mir gesagt: Ich möchte, dass Sie mein Ludwig Ehrhard sind. Und da ich zufälligerweise die deutschen Erfahrungen studiert hatte, wusste ich, dass man in Polen viel mehr tun muss als in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort reichten zwei Operationen. Die Erste war die Stabilisierung, das heißt die Eindämmung der Inflation, und die Zweite war die Befreiung der Wirtschaft von den Regulierungen der Kriegszeit. Sie mussten keine Institutionen der Marktwirtschaft aufbauen, weil der Kapitalismus dort nicht zerstört, sondern lediglich suspendiert worden war. Eine der größten Aufgaben bei uns war gerade der Aufbau und Wiederaufbau der vom Sozialismus zerstörten Institutionen. Das musste neben der Stabilisierung und Deregulierung geschehen.« Durch die Freigabe der Preise, die Anreize zur Privatisierung, Deregulierung der Märkte, Selbstständigkeit und Selbstfinanzierung der Staatsbetriebe, Abschaffung des staatlichen Außenhandels- und Devisenmonopols, Inländerkonvertibilität der einheimischen Währung (d. h. sie konnte von da an beliebig in andere Währungen umgetauscht werden), restriktive Geldpolitik, restriktive Lohnpolitik, Aufbau eines leistungsfähigen Bankwesens, Aufbau eines marktkonformen Steuersystems, Anpassung der institutionellen Struktur an die Erfordernisse der EU, d. h. durch eine Politik, die auf die Selbstregulierungs- und Selbstheilungskräfte des Marktes setzte, konnte die Wirtschaft in relativ kurzer Zeit konsolidiert werden. Die polnische Volkswirtschaft erreichte in den folgenden Jahren Zuwachsraten im Bruttoinlandsprodukt (BIP) von über 5 Prozent, D&E Heft 58 · 2009 Abb. 3 Der polnische Staatspräsident Lech Kaczynski blieb den Feierlichkeiten in Krakau fern und nahm dafür an einer Mittagsmesse am Denkmal der gefallenen Werftarbeiter in Danzig am 4. Juni 2009 teil. © picture alliance, dpa die Inflationsrate konnte schon 2001 auf unter 4 Prozent gedrückt werden, 2001 erwirtschaftete der Privatsektor bereits 75 % des BIP und stellte 70 % der Arbeitsplätze. Das alte Stereotyp von der »Polnischen Wirtschaft« bekam einen neuen Klang: »Polnische Wirtschaft« stand nun für die erfolgreiche Transformation von der Plan- zur Marktwirtschaft. Allerdings hatte dieser Prozess auch seine Schattenseiten. Die Arbeitslosigkeit stieg beträchtlich an. Für die Zeiten der Volksrepublik bis 1989 galt noch der fatale Satz »Die Regierung tut so, als ob sie uns bezahlen würde und die Arbeiter tun so, als ob sie arbeiten würden«. Unter den Bedingungen der Marktwirtschaft – mache Beobachter sprachen auch vom ungezügelten »Manchesterkapitalismus des 19. Jahrhunderts« – stieg die Arbeitslosigkeit und die Schere zwischen den Gewinnern und den Verlieren der Transformation fast ins Unermessliche. Dies wird heute auch von allen Befürwortern der Umgestaltung der letzten 20 Jahre so gesehen. Aber fast alle sind sich darin einig, dass es keine vernünftige Alternative zu dem damals eingeschlagenen Weg gegeben hatte. Dies belegt auch die Tatsache, dass alle Regierungen nach 1989 – von den diversen Regierungen des »Postsolidarnosc-Lagers« bis zu den Regierungen der Postkommunisten – an dem radikalen wirtschaftsliberalen Kurs festhielten – ungeachtet aller Differenzen in politischen Fragen. Für eine Bilanz des in 20 Jahren Erreichten ist es aus historischer Perspektive zudem interessant, an zeitgenössische Kommentare zu den Erfolgsaussichten einer zeitgleichen Umgestaltung des politischen und wirtschaftlichen Systems in Polen zu erinnern. 1990 prognostizierte der polnisch-amerikanische Soziologe Adam Przeworski: »Sobald die antikommunistische Euphorie verflogen sein wird und es zur politischen Organisierung von Interessenkonflikten kommt, wird die Politik in Osteuropa eine Form annehmen, die für den ‹armen Kapitalismus› kennzeichnend ist. Es gibt keinerlei Gründe dafür, warum die Verhältnisse in Bulgarien, Ungarn oder Polen andere werden sollten als in Argentinien, Chile oder Brasilien […] Die Faktoren, die die Demokratie begünstigen, werden sich gleichzeitig zuungunsten wirtschaftlicher Reformen auswirken, wie sie in Ungarn, Polen und Jugoslawien bereits im Gange sind und von anderen Ländern ins Auge gefasst werden. Diese Reformen versprechen nicht nur radikal zu werden − nichts Geringeres als der Übergang vom Sozialismus zum Kapitalismus −, sondern auch außerordentlich schmerzhaft. Und die Erfahrung anderer Länder lehrt, dass solche Reformen unter demokratischen Verhältnissen schwer zu bewerkstelligen sind. Sie mobilisieren den Widerstand derjenigen, die am meisten zu verlieren haben: Das sind die Manager der geschützten oder subventionierten Firmen, die Arbeiter, die vor der Entlassung stehen, und die zahllosen Menschen, die den Abbau der Aufwendungen für Einkommenssicherung und Sozialleistungen fürchten.« »E s be g a nn in Gd a n s k« – R ü ck bl i ck und B il a n z 41 MANFRED MACK 42 Umgang mit den Dokumenten des ehemaligen Geheimdienstes gab, war politisch motivierten Intrigen Tür und Tor geöffnet. Prominentestes Opfer war der ehemalige Streikführer der »Solidarnosc« und spätere Staatspräsident Lech Walesa, der von seinen Gegnern als vermeintlicher Stasi-Agent mit dem Decknamen »Bolek« denunziert werden konnte. Zu seiner Diskreditierung trug auch die mittlerweile gegründete polnische Gauck-Behörde »IPN« (Institut des nationalen Gedenkens) bei. Unter der Regierung der Kaczynski-Partei »Recht und Gerechtigkeit« war diese Institution, die in Polen, anders als in Deutschland, auch staatsanwaltliche Kompetenzen hat, zu Abb. 4 »Wenn Sie zurück blicken: Sind Sie der Ansicht, der politische Wandel in Polen hat sich gelohnt?« einer Institution geworden, die bisweilen © CBOS, Polish Public Opinion 2/2009 S. 2 auch gezielt im innenpolitischen Streit eingesetzt wurde. Przeworski war nicht der einzige Experte, der damals propheJaroslaw Kaczynski hatte schon 1991 gefordert: »Man hätte den zeite, Polen würde schließlich zusammen mit anderen Ländern Kommunismus in Polen angreifen und gänzlich vernichten müssen.« In aus der Region in der Dritten Welt landen. seiner politischen Strategie sollte die moralische und juristische Der konservative britische Philosoph John Gray, ein Anhänger von Abrechnung mit dem Kommunismus und das Eintreten für Moral Margaret Thatcher schrieb: und Gerechtigkeit den Verlierern der Transformation einen Aus»Die menschlichen und sozialen Kosten des Übergangs zur Marktwirtgleich für die ökonomischen Zumutungen in der Übergangsphase schaft sind für die meisten postkommunistischen Länder so hoch, dass es (Arbeitslosigkeit, Anstieg der sozialen Ungleichheit, Gefährdung an Wahnsinn grenzen würde anzunehmen, er könnte im Rahmen liberal− der Existenzgrundlagen) anbieten. demokratischer Institutionen vollzogen werden.« Der polnische Soziologe Aleksander Smolar sieht fünf Gründe, Er hielt die Rekonstruktion des Staates, die Herstellung der Ordwarum sich dieses radikale Programm der Kaczynskis gegenüber nung, das Erzwingen von Respekt vor dem Gesetz für vorrangig. der gemäßigten Politik, wie sie von Regierungen unterschiedliDas unterschied ihn nicht von den Ansichten vieler Liberaler zu cher Provenienz betrieben wurde, nicht durchsetzen konnte: Anfang der 1990er-Jahre. Mehr oder weniger offen zweifelten sie (1.) Die Ablehnung des alten Systems war so weitreichend, dass daran, dass grundlegende Wirtschaftsreformen im Rahmen der alles, was nur im Entferntesten an Sozialismus erinnerte, auf Demokratie durchgesetzt werden könnten. Jahre kompromittiert war. Der Liberalismus wurde zum unangefochtenen Monopolist auf dem Ideenmarkt. Auch die postkommunistischen Regierungen (1995–97, 2001–2004) hatten »Dritte« oder »Vierte Republik«? keine ideologische Alternative und setzten das liberale Reformprogramm fort. Trotz der wirtschaftlichen Erfolge wird die demokratische Umge(2.) Die gesellschaftlichen Erwartungen waren nach dem Scheistaltung in Polen bis heute – trotz aller Erfolge – im innerpolnitern der kommunistischen Utopie auf niedrigem Niveau. »Die schen Diskurs immer noch in Frage gestellt wird. Der Wahlerfolg Menschen akzeptierten die Systemtransformation, sie waren vielder Partei der Kaczynski-Brüder (Partei: »Recht und Gerechtigkeit«/ leicht entmutigt oder zornig, aber sie erwarteten keine Wunder von PIS) im Jahre 2005 und ihr Versuch, die nach 1989 etablierte 3. Reden Regierenden.« publik durch eine 4. Republik abzulösen, sind dafür der beste Be(3.) Die Hoffnungen der Menschen waren auf den Westen gerichweis. Ihnen war es gelungen, die Verlierer der Systemtransformatet, das Ziel einer geradezu mythischen »Rückkehr nach Eution auf ihre Seite zu ziehen. Dabei profitierten sie besonders von ropa« zähmte selbst die radikalen Teile der politischen Elite. der niedrigen Wahlbeteiligung in Polen seit 1989, die es Ihnen er(4.) Die Gesellschaft war trotz der Positionen von »Solidarnosc« möglichte, mit nur 27 % der Stimmen (bei einer Wahlbeteiligung und der katholischen Kirche politisch schwach organisiert, von 40 %) die Regierung zu übernehmen. das Gefühl der Alternativlosigkeit gegenüber den Reformen Dass dies gelang, hing wesentlich mit der zweiten Grundentlähmte die Gesellschaft. scheidung der Regierung Mazowiecki aus dem Jahre 1989 zusam(5.) Die Entscheidungsprozesse waren entpolitisiert. Die Schwäche men, der Politik des sogenannten »dicken Strichs«. der Parteien, der gesellschaftlichen Organisationen und der Premier Mazowiecki sagte in seiner Regierungserklärung »Wir ziesozialen Bewegungen erlaubte es den regierenden Eliten, ihre hen einen dicken Strich unter die Vergangenheit. Wir werden nur das verEntscheidungen, insbesondere den »Balcerowicz-Plan« ohne antworten, was wir getan haben, um Polen aus der jetzigen Krise zu helnennenswerte gesellschaftliche Diskussion durchzuführen. fen«. Dies bedeutete den Verzicht auf eine juristische Abrechnung mit den Repräsentanten des kommunistischen Regimes und der Vorläufige Bilanz der Transformation in Polen Konzentration der Kräfte auf einen gemeinsamen Aufbau eines demokratischen Polen. Deshalb entstand in Polen auch zunächst Für eine Bilanz der Transformation in Polen nach 20 Jahren ist es keine der Gauck-Behörde in Deutschland vergleichbare Instituaufschlussreich, sich jenseits der aktuellen politischen Auseinantion. Diese Politik des Einfrierens der Geschichte und der Archive dersetzungen um die Rolle des »Runden Tisches«, um die Erfolge erwies sich schon sehr bald als schwerwiegende Belastung für und Misserfolge der Umgestaltung, um die Notwendigkeit der den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft. Den Gegnern der Abrechungen mit dem kommunistischen System die Ergebnisse Politik des »dicken Strichs« gelang es immer wieder, durch die der Meinungsbefragungen anzuschauen. Denn daraus ergibt Veröffentlichung von tatsächlichen oder fingierten belastenden sich – trotz aller innerpolnischen Streitigkeiten und offensichtliMaterialien des Geheimdienstes der Volksrepublik Polen politichen negativen Begleiterscheinungen – das Bild eines alles in sche Gegner zu diskreditieren. allem sehr erfolgreichen und gelungen Übergangs von einer An dieser Praxis scheiterte auch eine der Regierungen aus dem kommunistischen Diktatur zu einem demokratischen System und »Solidarnosc-Lager«. Da es keine gesetzliche Grundlage für den »E s be g a nn in Gd a n s k« – R ü ck bl i ck und B il a n z D&E Heft 58 · 2009 von einer kommunistischen Planwirtschaft zu einer liberalen Marktwirtschaft. Auffallend ist dabei vor allem, dass der Zufriedenheitsindex nach dem Beitritt Polens zur EU auf allen Gebieten merklich zugenommen hat. Dies zeigt sich auch z. B. in folgenden demoskopischen Befunden: (1.) Hat sich der Systemwechsel 1989 gelohnt? 1994 antworteten 60 % mit Ja und 29 % mit Nein, im Jahr 2009 stieg die Zustimmung auf 82 % und nur noch 9 % antworteten mit Nein- [cbos 02/2009) (| Abb. 4 |) (2.) Brachte die Transformation mehr Kosten oder mehr Vorteile mit sich? Abb. 5 Meinungsumfrage 2009: »Sollen die Menschenrechtsverletzungen zur Zeit der Volksrepublik 1994 glaubten noch 42 % dass die BelasPolen heute noch vor Gericht gestellt werden?« © CBOS, Polish Public Opinion 1/2009 S. 2 tungen größer waren als die Entlastungen (12 %), im Jahr 2009 hatten sich die Kneip, Matthias/Mack, Manfred (2007): Polnische Geschichte und deutschEinschätzungen radikal geändert, nun glaubten nur noch 15 % polnische Beziehungen. Berlin. Cornelsen-Verlag. das die Kosten überwogen hätten, während 56 % eindeutig die Vorteile und die Entlastungen sahen. (| M 3 |) Mack, Manfred (2008): Polens Identitätssuche nach dem Beitritt zur EU. In: (3.) Ist das System der Marktwirtschaft und des privaten UnternehmerDeutschland & Europa, Heft 56, S. 52–57. tums das beste Wirtschaftssystem für Polen? www.deutschlandundeuropa.de/56_08/buergerunion.htm. 2000 wurde diese Frage nur von 41 % bejaht, 2006 sogar nur Merli, Franz/Wagner, Gerhard (Hrsg.)( 2006): Das neue Polen in Europa: Polivon 35 %. Im Jahr 2009 bejahten bereits 59 % der Menschen tik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. Innsbruck: Studien Verlag. diese Frage [cbos 3/2009] (| M 8 |) (4.) Zufriedenheit mit den materiellen Lebensbedingungen Meyer, Gerd/Sulowski, Stanislaw/Lukowski, Wojciech (Hrsg.)(2007): BrennIm Zeitraum von 1994 bis 2009 stieg der Zufriedenheitsindex punkte der politischen Kultur in Polen und Deutschland. Warszawa: Dom von 26 auf 52 %, die Anzahl der Unzufriedenen ging von 40 auf Wydawniczy Elipsa. 19 % zurück. [cbos 1/2009] (| M 6 |) Quo vadis, Polonia? (2006): Kritik der polnischen Vernunft (Osteuropa Heft (5.) Soll die Periode der Volksrepublik weiterhin juristisch aufgearbeitet wer11–12/06) den oder soll man die Akten den Historikern zur Auswertung übergeben? In dieser innenpolitisch sehr umstrittenen Frage geben die Raabe, Stephan (2008): Transformation und Zivilgesellschaft in Polen: Die Befunde der Meinungsumfragen ein erstaunlich eindeutiges Kirche als »Verbündete« der Zivilgesellschaft. Überlegungen anhand neuer Ergebnis: Die übergroße Mehrheit (76 %) hält die juristische Studien. Warschau: Konrad-Adenauer-Stiftung. Aufarbeitung nicht für sinnvoll und will die Akten lieber in den www.kas.de/wf/de/33.14171/ Händen der Historiker sehen, nur 18 % sind gegenteiliger MeiPolen-Analyse Nr. 55 (2009): 1989: Zwanzig Jahre danach. Mit einem Beitrag nung. [cbos 6/2009] (| Abb. 5 |) von Andrzej Paczkowski. www.laender-analysen.de/polen/ (6.) Was hat am stärksten zum Niedergang des Kommunismus in der Sowjetunion und den anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks beigetragen? Janicki, Mariusz/Wladyka, Wieslaw (2009): Denkmal mit Rissen. Polnisches Hier werden an erster Stelle die Solidarnosc und die polnische Original in: Polityka Nr. 23 deutsche Übersetzung: Opposition (44 %), danach das Pontifikat des polnischen www.de-pl.info/de/page.php/article/1598 Papstes (38 %), die Politik Michail Gorbatschows (25 %), die Smolar, Aleksander (2006): Polen: Die Radikalen an der Macht, in: Transit 31. Politik Ronald Reagans (10 %) genannt. 44 % der Befragten www.eurozine.com/articles/article_2006-09-28-smolar-de.html sind der Meinung, dass die Ereignisse in Polen, zum Niedergang des Kommunismus in den anderen Ländern beigetragen hat, 37 % glauben, dass es ohne die Veränderungen in Polen Internethinweise auch keine Änderung in den anderen Ländern gegeben hätte. Offensichtlich teilt eine Mehrheit der Polen die von der polniwww.deutsches-polen-institut.de/Service/Links/index.php (Linksammschen Regierung im Jubiläumsjahr lancierte Sichtweise. Blickt lung des Deutschen Polen-Instituts) man auf die Feierlichkeiten und Veranstaltungen zum 20. Jahwww.cbos.pl/EN/home_en/cbos_en.php (Aktuelle Meinungsumfragen) restag der friedlichen Revolutionen, so scheint sich diese Einschätzung auch außerhalb Polens durchzusetzen: Es begann www.de-pl.info/pad (Polityka auf Deutsch. Ausgewählte Beiträge der Woin Danzig. [cbos 2/2009] (| M 10 |) chenzeitschrift Polityka in deutscher Übersetzung. Kostenloses online-Abo und Archiv) Literaturhinweise Bertelsmann Transformations-Index für Polen (Poland Country Report 2008) mit deutscher Zusammenfassung. www.bertelsmann-transformation-index.de/169.0.html?&L=1 Bingen, Dieter/Ruchniewicz, Krzysztof Ruchniewicz (Hrsg.) (2009): Länderbericht Polen. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur. Bonn: Bpb 2009 (=Schriftenreihe; Bundeszentrale für Politische Bildung; Bd. 735). www.eurozine.com (online erscheinendes Magazin, Eurozine – Gesellschaft zur Vernetzung von Kulturmedien mbH mit ausgewählten Beiträgen aus 70 europäischen Kulturzeitschriften) www.laender-analysen.de/polen/ (Polen-Analysen: vierzehntägig erscheinende Analysen, die kostenlos abonniert werden können, frühere Ausgaben sind online abrufbar) www.bpb.de/themen/SKSN6I (Dossier der BpB zu Polen) Buras, Piotr/Tewes, Henning (2005): Polens Weg von der Wende bis zum EU-Beitritt. Stuttgart; Leipzig: Hohenheim-Verlag. www.poland.gov.pl/index.php?document=3 (Offizielles Förderportal der Republik Polen mit zahlreichen Beiträgen zu Politik, Kultur und Geschichte Polens) Freiheitliche Farbenlehre. Der Wende Not und Blütenträume (2009). Themenausgabe der Zeitschrift polenplus (P+) Nr. 09. www.transodra-online.net/ (Transodra-online. Internetportal mit aktuellen deutschen und polnischen Presseartikeln zu Polen) D&E Heft 58 · 2009 »E s be g a nn in Gd a n s k« – R ü ck bl i ck und B il a n z 43 MANFRED MACK sagen, dass es heute so ist. Es lohnt sich demnach, dieses Tages zu gedenken, an dem die Polen es verstanden haben, sich zu mobilisieren und Verantwortung für ihre Freiheit zu übernehmen.« Materialien © »Rzeczpospolita«, 4. Juni 2009 M 4 Der SPIEGEL: Die herbeigeredete Revolution M 1 Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts in Polen, Ost- und Westdeutschland 1989–2002 (1991=100) © nach: Stöber, Georg (2003). Der Transformationsprozess in (Ost-)Deutschland und Polen. Hannover. Hahn-Verlag, S. 184 M 2 Die polnische Tageszeitung »Rzeczpospolita« 44 Der 20. Jahrestag des Falls des Kommunismus in Polen müsse gefeiert werden, schreibt Pawel Lisicki in der konservativen Tageszeitung Rzeczpospolita: »Man könnte vieles über die Geschichte der vergangenen 20 Jahre erzählen. Mit Sicherheit war es die Zeit eines gewaltigen Zivilisationssprungs. Es reicht, zu sagen, dass das durchschnittliche ProKopf-Einkommen seit 1989 um ein Siebenfaches gestiegen ist. (…) So ist es kaum vorstellbar, dass noch in der Mitte der 80er Jahre alles anders ausgesehen hat. Es gab keinerlei Hoffnung auf Besserung, auf richtige Reformen und auf Befreiung aus dem kommunistischen Korsett. (…) Folglich wäre es eine Erfolgsstory. (…) Aber über die vergangenen 20 Jahre kann man auch etwas ganz anderes sagen: War es nicht eine Zeit, in der die Werte verwässert wurden? Eine Zeit des Gedächtnisschwundes [keine Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur] und der Schwächung des staatsbürgerlichen Bewusstseins? (…) Statt Nationalstolz hat man uns Scham und Misstrauen gegenüber einer starken nationalen Identität gelehrt. (…) Aber heißt das, es gebe keinen Grund zum Feiern? Im Gegenteil. Selbst wenn das Schicksal der Polen am 4. Juni 1989 nicht alleine von den Polen abhing, kann man Innerhalb von zwei Monaten krempelte der Runde Tisch Polen vollkommen um. Als die Teilnehmer am 5. April 1989 wiederum im Palais Radziwill das 200-seitige Schlussdokument vorstellten, lag einmal mehr das Bewusstsein in der Luft, Geschichte zu schreiben. Nie zuvor hatte eine kommunistische Partei im Ostblock freiwillig ihr Machtmonopol aufgegeben, immer waren Versuche, die Vorherrschaft der Kommunisten infrage zu stellen, mit Waffengewalt beendet worden. Jetzt aber zeigte sich die polnische KP bereit, die Macht mit anderen zu teilen. Volle Demokratie erschien damals auch den Oppositionellen noch als utopisches Ziel. Als die Solidarnosc-Vertreter am Runden Tisch den halbfreien Wahlen zustimmten, existierte der Warschauer Pakt noch, und mit der DDR und der Tschechoslowakei hatte Polen zwei reformfeindliche Nachbarn. Dass alles sehr viel schneller gehen würde, ahnte niemand. Die Kommunisten glaubten noch immer, Rückhalt in der Bevölkerung zu haben; die Solidarnosc war traumatisiert durch die Erfahrung des Kriegsrechts, das die 1980 errungene Freiheit zunichte gemacht hatte. »Es ist paradox«, urteilte der spätere Staatspräsident Aleksander Kwasniewski, der für die PVAP am Gewerkschaftstisch saß: »In der Fehleinschätzung lag Polens Chance.« Dann allerdings sprach das Volk – und beim Wahlgang am 4. Juni 1989 erlebten die Kommunisten eine unvergleichliche Niederlage. Sämtliche nicht garantierten Sitze gingen an die Opposition. Trotz des Debakels der Kommunisten hielt die Solidarnosc an den Vereinbarungen vom Runden Tisch fest, auch wenn viele Kompromisse durch die Beschleunigung der Ereignisse Makulatur geworden war. Aber nicht nur deshalb wurde sie heftig kritisiert; vielen galt der Pakt mit den alten Machthabern von Anfang an als »Verrat an den Arbeitern« – anders als die Zulassung der unabhängigen Solidarnosc im August 1980 war die »Refolution« von 1989 nicht auf der Straße von einer Massenbewegung erstritten, sondern zwischen den Eliten ausgehandelt worden. Dem Runden Tisch fehlte der gesellschaftliche Unterbau. Über das »große historische Experiment« (Kiszczak) wird bis heute heftig gestritten. Den liberalen Polen gilt der Runde Tisch als Symbol für das »Wunder der Empfängnis der Dritten Republik«, so Adam Michnik, das in einer für Polen untypischen Weise errichtet wurde, nämlich nüchtern und ohne Blutvergießen. Für die Konservativen hingegen ist das geschichtsträchtige Möbel, das heute als Museumsstück im Palais Radziwill zu besichtigen ist, Sinnbild eines faulen Kompromisses zugunsten der alten Kräfte, die so ihre Privilegien in die neue Zeit retten konnten. Zu den schärfsten Kritikern des »historischen Kompromisses« zählen die nationalkonservativen Kaczynski-Zwillinge. Der Runde Tisch ist für Lech Kaczynski, Polens derzeitigen Präsidenten, und seinen Bruder Jaroslaw, 2006/7 kurzzeitig Ministerpräsident, heute ein Schandmal, der Pakt mit dem Regime, den sie 1989 selbst mitgestalteten, eine falsche Verständigung. © http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/3626/die_herbeigeredete_revolution.html M 3 »Erbrachte die Transformation nach 1989 mehr Nach- oder mehr Vorteile?« © CBOS, Polish Public Opinion 2/2009 S. 2 »E s be g a nn in Gd a n s k« – R ü ck bl i ck und B il a n z D&E Heft 58 · 2009 M 5 Jaroslaw Kaczynski, ehemaligen Ministerpräsident Polens, zur Transformation in Polen »In Polen ist der postkommunistische Staat schlechthin entstanden, sozusagen ein postkommunistisches Monstrum. Ein Monstrum, in dem die Nomenklatura die gesellschaftliche Vorherrschaft errang, die sich sehr schnell zur politischen Vorherrschaft weiterentwickelte und die Wiedereroberung der Macht einleitete. Ein Monstrum mit einem hohen Maß an Pathologien, wie sie das vergangene System hinterlassen hatte. Die Nomenklatura gedieh im neuen System bestens und schaffte parallel zur offiziellen Ordnung ein alternatives Steuerungssystem aus verschiedenen Institutionen, insbesondere solche, die etwas mit der Güterverteilung zu tun haben, denn eben um diese Güterverteilung ging es insbesondere.« © Gazeta Wyborcza, 4.6.2006. M 7 »Kebab« – Die Zukunft der Geburtstätte der Solidarnosc, der ehemaligen Lenin-Werft in Danzig, hängt im Jahr 2009 von arabischen Investoren ab. © Andrzej Mleczko, Polen 2009 »Wir, die wir die ›Zentrumsallianz‹ (PC) bildeten, gingen von folgender gesellschaftlichen Diagnose aus: Man darf die Gesellschaft nicht ruhigstellen, denn das würde zur Apathie führen, vielmehr muss man ihr etwas bieten, da sie großen ökonomischen Belastungen ausgesetzt ist und sich moralisch ungerecht behandelt fühlt. Einerseits muss man […] eine große Reformbewegung für die Privatisierung initiieren. […] Andererseits muss man dieser Gesellschaft im Rahmen der laufenden Maßnahmen möglichst rasch und möglichst viel in der moralischen Sphäre anbieten. Das ist durchaus möglich, weil es viele Gründe für die gesellschaftliche Frustration gibt, die nichts mit der Wirtschaft zu tun haben.« 45 © Jaroslaw Kaczynski, »Nowa Polska czy jescze stara?« (Ein neues Polen oder noch das alte?), Interview mit Teresa Toranka in ihrem Sammelband My (Wir), Warschau 1994, S. 115 M 8 »Denken Sie, dass die Marktwirtschaft das beste Wirtschaftssystem für Ihr Land ist?« © CBOS 2/2009, www.cbos.pl M 9 Arbeitslosenquote in Polen, in West- und Ostdeutschland 1990–2001 M 6 »Sind Sie im Allgemeinen mit Ihrer Situation zufrieden?« © CBOS, Polish Public Opinion 1/2009 S. 2 D&E Heft 58 · 2009 © Stöber, Georg (2003). Der Transformationsprozess in (Ost-)Deutschland und Polen, ebenda, S. 185 »E s be g a nn in Gd a n s k« – R ü ck bl i ck und B il a n z MANFRED MACK 46 demokratischen Wettbewerbs nicht gelingen würde, die Teilung Deutschlands aufrecht zu erhalten und dass die DDR ein Kasernenstaat war, der ohne die Präsenz der Roten Armee nicht weiter bestehen würde. (…) Wer hat in Polen den Kommunismus gestürzt? In Polen hat das die Arbeiterklasse getan, die aber auch zum ersten Opfer der Transformation wurde. Stellen wir uns einen großen Industriebetrieb vor, der durch Streiks die Machthaber zu Zugeständnissen bewegen konnte. Dieser Betrieb stellte Lenin-Büsten für Schreibtische her. Die Beschäftigten arbeiteten gut. 1989 hörten sie nicht auf, gut zu arbeiten. Doch heute braucht niemand mehr Lenin−Büsten. Der Markt hat diesen Betrieb zerstört. Die Arbeiter, mit deren Hilfe die Freiheit erstreikt werM 10 »Was hatte Ihrer Meinung nach den größten Einfluss auf den Zusammenbruch der UdSSR und den konnte, fielen dieser Freiheit zum Opfer. anderer kommunistischer Staaten?« © CBOS, Polish Public Opinion 2/2009 S. 3 Das ist das erste Paradox der Demokratie in Polen. (…) Die Kritiker der demokratischen TransformaM 11 Adam Michnik: Reflexionen über 1989 tion in Polen sagen, dass die Bilanz der beiden Jahrzehnte negativ sei. Sie sagen, dass die Täter der größten kommunistischen VerJe nach Standpunkt sind die Antworten auf die Frage nach den Urbrechen nicht verurteilt worden sind (…); dass sich die Korruption sachen für den Untergang des Kommunismus verschieden. Wenn breit mache; dass die großen Eigentumsunterschiede und das man in Washington lebt, so wird einem ein Amerikaner antworten, bittere Gefühl vieler Kinder der Solidarnosc−Revolution sie sagen dass dies das Ergebnis der US−Politik gewesen sei. Ein Demokrat lassen, für so ein Polen hätten sie nicht gekämpft. Sie sagen auch, wird sagen, dass dies ein Ergebnis der von Jimmy Carter durchgedass die Kriterien verloren gegangen sind, wie die Helden der setzten Menschenrechtspolitik gewesen sei. Also dessen, was die Vergangenheit einzuschätzen seien. (…) 1989 war die SowjetDissidenten mit Vladimir Bukovskij eine »Entspannung mit union noch ganz gut in Schuss, und niemand konnte ihre Selbstmenschlichem Antlitz« nannten. Ein Republikaner wird sagen, zerstörung voraussehen. (…) Der 4. Juni 1989 ist zu einem symboldass dies ein Ergebnis der Politik Reagans gewesen sei, da er einen haften Datum geworden. An diesem Tag fanden in Polen freie Rüstungswettlauf eingeleitet habe, den die Sowjetwirtschaft nicht Wahlen statt −− nicht ganz demokratische, aber doch schon richmehr habe verkraften können. Im Vatikan wiederum kann man tige Wahlen, die dem System der kommunistischen Diktatur die hören, dass der Untergang des Kommunismus hauptsächlich das Legitimation nahmen; am selben Tag wälzten in Peking auf dem Verdienst Johannes Pauls II. und seines Wirkens gewesen sei, der Platz des Himmlischen Friedens die Panzer die Demonstration diesem System insbesondere in Polen die Legitimation genomjener Studenten nieder, die demokratische Freiheiten forderten. men habe. Wenn man in Kabul lebt, so wird einem gesagt, dass Wer heute sagt, dass damals alles auf der Hand gelegen habe, der Kommunismus wegen des sowjetischen Einmarschs in Afghaverschweigt, dass er damals nichts Derartiges sagte. nistan untergegangen sei, aber auch am vernünftigen Widerstand © www.eurozine.com 3/, 30.4.1009, Original in Polnisch, Übersetzung: Peter Oliver Loew, der Afghanen scheiterte, die das Sowjetimperium in eine auswegaus: Adam Michnik: »Osteuropa« 2−3/2009 lose Situation geraten ließen. In Berlin heißt es, der Untergang des Kommunismus sei das Ergebnis einer vernünftigen »Ostpolitik«, die dazu geführt habe, dass die Sowjetunion über Dinge M 12 Solidarnosc-Aktivist Henryk Wujec über 1989 reden musste, über die sie zuvor nicht hatte reden wollen. In Moskau erzählt jeder, es sei das Ergebnis von Gorbatschows PerestroDer Solidarnosc-Aktivist Henryk Wujec saß 1989 mit am »Runden Tisch« ika, und in Warschau, dass es das Verdienst der Solidarnosc, Walein Polen. Mit Tadeusz Mazowiecki, dem späteren Premier Polens, verhansas usw. gewesen sei. Kurz gesagt − auf diese Frage gibt es nicht delte er über die Wiederzulassung der verbotenen Gewerkschaft Solidarnur eine Antwort. Ein ganzes kompliziertes Faktorbündel ließ die nosc. Er war noch während des Studiums zur Opposition gestoßen, hatte politische Elite in der Sowjetunion zu der Einsicht gelangen, das 1968 die Studentenrevolte in Warschau unterstützt und später das Komiseine gewisse demokratische Modernisierung unausweichlich sei tee zur Verteidigung der Arbeiter (KOR) mitgegründet. und der Sozialismus anderenfalls nicht überleben würde. (…) taz: Herr Wujec, wie finden Sie das heutige Polen? Wenn ich über den Sinn dessen nachdenke, was in Polen am RunHenryk Wujec: Schön! Es ist das Polen, für das ich gekämpft habe. den Tisch geschah und was zu einer Art Blaupause für andere LänNatürlich hat es immer noch viele Fehler und Mängel. Aber die komder wurde, sind einige Faktoren frappierend. Erstens war es eine menden Generationen müssen ja auch noch etwas zu tun haben. große Revolution ohne Revolution. Niemand ging auf die Straße, Nein, im Ernst: Was wir geschafft haben, ist eine große Sache. es gab keine Barrikaden und keine Erschießungskommandos. taz: Sie haben für Solidarnosc 1989 am runden Tisch in Warschau mit Alle hatten die Barrikaden von 1980 und während des Kriegsden Kommunisten verhandelt. Haben Sie erwartet, dass Sie zwanzig Jahre rechts vor Augen. Das historische Bewusstsein gab den Rahmen später in einer Demokratie leben würden? dessen vor, wie wir die Zukunft sahen. Niemand von uns hatte ein Henryk Wujec: Wir hatten nicht die geringste Ahnung. SchließGefühl dafür, was geschah. Wie Aleksander Kwasniewski viele lich lebten wir seit 1945 im kommunistischen Block. Wir wussten, Jahre später sagen sollte, ist ungewiss, wie sich alles entwickelt dass alle Versuche, sich von diesen Fesseln zu befreien, mit dem hätte, wären sich beide Seiten in Polen damals bewusst gewesen, Einmarsch der sowjetischen Armee enden würden. So wie in 1956 dass dies alles auf eine Vereinigung Deutschlands hinauslaufen Ungarn oder 1968 in der Tschechoslowakei. Unsere Hauptfordewürde. Dennoch war man sich in der Opposition bewusst, dass rung war nur die Wiederzulassung der unabhängigen Gewerkein vereinigtes Deutschland nur natürlich sei. Vielleicht wurde schaft Solidarnosc. das nicht offen thematisiert, aber wir dachten so. Für mich war es taz: Wie wirkten Glasnost und Perestroika? offensichtlich, dass es unter den normalen Verhältnissen eines »E s be g a nn in Gd a n s k« – R ü ck bl i ck und B il a n z D&E Heft 58 · 2009 Henryk Wujec: Uns war klar, es war viel möglich. Sehr viel. Aber dass in Polen innerhalb von ein paar Monaten eine demokratische Regierung entstehen könnte und sich später sogar die sowjetische Armee freiwillig aus Polen zurückziehen könnte, das hatten wir in unseren kühnsten Träumen nicht erwartet. taz: Am Gebäude der ehemaligen polnischen Botschaft in Berlin hängt ein Banner mit der Aufschrift »Es begann in Gdansk«. Warum ist das so wichtig? Henryk Wujec: Weil eben wirklich alles in Danzig begann, das freie Polen, der Fall der Mauer, die samtene Revolution, das Ende des Kommunismus. Es begann mit den Streiks auf der LeninWerft, wo die Arbeiter die erste unabhängige Gewerkschaft im damaligen Ostblock erkämpften. Die Solidarnosc machte dann allen anderen vor, dass es möglich ist, das scheinbar Unmögliche zu erreichen. Der Fall der Mauer begann in Danzig. Daran sollten sich die Deutschen erinnern. taz: Denken Sie, dass die Montagsdemonstrationen in Leipzig, Berlin und anderen Städten die Solidarnosc-Streiks zum Vorbild hatten? Henryk Wujec: Die Polen waren schon frei. Sie hatten sich selbst befreit. Das gab allen anderen Mut, auch den Deutschen. Sie würden es allein schaffen. Der Ruf »Wir sind ein Volk!« zeigt das doch. Hilfe von außen war nicht notwendig, keine amerikanischen Panzer und keine waffenstarrenden Armeen. taz: Als dann am 9. November in Berlin die Mauer fiel: Was war das für ein Gefühl in Polen? Henryk Wujec: Das war ein furchtbares Wechselbad der Gefühle. Einerseits freuten wir uns für die DDR-Deutschen, andererseits kroch in uns eine tief sitzende Angst hoch. Kanzler Helmut Kohl war damals gerade zu Besuch in Polen. Als er seine Visite unterbrach und nach Berlin fuhr, hielt ganz Polen den Atem an: Würde Kohl nach Polen zurückkommen und die lang geplante Visite fortsetzen? Er kam zurück. Das war gut. Aber die Angst wich lange nicht. Ich zum Beispiel kam als Zweieinhalbjähriger ins KZ Majdanek. Meine Eltern konnten flüchten und sich in den Wäldern verstecken. Ich wurde gegen Bezahlung rausgeschmuggelt. Sonst hätte ich nicht überlebt. Das vergisst man nicht. Bei der Wiedervereinigung Deutschlands dachte Kohl aber nicht an Polen und unsere furchtbaren Kriegserfahrungen. Wir wollten, dass er so schnell wie möglich die deutsch-polnische Grenze anerkennt. Er aber wollte Rücksicht nehmen auf die Vertriebenen und erst die Wahlen gewinnen. Das hat uns furchtbar verletzt. taz: Schmerzt es die Polen, dass der Fall der Mauer weltweit zum Symbol für das Ende des Kommunismus wurde? Henryk Wujec: Ja, das tut schon weh. Der runde Tisch ist ein Möbelstück, das sich nicht gut als Symbol eignet. Der SolidarnoscSchriftzug ist zu polnisch, Papst Johannes Paul II. wieder zu universal. Lech Walesa zerstörte seinen Ruhm als Arbeiterheld in der Zeit seiner Präsidentschaft, dazu kamen später noch die Vorwürfe aus dem Institut des Nationalen Gedenkens, dass Walesa als Spitzel IM »Bolek« für die Stasi gearbeitet habe. Polen hat kein gutes Symbol. Aber es ist eben so: Es begann in Danzig. taz: Würde sich der runde Tisch als nationales Symbol für den friedlichen Übergang eignen? Henryk Wujec: Eher nicht. Denn mit dem runden Tisch sind zwei Mythen verbunden. Ein positiver vom friedlichen Übergang zur Demokratie und ein negativer vom angeblichen Verrat der Solidarnosc-Führer und einem Geheimpakt zwischen ihnen und den Kommunisten. Das ist natürlich Unsinn. Es sind auch nie irgendwelche Beweise aufgetaucht. Der runde Tisch ist zwar enorm wichtig, eignet sich aber nicht als Symbol. Alle Stürme überstanden hat dagegen der berühmte rote Schriftzug »Solidarnosc«. taz: Sie haben 1989 das Wahlplakat mit Gary Cooper lanciert, das weltberühmt wurde. Henryk Wujec: Ich organisierte damals mit anderen die Wahlen für die Solidarnosc. Wir hatten nichts, kein Fernsehen, kein Radio, keine Zeitungen. Die Kommunisten hingegen hatten Zugang zu allen Massenmedien. Wir hatten Angst, die Wahlen zu verlieren, weil niemand wusste, wer zu uns gehörte. Bislang hatte die Opposition immer dazu aufgerufen, die Wahlen zu boykottieren. D&E Heft 58 · 2009 M 13 Polens Staatspräsident Lech Kaczynski am 6. Februar 2009 auf einem Treffen von Historikern zum 20. Jahrestag der Gespräche am »Runden Tisch« in Polen. Im Hintergrund Tomasz Sarneckis Wahlplakat mit dem Titel: »Solidarnosc – High noon am 4. Juli 1989«. Es zeigt den US-amerikanischen Filmschauspieler Gary Cooper mit einer Papierrolle anstatt eines Revolvers – einem Symbol der »Friedlichen Revolution«. © picture alliance, dpa Diesmal sollten alle hingehen. Gesucht wurden Ideen für einprägsame Plakate und Flugblätter. taz: Aber ein Cowboy in Polen? Henryk Wujec: Das war genial. Der amerikanische Cowboy stand für den Traum, in Polen einst so frei leben zu können wie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich habe diese Idee eines Kunststudenten gegen meine Kollegen durchgesetzt. Heute erinnert dieses Plakat an den ersten großen Wahltriumph der Solidarnosc. Mit Gary Cooper haben wir die Wahlen gewonnen! Am Ende war Tadeusz Mazowiecki der erste nichtkommunistische Ministerpräsident in Polen und im gesamten damaligen Ostblock. taz: Was ist aus der Solidarnosc geworden? Henryk Wujec: Die Gewerkschaft gibt es bis heute, wenn sie auch stark geschrumpft ist und für andere Ziele kämpft als damals. Die Freiheitsbewegung zersplitterte sich in viele kleine und einige größere Parteien. Schon vor dem runden Tisch gab es einen ersten Bruch. Einige hielten es für falsch, sich auf Verhandlungen mit den Kommunisten einzulassen. Andere meinten, dass die Solidarnosc bereits 1981, als General Jaruzelski das Kriegsrecht über Polen verhängte, untergegangen war. Aber die Masse hielt nach wie vor zu Lech Walesa, dem Arbeiterhelden von 1980. Als geschlossene Einheit siegte die Solidarnosc ein letztes Mal bei den ersten noch halbdemokratischen Wahlen am 4. Juni 1989. taz: Und die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei? Henryk Wujec: Löste sich auf, um sich wenig später unter anderem Namen neu zu gründen. Heute spielt die Herkunft aus dem Solidarnosc- oder Kommunistenlager aber kaum noch eine Rolle. Die linken Parteien haben wirtschaftsliberale Programme, und die rechten übernehmen schon mal die antideutsche Propaganda aus der kommunistischen Gomulka-Zeit. […] © Tageszeitung (taz), 5.2.2009, Das Interview führte Gabriele Lesser M 14 »Trugen Ihrer Meinung nach die Ereignisse in Polen 1989 zum Zusammenbruch des Kommunismus in anderen Staaten bei?« © CBOS, Polish Public Opinion 2/2009 S. 3 »E s be g a nn in Gd a n s k« – R ü ck bl i ck und B il a n z 47 III. MAUERÖFFNUNG IN EUROPA 3. Ungarn öffnet die Grenze – »Vom Musterknaben zum Sorgenkind« WALTER-SIEGFRIED KIRCHER | DIETRICH ROLBETZKI D ie Bilder von jubelnden Menschen auf der Berliner Mauer, von Lech Walesa und den Gesprächen am Runden Tisch in Warschau, von deutschen Urlaubern in der Prager Botschaft, sie waren auf der ganzen Welt zu sehen. Wie unspektakulär ging es dagegen Monate zuvor im Mai 1989 an der österreichisch-ungarischen Grenze zu, als Soldaten mit dem Abbau der Sperranlagen begannen. Dass auch dieses Ereignis das Ende der DDR zur Folge hatte, war damals wohl weder den Beteiligten noch den Verantwortlichen bewusst. »Das wird Ihnen das deutsche Volk niemals vergessen«, versicherte Bundeskanzler Helmut Kohl im August 1989 dem ungarischen Ministerpräsidenten Miklós Németh, als er erfuhr, dass Ungarns Westgrenze bald auch für Zehntausende Ostdeutsche offen stünde. Zwanzig Jahre später ist zu registrieren, dass Ungarn zuletzt in Öffentlichkeit und Medien im Rückblick auf 1989 eine vergleichsweise geringe Aufmerksamkeit erfährt, und, wenn doch erwähnt, dann mit negativen Schlagzeilen im Zusammenhang mit wachsendem Rechtsextremismus und katastrophaler Wirtschaftslage im Gefolge der Weltwirtschaftskrise. Befindet sich das einst so gelobte ungarische Nachwendemodell politisch, wirtschaftlich und sozial in einer Krise, auf dem Weg weg von Europa? 48 »Wir wollen nicht länger Sklaven sein«: Ungarn 1956 Mit den Worten des Dichters Sándor Petöfi begehrten am 23. Oktober 1956 Zehntausende von Demonstranten in Budapest gegen die Herrschaft der Kommunisten und die sowjetischen Truppen im Lande auf. Als Verlierer des Ersten Weltkrieges hatte Ungarn zwei Drittel seines Gebietes eingebüßt. Das Land hatte sich dann mit Nazideutschland eingelassen und war am Ende erneut Kriegsverlierer und von sowjetischen Truppen besetzt. Mit deren Hilfe, Terror, Wahlbetrug, erzwungenen Koalitionsregierungen und Parteizusammenschlüssen gelangten die Kommunisten bis 1949 an die alleinige Macht. Ungarn wurde Volksrepublik, in der »der ungarische Stalin« (Holger Fischer) Mátyás Rákosi eine Schreckensherrschaft errichtete und sein Land nach sowjetischem Vorbild umformte. Die Abrechnung des sowjetischen KP-Generalsekretärs Nikita Chruschtschow im Februar 1956 mit Stalin und seinen Verbrechen ließ eintreten, was der verstorbene Diktator geahnt hatte: »Ohne mich geht ihr unter.« Chruschtschows Rede hatte in Ungarn Hoffnungen geweckt, doch Veränderungen waren ausgeblieben. Und so wuchs, vor allem unter den Intellektuellen, die Unruhe. Am Abend des 22. Oktober 1956 forderten Tausende von Studenten der Technischen Universität in Budapest Pressefreiheit, eine neue Regierung unter dem Reformkommunisten Imre Nagy und den Abzug der Russen. Dann beschlossen sie für den folgenden Tag eine Demonstration, um ihre Solidarität mit den polnischen Reformkommunisten zu bekunden. Tags darauf ertönten auf Budapests Straßen die Forderungen der Studenten, und um sie noch weiter zu verbreiten, zogen Demonstranten zum Rundfunkgebäude. Dort wurde die Ausstrahlung verweigert, und Angehörige des Sicherheitsdienstes AVH schossen in die Menge und lösten damit den Aufstand aus. Denn die bisher friedlichen Demonstranten besorgten sich nun eilends Gewehre und Munition aus Budapester Waffenfabriken, erhielten sie aber auch von herbei befohlenen Soldaten, die meist zu ihnen überliefen. Um noch zu Abb. 1 Ein sowjetischer Panzer in Budapest nach dem Aufstand im Dezember 1956. Am 23. Oktober 1956 fielen bei einer zunächst friedlichen Kundgebung in Budapest erste Schüsse. Arbeiter, Studenten und Jugendliche bewaffneten sich und nahmen den Kampf gegen die einrückenden sowjetischen Truppen auf. © dpa 1956 retten, was zu retten war, übergab die kommunistische Parteiführung Imre Nagy das Amt des Ministerpräsidenten, wohl in der Hoffnung, er könne die Aufständischen steuern. Nur wenig später entschied man in Moskau, Sowjetpanzer einzusetzen, was auch die KP erbat. Die Russen aber trafen, anders als 1953 in Ost-Berlin, auf bewaffneten Widerstand. Am 25. Oktober kam es vor dem Parlament zu einem Blutbad, auch in anderen Städten – der Funke aus Budapest war auf das Land übergesprungen – gab es nun Demonstrationen und Tote. Am 28. Oktober schwiegen die Waffen und die Regierung nannte die Ereignisse nun eine »nationale demokratische Bewegung«. Wenig später begann der ausgehandelte Abzug der sowjetischen Panzer. Am 30. Oktober verkündete Nagy die Abschaffung des Einparteiensystems und den Beginn einer »Demokratisierung«. In den Großbetrieben waren inzwischen Arbeiterräte entstanden – eine Abkehr vom sozialistischen System wollten die Rebellen keineswegs -, und aus Aufständischen, Teilen der Armee und der Polizei begann man, eine Nationalgarde zu formen. Die Sowjetunion dachte freilich nicht daran, sich aus Ungarn zurückzuziehen. So verkündete die Regierung am 1. November die Neutralität des Landes und seinen Austritt aus dem Warschauer Pakt. Das sollte Druck auf Moskau ausüben. Es half nichts mehr, denn Moskau sah – zumal Israel, Großbritannien und Frankreich Ende Oktober Ägypten angegriffen hatten – Nachgeben in Ungarn als Zeichen von Schwäche an. Am 4. November rollten wieder die Panzer. Verzweifelt wehrte sich die neue Nationalgarde, aber die vom Westen erhoffte Hilfe blieb aus. János Kádár, seit dem 25. Oktober an Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « D&E Heft 58 · 2009 der Spitze der kommunistischen Partei, die sich in Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei umbenannt hatte, bildete eine Regierung, die sowjetische Bajonette ins Amt hoben. Das Ende des Aufstands war ein »Rachefeldzug« (Ivan Lendvai): 26.000 Prozesse, 229 vollstreckte Todesurteile (auch Nagy und seine engsten Weggefährten wurden hingerichtet und anonym verscharrt), lange Freiheitsstrafen. Hunderttausende Ungarn flohen in den Westen. Und doch: vergebens war der Aufstand nicht. »Gulaschkommunismus«: die Ära Kádár (1956–88) In den 60er-Jahren trug János Kádár den Ereignissen von 1956 Rechnung und begann, die Zustimmung der Bevölkerung zu suchen. Wirtschaftsreformen, die den Betrieben mehr Entscheidungsmöglichkeiten einräumten und auch den Bauern mehr Freiheiten brachten, die Zulassung privater Wirtschaft, dazu engere Zusammenarbeit mit westlichen Ländern, all das bescherte der Bevölkerung eine immer bessere Versorgung und wachsenden Lebensstandard. Das Kulturleben wurde freier, die Religionsausübung nicht mehr behindert, und immer mehr Ungarn konnten westliche Länder besuchen. Unwidersprochenes Hinnehmen der bestehenden Verhältnisse wertete der Parteichef als Zustimmung. Begriffe wie »Gulaschkommunismus«, »lustigste Baracke des Ostblocks« ließen freilich leicht übersehen, dass Ungarn nach wie vor eine Diktatur war, von den Russen überwacht. Umsturz ohne Gewalt Soziale Sicherheit, zunehmender Konsum und wachsender Lebensstandard waren die wichtigsten Stützen des Kádár-Systems. Aber sie führten auch – das wurde in den 80er-Jahren offenbar – zu dramatischer Verschuldung im Westen und an die Grenzen der Zentralverwaltungswirtschaft. Steigende Preise, sinkender Lebensstandard und der immer deutlicher werdende Widerspruch zwischen Ideologie und Realität erschütterten das Vertrauen in die Fähigkeiten des kommunistischen Systems – auch bei bisher überzeugten Anhängern. Ein Kurswechsel war nicht mehr zu umgehen. Und so kam es unter Führung des jungen Ökonomen Miklós Németh ab 1987 zu Reformen, die den Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft einleiteten. Auch politische Reformen erschienen jetzt notwendig, um die Bürger zur Mitarbeit zu bewegen. Die alte Funktionärsgarde war zu weitgehenden Veränderungen nicht bereit. Aber im Mai 1988 entmachtete Károly Grósz, dem es vor allem um Macht ging, Kádár, während gleichzeitig entschlossene Reformer in der Partei in führende Positionen gelangten. Die entscheidenden Veränderungen brachte das Jahr 1989. Um die Entwicklung voran zu treiben, nannte der Reformer Imre Pozsgay im Rundfunk die Ereignisse von 1956 einen »Volksaufstand«. Damit wurden dem bisherigen System und der sowjetischen Intervention die Rechtfertigung entzogen. Auch ein weiteres Festhalten an der Einparteienherrschaft erschien nun kaum noch möglich. So akzeptierte das ZK im Februar den Übergang zu einem Mehrparteiensystem und zur » repräsentativen Demokratie auf der Basis freier Wahlen«. Neu entstandene oppositionelle Gruppen und wieder gegründete ehemalige Parteien formierten sich im März 1989 zum »Oppositionellen Runden Tisch« und handelten dann im Sommer 1989 mit den bisherigen Machthabern am »Nationalen Runden Tisch« den Übergang zur Demokratie aus. Am 23. Oktober 1989 wurde die »Republik Ungarn« ausgerufen, eine parlamentarische Demokratie, auf den Tag genau 33 Jahre nach Beginn des Aufstandes von 1956. Anders als in der DDR wurde der Wandel in Ungarn von Mitgliedern der kommunistischen Partei betrieben: Die Wirtschaftskrise war der Auslöser. Parteimitglieder wie Imre Pozsgay, Miklós Németh (ab November 1988 Ministerpräsident) und Gyula Horn hatten schon Jahre zuvor am real existierenden Sozialismus zu zweifeln begonnen und setzten sich nun an die Spitze des Re- D&E Heft 58 · 2009 Abb. 2 Österreichische Grenzbeamte öffnen ein Grenztor. Etwa 500 DDR-Bürger nutzten ein paneuropäisches Picknick an der ungarisch-österreichischen Grenze, bei dem ein Grenztor symbolisch geöffnet wurde, zur Flucht in den Westen. Aufgenommen am 19. August 1989. © picture alliance, dpa 1989 formprozesses (| M 2 |). Die Parteibasis begann sie zu unterstützen. Viele KP-Mitglieder glaubten auch, dass ihre erneuerte Partei in einem Mehrparteiensystem die führende Rolle verteidigen könnte. Ein Festhalten mit Gewalt am alten System hätte zudem den Verzicht auf Westkredite und westliches Know-how bedeutet. Die Opposition hat den Wandel nicht herbeigeführt, aber mitverhandelt und mitgetragen. Das Wichtigste für alle Verteidiger der alten Zustände aber war die Erkenntnis, dass sie nach den Gorbatschow-Reformen in der UdSSR mit sowjetischer Hilfe nicht rechnen konnten. Das freilich hatte Moskau nicht von Anfang an offen verkündet. Die Ungarn mussten und wollten vielmehr ihren Freiraum Schritt für Schritt ausloten (| M 2 |). »… ihnen keine Träne nachweinen« (Erich Honecker) Im Sommer 1989 hatten immer mehr DDR-Bürger den Glauben an die Reformierbarkeit ihres Landes verloren und versuchten, ihm zu entkommen. Die Grenze zwischen Österreich und Ungarn war mit Stacheldraht, elektrischen Signalanlagen, Spurstreifen, Wachttürmen und Grenztruppen gesichert. Aufgegriffene DDRBürger wurden an die Behörden der DDR ausgeliefert. Aber am 2. Mai 1989 begannen ungarische Soldaten mit dem Abbau der Grenzhindernisse, denn sie waren technisch veraltet und teuer, schreckten Touristen ab und förderten kaum den Ruf des Landes. Für Ungarn waren sie überdies unnötig, denn die Landeskinder durften seit 1988 ohnehin überallhin reisen. Die Tragweite des Schrittes schien anfangs den wenigsten Beteiligten (Ministerpräsident Németh hatte nur Generalsekretär Gorbatschow unterrichtet und die Gewissheit erhalten, der werde nicht einschreiten) klar gewesen zu sein. Immerhin war die Westgrenze noch keineswegs für alle offen, wurde auch weiterhin bewacht, und illegaler Übertritt blieb strafbar. Doch ostdeutsche Ausreisewillige kamen nun in Scharen und blieben: in der Botschaft der Bundesrepublik, auf Campingplätzen, in Parkanlagen. Die Regierung geriet in eine Zwickmühle. Die DDR drängte auf Rückführung wie bisher, die Bundesrepublik auf Ausreise in den Westen. Zudem galt in Ungarn seit Juni 1989 auch die Genfer Flüchtlingskonvention, nach der politisches Asyl Suchende nicht in Länder, wo sie bestraft werden konnten, abgeschoben werden durften. Am 19. August 1989 fand bei Sopron ein von der Opposition organisiertes Paneuropa-Picknick statt, bei dem vorübergehend ein Grenztor geöffnet werden sollte. Angesichts der Situation musste man dabei auch mit einer Massenflucht von DDR-Bürgern rechnen. Reformer wie Pozsgay und Németh sahen in dieser Möglichkeit einen Test für das Verhalten der Sowjetunion. Von der Regierung »gefördert oder … toleriert« (Andreas Oplatka) verbreitete sich unter den Fluchtwilligen die Nachricht vom Picknick. Der Grenzschutz freilich erhielt keine klaren Befehle – wenn es Weisungen gegeben hat, dann kamen sie »unten« nicht an –, aber Oberstleutnant Árpád Bella entschied, die etwa 600 Flüchtlinge nicht zu hindern. Moskau schwieg. Aber aller Welt wurde deutlich, Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « 49 WALTER-SIEGFRIED KIRCHER | DIETRICH ROLBETZKI Republik an prominenten Stellen, zu Beginn und im letzten Paragraphen, festgelegt ist. Bereits im Herbst 1989 waren somit die innenpolitischen und internationalen Weichen gestellt. Die politischen Parteien 1990–2009: Wahlen und Regierungen Der Wechsel zu parlamentarischer Demokratie und Marktwirtschaft veränderte Ungarn grundlegend. 1990 fanden die ersten demokratischen Parlamentswahlen statt (| M 8 |). Letztlich ging es dabei um die Bestätigung des Systemwechsels. Zunächst bildeten sich bis Anfang der 1990er-Jahre drei bestimmende politische Lager heraus. Über eine historische Vergangenheit verfügten die FKGP, die MSZP, die KDNP; als neue Parteien gelten das MDF, der SZDSZ und der zunächst noch liberale FIDESZ. Die größte Partei unter den Nachfolgeparteien der kommunistischen Partei war die MSZP. Von 1990 bis 2006 wurden die Wahlberechtigten fünfmal zu Parlamentswahlen gerufen. Die jeweiligen Regierungsbündnisse hielten bis zum Ende der Wahlperioden. Nach jeder Wahl kam es zu einem Regierungswechsel, allein 2006 gelang es einem Ministerpräsidenten wiedergewählt zu werden. »Eine reichere, sicherere und ruhigere Welt«: in die NATO und in die EU Abb. 3 Unter dem Jubel von Tausenden von Menschen rief Parlamentspräsident Matyas Szüros am 23.10.1989 vom Balkon des Parlamentsgebäudes in Budapest die Republik aus. Er setzte damit die Verfassungsreform in Kraft, die einen wichtigen Schritt in Richtung auf ein demokratisches System westlicher Prägung darstellte. Die offizielle Umwandlung Ungarns in ein Land mit demokratischer Verfassung erfolgte genau an dem Tag, an dem vor 33 Jahren der Volksaufstand gegen das kommunistische Regime ausbrach © picture alliance, dpa, 1989 50 dass nun etwas geschehen musste. Und Bonn bedankte sich wenig später mit einem 500 Millionen DM – Kredit und wollte auch Ungarns Annäherung an die EG unterstützen. Über die vom 11. September an offene Grenze reisten bis Anfang November über 50.000 DDR-Bürger in die Bundesrepublik aus. Der Exodus stellte die DDR-Führung vor aller Welt bloß, ermutigte die Opposition in der DDR, immer energischer Veränderungen zu fordern, wobei ihr gewiss zugute kam, dass es nun wieder ein »offenes« Tor gab, zwang die SED-Führung schließlich zu einem neuen Reisegesetz, dessen Bekanntgabe die Berliner Mauer zum Einsturz brachte und damit bald auch die Tage des Regimes beendete (| M 5 |). Weichenstellungen 1989ff – »Beginn einer neuen, historischen Ära« »Mit der Ausrufung der Republik am 23. Oktober 1989, den ersten freien Wahlen im März/April 1990 und dem endgültigen Abzug der sowjetischen Truppen am 19. Juni 1991 stand Ungarn gleichzeitig am Ende einer alten und am Beginn einer neuen historischen Ära.« (Dalos 2004, 185). Nach Abschluss der sog. Ausgleichsgespräche am Nationalen Runden Tisch wurden in sogenannten »Eckgesetzen« und im Gesetz über die Verfassungsänderung (23.10.1089) die Verhandlungsergebnisse fixiert: Befreiung des Strafrechts von sozialistischen Elementen, Parlamentswahlen nach demokratischen Grundsätzen, Pluralismus und Chancengleichheit bei Parlamentswahlen, bei der politischen Tätigkeit von Parteien, bei der staatlichen Finanzierung. Genannt werden auch »Marktwirtschaft«, »Recht auf Unternehmung«, freier Wettbewerb und Privateigentum sowie die Verpflichtung auf das internationale Recht (| M 6 |). Durch diese verbindliche »normative Aussage zur Wirtschaftsordnung« sollte die Marktwirtschaft als »Gegenmodell« die sozialistische Planwirtschaft ablösen (Kipke 2005, S. 47). Bemerkenswert ist, dass die »europäische Zukunft« der ungarischen Nach der Wende 1989 hoffte Ungarn, möglichst schnell der EU und der NATO beitreten zu können (| M 10 |). Es war ein ehemaliger Kommunist, Gyula Horn, der Ungarn an die NATO heranführte. Er ließ die Bevölkerung über die Frage eines Beitritts abstimmen. Bei einer Wahlbeteiligung von 49,14 % stimmten 85,33 % mit »Ja«, 14,67 % mit »Nein«. Der Beitritt zur NATO erfolgte im März 1999. Weitere fünf Jahre sollte es dauern, bis Ungarn am 1. Mai 2004 die EU-Vollmitgliedschaft erhielt. In Ungarn hatten etwa 84 % für den Beitritt gestimmt, die Wahlbeteiligung lag lediglich bei ca. 46 %. Alle Parlamentsparteien hatten für den Beitritt geworben; allein die Ultra-Rechten, nicht im Parlament vertreten, hatten dagegen opponiert. Eine »reichere, sicherere und ruhigere Welt« sei von nun an das neue Zuhause der Ungarn, äußerte der damalige Ministerpräsident Medgyessy. Und die EU-Kommission ließ verlautbaren, die »tragische Trennung des Landes von der europäischen Familie demokratischer Nationen« sei nun beendet. Damit waren die zwei wichtigsten außenpolitischen Ziele, die sich Ungarn 1990 gesetzt hatte, erreicht. Die innenpolitischen wirtschaftlichen und sozialen Probleme Ungarns waren dagegen noch lange nicht gelöst. Der am 1. Mai 2004 vollzogene Beitritt zur EU wirkte wirtschaftlich nur kurzfristig stimulierend, waren die entscheidenden Verflechtungen mit der alten EU doch schon zuvor geschehen (| M 12 |). Europawahlen 2009: Europamüdigkeit »… wer spricht hier von Europawahlen«, war im Vorfeld der Wahlen 2009 zu lesen, und die Wirtschaftszeitung »Figyelö« schrieb in einem Leitartikel, die ungarischen Parteien hätten im Europawahlkampf europäische Themen weitgehend ignoriert: »Den hiesigen Parteien ist es gelungen, den Wahlkampf über die Bühne zu bringen, ohne auch nur ein Wort über die EU zu verschwenden. […] Was Ungarn in Zukunft in der Europäischen Union verwirklichen will, bleibt für die Wähler ein Rätsel.« Bei der Europawahl 2004 war dies nicht viel anders. Die nun deutlich rechtskonservative Oppositionspartei Fidesz vermied auch 2009 penibel jeglichen Hinweis darauf, dass es in Wirklichkeit um die 22 ungarischen Mandate im Europäischen Parlament ging. Sie machte vielmehr ihre Wählerschaft glauben, es ginge bei den Europawahlen darum, über die postsozialistische Regierung zu richten. Das Ergebnis war entsprechend: Der Bund Junger Demokraten (Fidesz) des Ex-Premierministers Viktor Orbán legte gegenüber 2004 um 9 % zu und errang Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « D&E Heft 58 · 2009 die Mehrzahl der Mandate. Die regierenden Sozialisten (MSZP) erhielten nur etwa 50 % ihrer bisherigen Stimmen (| M 9 |). Die Wahlbeteiligung betrug dabei alarmierende 36,3 % (2004: 38,5 %). Hauptthemen des Wahlkampfes waren die unsicheren Arbeitsplätze, die geringe Energiesicherheit und die europäische Agrarpolitik. »Überraschend war die Anzahl der Wählerstimmen, welche die rechtsradikale Partei Jobbik auf sich vereinen konnte und der damit einher gehende massive Vorstoß des Ultraradikalismus in Ungarn«, kommentierte die linksliberale Zeitung »168 óra« (12. Juni 2009): ein Hinweis auf die wachsende antieuropäische Stimmung auf der ungarischen Rechten. Für die ungarischen Neonazis sind Brüssel, EU und Europa grundsätzlich von Übel. Innenpolitisch schüren Rechtsextreme wie Rechtskonservative antijüdische und anti-Roma Ressentiments, um gemeinsam einen Macht- und Regierungswechsel zu erreichen. Etwa 10 % der Ungarn sympathisieren mit der paramilitärischen »Magyar Abb. 4 EU-Beitritt von Ungarn als Wachstumsschub? © dpa Infografik Gárda« (Ungarische Garde). Nicht gelöst ist in Ungarn zudem die Frage, wie Politiker, 20 Jahre nach der Öffnung der Grenze aktuell in einer »post-acParteien und Bevölkerung mit der faschistischen Vergangenheit cession crisis«, die zur Folge habe, dass »in the Western academia des Landes, mit den Untaten des mit Hitlerdeutschland kollabothe ›hurrah optimism‹ about the new ECE democracies has turned to the rierenden Horthy-Regimes und den Gräueln der Pfeilkreuzler opposite about the ›backsliding democracies‹« (Ágh, S. 69). sowie mit der »neuen extremen Rechten« umgehen sollen. Das Wie kann nun die »neue historische Ära«, die europäische Zubelastet das innenpolitische Klima enorm. kunft Ungarns, doch noch gerettet werden? Der in Budapest geborene, in Berlin als freier Schriftsteller arbeitende György Dalos Ungarn heute: »das Ende eines Modells«? hat dazu Bedenkenswertes geschrieben: Ungarn brauche vor allem eine reife Zivilgesellschaft (| M 14 |). Der EU-Beitritt Ungarns war einst von großen wirtschaftlichen Hoffnungen und optimistischen Prognosen begleitet. Politik, MeLiteraturhinweise dien und Wissenschaftler hatten Ungarn bereits in einer Liga mit den entwickelten Staaten gesehen. Doch die weltweit stagnieÁgh, Attila: Hungary (2008): Hungarian Politics in the Early 21st Century: rende, dann real einbrechende Konjunktur sollte die ostmitteleuroReforms and Post-EU Accession Crisis, in: Südosteuropa Mitteilungen päischen Länder besonders hart treffen (| M 12 |, | M 16 |). Dass ge02/2008, S. 68–81. rade Ungarn zu den am schwersten getroffenen Staaten gehört, hat vielfältige, ganz spezifische hausgemachte Gründe (| M 13 |). Dalos, György (2004): Ungarn in der Nussschale. Geschichte meines Landes. Die Folgen: Investoren ziehen Gelder ab, Firmen verlagern die ProC. H. Beck, München. duktion nach Tschechien, Rumänien, Polen, gar nach China, die Dalos, György (2006): 1956. Der Aufstand in Ungarn. C. H. Beck, München. Zuliefererbranche kriselt, der ungarische Forint fiel zum Euro auf den tiefsten Stand aller Zeiten. Ausländische, darunter viele deutDalos, György (2009): Der Vorhang geht auf. Das Ende der Diktaturen in sche Firmen, hatten in den letzten Jahren in Ungarn investiert, die Osteuropa, C. H. Beck, München. dortigen Kostenvorteile genutzt, Arbeitsplätze geschaffen, SchwieHorn, Gyula (1991): Freiheit, die ich meine. Erinnerungen des ungarischen rigkeiten im eigenen Herkunftsland z. T. überbrückt, neue AbsatzAußenministers, der den Eisernen Vorhang öffnete, Hoffmann und Campe, märkte erschlossen. Neben der Autoindustrie sind in den neuen Hamburg. EU-Ländern nach wie vor besonders Handel und Banken tätig, Beobachter konstatierten Ungarn geradezu einen Ausverkauf an ausKipke, Rüdiger (2005): Das politische System Ungarns. Eine Einführung. ländische Investoren und eine Konzentrierung wirtschaftlicher Verlag für Sozialwissenschaften/VS, Wiesbaden. Macht in der Hand ausländischer Banken. Kopácsi, Sándor (1979): Die ungarische Tragödie. DVA, Stuttgart. Internationales Hilfspaket und »post-accession crisis« Im Oktober 2008 musste Ungarn nun jedoch ein Hilfspaket der internationalen Gemeinschaft in Anspruch nehmen: 20 Milliarden Euro stellten der Internationale Währungsfond, die Weltbank und die EU dem Land zur Verfügung. Das Hilfspaket soll Ungarn helfen, »dem Druck des Marktes zu widerstehen« (EU-Kommission, Okt. 2008). Für Ungarn beträgt z. B. die BIP-Wachstumsprognose 2009 -3,0 %. Saniert werden muss Ungarn nicht erst seit Oktober 2008 (G. P. Hefty, FAZ v. 23.3.2009). Der Leiter des »Together for Europe-Research Centre for EU Studies« an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften sieht auch und gerade sein Land D&E Heft 58 · 2009 Lendvai, Paul (1989): Die Ungarn. Ein Jahrtausend Sieger in Niederlagen. C. Bertelsmann, München. Oplatka, Andreas (2009): Der erste Riss in der Mauer. September 1989 – Ungarn öffnet die Grenze. Zsolnay, Wien. Schmidt-Schweizer, Andreas (2007): Politische Geschichte Ungarns von 1985 bis 2002: von der liberalisierten Einparteienherrschaft zur Demokratie in der Konsolidierungsphase. Oldenbourg, München (Südosteuropäische Arbeiten 132). Haus der Geschichte Baden – Württemberg und Kulturinstitut der Republik Ungarn (Hrsg.) (2002): Ungarn und Deutschland. Eine besondere Beziehung, Silberburg – Verlag, Tübingen. Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « 51 WALTER-SIEGFRIED KIRCHER | DIETRICH ROLBETZKI Materialien M 1 »… dass die Geschichte meine Mörder verurteilen wird« Auf den Tag genau 31 Jahre nach seiner Hinrichtung werden die prophetischen Worte eines zum Tode Verurteilten wahr. Die sterblichen Überreste Imre Nagys, ungarischer Ministerpräsident in den Tagen des Aufstandes von 1956, und seiner vier Schicksalsgefährten wurden am 16.6.1988 feierlich und mit allen Ehren posthum in einer nationalen Gedenkstätte zur letzten Ruhe gebettet. Schon einmal wurden diese Toten bestattet: nach ihrer Hinrichtung anonym verscharrt. Jahrzehnte waren sie als »Konterrevolutionäre« verfemt. © picture alliance, dpa 1988 M 2 Wie aus Kommunisten Reformer wurden 52 (1) Der Funktionär Pozsgay […] zog vor allem aus der polnischen Krise 1980/81 die Konsequenz, dass sich die herrschende Partei legitimieren und ihre führende Rolle durch Dienst am Gemeinwesen quasi neu verdienen müsse. Die zu bloßer Fassade gewordenen Organisationen, Gewerkschaften und Berufsverbände müssten zu echtem Leben galvanisiert werden, und selbst der Sozialismus brauche statt des bisherigen Kommandosystems einen Konsens, in dem sich auch Gruppeninteressen repräsentiert fühlten. György, Dalos: Das Ende der Diktaturen in Osteuropa. C. H. Beck, München 2009, Seite 73. (2) In mir ist die Kritik am herrschenden Regime und schließlich seine Ablehnung erst allmählich herangereift. […] Die Erlebnisse in der Sowjetunion [Horn studierte dort von 1950–1954], die Entdeckung der tiefen Kluft zwischen Propaganda und Realität ließen mich die Fehler des Systems zwar erkennen, hatten aber nicht zur Folge, dass ich es auch ablehnte. Erst später, Schritt für Schritt, indem ich andere Länder und Systeme aus eigener Erfahrung kennen lernte, kam ich zu der Einsicht, dass der Staatssozialismus nichts mit den sozialistischen Idealen gemein hat. […] dass mit der SPD und mit anderen sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien Westeuropas […] ein Dialog zustande kam, dem dann die Aufnahme von Kontakten folgte. Die besondere Bedeutung der Beziehungen sehe ich […] darin, dass wir über sie direkten Einblick in die Funktionsweise einer modernen Gesellschaft erhielten und durch diese »Körpernähe« zu den entwickelten Demokratien, über die wir bislang nur Negatives […] gehört hatten, vieles anders beurteilen lernten und viele Vorurteile abbauen konnten. Dies betone ich auch deshalb, weil der Geist und das Gedankengut der westeuropäischen Sozialdemokratie nach meiner Überzeugung maßgeblich zur Entfaltung der ungarischen Reformgedanken und –maßnahmen beigetragen haben; von hier kamen wichtige Impulse, die Welt durch eine andere Brille zu sehen und uns mit der Realität auseinanderzusetzen. Gyula Horn: Freiheit, die ich meine. Erinnerungen des ungarischen Außenministers, der den Eisernen Vorhang öffnete. Hoffmann und Campe, Hamburg 1991, S. 271 und S. 57. (3) Woher die Wandlung? Horn nennt […] als erstes die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) […] Die Ost-West-Annäherung als Folge der Helsinki-Schlussakte habe auch seine Auffassung beeinflusst. […] In Gesprächen, auf Reisen, aus der Lektüre konnte er die Funktionsweise demokratischer Gesellschaften eher kennen lernen als ZK-Mitarbeiter anderen Sparten. Von besonderer Bedeutung war dabei, dass die USAP [Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei] Beziehungen zur SPD unterhielt, sodass sich Horn […] mit sozialdemokratischem Gedankengut vertraut machte. Wann erkannte er, dass in Europa eine Wende bevorstand […]? In der zweiten Hälfte der 80er-Jahre antwortet Horn. […] Schewardnadse [sowjetischer Außenminister] macht geltend, die Sowjetführung unter Gorbatschow habe sich schon von 1985 an davon leiten lassen, dass die europäische Trennung überholt sei, dass man die Sowjettruppen aus dem ostmitteleuropäischen Vorfeld zurückziehen und die politisch-psychologischen Folgen in Kauf nehmen müsse. Horn kann sich nicht erinnern, Signale so schöner und direkter Art aus Moskau empfangen zu haben. Es gab keine Stunde der plötzlichen Erleuchtung, dass die Ostblockländer fortan ihren eigenen Weg gehen dürften; es war eher ein Prozess, in dessen Verlauf man das Terrain vorsichtig abtasten, Schritt für Schritt Neuland erobern musste. Andreas Oplatka: Der erste Riss in der Mauer. September 1989 – Ungarn öffnet die Grenze. Zsolnay, Wien 2009, Seite 83f. © Paul Zsolnay Verlag Wien M 3 Ungarn öffnet die Westgrenze für DDR-Bürger Ich ließ meine beiden Stellvertreter zu mir kommen und teilte ihnen meine Entscheidung mit. »Hier muss eine radikale Lösung her, die ermöglicht, dass alle DDR-Bürger Ungarn legal verlassen können. Und das geht nur, wenn wir […] das sogenannte Reiseverkehrsabkommen zwischen Ungarn und der DDR aus dem Jahre 1969 […] außer Kraft setzen.« […] Ich rief Miklós Németh an und skizzierte ihm kurz meine Vorstellung. Es war lange still am Apparat, dann sagte Németh: »Wir besprechen das heute Nachmittag. Ich bestelle […] alle aus dem Kabinett, die ich erreichen kann.« […] Miklós Németh meinte [am Nachmittag] nach einer längeren Pause: »Ja, das müssen wir tun. Es gibt keinen anderen Ausweg.« Auch der Innenminister sagte mir seine Unterstützung zu, bemerkte nur halblaut: »Weißt Du Gyula, dass wir damit unter den beiden deutschen Staaten den westdeutschen wählen?« »Nein«, erwiderte ich, »wir setzen uns für das Recht der Deutschen ein und wählen Europa. Außerdem ist ein System, in dem die eigenen Bürger nicht leben wollen, keinen Heller wert. In Sachen Menschenrechte sind die allgemeinen internationalen Normen wichtiger als ein Abkommen zwischen zwei Staaten des Warschauer Paktes.« Danach fragte mich der Ministerpräsident: »Hast Du daran gedacht, dass wir uns mit diesem Schritt in Osteuropa isolieren?« »Meiner Meinung nach ist nur die Reaktion der Sowjetunion und der Tschechoslowakei wichtig.«[…] Die Sowjets informierten wir erst am letzten Tag. Es war offensichtlich, dass sie schon lange von unserem Vorhaben wussten. Wahrscheinlich hatte sich auch die DDR-Führung bei ihnen über uns beklagt. […] Schewardnadse: »Ich bin der Meinung, man sollte jeden ziehen lassen, der gehen will. Man darf die Leute nicht mit Gewalt zurückhalten.« Dennoch konnten wir vor unserer Entscheidung nicht abschätzen, welche Reaktion ein solcher […] Schritt, insbesondere unter dem Aspekt der spezifischen sowjetischen Interessen am Bestehenbleiben der DDR, bei Gorbatschow auslösen würde. Eine militärische Intervention befürchtete ich nicht, denn ich bin überzeugt: Michail Gorbatschow verabscheut militärische Lösungen mindestens ebenso sehr wie wir. Allerdings konnten wir nicht mit Sicherheit ausschließen, dass sich die Sowjets unter Umständen gezwungen sehen würden, auf politischem, vor allem aber auf wirtschaftlichem Gebiet Sanktionen gegen uns zu ergreifen. Zumindest hätte das neue Probleme für uns bedeutet. Gyula Horn: a. a. O., Seite 321ff. Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « D&E Heft 58 · 2009 M 4 Warum ließ die Sowjetunion die Ungarn gewähren? Entgegen ihrer nachträglichen Darstellung ließen die Sowjetführer die Ungarn Anfang September nicht darum gewähren, weil sie zur Einsicht gekommen waren, dass das Recht, vereint in einem Staat zu leben, auch dem deutschen Volk zukam. Auf die Frage, wann man im Kreml den unvermeidlichen Verlust erkannt habe, antwortete Tschernajew dem Verfasser: »Im Januar 1990.« Gorbatschows Darstellung der Wiedervereinigung bestätigt diese Angabe. Die sowjetische Deutschlandpolitik hielt in den Monaten zuvor am Fortbestand der DDR fest. Moskau handelte folglich gegen seine Interessen, indem es die Massenflucht in Ungarn zuließ. Dafür gibt es Erklärungen. Eine Intervention erschien nicht mehr machbar, ein Verbot nicht durchsetzbar und vor allem: die Bedeutung der Ereignisse an Ungarns Westgrenze wurde unterschätzt. Die Signale aus Moskau waren aus ungarischer Optik beruhigend. Mit Blick auf Ostberlin sondierten die Ungarn nicht das politische, sondern das kommerzielle Terrain: Verfügte die DDR über lebenswichtige Waren, die sie im Handel mit Ungarn als Vergeltungsmaßnahme hätte sperren können? Oder war sie in der Lage durch die Zurückweisung bestimmter ungarischer Erzeugnisse in Ungarn selbst ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten zu verursachen? Die Experten in Budapest verneinten dies. M 7 Gemeinsam mit seinem österreichischen Amtskollegen Alois Mock (l.) schnitt der damalige ungarische Außenminister Gyula Horn am 27.6.09 symbolisch ein Stück des »Eisernen Vorhangs« durch. Ungarn hatte allerdings schon Monate vorher damit begonnen, die Grenzbefestigungen abzubauen. © Ullstein Bild, AP Andreas Oplatka: a. a. O., Seite 178 M 5 Die Bedeutung der ungarischen Entscheidung Welchen Verlauf die Vereinigung Deutschlands ohne die von Ungarn im Eisernen Vorhang geschlagene Bresche genommen hätte, gehört zu den müßigen »Wie wäre es gewesen«–Fragen. Dennoch dürfte man summarisch dies zur Antwort geben: Angesichts der wirtschaftlichen und ideologischen Erschöpfung des sozialistischen Blocks und namentlich seiner Führungsmacht, der Sowjetunion, wäre wohl die gleiche Entwicklung eingetreten, ohne den ungarischen Beitrag aber etwas langsamer verlaufen. Was im Sommer 1989 in Ungarn geschah, beschleunigte die Vorgänge. Die Geschichte der Grenzöffnung ist zugleich ein Beleg dafür, dass es besondere Situationen geben kann, in denen auch ein kleines Land Prozesse von weltpolitischer Bedeutung zu beeinflussen vermag – vorausgesetzt, dass die Führung ihren Spielraum ermisst und zu nutzen wagt. Die Regierung Németh deutete die Zeichen richtig. Ihre führenden Köpfe ließen sich – aus rationaler Erkenntnis wie aus politischem Instinkt – von der Überzeugung leiten, dass sie zunehmend über Handlungsfreiheit verfügten, dass eine europäische Wende bevorstand und dass es bei der ihnen aufgezwungenen Wahl im Interesse ihres Landes lag, sich für die Bundesrepublik und nicht für die DDR zu entscheiden. M 6 Auszüge aus der Verfassung der Republik Ungarn (Verfassungsänderung 23. Oktober 1989) § 2 (1) Ungarn ist ein unabhängiger, demokratischer Rechtsstaat. (2) In der Republik Ungarn geht alle Staatsgewalt vom Volke aus, das die Volkssouveränität durch seine gewählten Abgeordneten und unmittelbar ausübt. […] § 2/A (1) Die Republik Ungarn kann im Interesse ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Union auf der Basis eines internationalen Vertrag [ … ] einzelne ihrer aus der Verfassung sich herleitenden Kompetenzen gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten ausüben. […] § 3 (1) In der Republik Ungarn dürfen sich Parteien und verfassungsmäßige Rechtsnormen frei bilden und können frei tätig sein. […] § 9 (1) Die Wirtschaft Ungarns ist eine Marktwirtschaft, in der das öffentliche und das private Eigentum gleichberechtigt sind und Heft 58 · 2009 www.mkab.hu/de/depage5.htm, 22. 06. 2004: Übersetzung, vom ungarischen Verfassungsgericht veröffentlicht und von R. Kipke überarbeitet. In: Kipke (2005) S. 109ff. M 8 Sitzverteilung im ungarischen Parlament seit 1990 Parteien/ Wahlen 1990 1994 1998 2002 2006 FIDESZ (seit 1998 mit KDNP) 22 20 148 164 164 FKGB 44 26 48 – – KDNP 21 22 – – – MDF 165 38 17 24 11 MSZP 33 209 134 178 190 SZDSZ 94 69 24 20 20 7 2 1 1 1 MIEP Andreas Oplatka: a. a. O., Seite 238f. D&E gleichen Schutz genießen. (2) Die Republik Ungarn anerkennt und fördert das Recht auf Unternehmung und die Freiheit des wirtschaftlichen Wettbewerbs. […] § 17 Die Republik Ungarn sorgt durch weitreichende Maßnahmen für die Bedürftigen. […] § 79 Über den Beitritt der Republik Ungarn zur Europäischen Union gemäß dem Beitrittsvertrag ist eine landesweite Volksabstimmung abzuhalten. Sonstige 14 1. National-konservatives/christliches Lager: MDF Ungarisches Demokratisches Forum KDNP Christlich-Demokratische Volkspartei FKGP Unabhängige Kleinlandwirte-, Landarbeiter- und Bürgerpartei 2. Liberales Lager: SZDSZ Bund Freier Demokraten 3. Rechtskonservatives Lager: FIDESZ Bund Junger Demokraten (- Ungarische Bürgerpartei) 4. Sozialistisches Lager: MSZP Ungarische Sozialistische Partei Nationalradikal, extrem rechtsorientiert: MIÉP Partei der Ungarischen Gerechtigkeit und des Ungarischen Lebens Nach Kipke (2005, S. 50 f.) u. für 2006 www.wieninternational.at/de/node/1036 Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « 53 WALTER-SIEGFRIED KIRCHER | DIETRICH ROLBETZKI M 9 Erdrutschsieg für oppositionelle rechtskonservative Fidesz Ungarn erlebte bei der Europawahl 2009 einen rechten Erdrutsch wie noch nie seit der demokratischen Wende vor 20 Jahren. Der rechts-populistische Bund Junger Demokraten (Fidesz) des ExPremierministers Viktor Orbán fuhr mit 56,4 Prozent der Stimmen und 14 Mandaten einen deutlichen Sieg ein. Die – noch und allein in Minderheit – regierenden Sozialisten (MSZP) wurden brutal abgewatscht: mit 17,4 Prozent der Stimmen und nur vier Mandaten verloren sie nicht nur mehr als die Hälfte ihrer bisher neun Sitze im EU-Parlament, sondern mussten ihr schlimmstes Debakel bei einer landesweiten Wahl seit 1990 hinnehmen […]. Den wahren Durchbruch feierte allerdings die offen rechts-extreme Partei »Jobbik« (Die Besseren). Sie kam aus dem Stand auf 14,8 Prozent der Stimmen und damit drei Mandate. Die Strategie des Parteichefs Gábor Vona, den Hass auf die Roma zu schüren, ging in einer von Wirtschaftskrise und Abstiegsängsten verunsicherten Bevölkerung auf. Die Aufmärsche der von ihm gegründeten, paramilitärischen, faschistoiden Ungarischen Garde verstärkten noch die Illusion, dass sich die »Probleme« mit ebenso simplen wie drastischen Methoden lösen ließen. Das moderatkonservative Ungarische Demokratische Forum (MDF) konnte mit 5,3 Prozent sein bisheriges einziges EP-Mandat halten. Für diese Partei geht der ehemalige Finanzminister, Radikalreformer und Wirtschaftssanierer Lajos Bokros nach Straßburg. Großer Verlierer ist neben den Sozialisten deren ehemaliger Koalitionspartner, der liberale Bund Freier Demokraten (SZDSZ). Mit 2,2 Prozent blieben diese Partei weit unter der Fünfprozentmarke und verliert damit ihre bisherigen zwei EP-Sitze. […] Gregor Mayer, Budapest, www.derStandard.at, 07.06.2009 M 10 54 Die Erweiterung als Motor der wirtschaftlichen Modernisierung Für Budapest ist der Beitritt der Staaten Mitteleuropas zur EU die Wiedervereinigung Europas, die Rückkehr Ungarns zu seinen natürlichen Beziehungs- und Abhängigkeitssystemen, aus denen es wider Willen herausgerissen worden war. In wirtschaftlicher Hinsicht ist Ungarn bereits heute integraler Bestandteil der Union, mehr als Dreiviertel der Ein- und Ausfuhren des Landes werden mit EU-Staaten abgewickelt. […] Budapest nimmt aufgrund des Entwicklungsstandes seiner institutionellen Strukturen und der erreichten Ergebnisse im Demokratisierungsprozess einen Platz unter den entwickelten Demokratien ein. […] Das Bruttosozialprodukt wuchs in den vergangenen vier Jahren um 4-5 Prozent, was gemäß den Prognosen – bei günstiger weltwirtschaftlicher Konjunkturlage – mittelfristig anhalten wird. […] Die Voraussagen prognostizieren eine Steigerung des ungarischen BIP um das Doppelte des Anstieges der Parameter in der EU […]. Es ist bemerkenswert, dass in den Analysen, die über die zukünftige Entwicklung der unter dem Aspekt der Wachstumsaussichten immer wichtiger werdenden Konkurrenzfähigkeit erstellt werden, Ungarn einen vorderen Platz unter den entwickelten Ländern einnimmt. In den unterschiedlichen internationalen Konkurrenzfähigkeitslisten stehen sämtliche EU-Beitrittskandidaten und manche EU-Staaten hinter Ungarn. Gleichzeitig zeigen die Parameter bezüglich Demographie und Lebensstandard im Vergleich mit dem »entwickelten Kern« der EU vorläufig einen bedeutenden Rückstand auf Seiten Ungarns […]. Im nächsten Jahrzehnt – im Falle der Aufrechterhaltung des derzeitigen Wirtschaftswachstums – wird das Wettmachen dieses Rückstandes die wichtigste gesellschaftspolitische Aufgabe Ungarns sein, damit 2010 der Durchschnitt der Europäischen Union erreicht wird. M 11 Rechtsruck bei der Europawahl in Ungarn im Juni 2009: Neben der rechtspopulistischen FIDESZ mit 56,5 % der Wählerstimmen erreichte die offen rechtsextreme Partei »Jobbik« 14,8 % der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 36,3 %. Hier: Kundgebung von Viktor Orban, dem Vorsitzenden der FIDESZ, in Nyiregyhaza, 245 km östlich von Budapest. © picture alliance, dpa 2009 M 12 Osteuropa – Der Kater nach der Party Nun ist der Höhenflug jäh gestoppt. Die weltweite Wirtschaftskrise […] kommt nun in den einst kommunistischen Ländern an. Es trifft sie härter und schneller, als die erfolgsverwöhnten Kapitalismus-Neulinge erwartet hatten. […] Ungarn hat den Internationalen Währungsfond, die Weltbank und die EU bereits um 20 Milliarden Euro angepumpt. […] Sicher ist: Westeuropa kann die Neumitglieder nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Mit der Weltwirtschaftskrise, so die Sicht im Osten, scheint sich die Globalisierung plötzlich umgekehrt zu haben. […] Ein Heer von Arbeitskräften ist jetzt wieder auf dem Weg zurück in die Heimat im Osten. In die Gegenrichtung fließt das verzweifelt benötigte Kapital ab: westliche Banken und Investoren ziehen sich zurück. Es war vor allem ein Fehler, der nun dazu führt, dass die Krise im Westen den Osten mit in ihren Strudel reißt: Jahrelang hatten die Osteuropäer sich im Westen mit Euro, Schweizer Franken oder skandinavischen Kronen versorgt. Die Kredite kurbelten den Inlandskonsum an und ließen die Wirtschaft wachsen. Viele Beitrittsländer importierten mehr Waren, als sie selbst ausführten. Nun sind die Schuldenberge hoch […]. Vor allem die Länder, deren Währungen nicht fest an den Euro gebunden waren, mussten grausame Kursstürze hinnehmen. Der rumänische Leu verlor im letzten Halbjahr 16 Prozent, der ungarische Forint fast 20 Prozent seines Wertes. Privatleute und mitunter auch Staaten können ihre Fremdwährungskredite nicht mehr bedienen. Massenpleiten im Osten schlagen nun zurück auf die leichtfertigen Geldgeber im Westen, die zudem etwa 70 Prozent aller Ostbanken kontrollieren. […] Die Verheißung der Revolution von 1989 – Freiheit und Wohlstand für alle Europäer – lässt sich jedenfalls nicht so schnell erfüllen wie erhofft. […] So sind die Beitrittsstaaten nach schwindelerregendem Aufschwung wieder zu Sanierungsfällen verkommen. […] Seit der Forint, der Lew und der Leu gefallen sind, können viele Schuldner ihre Kredite nicht mehr bedienen. Der Spiegel Nr. 13/23.03.2009, S. 94f Lajos Keresztes: Ungarn: EU-Beitritt als Motor der Modernisierung. In: WeltTrends Nr. 34, Frühjahr 2002, S. 65–80. Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « D&E Heft 58 · 2009 M 13 Ein Ende der Krise ist noch lange nicht in Sicht Wirtschaftliche Hiobsbotschaften, das Nachbarschaftsgezänk mit der Slowakei und randalierende Neonazis prägen derzeit das trostlose Bild des Donaustaates. Dabei galt Ungarn lange als Musterbeispiel für eine geglückte Transformation. Schon zu kommunistischen Zeiten hatte das Land früh mit marktwirtschaftlichen Mechanismen experimentiert. Nach der Wende von 1989 galt Ungarn neben Tschechien in der 1990er Jahren wegen zügiger Privatisierung und Wirtschaftsreformen lange Zeit als einer der Vorreiter in der östlichen Region. Doch nach 1989 erlahmte der Reformeifer – unabhängig davon, ob linke oder rechte Würdenträger die Regierungsbank drückten. Bald konnten M 15 Treffen der Visegrad-Gruppe am 11.9.2009 in Gdynia, Polen. Von links: Der slowakische Präsident die Staatseinnahmen mit den Kosten des inIvan Gasparovic, der ungarische Präsident Laszlo Solyom, der tschechische Präsident Vaclav Klaus effizienten Sozialsystems und aufgeblähten und der polnische Präsident Lech Kaczynski. Nach dem Beitritt aller vier Mitgliedstaaten zur Verwaltungsapparats nicht mehr Schritt halNATO und EU steht die Staatengruppe vor einer Neudefinition ihrer Ziele: Fragen der wirtschaftliten. Das Problem des niedrigen Steueraufchen Integration und die gemeinsame Interessensvertretung innerhalb der EU dominieren im Mokommens wurde durch die offiziell sehr gement die Diskussionen. © picture alliance, dpa ringe Beschäftigungsquote und die hohe Zahl von Frührentnern und Berufsinvaliden verschärft. Nur etwas mehr als die Hälfte der 15 bis 64-jährigen Ungarn ist in den legalen Arbeitsmarkt integriert, und von der Schattenwirtschaft, die seit Jahren blüht, profitiert der Fiskus kaum. Das wachsende Haushaltsdefizit suchte Budapest mit der verstärkten Aufnahme von Krediten und der Ausgabe von Staatsanleihen zu finanzieren. Ungarn habe keine Rücklagen gebildet und geglaubt, man könne jahrzehntelang nur Schulden machen, klagte kürzlich der Analyst György Jaksity auf der Website »index«. Nun stehe das Land »mit heruntergelassenen Hosen in den Brennnesseln«. Die [Unternehmen] verlagern immer häufiger Arbeitsplätze von der Donau nach Polen. […] »Ungarn ist unser größtes Problem«, sagt Dirk Wölfer von der Deutsch-Ungarischen Handelskammer in Budapest. […] Trotz der internationalen Milliardenkredite steht auch der angeschlagene Bankensektor Ungarns weiter auf sehr wackeligen Füßen. […] Auch private Sparguthaben, von denen die Banken zehren könnten, seien in Ungarn kaum vorhanden […]. Thomas Roser, Belgrad, in: Stuttgarter Zeitung 27.11.2008, S. 16 M 14 Was Ungarn im 21. Jahrhundert braucht Was Ungarn im 21. Jahrhundert am meisten braucht, ist eine reife Zivilgesellschaft, die der Versuchung widerstehen kann, soziale Fragen autoritär zu beantworten, Minderheiten im Ernstfall zu Sündenböcken abzustempeln und Offenbarungen einander befehdender Eliten für bare Münze zu nehmen. [ … ] Den Politikern, die dieses Land in den nächsten Jahrzehnten regieren werden, kann man vielleicht als höchstes Gut eine größere Einsicht wünschen, wohl wissend, dass diese vor allem mehr Phantasie voraussetzt. György Dalos: Ungarn in der Nussschale. Geschichte meines Landes. C. H. Beck, München 2004, S. 190 D&E Heft 58 · 2009 M 16 Abschwung Ost – »der Kater nach der Party« © Der Spiegel, 13/ 23.3.2009, S. 95 Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « 55 III. MAUERÖFFNUNG IN EUROPA 4. Autoritäre Macht in Russland: Vom Kommunismus bis zum System Putin BENNO ENNKER D er Zusammenbruch des Kommunismus hatte sein zentrales Ereignis in der Auflösung der Sowjetunion. Diese bezeichnete Wladimir Putin zur »größten geo-politischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts«. Auf welchen Grundlagen entwickelte sich das System, das er nach zwei Amtsperioden als Präsident (2000–2008) seinem Nachfolger Dmitri Medwedew hinterlassen hat? Michail Gorbatschow und der Zerfall der UdSSR 56 Leonid Breschnew, der kommunistische Generalsekretär und Staatschef der Sowjetunion, der seit 1964 eine überragende Macht im Lande und im gesamten Ostblock ausübte, hinterließ bei seinem Tode 1982 ein schweres Erbe: Das Wirtschaftswachstum blieb zurück. Das Vertrauen in das System verfiel. Die wachsenden Probleme veranlassten die politische Führung schließlich am 11. März 1985 mit Michail Gorbatschow einen Generalsekretär zu berufen, dem die Kraft zu Reformen zugetraut wurde (| Abb. 1 |). Dieser entwarf die politischen Konzepte »Glasnost« (Offenheit) und »Perestroika« (Umstrukturierung) (| M 1 |). Die Perestroika sollte den Sozialismus durch eine Stärkung der Sowjets (russisch: Räte) im Sinne von Parlamenten, durch die Wahl der Parteifunktionäre und die Stärkung der Rechtsordnung im Sinne eines Rechtsstaates beleben. Die Vormacht der Kommunistischen Partei sollte dabei allerdings erhalten bleiben. Die Wahlen zu einem Kongress der Volksdeputierten im Frühjahr 1989 stellten – auch wenn das Wahlverfahren nicht wirklich demokratischen Prinzipien entsprach – den Durchbruch zu einer demokratischen Entwicklung dar. Glasnost ermöglichte den Medien eine kritische Berichterstattung über politische und gesellschaftliche Ereignisse und die Lage im Lande. Die Gesellschaft erlebte eine vehemente Politisierung. Unter diesen Bedingungen verlor die KPdSU rasch ihren monolithischen Zusammenhalt, ihr gesellschaftliches Gewicht und ihre öffentliche Autorität. Im März 1990 schließlich wurde ihr auch das politische Monopol in der Sowjetverfassung aberkannt. Dieser Prozess ging einher mit der Bildung neuer gesellschaftlicher Organisationen, Bürgerinitiativen und zuletzt auch Parteien. Im März 1990 brachten die neuen demokratischen Organisationen in den Lokal- und Regionalwahlen der Kommunistischen Partei vielfach empfindliche Niederlagen bei. Bald breitete sich allerdings im Innern der Sowjetunion ein Steppenbrand aus, eine »Explosion des Ethnischen«, die sich in blutigen nationalen Konflikten in teilweise pogromartigen Ausmaßen Ausdruck verschaffte. Betroffen waren vor allem ethnisch gemischt besiedelte Gebiete von Usbekistan, Kirgisien, Kasachstan, Tadschikistan, Moldawien, Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Nationale Bewegungen erfassten bald die gesamte Sowjetunion. Im Laufe des Jahres 1990 beanspruchten sämtliche 15 nationale Sowjetrepubliken ihre Souveränität, unter denen einige, wie die baltischen Republiken, bereits darüber hinaus die Unabhängigkeit verlangten. Gorbatschow, nach einer Verfassungsänderung zum Staatspräsidenten bestimmt, stellte faktisch die alleinige politische Klammer um die auseinander brechende Sowjetunion dar. Während er mit dem Angebot eines neuen, dezentralisierenden »Unionsvertrags« den Forderungen der Einzelrepubliken entgegenkam, zeigte sich, dass er den zentrifugalen Kräften nicht mehr effektiv gegensteuern konnte. Gorbatschow suchte zwischen den Kräften, die das Sowjetsystem aus nationa- Abb. 1 Michail Gorbatschow, seit 1985 Generalsekretär der KpdSU, 1990– 1991 Staatspräsident der UdSSR, hier bei einer Rede auf dem XI. Parteitag der © picture alliance, dpa SED am 17.4. 1986 in Ost-Berlin (DDR). listischen und demokratischen Motiven ablehnten und jenen konservativen kommunistischen Machthabern, die es wiederherstellen wollten, zu lavieren. Letztere, die Führer zentraler Apparate von Regierung und Geheimdienst, fanden sich in einer Verschwörung zusammen, um im August 1991 den alten zentralisierten Sowjetstaat mit einem gewaltsamen Putsch wieder herzustellen. Der Putsch scheiterte bereits nach wenigen Tagen am Widerstand in Russland, insbesondere in Moskau selbst (| Abb. 2 |). Dort hatte sich im Laufe des Jahres durch die Wahl Boris Jelzins zum Präsidenten der Russischen Republik eine deutliche Mehrheit für den entschiedenen Gegner der Kommunistischen Partei erklärt, der für tiefgreifende Reformen, den raschen Übergang zur Marktwirtschaft und die Wahrung der Rechte der Einzelrepubliken in einer neuen, föderativ verfassten Union eintrat (Brown, S. 468f) Als der Putsch binnen kurzem am Widerstands in der Bevölkerung und der russischen Regierung zusammenbrach, hatten die Verschwörer die letzten Reste der Legitimität der Sowjetunion zerstört, deren Führungsorgane sich endgültig desavouiert hatten. Am 8. Dezember 1991 trafen sich die Vertreter Russlands, Weißrusslands und der Ukraine in Minsk zur Aushandlung eines »slawischen Dreibunds« und erklärten, »dass die UdSSR als Völkerrechtssubjekt und als geopolitische Realität aufhört zu existieren.« Nachdem sich dem weitere Republiken anschlossen, kam es am 21. Dezember 1991 in Alma-Ata zur Unterzeichnung der Gründungsakte für die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten als einem losen Staatenbund von elf der früheren sowjetischen Unionsrepubliken, also allen außer den baltischen Staaten und Georgiens. Michail Gorbatschow musste die gegen seinen Willen geschaffenen Fakten anerkennen und als Präsident der Sowjetunion zurücktreten. Boris Jelzin – Beginn des Präsidial-Regimes Als Boris Jelzin von der Bevölkerung im Juni 1991 in das neu geschaffene Amt des Präsidenten der Republik gewählt wurde, beruhte das politische System noch weiterhin auf der für die RSFSR geltenden sowjetischen Verfassung. Nach dem Abwenden des August-Putsches entschied sich Boris Jelzin nicht dafür, durch Au toritäre M acht in Rus sl and: Vom Kommunismus bis zum S ys tem P u tin D&E Heft 58 · 2009 eine Neuwahl des Parlaments und die Verabschiedung einer demokratischen Verfassung neue Legitimitätsgrundlagen für die anstehenden Reformen zu schaffen. Stattdessen setzte er die Priorität auf die Umsetzung der marktwirtschaftlichen Reformen. Dies war eine Weichenstellung, die sich für die demokratische Kultur als fatal erweisen sollte. Einer der Reformer, Ewgenij Jasin, zunächst Berater und später Minister Jelzins, erklärte damals unumwunden: »Wir brauchen eine starke Exekutivmacht auf allen Ebenen mit klar gezeichneten Grenzen der Autorität. Es sollte klar sein, dass ohne starke und effektive Exekutivmacht Reformen in den Dimensionen, wie wir sie vorhaben, unmöglich sind.« (Jasin, S. 15). Jelzin und seine Mitarbeiter glaubten also, dass die Wirtschaftsreformer »vor populistischer Politik geschützt werden mussten.« (McFaul, S. 147) Im November 1991 räumte der russische Kongress der Volksdeputierten Jelzin außerordentliche Vollmachten zur Durchführung von Wirtschaftsreformen ein. Dieser nutzte sie u. a., um sich einen eigenen Apparat, eine Präsidialverwaltung einzurichten, sowie dazu, in den russischen Regionen sogenannte Verwaltungschefs zu ernennen, die dort als »Gouverneure« der Zentralmacht fungierten. Auch ihre Wahl wurde verschoben. Jegor Gaidars, als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident in seine Reformregierung berufen, begann umgehend damit, das Wirtschaftssystem umzugestalten und stellte dabei die schrittweise Freigabe der Preise und die Privatisierung der Staatsbetriebe in den Mittelpunkt. Die »Schocktherapie« stürzte das Land in eine gigantische Inflation. Gleichzeitig sank die Produktion 1992 um fast 20 %. Dies führte zu einem dramatischen Absinken des Lebensstandards, sodass Mitte der 90erJahre über 30 % der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebten. Unter diesem Druck zerfiel die Mehrheit, die Jelzin im russischen Parlament besaß. Dieses stellte sich gegen den Präsidenten. Die gegenseitige Blockade führte im Herbst 1993 zur Staatskrise, zum Präsidenten-Dekret der Parlamentsauflösung und gewaltsamer Konfrontation, die mit Hilfe der Streitkräfte gelöst wurde. Das Parlamentsgebäude wurde beschossen und die Anführer verhaftet (Mommsen 1996, S. 28). Der Aufruhr und der massive Einsatz von Gewalt kosteten viele Opfer. Binnen zwei Monaten nach diesen Ereignissen, die jede Staatsmacht in Russland fraglich erscheinen ließen, ließ Jelzin über einen neuen Verfassungsentwurf abstimmen und das russische Parlament neu wählen. Zwar wies die Abstimmung über die Verfassung die geforderte Beteiligung von über 50 % auf und erhielt die mehrheitliche Zustimmung. Im neu gewählten Parlament saß jedoch eine noch deutlichere Mehrheit von Abgeordneten als zuvor, die gegen die Politik des Präsidenten eingestellt waren: Kommunisten, Nationalisten und Rechtsextremisten. Die Demokraten und »Zentristen«, die bereit waren Jelzin zu stützen, waren zersplittert und marginalisiert. Das große Vertrauensvotum, das Jelzin von der Bevölkerung noch beim Referendum im Frühjahr 1993 erhalten hatte, sollte er nie mehr erlangen. Auch die Autorität der Verfassung blieb über Jahre nur schwer zu verankern. Vor allem blieb die Polarisierung zwischen Präsident und Parlament unüberwunden und Jelzins Präsidentschaft hatte sich durch ihre Kompromisslosigkeit und die Entscheidung für das gewaltsame Vorgehen zur Geisel des Militärs gemacht. Die Bilder des von Panzern beschossenen und brennenden Parlamentsgebäudes wirkten sich auf das Prestige der Demokraten fatal aus, die mit dem Ruch des »Bürgerkrieges« behaftet waren. Dies trug erheblich zur Abwendung großer Teile der russischen Bevölkerung von der »Demokratie« bei (Mommsen 1996, S. 196). Die mit solchen Opfern errungene Verfassung (| Abb. 3 |) beginnt mit einer Selbstdefinition: »Das multinationale Volk der Russländischen Föderation« wird als das Subjekt dieser Verfassungsgebung sowie »Träger der Souveränität und einzige Quelle der Macht« im Staate bestimmt. Sodann wird festgelegt: »Die Russländische Föderation – Russland ist ein demokratischer föderativer Rechtsstaat mit republikanischer Regierungsform.« Und: »Der Mensch, seine Rechte und Freiheiten bilden die höchsten Werte. Anerkennung, Wahrung und Schutz der Rechte und Freiheiten des Menschen und Bürgers sind Verpflichtung des Staates.« Damit wurde eine deutli- D&E Heft 58 · 2009 Abb. 2 Der russische Präsident Boris Jelzin rief am 19.8.1991 die Bevölkerung zum Generalstreik auf. Ein achtköpfiges »Notstandskomitee« hatte kurz zuvor die Macht in Moskau übernommen und den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow in seinem Feriensitz auf der Krim unter Hausarrest gestellt. Am 21.8. gaben die Putschisten auf und am 22.8. kehrte Gorbatschow nach Moskau zurück. © picture alliance, dpa che Hinwendung zu westlichen Verfassungswerten angedeutet. Dazu gehörten neben Demokratie, Rechtsstaat und Föderalismus auch das Bekenntnis zu Volkssouveränität und Gewaltenteilung. An den Anfang der Verfassung wurde außerdem ein ausführlicher Grundrechte-Katalog gestellt. Problematisch sieht dagegen die Machtverteilung unter den Staatsgewalten aus, in der dem Parlament nur eine schwache Position zugestanden, dem Präsidenten dagegen eine große Machtfülle übergeben wurde. Mit dem unbeschränkten Recht, Dekrete zu erlassen und Referenden in der Bevölkerung abzuhalten, wird selbst das Vorbild der Machtvollkommenheit des französischen Präsidenten überboten (| M 3 |). Dafür ist die Amtszeit des russischen Präsidenten auf nur vier Jahre begrenzt, und ihm ist nur die einmalige Wiederwahl gestattet. Am 19. Nov. 2008 hat jedoch das russische Parlament mit großer Mehrheit für die Amtszeitverlängerung des Präsidenten von vier auf sechs Jahre gestimmt. Die Absetzung ist nur unter erschwerten, komplizierten und aufwendigen Bedingungen möglich. Die Stellung des Amtsinhabers wurde gegenüber der Regierung noch zusätzlich dadurch verstärkt, dass der Präsident die »Hauptrichtungen der Innen- und Außenpolitik« festlegt. Er ist zudem Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Der Präsident ernennt den Premierminister »mit Zustimmung der Staatsduma«, also der zweiten – aus direkt gewählten Abgeordneten bestehenden – Kammer der Bundesversammlung. Wird diese Zustimmung dreimal versagt, greift der Präsident zur Parlamentsauflösung. Die Staatsduma erhielt die klassischen Gesetzgebungs- und Budgetrechte sowie solche der Kontrolle gegenüber der Tätigkeit der Exekutive. Auch hier kommt noch die Prärogative des Präsidenten zum Tragen, wenn das Parlament ein Präsidenten-Veto gegen Gesetze nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln zurückweisen kann. Diese große Übermacht des Präsidenten erhält ihre Legitimation aus der allgemeinen Volkswahl, durch die er ins Amt kommt. Der Föderationsrat als die Parlamentskammer, in die Abgeordnete von den Regionen delegiert werden, um dort deren Interessen zu vertreten, ist ein weiterer Faktor im Zusammenspiel der Gewalten. Nur mit seiner Zustimmung kann der Präsident den Generalprokurator – ein mit umfassenden Vollmachten ausgestatteter Generalstaatsanwalt – und die Richter am Verfassungsgericht bestimmen sowie den Kriegs- und Ausnahmezustand verhängen. Dieses »Oberhaus« hat auch das Recht, über den Einsatz der Streitkräfte im Ausland zu entscheiden. Schon frühzeitig etablierte sich damit ein System improvisiert eingerichteter Institutionen und informeller Strukturen an der Spitze. Diese verschmolzen mit dem stark personalistischen Herrschaftsstil des Präsidenten zum »System Jelzin«. Jelzin verschaffte sich neben der ständig wachsenden Präsidenten-Administration weitere machtvolle Organe, durch die ständige Kompetenz-Parallelen untereinander und mit der Regierung Au toritäre M acht in Rus sl and: Vom Kommunismus bis zum S ys tem P u tin 57 BENNO ENNKER konstruiert wurden. Die sogenannten »Machtminister«, Chefs der Geheimdienste, des Verteidigungs-, des Innen- und des Außenministeriums, wurden im »Nationalen Sicherheitsrat« versammelt, den Jelzin mit weitreichenden Kompetenzen ausstattete, sodass er bald die Rolle einer »Oberregierung« einnahm. Wichtige politische Entscheidungen wurden auf dem Wege »einer geheimen Kabinettspolitik, die an die Praktiken des sowjetischen Politbüros erinnerte«, vorzugsweise in diesem Gremien gefasst. Die »Gehilfen des Präsidenten« hatten ständigen direkten Zugang zum ihm und wirkten oft parallel zu den entsprechenden Sachabteilungen in der Präsidentenadministration. Margareta Mommsen urteilt über diese Phänomene von »Wildwuchs, Konkurrenz und Parallelismen in und zwischen den Organen«: »Anstatt klarer transparenter Strukturen entstand ein Regime des Wettbewerbs der Institutionen und Akteure. Dies war eine der Ursachen dafür, dass eine ‚kompetitive Oligarchie’ als eines der herausragenden Merkmale des Übergangsregimes in Russland entstand.« (Mommsen 2003, S. 33f). Niedergang einer demokratischen Präsidentschaft 58 Seit dem Herbst 1994 manifestierten sich die dramatischen Fehlleistungen des Präsidialregimes ohne funktionierende »checks and balances«. Dies wurde zunächst durch die im Sicherheitsrat gefällte Entscheidung für den Beginn des Ersten TschetschenienKrieges deutlich. Angesichts der schwindenden Popularität Jelzins sorgte 1996 eine Koalition von Finanzmagnaten (Oligarchen) (| Abb. 5 |) durch ihre Geldmittel und die Herrschaft über die privaten Massenmedien für seine Widerwahl. Hierbei ist vor allem Boris Beresowski zu nennen, der als Chef des größten Medienkonzerns des Landes die öffentliche Meinung stark beeinflussen konnte. Er wurde nach der Wahl stellvertretender Sekretär des Sicherheitsrates. Als in der Folgezeit Jelzin über längere Perioden erkrankte, wurden die Staatsgeschäfte nicht vom verfassungsmäßig vorgesehenen Premierminister, sondern zunächst vom Chef der PräsidialAdministration, A. Tschubais, geführt. Nach dessen Ablösung wurde das Staatsruder – unter beständigen Konflikten und Intrigen in der höchsten politischen Spitze – faktisch von der »Familie«, einem engen persönlichen Kreis um Jelzin geführt, in dessen Mitte Beresowski stand. Diese Kräfte spielten die konkurrierenden bürokratischen Strukturen gegeneinander aus, schirmten Abb. 3 Die Verfassung der Russischen Föderation Abb. 4 Jelzin fordert Gorbatschow heraus: Der russische Präsident Jelzin zwingt den sowjetischen Präsidenten Gorbatschow am 23.8.1991, im russischen Parlament ein Protokoll seines Ministerkabinetts vom Putschtag vorzulesen. © picture alliance, dpa den gewählten Präsidenten vor der Öffentlichkeit ab, kontrollierten seine Informationszufuhr und handelten an seiner Stelle (Schröder S. 67f). Unterdessen war die »Privatisierung der Macht« für die Öffentlichkeit unübersehbar geworden. Sie funktionierte auf der Grundlage des Gruppenpluralismus der Staatsbürokratie und der Eliten. Eine der genauesten Beobachterinnen der politischen Macht in Russland, Lilija Schewzowa, hatte schon 1995 einen hellsichtigen Befund bei der Analyse des unter Jelzin herausgebildeten Systems formuliert: »Das stärkste Bollwerk gegen den Autoritarismus bildet nicht Russlands noch zerbrechliche Zivilgesellschaft, sondern der fragmentierte Charakter der postkommunistischen Elite selbst, deren zahlreiche Gruppen sich aus purem Eigeninteresse autoritären Maßnahmen widersetzen.« (Shevtsova, S. 69, in Mommsen 1996). Es sollte sich unter Jelzins Nachfolger, Wladimir Putin, zeigen, dass dieses Bollwerk nicht unüberwindbar war. Dem Chaos an der Staatsspitze gesellte sich ein riesiges Ausmaß an Korruption quer durch alle Gesellschafts- und Verwaltungsetagen sowie eine Explosion der Kriminalität, die die Verunsicherung der russischen Bürger ins Extrem trieben. Dies verzerrte Abbild von »Demokratie«, das durch das System Jelzin geboten wurde, war begleitet von der sozialen Polarisierung von Arm und Reich im Gefolge der schockartigen Einführung der Marktwirtschaft. Der überwiegende Teil der Gesellschaft sah sich auf der Seite der »Verlierer«, nur ein Bruchteil konnte sich als »Gewinner« der Markt-Reform empfinden. Am Ende der Jelzin-Ära wurde diese vom weit überwiegenden Teil der russischen Bevölkerung ausschließlich negativ bewertet. Die Popularität seinen Nachfolgers Wladimir Putins (| Abb. 6 |) hat sich zunächst vor allem aus diesem populären Abscheu vor den Erfahrungen mit dem System Jelzin genährt. Wladimir Putin konnte, seitdem er im August 1999 als Premierminister und erklärter NachfolgeFavorit Jelzins angetreten war, sich immer deutlicher als personifiziertes Gegenbild zu all den negativen Erscheinungen präsentieren. Putin war, © Erich Schmidt-Verlag bevor er Premierminister und Jelzins Au toritäre M acht in Rus sl and: Vom Kommunismus bis zum S ys tem P u tin D&E Heft 58 · 2009 Gewonnen, zerronnen Vermögen russischer Oligarchen, in Milliarden Dollar KERNGESCHÄFT VERMÖGEN MITTE 2008 ENDE 2008 SCHULDEN Oleg Deripaska Aluminium, Rohstoffe 28,0 7,2 14,0 Roman Abramowitsch Ölindustrie, Infrastruktur 23,5 3,3 2,0 Wladimir Lissin Stahlindustrie 22,2 3,1 3,3 Alexej Mordaschow Stahlindustrie 22,1 3,5 0,2 Wladimir Potanin Rohstoffe 21,5 2,0 – Michail Prochorow Rohstoffe, Banken 21,5 1,3 – Abb. 5 Vermögen russischer »Oligarchen« in Mrd. Dollar. Hier ein weiterer Ausblick: Zahlen vor und nach der weltweiten Finanzkrise 2008/09 © nach: Iswestija, 21.5.2009 Kronprinz wurde, bereits ein Jahr lang Chef des Geheimdienstes FSB. Das gab ihm die Möglichkeit, die korrupten Umtriebe der Kreml-Familie und der mit ihr verbundenen Oligarchen genau zu erfassen und für seine Zwecke auszunutzen. Das »System Putin«, die populäre Zementierung autoritärer Herrschaft Jelzin ernannte Putin im September 1999 zum Ministerpräsidenten. Innerhalb von vier Monaten stiegen dessen Beliebtheitswerte von zwei auf über 40 Prozent. Mit einer massiven, intelligent konzipierten und verschwenderisch finanzierten Imagekampagne, die alle Mittel einsetzte und geschickt mit dem Feindbild Tschetschenien spielte – der russische Einmarsch in Tschetschenien im September 1999 war integraler Bestandteil der Wahlkampagne -, wurde der Masse der Wählerschaft suggeriert, dass Putin der einzig akzeptable Präsidentschaftsanwärter sei. Zum Jahreswechsel trat Jelzin zurück (| M 4 |) und Putin wurde amtierender Präsident. Am 26. März 2000 setzte er sich im ersten Wahlgang der Präsidentenwahl mit 52,9 Prozent durch. Er legte zwei Tage vor Jelzins Rücktritt, am 29.12.1999, sein politisches Programm vor: Russland war eine Großmacht und es muss wieder zu einer solchen werden, hieß es dort. Entscheidende Voraussetzung dafür sei eine starke Volkswirtschaft. Die russische Gesellschaft habe allerdings schon zu viele radikale Veränderungsschritte in den letzten Jahren erleiden müssen, sodass nun eine »evolutionäre, sukzessive und ausgewogene Vorgehensweise« notwendig sei, um Stabilität zu erreichen und um eine Vertiefung der Spaltung in der Gesellschaft zu verhindern. Daher forderte Putin in allen seinen Verlautbarungen einen »starken Staat« (| M 9 |). Sobald der neue Präsident sein Amt übernommen hatte, ging er an die Ordnung der Machtverhältnisse. Bei der Konsolidierung seiner Machtposition musste Putin sich mit jenen Kräften auseinandersetzen, die er als Gegenmächte gegen seine Gestaltungsmöglichkeiten als Präsident und als Gegenmächte gegen die Zentralgewalt ansah (| Abb. 7 |): Dazu zählte er an erster Stelle die unter Jelzin gewachsenen Zentrifugalkräfte der »föderalen Subjekte«, der Regionen und Republiken und die Eigenmächtigkeiten ihrer »Provinzfürsten«. Künftig sollte sich der Föderations-Rat nicht mehr aus Gouverneuren bzw. Republikpräsidenten und Vorsitzenden der Regionalparlamente zusammensetzen, sondern aus entsandten Vertretern der Regionen. De facto bedeutete dies die Entmachtung des Föderationsrates. Per Präsidialerlass schuf Putin sieben Föderalbezirke, an deren Spitze je ein bevollmächtigter Vertreter des Präsidenten steht. Ihre Aufgabe ist es, die D&E Heft 58 · 2009 Abb. 6 Präsident Wladimir Putin und der ehemalige Präsident Boris Jelzin bei einer Parade auf dem Roten Platz in Moskau anlässlich des Jahrestages des Sieges der Roten Armee am 9. Mai 1945 © picture alliance, dpa Umsetzung der Politik der Zentralregierung und der präsidialen Personalpolitik in den Regionen zu kontrollieren. Die seit 1996 praktizierte direkte Wahl der Gouverneure in den Regionen der russischen Republik schaffte Putin Ende 2004 wieder ab. Seither schlägt er selbst den Kandidaten für ein Gouverneursamt vor. Sein Vorschlag muss zwar vom jeweiligen Regionalparlament bestätigt werden, der Staatspräsident hat jedoch das Recht, das Regionalparlament aufzulösen, wenn diese Bestätigung bis zur dritten Lesung nicht erfolgt. Die Macht der früheren Kreml-Familie wurde durch Einführung von wirtschaftsliberalen Vertrauensleuten aus Putins früherer Wirkungsstätte, St. Petersburg sowie durch das Vorgehen gegen Beresowski weiter reduziert. Nach und nach brachte Putin zahlreiche Angehörige des Inlandsgeheimdienstes FSB (sog. »Silowiki«, wörtlich: die Kräftigen, Mächtigen), die er aus seiner früheren langjährigen Geheimdiensttätigkeit kannte, in Schlüsselstellungen der Exekutive. Damit wurde die Macht der Repräsentanten der diversen Geheimdienste, des Militärs und der Polizei-Behörden in der präsidialen Machthierarchie erheblich gestärkt. Vor allem wurden Kommandohöhen der Wirtschaft im Öl-, Gas- und Rüstungsgeschäft mit Silowiki besetzt, die als »Putins Oligarchen« oder »Staats-Oligarchen« bezeichnet werden. Wie weit diese Macht wirklich reicht, bleibt allerdings umstritten, zumal diese davon abhängt, ob sie in einem korporativen Interesse integriert ist. Gerade ihre tiefe Verquickung mit wirtschaftlichen Interessen sorgt offensichtlich für eine wirksame Fragmentierung dieser Elitengruppen und heftigen Konkurrenzkampf unter einander, der zum Ende von Putins Präsidentschaft bis zu einem »Krieg der Geheimdienste« führte (Shevtsova S. 100ff). Gegenüber der Macht der Oligarchen verfolgte er eine Doppelstrategie: Während er gegen politisch ambitionierte »Oligarchen« wie Boris Beresowski und Wladimir Gussinski vorging, die über Massenmedien Einfluss ausübten, bezog er die Mehrheit der Großunternehmer in einen fortgesetzten Dialog ein. Noch im Laufe des Jahres 2000 sicherte sich die Putin-Administration so die Verfügung über die wichtigsten Fernsehsender und hatte damit die Mittel zur Meinungsmanipulation (Schröder). Die Unterwerfung des Fernsehens führte zu einer faktischen Verstaatlichung dieses Medium und effektiver Einschränkung der Pressefreiheit. Diese Kontrolle über die wichtigsten Massenmedien, insbesondere die landesweit zu empfangenden Fernsehsender durch den Staat war eine Voraussetzung für den Ausbau der Macht des Präsidenten. Wenige Monate vor den Duma-Wahl 2003 ging die Staatsanwaltschaft im Herbst dann gegen Michail Chodorkowski vor, der an Au toritäre M acht in Rus sl and: Vom Kommunismus bis zum S ys tem P u tin 59 BENNO ENNKER »Familie« Jelzin mit der Basis Reformer aus St. Petersburg Silowiki Silowiki Putin PräsidialApparat Reformer aus St. Petersburg Putin Oligarchen Regionale Führer 60 Oligarchen Regionale Führungen JelzinFamilie Abb. 7 System der Machtgruppierungen bei Putins Machtantritt © nach: Eberhard Schneider Abb. 8 der Spitze des Mineralölunternehmens JUKOS stand. Die Strafverfahren gegen Chodorkowski und einige seiner Mitarbeiter, denen von der Staatsanwaltschaft insbesondere Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe vorgeworfen wurde, wurden von vielen Beobachtern als erneutes Signal gesehen, dass Putin eine gegen ihn gerichtete Politik der Oligarchen nicht duldet. 2005 wurde Chodorkowski schließlich zu acht Jahren Lagerhaft verurteilt, ein offensichtlich bestelltes Urteil in einem Prozess, der allen rechtsstaatlichen Maßstäben Hohn sprach (Nußberger). Unter den übrigen Finanzmagnaten führte dieses Vorgehen zu großer Verunsicherung und schließlich zur Unterwerfung unter Putins Forderung, sich aus aller Politik herauszuhalten. Putin gelang es, von Dezember 1999 an, Parlamentswahlen zu gestalten, die ihm mit immer größeren Mehrheiten eine fast gänzlich hörige Duma bescherte. Seit 2003 besitzen dort die ihn unterstützenden »Parteien der Macht« eine Zweidrittelmehrheit. Liberale und demokratische Parteien sind seit 2007 im Parlament auch nicht mehr durch einzelne fraktionslose Abgeordnete vertreten, da sie nicht mehr direkt gewählt werden können, wie eine Änderung des Wahlgesetzes bestimmte. Ihre Parteien scheiterten bereits 2003 an der Fünf-Prozent-Hürde, die für die Listenwahl galt, nach der damals die Hälfte der Duma gewählt wurde. Das neue Wahlgesetz ließ nur noch diese Listenwahlen zu. Putins Politik fand breiten Rückhalt in der Bevölkerung, wie sich in regelmäßigen Umfragen und in seiner Wiederwahl im Frühjahr 2004 zeigte, als er 71,3 % der Stimmen erhielt. Ein Grund für die anhaltend hohe Popularität Putins (vgl. Umfragen des »Lavada Centers«) liegt – unabhängig von der geringen Medienpräsens der Opposition – in dem weit verbreitete Wunsch nach einem »starken Staat«, der die Bürger vor negativen Auswirkungen der Marktwirtschaft, aber auch vor dem gesellschaftlichen Chaos, der Kriminalität der 90er-Jahre und der Gefahr des Auseinanderbrechens der Russischen Föderation in Schutz nehmen soll. Den wichtigsten Rahmen für die Stabilisierung von Putins Popularität bot allerdings das allerdings schon vor seinem Amtseintritt – einsetzende Wirtschaftswachstum, das vorrangig durch den Anstieg des Ölpreises getragen wurde (| Abb. 9 |, | M 7 |). Die Bausteine für das mehr denn je auf die Person des Präsidenten zugeschnittene »System Putin« stammen dennoch zumindest zum Teil bereits aus der Periode von Jelzins Präsidentschaft: 1. Die Präsidialverfassung mit ihren mangelhaft austarierten Gewichten der Staatsgewalt wurde in der Praxis bereits unter Jelzin im Übermaß zugunsten der Prärogative des Präsidenten ausgenutzt. Putin hatte diese Praxis weiter getrieben und durch Entmachtung der föderalen Subjekte eine vorher unmögliche Zentralisierung erreicht. 2. Die Macht der Oligarchen, deren direkte Intervention in die Politik er mit aller Gewalt unterband, konnte er in eine eigene Machtressource für sein Eingreifen in die Wirtschaft umwandeln. 3. Die Geheimdienste, deren Aufstieg in den letzten Jahren der Jelzin-Zeit begann, wurden von Putin nicht nur auf Schlüsselpositionen der Exekutive geführt, sondern auch mit der Verteilung von »Staats-Oligarchen« auf Kommandohöhen von Energie- und Rohstoffkonzernen vollendet. 4. Der anhaltende Rückhalt in der Bevölkerung, den Jelzin in diesem Ausmaß selbst in seinen besten Zeiten nie genoss, wurde gewährleistet durch neue Elemente in der Machtausübung, unter denen die staatliche Kontrolle der Fernsehsender die wichtigste ist. Beobachter des Geschehens haben die Präsidentschaft Putins als »die bisher deutlichste Verkörperung des »russischen Weges« eingeordnet: »Dieser Weg verläuft sozusagen gleich weit entfernt vom kommunistischen Totalitarismus und vom westlichen Liberalismus. Insofern handelt es sich um einen der vielen »Dritten Wege«. (…) Die zentrale politische Forderung des »russischen Weges« lautet: »Alle Macht dem Kreml!« (Simon S. 9) Die Parole gilt weiterhin, auch nachdem es seit dem Frühjahr 2008 zu einem genau inszenierten Austausch der Ämter gekommen war, nachdem Putins zweite Amtszeit abgelaufen und seine erneute Wiederwahl durch die Verfassung untersagt war: Dmitri Medwedew (| Abb. 8 |, | Abb. 10 |), vormals stellvertretender Premierminister und Chef des Energie-Monopolisten GASPROM, wurde von Putin als Nachfolger auserkoren und nach einer planvoll durchgeführten Wahl neuer Präsident. Putin wurde Premierminister und gleichzeitig Chef der Kreml-Partei »Einiges Russland«, die das Parlament beherrscht. Trotz liberaler Versprechen des neuen Präsidenten in Hinblick auf die Unabhängigkeit der Gerichte und Korruptionsbekämpfung bleibt die Macht Putins ungebrochen und das »System Putin« scheint zementiert. Denn an seiner Autorität unter dem Konglomerat der Machteliten und seiner ungebrochen höchsten Popularität hängt vorläufig das gegenwärtige politische System Russlands. Veränderte Machtgruppierungen unter Putin © Benno Ennker Literaturhinweise Brown, Archie (2000): Der Gorbatschow-Faktor. Wandel einer Weltmacht. (Aus d. Englischen) Frankfurt a. M. Buhbe, Matthes/Gorzka, Gabriele (Hrsg.) (2007): Russland heute. Rezentralisierung des Staates unter Putin. Wiesbaden. Gorzka, Gabriele/Schulze, Peter W. (Hrsg.) (2002): Russlands Perspektive. Ein starker Staat als Garant von Stabilität und offener Gesellschaft? Bremen. Au toritäre M acht in Rus sl and: Vom Kommunismus bis zum S ys tem P u tin D&E Heft 58 · 2009 Abb. 9 »Lasst uns Demokratie lernen!« – Karikatur aus dem Wahlkampf 1989 in der UdSSR © Krokodil, Russische Satirezeitschrift Höhmann, Hans-Hermann/Schröder, Hans-Henning (Hrsg.) (2001): Russland unter neuer Führung. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts. Münster. McFaul, Michael (2001): Russias’s Unfinished Revolution. Political Change From Gorbachev to Putin. Ithaca u. London. Mommsen, Margareta (1996): Wohin treibt Russland? Eine Großmacht zwischen Anarchie und Demokratie. München. Abb. 11 Händedruck zwischen dem russischen Staatspräsidenten Dimitri Medwedjew (links) und dem russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin am 20.11.2008 auf dem Parteikongress der Partei »Einiges Russland!« © picture alliance, dpa, Dies. (2003): Wer herrscht in Russland? Der Kreml und die Schatten der Macht. München. Dies./Nussberger, Angelika (2007): Das System Putin. Gelenkte Demokratie und politische Justiz in Russland. München. Sakwa, Richard (2004): Putin. Russia’s Choice. London & New York. Shevtsova, Lilia (2005): Putin’s Russia. Rev. & exp. Edit. Washington. Dies. (2007): Russia. Lost in Transition. The Yeltsin and Putin Legacies. Washinton. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (2001): Russland unter Putin. Der Bürger im Staat, 51. Jgg., H. 2/3. Bundeszentrale für politische Bildung (2003): Russland. Informationen zur politischen Bildung, Nr. 281. Monatszeitschrift »Osteuropa«, hrsg. Von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. 61 Abb. 12 »Ob Dimitri Medwedew schon wie der Präsident aussieht?« © Kommersant-Vlast, Russische Wochenzeitschrift vom 21.1.2008, http://kommersant.ru Internethinweise www.laender-analysen.de/russland/ (Russland-Analysen, hrsg. von der Forschungsstelle Osteuropa, Bremen) www.swp-berlin.org/ (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin) www.carnegie.ru/en/ (Carnegie Endowment for International Peace, the Carnegie Moscow Center, englisch) Abb. 10 Wirtschaftliche Transformation in der Russischen Föderation und in Osteuropa D&E Heft 58 · 2009 © Erich Schmidt Verlag Au toritäre M acht in Rus sl and: Vom Kommunismus bis zum S ys tem P u tin BENNO ENNKER M 3 Boris Jelzin über die neue russische Verfassung Materialien »Aber was wollen Sie? In einem Land, das an Zaren und Führer gewöhnt ist; in einem Land, in dem sich keine klaren Interessengruppen herausgebildet haben, in dem die Träger der Interessen nicht bestimmt sind, sondern erst normale Parteien im Entstehen begriffen sind; in einem Land, in dem der rechtliche Nihilismus überall zu Hause ist; – wollen Sie in einem solchen Land das Hauptgewicht allein oder in erster Linie auf das Parlament legen? Nach einem halben Jahr, wenn nicht früher, werden die Leute nach einem Diktator rufen. Dieser Diktator wird sich schnell finden, davon bin ich überzeugt. Und wahrscheinlich in diesem Parlament. Jede Zeit hat ihr eigenes Machtgleichgewicht in einem demokratischen System. Heute schlägt in Russland dieses Gleichgewicht zugunsten des Präsidenten aus.« M 1 »Glasnost« und »Perestroika« Auf dem XXVII. Parteitag der KPdSU führte am 25. Februar 1986 Gorbatschow in seinem Grundsatzreferat erstmals den Begriff Glasnost ein mit den Worten: (a) »Ohne Glasnost gibt es keine Demokratie, und es kann sie auch nicht geben. (…) Es kommt darauf an, Glasnost zu einem störungsfrei funktionierenden System werden zu lassen. Man braucht Glasnost im Zentrum, aber ebenso sehr, ja vielleicht sogar noch mehr an der Basis, dort, wo der Mensch lebt und arbeitet.« Michail Gorbatschow: Erinnerungen. Berlin 1995, Seite 284. Boris Jelzin. Interview in Izvestija vom 16.11.1993 (übersetzt und zit. In: Margareta Mommsen: Wohin treibt Russland? Eine Großmacht zwischen Anarchie und Demokratie. München 1996, S. 202–203. (b) Perestroika ist eine unumgängliche Notwendigkeit. (…) Diese Gesellschaft ist reif für eine Veränderung. Sie hat sich lange danach gesehnt. Jeder Aufschub hätte in naher Zukunft zu einer Verschlechterung der Situation im Innern führen können und eine ernste soziale, wirtschaftliche und politische Krise heraufbeschworen. (…) Wir wollen Offenheit in allen öffentlichen Angelegenheiten und in allen Bereichen des Lebens. Das Volk muss wissen, was gut und was schlecht ist, um das Gute zu mehren und das Schlechte zu bekämpfen. So sollten die Dinge im Sozialismus sein. 62 M 4 Boris Jelzin begründet seinen vorzeitigen Rücktritt »Heute, an diesem für mich wichtigen Tag, möchte ich Ihnen mehr persönliche Worte sagen als gewöhnlich. Ich möchte Sie um Vergebung bitten. Um Vergebung dafür, dass viele Ihrer Erwartungen enttäuscht wurden. Das, was uns einfach erschien, hat sich als qualvoll und schwierig herausgestellt. Ich bitte um VergeMichail Gorbatschow: Perestroika, Die zweite russische Revolution, München 1997, S. 17 bung dafür, dass ich die Hoffnungen der Menschen nicht zu erfülund S. 92. len vermochte, die glaubten, dass wir schlagartig aus dem grauen, totalitären Stillstand der Vergangenheit in eine lichte, (c) »Über die Demokratisierung, über die Umgestaltung, über die wohlhabende und zivilisierte Zukunft springen könnten. Ich habe Einbeziehung des Volkes in alle gesellschaftlichen Prozesse, selbst daran geglaubt. Es schien, noch ein Ruck, und wir schaffen kann man die Umgestaltung verwirklichen und ihr unumkehres. Mit einem Ruck hat es nicht geklappt. Teilweise war ich zu baren Charakter verleihen. Ich würde hier nur hinzufügen, naiv. Teilweise waren die Probleme zu schwierig. Wir kämpften dass Demokratisierung und Offenheit nicht bloß Mittel der uns vor durch Fehler und Misserfolge. Viele Menschen mussten in Umgestaltung sind. Sie bedeuten die Realisierung des eigentdieser schwierigen Zeit Erschütterungen erleben. (…) Ich gehe. lichen Wesens unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung, Ich habe alles getan, was ich konnte. Ich gehe nicht wegen der einer Gesellschaftsordnung der Werktätigen und für die Gesundheit, ich gehe wegen der Gesamtlast der Probleme. Mir Werktätigen. Das ist keine vorübergehende Kampagne, sonfolgt eine neue Generation, eine Generation, die mehr und Bessedern das Kernstück des Sozialismus.« res zu leisten vermag. Gemäß der Verfassung habe ich meine Michail Gorbatschow: Rede im Plenum des Zentralkomitees der KPdSU am 8.1.1988. In: Amtsgeschäfte an Ministerpräsident Wladimir Putin übergeben. Michail Gorbatschow: Die Zweite Etappe hat begonnen. Eine Debatte über die Zukunft der Er wird drei Monate lang Interimspräsident sein, und Ende März Reformpolitik. Köln 1988, S. 21. kommt die Präsidentenwahl. Ich war immer von der verblüffenden Weisheit der Russen überzeugt. Deshalb zweifele ich nicht daran, »In der zweiten Hälfte der 80er Jahre begann die Perestrojka. Erinnern Sie sich an Ihre welche Wahl Sie Ende März 2000 trefEinstellung dazu zu Beginn der Perestroika, am Ende und heute?« fen werden. (…) Frohes Neues Jahr! Frohes Neues Jahrhundert, meine Vollständige Unterstützung Nicht eindeutig, aber eher negativ Keine Erinnerungschwer zu sagen Lieben!« Nicht eindeutig, aber eher positiv Vollkommene Ablehnung © Boris Jelzin, nach: www.manager-magazin.de/ geld/artikel/0,2828,58191,00.html Heute (2005) Gegen Ende (1989–1991) Zu Beginn (1985–1988) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% M 2 Umfragen zur Beurteilung der »Perestroika« in der Russischen Föderation © Zahlen nach: Russland-Analysen, Forschungsstelle Osteuropa, 2005 Au toritäre M acht in Rus sl and: Vom Kommunismus bis zum S ys tem P u tin D&E Heft 58 · 2009 M 5 Wer ist in den Augen der russischen Bevölkerung am Elend und Chaos in den Neunzigerjahren Schuld? (Angaben in %) 1994 21,9 12,2 29,0 18,1 5,4 6,0 7,1 3,7 4,5 20,0 26,1 8,3 5,3 23,9 0,5 8,6 1 – KPdSU 2 – Kommunisten (heutige KPRF) 3 – M. Gorbatschow 4 – B. Jelzin 5 – Internationale Finanzkreise 6 – Demokraten 7 – Internat. Verschwörung gegen Russland 8 – USA, amerikan. Imperialismus 9 – Juden 10 – Mafia 11 – Nomenklatura 12 – Spekulanten 13 – Nationalisten 14 – Wir selbst 15 – Niemand 16 – Keine Meinung 2001 12,6 5,2 32,1 34,0 6,9 7,2 9,4 5,5 3,6 25,5 15,8 4,9 2,4 29,9 1,8 15,0 © Zahlen nach: Russisches unabhängiges Institut für soziale und nationale Probleme – Institut für komplexe Sozialforschung der russischen Akademie der Wissenschaften, im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, Moskau, Februar 2002 In welchem Maße verdienen folgende Institutionen Vertrauen … völlig sammen!« Am 31. Januar 1990 wurde in Moskau der erste McDonald’s eröffnet. Dieses Ereignis kann als Synonym für die Konsumrevolution gelten, welche die ehemals sozialistischen Länder im Zuge des Übergangs zur Marktwirtschaft erlebten. © Krokodil. Satiriceskij Zurnal 9/1990, S. 1, zit. nach: Althanns, Luise: Die Eröffnung der ersten McDonald’s in Moskau. In: Themenportal Europäische Geschichte (2007), www.europa.clio-online.de/2007/Article=227 überhaupt nicht 2001 2004 2001 2004 Präsident 52 % 62 % 7% 6% Kirche, Religionsgruppen 41 % 41 % 12 % 8% Presse, Radio, Fernsehen 28 % 26 % 18 % 18 % Armee 33 % 28 % 18 % 20 % Staatssicherheitsorgane 22 % 20 % 19 % 20 % Föderationsrat 12 % 8% 21 % 23 % Staatsanwaltschaft 11 % 13 % 30 % 27 % Gerichte 13 % 14 % 26 % 27 % Regierung 21 % 12 % 22 % 29 % Staatsduma 10 % 9% 35 % 33 % Regionale Führungsorgane 21 % 19 % 27 % 33 % Gewerkschaften 14 % 10 % 31 % 34 % Kommunale Führungsorgane 20 % 18 % 31 % 37 % Politische Parteien 7% 5% 36 % 40 % Miliz (Polizei) 12 % 11 % 38 % 40 % M 6 Vertrauen zu Institutionen 2001 und 2004 M 8 »Moskau … wie viel kommt in diesem Klang für das russische Herz zu- © Russlandanalysen 24/2004 12 M 9 Wladimir Putins Milleniums-Rede »Russland wird in naher Zukunft keine, wenn überhaupt, zweite Ausgabe, sagen wir, der USA oder Englands werden, wo liberale Werte eine tief verwurzelte historische Tradition haben. Bei uns haben der Staat, seine Institutionen und Strukturen im Leben des Landes immer eine außerordentlich wichtige Rolle gespielt. Der starke Staat ist für Russen keine Anomalie, nicht etwas, wogegen man kämpfen müsste, sondern im Gegenteil eine Quelle und ein Garant der Ordnung, ein Initiator und die wesentliche bewegende Kraft jedweder Veränderung. Die heutige russische Gesellschaft setzt einen starken und effektiven Staat nicht mit einem totalitären gleich. Wir haben gelernt, die Wohltaten der Demokratie, des Rechtsstaates und der persönlichen und politischen Freiheit zu schätzen. Gleichzeitig sind die Menschen durch die offensichtliche Schwächung der Staatsgewalt beunruhigt. Die Gesellschaft wünscht die Wiederherstellung einer richtungsweisenden und regulierenden Rolle des Staates in dem Maße, wie es notwendig ist, ausgehend von den Traditionen und der heutigen Lage Russlands. (…) Die heutige russische Gesellschaft setzt einen starken und effektiven Staat nicht mit einem totalitären gleich.« Wachstumsrate des realen BIP im Vergleich zum Vorjahr BIP-Wachstumsrate pro Kopf Durchschnittliche Wachstumsrate des BIP von 1999–2008 Durchschnittliche Wachstumsrate pro Kopf 10 Wladimir W. Putin: Russland an der Jahrtausendwende (Programmatische Millenniums-Rede Putins) in: Wolfgang Seiffert: Wladimir W. Putin: Wiedergeburt einer Weltmacht, München 2000, 139–164, hier: S. 152/153 8 6 4 2 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 M 7 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts und des Wachstums pro Kopf © Zahlen nach: Russland-Analysen, Forschungsstelle Osteuropa, 2005 D&E Heft 58 · 2009 Au toritäre M acht in Rus sl and: Vom Kommunismus bis zum S ys tem P u tin 63 III. MAUERÖFFNUNG IN EUROPA 5. Eine Weltmacht auf dem Rückzug? Von der UdSSR zur Russischen Föderation GERD BRAITMAIER A m 14.8.2008, sieben Tage nach dem Beginn des russischgeorgischen Krieges um Südossetien, erschien die Wochenzeitung »Die ZEIT« auf der Titelseite mit einer roten Überschrift: »Die russische Gefahr«. Im Bild gezeigt wurden voranstürmende russische Infanteristen und der Untertitel: »Mit ihrem Angriff auf Georgien zeigt sich die Großmacht so brutal wie zu Sowjetzeiten.« Auf der vierten Seite zeigen drei Bilder sowjetische Panzer in Prag 1968 und in Afghanistan 1979 sowie russische in der südossetischen Stadt Zchinwali 2008, das ganze unter der Überschrift: »Gibt es einen neuen Kalten Krieg?« Die »ZEIT« vermutete also eine russische »rollback«Strategie aus längst vergangen geglaubten Tagen: »Längst hat Moskau ein politisches Exportmodell entwickelt, das keine totalitäre Überwachung braucht, um zu herrschen: Wahlen ohne Opposition, freie Meinung ohne freie Medien, Richter ohne Rechtsstaat.« Ist gar ein neuer Kalter Krieg zu erwarten? Der »Fünftagekrieg« gegen Georgien aus russischer Sicht 64 Abb. 2 Demonstration in Georgien am 1.9. 2008 gegen die russische Militäraktion in Georgien © picture alliance, dpa Über einen »neuen kalten Krieg« schrieb auch Sergej Karaganow am 28.8.2008 in der »Russkaja Gazeta« und in der Zeitschrift »Rossija v global’noj politike«. Karaganow, immerhin Vorsitzender des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik, einem einflussreichen »Think-tank« der russischen Außenpolitik, stellte den Krieg in den Rahmen einer Auseinandersetzung über die Neuaufteilung der Welt und ihrer Ressourcen zwischen den Ländern des »alten Westens« und des »neuen Kapitalismus«, der sich im Zuge der Globalisierung in Osteuropa, Ost- und Südostasien entwickelt habe. Politisch finde diese Konkurrenz ihren Ausdruck im Gegensatz zwischen dem »liberalen Kapitalismus« des Westens und dem »autoritären Kapitalismus« Russlands und Chinas. Der »alte Westen«, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und ihres Imperiums den Sieg seiner kapitalistischen GesellRUSSLAND ABCHASIEN Suchumi SCHWARZES MEER 50 km 5797 Batumi SÜDOSSETIEN Poti Zchinwali G E O R G I E N Gori TÜRKEI Tiflis ARM. ASERB. Abb. 1 Georgien-Krieg: Bewaffneter militärischer Konflikt im Kaukasus zwischen Georgien auf der einen und Russland sowie den international nicht anerkannten Republiken Südossetien und Abchasien auf der anderen Seite. Der Konflikt wurde auf georgischem Staatsgebiet ausgetragen. Die offenen Kampfhandlungen zwischen Soldaten der georgischen Armee und südossetischen Milizverbänden begannen bereits im Juli 2008 und eskalierten in der Nacht zum 8. August, in der georgische Einheiten eine Offensive zur Rückgewinnung der Kontrolle über die ganze Region begannen. Daraufhin griffen aus dem Nordkaukasus russische Truppen ein, drängten die georgische Armee zurück und drangen bis ins georgische Kernland vor. 162 südossetische Zivilisten wurden getötet © picture alliance, dpa schaftsordnung und des »liberal-demokratischen Modells« feierte, habe angesichts des Wirtschaftsaufschwungs in Russland und China entdecken müssen, dass er in der globalen Konkurrenz an Boden verlor. Er habe zum Gegenangriff angesetzt, um verloren geglaubte Positionen wieder zu gewinnen, eine Neuaufteilung der Welt zu eigenen Ungunsten zu verhindern und die Modernisierung Russlands als Voraussetzung für dessen Großmachtposition zu verhindern. Der Westen erkläre jetzt den »autoritären Kapitalismus« russischer Provenienz zum »Feind«, um ihn zu stoppen, solange er noch nicht mehr Macht und Einfluss verfüge, und ihn notfalls zu »vernichten«. Der »Fünftagekrieg« zwischen Georgien und der Russländischen Föderation kennzeichnete einen Tiefpunkt im Verhältnis Russlands zum Westen im Allgemeinen und zu den USA im Besonderen. Das galt nicht nur für den Bereich der offiziellen Politik und der veröffentlichten Meinung, sondern das ergab auch die Befragung der russischen Bevölkerung. Das »Analytische Zentrum Jurij Levada« veröffentlicht seit 1990 regelmäßig Umfragen, in denen Bürger der RF nach ihrem Verhältnis zu den USA befragt wurden (| M 1 |). In der russischen Bevölkerung sanken während der Südossetienkrise die Sympathiewerte für die USA noch stärker als während des Kosovokrieges 1999 oder dem Irakkrieg 2003. Nicht einmal ein Viertel der Befragten bezeichnete ihre Haltung gegenüber den USA noch als »gut« oder »eher gut«. Über zwei Drittel nannten sie »sehr schlecht« oder »schlecht«. Das zeigt eine Umkehrung der bisherigen russischen Haltung gegenüber den USA. Denn trotz jahrzehntelanger sowjetischer Feindbildpropaganda stand die überwiegende Mehrheit der Russen den USA grundsätzlich freundlich gegenüber. Das unterschied die Haltung der russischen Bevölkerung erheblich von großen Teilen der politischen Klasse in Moskau, die bereits begann, die erste russische Regierung unter Boris Jelzin wegen allzu großer Nachgiebigkeit gegenüber dem Westen im Allgemeinen und den USA im Besonderen zu kritisieren. Kritiker wie Andrej Illarionow, Direktor des »Instituts für wissenschaftliche Analyse«, wenden hier ein, dass die Umfrageergebnisse wenig über die tatsächliche Haltung der russischen Bevölkerung aussagten und viel über die Tatsache, dass Wladimir Putin Eine Welt m a ch t auf d e m Rü ck z u g? Vo n d er Ud SS R z ur Ru s s is che n F ö d er at i o n D&E Heft 58 · 2009 in seinen zwei Amtsperioden als Präsident die wichtigsten elektronischen Medien unter staatliche Kontrolle brachte, sodass die Regierung den Prozess der Meinungsbildung der russischen Bevölkerung jetzt effektiv kontrollieren und steuern konnte – allzumal in außenpolitischen Angelegenheiten. Sollte es der russischen Regierung im Allgemeinen und Wladimir Putin im Besonderen nur darum gegangen sein, die politische Klasse und die Bevölkerung hinter sich zu bringen, dann hätten sie keine bessere Gelegenheit finden können. Seit 2005, das bestätigen alle verfügbaren Umfrageergebnisse und Presseanalysen (| M 2 |), sind Georgien und die georgische Regierung die »bete noir« der russischen Politik. Erstmals, schrieb Dmitrij Bulin, hätten die Personen an der Spitze des Staates die Unterstützung fast aller gefunden, die sich in Abb. 3 Russische Karikatur zum Georgienkonflikt © www.vpk.ru Russland berufsmäßig mit politischer Analyse befassten. Darüber hinaus habe der Krieg die russische Gesellschaft »geeint«, da die überwiegende Mehrheit im Land jetische Partei- und Staatsführung zu entschlosseneren Refordas Vorgehen der russischen Streitkräfte im südlichen Kaukasus men als bisher. Um diese abzusichern, revidierte die neue Parteiunterstützte. und Staatsführung unter Michail S. Gorbatschow seit 1985 die Der Krieg wurde in Moskau offiziell immer als ein Element russibisherige Außen-, Sicherheits- und Militärpolitik. Mit dem Stichscher Selbstbehauptung gegenüber den USA, der NATO und dem wort »neues Denken« (»novoe myslennie«) definierte sie sowjetiWesten verstanden. Dies um so mehr, als man den Eindruck sche Sicherheit und sowjetische Interessen neu, um Blocklogik hatte, dass Georgien (und die Ukraine) bei der amerikanischen und Denken in Nullsummenspielen zu überwinden. Strategie der »Einkreisung« bzw. »Eindämmung« Russlands eine wichtige Rolle spielten. Der Krieg mit Georgien und die anschlieDem »neuen Denken« folgte »neues Handeln«. Bei den Feiern aus ßende Anerkennung Abchasiens und Südossetiens, schrieb Vitalij Anlass des 40. Jahrestages des Kriegsendes in Europa, am Tret’jakov, beendete endgültig den bisherigen »Rückzug« und lei8.5.1985, forderte Gorbatschow eine »echte Rückkehr der Enttete einen neuen »Vormarsch« auf dem Weg zu einer »Russländispannung« und erklärte sich bereit, Verhandlungen über Rüsschen Union« (»Rossijskij Sojuz«) ein. tungskontrolle in allen Bereichen zu führen. Am 19.11.1985 traf er sich mit Ronald Reagan zu einem Gipfeltreffen in Genf, um die seit 1983 stagnierenden Verhandlungen über strategische AbrüsDer »Rückzug«: sowjetische Außenpolitik unter tung wieder in Gang zu bringen. Nach einem Gespräch unter vier Gorbatschow Augen sicherten sich die Vertreter der führenden Atommächte erstmals zu, keine militärische Vorherrschaft anzustreben. In der Anfang der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts ging in Europa gemeinsamen Erklärung hieß es, »dass ein Atomkrieg nicht gewonschon einmal die Rede von einem »neuen Kalten Krieg« um. Die nen werden kann und niemals ausgefochten werden darf«. Damit war Sowjetunion hatte nach einer Phase der Entspannung im Verhältder Start für Gespräche über Abrüstung und Rüstungskontrolle nis zu den USA (SALT-Verträge) und Westeuropa bzw. Deutschland gegeben. (Ostverträge, KSZE in Helsinki, MBFR in Wien) ihr weltpolitisches Am 15.1.1986 schlug Gorbatschow schließlich einen DreistufenEngagement intensiviert, insbesondere in Afrika (Somalia, Äthioplan für den Abbau aller Atomwaffen bis 2000 vor. Nach überwiepien, Angola, Mocambique) und schließlich auch in Asien (Afghagend positiven Reaktionen im Westen kündigte er am 28.7.1986 nistan). Die Stationierung eines neuen Typs atomarer Mittelstreeinen Teilabzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan an ckenraketen in Europa provozierte alte Ängste und führte zum und räumte damit einen weiteren Stolperstein für erfolgreiche berühmten »Doppelbeschluss« der NATO. Die sowjetische RegieAbrüstungsverhandlungen aus dem Weg. Das Treffen von Reykjarung sah sich vor einem neuen Rüstungswettlauf, den der USvik 1986 zwischen dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reamerikanische Präsident Ronald Reagan auch öffentlich propaagan und Michail Gorbatschow endete noch ohne Vereinbarung, gierte, etwa durch amerikanische Pläne eines weltraumgestützten weil sie sich nicht über das amerikanische SDI-Programm einigen Raketenabwehrsystems (SDI). Dem hatte die Regierung der konnten. Doch im Februar 1987 verzichtete Gorbatschow auf die UdSSR nichts entgegen zu setzen. Verknüpfung von Verhandlungen über den Abbau der europäiDie Diskrepanz zwischen der begrenzten Leistungsfähigkeit des schen Mittelstreckenraketen mit denjenigen über andere Waffeneigenen Systems und den Anforderungen, welche die selbst gesysteme, insbesondere dem amerikanischen SDI-Programm, und wählte Rolle einer mit den USA konkurrierenden Weltmacht gab damit den Anstoß für die Unterzeichnung eines Abkommens stellte, war einfach nicht mehr zu übersehen: sinkende Leistungsüber die Beseitigung aller Mittelstreckenraketen in Europa am fähigkeit der Wirtschaft, technische Rückständigkeit, ein Staats8.12.1987 in Washington, das weltweit als »historischer Durchhaushalt, der durch die Last der Militärausgaben blockiert war, bruch« gefeiert wurde. und gravierende Versorgungsprobleme, die zu latenten oder ofAm 6.2.1988 fühlte sich Gorbatschow innenpolitisch schließlich in fenen Legitimationskrisen der kommunistischen Parteiherrschaft so starker Position, um den Abzug aller sowjetischen Truppen aus in einzelnen Ländern des »Ostblocks« führten, zwangen die sowAfghanistan anzukündigen. Er bereitete damit ein weiteres Gip- D&E Heft 58 · 2009 Eine Welt m a ch t auf d e m Rü ck z u g? Vo n d er Ud S S R z ur Ru s s is che n F ö d er at i o n 65 GERD BRAITMAIER Abb. 4 Der Generalsekretär der KPdSU Michail Gorbatschow und der US-amerikanische Präsident Ronald Reagan auf einem Gipfeltreffen in Genf am 19.11.1985. In der Folgezeit wurden umfangreiche Abrüstungsvereinbarungen getroffen. © picture alliance, dpa 66 feltreffen mit dem amerikanischen Präsidenten in Moskau vom 29.5. bis 2.6.1988 vor, bei dem die Ratifizierungsurkunden des INF-Vertrages ausgetauscht wurden. Der sowjetische Truppenabzug wurde zwischen dem 15.5.1988 und dem 15.2.1989 verwirklicht und befreite die sowjetische Partei- und Staatsführung von einer schweren außen-, innen- und finanzpolitischen Bürde. Gorbatschow bemühte sich, die Initiative zu behalten und kündigte am 7.12.1988 in einer Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York als weitere einseitige Abrüstungsschritte die Reduzierung der sowjetischen Streitkräfte um eine halbe Million Mann und den Abzug von sechs Panzerdivisionen aus der DDR, der CSSR und Ungarn an. Nach Afghanistan wollte er sich offenbar auch der »burdens of empire« in Ostmittel- und Südosteuropa sowie Deutschland entledigen. Im April 1985 – er war gerade Generalsekretär der KPdSU geworden – hatte er bei der Unterzeichnung der Verlängerung des »Warschauer Vertrages« noch die »Einheit von Marxismus-Leninismus und sozialistischem Internationalismus« betont und damit die »Breschnew-Doktrin« von der »eingeschränkten Souveränität sozialistischer Staaten« bestätigt. Auf der Gipfelkonferenz der »Ostblock«-Staaten in Bukarest am 7.7.1989 gestand er nun jedem »sozialistischen Staat« ein Recht auf eigene Entwicklung zu und kündigte damit die »Breschnew-Doktrin« auf, welche diese Staaten notfalls unter Waffenandrohung und -einsatz (z. B.: Ungarn 1956, Prag 1968) an ein bestimmtes Staats- und Gesellschaftsmodell sowie in ein Bündnis mit der Sowjetunion zwang. Vom 12. bis 15.7.1989 besuchte Gorbatschow Bonn und erklärte zum Abschluss seines Besuches sogar: »Die Mauer kann wieder verschwinden, wenn die Voraussetzungen entfallen, die sie hervor gebracht haben.« Bei den Festveranstaltungen zum 40. Jahrestag der DDR am 7.10.1989 betonte er die Notwendigkeit von Reformen auch in der DDR und äußerte den legendären Satz: »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.« Am 9.11.1989 fiel dann schließlich die Mauer tatsächlich. Es begann damit der Umbruch in der DDR, der schließlich zur Vereinigung mit der BRD führte. Die sowjetische Regierung erteilte während dieser ganzen Zeit den in der DDR stationierten Truppen (immerhin 500.000 Mann) den Befehl, in den Kasernen zu bleiben und sich nicht in das Geschehen einzumischen. Michail Gorbatschow erklärte beim Treffen mit Bundeskanzler Helmut Kohl am 10.2.1990 in Moskau schließlich, dass die UdSSR einer Vereinigung Deutschlands nicht im Wege stehe. Beim Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten George H. Bush vom 31.5. bis 3.6.1990 gestand er zudem zu, dass die Bündniszugehörigkeit eines vereinten Deutschland von den Deutschen selbst entschieden werden müsse, wobei er sich keine Illusionen gemacht haben dürfte, wie dieses Votum ausfallen würde. Mit der Zustimmung Michail Gorbatschows zur Wiedervereinigung Deutschlands wurde endgültig deutlich, dass die Sowjetunion nicht mehr gewillt war, Selbstständigkeits- und Freiheitsbestrebungen in den ehemaligen«Ostblock«-Staaten gewaltsam zu unterdrücken und damit dem chinesischen Beispiel vom Sommer 1989 zu folgen. Die Regierungen der ehemaligen Mitgliedsstaaten des Warschauer Paktes drängten immer mehr auf einen Abzug der sowjetischen Truppen aus ihren Ländern und auf die Auflösung des Paktes. Die sowjetische Regierung wollte ihn wenigstens als Koordinierungsorgan für weitere Abrüstungsverhandlungen mit der NATO erhalten, gab schließlich jedoch nach. Am 25.2.1991 verkündete Gorbatschow das Ende des »Warschauer Paktes« und zog die Konsequenz aus den revolutionären Veränderungen in Ostmittel- und Südosteuropa sowie in Deutschland. Die militärischen Strukturen des »Warschauer Paktes« wurden am 31.3.1991, der Pakt selbst am 1.7.1991 aufgelöst. Am 5.1.1991 war bereits der »Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe« (RGW), das ökonomische Gegenstück zur WVO aufgelöst worden. Auch hier misslang die Umwandlung in eine Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Parallel zum Abbau der Blockkonfrontation in Europa und Deutschland kündigte die Sowjetunion ihr Engagement in Mittelamerika, Afrika und Asien auf. Die sowjetische Weltmacht zog sich auf der ganzen Linie zurück und gab den Anspruch auf, ein für alle vorbildliches und verbindliches »sozialistisches« Modell darzustellen und dieses auch durchzusetzen. Dies war der Preis für bessere Beziehungen zum Westen und insbesondere zu den USA als westlicher Vor- und Führungsmacht, für besseren Zugang zu westlichen Märkten, Wissen und Technologie, für die finanzielle Entlastung des Staatshaushaltes von Militärausgaben und weiteren Kosten für den Unterhalt des Imperiums. Aus der Sicht der sowjetischen Militärs, die von konservativen Parteiführern, Geheimdienstleuten und Sicherheitskräften geteilt wurde, schuf der Verlust der sowjetischen Bastionen in Ostdeutschland, Ost- und Südosteuropa jedoch neue Sicherheitslücken. Ein sowjetischer Admiral klagte im Juli 1990: »Im Westen haben wir unsere Verbündeten verloren, im Osten haben wir keine, und damit sind wir zur Situation von 1939 zurückgekehrt.« Eine Perspektive, die bis heute von manchen Angehörigen der »siloviki« der Russländischen Föderation geteilt wird. Gorbatschow und sein Außenminister Edward Schewardnadse suchten im Folgenden nach einer Alternative zur bisherigen sowjetischen Sicherheitskonzeption, die Sicherheit unilateral und in erster Linie als militärische Beherrschung von Territorium begriff. Die Rede vom »gemeinsamen Haus Europa« zielte auf die Auflösung der »Logik« bipolarer Konfrontation und des Denkens in »Nullsummenspielen« auf der Grundlage gleicher und geteilter Sicherheit für alle europäischen Staaten. Ein Schritt auf dem Weg zum »gemeinsamen Haus Europa« sollte der am 19.11.1990 in Wien unterzeichnete »Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa« (VKSE) sein, das bislang umfassendste Abkommen zur Abrüstung und Rüstungskontrolle für konventionelle Waffen (trat am 17.7.1992 in Kraft). Das Abkommen sollte ein stabiles Gleichgewicht konventioneller Streitkräfte auf niedrigem Niveau schaffen und Überraschungsangriffe und großangelegte offensive Operationen unmöglich machen. Ergänzt wurde dieser Vertrag durch die »Charta von Paris« vom 21.11.1990, die das Prinzip »gleicher Sicherheit für alle« verkündete und festschrieb, dass Sicherheit »unteilbar« sei. Durch die Weiterentwicklung der KSZE zur OSZE wurde am 11.7.1992 ein organisatorischer Rahmen geschaffen, welche dieses Prinzip institutionell verkörpern und politisch verwirklichen sollte. Eine Welt m a ch t auf d e m Rü ck z u g? Vo n d er Ud S S R z ur Ru s s is che n F ö d er at i o n D&E Heft 58 · 2009 Russlands »nationale Identität« und Außenpolitik unter Jelzin (1991 – 1999) Michail Gorbatschow hatte ursprünglich nicht die Absicht, die »Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken« (UdSSR) zu zerstören, die von ihr geschaffenen und beherrschten Bündnissysteme aufzulösen oder gar Deutschland zu vereinen. Diese Ereignisse waren eine Folge eines Prozesses, den sein »neues Denken« und noch mehr sein »neues Handeln« auslösten, des Zusammenwirkens »großer Politik« mit den Volksbewegungen sowie der inneren Machtkämpfe in den Staaten des sowjetischen Imperiums. Die Auflösung des Unionsverbandes war der machtpolitische Schachzug seines Gegenspielers Boris Jelzin. Dieser nutzte den gescheiterten Putschversuch gegen Gorbatschow vom 19.8.1991, um im Verein mit Führern anderer Sowjetrepubliken den »Austritt« Russlands aus der Sowjetunion zu beschleunigen und zu verhindern, dass die zentralen Organe der sowjetischen Staatsmacht seine Position als Präsident der russischen Sowjetrepublik gefährden könnten. Dem neuen russischen Staat fehlte nun aber ein »ungeteiltes Bekenntnis« seiner Eliten zum post-sowjetischen russischen Staat, eine »akzeptierte und integrierende nationale Identität«, die seiner Außenpolitik Kohärenz und Stabilität gewährt hätte, wie Gerhard Mangott schreibt. Zunächst setzte Andrej Kosyrew, der Außenminister Boris Jelzins, die Politik fort, die Gorbatschow mit der Idee des »gemeinsamen europäischen Hauses« vorgegeben hatte. Unter dem Stichwort »Europäismus« sollten die Kontakte zu allen europäischen Institutionen vertieft werden, um der RF den Weg in die Europäische Gemeinschaft (EG) bzw. später der Europäischen Union (EU) zu ebnen. Unter dem Terminus »Atlantismus« wurde ein langfristiges Projekt verfolgt, das letztendlich den Beitritt der RF zu NATO ermöglichen sollte. Die rasche Integration der RF in euro-atlantische Strukturen sollte sicherstellen, dass Marktwirtschaft, Demokratie und westliche Werte rasch Eingang in die postsowjetische, russische Gesellschaft fanden. Doch im Westen machte man eine erfolgreiche Transformation des politischen und ökonomischen Systems zur Voraussetzung einer Öffnung der Strukturen für die RF. Nur symbolisch und ökonomisch kam man der russischen Regierung entgegen: 1992 wurde die RF in die »G-7« und 1994 in das NATO-Programm »Partnerschaft für den Frieden« sowie in den »Internationalen Währungsfond« (IWF) aufgenommen. Die »Europäische Union« ersetzte 1994 das 1989 mit der UdSSR abgeschlossene Handels- und Kooperationsabkommen durch einen neuen Vertrag, welche die Beziehungen zur RF dauerhaft konsolidieren sollte. 1996 wurde die RF in den Europarat aufgenommen, begleitet von heftigen Kontroversen über das russische Vorgehen im ersten Tschetschenienkrieg (1994–1996). Innenpolitisch attackierten die kommunistischen und nationalistischen Gegenspieler den »Euro-Atlantismus« als »idealistisch« und »romantisch«. Diese Politik sei der Größe und der Würde Russlands nicht angemessen, weil das Land dadurch zum »Juniorpartner« der USA werde. Seine Rolle als eigenständiger Akteur im internationalen System werde geschwächt, seinem Ansehen als »Großmacht« sei es abträglich. Die RF sei geographisch, geopolitisch und geostrategisch nicht nur eine europäische, sondern auch eine asiatische Macht. Zudem vernachlässige die Regierung durch ihre Orientierung nach und am Westen den Raum der ehemaligen Sowjetrepubliken und verstoße damit sträflich gegen die nationalen Interessen Russlands. Russische Politik gegenüber dem »nahen Ausland« unter Jelzin Der neue Staat definierte sich »russländisch« (»Rossijskaja Federacija«) und nicht »russisch« (»Russkaja Federacia«), politisch und nicht ethnisch, was angesichts des multinationalen Charakters der RF auch angebracht schien. Zudem implizierte dies der Idee D&E Heft 58 · 2009 Abb. 5 Der russische Präsident Boris Jelzin und Bundeskanzler Helmut Kohl stellten in baden am 17.4.1997 erste Weichen für eine NATO-Osterweiterung © picture alliance, dpa nach den Verzicht auf eine ethnisch zu begründende Politik der Revision der Grenzen, ein wichtiger Schritt zur Vermeidung kostspieliger Grenz- und Bürgerkriege. Denn am Ende der UdSSR befanden sich nach den Angaben von Gerhard Mangott ca. 25,1 Millionen Russen außerhalb der Grenzen der RF wieder. 2004 waren es immer noch 18,5 Millionen, davon 8,3 Millionen in der Ukraine, 4,6 Millionen in Kasachstan, etwas über 1 Million in Belarus und in Turkmenistan. In Georgien, dem Schauplatz des jüngsten Krieges, lebten 2004 noch ungefähr 300.000 Russen. Die Idee einer »Bürgernation« stand im politischen Diskurs stets im Konflikt mit einem ethnischen Staatsbegriff, aus dem eine Zuständigkeit für die russischen Minderheiten in den benachbarten, unabhängig gewordenen Sowjetrepubliken abgeleitet wurde. Gegenüber den baltischen Staaten und der Ukraine benutzte die russische Diplomatie ihre Schutzfunktion über die russische Diaspora als Druckmittel und Anlass zur Einmischung in die inneren Angelegenheiten des »nahen Ausland«, wie Präsident Boris Jelzin die ehemaligen Sowjetrepubliken nannte. Der ethnische Faktor führte dazu, dass ein erheblicher Teil der politischen Klasse in Moskau sich mit den neuen Grenzen nicht abfand. In ihrer Wahrnehmung waren die »russländischen« Grenzen immer noch identisch mit den sowjetischen. Der Bezugsrahmen russischen Selbstverständnisses und davon abgeleiteter Außen- und Sicherheitspolitiken blieb die Sowjetunion. Dies verdankte sich auch dem Umstand, dass die RF als Rechtsnachfolger der UdSSR nicht nur deren Schulden, sondern auch das strategische Waffenarsenal und den größten Teil der übrigen militärischen Installationen übernommen hatte. Dazu gehörten auch Einrichtungen außerhalb der Russischen Föderation: Allein in Georgien waren es 1.600 Standorte und Objekte. Die russische Flotte im Schwarzen Meer war und ist bis heute auf der Halbinsel Krim stationiert, die staatsrechtlich zur Ukraine gehört. Noch immer sichern russische Grenztruppen die Grenzen Tadschikistans zu Afghanistan und China. 1992/93 verkündeten Jelzin und Kosyrew, dass die RF sich jetzt sowohl nach Westen als auch nach Osten wenden werde. Und das »nahe Ausland«, also die unabhängig gewordenen Sowjetrepubliken an den russischen Staatsgrenzen, sollten künftig in der sowjetischen Außen- und Sicherheitspolitik Priorität vor einer entschiedenen Hinwendung nach Westen und Integration in westliche Sicherheits- und Bündnisstrukturen haben. Das vorrangige Ziel russländischer Außenpolitik sollte sein, den postsowjetischen Raum zusammen zu halten, indem die Zusammenarbeit Eine Welt m a ch t auf d e m Rü ck z u g? Vo n d er Ud S S R z ur Ru s s is che n F ö d er at i o n 67 GERD BRAITMAIER gen in Bosnien-Herzegovina bombardierte. In der russischen Presse wurden diese Aktionen gegen das serbische »Brudervolk« mit einer Feindseligkeit kommentiert, die an Sowjetzeiten erinnerte. Realpolitische Wende in der russischen Außen- und Sicherheitspolitik 68 Bei regionalen Konflikten wurde die russische Regierung zwar konsultiert, hatte aber auch hier keine effektiven Mitspracherechte. Der dramatische wirtschaftliche Leistungseinbruch und die Erosion der Streitkräfte beschränkten zudem den außenpolitiAbb. 6 Der russische Präsident Boris Jelzin und der NATO-Generalsekretär Javier Solana am schen Aktionsradius erheblich. Am 5.1.1996 löste der 27.5.1997 in Paris bei der Unterzeichnung einer historischen Vereinbarung zischen dem westlidamalige Leiter des Auslandsgeheimdienstes, Evgechen Verteidigungsbündnis und Russland. nij Primakov, den westlich orientierten Andrej Kosy© picture alliance, dpa rev an der Spitze des russischen Außenministeriums ab. Primakov präsentierte sich nun als »Realpolitiim Rahmen der »Gemeinschaft Unabhängiger Staaten« (GUS) geker« und erklärte, dass die RF »als Großmacht« in alle Richtungen fördert würde. In der Folgezeit wurden Verträge über die Bildung agieren müsse und die russische Außenpolitik nach den Prinzieiner Wirtschafts- und Zoll-Union, über Vertiefung der Integrapien des Machtgleichgewichts auszurichten sei. Die USA seien tion und einen gemeinsamen Wirtschaftsraum abgeschlossen. zwar gegenwärtig der mächtigste Staat, aber beileibe nicht das Die »Gemeinschaft Unabhängiger Staaten« war und blieb eine Zentrum der internationalen Politik. Kennzeichen weltpolitischer Organisation zur geordneten Auflösung der Sowjetunion. Sie war Entwicklung sei der Übergang von der bipolaren Konfrontation gekennzeichnet durch unklare Mitgliedschaftsverhältnisse, manwährend des Kalten Krieges zu einer multipolaren Welt. Im Rahgelndes Engagement und geringe Bereitschaft, die im Rahmen men dieser »Primakov-Doktrin« verfolgte die russische Außenpoder GUS verhandelten Verträge und Normen auch umzusetzen. litik eine »strategische Partnerschaft« mit der Volksrepublik Das Ergebnis war ein um die RF zentriertes Netzwerk bilateraler China und versuchte die Union mit Belarus weiter zu entwickeln. Beziehungen und Substrukturen mit einzelnen Mitgliedstaaten, Darüber hinaus wurden neue Abkommen über wirtschaftliche Zudas die Geschlossenheit der GUS unterminierte. Das Scheitern sammenschlüsse mit Mitgliedsstaaten der GUS vorangetrieben. der russischen Politik war allerdings auch Ergebnis eines hinhalDort, wo die russische Regierung Entwicklungen, die ihren Intertenden Widerstandes der postsowjetischen Republiken, die – abessen zuwider liefen, nicht verhindern konnte, bemühte sie sich gesehen vom Sonderfall Belarusslands – ihre neu gewonnene Unnun um Kompensationen. Die NATO handelte mit der russischen abhängigkeit nicht aufgeben wollten. So gründeten Georgien, Regierung ein separates Abkommen über Zusammenarbeit aus, die Ukraine, Moldawien und Aserbaidschan, zeitweilig ergänzt um die RF davon abzuhalten, den Prozess der Osterweiterung mit durch Usbekistan, die GU(U)AM, um sich besser gegen die hegeallen Mitteln zu obstruieren. Am 27.5.1997 wurde die »Grundakte monialen Bestrebungen Moskaus wehren zu können. über gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit« in Paris unterzeichnet. Sie gewährte der RF einen prestigeträchtigen Sonderstatus. Zudem wurde die RF in den Kreis der GDie russische Westpolitik unter Jelzin 7-Staaten aufgenommen, in den »Pariser Club« und erhielt die Zusicherung, dass die USA und die EU einen Beitritt zur WTO und Ungeachtet des versprochenen Paradigmenwechsels bemühte zur OECD unterstützen würden. Die Hoffnung, dass die russische sich die russische Regierung weiterhin um die Aufnahme in euroUnterschrift unter die »Grundakte« zugleich eine Akzeptanz der atlantischen Organisationen. Nur machte sie eine Mitgliedschaft Osterweiterung beinhaltete, trog jedoch. Weder die russische Restärker als zuvor von eigenen Interessen abhängig. 1992 wurde gierung noch die veröffentlichte und öffentliche Meinung in der die RF Mitglied des »Nordatlantischen Kooperationsrates (NorthRF waren dazu bereit. Als die NATO im Zusammenhang mit der Atlantic Cooperation Council/NACC). Dieser war 1991 als Gre»Kosovokrise« 1999 gegen russischen Einspruch und ohne Rückmium für die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen sprache im Russland-NATO-Rat ihren 60-tägigen Bombenkrieg den damals 16 NATO-Mitgliedsstaaten, europäischen Nichtmitgegen Serbien, nach Ansicht vieler Russen das serbische »Brudergliedern und der EU gegründet worden. 1994 begann die NATO volk«, eröffnete, meinten russische Publizisten zu wissen, worauf mit dem Programm »Partnerschaft für den Frieden« (Partnership die NATO-Politik in Wirklichkeit hinauslief: Die NATO beabsichfor Peace/PfP). Die russische Regierung betrachtete das PfP-Protigte offenbar, Russland von der Mitsprache in allen relevanten gramm misstrauisch, verhandelte jedoch ein Rahmenabkommen. sicherheitspolitischen Angelegenheiten Europas auszugrenzen. Der Beitritt zum PfP-Programm erfolgte erst, als der Plan gescheitert war, die OSZE zum Hauptpfeiler der europäischen SiRussische Machtpolitik unter Putin cherheitspolitik zu machen. Die Akzeptanz des PfP-Programms beinhaltete jedoch nicht, dass die russische Regierung eine OstWladimir Putin, Jelzins Nachfolger, akzeptierte zunächst den Proerweiterung der NATO akzeptierte. Sie unterzeichnete das Rahzess ökonomischer Globalisierung als objektive Rahmenbedinmenabkommen vor allem in der Hoffnung, eine Osterweiterung gung für die weitere wirtschaftliche und politische Entwicklung verhindern zu können. Als der Rat der Außenminister der NATO im der RF. Er interpretierte ihn also nicht mehr, wie noch in den Dezember 1994 eine Osterweiterung dennoch in Erwägung zog, Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts, in der Tradition marxisverließ die russische Delegation im Protest die Unterzeichnungstisch-leninistischen Denkens als machtpolitischen Ausdruck einer zeremonie des PfP-Programms. Staatspräsident Boris Jelzin westlichen, d. h. vor allem amerikanischen Strategie der Sichewarnte, dass die Osterweiterung der NATO zu einem »Kalten Frierung weltweiter Hegemonie und Einschränkung russischer Großden« in Europa führe. Einen weiteren Tiefpunkt der russischen machtansprüche. Durch diesen Perspektivwechsel veränderte Beziehungen zum Westen nach den Auseinandersetzungen über sich auch das Verständnis dessen, was eine Großmacht ausden Tschetschenienkrieg kam 1995, als die NATO erstmals in den machte: Nicht militärische Kapazitäten und politische Geschlosjugoslawischen Bürgerkrieg intervenierte und serbische Stellun- Eine Welt m a ch t auf d e m Rü ck z u g? Vo n d er Ud S S R z ur Ru s s is che n F ö d er at i o n D&E Heft 58 · 2009 senheit, sondern ökonomische Potenz sei entscheidend; Russland, so forderte Putin, müsse sich ökonomisch modernisieren, um seinen Großmachtanspruch einlösen zu können. Die RF müsse eine weltweit präsente Wirtschaftsmacht werden und dazu sei die Zusammenarbeit mit dem Westen, die Integration in die Strukturen und Institutionen der Weltwirtschaft sowie eigene Einflussnahme auf globale ökonomische Prozesse erforderlich. Dieser Zusammenhang von Modernisierung, Weltmarktintegration, wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem führenden westlichen Staaten und Großmachtstatus wurde z. B. in der »Konzeption nationaler Sicherheit« Putins vom 10.1.2000 und in der »Strategie nationaler Sicherheit« seines Nachfolgers Dimitri Medwedew vom 12.5.2009 festgeschrieben. Gleichzeitig nutzte er die Tschetschenien- und Kosovokriege in den Wahlkampagnen 1999/2000ff – oder auch den Georgienkrieg 2008 – geschickt, um sich selbst als Gewährsmann eines »patriotischen Konsens« zu präsentieren. Auch dies sicherte ihm eine hohe Zustimmung in Meinungsumfragen, begünstigt allerdings durch die Kontrolle zentraler Medien, mit deren Hilfe er nicht nur innen-, sondern auch außenpolitischen Dissens kontrollierte und notfalls marginalisierte. Als Putin nach den terroristischen Anschlägen des 11.9.2001 auf das World Trade Center und das Pentagon zu den ersten gehörte, der den Amerikanern sein Mitgefühl aussprach und Bush anbot, gemeinsam gegen den »internationalen Terrorismus« zu kämpfen, schien zunächst eine neue Epoche der russisch-amerikanischen Beziehungen zu beginnen. Am 24.9.2001 erklärte Putin in einer Fernsehansprache die solidarische russische Haltung zur »geplanten antiterroristischen Operation in Afghanistan«. Er kündigte humanitäre Hilfen und Zusammenarbeit der Nachrichtendienste an. Verteidigungsminister Sergej Ivanov nahm am 25.9.2001 an einem Treffen der Verteidigungsminister der NATO in Brüssel teil und erklärte, dass die RF und die zentralasiatischen Staaten den amerikanischen Streitkräften Luftkorridore und Stützpunkte für den Kampf gegen die »Terroristen« in Afghanistan zur Verfügung stellen. Man werde allerdings nicht mit eigenen Truppen teilnehmen. Ein weiteres Ergebnis des scheinbaren russisch-amerikanischen »Rapprochement« war die »Römische Erklärung« vom Mai 2002, mit welcher der »NATO-Russland-Rat« (NRC) geschaffen wurde. Die NATO erkannte hier der RF den erwünschten Sonderstatus zu und auf deklaratorischer Ebene ihren Großmachtanspruch an. Die Vertragsparteien wollten als »gleichberechtigte Partner« miteinander in den Dialog treten, heißt es, sich konsultieren und zusammen arbeiten. Da Entscheidungen nur im Konsens getroffen werden können, sah die russische Regierung ihre Entscheidungs- und Handlungsfreiheit gewahrt. Die Kehrseite der Medaille war jedoch, dass die RF keine materielle Mitwirkung- und Entscheidungsrechte auf die NATO hatte und aus russischer Sicht die Sicherheitslücke in Europa nicht geschlossen wurde. Vor dem Hintergrund frustrierender Erfahrungen mit dem hegemonialen Unilateralismus der USA, z. B. im Irak-Krieg, mit den geplanten Raketenabschussbasen in Polen und Tschechien, den NATO-Erweiterungsplänen bis zu zur Ukraine und Georgien, bekam der Klang des »Freiheitspathos« der US-amerikanischen Regierung in der zweiten Amtszeit von Bush in Moskau jedoch zunehmend eine bedrohliche Dimension: Die USA erschienen wieder als überlegene Macht, die durch ideologische Motive und eben nicht durch reale Interessen getrieben wurde. Das Verhalten der amerikanischen Regierung unter George W. Bush jun. mobilisierte in Moskau Erinnerungen an den Paternalismus des Westens während der Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts, die zu überwinden Wladimir Putin einst angetreten war und zwar durch die Restauration der russischen Staatlichkeit (gosudarstvennost’) im Innern und ihre machtpolitische Projektion (derzavennost’) nach außen. Ob sich unter den neuen Präsidenten Obama in den USA und Medwedjew in Russland eine neue Perspektive ankündigen kann, bleibt abzuwarten. D&E Heft 58 · 2009 Abb. 7 Am 10.2.2007 kritisiert der russische Präsident Wladimir Putin auf der Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik die NATO-Osterweiterungspolitik sowie die Militäreinsätze der USA © picture alliance, dpa Literaturhinweise Allison, Roy et. al. (2008): Putin’s Russia and the enlarged Europe. London (Chatham House) Mangott, Gerhard, u. a. (2005): Russlands Rückkehr. Außenpolitik unter Putin. Wiener Schriften zur internationalen Politik, Band 7. Baden-Baden (Nomos-Verlagsgesellschaft) Wipperführt, Christian (2007): Russland und seine GUS-Nachbarn. Hintergründe, aktuelle Entwicklungen und Konflikte in einer ressourcenreichen Region. Stuttgart (ibidem-Verlag) Internethinweise www.laender-analysen.de/ (Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen/Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e. V./Deutsches Polen-Institut Darmstadt) www.swp-berlin.org/ (Homepage der Stiftung Wissenschaft und Politik mit umfangreichen Dossiers zu einzelnen Ländern und weltpolitischen Themen) http://www.kremlin.ru/ (Homepage der russischen Präsidenten; es gibt hier auch Dokumente in englischer und deutscher Sprache) www.mid.ru/ (Homepage des russischen Außenministeriums; es gibt hier auch Dokumente in englischer und deutscher Sprache) Eine Welt m a ch t auf d e m Rü ck z u g? Vo n d er Ud S S R z ur Ru s s is che n F ö d er at i o n 69 GERD BRAITMAIER Materialien M 1 Nationale Interessen Russlands – im Jahre 2000 »Die nationalen Interessen Russlands im internationalen Bereich bestehen in der Gewährleistung der Souveränität, in der Festigung von Positionen Russlands als einer Großmacht, als eines der einflussreichen Zentren der multipolaren Welt, in der Entwicklung der gleichberechtigten und gegenseitig vorteilhaften Beziehungen zu allen Ländern und integrativen Zusammenschlüssen, vor allem zu den Teilnehmern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) und traditionellen Partnern Russlands, in der allgemeinen Wahrung der Menschenrechte und Freiheiten und in der Unzulässigkeit, doppelte Standards in diesem Bereich anzuwenden. […] Die nationalen Interessen Russlands im militärischen Bereich bestehen im Schutz der Unabhängigkeit, Souveränität, der staatlichen und territorialen Integrität, in der Vorbeugung einer bewaffneten Aggression gegen Russland und dessen Verbündete, in der Gewährleistung von Verhältnissen zur friedlichen, demokratischen Entwicklung des Staates. […] Die nationalen Interessen Russlands im Bereich der Grenzen bestehen in der Schaffung der politischen, rechtlichen, organisatorischen und anderen Verhältnissen, welche den zuverlässigen Schutz der Staatsgrenze der Russischen Föderation gewährleisten.« M 4 Russland-NATO- Koncepcija nacional’noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii (Konzeption der nationalen Sicherheit der Russischen Föderation), bestätigt durch den Ukaz des Präsidenten der Russischen Föderation Nr. 24 vom 10.1.2000. 70 Gipfel am 28.5. 2002 in Rom: 19 NATO-Staaten und Russland unterzeichnen Abkommen gegen Terrorbekämpfung und für Abrüstung © picture alliance, dpa ausländischen Militärstützpunkten und großen Truppenkontingenten in unmittelbarer Nähe der russischen Grenzen. – Die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen und deren Trägermittel. M 2 Gefährdung der nationalen Sicherheit der RF – Die Schwächung der Integrationsprozesse in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. »Die Hauptgefahren im internationalen Bereich sind durch fol– Die Entstehung und Eskalation der Konflikte in der Nähe der gende Faktoren verursacht: – Die Bestrebungen einzelner StaaStaatsgrenze der Russischen Föderation und der Außengrenten und zwischenstaatlicher Vereinigungen, die Rolle der bestezen der Teilnehmer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. henden Mechanismen zur Gewährleistung der internationalen Die Ansprüche auf Territorium der Russischen Föderation. Sicherheit abzuwerten, vor allem der UNO und der OSZE. Die Gefährdung der nationalen Sicherheit der Russischen Födera– Die Gefahr der Schwächung des politischen, wirtschaftlichen tion im internationalen Bereich kommt in Versuchen anderer und militärischen Einflusses Russlands in der Welt. -Die FestiStaaten zum Ausdruck, der Festigung Russlands als eines Eingung militär-politischer Blöcke und Bündnisse, vor allem die flusszentrums in der multipolaren Welt entgegen zu wirken, Erweitung der NATO nach Osten. Eventuelles Aufkommen von Russland an der Realisierung nationaler Interessen zu hindern und seine Positionen in Europa, dem Nahen Osten, Transkaukasien, Zentralasien und der asiatisch-pazifi100 17.–20. Juli 2009 führte das Analysezentrum Jurij Levada (Levada-Zentsehr gut/gut schen Region zu schwächen. Eine rum) eine repräsentative Meinungsumfrage unter 1600 Russen in 128 sehr schlecht/schlecht ernsthafte Gefahr für die nationale Wohnorten und 46 Regionen des Landes durch. Die Verteilung der Antschwer zu beantworten 90 Sicherheit der Russischen Föderation worten auf die Fragen dieser Untersuchung führt in Prozentangaben der Gesamtzahl der Befragten zusammen mit den Ergebnissen vorherstellt der Terrorismus dar. Der inter80 gehender Umfragen. Die statistische Abweichung überschreitet nicht nationale Terrorismus entfesselte 3,4 % einen offenen Feldzug zur Destabili70 sierung der Lage in Russland. […] Die Gefährdung der nationalen Sicher60 heit und der Interessen der Russischen Föderation auf dem Gebiet der Staatsgrenze sind durch Folgendes 50 verursacht: Wirtschaftliche, demographische und kulturell-religiöse 40 Expansion der angrenzenden Staaten auf das russische Territorium; Akti30 vierung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität sowie aus20 ländischer Terrororganisationen. 10 0 5/90 11/91 8/92 4/93 3/95 3/97 12/98 4/99 2/00 2/01 3/02 4/03 3/04 3/05 4/05 3/06 3/07 3/08 3/09 5/09 7/09 Koncepcija nacional’noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii (Konzeption der nationalen Sicherheit der Russischen Föderation), bestätigt durch Ukaz des Präsidenten der Russischen Föderation Nr. 24 vom 10.1.2000. M 3 Meinungsumfragen in der Russischen Föderation: Verhältnis zur USA von 1990–2008 Eine Welt m a ch t auf d e m Rü ck z u g? Vo n d er Ud S S R z ur Ru s s is che n F ö d er at i o n D&E Heft 58 · 2009 M 5 Präsident Putin zur NATO » Ich denke, es liegt auf der Hand, dass die Expansion der NATO mit der Modernisierung des Bündnisses selbst oder mit der Gewährleistung der Sicherheit in Europa in keinerlei Zusammenhang steht. Sie stellt im Gegenteil eine ernste Provokation dar, die das Maß des gegenseitigen Vertrauens mindert. Wir haben das Recht zu fragen, gegen wen diese Expansion sich richtet. Und was ist aus den Zusicherungen geworden, die unsere westlichen Partner uns nach der Auflösung des Warschauer Paktes gaben? Wo sind diese Erklärungen heute? Niemand erinnert sich mehr daran. Aber ich erlaube mir […] ins Gedächtnis zu rufen, was seinerzeit erklärt wurde. Ich möchte aus der Rede von NATO-Generalsekretär [Manfred] Wörner am 17. Mai 1990 in Brüssel zitieren. Er sagte damals: »Die Tatsache, dass wir bereit sind, keine NATOTruppen außerhalb des Territoriums der Bundesrepublik zu stationieren, gibt der Sowjetunion feste Sicherheitsgarantien.« Was ist aus diesen Garantien geworden?« Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, auf der Konferenz für Sicherheitspolitik in München am 10.2.2007. M8 M 6 Präsident Medwedew zum NATO-Russland-Rat » Russland […] geht […] von der Wichtigkeit der stabilen Entwicklung des Zusammenwirkens im Format des Russland-Nato-Rates aus, um die Berechenbarkeit und Stabilität in der Euroatlantischen Region, maximale Nutzung des politischen Dialogs und der praktischen Zusammenarbeit bei der Lösung von Fragen zu sichern, die gemeinsame Bedrohungen betreffen: Terrorismus, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, regionale Krisen, Drogenhandel, natürliche und anthropogene Katastrophen. In den Beziehungen zur NATO will Russland von der Bereitschaft der Allianz zur gleichberechtigten Partnerschaft ausgehen, von der strikten Beachtung von Prinzipien und Normen des Völkerrechts, von der Erfüllung der im Rahmen des Russland-NATO-Rates übernommenen Verpflichtung aller Mitglieder, ihre Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit der Russischen Föderation zu gewährleisten sowie sich militärisch zurück zu halten. Russland lehnt die NATO-Erweiterung ab, unter anderem auch die Pläne, die Ukraine und Georgien in die NATO aufzunehmen sowie überhaupt die militärische Infrastruktur der NATO zu den russischen Grenzen anzunähern. Das verletzt das Prinzip der gleichen Sicherheit, führt zu neuen Trennlinien in Europa und widerspricht der Aufgabe, die Effizienz der gemeinsamen Arbeit bei der Suche nach Antworten auf reale Herausforderungen der Gegenwart zu erhöhen. Koncepcija vnešnej politiki Rossijskoj Federacii (Konzeption der Außenpolitik der Russischen Föderation), bestätigt durch den Ukaz des Präsidenten der Russischen Föderation D. A. Medwedew, 12.7.2008 M 7 Präsident Medwedew zur NATO » Der bestimmende Faktor in Bezug auf die Nordatlantische Vertragsorganisation besteht in der für Russland unannehmbaren Pläne, die militärische Infrastruktur der Allianz an seine Grenzen vorzuverlegen und im Versuch, sich eine globale Rolle zu geben, die im Gegensatz zu den Normen des Völkerrechts steht. Russland ist bereit, die Beziehungen mit der Nordatlantischen Vertragsorganisation auf der Grundlage der Gleichberechtigung und im Interesse der Stärkung der allgemeinen Sicherheit in der nordatlantischen Region zu entwickeln. Ihre Tiefe und ihr Gehalt werden von der Bereitschaft der Allianz bestimmt, bei der Verwirklichung ihrer militär-politischen Pläne den gerechtfertigten Interessen Russlands Rechnung zu tragen, die Normen des Völkerrechts zu respektieren, aber auch von der humanitären Rich- D&E Heft 58 · 2009 Russische Karikatur zu Putins Verhältnis zu den neuen NATO – Mitgliedstaaten bzw. Kandidaten: Von links oben »Prag«, »Warschau«, »Kiew«, »Bukarest« (7.4.2008) © RIA NOVOSTI, Moskau, Russian News&Information Agency, www.visualrian.com tung bei ihrer weiteren Transformation und Suche nach neuen Aufgaben und Funktionen. Strategija nacional’noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii do 2020 goda (Strategie der nationalen Sicherheit der Russischen Föderation bis zum Jahr 2020), bestätigt durch den Ukaz des Präsidenten der Russischen Föderation Nr. 537 vom 12.5.2009. M 9 Geostrategische und globale Perspektiven » Es gibt eine Reihe von Fragen, bei denen sich russische, europäische und amerikanische Interessen ähneln oder decken. Sie betreffen Afghanistan, Pakistan, Iran, die Eindämmung von Atomwaffen, den Kampf gegen den Terrorismus und die Piraterie usw. Eine wirksame globale Führung erfordert eine neue Lesart der problematischen europäisch-atlantischen Sicherheit nicht nur in Washington und Brüssel, sondern auch in Moskau. Die Alternative – der Versuch, ein gewisses Gegengewicht zu Amerika und Europa auf der Basis der BRIC-Staaten (= Brasilien, Russland, Indien und China) zu schaffen – ist illusorisch. So bleibt zu hoffen, dass die russische Führung die nüchterne Reaktion Pekings auf die Ereignisse im Kaukasus richtig einschätzt: China wird ausschließlich im eigenen Interesse und im Rahmen einer langfristigen Strategie für den Aufstieg der Volksrepublik China handeln. Die besonderen Beziehungen zwischen dem Gläubiger China und dem Schuldner USA ähneln der indisch-amerikanischen Allianz und der friedlichen Beziehung zwischen dem südamerikanischen Giganten und dem Koloss im Norden des Kontinents. Selbst wenn Russland das Ziel verfolgte, Beziehungen zu jenem Teil der Welt aufzubauen, müsste es sich von der fixen Idee des Kampfes gegen den amerikanischen Imperialismus verabschieden und den Antiamerikanismus in der offiziellen Propaganda eindämmen, der Russland zum »weißen Raben« auch bei den BRIK-Staaten macht.« Trenin, Dmitri. Neprakticnyj pragmatizm (Unpraktischer Pragmatismus). Pro et Contra, Sept.-Dez. 2008, S. 31. Eine Welt m a ch t auf d e m Rü ck z u g? Vo n d er Ud S S R z ur Ru s s is che n F ö d er at i o n 71 III. MAUERÖFFNUNG IN EUROPA 6. Die NATO – ein Relikt des Kalten Kriegs? FLORIAN JORDAN Z wanzig Jahre nach dem Fall der Mauer und fast zwanzig Jahre nach Auflösung des Warschauer Paktes und der Sowjetunion feiert die Nato ihr 60-jähriges Bestehen und sieht sich mit vielfältigen neuen Herausforderungen konfrontiert. Sechs Jahrzehnte nachdem in Washington das transatlantische strategische Bündnis zwischen dem nordamerikanischen Kontinent (USA und Kanada) und Westeuropa begründet worden war, befindet sich die Nato in einem entscheidenden Transformationsprozess. Die internationale Neuausrichtung der Nato nach 1990 und die fortschreitende Integration ehemaliger Warschauer-Pakt-Staaten, wie beispielsweise Polens, in die Organisationsstrukturen der Nato waren eine entscheidende Aufgabe der letzten Dekade. Einst als kollektives Selbstverteidigungsbündnis begrenzt auf den geographischen Raum der Bündnismitglieder mit Schwerpunkt Mitteleuropa gegründet, engagiert sich die Nato heute unter anderem in Afghanistan und am Horn von Afrika, um dort, wie der amerikanische Vizepräsident Joe Biden 2009 in München formulierte, »neuen Realitäten effektiv begegnen zu können«. Das Ende des Kalten Krieges 72 Mit der als »Wende« bezeichneten radikalen Veränderung der politischen Landschaft in Osteuropa und dem dadurch ausgelösten Zerfall des Warschauer Paktes und der Sowjetunion ging die nach dem zweiten Weltkrieg entstandene und als »Kalter Krieg« beschriebenen Ost-West-Konfrontation zu Ende. Am 4. April 1949 war die Nato als Antwort auf sowjetische Expansionsbestrebungen in Osteuropa und der Berlin-Blockade auf Basis des in Artikel 51 der UN-Charta garantierten »Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung« gegründet worden (| M 3 |). Die Bundesrepublik Deutschland trat 1955 der Nato bei. Die Allianz ist ein Zusammenschluss souveräner Staaten, die vereinbart haben, entscheidende Ziele ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik gemeinsam zu verfolgen. Das sind in erster Linie die Gewährleistung von Freiheit und Sicherheit aller Mitgliedstaaten mit politischen und militärischen Mitteln sowie die Mitwirkung an einer gerechten und dauerhaften Friedensordnung im euroatlantischen Raum und die Sicherung des Wohlergehens seiner Bürgerinnen und Bürger. Die Mitgliedstaaten verfolgen als gemeinsames Interesse eine angemessene militärische Verteidigung zur Abschreckung und die Abwehr von Aggressionen gegen sie. Im Sinne der UN-Charta sollen internationale Streitfälle friedlich geregelt und internationale Beziehungen ohne Gewaltandrohung oder ihre Anwendung unterhalten werden (| M 1 |). Kernstück des Nato-Vertrages ist der Beistandsartikel im Falle eines Angriffs, der Artikel 5. Dieser Artikel regelt das Recht auf kollektive Selbstverteidigung, welches zum Tragen kommt, sobald ein oder mehrere Mitglieder angegriffen werden sollten. Kommt es in Folge eines Angriffs zur Erklärung des Artikel, wie nach den Anschlägen des 11. September 2001 geschehen, sehen sich die Mitgliedstaaten zur Beistandsleistung verpflichtet, wobei diese nicht zwingend militärischer Natur sein muss. Angriffe wie Gegenmaßnahmen werden dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mitgeteilt. Diese Maßnahmen sollen eingestellt werden, sobald der Sicherheitsrat die notwendigen Schritte zur Wiederherstellung und Erhaltung von Frieden und Sicherheit unternommen hat (| M 2 |). D ie N AT O – e in R e l ik t d e s K a lt e n K r ie g s ? Abb. 1 »Die neuen Feinde« © Klaus Stuttmann, 3.4.2009 Der Nato-Vertrag ist seit 1949 unverändert gültig und hat im Lauf der Zeit verschiedene strategische Neuausrichtungen erlebt. Bis 1989 handelte es sich dabei meist um reaktive Maßnahmen, welche auf die Politik der Sowjetunion und des Warschauer Pakts antworten sollten. Exemplarisch seien dabei in Schlagworten chronologisch die Schwerpunkte der Nato Strategie verdeutlicht: Bis 1957 galt die Theorie von »Schwert und Schild«, 1957 abgelöst durch die atomar geprägte »massive Vergeltung«. Im Zuge des Prager Frühlings 1968 wurde die »flexible response« eingeführt, welche ihrerseits von der Anfang der Siebzigerjahre verabschiedeten Doktrin der »Entspannung und Verteidigungsfähigkeit« ersetzt wurde. Auch die Nato war also stets ein Spiegelbild ihrer Zeit und somit in den Fünfzigerjahren von einer angespannten krisengeschüttelten Zeit auf eine mögliche Ost-West-Konfrontation eingestellt. Im Lauf der Zeit wechselten die politischen Akteure und mit ihnen zog Anfang der Siebzigerjahre eine Annäherung zwischen Ost und West in den politischen Alltag ein. Abrüstungskonferenzen und die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) bestimmten ein zunehmendes Klima des Dialogs. Trotz allem kam es infolge der sowjetischen Offensivrüstung der späten Siebzigerjahre zu einem Wettrüsten im Rahmen des Nato-Doppelbeschlusses 1979. Verbunden mit der Nachrüstung in Europa erhielt die sowjetische Führung ein Verhandlungsangebot über konkrete Abrüstungen. Mitte der Achtzigerjahre konnte die Sowjetunion ihre Rüstungsinvestitionen nicht mehr finanzieren und musste schließlich konkreten Abrüstungen zustimmen. Der wirtschaftliche Kollaps der Sowjetunion und damit auch des Warschauer Pakts war nun in den Bereich des Möglichen getreten. Trotzdem waren die Ereignisse des Sommers und Herbst 1989 für die meisten überraschend und auch die Nato war auf solche eine fundamentale Veränderung nicht vorbereitet. Die gescheiterte Friedensdividende und die »Partnership for Peace (PfP)« Die Organe der Nato und ihre Mitgliedstaaten waren gezwungen, auf die politischen Umwälzungen der frühen Neunzigerjahre durch eine umfassende neue Beurteilung der Sicherheitslage zu reagieren. Diese Analyse ergab, dass das Bündnis weder über ein D&E Heft 58 · 2009 lagegerechtes Konzept noch über die erforderlichen Strukturen verfügte, um den Risiken und Herausforderungen des letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts und darüber hinaus gerecht zu werden. In der allgemeinen Hochstimmung über das Ende des Kalten Krieges, die in Deutschland aufgrund der Wiedervereinigung besonders ausgeprägt war, entstand die Vorstellung, nunmehr in einer Epoche des allgemeinen Friedens und globaler Stabilität leben zu können. Derlei Vorstellungen erwiesen sich bei genauer Betrachtung aber schnell als Utopie. Es zeigte sich, dass die Welt nicht friedlicher geworden war, sondern zunehmend neue Abb. 2 60 Jahre NATO – Entwicklung der Mitgliedstaaten © dpa, 2009 beziehungsweise bisher durch den Kalten Krieg überlagerte Instabilitäten und Konflikte zu registrieren waren. Die Zahl der bewaffneArmenien, Georgien und die Ukraine). Die Kooperation basiert ten Auseinandersetzungen, insbesondere in Asien und Afrika, auf einem mit den einzelnen Teilnehmer bilateral verhandelten hatte signifikant zugenommen. Auch im näheren Umfeld der individuellen Partnerschaftsprogramm. Jeder Teilnehmerstaat Nato spitzte sich die Situation zu: Ein erster Konflikt in Slowenien bestimmt selbst den Inhalt, das Ausmaß und die Intensität der 1991 bildete den Auftakt für den Krieg in und um das zerfallende Kooperation. Zu den Zielen der »Partnership for Peace« zählen Jugoslawien. die Transparenz nationaler Verteidigungsplanung und HaushaltsZu einer ersten wegweisenden Weichenstellung kam es auf dem verfahren und die Stärkung der Fähigkeit und der Bereitschaft, zu Nato-Gipfel in Rom 1991 durch die Annahme eines neuen strateKrisenmanagementeinsätzen unter UN- oder KSZE/OSZE-Mandat gischen Konzepts, welches zum Ausgangspunkt für eine Generalbeizutragen. überholung der Allianz wurde. Deren Rahmen wurde wiederum Schließlich wurde 1997 noch der »NATO-Russland-Rat« eingerichim Januar 1994 auf dem Gipfel von Brüssel vorgezeichnet: eine intet, der auf Basis einer »Grundakte über gegenseitige Beziehunterne sowie externe Anpassung an die veränderten sicherheitspogen, Zusammenarbeit und Sicherheit« dem sicherheitspolitilitischen Parameter. Die Allianz beschloss einen deutlichen Abbau schen Verhältnis der Allianz zu Russland eine stabile Basis geben ihrer Streitkräfte, vor allem in Europa, und stellte die Wahrung sollte. von Sicherheit und Stabilität in Gesamteuropa in den Mittelpunkt ihrer Politik. Die Osterweiterung der NATO Die Auflösung des Warschauer Pakts und der Zerfall der Sowjetunion führte in Ost- und Südosteuropa zu einem sicherheitspolitiDiese Entwicklung war notwendig, um die nach NATO-Artikel 10 schen Vakuum, in dem traditionelle nationalistische, ethnische mögliche und von den ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten wie und religiöse Konflikte aufbrachen oder weiter aufbrechen konnPolen oder Ungarn gewünschte Aufnahme in die NATO zu verten. Die Furcht vor einem Erstarken des imperialen Anspruchs wirklichen (| M 10 |). Denn insbesondere Russland betrachtete Russlands bewog vor allem die mittelosteuropäischen Staaten, eine Osterweiterung der NATO skeptisch und abwartend. Durch um Aufnahme in die Nato und EU zu ersuchen. Somit fand sich die das Versprechen der NATO, in den potentiellen neuen MitgliedsNATO in den Neunzigerjahren vor allem mit Fragen des Artikel 10 ländern von der Stationierung ausländischer Truppen und von des NATO-Vertrags auseinandergesetzt. Der Artikel 10 behandelt Kernwaffen abzusehen und durch die beständige Einbindung die Möglichkeit, neue Mitgliedstaaten in die Allianz aufzunehmen Russlands im Rahmen des NATO-Russland-Rates, wurde der Erund in die Organisationsstrukturen der NATO zu integrieren. Erste weiterungsoption ein realpolitische Chance gegeben. Grundlagen für eine mögliche Aufnahme früherer WarschauerAnlässlich ihrer Tagung im Juli 1997 in Madrid luden die NATO die Pakt-Staaten im Rahmen der »Londoner Erklärung« vom 6. Juli Länder Polen, Tschechien und Ungarn offiziell zu Beitrittsver1990 durch die offizielle Einladung wechselseitig die bisherige handlungen ein. Nachdem der Ratifizierungsprozess 1999 abgeGegnerschaft zu beenden und den Gewaltverzicht zu erklären: schlossen war, konnten die drei Länder am 12. März 1999, anläss»Wir (die NATO Mitgliedstaaten: Anm. d. Verf.) wissen, dass in dem neuen lich des 50. Jahrestages der Allianz, in das Bündnis aufgenommen Europa die Sicherheit eines jeden Staates untrennbar mit der Sicherheit werden. Die NATO bekannte sich zu dieser Zeit zu einer »Politik seiner Nachbarn verbunden ist. Die NATO muss zu einem Forum werden, der offenen Tür« und sicherte weiteren Staaten die Möglichkeit in dem Europäer, Kanadier und Amerikaner zusammenarbeiten, nicht nur eines Beitritts zu, ohne sie aber schon namentlich zu nennen. zur gemeinsamen Verteidigung, sondern auch beim Aufbau einer neuen Die Aufnahme drei neuen Mitgliedstaaten der NATO im Jahre 1999 Partnerschaft mit allen Ländern Europas. Die atlantische Gemeinschaft war ein Meilenstein in der Geschichte des atlantischen Bündniswendet sich den Ländern Mittel- und Osteuropas zu, die im Kalten Krieg ses, das zum ersten Mal Staaten aufnahm, die zehn Jahre zuvor unsere Gegner waren, und reicht ihnen die Hand zur Freundschaft.« noch dem Warschauer Pakt angehört hatten. Aufnahme fanden 1991 wurde als permanente Struktur zum Zweck wechselseitiger damit die Länder, bei denen der politische und wirtschaftliche sicherheitspolitischer Konsultationen der NATO zunächst ein KoTransformationsprozess am weitesten fortgeschritten war. operationsrat, bestehend aus den ehemaligen Warschauer-PaktIn einer zweiten Runde wurden 2004 und 2009 weitere Mitglieder Staaten und den NATO-Mitgliedern, eingerichtet. Als weitere Insin die NATO integriert. Dabei handelte es sich 2004 im einzelnen titution wurde 1994 das »Partnership for Peace Programm« ins um: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei Leben gerufen. Sein Ziel ist die Vertrauensbildung mit den Länund Slowenien. 2009 kamen noch Albanien und Kroatien als dern Osteuropas durch eine gemeinsame Sicherheitsplanung, jüngste Mitglieder zur NATO. Ein »Membership Action Plan« hatte gemeinsame militärische Übungen sowie die Förderung der dedie neuen Mitglieder auf ihre Teilnahme an der Allianz vorbereimokratischen Kontrolle in den Armeen der Partnerländer. Eingetet. Dazu wurden sie auf die Notwendigkeit der Vorhaltung geeigladen waren alle am KSZE-Prozess beteiligten Staaten (z. B. auch D&E Heft 58 · 2009 D ie N AT O – e in R e l ik t d e s K a lt e n K r ie g s ? 73 FLORIAN JORDAN Abb. 3 Auslandseinsätze der Bundeswehr 74 neter Streitkräfte für NATO-Missionen, deren Standardisierung und Interoperabilität, ausreichende Verteidigungsausgaben sowie die Mitwirkung in den NATO-Gremien verwiesen. Mit den baltischen Staaten wurden zudem erstmals Teilrepubliken der ehemaligen Sowjetunion aufgenommen. Die russische Regierung stand auch deshalb der Osterweiterung der NATO zunehmend kritisch gegenüber. Auch innerhalb des Bündnisse gab und gibt es anhaltende Diskussionen über die Aufnahme osteuropäischer Staaten in die NATO. Auf dem NATO-Gipfel in Bukarest 2008 konnten sich so die Mitgliedstaaten nicht darauf einigen, die insbesondere von den USA unter der Bush-Administration gewünschte Aufnahme von Georgien und der Ukraine sofort einzuleiten. Diesen Ländern bot die Allianz dort nunmehr eine Beitrittsperspektive ohne festen Zeitplan an. Out of area und Operation Althea (Bosnien-Herzegowina) »Heute sehen sich unsere Nationen und die Welt neuen zunehmend globalen Bedrohungen wie dem Terrorismus, der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und ihrer Trägermittel und Angriffen auf Computernetzwerke gegenüber.« Diese »Erklärung zur Sicherheit des Bündnisse« anlässlich des Straßburger Gipfels im April 2009 stellt konzentriert die neuen Herausforderungen für die transatlantische Allianz zu Beginn des 21. Jahrhunderts dar. Mit dem Untergang der Sowjetunion stellte sich die Frage nach der Funktion des Bündnisses in einem gänzlich veränderten politischen System. Die Mitgliedstaaten gerieten unter erheblichen Anpassungsdruck. Sie waren einstimmig der Meinung, dass eine direkte Bedrohung wie zu Zeiten des Kalten Kriegs nicht mehr vorhanden war, dass aber nach wie vor die Existenz des Bündnisses notwendig sei. Die NATO hat in dieser Zeit neben der Osterweiterung und der Europäisierung des transatlantischen Bündnisses sich vor allem als Mandatnehmer der UN bewiesen (| Abb. 3 |). Die veränderte globale Sicherheitsarchitektur wurde zusehends instabiler und die Bipolarität des Kalten Kriegs wich einer neuen Multipolarität regionaler Krisen und Konflikte mit häufig überregionalen Folgen. Ursprünglich rein auf den transatlantischen Raum fokussiert und somit geostrategisch positioniert und mit dem Schutz der Integrität seiner Mitgliedstaaten beauftragt, betrat Anfang D ie N AT O – e in R e l ik t d e s K a lt e n K r ie g s ? der Neunzigerjahre der »out-ofarea«-Terminus die Bühne der Weltpolitik. Galt bis 1990 ein möglicher »out-of-area-Einsatz« als potenzielle Gefahr für den Weltfrieden, zwangen die Balkan-Kriege im ehemaligen Jugoslawien, der Krieg in Ruanda, der Bürgerkrieg in Somalia und der erste Golfkrieg Anfang der Neunzigerjahre zu einer Neubewertung der NATOStrategie. Eine zunehmende Destabilisierungswirkung ganzer Regionen durch »failed states« und die damit einhergehenden Migrationsbewegungen von Flüchtlingen schufen die Notwendigkeit, sowohl aus humanitären wie auch realpolitischen Erwägungen zu handeln und über Einsätze »out-of-area« nachzudenken und diese dann auch durchzuführen. 1991 wurde das Konzept »Out of area« von der Allianz schließlich offiziell verabschiedet. Es sollte das Übergreifen von Krisen auf das Bündnisgebiet verhindern, Konflikte verhüten und durch die Einrichtung © dpa 2009 einer schnellen Eingreiftruppe bessere Möglichkeiten bieten, schnell und flexibel regionale Konflikte einzudämmen und Konfliktparteien zu trennen und an den Verhandlungstisch zurückzuführen. Die NATO erklärte sich nun bereit, friedenserhaltende Maßnahmen auf der Basis der UN oder der OSZE durchzuführen und im Rahmen der UN-Charta Krisen- und Konfliktprävention zu betreiben. Der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien lenkte allein aufgrund der fast 350.000 Flüchtlinge, die insbesondere in Deutschland Zuflucht suchten, die Aufmerksamkeit der NATO auf den westlichen Balkan, sodass es 1992 zu einem ersten Einsatz der NATO zur Kontrolle des UN-Embargos gegen Rest-Jugoslawien kam. Nachdem der Bosnien-Herzegowina-Konflikt mit dem Abkommen von Dayton 1995 beendet werden konnte, übernahm die NATO auf Beschluss des UN-Sicherheitsrates die Führung einer multinationalen »Implementation Force« (IFOR), bestehend aus NATO-Staaten und Partnerstaaten, zur Aufrechterhaltung des Friedens. Im Jahre 2004 wurde die NATO durch die Europäische Union abgelöst, die ihrerseits nun die Verantwortung für den Frieden in Bosnien-Herzegowina trägt. Dies sollte den zunehmenden sicherheitspolitischen Handlungswillen der Mitgliedsländer der EU und ihres militärischen Organs der WEU zum Ausdruck bringen. Vier Faktoren förderten die Absicht der EU, die Führung der IFOR-Nachfolgemission zu übernehmen: Erstens der Abschluss der Dauervereinbarungen von NATO und EU, mit denen die Europäer überhaupt erst in die Lage versetzt wurden, eine militärische Operation dieser Größenordnung in Angriff zu nehmen, zweitens das besondere europäische Interesse an einem Land mit EU-Perspektive, das unter anderem in dem gemeinsamen Vorgehen von NATO und EU auf dem Balkan zum Ausdruck kam, drittens die Lage in Bosnien-Herzegowina selbst, die sich zum Positiven wandelte, sowie viertens das entwickelnde übereinstimmende amerikanisch-europäische Interesse an einer europäischen Nachfolgeoperation in Form der Mission EUFOR Althea. Die NATO-EU-Partnerschaft, die den europäischen Regierungen die Verfügung über die notwendigen Instrumente für größere Krisenmanagementoperationen unter eigener Führung garantiert, wurde im Wesentlichen in der 2002 durch alle NATO-Staaten und der EU verabschiedeten »Deklaration zur Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik« umgesetzt. Bei Anerkennung der unterschiedlichen Natur von EU und NATO soll hier sichergestellt werden, dass sich die Krisenmanagementaktivitäten gegenseitig verstärken. Ob im Krisenfall die NATO oder die EU D&E Heft 58 · 2009 eingreift, ergibt sich aus Konsultationen innerhalb der einzelnen Organisationen wie auch zwischen ihnen. Die NATO-EU-Zusammenarbeit in Bosnien-Herzegowina ist als Mission »EUFOR Althea« eingebettet in ein abgestimmtes Vorgehen auf dem westlichen Balkan. Als Ziel nennt die Vereinbarung die selbsttragende Stabilität der fünf Staaten des westlichen Balkans: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien und Serbien-Montenegro auf der Grundlage demokratischer und effektiver Regierungsstrukturen und einer lebensfähigen Marktwirtschaft. Als Zwischenbilanz lässt sich sagen, dass »EUFOR Althea« seinen Auftrag bisher erfüllen konnte und in Bosnien-Herzegowina ein sicheres Umfeld aufbauen konnte, das als zentrale Voraussetzung für die friedliche weitere Umgestaltung des Staates einer zukünftigen EU-Mitgliedschaft gelten kann. Neben der Mission in Bosnien-Herzegowina kam es schließlich 1999 zum militärischen Einsatz der NATO als »humanitärer Intervention« in Serbien und im Kosovo, letztlich um einen Genozid an der Kosovo-albanischen Bevölkerung zu unterbinden und auch in dieser Region des ehemaligen Jugoslawien sichere und stabile Verhältnisse zu garantieren. Die völkerrechtliche Legitimation dieses Schrittes wurde jedoch nicht nur von Russland, sondern auch von innenpolitischen Kritikern angezweifelt. Ausgestattet mit einem Mandat der UN wurde jedoch nach dem Waffengang und nach dem Vorbild von IFOR eine multinationale »Kosovo Force« (KFOR) aufgebaut und im Kosovo stationiert. Diese soll bis zur endgültigen Klärung des zukünftigen Status des Kosovo die Friedenssicherung in der Region garantieren. Nach der Unabhängigkeitserklärung und Anerkennung des Kosovo durch zahlreiche Staaten wurde das Mandat von KFOR durch die UN-Sicherheitsrats-Resolution 1244 weiter verlängert, um die noch fragile Stabilität zu schützen. Abb. 4 »Um sieben Mitglieder stärker« © Horst Haitzinger, 22.11.2002 gigen Anwendungen sowohl militärischer wie auch ziviler Krisenund Wiederaufbauinstrumente fort (| M 7 |). Zahlreiche Missionen führten und führen die NATO neben den dargestellten Einsätzen auf dem Balkan zu Krisenoperationen in »failing und failed states« wie beispielsweise am Horn von Afrika im Rahmen der Pirateriebekämpfung und dem Einsatz in Afghanistan im Rahmen der »International Security Assistance Force« (ISAF). Dass die NATO auch jenseits des Atlantiks für die neue USAdministration unter Präsident Obama eine entscheidende Rolle in der globalen Sicherheitsarchitektur und als Stabilitätsfaktor für die transatlantischen Beziehungen spielt, brachte der amerikanische Vizepräsident Joe Biden im Frühjahr 2009 auf der Münchner Sicherheitskonferenz zum Ausdruck, als er ausdrücklich eine Erneuerung der Partnerschaft Europas und Amerikas auf Basis der NATO anbot (| M 6 |). Die Zukunft der NATO Auch im sechzigsten Jahr ihres Bestehens gilt weiterhin das Diktum des ehemaligen NATO-Generalsekräters Manfred Wörner: »The slogan ›out-of-area or out of business‹ is out of date. We are out-ofarea and we are very much in business.« Die neue Multipolarität der Welt nach 1990 und die zahlreichen ungelösten ethnisch-religiösen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Disparitäten führten zu den ersten Schritten eines globalen-vernetzten Sicherheitsdenkens innerhalb der NATO. Angesichts der Anschläge vom 11. September 2001 und der sich anschließenden erstmaligen Erklärung des Artikel 5 der NATO-Charta beschleunigte sich das Tempo internationaler Krisenintervention durch die NATO. In der Auseinandersetzung mit den Gefahren des internationalen Terrorismus erkannten viele Staaten und Regierungen die dringende Handlungsnotwendigkeit im Rahmen des Krisenmanagements mit möglichst präventivem Charakter. Die NATO umfasst heute 28 Mitgliedstaaten in einem transatlantischen Bündnis, das sich vom Verteidigungsbündnis zu einem Instrument globaler Stabilitätsprojektion entwickelt hat und nahezu global agiert. Es gelang der NATO erfolgreich, zahlreiche Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts zu integrieren und die Partnerschaft der Allianz mit Russland zu vertiefen. Das transatlantische Bündnis hat sich, beispielsweise in Bosnien, als einzige wirksames und weltweit agierendes Instrument des militärischen Konfliktmanagement erwiesen. In wieweit die EU weiterhin einen eigenständigen Beitrag – auch außerhalb Europas wie z. B. zur Absicherung der Wahlen im Kongo – leisten wird, bleibt abzuwarten. Hier zeigen sich vor allem innereuropäische Auseinandersetzungen über eine gemeinsame sicherheitspolitische Strategie und ihre möglichen Umsetzung in potentiellen Krisenregionen. Ein ähnlicher Diskurs wird zunehmend auch unter den NATO-Staaten über die richtige Wahl der Einsatzmittel und einer möglichen geographischen Fokussierung geführt. Des Weiteren setzt sich eine mit dem Einsatz in Afghanistan begonnene Diskussion über den vernetzten Ansatz, also der gleichran- D&E Heft 58 · 2009 Literaturhinweise Gersdorff, Gero von (2009): Die Gründung der Nordatlantischen Allianz. München. C. H. Beck. Gruber, Stefan (2008): Die Lehre vom gerechten Krieg: eine Einführung am Beispiel der NATO-Intervention im Kosovo/Stefan Gruber. Marburg. Hauser, Gunther (2008): Die Nato – Transformation, Aufgaben, Ziele. Frankfurt am Main; E. S. Mittler. Overhaus, Marco (2009): Die deutsche NATO-Politik: vom Ende des Kalten Krieges bis zum Kampf gegen den Terrorismus. Baden-Baden: Nomos. Schulz, Peter (2008): Der Kosovokonflikt unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Rolle. Hamburg. Nomos. Varwick, Johannes (Hrsg.) (2005): Die Beziehungen zwischen NATO und EU. Partnerschaft, Konkurrenz, Rivalität? Leverkusen. Opladen. Varwick, Johannes (2008): Die NATO: vom Verteidigungsbündnis zur Weltpolizei? München. Beck. Internethinweise www.nato.int (offizieller Webauftritt der NATO) www.unosek.org (UNO-Büro zum Kosovo) www.nato.diplo.de/Vertretung/nato/de/Startseite.html (Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der NATO) www.securityconference.de (Münchner Sicherheitskonferenz) www.politische-bildung.de/nato_gipfel.html (Internetportal der Bundes-zentrale und der Landeszentralen für politische Bildung) www.bundesregierung.de/Webs/Breg/nato/DE/Startseite/Startseite.html (Informationen der Bundesregierung zur NATO) D ie N AT O – e in R e l ik t d e s K a lt e n K r ie g s ? 75 FLORIAN JORDAN MATERIALIEN M 1 Präambel des Nordatlantikvertrages (1949) »Die Parteien dieses Vertrages bekräftigen erneut ihren Glauben an die Ziele und Grundsätze der Satzung der Vereinten Nationen und ihren Wunsch, mit allen Völkern und Regierungen in Frieden zu leben. Sie sind entschossen, die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit der Person und der Herrschaft des Rechts beruhen, zu gewährleisten. Sie sind bestrebt, die innere Festigkeit und das Wohlergehen im nord-atlantischen Gebiet zu fördern.« www.staatsvertraege.de/natov49.htm M 5 Proteste auf dem Sonderparteitag der Grünen zum Afghanistan-Einsatz M 2 Artikel 5 des Nordatlantikvertrages 76 »Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird; sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten Rechts der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten. Von jedem bewaffneten Angriff und allen daraufhin getroffenen Gegenmaßnahmen ist unverzüglich dem UN-Sicherheitsrat Mitteilung zu machen. Die Maßnahmen sind einzustellen, sobald der Sicherheitsrat diejenigen Schritte unternommen hat, die notwendig sind, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit wiederherzustellen und zu erhalten.« www.staatsvertraege.de/natov49.htm M 3 Charta der Vereinigten Nationen, Artikel 51 »Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der UN-Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält.« www.unric.org/html/german/pdf/charta.pdf M 4 Artikel 10 des Nordatlantikvertrages »Die Parteien können durch einstimmigen Beschluss jeden anderen europäischen Staat, der in der Lage ist, die Grundsätze dieses Vertrags zu fördern und zur Sicherheit des nordatlantischen Gebiets beizutragen, zum Beitritt einladen. » www.staatsvertraege.de/natov49.htm D ie N AT O – e in R e l ik t d e s K a lt e n K r ie g s ? der Bundeswehr im Jahre 2007 © picture alliance, dpa 2007 M 6 Ansprache Vizepräsident Joe Biden auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2009 Chancellor Merkel, Ambassador Ischinger, colleagues: (…) Today, I am especially honored to represent a new American administration and the oldest American tradition: the peaceful, democratic transfer of power. (…) I come to Europe on behalf of a new administration determined to set a new tone in Washington, and in America’s relations around the world. That new tone – rooted in strong partnerships to meet common challenges – is not a luxury. It is a necessity. While every new beginning is a moment of hope, this moment for America and the countries represented in this room – is fraught with concern and peril. In this moment, our obligation to our fellow citizens is to put aside the petty and the political to reject zero sum mentalities and rigid ideologies, to listen to and learn from one another and to work together for our common prosperity and security. That is what this moment demands. That is what the United States is determined to do. For 45 years, this conference has brought together Americans and Europeans – and, in recent years, leaders from beyond the TransAtlantic community – to think through matters of physical security. This year, more than ever before, we know that our physical security and our economic security are indivisible. We are all confronting a serious threat to our economic security that could spread instability and erode the progress we’ve made in improving the lives of our citizens. In the United States, we are taking aggressive action to stabilize our financial system, jump start our economy and lay a foundation for growth. (…) Even as we grapple with an economic crisis, we must contend with a war in Afghanistan now in its eighth year, and a war in Iraq well into its sixth year; And we must recognize new forces shaping this young century: The spread of mass destruction weapons and dangerous diseases; A growing gap between rich and poor; Ethnic animosities and failed states; A rapidly warming planet and uncertain supplies of energy, food, water; The challenge to freedom and security from radical fundamentalism (…) Two months from now, the members of the North Atlantic Treaty Organization will gather for our Alliance’s 60th anniversary. This Alliance has been the cornerstone of our common security since the end of World War II. It has anchored the United States in Europe and helped forge a Europe whole and free. Together, we made a pact to safeguard the freedom of our peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty and the rule of law. We made a commitment to cooperate, to consult – and to act with resolve when the principles we defend are challenged. There is much to celebrate. But we must do more. We must recommit to our shared security and renew NATO, so that its success in the 20th century is matched in the 21st. NATO’s core purpose remains the collective defense of its mem- D&E Heft 58 · 2009 bers. But faced with new threats, we need a new resolve to meet them, and the capabilities to succeed. Our Alliance must be better equipped to help stop the spread of the world’s most dangerous weapons, to tackle terrorism and cyber-security, to expand its writ to energy security and to act in and out of area effectively. We will continue to develop missile defenses to counter a growing Iranian capability, provided the technology is proven to work and cost effective. We will do so in consultation with our NATO allies and Russia. As we embark on this renewal project, the United States, like other Allies, would warmly welcome a decision by France to fully participate in NATO structures. (…) We also support the further strengthening of European defense, an increased role for the European Union in preserving peace and security, a fundamentally stronger NATO-EU partnership and deeper cooperation with countries outside the Alliance who share our common goals and principles. The United States rejects the notion that NATO’s gain is Russia’s loss, or that Russia’s strength is NATO’s weakness. The last few years have seen a dangerous drift in relations between Russia and the members of our Alliance. It is time to press the reset button and to revisit the many areas where we can and should work together. Our Russian colleagues long ago warned about the rising threat from the Taliban and Al Qaeda in Afghanistan. Today, NATO and Russia can and should cooperate to defeat this common enemy. We can and should cooperate to secure loose nuclear weapons and materials and prevent their spread, to renew the verification procedures in the START-treaty and then go beyond existing treaties to negotiate deeper cuts in our arsenals. The United States and Russia have a special obligation to lead the international effort to reduce the number of nuclear weapons in the world. We will not agree with Russia on everything. For example, the United States will not recognize Abkhazia and South Ossetia as independent states. We will not recognize a sphere of influence. It will remain our view that sovereign states have the right to make their own decisions and choose their own alliances. But the United States and Russia can disagree and still work together where our interests coincide. www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?menu_2009=&menu_ konferenzen=&sprache=de&id=238& M 7 Die Nato sucht eine neue Strategie So selbstverständlich mittlerweile der Nato-Einsatz in Afghanistan geworden ist, so schwer fällt es, den Sinn des Bündnisses insgesamt im 21. Jahrhundert zu definieren. 28 Nato-Mitglieder haben 28 Vorstellungen, die von der Rolle des Weltpolizisten bis zur Konzentration auf die Verteidigung der Mitgliedstaaten reichen. Es klingt paradox: In der Praxis funktioniert die Nato, sie kann auf Krisen reagieren. Aber manchmal fangen die Probleme mit den Worten an – wenn man definieren soll, warum man tut, was man tut (…). Zentraler ist aber die Frage, welche Aufgaben die Nato künftig übernehmen soll. Vor allem die USA drängen auf eine größere weltweite Rolle. Das ist wenig überraschend. Denn zum einen hätte die ökonomisch angeschlagene Supermacht gern einen Partner, der ihren Einfluss absichert. Sehr schmerzlich haben die USA zudem gelernt, wie kontraproduktiv es sein kann, allein zu handeln – selbst wenn sie über genügend militärische Mittel verfügen. Zudem ist die Nato nach wie vor die einzige funktionsfähige Organisation, die die USA mit ihrem wichtigsten Verbündeten, Europa, verbindet. Also wird das Bündnis in Washington und im Nato-Hauptquartier als Allzweckwaffe gehandelt, um künftig auch ein breites Themenspektrum wie Klimawandel, Energiesicherheit, Migration oder »Cyberwar«, also Angriffe auf elektronische Netzwerke, abzudecken. Dagegen steht das völlig andere Interesse der östlichen NatoStaaten, die das Bündnis vor allem als Schutz gegen Russland begreifen. Statt geografischer Ausweitung des Aktionsradius wollen D&E Heft 58 · 2009 M 8 Der US-amerikanische Vizepräsident Joe Biden stellte auf der 45. Münchner Sicherheitskonferenz im Jahre 2009 die neue Sicherheitspolitik der Obama-Administration vor © picture alliance, dpa sie eher eine Beschränkung auf den Schutz der Nato-Länder selbst. Auch kleine Nato-Staaten wie Norwegen, die zunehmend Übungsflüge russischer Kampfbomber an ihren Grenzen beobachten, drängen auf eine Stärkung des Artikels 5 des Nato-Vertrages, also der Beistandsklausel bei Angriffen. In der nun beginnenden Strategiedebatte wären die Nato-Staaten gut beraten, Debatten ehrlicher zu führen und die Organisation nicht mit Aufgaben zu überfrachten. Die Debatte über den Artikel 5 zeigt, wie unsinnig etwa bestimmte Erweiterungsdiskussionen sind: Die Nato muss im Notfall auch halten können, was sie verspricht. In der Verlässlichkeit liegt ihre Abschreckungskraft. Aber es dürfte beim bestem Willen unmöglich sein, etwa dem isoliert liegenden Georgien an Russlands Südgrenze im Falle eines umfassenden Angriffs wirklich zu helfen. Zweitens wächst nach den Erfahrungen im Irak und in Afghanistan die Einsicht, dass Sicherheit und Stabilität eben nur zum Teil durch militärische Mittel erreicht werden können. Daraus folgt, dass die Bewältigung zusätzlicher Herausforderungen im 21. Jahrhundert nicht unter dem Dach eines militärischen Bündnisses organisiert werden sollte. Und drittens hat die Nato viel zu wenig beachtet, wie ihr Handeln in der Welt ankommt. Der Blick auf militärische Kapazitäten und die Freude über die eigene Effektivität verstellen nur den Blick auf unbeabsichtigte und negative politische Nebenwirkungen. Wenn der mächtigste Militärapparat der Welt auf anderen Kontinenten aktiv wird, löst dies fast zwangsläufig Misstrauen über die Motive aus. (…) Gerade im Verhältnis zu Russland hat die Nato zudem die Erfahrung machen müssen, dass mehr Waffen und mehr Militärbasen nicht unbedingt mehr Sicherheit erzeugen. So verstärkte der Streit über das geplante und nun erst einmal vertagte US-Raketenabwehrsystem in Osteuropa die Gefahr eines neuen Wettrüstens. In den kommenden Jahren wird dies zunehmend auch für die Politik gegenüber China gelten. Die Nato darf deshalb kein Instrument werden, um den wachsenden Einfluss Chinas in Asien zurückzudrängen. All dies spricht dafür, sich bei allen Wünschen nach einer klaren Rolle für das Bündnis mit der neuen Nato-Strategie nicht zu überheben und politisch vorsichtig zu agieren. Ein offensiv formuliertes Konzept richtet mehr Schaden an, als es nutzt. Das bedeutet nicht, dass das Bündnis im 21. Jahrhundert an Bedeutung verlieren wird, wie die russische Führung gern suggeriert. Einen Großteil der Stabilität gerade in Westeuropa verdanken wir der Tatsache, dass sich niemand mit der Nato anlegen möchte. Aber auch in einem Militärbündnis zählen nicht allein die Waffen – es kommt ebenso sehr auf die Worte an. Andreas Rinke, Handelsblatt, 30.07.09 D ie N AT O – e in R e l ik t d e s K a lt e n K r ie g s ? 77 III. 20 JAHRE MAUERÖFFNUNG IN DEUTSCHLAND 7. Die Verbliebene Weltmacht: Die Europapolitik der USA vor und nach 1989 JÜRGEN KALB N ach wie vor konkurrieren in den USA im Wesentlichen »zwei Varianten hegemonialer Außenpolitik« (Peter Rudolf) miteinander: Da ist zum einen die nach dem 11. September 2001 unter Präsident George W. Bush imperial zugespitze Position des »Unilateralismus«, die den USA als »verbliebener Weltmacht« das Recht auf ein selbstmandatiertes internationales Handeln zubilligte, und zum anderen die »liberal-multilaterale Position«, die im Moment z. B. von Präsident Barack Obama vertreten wird und die auf die Tradition Woodrow Wilsons, des US-Präsidenten im I. Weltkrieg (»To make the world save for democracy«), zurückreicht und die sich einem »multilateralen Internationalismus« unter demokratischen Bündnispartnern verpflichtet weiß. Isolationistische Positionen, wie sie noch in der Zwischenkriegszeit in den USA die Oberhand gewonnen hatten, befinden sich in der US-amerikanischen Diskussion immer mehr auf dem Rückzug. Die Bereitschaft zum Einsatz militärischer Macht ist in den großen politischen Lagern der USA, in den beiden Häusern des Kongresses, den Meinungsspalten der überregionalen Zeitungen und Politikjournale, aber auch den einflussreichen Interessengruppen und »Think Tanks«, den Ideenagenturen, längst nicht mehr umstritten. 78 »Imperiale Illusionen?« Insbesondere in den acht Jahren der Präsidentschaft von George W. Bushs (2001–2009) geriet die US-amerikanische Außenpolitik international gesehen heftig in die Kritik. Dabei verlagerte sich zudem der Fokus deutlich weg von Europa hin zum Nahen und Mittleren Osten. Nicht mehr der »Eiserne Vorhang« (Churchill) und die Konfrontation zweier Supermächte standen im Mittelpunkt des Geschehens. Spätestens seit den Anschlägen des 11. September 2001 in New York mit mehr als 3.000 Toten traten die Probleme der »neuen Kriege« (Herfried Münkler) und asymmetrischer Kriegsführung auch ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Was war zu tun? Welche Konsequenzen sollte dies für die US-amerikanische Außenpolitik zeitigen? Die Bush-Administration reagierte rasch mit der sogenannten »Bush-Doktrin« (| M 5 |), also der Drohung, militärische Macht auch präventiv (»preemptiv«) einzusetzen, und zwar nicht nur gegen terroristische Organisationen und Staaten, die ihnen Unterstützung gewähren, sondern auch gegen »Schurkenstaaten«, die nach Massenvernichtungswaffen strebten. Bush verfolgte hierbei zudem einen konsequent unilateralen Kurs. Obwohl die NATO nach den Anschlägen von New York zum ersten Mal den Verteidigungsfall ausgerufen hatte und zum Militärschlag gegen Afghanistan bereit war, verzichteten die USA hier ausdrücklich auf deren militärische Unterstützung. Im Falle des Krieges gegen den Irak im Jahre 2003 vertraute Bush ausschließlich auf sogenannte »willige Helfer«, also z. B. Bündnispartner in Europa, die bereit waren, unter US-amerikanischem Oberbefehl militärisch zu intervenieren. Dies spaltete die europäischen Nationen innerhalb der EU und NATO nachhaltig. Berühmtheit erhielt hier insbesondere die Rede des ehemaligen Verteidigungsministers Donald Rumsfeld, der vom »alten« und »neuen« Europa gesprochen hatte. Mit »alt« waren hier vor allem Frankreich und Deutschland gemeint, die sich einer Intervention im Irak widersetzten, mit »neu« jedoch insbesondere auch jene Länder wie z. B. Polen und Tschechien, die noch vor 1989 zum so- D ie N AT O – e in R e l ik t d e s K a lt e n K r ie g s ? Abb. 1 Vom Reichstagsgebäude aus schauen der amerikanische Präsident Ronald Reagan (Mitte), Bundeskanzler Kohl und der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen am 12.6. 1987 über die Berliner Mauer. Am 22.6. forderte er den Staats- und Parteichef der UDSSR auf: »Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein!« © picture alliance, dpa, Roland Holschneider genannten »Ostblock« und damit direkten Einflussbereich der Sowjetunion gezählt hatten. Die in den europäischen, aber auch US-Medien verwendeten Begriffe wie »American Empire« oder »Imperial Ambitions« bezogen sich dabei bewusst auf jene radikale Kritik amerikanischer Außenpolitik, die einst während des Vietnam-Krieges zu weltweiten Protesten gegenüber jener Nation geführt hatte, die noch im II. Weltkrieg Europa vom Nationalsozialismus befreit hatte. Mit der neuen Präsidentschaft von Barack Obama scheint sich nun, glaubt man wiederum den Medien, schlagartig das Auftreten USamerikanischer Außenpolitik verändert zu haben. Interdependenz von Außen- und Innenpolitik Zu kurz greift, wer die Außenpolitik der USA nur aus dem internationalen System erklären will. Vielmehr sind gerade bei den USA jene Bedingungen und Zusammenhänge immer einzubeziehen, die sich aus dem politischen System der Vereinigten Staaten selbst ergeben. Europäer sind gelegentlich verwirrt und irritiert, wenn aus der Administration eines Präsidenten höchst widersprüchliche Äußerungen kommen, die Politik des Landes von maßgeblichen Regierungsmitgliedern immer wieder unterschiedlich definiert wird. Aus dieser Widersprüchlichkeit kann auf der anderen Seite des Atlantiks jedoch auch die Gewissheit gewonnen werden: »Äußerungen einzelner Politikerinnen bzw. Politiker, die radikal und zugespitzt anmuten, an Säbelrasseln, an Imperialismus und pure Machtpolitik erinnern, sind unter Umständen nicht so gemeint, wie sie beim ersten Zuhören klingen. In Wirklichkeit deuten sie eher auf einen Machtkampf in der präsidentiellen Administration hin: Es gilt die Aufmerksamkeit und Zustimmung des Präsidenten zu gewinnen. Zudem hat ein prinzipieller Wesenszug der Gesellschaft in den USA bis heute Gültigkeit, auch in den Zeiten des Patriot Act, der Heimatschutzbe- D&E Heft 58 · 2009 hörde, der Einschränkung einiger Grundrechte und des militärischen und diplomatischen Unilateralismus: die fundamentale Skepsis gegen jede Art von Machtanhäufung. Diese ist Teil des US-amerikanischen Freiheitsverständnisses, wird genährt aus der Tradition der Graswurzeldemokratie und leitet sich historisch her aus der Ablehnung absolutistischer Tyrannei im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts.« (Peter Lösche, www.bpb.de, a. a. O.) Gerade für die USA trifft exemplarisch zu, dass Außenund Innenpolitik, Außen- und Wirtschaftspolitik stets eng miteinander verbunden sind. Die US-amerikanische Außenpolitik kann daher nur aus ihrem jeweiligen inneren Zusammenhang, in dem sie formuliert wurde, begriffen, kann nur analysiert werden, wenn sie als Teil und Ergebnis des politischen Systems der Vereinigten Staaten verstanden wird. Ernst-Otto Czempiel hat gleich in mehreren Publikationen darauf hingewiesen, dass sich im Prozess der innenpolitischen Demokratisierung weltweit, der nicht zuletzt seinen Ausgang von den USA nahm, die Beziehung zwischen Gesellschaft und Herrschaft, jedenfalls im Unterschied zu den Monarchien und autoritären Regimes des 19. und 20. Jahrhunderts, grundlegend geändert hat. Demokratische Systeme seien »prinzipiell auf Sicherheit und Frieden gerichtet, weil der Wohlstandsbürger risikoavers ist.« (Czempiel, S. 18) Zunehmend beeinflussen gesellschaftliche Akteure das ehedem Außenpolitik-Monopol der jeweiligen präsidentialen Administration. Zudem hat sich das internationale System seit dem Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa und fortschreitender Globalisierungsprozesse grundlegend geändert. War Globalisierung im Zeitalter des Kalten Krieges noch weitgehend durch die Systemkonkurrenz geprägt, so kennzeichne das aktuelle internationale System vor allem die fortschreitende »Ausbreitung des liberalkapitalistischen Wirtschaftssystems auf immer größere Teile der Welt und das weltweite Auftreten gesellschaftlicher Akteure« (Czempiel, S. 20). Insbesondere aus der Sicht der USA verliert Europa hierbei längst seine von ihm selbst häufig noch beanspruchte zentrale Lage, die es zu Zeiten des Kalten Krieges möglicherweise noch inne hatte. Geostrategische Überlegungen in den USA zielen längst eher auf den mittleren und fernen Osten ab. Kriegerische Auseinandersetzungen (wie z. B. Afghanistan, Irak) haben sich dorthin verlagert. Sorgen um dortige Ressourcen und Absätzmärkte (Der Spiegel, 2003: »Kampf ums Öl«) beschäftigen USamerikanische Beobachter ebenso weit stärker als die so kontrovers diskutierte These von Samuel P. Huntington vom »Clash of Civilizations« (auf deutsch mit »Kampf der Kulturen« wiedergegeben), von einer Systemkonkurrenz zwischen westlichen und islamischen Kulturen und einer »Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert« (Huntington). Stephan Bierling hat in seiner »Geschichte der amerikanischen Außenpolitik« zudem darauf hingewiesen, dass die amerikanische Öffentlichkeit, sieht man einmal von den großen Tageszeitung »New York Times, »Washington Post« und »Los Angeles Times« ab, die noch darüber berichten, wenig von der internationalen Politik, schon gar nicht in Europa, wahrnimmt und höchstens auf aktuelle, zumal kriegerische Ereignisse reagiert, und das nicht selten eher emotional. In der Tradition der amerikanischen Freiheitsbewegung sei man in den USA nach wie vor und über alle Lager hinweg der Meinung, die USA seien etwas ganz Besonderes. Gab es in Europa im 19. und 20. Jahrhundert nur »Krieg, Machtpolitik, Tyrannei und Unterdrückung, (so stand) Amerika für Frieden, Freiheit, Demokratie und Ideale. Dieser Exzeptionalismus kulminierte in der Ansicht, dass es die ‹gottgewollte Bestimmung› (Manifest destiny) der USA sei, der Welt als Vorbild zu dienen.« (Bierling, S. 13). Walter McDougall spricht gar vom Wandel der USA vom »Leuchtturm« zum »Kreuzfahrer-Staat« (Walter McDougall: Promised Land, Crusader State. Boston 1977). Der »American Way of life« solle nunmehr die Welt endgültig erreichen, d. h. Demokratie und Marktwirtschaft mit weltweit offenen Märkten die Welt humanisieren. Dahinter steht aus US-amerikanischer Sicht nicht nur die tiefe Überzeugung, dass demokratische Staaten gegeneinander keine Kriege führten, sondern auch und vor allem, dass diese »amerikanischen« Werte anderen in der Welt weit überlegen seien. Diese D&E Heft 58 · 2009 Abb. 2 Die außenpolitische Entscheidungsfindung in den USA. © Stephan Bierling, Geschichte der amerikanischen Außenpolitik, a. a. O., S. 10 Überzeugungen scheinen – trotz aller sonstigen Unterschiede – die Eliten, hier z. B. die außenpolitischen »Schulen«, zu einen und dafür zu sorgen, dass innenpolitisch ein weit größeren Anteil am Bruttoinlandsprodukt für Rüstungsanstrengungen aufgebracht werden kann als in anderen westlichen Staaten, z. B. in Europa oder gar der Bundesrepublik Deutschland. Wenn auch der Präsident und seine jeweilige Administration im Bereich der Außenpolitik weit stärkere Vollmachten besitzen als in der Innenpolitik, so ist der Einfluss des Kongresses, im Bereich der Außenpolitik speziell des Senats, in den USA kaum zu unterschätzen. Weltanschaulich lassen sich hier nach Stephan Bierling vor allem drei Richtungen unterscheiden, die – von recht verschiedenen »pressure groups« beeinflusst – durchaus unterschiedliche Akzente setzen können: (1) Die »liberalen Institutionalisten«; – (2) die »konservativen Internationalisten« oder Vertreter der realistischen Schule sowie (3) die »konservativen Unilateralisten« oder auch allgemein die Vertreter der Neokonservativen. Zu den Vertretern der »liberalen Institutionalisten« zählen in jüngster Zeit vor allem die Präsidenten Jimmy Carter und Bill Clinton (jener zumindest in seiner ersten Amtszeit, als die »Republikaner« noch nicht die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses hatten) sowie aktuell Barack Obama. Als Mittel der Politik geht es ihnen vor allem um eine multilaterale Vorgehensweise mit offener Diplomatie und die Stärkung internationaler Organisationen wie UNO, aber auch der NATO. Gewaltanwendung wird hier nur als »ultima Ratio« in Betracht gezogen. Demgegenüber vertreten die »konservativen Internationalisten« oder auch »Realisten« die These, die USA müssten, um globale Bedrohungen wie den Kommunismus oder Terrorismus abzuwenden, militärisch nahezu überall auf der Welt präsent sein und die Gefahren einzudämmen (»Containment«-Politik). Internationale Bündnissysteme sollten vor allem unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, ob sie US-amerikanischen Interessen dienten. Die »Realisten« in dieser Richtung vertraten deshalb vor allem eine Gleichgewichtspolitik und den Interessenausgleich z. B. mit der ehemaligen Sowjetunion. Richard Nixon und später George Bush Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « 79 JÜRGEN KALB Abb. 3 Der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow auf einem von insgesamt 6 Gipfeltreffen mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, 1987 in Rejkiawik (Island) © picture alliance, dpa 1987 80 sen. könnten als klassische Vertreter dieser Position genannt werden. Der ehemalige Außenminister Nixons und Friedensnobelpreisträger Henry Kissinger vertritt heute noch auf internationalen Vortragsreisen diese Position. Mit Ronald Reagan und George W. Bush jr. haben sich in den letzten Jahrzehnten Präsidenten hervorgetan, die unter dem Schlagwort »America first« und dem Bekenntnis zu einem amerikanischen Unilateralismus bekannt und deshalb oftmals heftig kritisiert wurden. Diese »Neokonservativen«, deren Bewegung jedoch nicht zuletzt innenpolitisch motiviert war, kennzeichnet eine tiefe Skepsis gegenüber internationalen Organisationen, vor allem der UNO und ihren Unterorganisationen, aus. Neben der Forderung nach höheren Rüstungsausgaben vertreten die »konservativen Unilateralisten« insbesondere Pläne für eine »Nationale Raketenabwehr« (aktuell: »National Missile Defense =NMD) zur Abwehr potenzieller Angriffe von »Schurkenstaaten« (»rogue states«). Gegenüber internationalen Umweltprogrammen oder Familienplanungsinitiativen der UNO verhalten sie sich äußerst kritisch. Ein kurzer historischer Rückblick soll hier im Folgenden zu einer näheren Charakterisierung der Abfolge US-amerikanischer Europapolitik führen. US- Europapolitik unter Carter: Von der Détente zur Verschärfung des Konflikts Als der Demokrat Jimmy Carter 1977 Präsident wurde, wollte er nach dem Trauma des Vietnamkriegs und der Machtpolitik Richard Nixons und Gerald Fords zunächst eine neue ethische Basis für die Außenpolitik legen. Allerdings erschwerten sowjetische atomare Aufrüstungsaktivitäten in Europa mit sogenannten SS 20 – Mittelstreckenraketen seine Bemühungen, Entspannungspolitik gegenüber der UdSSR fortzusetzen. Nicht zuletzt der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) drängte die USA zu einem Nachrüstungsbeschluss für atomare Mittelstreckenraketen (z. B. »Pershing II«), die ihm innenpolitisch in der Bundesrepublik große Schwierigkeiten bereitete. Als dann die SU unter ihrem greisen Generalsekretär der KPdSU Leonid Breschnew auch noch am 27. Dezember 1979 in Afghanistan einmarschierte, gehörte die »Détente«-Politik der USA vollends der Vergangenheit an. Carters tiefe Enttäuschung mündete gleich in einer Reihe von antisowjetischen Maßnamen: Verurteilung der sowjetischen Invasion durch den Sicherheitsrat und die Generalversammlung der UNO, Weizenembargo, Stopp der Lieferung von High-Tech-Produkten an die SU, Rückzug aus dem SALT II – Vertrag mit der SU, der Obergrenzen für die Aufrüstung von atomaren Interkontinentalraketen vorsah sowie den Boykott der Olympischen Spiele 1980 in Moskau. Dies traf nun aber wieder auf Widerstand bei vielen europäischen Bündnispartnern. Abb. 4 »Das Kuratorium Deutsche Einheit« verlieh am 16.6. 2005 den Architekten der deutschen Einigung den »Point-Alpha-Preis«. Von links: Der frühere sowjetische Präsident Michail Gorbatschow, Ex-US-Präsident George Bush senior und Altbundeskanzler Helmut Kohl © picture alliance, dpa 2007 Reagans Kreuzzug gegen das »Reich des Bösen« Ronald Reagan war 1981 vor allem gewählt worden, um die amerikanische Wirtschaft zu sanieren. Außenpolitisch versprach er insbesondere die Stärkung der amerikanischen Rolle in der Welt. Dazu bediente er sich von Anfang an einer »konservativen Kreuzzugsrhetorik« (Bierling, S. 177), die an die »Containment«-Politik Henry Trumans und seine »Roll back«-Strategie der 50er-Jahre erinnerte. Für Reagan war klar, dass die UdSSR die Wurzel der Instabilität auf der Welt bildete, sie entfachte Bürgerkriege, unterstützte Terroristen und war bereit, »jedes Verbrechen zu begehen, zu lügen und zu betrügen«. In seiner berühmten Ansprache vor der »Nationalen Vereinigung protestantischer Christen« am 12.9.1983 sprach er davon, dass die UdSSR das »Zentrum des Bösen in der modernen Welt« sei und ein »Reich des Bösen« (»evil empire«) beherrsche (| M 1 |). Als ersten Schritt im Systemwettkampf mit der UdSSR setzte der Präsident deshalb eine Erhöhung des Rüstungsbudgets um 15 Prozent auf 233 Milliarden Dollar durch, im Fünfjahresprogramm waren es mehr als 1,5 Billionen Dollar. Zudem verkündete er einer staunenden Öffentlichkeit die Entwicklung einer weltraumgestützten »Strategischen Verteidigungsinitiative« (»SDI«), die die USA im Kriegsfall vor feindlichen Atomraketen schützen solle. In großer Deutlichkeit wollte die Reagan-Administration der UdSSR deutlich machen, dass sie den Rüstungswettlauf mit den USA nicht gewinnen könne. Eine Wende trat jedoch im Frühjahr 1985 ein, als Reagan nach seiner triumphalen Wiederwahl dem neuen Generalsekretär der KPdSU Michail Gorbatschow persönlich begegnete. Zwar dauerte es noch etwa zwei Jahre, bis konkrete Verhandlungen zu einem Ergebnis führten. Aber Gorbatschow wollte und konnte sich nicht auf einen für die Sowjetunion fatalen Rüstungswettlauf einlassen, Reagan wollte aber unbedingt an seinen SDI-Plänen festhalten. 1987 unterzeichneten sie schließlich doch ein erstes ernsthaftes Abrüstungsabkommen zwischen den Supermächten, den INF-Vertrag, der vorsah, innerhalb von drei Jahren alle bodengestützten atomaren Kurz- und Mittelstreckenraketen zu verschrotten (»Nulllösung«). Außerdem gewährleistete er ein umfangreiches Verifikationssystem mit Vorort-Inspektionen und Überwachungsmaßnahmen. Reagan wollte nunmehr auch nicht mehr vom »Reich des Bösen« sprechen, forderte aber am 22.6. 1987 dennoch Gorbatschow in seiner berühmten Rede direkt auf: »Wenn Sie Frieden, wenn Sie Wohlstand für die Sowjetunion und Osteuropa, wenn Sie Liberalisierung suchen (…), dann, Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein!« Reagans Position hatte sich dennoch deutlich gewandelt: Von seiner neokonservativen Kreuzzugsrhetorik war er immer mehr zu einer Kooperation mit Gorbatschow übergegangen, die sich zunehmend, wenn auch in erster Linie bilateral verstanden, an die Positionen der »Realisten« innerhalb der republikanischen Partei annäherte. Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « D&E Heft 58 · 2009 Abb. 5 Am 12.9.1990 unterzeichneten die vier Siegermächte des II. Weltkriegs und die Vertreter der beiden deutschen Staaten im Moskauer Hotel »Oktober« den »2+4-Vertrag«. Von links: Die Außenminister Roland Dumas (F), Eduard Schewardnadse (UdSSR), James Baker (USA), Dietrich Genscher (BRD) und Douglas Hurd (GB). In der Mitte Michail Gobatschow und rechts der erste und letzte demokratisch gewählte Ministerpräsident der DDR: Lothar de Maizière © picture alliance, dpa George Bush sen.: »Konservativer Multilateralismus« Als der ehemalige Vizepräsident George Bush sen. 1989 sein Amt übernahm, fand er eine insgesamt recht stabile Situation vor. Ab Mai 1989 rückte Bush dann immer mehr von der amerikanischen Eindämmungspolitik ab und begann, Gorbatschow international zu unterstützen. Zwar forderte er öffentlich von der Sowjetunion weitere Abrüstungsschritte im nuklearen und konventionellen Bereich, das Recht der mittel- und osteuropäischen Staaten auf Selbstbestimmung und demokratische Freiheit im Ostblock, verwies aber schon im Juli 1989 darauf, dass die begonnenen Reformen in Osteuropa wesentlich vom Erfolg der »Perestroika« Gorbatschows abhingen: Zu seinen Beratern sagte er: »Wenn es keinen Gorbatschow gäbe, gäbe es auch nichts von dem, was wir gerade in Polen und Ungarn gesehen haben« (Michael Duffy). Ungarn hatte im Mai den Eisernen Vorhang geöffnet, bei halbfreien Wahlen im Juni in Polen war die Gewerkschaftsbewegung »Solidarnosc« als klarer Wahlsieger hervorgegangen. Besonders beeindruckte Bush sen., dass Gorbatschow die Breschnew-Doktrin aufgegeben hatte, mit der die UdSSR seit 1968 Interventionen in Satellitenstaaten gerechtfertigt hatte, und dass er das marode SED-Regime in der DDR anlässlich der 40-Jahr-Feiern im Oktober 1989 in Ost-Berlin offensichtlich intern heftig kritisiert hatte sowie vor allem keinerlei Maßnahmen ergriff, um die Öffnung der Mauer am 9. November rückgängig zu machen. Anfang Dezember versuchte er auf einem Gipfeltreffen Gorbatschow die Angst zu nehmen, die USA könnten die Schwierigkeiten der UdSSR zum Ausbau der eigenen Machtposition nutzen. Er versicherte, er werde jede Annäherung der beiden deutschen Staaten »weise und vorsichtig« begleiten und die »legitimen sicherheitspolitischen Interessen der UdSSR« berücksichtigen. Bush sah dabei Helmut Kohls 10-Punkte-Plan und die weiteren Schritte zur deutschen Einheit in wesentlich positiverem Licht als die meisten seiner Berater, vor allem aber als die britische Premierministerin Margaret Thatcher und der französische Präsident François Mitterand. Stephan Bierling analysiert hierbei ein strategisches Kalkül Bushs: »Wenn sich die USA als erste Macht für Kohls Vereinigungspolitik einsetzten, so würde ihnen das Deutschland später nicht vergessen.« (S. 202). Allerdings nannte Bush auch deutliche Bedingungen für eine Zustimmung der USA zur deutschen Einigung: Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze zu Polen und Verbleib Gesamtdeutschlands in der NATO. Zur multilateralen Einbettung der deutschen Einigung initiierte Bush schließlich die »2+4-Verhandlungen«, in deren Rahmen die Bundesrepublik und die DDR mit den Vertretern der vier Sieger- D&E Heft 58 · 2009 Abb. 6 Der amerikanische Präsident Bill Clinton (Mitte) informiert sich am 5.5.1999 im Brüsseler Hauptquartier des Miltärbündnisses bei NATO-Generalsekretär Javier Solana (re.) und dem Oberkommandierenden in Europa, US-General Wesley Clark, über den Stand der Luftangriffe der Allianz gegen Jugoslawien (Serbien) © picture alliance, dpa mächte des Zweiten Weltkriegs die außenpolitischen Regulierungen zur Deutschen Einheit völkerrechtlich abschlossen. Als Moskau im Januar 1991 mit Gewalt gegen Sezessionsbewegungen im Baltikum vorging, reagierte die Bush-Administration nur recht milde, um Gorbatschow nicht zu brüskieren. Und Boris Jelzin, den Widerpart Gorbatschows in Russland, akzeptierte er als Gesprächspartner erst, als mit dessen Unterstützung ein Putschversuch der sowjetischen Militärs gegen Gorbatschow niedergeschlagen wurde. Dieser Kollaps der Sowjetunion war in der Folgezeit dann nicht nur die Geburtsstunde der GUS, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, als Nachfolgeorganisation der UdSSR, sondern auch der Beginn einer Suche nach einer »Neuen Weltordnung«, die Bush 1991 ausrief. Insbesondere im ersten Irakkrieg, als Saddam Hussein Kuwait überfiel, setzte George Bush sen. ganz auf die multilaterale Zusammenarbeit und UNO-Legitimation. Schon Ende 1990 hatten die ehemaligen Gegner des Ost-WestKonflikts die »Charta von Paris« unterzeichnet und damit ein umfassendes Bekenntnis zu den Menschenrechten, zur Demokratie, zum Freihandel und zu einer Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheitspolitik abgelegt. Aus den eher losen KSZE-Treffen wurde 1995 schließlich eine ständige Organisation mit Sitz in Wien: die OSZE (»Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa«). Die NATO-Staaten reduzierten in der Folgezeit ihrer Verteidigungshaushalt um rund 20 %, vor allem in der Bundesrepublik Deutschland, was u. a. auch Teil des »2+4-Abkommens« war. Bill Clinton: Zunächst Innenpolitiker – außenpolitisch eine »Wende rückwärts« Bei den Präsidentschaftswahlen im November 1992 hatten Bush seine außenpolitischen Erfolge jedoch wenig genutzt. Eine anhaltende Wirtschaftskrise und nach wie vor horrende Schulden im Staatshaushalt brachten den Demokraten Bill Clinton ins Weiße Haus in Washington. Am Mulitlateralismus seines Vorgängers hielt Clinton fest, sprach gar von einem »assertive« (»anspruchsvollen«) Multilateralismus. Dies bedeutete auch, dass die UNO in den sich entwickelnden Jugoslawien-Krieg ab 1991/92 die Initiative erhielt. Die Kriege in Kroatien und Bosnien-Herzegowina wurden als Bürgerkriege eingestuft und zur Sicherung des Friedens wurden Peacekeeping-Truppen (»UNPROFOR«) eingesetzt, was sich als wenig effektiv herausstellte. Nach dem Friedensschluss von Dayton (1995) in Bosnien beauftragte schließlich der Sicherheitsrat der UNO die Militärallianz NATO mit der Beaufsichtigung, was zur Etablierung von IFOR und SFOR-Truppen führte. Ab 1994 spricht Czempiel von einer »Wende rückwärts« in Clintons Außenpolitik. Was war geschehen? In den USA hatten die Republikaner in beiden Häusern nicht nur die Mehrheit erlangt und eine neue amerikanische Außenpolitik unter dem Titel »Contract Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « 81 JÜRGEN KALB Abb. 7 Junge Demonstranten verbrennen 1999 bei einer Protestaktion vor der US-Botschaft in Moskau die amerikanische Flagge. Sie forderten die Einstellung der Luftangriffe der NATO auf Serbien © picture alliance, dpa 27.3.1999 82 with America« gefordert, auch in zahlreichen osteuropäischen Staaten mehrten sich die Stimmen, über den »Nordatlanischen Kooperationsrat« mit seinen rund 40 Mitgliedstaaten – einschließlich Russlands und der meisten GUS-Stataten – hinaus als Vollmitglied in die NATO aufgenommen zu werden. Vermutet wird auch, dass Interessen der amerikanischen Rüstungsindustrie eine wichtige Rolle spielten. Jetzt sollten Polen, Tschechien und Ungarn in die NATO aufgenommen werden. Boris Jelzin reagierte empört. Am 5.12.1995 erklärte Jelzin auf einer OSZE-Tagung, der Westen riskiere einen »kalten Frieden«, wenn er russische Sicherheitsinteressen übergehe. Die Clinton-Administration reagierte zwar mit weiteren wirtschaftlichen Zugeständnissen an Russland und der »NATO-Russland-Gründungsakte«, die 2002 schließlich in den »NATO-Russland-Rat« mündete, die »Russia-First-Politik« war jedoch gescheitert. Im Weiteren intensivierten die USA ihre Kontakte zu den baltischen Staaten, den ehemaligen Sowjetrepubliken im Kaukasus und zur Ukraine, die bereits 1997 mehr Auslandshilfe erhielt als die Russische Föderation. Unter »Enlargement« wurde nunmehr etwas anderes verstanden als noch zu Zeiten der Charta von Paris. Die NATO- und auch EU-Osterweiterung rückten beide Bündnisse eng an die ehemaligen Grenzen der UdSSR heran. Den eindeutigen Führungsanspruch (»leadership«) der USA im Bündnis, obwohl am Multilateralismus festhaltend, belegten letztlich auch die Ereignisse im Serbien- bzw. Kosovo-Krieg im März 1999. Bei ihren Luftangriffen auf Serbien verzichteten die USA und die NATO ganz bewusst auf eine Autorisierung durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Massenvertreibungen von Kosovo-Albanern und grausame Massaker unter der Zivilbevölkerung, für die die NATO-Staaten Serbien unter Slobodan Milosevic verantwortlich machten, führten letztlich zu einem neuen NATOKonzept, das das westliche Militärbündnis nunmehr als eine weitere globale Organisation zur Sicherung des Weltfriedens neben UNO, OSZE, EU u. a. betrachtete. Kritiker sprachen hier von der »Selbstmandatierung« der NATO und sprachen ihr hierfür die Legitimation eines Einsatzes außerhalb der reinen Selbstverteidigung ab. Das Verhältnis zur Russischen Föderation erfuhr durch die Serbien-Kosovo-Frage auf jeden Fall eine nachhaltige Verschlechterung. Bushs Hegemonialismus nach 9/11 Eine weltpolitische Zäsur stellte unumstritten der Terrorangriff islamistischer Fundamentalisten am 11.9.2001 in dar. Die sich an die Anschläge mit mehr als 3.000 Toten in New York und Washington anschließende Neujustierung der US-Außenpolitik unter George W. Bush veränderte die internationalen Beziehungen fundamen- Abb. 8 US-Präsident George W. Bush drückt am 8.5.2003 bei einem Empfang im Weißen Haus in Washington seine Unterstützung für die Osterweiterung der NATO aus. Hinter ihm stehen (von links nach rechts) die Außenminister von Estland, Rumänien, Litauen, US-Außenminister Colin Powell, der Slowakei, Slowenien, Bulgarien und Lettland Sandra. Zuvor hatte der US-Senat die Osterweiterung der NATO einstimmig gebilligt. © picture alliance, dpa tal. Wie einst im Kalten Krieg die Qualität der Beziehungen der USA zu einem anderen Staat primär davon abhing, wie er sich zur Sowjetunion stellte, so richtete sich die Regierung Bush nunmehr danach, ob ein Staat den amerikanischen »Krieg gegen den Terror« unterstützte oder nicht. Die Mitte September 2002 verkündete »Nationale Sicherheitsstrategie« (NSS) bekannte sich in bisher nicht gekannter Deutlichkeit zum Unilateralismus (| M 5 |). Die Vereinigten Staaten als führende Militärmacht nehmen darin für sich in Anspruch, mit »präemptiven Aktionen« nicht nur gegen Terroristen, sondern auch gegen »Schurkenstaaten« vorzugehen, vor allem wenn diese Massenvernichtungswaffen besitzen oder erwerben wollten und damit die Sicherheit der USA gefährdeten. Entscheidungen über solche Interventionen sollten nun aber allein in den USA gefällt werden. Das Prinzip der Souveränität von Staaten, zu dem sich die UNO bekennt, hat somit nach amerikanischer Auffassung nur noch »eingeschränkte Gültigkeit« (Bierling, S. 245). Die Doktrin geht noch weiter: Ausdrücklich wird betont, dass die amerikanischen Normen »Demokratie, Entwicklung, freie Märkte und freier Handel« universell Gültigkeit haben sollten. War kurz nach den Anschlägen die internationale Solidarität mit den USA weltumspannend, so fürchteten bald viele Verbündete, insbesondere die Kontinental- und dort vor allem die Westeuropäer, die mit einer solchen Politik einhergehenden Risiken und lehnten diese Politik als »Pax Americana« (Czempiel) grundsätzlich ab. Der französische Außenminister Hubert Védrine kritisierte die NSS öffentlich als zu »simplistisch«, der deutsche Außenminister Joschka Fischer betonte, Bündnispartner seien keine Satelliten. Dabei hatten in den ersten Wochen und Monaten nach dem 11. September nicht nur der Sicherheitsrat der UNO das »Recht auf Selbstverteidigung«, sondern auch die NATO – sogar zum ersten Mal in ihrer Geschichte – den »Verteidigungsfall« ausgerufen. Bei den sich anschließenden amerikanischen Waffengängen gegen Afghanistan und 2003 gegen den Irak versicherte sich Bush schon nicht mehr der internationalen Organsiationen, auch nicht der Unterstützung der NATO. Lediglich Großbritannien, später dann weitere europäische Mitglieder der Allianz, wurde auf bilateraler Ebene hinzugezogen. Die NATO hat sich in den neunziger Jahren ohnehin deutlich geändert. Mit der Allianz zur Zeit des Kalten Krieges hatte sie immer weniger gemein. Schon bald hatte sie 19, dann 26 und später sogar 29 Mitgliedstaaten. Sie entwickelte sich immer mehr zu einer Organisation, die für die politische Stabilität des osteuropäischen Raumes – im amerikanischen Sinne – kümmern sollte. Die anfängliche Kooperation mit der Russischen Föderation im Programm »Partnerschaft für den Frieden« oder im »Nato-Russland-Rat« blieben jedoch im Weiteren nicht spannungsfrei. Als George Bush den Regierungen der Ukraine und in Georgien seine Bereitschaft zur Aufnahme ihrer Länder in die NATO signalisierte, waren heftige Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « D&E Heft 58 · 2009 Proteste aus Moskau hörbar. Diese Spannungen fanden schließlich ihren Höhepunkt im Georgienkrieg des Jahres 2008. Unter Präsident George W. Bush diente die Formel vom »Globalen Kampf gegen den Terror« zur Legitimation für die Durchsetzung eines neuen strategischen Paradigmas: eines »Hegemonialismus mit imperialen Implikationen, einer ‹grand strategy›, die nicht in erster Linie auf die konsensorientierte Kooperation innerhalb multilateraler Institutionen setzt, sondern auf einseitiges Handeln und harte erzwingende Macht zur Durchsetzung eigener, sehr weit verstandener Sicherheitsinteressen.« (Rudolf, 2006, S. 13). Zentrale Prinzipien sind hierbei die Bewahrung einer überlegenen Machtposition der USA, nicht zuletzt im militärischen Bereich, eine strategische Unabhängigkeit im Sinne eines US-amerikanischen Unilateralismus, die Ausweitung des Verständnisses von Selbstverteidigung mit Recht auf offensive präventive Selbstverteidigung sowie die Transformation autokratischer Staaten in Richtung »Freiheit und Demokratie« mit einem Fokus auf die arabische Welt (| M 2 |). Ernst-Otto Czempiel nennt als Ursache hierfür neben der realen Bedrohung durch terroristische Gewalttaten vor allem innenpolitische Gründe in den USA. Er wertet gar das Nationale Raketen-Abwehr-Programm, eine Wiederaufnahme und Weiterentwicklung von Reagans SDI-Projekt, als »außenpolitisches Hauptziel der Bush-Administration« (Czempiel, S. 164). Und in der Tat hinterließ George Bush 2009 nach acht Jahren Präsidentschaft ein riesiges Haushaltsdefizit, das längst vor der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise durch die enormen Rüstungsausgaben entstanden war. Geplante amerikanische Raketenabfanganlagen auf den Territorien Polens und Tschechiens zur Abwehr von Raketen z. B. aus dem Iran interpretierte der Kreml als unmittelbare Aggression gegenüber der Russischen Föderation. Auch diese Frage spaltete ähnlich wie das militärische Engagement gegen den Irak die europäischen Nationen, die inzwischen zum Großteil Mitglied in der Europäischen Union geworden waren. Obama: »Paradigmenwechsel« oder »instrumenteller Multilateralismus«? Die Vorstellung, dass die politischen Kräfteverhältnisse der Welt durch den Einsatz der Armee neu geordnet werden können, war die Hoffnung der Bush-Administration und ein klarer Bruch mit der »realistischen« Doktrin, der noch sein Vater während der Überwindung des Kalten Krieges anhing. Der »Realismus« oder »konservative Instutionalismus« besagte, dass das Militär nur maßvoll eingesetzt werden sollte, vor allem als unmittelbare Antwort auf offene Aggressionen des Gegners. Die Mehrzahl der Europäer erwartete dies nun wieder von Barack Obama, dem neuen amerikanischen Präsidenten. Er solle »europäische Mittel« (Scott Stock Gissendanner, Die Zeit 18.1.2009) anwenden, also mit multilateralen Verhandlungen, unter Einhaltung des Völkerrechts, d. h. mit vorrangig »weichen« Mitteln wie Entwicklungshilfe oder mittels kulturellem Austausch Amerikas Führungsrolle ausfüllen (| M 8 |). Die Grundzüge seiner Außenpolitik hat Obama bereits in mehreren Reden vorgestellt. Als seine primären Ziele nannte er, Amerikas »moralische Führerschaft« wiederherzustellen, multilaterale Ansätze zu stärken und aus der Großmacht USA wieder die Zivilmacht USA zu machen. Damit erfüllt er bislang weitestgehend die Erwartungen der (West-)Europäer. Inzwischen hat er auch das ehrgeizige Raketenabwehrprojekt eingestellt und Vorsicht bei der NATO-Osterweiterung signalisiert. Gleichzeitig fordert er ein stärkeres Engagement der Europäer bei internationalen Konflikten, z. B. im AfghanistanKrieg. Abzuwarten bleibt, ob Obama in konkreten außenpolitischen Konfliktsituationen seinem Bekenntnis zum Multilateralismus, seinem Bekenntnis zur UNO und zur NATO treu bleiben wird. Skeptiker sprechen schon heute davon, dass auch Obama bei der Vertretung amerikanischer Interessen in erster Linie an die Kosteneffizienz denkt und sein Multilateralismus ein instrumenteller sein werde. Die Verleihung des Friedensnobelpreises an Obama D&E Heft 58 · 2009 Abb. 9 Der amerikanische Präsident Barack Obama mit dem Präsidenten der Russischen Föderation Dimitri Medwedew am 23.9.2009 am Rande der 64. Generaldebatte der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York © picture alliance, dpa im Oktober 2009 wurde zudem von seinen innenpolitischen Gegnern in den USA kritisch kommentiert. Auch in der Ära Clinton konnte ein durch Wahlen gestärkter Kongress gegen die außenpolitischen Prinzipien des Präsidenten wirkungsvoll opponieren. Literaturhinweise Bierling, Stephan (2007): Geschichte der amerikanischen Außenpolitik. Von 1917 bis zur Gegenwart. München. (Becksche Reihe). 3. Auflage. Brzezinski, Zbigniew (1997): The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York (Basic Books). Czempiel, Ernst-Otto (2002): Weltpolitik im Umbruch. Die Pax Americana, der Terrorismus und die Zukunft der internationalen Beziehungen. München. (Becksche Reihe) Fehl, Caroline / Thimm, Johannes (2008): Weltmacht und Weltordnung. Multilateralismus im internationalen Spannungsfeld. Berlin. (SWP-Studie) (auch online) Geissbühler, Simon (Hrsg.) (2008): Der amerikanische Neokonservatismus und die Außenpolitik der USA. Wien. Berlin. (Lit-Verlag) Hippler, Jochen (2003): Unilateralismus der USA als Problem der internationalen Politik. in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ). 31/32 2003. S. 15–22 Kaim, Markus (2009): Obama und die transatlantischen Sicherheitsbeziehungen. In: APuZ, 15/16. 2009. S. 9–21 Keller, Patrick (2008): Neokonservatismus und amerikanische Außenpolitik. Paderborn. (Schöningh-Verlag) Rudolf, Peter (2006): Amerikapolitik. Konzeptionelle Überlegungen zum Umgang mit dem Hegemon. Berlin. SWP-Studie. (auch online ) Rudolf, Peter (2007): Imperiale Illusionen. Amerikanische Außenpolitik unter George W. Bush. Baden-Baden. Nomos-Verlag. Staak, Michael (2008): Die Außenpolitik der Bush-Administration. in: Aus Politik und Zeitgeschichte. 37/38 2008. S. 6–13. Internethinweise www.swp-berlin.org/ (Webseite der Stiftung Wissenschaft und Politik) www.blaetter.de/ (Blätter für deutsche und internationale Politik) www1.bpb.de/themen/LYW388,0,0,USA.html (Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung zur USA) Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « 83 JÜRGEN KALB MATERIALIEN M 1 »The Reagan Doctrine« (6.2.1985) »We cannot play innocents abroad in a world that is not innocent; nor can we be passive when freedom is under siege. (…) We must stand by all our democratic allies. And we must not break faith with those who are risking their lives – on every continent, from Afghanistan to Nicaragua – to defy Soviet-supported aggression and secure rights which have been ours since birth. (…) Support for freedom-fighters is self-defense.« www.reagan.utexas.edu//archives//speeches/1985/20685e.htm M 4 Auf einem Treffen am 1.4. 2008 in Kiew mit dem amerikanischen Präsidenten George W. Bush betonte der ukrainische Präsident Viktor Juschtschenko, es läge im ukrainischen Interesse, rasch NATO-Mitglied zu werden. © picture alliance, dpa M 2 »Neue Chancen amerikanischer Politik« 84 »… an earthquake of the magnitude of 9/11 can shift the tectonic plates of international politics. The international system has been in flux since the collapse of Soviet power. Now it is possible – indeed, probable – that the transition is coming to an end. If that is right, if the collapse of the Soviet Union and 9/11 bookend a major shift in international politics, then this is a period not just of grave danger, but of enormous opportunity. Before the clay is dry again, America and our friends and our allies must move decisively to take advantage of these new opportunities. This is, then, a period akin to 1945 to 1947, when American leadership expanded the number of free and democratic states – Japan and Germany among the great powers – to create a new balance of power that favored freedom. After the end of the Cold War, and still in the shadow of September 11, we may well be on the cusp of an era in which the world will not be bedeviled by great power rivalry. There will be differences among the great powers. But if the scales tip toward shared interest, rather than interest in conflict between them, this will truly be an era unlike any other.« Rice, Condoleezza, National Security Advisor, Remarks on Terrorism and Foreign Policy, 29.4.2002, www.whitehouse.gov/news/releases/2002/04/print/20020429-9.html M 5 George W. Bush – amerikanischer Präsident von 2001– 2009 »Competition between great nations is inevitable, but armed conflict in our world is not. More and more, civilized nations find ourselves on the same side – united by common dangers of terrorist violence and chaos. America has, and intends to keep, military strengths beyond challenge – thereby, making the destabilizing arms races of other eras pointless, and limiting rivalries to trade and other pursuits of peace. (…) Today the great powers are also increasingly united by common values, instead of divided by conflicting ideologies. The United States, Japan and our Pacific friends, and now all of Europe, share a deep commitment to human freedom, embodied in such strong alliances as NATO. (…) Democracy and economic openness (…) are the best foundations for domestic stability and international order. The United States will use this moment of oppurtunity to extend the benefits of freedom across the globe. We will actively work to bring the hope of development, free markets, and free trade to every corner of the world. The events of September 11, 2001, taught us that weak states, like Afghanistan, can pose as great a danger to our national interests as strong states. Poverty does not make poor people into terrorists and murderers. Yet poverty, weak institutions, and corruption can make weak states vulnerable to terrorist networks and drug cartels within their borders. (…) © Bush, George, W.: Rede in West Point vom 1.6.2002, www.whitehouse.gov/news/ releases/2002/06/20020601-3.html M 6 NSS – Nationale Sicherheitsstrategie der USA – 2006 »If necessary, however, under longstanding principles of self defense, we do not rule out the use of force before attacks occur, even if uncercainty remains as to the time and place of enemy’s attack. When the consequences of an attack with WMD (Weapons of Mass Destruction) are potentially so devastating, we cannot afford to stand idly by as grave dangers materialize. This is the principle and logic of preemption.« © The White House, The National Security Strategy of the United States of America, März 2006, S. 23. M 3 Die Entwicklung der weltweiten Rüstungsausgaben und der Umsatz der größten Rüstungskonzerne © picture alliance, dpa 2007 Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « D&E Heft 58 · 2009 M 7 Anti-NATO-Demonstration von ukrainischen Orthodoxen am 2.4. 2008 in Kiew. Der amerikanische Präsident Bush hatte die NATO aufgefordert, due Ukraine und Georgien möglichst rasch in die Allianz aufzunehmen. © picture alliance, dpa M 9 Präsident Obama kündigte am 17.9.2009 öffentlich an, auf die geplanten amerikanischen Raketenabwehrbasen in Polen und Tschechien einstweilen zu verzichten, die sein Vorgänger George W. Bush geplant hatte. Russland hatte sich von dem Projekt bedroht gefühlt und wiederholt mit Gegenmaßnahmen gedroht. © picture alliance, dpa M 8 »Das ist das Ende der Eiszeit« – Barack Obama als Präsident Markus Kaim leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. sueddeutsche.de: US-Präsident Obama stoppt die Pläne seines Vorgängers George W. Bush, einen Raketenschild in Osteuropa zu bauen. Der offizielle Grund ist die nachlassende Bedrohung durch Iran. Ist das nur ein Vorwand? Markus Kaim: Iran mag auch eine Rolle gespielt haben, das kann ich nicht ausschließen. Der entscheidende Grund aber ist der Paradigmenwechsel in den amerikanisch-russischen Beziehungen. Seit Obamas Amtsantritt kann man ganz deutlich erkennen, dass die US-Regierung von völlig neuen Grundannahmen ausgeht. Bush hat, vor allem am Ende seiner Amtszeit, Russland als Rivalen und potentiellen Störenfried angesehen, sei es im Kosovo oder im Verhältnis zu Iran. Bei der Regierung Obama überwiegt ganz deutlich die Einsicht, dass die USA Russland zur Lösung einer Vielzahl von Problemen benötigt – von Regionalkonflikten wie in Georgien bis hin zu den großen Themen Iran oder Rüstungskontrolle. sueddeutsche.de: Erleben wir damit eine Zäsur in den amerikanischrussischen Beziehungen? Kaim: Das ist das Ende der Eiszeit. Allerdings ist das Moratorium für den Raketenschild nicht das erste Anzeichen dafür. Bei seinem Besuch in Moskau im Juli hat Obama sich mit Russland in einigen wichtigen Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle geeinigt. In diesem Feld ist am Ende der Ära Bush überhaupt nichts mehr passiert. Zweites Stichwort ist die Nato-Osterweiterung. Bush drängte auf einen baldigen Eintritt Georgiens und der Ukraine in das Verteidigungsbündnis, Obama trat auch hier so stark auf die Bremse, sodass auch diese Pläne erst einmal vertagt sind. Und das dritte Feld ist eben die Raketenabwehr. (…) sueddeutsche.de: Muss Obama nun fürchten, dass seine Landsleute ihm vorwerfen, zu wenig die Interessen der Amerikaner zu vertreten? Kaim: Natürlich werden morgen die üblichen Verdächtigen, die außenpolitischen Hardliner, Obama beschimpfen. Die breite Bevölkerungsschicht hat derzeit jedoch andere Prioritäten. In der Innenpolitik dominiert der Streit um Obamas Gesundheitsreform, in der Außenpolitik der Krieg in Afghanistan. Einzig die einflussreiche Gruppe polnischstämmiger Amerikaner könnte sich Obama vergraulen. Die zeigten bereits deutlich ihren Unmut, als sich ihre Hoffnungen auf Visafreiheit für Polen nicht erfüllt haben. Die nächsten Wahlen in den USA, die »midterm elections«, sind aber noch mehr als ein Jahr entfernt – bis dahin dürfte auch deren Ärger verraucht sein. M 10 Die liberale polnische Zeitung »Gazeta Wyborcza« »Polen braucht weiterhin den starken Verbündeten aus den USA. Der Raketenschild sollte seine Grundlage sein, und nun müssen wir halt auf irgendeinen Ersatz warten. Nach der gestrigen Entscheidung des Weißen Hauses, auf den Bau des Raketenabwehrschildes in Polen und in Tschechien zu verzichten, müssen sich die Beziehungen zwischen Warschau und Washington ändern. Das Jahr 2009 hat sich als Ende des engen Bündnisses mit den USA erwiesen, das ziemlich lange gedauert hat – rund zehn Jahre. Man kann und muss dieses Bündnis weiter fortführen, aber auf einer anderen Grundlage. Amerika bleibt nach wie vor die wichtigste Supermacht auf der Welt, auch wenn sie nachlässt. Und ihre Interessen und fundamentalen Werte decken sich mit unseren.« © Bartosz Weglarczyk, 18.09.2009 M 11 Das tschechische Internetportal: www.aktualne.cz »Barack Obama erbte das Projekt, das den Bau eines Radars in Tschechien und eines Raketenschildes in Polen vorsah, von seinem Vorgänger. Die Leute um George W. Bush hatten damals bereits die Verträge mit der tschechischen und der polnischen Regierung vereinbart. Von Beginn an verhielt sich Obama, der erste Mann der USA seltsam dazu. Und das aus drei Gründen: wegen der hohen Kosten, der fragwürdigen Verlässlichkeit des Systems und nicht zuletzt wegen des laut geäußerten Unwillens des Kreml. Auf der anderen Seite war da das Bemühen des Weißen Hauses, die Welt vor der Gefahr aus dem Iran zu schützen und das den Verbündeten gegebene Versprechen einzuhalten. (…) Am Ende waren auch die innenpolitischen Probleme Tschechiens und Polens, das Projekt der eigenen Bevölkerung schmackhaft zu machen, ein Argument für die neue Regierung, das Projekt zu stoppen. (…) Kritiker sehen in diesem Schritt einen Sieg des Kreml, mit dem das Weiße Haus einen Neuanfang versucht.« © www.aktualne.cz vom 17.09.2009 www.sueddeutsche.de, 17.9.2009 D&E Heft 58 · 2009 Ung arn öff ne t die Gren ze – »Vom Mus terk n aben zum S orgenk ind « 85 DEUTSCHLAND & EUROPA INTERN 1. Die Medienrecherche des Medienzentrenverbundes PETER SCHMIDT I 86 m Online Angebot SESAM des Medienzentrenverbundes Baden-Württemberg sind derzeit weit über 43.000 Nutzerinnen und Nutzer registriert, die auf nahezu 33.000 Medien zugreifen können. »Gebündelt« sind diese in Medienzusammenstellungen, sogenannten Themenbanken und Unterrichtsmodulen – ein Angebot, das stetig ausgebaut wird. Eine komfortable und übersichtliche Nutzerführung erleichtert die Suche und das Auffinden der Objekte in der gesamten Medienrecherche. Eine Suchanfrage bezieht jeweils alle drei Archive ein, diese werden aber deutlich getrennt ausgewiesen: werden etwa Verleihmedien zum Thema »DDR« gesucht, so werden im Hintergrund auch die Medien zum Herunterladen aus SESAM und aus dem Fotoarchiv nach diesem Thema durchsucht. Der Kunde erfährt also immer, in welchem Bereich das jeweilige Medium auffindbar ist. Auch lässt sich die Suche auf eine bestimmte Medienart einschränken. Die Qualität der Inhalte wird durch die Bewertung der Medienbegutachtung des LMZ Abb. 2 Unterrichtsmodule zum Thema DDR umfassen komplette Stundenentwürfe sowie das gesamte gewährleistet, in der erfahrene Lehrkräfte dazugehörende Medienpaket zum Download. alle Angebote auf ihre Übereinstimmung mit den Bildungsplänen prüfen. Ein weiterer großer Vorteil der Nutzung des MedienThemenbanken und Unterrichtsmodule zur DDR angebotes des Medienzentrenverbundes besteht darin, dass und dem Thema »20 Jahre friedliche Revolution« alle Medien lizenz- und urheberrechtlich unbedenklich im Unterricht eingesetzt werden können. Zusätzlich bietet das LMZ mehrere hundert Unterrichtsmodule an, d. h. fertige Unterrichtseinheiten mit Stundenentwürfen zur Behandlung einzelner Themen in allen Schularten und Fächern. Vorrangig finden dabei Medien Verwendung, die auch in den SESAM-Themenbanken enthalten sind. Praktischerweise bietet jedes Unterrichtsmodul den kompletten Download aller Materialien, die das Modul verwendet, im Paket an. Pünktlich zum Jahrestag der friedlichen Revolution in der DDR wurden zwei neue Unterrichtsmodule (insgesamt 11 Unterrichtsstunden) erarbeitet. Modul 1 trägt den Titel »Jugend in der DDR«, Modul 2 beschäftigt sich mit dem »Leben in und bis zum Ende der sozialistischen DDR«. Basis aller dieser Stundenentwürfe sind exklusive Videointerviews mit Zeitzeugen, die das LMZ eigens erstellt hat und über die Medienrecherche zum Download vorhält. Das mediale Verleih- und Download-Angebot der Medienzentren wird im laufenden Schuljahr ergänzt durch zahlreiche Veranstaltungen in ganz Baden-Württemberg. In Form von Medientagen, Filmvorführungen mit Zeitzeugen, Diskussionsveranstaltungen und Lehrerfortbildungen beteiligt sich der Kompetenzverbund der Medienzentren in Baden-Württemberg an dem Gedenken an das singuläre historische Ereignis der friedlichen Revolution in Abb. 1 Suchmaske der Medienrecherche, getrennt nach Ausleihmedien und Meder DDR vor 20 Jahren. dien zum Herunterladen – jeweils spezifizierbar nach Medienarten. Der Registrierungsprozess ist selbsterklärend: elektronischer Versand und parallel postalischer Versand mit Schulstempel. Binnen weniger Tage wird eine Benutzerkennung als mail verschickt. Für Fragen rund um die Medienrecherche ist unter der Nummer 0721 8808-58 eine Hotline eingerichtet, eine FAQ-Liste finden Sie unter dem Reiter Hilfe/AGB« auf der Seite: http://medienrecherche.lmz-bw.de Die Medienrecherche des Medienzentrenverbundes D&E Heft 58 · 2009 DEUTSCHLAND & EUROPA INTERN 2. www.ddr-im-unterricht.de – ein Angebot der LpB KARL-ULRICH TEMPL D as Ministerium für Jugend, Kultus und Sport hat alle baden-württembergischen Schulen dazu aufgefordert, anläßlich von 20 Jahren Friedliche Revolution die Geschichte der DDR in Projekttagen zum Gegenstand schulischen Lernens zu machen. Die Landeszentrale für politische Bildung bietet dazu mit dem Internetportal www.ddr-im-unterricht.de ab sofort nützliche Hinweise und zahlreiche Hilfestellungen, wie das Lernfeld DDR im Schulunterricht sinnvoll erarbeitet werden kann. Das Portal liefert – Hintergrundwissen zum Thema DDR – stellt Unterrichtsmaterial zur Verfügung – informiert über Fortbildungsveranstaltungen – verweist auf Literatur und Medien – informiert über interessante und weiterführende Links. Abb. 1 www.ddr-im-unterricht.de: Ein Webportal der LpB Baden-Württemberg – Zur gezielten Navigation durch die Fülle der Internetangebote und Printmedien zum Thema. D&E Heft 58 · 2009 w w w.d d r-im- un t erricht.d e – ein A n geb o t d er L p B 87 DEUTSCHLAND & EUROPA INTERN Die Autorinnen und Autoren Abb. 1 Von links nach rechts: Tobias Ritter, Praktikant bei der LpB Ba-Wü (Mitgestalter der LpB-Website: www.ddr-im-unterricht.de), OStR i. R. Dietrich Rolbetzki, Mitglied des Beirats von D&E, OStR i. R. Dr. Walter-Siegfried Kircher, Mitglied des Beirats von D&E, Ltd. RD i. R. Wolfgang Walla, ehemaliger Abteilungsleiter im Statistischen Landesamts in Baden-Württemberg, Gerd Braitmaier, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium Stuttgart, Dr. Benno Ennker, Lehrbeauftragter für Kultur- und Sozialgeschichte Russlands an der Universität, St. Gallen, Schweiz, StD Jürgen Kalb, Chefredakteur von D&E, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium und Fachberater am RP Stuttgart. 88 Abb. 2 Frank Richter, Direktor der LpB in Sachsen, Mitbegründer der »Gruppe der 20« in Dresden Abb. 3 Prof. Dr. Roland Czada, Universität Osnabrück, Professur für Staat und Innenpolitik Abb. 4 Florian Jordan, Kapitänleutnant der Bundeswehr und Jugendoffizier in Baden-Württemberg Abb. 5 Prof. Dr. Ryszard Kaczmarek, Instytut Historii Uniwersytetu Slaskiego, Katowice, Polen Weitere Autoren des Hefts: Peter Schmidt, Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Leiter des Referats Fort- und Weiterbildung Abb. 6 StD Dr. Andreas Grießinger, Fachreferent für Geschichte am RP Freiburg Abb. 7 Manfred Mack, Deutsches Polen-Institut, Darmstadt Abb. 8 Joanna Beszcynska, Instytut Historii Uniwersytetu Slaskiego, Katowice, Polen. Karl-Ulrich Templ, stellvertretender Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Baden- Württemberg Die Bestseller in Neuauflage. ;khefWled7X_iP JWiY^[dXkY^Z[h [khef_iY^[d?dj[]hWj_ed >[hWki][][X[dledM[hd[h M[_Z[d\[bZkdZMeb\]Wd]M[ii[bi ''$7kÔW][(&&/" *//I$"XheiY^$"'/"/&Ð" ?I8D/-.#)#.)(/#**-.#& @W^hXkY^Z[h;khef_iY^[d ?dj[]hWj_ed(&&. >[hWki][][X[dledM[hd[h M[_Z[d\[bZkdZMeb\]Wd]M[ii[bi (&&/"+,&I$"XheiY^$"*/"ÅÐ" ?I8D/-.#)#.)(/#*',(#. ¹G`W`fTWZd^[UZWe>WZdg`V@SUZeUZ^SYWiWd]¸ ¹6Se4gUZ[efi[WVWdg`hWdl[UZfTSd ¸ 8WYa]hekdZ;khef[&)$&-$(&&-"pkhLehWkÔW][ Fhe\$:h$;h_Y^Hf[h"L[hmWbjkd]ihkdZiY^Wk+%&."pkhLehWkÔW][ 8_jj[X[ij[bb[dI_[_c8kY^^WdZ[beZ[hl[hiWdZaeij[d\h[_kdj[h mmm$decei#i^ef$Z[ Die Autorinnen und Autoren D&E Heft 58 · 2009 Stafflenbergstraße 38, 70184 Stuttgart Telefon 0711/164099-0, Service -66, Fax -77 [email protected], www.lpb-bw.de Direktor: Lothar Frick Büro des Direktors: Susanne Krieg/Thomas Schinkel/Sabina Wilhelm Stellvertretender Direktor: Karl-Ulrich Templ Stabsstelle Marketing Leiter: Werner Fichter Öffentlichkeitsarbeit: Joachim Lauk -60 -62 -40 -63 -64 Abteilung Zentraler Service Abteilungsleiter: Günter Georgi -10 Haushalt und Organisation: Gudrun Gebauer -12 Personal: Sabrina Gogel -13 Information und Kommunikation: Wolfgang Herterich -14 Siegfried Kloske, Haus auf der Alb, Tel.: 07125/152-137 Abteilung Demokratisches Engagement Abteilungsleiter/Gedenkstättenarbeit: Konrad Pflug* -30 Politische Landeskunde: Dr. Iris Häuser* -20 Schülerwettbewerb des Landtags: Monika Greiner* -25 Thomas Schinkel* -26 Frauen und Politik: Beate Dörr -29 Jugend und Politik: Angelika Barth* -22 Freiwilliges Ökologisches Jahr: Steffen Vogel* -35 Alexander Werwein*/Charlotte Becher* -36/-34 Stefan Paller* -37 Abteilung Medien und Methoden Abteilungsleiter/Neue Medien: Karl-Ulrich Templ -40 Politik & Unterricht/Schriften zur politischen Landeskunde Baden-Württembergs: Dr. Reinhold Weber -42 Deutschland & Europa: Jürgen Kalb -43 Der Bürger im Staat/Didaktische Reihe: Siegfried Frech -44 Politische Bildung Online/E-Learning: Susanne Meir -46 Politische Bildung Online: Jeanette Reusch-Mlynárik, Haus auf der Alb, Tel.: 07125/152-136 Internet-Redaktion: Klaudia Saupe -49 Außenstelle Freiburg Bertoldstraße 55, 79098 Freiburg Telefon: 0761/20773-0, Fax -99 Leiter: Dr. Michael Wehner Jennifer Lutz -77 -33 Außenstelle Heidelberg Plöck 22, 69117 Heidelberg Telefon: 06221/6078-0, Fax -22 Leiter: Wolfgang Berger Alexander Ruser -14 -13 Außenstelle Tübingen Haus auf der Alb, Hanner Steige 1, 72574 Bad Urach Telefon: 07125/152-133, -148; Fax -145 Leiter: Rolf Müller Klaus Deyle Projekt Extremismusprävention Stuttgart: Stafflenbergstraße 38 Leiterin: Tina Schmidt-Böhringer Assistentin: Regina Bossert -135 -134 -81 -82 * Paulinenstraße 44–46, 70178 Stuttgart Telefon: 0711/164099-0, Fax -55 LpB-Shops/Publikationsausgaben Bad Urach Hanner Steige 1, Telefon 07125/152-0 Montag bis Freitag 8.00–12.00 Uhr und 13.00–16.30 Uhr Abteilung Haus auf der Alb Tagungszentrum Haus auf der Alb, Hanner Steige 1, 72574 Bad Urach Telefon 07125/152-0, Fax -100 www.hausaufderalb.de Abteilungsleiter/Gesellschaft und Politik: Dr. Markus Hug Schule und Bildung/Integration und Migration: Robert Feil Internationale Politik und Friedenssicherung/ Integration und Migration: Wolfgang Hesse Europa – Einheit und Vielfalt: Dr. Karlheinz Dürr Bibliothek/Mediothek: Gordana Schumann Hausmanagement: Nina Deiß Außenstellen Regionale Arbeit Politische Tage für Schülerinnen und Schüler Veranstaltungen für den Schulbereich Freiburg -146 -139 -140 -147 -121 -109 Bertoldstraße 55, Telefon 0761/20773-10 Dienstag und Donnerstag 9.00–17.00 Uhr Heidelberg Plöck 22, Telefon 06221/6078-11 Dienstag, 9.00–15.00 Uhr Mittwoch und Donnerstag 13.00–17.00 Uhr Stuttgart Stafflenbergstraße 38, Telefon 0711/164099-66 Montag und Mittwoch 14.00–17.00 Uhr Newsletter »einblick« anfordern unter www.lpb-bw.de/newsletter.html DEUTSCHLAND & EUROPA IM INTERNET D & E-Hefte finden Sie zum kostenlosen Download (ab 2006 auch mit methodisch-didaktischen Hinweisen) im Internet unter www.deutschlandundeuropa.de Einzelhefte 3,– EUR, Abonnements für 6,– EUR pro Jahr (2 Hefte) BESTELLUNGEN Alle Veröffentlichungen der Landeszentrale (Zeitschriften auch in Klassensätzen) können schriftlich bestellt werden bei: Landeszentrale für politische Bildung, Marketing, Stafflenbergstraße 38, 70184 Stuttgart, Telefax 0711.164099-77, [email protected] oder direkt im LpB-Webshop: www.lpb-bw.de/publikationen.html. Bitte beachten Sie die Lieferbedingungen: Ab 1 kg gehen die Versandkosten zu Lasten des Bestellers. www.lpb-bw.de