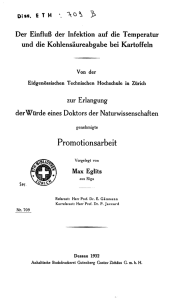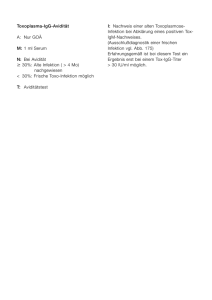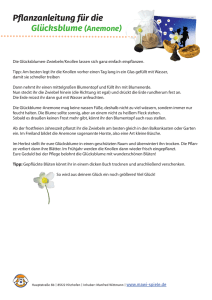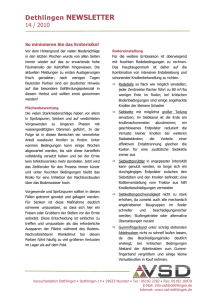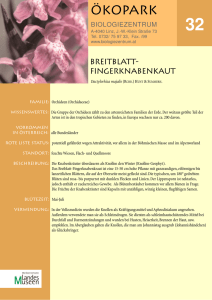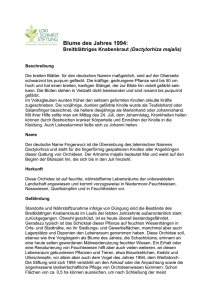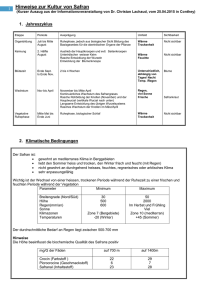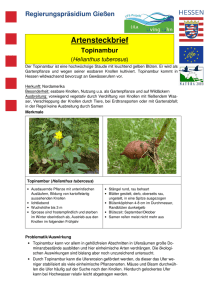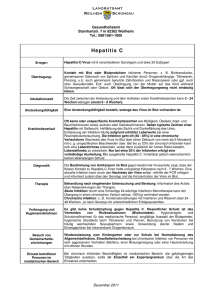dspace cover page - ETH E
Werbung

Research Collection
Doctoral Thesis
Der Einfluss der Infektion auf die Temperatur und die
Kohlensäureabgabe bei Kartoffeln
Author(s):
Eglits, Max
Publication Date:
1932
Permanent Link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000092032
Rights / License:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted
This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more
information please consult the Terms of use.
ETH Library
Diss.
E T H
\
~\S\
>
Der Einfluß der Infektion auf die
und die
Kohlensäureabgabe
Temperatur
bei Kartoffeln
Von der
Eidgenössischen
Technischen Hochschule in Zürich
zur
Erlangung
der Würde eines Doktors der Naturwissenschaften
genehmigte
Promotionsarbeit
Vorgelegt
Max
aus
von
Eglits
Riga
$£f.
Referent: Herr Prof. Dr. E. Gäumann
Korreferent: Herr Prof. Dr. P.
Jaccard
Nr. 709
Dessau 1932
Anhaltische Buchdruckerei
Gutenberg Gustav
Zichäus G.
m.
b. H.
Aus dem Institut für
der
Eidg.
spezielle
Botanik
Technischen Hochschule in Zürich.
Direktor: Prof. Dr. B. Gäumann.
Der Einfluß der Infektion auf die
und die
Kohlensäureabgabe
Temperatur
bei Kartoffeln.
Von
Max
Eglits, Eiga, Lettland.
Mit 34
1.
Textabbildungen.
Einleitung.
Die
der
Literatur noch
356
und
Temperaturveränderungen bei infizierten Pflanzen sind in
wenig behandelt. Fischer und Gäumann, 1929, S.
357, nennen die Arbeit Evans als den einzigen Beleg für
Auftreten
von
M. P.
Fieberzuständen
Evans, 1922,
steigerungen bei von
zustand sei
nur
S.
bei
erkrankten
480—481, berichten
Pflanzen.
das
I. B. P. und
über wesentliche
Temperatur¬
digitatum befallenen Orangen. Der Fieber¬
Geweben eingetreten.
In Vorbehalt einer
Pénicillium
bei lebenden
ausführlicheren
Abhandlung verzichtet Evans auf die zahlenmäßige An¬
gabe
Temperaturmessungen. Die Beobachtungen sind mit Queck¬
silberthermometern durchgeführt worden.
Ein weiterer Bericht über die
Beobachtungen Evans ist leider aus der Literatur nicht zu entnehmen.
Auch Fr. Tobler, 1931, S. 414, erwähnt Temperaturerhöhungen, die unter
Einfluß von Giftwirkung eines Parasiten, in Blättern beobachtet seien.
Ausführlicher ist das Wundfieber der Pflanzen behandelt. Abgesehen
den älteren Autoren, sei hier auf die Arbeit H. Thiessens, 1912.
von
S. 53—106, hingewiesen, die ein eingehendes Studium über das Auftreten
von Wundfieber bei Kartoffeln, Möhren und Äpfeln umfaßt.
Über die Atmung verletzter oder von parasitischen Pilzen befallener
Pflanzen liegen mehrere Beobachtungen vor.
Fischer und Gäumann.
S.
kurze
bieten
eine
Zusammenfassung über diese Arbeiten.
354—356,
1929,
Es sei beobachtet, daß von Endoparasiten befallene Pflanzen wesentlich
größere Kohlensäuremengen ausscheiden, als die gesunden. Diese Er¬
scheinung könne auch durch Fernwirkung hervorgerufen werden. Die
Ektoparasiten hätten in den beobachteten Fällen Hemmung der Bespirader
tion in den kranken Geweben verursacht.
Veranlassung von Herrn Prof. Dr. E. Gäumann habe ich, unter
Leitung, im Sommersemester 1930, mit den Temperaturmessungen
bei kranken Pflanzen begonnen. Infolge meiner Dienstverhältnisse konnte
das Thema nicht ohne Unterbrechung bearbeitet werden, da ich, zur AusAuf
seiner
Max
344
Eglits:
Übung meiner Dienstpflichten
an der Lettländischen Universität, die Winter¬
verbringen mußte. Auch die methodischen Studien
Anspruch. Erst im Sommersemester 1932 konnte
semester in der Heimat
nahmen viel Zeit
in
die Arbeit in Zürich
zum
Abschluß
gebracht werden.
Ich
die
benutze
angenehme Gelegenheit, Herrn Prof.Dr.E. Gäumann meinen ergebensten
Dank für die lebhafte Teilnahme und das
meiner
Durchführung
Arbeit
auch den Herren Prof. Dr. P.
Obergärtner 0.
Riet h
hier
Scherrer,
und
mann
gebensten
bestens
unterstützten,
Dank
Eidg.
der
Riga
0.
Ratschlägen
ter, Dr. 0. Jaag,
Schibli,
Hochschule
für die mir
die
mich
oder behilflicher Tat
Zuletzt
gedankt.
Technischen
Lettländischen Universität in
Dr. M. Fur
Laboranten
während meiner Arbeit mit wertvollen
freundlichst
große Entgegenkommen bei der
darzubringen. Es sei hier
nochmals
noch
meinen
in Zürich
und
er¬
der
gebotene Arbeitsmöglich¬
keit und materielle Hilfe.
Die
Fragestellung
zur
Durchführung
meiner Arbeit
läßt
sich
auf
zwei Punkte zusammenfassen:
folgende
1. Gibt
Temperaturveränderungen bei erkrankten Pflanzen?
es
2. Stehen diese mit der
Kohlensäureabgabe
Apparatur
2.
in
Zusammenhang?
und Arbeitsmethode.
Die Versuche wurden im Raum mit konstanter
geschosse
Abb.
neuen
bestand
1,
trische
des
aus
Heizung
gehalten
werden
drähten,
denen
können.
Kleine
Versuchshauses
Temperatur im Erd¬
durchgeführt. Der Versuchsraum,
zwei Dunkelzimmern, deren Temperatur durch elek¬
mit automatischer
konnte.
noch
Die
Schaltvorrichtung auf 20° C konstant
Heizkörper bestanden aus Widerstands¬
Widerstandsbrücken
vorgeschaltet waren, um
Erwärmung der Heizkörper entsprechend den Bedürfnissen regulieren
nicht
Temperaturschwankungen,
die
gewöhnlich 0,ü— 0,4°
überschritten, konnten nicht ganz vermieden werden.
die
zu
C
Diese hatten
Ergebnisse keinen wesentlichen Einfluß, da die Versuchs¬
objekte und die Apparatur noch besonders, vor Temperaturschwankungen
geschützt, untergebracht waren. Ein Ventilator, der im Schaltzimmer
aufgestellt war und für die Zirkulation der Luft in den beiden Räumen
aber
auf
die
sorgte, half wesentlich, die Konstanz
der
Temperatur zu erhalten.
Temperaturmessungen wurden in der Weise durchgeführt, daß
man die Temperaturveränderungen
in den erkrankten Geweben auf die
der
Temperatur
gesunden Gewebe, als auf den Nullpunkt, bezog. Für
die Messungen wurde ein Drehspulspiegelgalvanometer mit Vorsatzlinse
der Firma Hartmann & Braun, Frankfurt a. M., mit wagerechter, licht¬
starker Ablesevorrichtung, bestehend aus 6 Volt Ableselampe, Skalenhalter
auf hufeisenförmigem Fuß, Cellonskalaund Kleintransformator für 220/6 Volt
gewählt. Die Stromempfindlichkeit des Galvanometers betrug 130 x 10~lü
Ampère je 1 mm der Skalateilung in Entfernung von 1 m. Um das GalDie
Dei Einfluß der Infektion auf die
Feuchtigkeit
\anometer vor
mußte
ausgeführt wurden,
welcher
vorne
Seite
eine
zu
es
in einem dicht verschließbaren
war
war,
den Kasten
Abb
Galvanometer,
E
mehrere Male mit
Bohrungen
dichten
Erdgeschoß
Eternitkasten,
werden.
Die
Abschluß
mit
der Deckel
konnte
und außen
war
dicht
der Kasten
1
Versuchszimmer, B Schaltzimmer, C Versuchskasten,
Quecksilbei^chaltrohren, F Skala mit Ableselampe, G Ventilator
A
Asphaltlack bestrichen.
meter waren auf einem
Die
zum
Mit Flugelschrauben
geschraubt werden. Von innen
Grundriß des Versuchsraumes.
D
untergebracht
und
abnehmbar
Gummistreifen versehen.
an
345
usw.
da die Versuche im
schützen,
mit Glasfenster versehen
des Kastens
Tempeiatur
fur
Der Kasten und das Galvano¬
massiven, erschütterungsfreien Steintisch montiert.
Durchleitung der Thermoelemente wurden mit
die
Schiffskitt dicht verschlossen.
Um
die Luft
im Kasten dauernd trocken
erhalten, mußten mehrere Glasschalen mit Chlorkalzium in den Kasten
gestellt werden. Die Cellonskala war im Brennpunkte der Vorsatzlinse
zu
des Galvanometers
eines
Planspiegels
eingestellt.
an
lichtes rundes Feld
Ablesungen wurden
der
mit
Beleuchtungsvorrichtung
Galvanometerspule wurde auf der Skala
Vermöge
einem
mit einer
der
dünnen dunklen
Lupe,
mit
Strich
Genauigkeit
bis
reflektiert.
1/10
und
ein
Die
der Skala¬
teilung durchgeführt.
Die Thermoelemente bestanden
stantandrähten mit zwei Lötstellen.
aus
umsponnenen
Kupfer-
Der Durchmesser des
und Kon-
Kupferdrahtes
Max Eglits:
346
betrug meist 0,2 mm, der des Konstantandrahtes
stand in den
ungefähr
Leitungen
der Thermoelemente
0,3
Der Wider¬
mm.
annähernd 3
war
dem inneren Widerstand des Galvanometers
Ohm,
was
Um die
entsprach.
Leitungen der Thermoelemente vor störenden Einflüssen der Feuchtig¬
keit zu schützen, wurden die Drähte durch siedendes Bienenwachs ge¬
zogen und darauf mit Schellack bestrichen.
Schellack,
mit stark verdünntem
was
von
Die Lötstellen bestrich
Zeit
zu
man
Zeit wiederholt werden
mußte.
Um
zu
gleicher Zeit mit
elementen arbeiten
mußten
und Thermo¬
Versuchsobjekten
mehreren
können,
zu
die Thermoelemente
mit Schalt¬
vorrichtungen
versehen werden.
Man benutzte
zweierlei Schalt¬
einen
apparate:
oder mehrere
Kupferschalter
Quecksilberschalt¬
röhren.
Der
aus
Kupferschalter
zehn auf einer
im Kreise
Abb. 2.
Hälfte natürlicher Größe.
Quecksilberschaltröhre.
A
Quecksilberschaltröhre.
C Wasserstoff.
D
Kupferdraht.
Thermoelementes.
H Kork.
B
Glasrohr.
F
I Drahtöse
zum
Quecksilber.
E
Leitung
G
Anhängen
des
Paraffin
der Eöhre.
Furnierkästchen,
versehene Drehscheibe befand.
war
die
der Deckel
Nummern
des Kästchens
der
Ebonitplatte
angeordneten kupfer¬
nen
Kontaktknöpfen. Unterhalb
der
Kontaktknöpfe
befand sich
ein radiärer Kupferhebel, welcher
beim Drehen der Reihe nach die
einzelnen
Meßpunkte
mit
dem
Galvanometer verband. Die Kon¬
taktvorrichtung
mit der Ebonit¬
platte befand sich
verschlossenen
bestand
in einem dicht
über dessen Deckel sich eine mit
Entsprechend
mit
Thermoelemente
der
Lage
einem Zifferblatt
der
Zeiger
Kontaktknöpfe
versehen,
welches
der Schalter immer
anzeigte.
Kupfer mit Kupfer verband, war seine positive Eigenschaft, daß er bei
Temperaturschwankungen im Schaltzimmer nicht als „Thermoelement-'
wirkte. Er gab aber nicht immer genügenden Kontakt infolge Erschlaffung
der Feder, die den radiären Hebel an die Kontaktknöpfe drückte. Diese
Feder
war
angebracht.
am
Da
unteren Ende der senkrechten Achse des radiären Hebels
Um diesen Defekt
vermeiden, benutzte man bei vielen
Messungen
Kupferschalters Quecksilberschaltröhren (Abb. 2). Die
Länge der Eöhren A betrug 40 mm, der Durchmesser 4 mm. Die Eöhren
enthielten chemisch reines Quecksilber B in Wasserstoffatmosphäre C.
Seitlich, an jedem Ende der Eöhre, war je ein Kupferdraht D eingeschmolzen,
dessen Ende aus der Röhre herausragte.
An diesen wurden die Kupfer¬
leitungen E des entsprechenden Thermoelementes gelötet. In wagerechter
Stellung gab die Röhre Kontakt mit dem Galvanometer, bei senkrechter
statt des
zu
Temperatur
Der Einfluß der Infektion auf die
347
usw.
Bei
gewissen Tem¬
peraturschwankungen im Schaltzimmer wirkten die Quecksilberschaltröhren
als schwache Thermoelemente. Um diese Störungen zu beseitigen, wurden
die Röhren in Glaszylinder F gestellt und in Paraffin G eingebettet. Die
Stellung
der Durchmesser 4
Länge der Zylinder betrug 10,
waren
bei
Die Schaltröhren
cm.
passendes Gestell montiert.
auf ein
Um die
was
ausgeschaltet.
das betreffende Element
war
Galvanometers
des
Nullpunktverlagerungen
einseitigen Ausschlägen
Galvanometer in den Zeitspannen
andauernden,
starken
Man füllte
folgendermaßen durchgeführt.
zwei dickwandige Vegetationsgefäße aus Steingut von 6 1
Die Temperatur des Wassers wurde annähernd auf
Wasser.
Die
werden.
Eichungen
Darauf stellte
gestellt.
meter mit Meßbereich
Die
C
°
annähernd
wurden bei stufenweiser
Vor
Quecksilbersäulen festgestellt.
metern mischte
man
der
Steigerung
Temperatur
sie
Darauf
entsprachen.
des Wassers
an
beiden
die Niveaudifferenzen der
und
jeder Ablesung
gründlich
das Wasser
der Skala.
eingestellt, daß
so
Skala
der
Nullpunkte
Ablesungen gemacht
Thermometern 20—40
20° C ein¬
Hundertstelgradteilungen
5° C und
dem
mit
Inhalt
in das eine Gefäß zwei Beckmann-Thermo¬
man
der Thermometer wurden
Quecksilbersäulen
bei 20
wurden
von
den
empirisch geeicht
mußte
der Thermoelemente
Empfindlichkeit
einsetzen
zwischen
können, wurde das
Messungen immer stromfrei gehalten.
Die
vermeiden,
zu
hätte
beiden Thermo¬
an
mit einem Stabe. Die Tausendstel¬
Angenommen, daß bei einer ge¬
wissen Einstellung Beckmann-Thermometer Nr. 1 bei gleichen Temperatur¬
verhältnissen durchschnittlich um 0,228° C niedrigere Werte angab als
die
zu
den
Auswertungen
Bei den
Beckmann Nr. 2.
Falle
Lupe geschätzt.
mit der
grade wurden
Werten
richtigen Werte
zu
Danach
erhalten.
Eichung
tauchte
die
Ruhelage
ihr Gefäß.
rührte das Wasser
Die
Temperaturen
gründlich
Darauf versetzte
des Galvanometers.
des Wassers
heißen
in
man
Hinzufügen
gleicher
Zeit in beiden Gefäßen. Nach
des Galvanometers
schlag
der Skalateilungen wurden
man
die
Ablesungen
grade schätzte
man
an
mit
Thermometern machte
jeder Eichung wurden
an
mit der
der
Die
zu
abgelesen werden.
Die Zehntel
Gleich darauf machte
Ablesungen
an
Die Tausendstel¬
den Beckmann-
ansteigender Quecksilbersäule. Bei
Ablesungen gemacht, mit fünf Ausschlägen
immer bei
stets zehn
Pipette,
das Wasser
Sekunden konnte der Aus¬
Lupe geschätzt.
Lupe.
das
und
einer
aus
man
Beckmann-Thermometern.
den
man
einigen
der Skala
in
prüfte
jede Lötstelle in
um
beiden Gefäßen wurden
Wassers
einiger Tropfen
stufenweise gesteigert. Vor jeder Ablesung mischte
durch
um
jedes BeckmannZu Beginn
man
beide Lötstellen des Thermoelementes
man
Gefäßes,
Wasser des einen
stellte
dem
die Thermoelemente.
Thermometer in sein Gefäß und eichte
der
Messungen mußten in
°
0,028 C addiert werden,
der
des Beckmann Nr. 1
nach rechts und fünf nach links.
JEglits :
Max
348
der Thermoelemente erläutern.
Beispiel soll die Berechnung'der Empfindlichkeit
Nullpunkt des Galvanometers 300 mm.
Ein
Ablesung von
Ausschlag des
der Skala
379,2
Galvanometers
mm.
Beckmann Nr.
79,2 mm.
1, 0,816° + 0,228° Niveaudifferenz
Beckmann Nr.
2, 0,929
Temperaturdifferenzen
Empfindlichkeit
°
=
des Wassers
0,115
=
Thermoelementes
des
1,044° C.
=
C.
C.
°
0,115°
=
:
79,2
je
C
0,00145°
=
1
mm
der
Skalateilung.
Der Mittelwert zehn solcher
Bestimmungen ergab
die
des Thermo¬
Empfindlichkeit
elementes.
Nach beendeter
mit
-f und
—
Eichung
Zeichen.
bei
gesteigerter Temperatur
die,
welche den
Ausschlag
wurden bei allen
oder
versah
Ausschlag
den
nach links
Messungen
die
dagegen
kamen in
Lötstelle,
gab,
rechts
Um Fehler
erzeugte.
als
zu
oder
welche
—
Pol
vermeiden;
den Infektionsstellen
an
die
Versuchsobjekte angebracht,
gesunden Gewebe
die
die
man
nach
+ Pole immer
die infizierten Hälften der
an
die Pole der Thermoelemente
man
Als + Pol bezeichnete
Pole
—
sterilen Hälften
die
der
Objekte.
Bei den
Verhältnisse
Sonst
war.
Temperaturmessungen galt
zu
bei
versetzen,
könnten
es.
welchen
eventuelle
die
die
Temperatursteigerungen
Transpiration ausgeglichen werden. Dieses erzielte
sättigung der Luft. Man stellte die Versuchsobjekte
schließbaren Kasten.
75
aus
5
Die Innenmaße des Kastens
Breite und 100
cm
mm
Die
eine Ende des Kastens
Öffnungen
von
von
15 x 20
15 x 15
bestanden
herausnehmbar.
sich ein mit Glasscheibe und
bares Fenster
erhöhte
durch Wasser¬
einen dicht
in
100
betrugen
aus
cm
ver¬
Länge,
und zwei
dicke Kork¬
Das
In einer Seitenwand befanden
gleichfalls
Oberwand
Die
mm
Furnierplatten.
herausnehmbarem Deckel
cm
cm.
durch
man
Darauf folgte eine 5
Außenwände
war
ausgeschaltet
Die Innenwände des Kastens bestanden
Eternitplatten.
starken
isolationsschicht.
Höhe.
cm
in solche
Versuchsobjekte
Transpiration
des
dicht verschlie߬
verschließbare
dicht
Kastens
bestand
aus
starkem
Spiegelglase, über das ein Deckel mit Korkisolation lag. Die
letzte Vorrichtung war für solche Versuche vorgesehen, die bei Belichtung
durchgeführt werden sollten. Die Ränder aller herausnehmbarer Teile
waren
an
mit starken Gummistreiien versehen und mit
den Kasten anschließbar.
Flügelschrauben
In den Wänden des Kastens
waren
dicht
mehrere
mit
Korkstopfen verschließbare Bohrungen für den Tubus des Quecksilber¬
thermometers, die Leitungen der Thermoelemente und die Bohren der Luft¬
leitung.
Im Versuchskasten stand ein Wasserbehälter
Größe 95
x
73 x 5
platte bedeckt
aus
Holzstäben
war.
mit
cm
betrug
Zinkblech,
dessen
Parallel den Wänden des Kastens stand ein Gerüst
Fließpapier.
Die
unteren Ränder
ragten in das Wasser des Behälters hinein.
die
aus
der mit einer durchlochten Zinkblech¬
und
Wasserdampfsättigung
der Luft
zu
des
Fließpapieres
Um nach Abschluß des Kastens
beschleunigen,
war
an
der heraus-
Der Einfluß der Infektion auf die
nehmbaren
Wand des Kastens
Ende in den
auch Schutz
im
Der Kasten bot
kleine,
ermöglichte,
Versuchsraume und
Dunkelheit
Temperaturschwankungen
Objekte dauernd in vollständiger
die
halten.
zu
sich,
Schon bei den ersten Versuchen erwies
nötige Wasser¬
daß die
der Luft des Versuchskastens mit beschriebener Vorrich¬
dampfsättigung
tung nicht
angebracht, dessen
den Versuchsobjekten
vermeidbare
nicht
gegen
349
usw.
ein Wasserverstäuber
hineinragte.
Kasten
Temperatur
ganz erreicht werden
ferneren Versuchen ein
Verbandstoffkammer.
konnte, deshalb
jedes Objekt
versetzte
man
in eine kleine feuchte
bei allen
Drahtgitter-
Bei halbierten Knollen kamen beide Hälften einer
Knolle in dieselbe Kammer.
Abb. 3.
A
Drahtgitter-Verbandstoffkammer. Hälfte natürlicher Größe.
E Versuchsobjekt.
Drahtgitterzelle. B Glasschale. C Korkstopfen. D Glasplatte.
F Thermoelemente.
Die feuchte
bestrichenen
Kammer,
G Verbandstoffdecke.
Abb.
Drahtgitterzelle A,
füllte Glasschale B diente. In der
sich eine auf vier
Versuchsobjekt
E
bestand
der als
Zelle,
aus
Unterlage eine mit
oberhalb des
man
Drahtgitterzelle
die
Schicht wasserdurchtränkten Verbandstoffes G.
und
dung mit dem Wasser H in der Schale
im Innenraum der Zelle.
untergebracht.
Als Versuchsobjekte
sunde, halbierte gesunde,
Wasser ge¬
Wasserspiegels, befand
C
elementen F versehen war, bedeckte
sättignng
einer mit Aluminiumlack
gestützte Glasplatte D, auf der
Nachdem das Versuchsobjekt mit
Korkstopfen
stellte.
3,
H Wasser.
für die
ganze
Dieser
bot die
mit
man
das
Thermo¬
doppelter
stand in Verbin¬
nötige Wasserdampf-
Die Zellen wurden im Versuchskasten
Temperaturmessungen dienten ganze
infizierte,
halbierte
an
ge¬
der einen Hälfte
350
Max
Eglits:
infizierte und halbierte mit Chloroformnarkose
Hälfte
infizierte
Kartoffelknollen.
Thermostaten bei +6
8
°
Der
abgetötete
Vorrat
der
der
an
Knollen
einen
wurde
C aufbewahrt. Für Infektionen
im
gebrauchte
phytophthorus von Kulturen auf Kartoffelsaft-Glnkose-Peptonagar.
Das Prinzip der Kohlensäuremessungen bestand
darin, daß man
—
man
Bacillus
kohlensäurefreie Luft
Dort wurde die
und in
schuß
durch die
Rezipienten
der
ausgeschiedene Kohlensäure
von
Versuchsobjekte
leitete.
der Luft
aufgenommen
Absorptionsgefäßen durch Barytlauge gebunden. Den Über¬
Lauge titrierte man mit Salzsäure zurück und bestimmte die
den
an
-Ar
Abb. 4.
Kohlensäurerezipient.
A
Glasglocke,
ß
Plangeschliffener
Hälfte natürlicher Größe.
Rand.
C Glasröhren.
D Kanüle.
E Tubu<..
Menge der abgegebenen Kohlensäure.
Da bei diesen Versuchen zu
gleicher
gleichen Objekten auch die thermischen Vorgänge festgestellt
werden sollten, mußte die Apparatur für
Temperatur- und Kohlensäure¬
Zeit und
an
messungen unter ein
Die
gemeinsames System gebracht werden.
nötige Druckluft erzeugte man mit einem Wasserstrahlgebläse
nach
Stuhl,
mit Windkessel
zum
Gebläse
wurde
und
Wasserabfluß-ßegulierhahn.
Freien
vom
zugeleitet.
passierte die Luft durch eine Gaswaschflasche mit
eine
Flasche
mit
Kaliumpermanganatlösung,
stopfen dicht verschlossene Vorratsflasche
in
das
keiten
des Luftdruckes
möglichst
war.
am
man
um
auszugleichen.
des Luftstromes
eine
5 1 Inhalt.
Man
mittelst
eines
Der beschriebene Teil
Gummi¬
mußte
Unregelmäßig¬
erlangte
dieses
Quetschhahues,
hinter der Vorratsflasche angebracht
der Luftleitung befand sich außerhalb des
im Versuchsraum.
in den Versuchskasten.
ferner die Luft
mit
Diese
die
dickwandigen Vakuumschlauch
Versuchskastens,
Leitung
Wasserstrahlgebläse
Kalkmilch, dieser folgte
danach
Luftleitungssystem eingeschaltet werden,
durch starkes Abdrosseln
der
von
Die Luft
Vom
Durch
Zur
eine Glasröhre
Entfernung
gelangte
die
der Kohlensäure leitete
durch vier Jenaer Gaswaschflaschen
mit Kalilauge.
Lauge betrug in der ersten Flasche 20°/0, in den
folgenden 30, 40 und 50 °/0. Die von Kohlensäure gereinigte Luft
mußte,
um die
Temperaturmessungen durchführen zu können, mit WTasserdampf
gesättigt werden. Zu diesem Zweck leitete man die Luft durch vier mit
Die Konzentration der
abgekochtem, destilliertem,
Gaswaschflaschen.
An
kohlensäurefreiem WTasser
diese
kam
ein
versehene
Jenaer
entsprechend gebogenes Glasrohr.
Der Einfluß der Infektion auf die
an
Temperatur
das sich der Laftstromverteiler anschloß.
pienten,
an
die die halbierten Knollen
Darauf
angebracht
351
usw.
folgten zwei Rezi¬
wurden.
Der
Rezipient, Abb. 4, bestand aus einer kleinen, dickwandigen Glas¬
glocke A mit plangeschliffenem Rande B. Der Innendurchmesser war bei
allen Glocken der gleiche und betrug 19,5 mm.
Jede Glocke war mit
zwei seitlich angeschmolzenen Glasröhren C versehen, die am Luftstrom
Anschluß fanden.
Am
gewölbten Teil der Glocke befand sich
eine
schmale
Kanüle D für die
Leitung des Thermoelementen und ein kleiner mit ein¬
geschliffenem Glasstöpsel versehener Tubus E, durch den die Infektion
ausgeführt werden konnte. Das Versuchsobjekt wurde am plangeschliffenen
Rande des Rezipienten mit Zelluloid-Azetonkitt fest angekittet.
Um die
Haftbarkeit des Kittes zu steigern, mußte die äußere Glockenwand, an¬
liegend dem plan geschliffenen Rande, matt geätzt werden.
Bei jedem Versuch standen zwei Rezipienten mit beiden Hälften
einer Knolle in Betrieb.
Die Infektion wurde innerhalb des Rezipienten
mit vier etwa 2 mm tiefen Stichen mit einer langen Nadel an der einen
Hälfte der Knolle durchgeführt.
Die andere Hälfte erhielt vier gleiche
sterile Stiche.
elementen
Die beiden Hälften einer Knolle wurden mit drei Thermo¬
verbunden, wobei die + Pole immer
angebracht waren,
die
—
Pole
an
den
an
gesunden.
der infizierten Hälfte
Ein Thermoelement
verband die Gewebe
innerhalb der Rezipienten, zwei wurden außerhalb
derselben, in bestimmter Entfernung von einander angebracht. Die Glas¬
stöpsel, ebenso die Kanülen für die Thermoelemente, wurden zuletzt mit
Krönigschem Glaskitt, bestehend aus einem Teil weißen Wachses und
vier Teilen
fand auch
Kolophonium, luftdicht verkittet.
Anwendung
zum
luftdichten
Der Krön
Verschluß
der
ig sehe Glaskitt
Gaswaschflaschen
Absorptionsgefäße.
und der
Beide Rezipienten mit den
angekitteten Versuchsobjekten stellte man
Drahtgitter-Verbandstoflkammer, die gleichfalls im Ver¬
suchskasten untergebracht war. Auf diese Weise konnten die Temperatur¬
in
eine
feuchte
messungen
an
den Geweben auch außerhalb der
unternommen werden. Die
an
die
Absorptionsgefäße.
Um
mußte
vor
die
Rezipienten
Diese
Geschwindigkeit
Störungen
Glasrohrleitung Anschluß
ohne
standen außerhalb des Versuchskastens.
des Luftstromes genau einstellen
jedem Absorptionsgefäß ein
eingeschaltet werden.
Rezipienten
fanden mit
kurzes
Die Schläuche wurden mit
zu
können,
Stück Vakuumschlauches
Präzisionsquetschhähnen,
gl, 1930, S. 27, bis zur erwünschten Luftstromgeschwindigkeit ab¬
gedrosselt. Zur Verbindung der einzelnen Elemente des Luftstromsystems
oder zur Durchleitung der Luft bediente man sich dickwandiger Vakuum¬
schläuche, die nach Pre gl, 1930, S. 56, mit roher Vaseline im Vakuum
imprägniert waren.
Die Absorptionsgefäße, Abb. 5, die zugleich auch zum Titrieren der
Absorptionsflüssigkeit dienten, bestanden aus einem 260 mm langen GlasPre
Max
352
rohr A
seitlich
Innendurchmesser,
aufgeblasene Halbkugel B mit
7
von
geschliffenen
mm
einem
Die eine Köhre
der Luft
Rezipienten.
vom
seitlich
eine
ein¬
ein¬
verschließbaren,
den Glasstöpsel
dicht
Durch
war.
D, deren Innendurchmesser 1,5
Absorptionsgefäßes und diente
mündete im untersten Teil des
Zuleitung
dessen oberem Ende
an
Glasstöpsel C angeschmolzen
verliefen zwei Köhren.
betrug,
Eglits:
Die
Mündung
E dieser Röhre
mm
zur
war
und ihr Lumen bis auf annähernd
gebogen
Infolgedessen wurde die in
Absorptionsflüssigkeit hineintretende Luft
gegen die Wand des Gefäßes gepreßt und in kleine
Bläschen zerspalten, die dann langsam in der
Absorptionsflüssigkeit emporstiegen. Das äußere
Ende F des Luftzuleitungsrohres war weitlumiger
und mit einem Dreiwegehahn G versehen.
Das
Absorptionsgefäß konnte infolgedessen an den
Luftstrom angeschlossen werden, ohne sofort die
0,2
mm
verschmälert.
die
Luft
zu
in
das Gefäß hineinleiten
müssen,
zu
Beginn des Versuches erwünscht
den
Glasstöpsel verlief gleichfalls
die
auf Hundertstel Kubikzentimeter
H für die Titrationssäure.
der
Halbkugel
war
eine
man
die
was
Durch
Mündung einer
geteilten Bürette
An der flachen Seite
schräg verlaufende mit
Glashahn versehene Röhre J
die
war.
angeschmolzen, durch
Absorptionsflüssigkeit aus einer auto¬
Pipette mit einer spitzgezogenen
matisch füllbaren
Mündung
und
derselben
Röhre
geschmolzen,
den
Indikator
war
ein
welches
hineinführte.
Natronkalkrohr K
den
Ausgleich
druckes beim Hineinführen der Säure
Der Aufbau des
Abbildung
Da
man
bediente
in
zu
man
Absorptions-
und
Vor dem
reinigt,
ist
besten
am
Über¬
ermöglichte.
aus
der
ersehen.
die
Kohlensäurebestimmungen
sich vier solcher Gefäße.
Betrieb, weitere zwei wurden
fünftes Gefäß
Titrationsgefäßes
des
An
an¬
war
für
kontinuierlich
durchführte,
Zwei befanden sich fortwährend
die
Messungen bereitgestellt.
Ein
Reserve.
Gebrauch
danach einmal
wurden
die
mit verdünnter
Absorptionsgefäße mechanisch
Salzsäure,
dreimal
ge¬
mit
Leitungs¬
mit
dreimal
destilliertem
und
Wasser
einmal
mit
Alkohol
gespült,
wasser,
danach mit Wärme getrocknet, der Stöpsel mit Krönigschem Glaskitt
verschlossen und von der Kohlensäure enthaltenden Luft gereinigt.
Für
die Reinigung der Gefäße benutzte man den Luftstrom einer Luftdruck¬
maschine.
Die Luft wurde auf beschriebene Weise
befreit und durch die
leeren
Absorptionsgefäße
mit
von
der Kohlensäure
einer
Geschwindig-
Der Einfluß der Infektion auf die
keit
20
von
Das Volumen
geleitet.
Minute
je
ccm
annähernd 90
Um die Kohlensäure
ccm.
Temperatur
353
usw.
Gefäße
der
enthaltende Luft
betrug
den Ge¬
aus
verdrängen, mußte das vierfache Volumen, etwa
360 ccm kohlensäurefreier Luft, durch die Gefäße geleitet werden, was
bei der genannten Luftstromgeschwindigkeit in 18—20 Minuten
man
Die Geschwindigkeit des Luftstromes bestimmte man mit
erreichte.
vollständig
fäßen
zu
Blasenzählern.
Darauf
sorptionsgefäße
gleichen Menge
der
Absorptionsflüssigkeit
angeschmolzene Köhre
Pipette beschickt.
automatischen
der
Das Volumen der
trug
Ab¬
die
immer genau
einer
mit
durch die seitlich
aus
wurden
angewandten Menge
be¬
5 ccm und ihr Titer war genau be¬
kannt. Die automatische
mit
Pipette wurde
kleinen Modifikationen nach Gaßner und
Goeze, 1932, S. 435, konstruiert.
Einzelheiten sind
die
an
bunden und die
S.
53—54,
ver¬
Luftstromgeschwindigkeit
die Minute eingestellt.
ccm
zeigt
Abb. 7
der
gl, 1930,
Pre
auf 2 bis 3
Deren
ersehen.
den Mariotteschen
und
Blasenzählern
Flaschen,
zu
AbsorptionsgeLuftleitung wurden sie mit
Anschluß
Nach
f'äße
der Abb. 6
aus
im Grundriß die
Anordnung
Apparatur.
DieAbsorptions-undTitrationsflüssigkeiten wurden nach Lieb und Krainick,
der beschriebenen
1931,
Mikroanalyse
für
in
367—384,
S.
empfohlenen Konzentrationen hergestellt.
Man benutzte
1/10
Baryumchlorid
säurefreie
n
Barytlauge, die 1 °/0
1/20 n kohlen¬
enthielt und
3
mit
Salzsäure
0/„ Baryum-
Abb. 6.
Automatische
Pipette.
A
Pipette,
B
Spitzgezogene Mündung, C Bunsenscher Verschluß, D Quetschhahn, E Ver¬
bindungsröhre mit
F Natroukalkrohr,
der Vorratsflasche,
G
Absaugflasche.
chlorid-Zusatz. Der Faktor der Säure wurde
mit Natriumkarbonat nachSörensen in Hitze mit
stimmt.
Methylrot
Barytlauge gebrauchte man
Flüssigkeiten wurden in dicht
als Indikator 1
Beim Titrieren der
Phenolphtlialeinlösung.
Die
als Indikator be¬
mit
°/0
Gummistopfen
verschlossenen und mit Natronkalkröhren versehenen Abklärflaschen auf¬
bewahrt.
3. Die
A.
Temperaturen gesunder und erkrankter Gewebe.
Temperaturmessungen
(Ausgeführt
an
Bei den nunmehr
veränderungen
zu
an
ganzen
zehn Knollen
mit 30
besprechenden
gesunden
Knollen.
Thermoelementen.]
Temperatur¬
Versuchen sollten die
in den infizierten Geweben
auf die
Temperatur gesunder
354
Max
Eglits:
Gewebe derselben
mußte deshalb
webe überall
Knolle, als auf den Nullpunkt, bezogen werden. Es
festgestellt werden, ob in einer gesunden Knolle die Ge¬
die gleiche Temperatur aufweisen.
Diese Frage ist schon
Thiessen, 1912, S. 53—106, im Zusammenhange mit den Wund¬
fiebermessungen, eingehend behandelt worden. Durch Temperaturmessungen
von
an
Äpfeln hat Thiessen festgestellt, daß
Neubildung einer Wundkorkschicht, nach 2 bis 3 Tagen beide Hälften
Objektes stets die gleichen Temperaturen aufweisen. Bei Messungen
halbierten Kartoffelknollen und
nach
eines
Ahh
Grundriß der
Apparatur
fur
Temperatur-
B und C Gaswaschflaschen mit Kalkmilch
E
7.
Kohlensauremessungen.
und Kaliumpermanganat,
und
A
D
Wasserstrahlgeblase.
Luftdruckregulatoi
Versuchskasten, F Jenaer Gaswaschflaschen mit Kalilauge, G Jenaer Gaswaschflaschen
destilliertem Wasser, H Luftstromverteiler, J Feuchte Kammer mit
Eezipienten und
Versuchsobjekten, K Absorptionsgefaße, L Blasenzahler, M Mariottesche Flaschen.
mit
an
Hälften verschiedener
hier mit
einigen
Objekte
Versuchen die
sei niemals die
Nullage eingetreten. Es galt
Ergebnisse Thiessen nochmals zu bestätigen.
Aus technischen Gründen kann das umfangreiche
Material aller
Messungen hier nicht wiedergegeben werden. Es seien die Temperatur¬
messungen an ganzen gesunden Knollen nur an Hand von drei Objekten
besprochen.
Durchführung
des Versuches.
Objekte einem Thermostaten
0,1 °/0 Formaldehydlösnng desinfiziert,
getrocknet, in die Drahtgitterkammer des Versuchskastens gestellt und
50 Stunden zum Ausgleich der Temperatur stehen
gelassen. Darauf jede
Knolle mit drei Thermoelementen versehen, Drahtgitterkammer mit wassermit +6 —8° C
entnommen,
in
Der Einfluß der Infektion auf die
durchtränktem Verbandstoff
bedeckt,
Verstäuber Wasser
Versuchskasten
mit den
in den
Ablesungen
der
355
usw.
geschlossen,
Versuchskasten
gestäubt,
mit dem
einer Stunde
nach
Galvanometer-Ausschläge begonnen.
Gbjekl-
/O
Temperatur
30
20
20
SO
fo
Objekt-
?0
00
SO
HO
//o&im/m
/OO
22
f/oS/«//ra>efi
7UO
Abb. 8.
ïemperaturkurven bei gesunden
Anlage
ganzen Knollen.
der Thermoelemente:
Beide
Objekt 20.
Pole
Thermoelementes
jedes
an
gleicher Seite
einer flachen Knolle.
Objekt
21.
+ Pole
Objekt
22.
-f- und
am
—
Kronenende,
Pole
an
—
Pole
am
Nabelende.
unterschiedlichen Seiten einer flachen
Knolle.
Objekt
Objekt
20
Objekt
21
22
Abb. 9.
Anlage
der Thermoelemente bei
gesunden
ganzen Knollen.
Hälfte natürlicher Größe.
Die Anlage der Thermoelemente ist in der Abb. 9 schematisch dar¬
gestellt. Es sei hier bemerkt, daß bei allen Messungen peinlichst ver¬
in die
mieden
wurde,
die Thermoelemente
setzen,
da bei
beginnender Entfaltung
hältnisse dort sich wesentlich ändern. Die
Phgtopath.
Z. Bd. S
Heft 4
..Augen"
der Keime
der Knollen
zu
ver¬
die thermischen Ver¬
Empfindlichkeit
der
angewandten
25
Eglits:
Max
356
betrug 0,00171—0,00178° C je
Ergebnisse der Messungen sind in Tabelle
Elemente
in Abb. 8 veranschaulichen die thermischen
1
Skalateilung. Die
wiedergegeben. Die Kurven
Verhältnisse in den Objekten 20.
der
mm
1
und 22.
Objekte 20 und 22 bieten die Normalfälle,
ständigem Temperaturausgleich nach 50 Stunden, Objekt
21
Ausnahmefall mit kleinen
0,0036
21
Temperaturdifferenzen,
die aber
mit
fast
voll¬
bildet einen
°
C nicht
überschreiten.
Tabelle 1.
Ergebnisse
der
Temperatnrmessungen
gesunden
an
Temperaturdifferenzen
Objekt
A
Th
Stunde nach der el men
1
2
3
15
16
18
20
22
24
26
39
41
43
46
48
51
63
65
67
73
111
Objekt
20
in
ganzen Knollen.
21
Objekt
22
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
Element
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,02136
0,02436
0,01424 --0.02245
0,01353
0,01740
0,00872 --0,01288
--0,00613 --0,01027
0,00374 + 0,00626
0,00320
0,00487
+ 0,00170
0,00191
0,00125
0,00087
--0,00071
0,00104
0,00071 4- 0,00104
0,00018 -j- 0,00070
--0,00053 4- 0,00052
--0,00071 -f 0,00070
--0,00036 + 0,00052
-0,00053 4- 0,00035
+ 0,00071 --0 00017
-f- 0,00036 --0,00052
4- 0,00071 --0,00070
-f 0,00053 --0,00052
-j- 0,00089 --0,00070
—
--0,01792
0,01740
0,01531
0,00974
--0,00661
0,00504
0,00452
0,00139
0,00087
--0,00070
0,00087
0,00053
0,00053
0,00035
0,00053
4- 0,00017
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
B.
—
—
—
-j-
4- 0,00070
4- 0,00035
4- 0,00035
-j-
(Ausgeführt
wie bei Versuch
0,00053
war
an
vor
1,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Beginn
Die
—
—
zehn
78
Anlage
verschieden.
am
Messungen
der
Bei den
Die
Ergebnisse
Kronenende,
der
79.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+
-f
+
-f—
—
-
—
—
—
—
—
-
—
-
—
—
—
—
-
—
-
—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Thermoelementen.)
Das
Übrige
Objekten 73, 74,
bei
79,
80 und 81
die
an
75
und
angebracht,
an
einzelnen
82
bei
waren
Objekten
den Nabelenden.
Die
dargestellt.
Empfindlichkeit
betrug 0,00146—0,00167 °C je 1 mm der Skalateilung.
Messungen sind in Tabelle 2 zusammengefaßt. Die
Kurven in Abb. 10 schildern
77 und
—
Thermoelemente
der Elemente ist in der Abb. 11
der Thermoelemente
—
0,03540
0,04702
0,03420
0,03740
0,03932
0,03454
0,03740
0,03654
0,03249
0,01938
0,02088
0,01727
0,00986
0,01044
0,00855
0,00816
0,00905
0,00872
0,00680
0,01009i— 0,00855
0,00697
0,00922
0,00616
0,00680
0,00748
0,00479
0,00680
0,00661
0,00205
0,00239
0,00357
0,00661
0,00327
0,00400
0,00205
0,00170
0,00373
0,00222
0,00208
0,00261
0,00154
0,00103
0,00139
0,00068
0,00034
0,00104
0,00120
0,00154 -f 0,00035|-|- 0,00068
0,00103 4-0,00122'4-0,00103
0,00052
0,00052
0,00034
0,00069 + 0,00033
0,00086
0,00069 -|- 0,00052
0,00120
Knollen halbiert.
die Pole der Elemente in der Mitte der Hälften
76, 77,
Anlage
-
gesunden halbierten Knollen.
an
Knollen mit 10
der
—
Beide Hälften einer Knolle mit einem Thermo¬
Abt. A.
element verbunden.
Knollen
0,00053
0,03910
0,07380
0,12340
0,05580
0,02380
0,14760
0,01870
0,04860
0,08280
0,00510
0,01224
0,02052
0,01190
0,01620
0,01404
0,01700
0,02160
0,02286
0,01700
0,01980
0,08340
0,01020
0,01800
0,02160
0,01020
0,01656
0,01872
0,01020
0,01620
0,01152
0,00629 + 0,00198
0,00360
0,00714 -j-0,00198 --0,00684
--0,00102
0,00126
0,00216
--0,00051
0,00162
0,00018
+ 0,00170 -f 0,00036 4- 0,00180
0
+
0,00360
0,00072
4- 0,00187 4- 0,00306
0,00162
4- 0,00153 -f 0,00234
0,00180
4- 0,00153 -[- 0,00018
0,00180
-)- 0,00017
0,00126
0,00270
4- 0,00442 + 0,00108 -f 0,00234
-
—
Temperaturmessungen
70 Stunden
75,
(Versuch 1.)
C.
°
Die
die thermischen Verhältnisse in den
Objekten
Der Einfluß der Infektion auf die
C.
Temperaturmessungen
an
Temperatur
mit Bacillus
ganzen,
357
usw.
phytophthorus
infizierten Knollen.
(Gemessen
an
Versuchsobjekte
kunft.
Stunden
51
22 Knollen mit 45
Thermoelementen).
Speisekartoffel ,.Fischli", süditalienischer Her¬
Beginn des Versuches in die Drahtgitterkammer
frühe
vor
ObjeKr
75
\__
7Û
f/eme/j/fû
SO
90
7/0
fOO
/<?<?
f*0
/JO
/50 Stvn&en
Objekt 77
ffementêO
70
SO
//O
9Û
70
i
i
i
i
80
90
tOO
t/O
/20
Abb.
gestellt.
bei
1
i
/30
/?<?
halbierten Knollen.
Darauf mit Thermoelementen versehen und
quadratischer Figur angeordneten
Infektionsmaterial einer neun Tage
Empfindlichkeit
der Thermoelemente
ObjeKr 75
1
1
/SOSlmden
10.
gesunden
mit vier in
infiziert.
/503/unde»
£U~*nf23
1
Temperaturkurven
des Versuchskastens
t-fQ
/30
0bjekr79
\
1
/20
etwa 2
mm
alten Kultur
0,00185—0,00167°
ObjeKr
tiefen Stichen
C
ObjeKh
77
entnommen.
je
1
mm
der
79
Abb. 11.
Anlage
der Thermoelemente hei
gesunden
halbierten Knollen.
Hälfte natürlicher Größe.
Skalateilung.
Nach Abschluß der
Messungen
die Knollen in
Längsrichtung
durch die Infektionsstellen halbiert und die Infektionsstufen durch Messungen
aufgeweichten Gewebeteile festgestellt.
In Tabelle 3 sind Temperaturmessungen
Aus den
Thermoelementen zusammengefaßt.
der
an
vier Knollen
Abb. 13
und 16
mit
sind
25*
acht
die
858
xejç
:s}i[%
t*c-ooooo:oiffloiOH^H5icocO'^io
t-icO'<#r~©eoiß05CO~HTt<r~©Ti*cO'<*co
IM
MIM
III
1
1
1
1
1
r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11 1
1
1
©" o~ ©~ ©~ o~ ©~ o~ ©~ ©~ ©" ©~ ©~ ©~ ©~ ©" ö" ©~
© © © o ©_©.©_©_©_©_©_©_©_©_©_©_©
©©©00©0000©©©0©00
0©©000©©©©00©©©©©
iOCOXlOCOCOCOIOCDCOCOIOlOCOÏICOiO
—i(-tJtJh[-t|t|h-l»)M.ri T* * .-H
t+H—r
1
!
! 1
o"©"
1
1
i—H 1—1—r
II 1
©~©~
o ©
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
!
1
1
1
1
o~©~©~©~©~©~©~©~o~©~©"
© ©
©
©_© ©_©_©_©_©_©_©_©
ooooooooooo°oo°oo
oo
*# *C
—
-HOOOOOOOOOO^OO
Iß CN
0505
-** Oi
COXH^JIHXCOIOIOO
t-H00W3^1O5»nCOQ0C35C35O5
.StmieTq tiajiotrg-jep
Elem nt Objekt
2
73
Elem nt Objekt
12
h
74
e
a
I++I+I
1
I++I
1
1
1
1
++!
©~©~©~o~o~©~©~©~©"©~©~©"©~©~©""©~
OOOO ©_© ©_©_©_©_©_©_©_©_©_©
OOOOOOOOOOOOOOOO0
CC-HOOOOOOOOOOOOOO_
HlOCDHÎÛt^CDt*Tj*Tj--COT|o>01T)(
HMHIO-ih.Ht»ÎÛCDlOHCON!MCC
Elem nt Objekt
16
75
H
S
ood'd'd'oö'ooo
©"©"©"©"©" o~
oooooooooo
oooooo
OOOOOOOOOOOOOOOOO
CM^H—lOOO^OOOOOOOOOO
C0t»-^HCOOl
HTjl CCCOHÎO
©OÏÎPHCDCOCOHCOH
CO^COCOCOr-tCOCO^HCO
l_l_l-l_
!
1 1
1
_l
1
1
l_
1
1
_l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
l_l
1 !
1
1
1
_l
1
1
1
!
o"
©~©~©~©~©~©~©~©~©"©~
o~o~o"o"
o
oooooooooo
oooo
oooo°oooooooooo°o
O
—
co
CO
OOOOOOOOOO
co'^i^^oo^cocdoo'*
—
COtHOO
co «*•** co
MHOÎIO
COOlOÎÎOMOlCOlOtNC»
A
Elem nt Objekt
19
76
Elem nt Objekt
20
77
O
U
S
H £
ci
O
''S
«
33
+++ 1
1
l
1 l+i
o" o~ o" o" ©~ ©" ©~
1
! ++++++
©~ o" o" ©~ ©~ o" ©~ ©~ ©"
o o o O O O O ©_©
©_©.©_©.©_©,©_
OOOOOOOOOOOOOOOOO
lOCOCN^HrHOOOO^OOOOOOO
iOO:COCß(HCDHH^
ot^œHÈ>cîi<Dœai
-^ I^HCO O t*CO
oo cm co as *# cm œ
Ti l
M
1
l
1
1
1
l
illn
l
+1
1
1
1 !
1
1 1
1
©"©"©" ©~
©__©__ o__o__
1
1
1
t111r
1
1
1
1
1
©~©~©~©~
©"©"o"©"©"©"
oooo
oooooo
i-IOOOOO^OOOO^OOOO^
OOOOo
—
CO CO •«* CO
CM-^iOCMOO^OOOO
CO CO CM «H OS ©
CO CO CO -rfl
tJODO-*
* © -# CO
++ +1 +11
o"o"o~o'"o~
©_©_©_©_©,
1
1
1
IS 51 lO * CO K5
++++++I+11
o"o"o"o~
©_o © o
©~©~©~©~©~
ooooo
O0000000000000000
©©O00_,._0©©©0©000©
HCO tD CO CO
o m © o o
^t^-^i-^i
COCOOSCOCO
m >o >o »o
ooooo
Elem nt Objekt
21
Elem nt Objekt
23
©~ ©~ ©~ ©~
o^o^o^o^
1
++++1
1
1 ++
©*" ©" ©" ©~ ©*" ©" ©"* ©" ©" ©~ ö"
ooooooooooo_
©oooooooooo^^ooo©
^
00 CO CO
cmcmoco
CSCO-tf'^CDTtiCOCD-HCO'—i
CDCOOOOO-^OOCMt^CO'^'X'
+ +++1 +1 +11 1 I++
©~©~©~©~©~©~©~©~
o^o^o^o^o^o^o^o^
+++1
©~©~©~©~cT©~©~©~
oooooooo
ooooooooooooooooo
oooooooo
COTtTKCO-^^COCO
COCO-HOOOOO
lOt^OCOCCCOHCO
79
Elem nt Objekt
25
!
1+I+I++++
78
80
'
Elem nt Objekt
27
81
Elem nt
Objekt
35
82
<b
n
£
»
a
B
•°
_
«
a
•0
»
a
o
0
u
.a
-<
»
Der Einfluß der Infektion auf die
Temperatur
Infektionsstufen beim Abschluß des Versuches und die
elemente
an
zehn Knollen
zu
/O
30
ZO
Vorgänge
40
JO
ObjeKr
fO
20
30
+0
Anlage
Die Kurven in Abb.
ersehen.
veranschaulichen die thermischen
359
usw.
60
der Thermo¬
14 und 15
12,
in diesen Knollen.
70
SO
90Jto»</a/
60
ÛO
SO
70
40
90
SUnc/ey
Abb. 12.
Temperaturkurven
bei ganzen, infizierten Knollen.
,w»*5** .9S
ObjeKt
59
(Zur
Tabelle
3.)
*S0t2
Objekf
60
Objekf
61
Objekf
-SO
-2
62
Abb. 13.
Anlage
der Thermoelemente und die Infektionsstufen bei ganzen infizierten Knollen.
Hälfte naturlicher Größe.
(Zur
Tabelle 3 und Abb.
12.)
Max
360
D.
Temperaturmessungen
an
Eglits:
halbierten, mit Bacillus phytophthorus
infizierten Knollen.
(Aasgeführt
an
frühe
Versuchsobjekte
bewahrt und
Hälften
jeder
31 Knollen mit 90 Thermoelementen.)
behandelt.
Knolle in
2.Ü
vor
Infektion
halbiert
Drahtgitter-Verbandstoffzelle
eine
objekt-
/Ü
Üblicherweisefauf-
Speisekartoffel „Fischli".
6ö Stunden
30
4ü
und
beide
des Versuchs¬
65
SO
60
70
SO
90Sfvnt/ef,
Abb. 14.
Temperaturkurven
kastens
gestellt.
Eine Hälfte
bei ganzen infizierten Knollen.
jeder
Knolle mit vier in
quadratischer Figur
gleichen, aber sterilen
infiziert,
angeordneten
Infek¬
Thermoelementen
verbunden.
mit
beide
Hälften
Stichen verletzt,
tionsmaterial einer sechs Tage alten Kultur entnommen.
Empfindlichkeit
Stichen
die andere Hälfte mit
f1
1
t-
1
ii
CtlO
"©
©
t
i
©"©
©^©_©_©_
[
l
\
i
1
1
1l
11
1
11
11
11
11
1
1
11 11 11 11
©
©_©
11
11
11
"o "o "o "o ~o
11
11
11
O ©
"o
1
1
11
©_©
11
11 11 11
1
1
11
©
o o o o o o
11
11
[1
!1
1
11
^
t1 n[ 11
11
1
11
11
11
11
"o "o
h-
1
CC
1
1
OjO
11 11 1
1[
11
o
11
G»
1
11
-3
1
]
1
1
I1
©"©
£* ü* CX
1
11 11 11
o © © © ©
11
1
1—t
[
1
r 11
o o © © o ©
11
"o "o "o "o
o o
O O O
11
JO
"o "o "o
OJD
"o "o "o "o "o "o "o "o "o "o "o "o o "o
1
rn
1
o "o "o "o "o *©
"o "o "o "o "o ~© "o
OOOOOOOOOOOJ
11
o©~©©~_©©"_o©"_©©"_o©"_
©_©_©
OOOOOOOO >G2JDJ
HObOtMOt'-h
w
o"©"©"©"©"©
1—1—1
i
©_©_©
©"©~©"o
©_©_©©
©~0~©"©"©"©
r—1—1
©[o—Io—©I—©|—©ir©©©©©©©©© ©©"_©©"©©_"©©_"©©_"©©
©*"©"©
Dj>pO
j-»
"o
11
o "o
1
!
M
o o o
.°
!
1
1
11
h-'
1
t—
1
M
11
1
1
1 1 11
1
M
1
! ! 11
1
! I 11
1M!
!t
h->
11
"o "o "o "o "o "o "o "o
1M1
"o"o
1
M
o o o o o o
o o "o "o "o o
M
op
"o "o
11
!
M
!1
1
1
M
11
1
i
1
1
1
1
.
o
1
1
Iti
1
1
O
11
11
1
J
11
1
!
11
1
1
1
1
1
-1
1
1
•
1
1
1
1
"o "o "o
1
1
"o "o *© "o "o "o "o
.j
11 1 11 1!
..
1! 11 1 1 1
P „o JO p jo p> o p> p> ^o jo p p? p p JO ,© p> p> _©
o o
M
Il
!
"o *o "o "o "o ~o "o "o "o "o
l„
J...J
1
2
50
49
48
47
46
45
44
62
61
60
59
OS
B"
n-
B
6b
ras
o
0
o
>
**
._
o
»
5.
B
nze
a
a
BP
OS
tyhp
reV(
O^pOjOjDjO
o^p>po
OOO. O.^_.O-J_.O_j_ Ol_-jO. OOO
j!
ex
E2
CD
B
w
cd'
C
B
B"
CD
ers
B
N
to
INS
Pu
B
00
B
er
er
Oj
CD
aus
S-
»
»
der
H
CP
S
a
1
P
—
CD
lebaT el onK
nego
©5lU0V»]C~©©Olt"Qa©DGO"ÎCb©O3"0C~©Ï0"O>©ûl"0t©©&Ol"It<'©.^C—»"Ïlf©Ui)>"^(K]©tiT~"rDJO©CCCt"D*)©CfK]"'lW~-©0^KW"0iO5©CO~C^©O0)^Cb'O5>-D~Th3CC^2lCt^tDC-ct4l2n^0C
'oO"H©O*O"HœoBK"DD©b~O©OI"tU©O~W©bl"Îf©OC"W©l"Oo^ItÎWO^CIÎ^OBOCb^WîÎOOœWDûÎtOlQK
O HJKOtCIKOtOtSbMlKJKH H H HO
^o+ocWiDOvc+HiCOoGc+CxtaOow<+wDiiCDaW+îioaOœoWH+Goiü^Ui+H<OoiCwuO+o:Oœo+i^<CWiHü+iO<DCo+O^b
^œ^OOUtCl)^^UlOOil»aOCüiOCO)ÜtÏUCHiiUUOOWDtCOß'-t-hOiaqC-^lrO<HlOD<COHHCSbÛHiDOUCO<OUDi^UGO
1-HOOOOOO-h —h'-hi—t
ojo^po^o^o
Hoo~^oO~WHoO"toO"^toûH"boSO~bo^~iol~btoJ"Üiot~Üoo"tDojC"ooHcOHœacWow"Moo"olw"Ooc"btoW"oo«t"
O.DJO
1
•!—1
tnemlE
tkejbO tnemlE
tnemlE
tkejbO tnemlE
nsemri netriz tkejbO tnemlEtnemlE
ttnemlE nemlE
tkejbO
>pOjO^p>pO
-j
9?
i
CD
B
11
B-
CD
CD
&
pu
B
B
B
CD
o
W
B
B
95
CD
B
4
^
The
CD
ö
CD
R
3
a.
CD
OD
Vf
B
B
CTQ
sT
Cd?
fen
B
^t-
ce
!>-
i—'
cd'
o
o
o
©
o
0,
nte
CD
3
1
'-
B-
CD
^
OB»
S
ietal
cier
nhez
ET
h-'
CO
CR
^
^
Cß
^
2
o
er
Ein
i-^
a
ß
der
So
(3
die
H
arep
noitkef 5710,
-921
eleom
meleo
enis
ssin
nonietdkneuftnSI
hcan
Bglits:
Max
362
17, 19—21 veranschaulichen die thermischen Vorgänge bei obigen
Objekten. Tabelle 4 bietet die Ergebnisse der Temperaturmessungen an
Abb.
drei
Objekten.
+16*12+19
-12
-16
Objekh
*n„
-20
Objekh
65
-23
Objekh
ObjekC
67
71
+35+37
Objekf
0bjekh68
66
72
Abb. 16.
Anlage
der Thermoelemente
und die Infektionsstufen bei ganzen infizierten Knollen.
Hälfte natürlicher Größe.
(Zu
Objekt"
«c
J
3o
15.)
L
*o
SO
60
7o
Objekt-
JO
den Abb. 14 und
34
40
SO
60
70
So
9o
too
no
/2o
âfandey
9o
too
Vo
120
Sfi/'tdey
41
So
Abb. 17.
Temperaturkurven
bei halbierten infizierten Knollen.
(Zur
Tabelle 4.)
WSO30»CSO«»C.&>-»ft >-£l^ö<ÜOlüi.*f[^l|h^ OT5DO©b0t
o"©"
i—1
11
1
r 11
11
© © © O © ©
©"©"©©
Il
©'©"©'©'©"©"©
11
11
11
11
!i
1
1
"o
©
11
© "© © ~© "o ~© ~© "© "© "© "o "©
11 11 11 11 !
o o o
1 1 11
1
1
©_o
o o
!
1
11 11
©_©
1
!
1
11
!
1
11
1
1
11
©_©
o~©
11 11 11
©
1
! 1 11
!
11
1
II
1
"h "h "h
1 11
1
!]
11
11
"©~©
1
[
11
!1
! i 11
© © ©
1
!
r I1 1
!
©_©
1i
© © © O ©
©
"o"b "o "o "b "b "o
1Mt
t1
©"©*o"
!1
11
1
1
"o
-^
©~©
1 1 11
I!
11
11
|
M
11
1
1
!1
!1
!1 1 1 11
1 11
1
11
o o
11
11
1 1 11
r
1
© ©
1
r1i
II
"o ~© ~© ~©
1
1
1
]1
1
1
_©
1!
© o
1
©_©
!
*
<s
!1
"*©
11 1
1
"©
Ol
11
°
o o
II I1 I1
©_©
1I
1 |j 11 11 !1 [ 1 11
1
1
1
M
1
11 !1 11 11 1 1 11 11 11 !1 !1 11
©,©
"o "o © "o"o "o "o "o "o "o "o ~© "o
1I
o _p _© _p _o © o ç> ©
11
©_p
"o"o
11
1
1
11
1
1
1
M
OJD
I
1
11
1
!
|_
1
*© "o
11 11
o o o o o o
11
|! j1 |1 |1 |1 |1
© "o © "o © "o © © "o
i
11
© © © © ©
[1 |1 j1 |! |! |1
"o
11 1 MI 11 1 1 1 1 11
© © © "o "o
[! J1 J! J1 jI |1 j1 1 j1 |1 |1 1[ j1 |1
©©©p©
©*©"
1
1
"© "© "© "© "© ~© "© "© ©
©_©
11
°
o o o o o o o
1 1 1 1 11
©„©
1
11
T—'
"o ~© "o "o "o ~© "o "o "o "o "o © "o "o "o "o "o "o "o "o "o "© "© "o "o "o "o "o
11 !! 1 1 !1
o o o o o o o © _© o
"o "o "o "o "o "o o "o "o © "o
M
*-*
11 1 1 11 1I 1I 1 I 1I 1I I1 I! 1I 1I 1 I 1I 1 I I1 tI 1I I1 1I 1I
1 11
© _o _© _© _© _© _p _© _© © _© _© ©
11
o_o
"o "o "o
M
1
_©
"o
11
o
1
iri
©©©©©©©©
©O©©©©©©©©©©©
©_©©_"©©_"©©_©©"©"©
©"©"©
1-î"
©_©
©J©_©
©_©_©
©"0©.".©0".0©.".op~.©©„©
ooooooooooooo
*-I"
~©"o
°„0_°_0 SJ'-SSS°
»-h"
'-%-k"i—T '—T'-t" •—!" *-V"
oJb"b
i
©j©J©_©_©_©J©
=J=J0
©~o"©~©
©©*_"©©_*o©_"p©_"©"
©oooooooo
|_.j
oooooooooooooooooooooo
"o
©_©_©_©_©_©
+œO©iom"Hosi©"Otw©+0is"J5©mbï-s"iH^+©oöna"w-c©j^"oa»+©ifR"coto©KO"\<^+Qa©o'o(œ©iœ"Oü^+©Qloc("f©c«H"^H+©ic:O"»ü©jO-"oMî+^©:ûi"u!©otœDl~Oœoc+0©Cxi1JaK<oOi3+Bü0œ3ti:to<-+»H)o>KOtwï^o+0Hi5O3lt0f+WBo;'H!ü*©ico3+lf-corœ^O»cHw+o)j]*K«^
^©©©"ß'©cIH"]^ÖS©~CO:"iOa!©Ä"^Hc©.oM"*^i©Df"Cca©i5O"D~C©0oD"lO©1Bu"ÜbÎ0©olO"c<^©nt'^f—l©IoCûatsïDOû<©t:5a1J^'0D-^MC>3T^b.Ol00.!c*f^01.»O{f0tH(^©WqI-1^0©»lOc<^^oDQ5COj0.-aoP0Bh'Q<5-KaO>
lCSoJ[bl*ü-OD]litvo)üH1Kiiui^f»Kf©Wl1O<©-©f0J^T^iC©lO©1iftdtWü*û^1^l!©©MüO~OiD"Q©üH!~O©OiooWCS^1iOl©0üCTQD©^œKOC~O0Ci©iÈlül1^^ff©œCD1i^©t^CüO~ÎW1O©Kli0^üü©ilO~fUod^ÎTi0OoO1W^©oJH0~sOC0DcD~^tjHCW©o»1KDn(©^<HHc0~lÜatT©iui~H^oQ*dl^f1HH0©tK^'tOii©fH1Xœ^©O:i5ü~l0*^©
+oH5Hqsoi0l^-«oO)oDOO<C+oJ<œ*»4KiOIo^oaÜll+ooD-<K<Chi0oi'OœQÜ-+ouo»l^^itWüoœjhœl*^o+ü|lltDÜio<üi!to)üKou+OlotHOaoœW»JiC]oo+OßH*»CoMc^QlœiwHfoO+R5RooC)C0HKa:o+o^iO0OiRoo0CCjHQ»lo+3'öctœo-oh<^l)olß+oaKCt<-oOl<^ilîo^voo+5)OaoO^œol^Cöt'+Oi(uhfHoiJv'œH+OoDüo4Ilct-Ü<b^Or!o+fia*œ^Hc^l
©iiH5Haf0i©.5ü©^ollöM©<<i-H©a]oIIi*c?HÜH<lp^ioD<«aw©)CiOK©0Üia»lo©HC00©tH!f0o©O0Ctî©0H«OC^?ûDl<lcCpüOiiO0©ai1OOa©0O<QO©)HtaOjOfiHoCKIO^o^j<lD©HDHOOCoCi©^lH©lnvO0i©lb^-ÜÜ©(H)lOo©KOv5œO©ODÜiHIotÜ<)©OluKDDÜiCC«XMW»ioÄnDt(HC0»H*WHc05ODiW0CCo
©~©~©~©"©
11
i
39
37
1
2
11
19
9
44
42
43
41
34
38
tnemlE
tnemlE
ttkejbO nemlE
tnemlE
tnemlE
ttkejbO nemlE
tnemlE
tnemlE
ttkejbO nemlE
nenonietdkneuftnSI
hcan
a>
Pi
B
œ
-3
B
B
*
ta
s
S?
«i
a
O
»
*•
f*
S"
s«
a
s
w
t»
o1
•
CD
5^
pg.
B
S»
cT
S.
tt
H
CD
p-
CB
s
1
09
CO
CO
tel
Max
364
Knollen benutzte
Objekte
im
man
entweder
Eglits:
Temperatur
Dampftopf sterilisierte,
Auf die Versuche mit den bei
nicht näher
eingegangen,
die
da
100° 0
30
4-Q
So
60
webe solcher Knollen keinen
bei
90
SO
70
Behandeln
Zum
unter
eine
Drahtgitter, dem
Stopfen der Glasglocke
von
als
war
eine abschließbare Glasröhre im
gefüllt werden
rand
raum
war
konnte.
1TQ
sich die
7Zo
-SSe/rt/e/?
Entwicklung
Versuche
mit Chloroform wurden
des
mit den
sie
halbiert
Man
stellte
Unterlage eine breite Glasschale
diente.
etwa
17
1 Inhalt versetzt.
eine Petrischale
Stopfen
angehängt, die
durch
der Glocke mit Chloroform nach¬
Die Glocke ruhte auf einer
mit Vakuumhahnenfett
wurde mit
fOO
Boden für die
geeigneten
Knollen
Glasglocke
sie auf ein
Am
der
kompakten Ge-
bedeckten
infizierten Knollen.
phytophthorus boten. Anders stellten
Chloroformdämpfen abgetöteten Knollen.
und
die
19.
halbierten,
Bacillus
in
man
4-2
Abb.
Temperaturkurven
indem
C,
abgetöteten Knollen sei hier
mit Schale
Objekr
20
100°
von
oder Chloroformnarkose.
Glasplatte.
Der Glocken¬
abgedichtet. Die Atmosphäre im Glocken¬
Chloroformdampf gesättigt gehalten. Nach Abschluß der
Der Einfluß der Infektion auf die
Narkose stellte
desinfizierte
365
usw.
die Knollen vier bis fünf Stunden ins Freie.
man
man
Temperatur
mit
sie nochmals
und stellte sie in die
Formaldehyd,«trocknete
Darauf
mit Alkohol
des Versuchskastens.
Drahtgitter-Verbandstoffzellen
Nach 45 bis 50 Stunden wurde die eine Hälfte mit Bacillus
phytopMJwrus
infiziert und beide Hälften einer Knolle mit Thermoelementen verbunden.
Objekl
•c
20
30
1
I
I
20
3Q
2o
40
40
30
6°
SO
4-0
70
4-9
30
I
1
I
1
SO
CO
70
60
So
70
60
So
OO
1
90
So
/2o
r/o
too
1
I
I
1
ÏOO
//O
f2o
ffo
roo
SU/rcJeq
Sfv/ic/eq
Sfunüeq
'2o
Abb. 20.
Temperaturkurven
Die thermischen
zeigten
viele
bei
Vorgänge
Temperatursteigerungen
schen
Vorgänge
keiner
Narkose nicht
abzutöten.
getötet
den
waren,
auf
bei den
Knolle,
von
gleiche
0,08597
die 24 Stunden
annehmen,
gewesen,
daß
°
C.
Die thermi¬
Weise behandelten
unterbracht werden.
genügend andauernd
Man könnte
eine
erzeugte nach Infektion sehr regelmäßige
mit einem Maximum
übrigen,
Gesetzmäßigkeit
in
Knollen.
in den mit Chloroform behandelten Knollen
Unregelmäßigkeiten. Beispielsweise
mit Chloroform behandelt war,
konnten
halbierten, infizierten
um
gewisse
anderen kamen Reiz-
Offenbar
die Gewebe
Teile
oder
Knollen,
war
die
vollständig
der Gewebe
ab¬
Hemmungswirkungen
zum
Eglits.
Max
366
Vorschein.
Resultate.
Auch
Durch 160
120stündige Narkose gab ähnliche unbestimmte
stündige und länger andauernde Narkose gerieten
die Knollen zuletzt in einen solchen
wesentlichen
Temperatursteigerungen
,„/£
Zustand, daß sie bei Infektion
mehr aufwiesen, obgleich der
keine
Infek-
Objekl- 55
20
30
So
-+0
60
70
90
SO
f2o
¥fO
tOO
Sfunc/ep
Abb. 21.
Temperaturkurven
tionsprozeß verhältnismäßig
Knollen.
halbierter, infizierter
schneller
vor
Es trat aber auch bei diesen
Die
ein.
bei
Temperaturdifferenzen
Graden und traten als
Objekr
Objekr
42
49
Objekten
ging,
als
oder
Objekt1
Objekl"
51
Objekr
55
von
Erniedrigungen
44
bei
lebenden
keine absolute
schwankten im Bereiche
Steigerungen
ObjeW
sich
Knolle.
zum
Ruhelage
tausendstel
Vorschein.
4 8
Objekr
52
Abb. 22.
Anlage
der Thermoelemente
und
die Infektionsstufen
bei
halbierten
infizierten Knollen.
Hälfte natürlicher Größe.
(Zu
In
der Tabelle 5
sind
fizierten Knollen nach 600
lichkeit
den Abb
die
19-21.)
Temperaturmessungen
stündiger
an
halbierten
in¬
Narkose
wiedergegeben. Die Empfind¬
betrug 0,00146—0,00162° 0 je 1 mm der
Die Temperaturkurven sind in Abb. 23
dargestellt. Die
der Thermoelemente
Skalateilung.
Anlage der Thermoelemente
der Abb. 24
zu
ersehen.
und
die erreichten Infektionsstufen sind
aus
Der Einfluß der Infektion auf die
Temperatur
367
usw.
Tabelle 5.
Ergebnisse
der
Temperatur uiessungen
an
halbierten, nach 600 stttndiger
(Versuch 5.)
Chloroformnarkose infizierten Knollen.
Temperaturdifferenzen
nach
n
in
°
C.
i
on Objekt
Stund« Infekt
Objekt
126
Objekt
127
128
Objekt
129
Objekt
130
Element 2
Element 3
Element 4
Element 5
Element 6
12
+ 0,00117
h 0,00324
|- 0,00048
16
0,00438
4- 0,00599
18
+ 0,00540
0,00583
\- 0,00616
\- 0,00632
0,00405
4- 0,00521
4- 0,00506
+ 0,00302
14
-1-
-
45
0,00453
-0,00131
0,00015
0,00234
0,00482
h 0,00409
0,00248
60
V
62
h 0,00336
64
+ 0,00307
23
36
38
-
-
-
E.
—
0
0,00161
—
-
—
-
—
—
—
—
—
—
-
0,00111
0,00126
0,00316
0,00174
0,00079
0,00111
0,00205
0,00032
0,00095
0,00269
der in
Besprechung
und
—
|- 0,00178
0,00632
0,00502
(- 0,00437
|- 0,00227
f- 0,00535
|- 0,00340
0,00243
i-
43
69
—
-
40
0,00389
0,00065
-
-
0,00585
4- 0,00616
4- 0,00363
-
-
25
-+-
-
-
0,00544
0,00393
0
-
-
-
0,00408
0,00242
0,00030
0,00196
4- 0,00015
0,00091
0,00030
0,00287
0,00181
0,00060
0,00196
-
fL-
+
4-
—
—
—
4
—
4—
—
—
—
4-
—
—
-
-
—
4-
0,00432
0,00496
0,00416
0,00480
0,00336
0,00176
0,00240
0,00176
0,00064
0,00160
0,00032
0,00144
0,00176
0,00464
Temperaturmessungen
an
gesunden halbierten
ergeben, daß die Temperatur in
einer Knolle
Geweben
nähernd
die
gleiche ist.
überall
den
meters nicht
geschätzt
wurden
Celsius
festgestellt
im
Bereich
sicher meßbar und
Differenzen
einiger
die
—
—
-
—
—
0,00221
0,00158
0,00300
0,00158
Methode,
steigerungen in den
Temperatur
Knolle,
bezogen wurden.
—
—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—
—
0,00213
0,00213
0,00076
0,00106
0,00304
0,00076
0,00015
0,00091
0,00182
0,00258
0,00198
0,00106
0,00015
0,00106
0,00286
126
127
_L
128
Objekt
130
Objekt
131
mußten
6Û
der
Objekt
SO
OO&i/ndittt
132
ge¬
Temperatur¬
gesunden Gewebe
als auf den
St-tftttJeit
_L
40
Messungen
erkrankten Geweben
der
—
von
festgestellt,
Brauchbarkeit
bei der die
derselben
-
Tausendstel Grad
Diese
schwankten.
wählten
auf die
—
0,00284
0,00095
0,00158
0,00126
—
Objekt 129
Ausschlägen des Galvano¬
größere
begründen
—
Objekt
werden. Nur in Ausnahmefällen
die im Bereiche
-
—
Element 10
an¬
zehn tausendstel Grad Celsius. Diese Größen
an
—
_L
In Normalfällen schwankten die
Temperaturdifferenzen
waren
—
132
Absolute Tem¬
konnte nicht
peraturgleichheit
werden.
—
0,00142
0,00284
0,00316
0,00111
0,00221
0,00111
0,00316
Objekt
ge¬
sunden ganzen und
den
—
Objekt
_L
Temperaturen.
Knollen
—
Objekt
gesunden
131
Element 7
Geweben gemessenen
erkrankten
Die
Objekt
Nullpunkt
_L
fo
20
3o
_L
So
4o
60 St-vnde»
Abb. 23.
Temperaturkurven
abgetöteten,
bei halbierten,
infizierten
(Zur Tabelle 5.)
Knollen.
Eglits:
Max
368
Ergebnisse
Die
der
Messungen
an
ganzen infizierten und
halbierten,
Nachweis, daß durch
Infektion wesentliche Temperatursteigerungen hervorgerufen werden. Die
Messungen mit mehreren an einem Objekt angebrachten Thermoelementen
zeigen, daß nach erfolgter Infektion in der ganzen Knolle thermische Ver¬
änderungen vor sich gehen und daß Temperatursteigerungen, die wohl
an
der einen Hälfte infizierten Knollen
wesentlich kleiner sind
als
an
den
erklärlich,
weshalb bei
Messungen
Objekf
126
Objekt
Objekt-
129
Objekt
Objekt-
Auf Grund
an
in
auch
Angriffsstellen,
entlegenen Gewebeteilen stattfinden.
es
erbringen
den
dieser
ganzen Knollen
128
Objekt
130
ist
einer Infek-
an
Objekt
127
den weiter
Erscheinung
131
132
Abb. 24.
der Thermoelemente und die Infektionsstufen bei
Anlage
abgetöteten
Knollen.
Hälfte natürlicher Größe.
(Zu Tabelle
tionsstelle verschiedene Größen
in
wurden,
Abhängigkeit davon,
der Thermoelemente
vom
Der Verlauf der
5 und Abb.
von
23.)
Temperatursteigerungen festgestellt
Entfernung die ,.— Pole"
in wie weiter
Infektionsherd angebracht
Temperaturveränderungen
waren.
bildet
eine
ansteigende
deren maximale Höhe bei ganzen Knollen nach 50 bis 75
Stunden,
bei halbierten Knollen nach 55 bis 100 Stunden erreicht wurde.
Danach
Kurve,
nahm die
Temperatur
Die höchste
0,11995°
Bei
in
allen Teilen der Knollen
allmählich wieder ab.
Temperatursteigerung bei halbierten infizierten Knollen betrug
C.
Messungen
formnarkose
an
Knollen,
die mit
genügend andauernder Chloro¬
abgetötet
hervorgerufene
Temperatursteigerungen nachgewiesen werden, obgleich das Vorschreiten
der Infektion verhältnismäßig schneller vor sich ging, als in den lebenden
Geweben.
Diese Feststellung bringt den Nachweis, daß die Temperatur¬
steigerungen bei lebenden infizierten Knollen nicht durch den Abbau der
waren, konnten keine durch Infektion
Stoffe seitens des Parasiten
der Reaktion
der lebenden
hervorgerufen werden, sondern daß
Wirtspflanze beruhen.
Gewebe der
sie
auf
Der Einfluß der Infektion auf die
den
Versuchen
nachstehenden
Temperatursteigerungen
zu
6 bis 8 halbierte
krone", vorjähriger Ernte,
bei
Der Vorrat
Kohlensäureabgabe
hervorgerufenen
Versuchsobjekte
Als
gleicher Zeit gemessen.
dienten bei den Versuchen
jähriger Ernte.
die
wurde
durch Infektion
und kranker Gewebe und die
gesunder
369
usw.
gesunder und erkrankter Gewebe.
4. Die Kohlensäureabgabe
Bei
Temperatur
Knollen der Sorte
„Kaiser¬
,.Fischli'', dies¬
den Versuchen 9 und 10
stand
Versuchsobjekte
der
wie
üblich
im
+6 —8° C.
Thermostaten bei
6, Objekt 133. Infektionsstelle innerhalb desRezipienten.
80 Stunden vor der Durchführung der Infektion wurde eine Knolle der
Sorte ..Kaiserkrone-' in Formaldehydlösung desinfiziert, halbiert, an die
Versuch
Kezipienten angekittet
suchskastens
Stichen
durch den Tubus
einer sechs
Tage
Rezipienten
des
alten Kultur
mit
Bacillus
phytophthorus
aus
infiziert, darauf der Tubus dicht verschlossen,
Rezipienten mit dem + Pol eines Thermo¬
elementen versehen und die Kanüle verkittet.
der anderen Hälfte der Knolle.
Stiche und den
pienten
des Ver¬
die eine Hälfte mit vier
durch die Kanüle des
Objekt
das
gestellt.
Drahtgitter-Verbandstoffzelle
und in die
Nach 80 Stunden wurde
—
Das Gleiche
geschah
mit
Statt der Infektion erhielt sie vier sterile
Außerhalb der Rezi¬
Pol desselben Thermoelementes.
wurden noch zwei Thermoelemente in Entfernung
von
1 und 2
cm
Tabelle 6.
Ergebnisse
halbierter
an
mit
Bac.
und Kohlensäuremessungen
Temperatur-
der
phytophthorus
infizierter Knolle
der
Sorte
Kaiserkrone.
(Versuch 6. Objekt 133.)
Temperaturdifferenzen in ° C, Kohlensäureabgabe der gesunden Gewebe in mg,
der infizierten Gewebe in "/,, bezogen auf die Abgabe der gesunden Gewebe.
a
^5
^
3
a
o
_
M
S "3 £
CO
Tempera mminerenzeu
Element 7
Element 3
in
Kohlensäureabgabe
C
»
17
22
4- 0,06350
27
-!-0,05L72
+ 0,0482.5
4 0,04729
+ 0,05713
+ 0,06948
4- 0,07353
-f 0,08106
12
32
37
42
47
52
57
-
-f 0,01428
4-0,01775
+
+
0,02611
+ 0,03346
4- 0,03998
4- 0,03652
^0 03611
-
1- 0,03284
-0,03815
-
0.05059
0,00718
+ 0,00407
4- 0,00582
-r-
4- 0,00757
+ 0.01106
4- 0,00989
0,00970
-| 0,00931
+ 0,01533
-
4- 0,02328
0.05957
4- 0,02794
-0,06916
4-0,03143
-
62
'-0.08936
+ 0.07772
67
+ 0,09322
+ 0,09573
4- 0,07936
4- 0,03647
4- 0,03398
-|- 0,08915
+ 0.03667
+ 0,09747
+ 0,11059
+ 0,10982
+ 0,09384
+ 0,10343
72
77
82
87
Gewebe
mg
0,00251
0,01737
4- 0,03493
+ 0,05211
1
erkrankter
Gewebe
0
C h-1
2
gesunder
Element 5
-
-
0,10465
-j-0,03996
4- 0,05432
+
0,05762
_
0,388
0,379
0,386
0,406
0.451
0,445
0,469
0,421
0,407
0,424
0,449
0,451
0,455
0,462
0,462
0.460
—
89,88
163,31
289,31
425,56
361,62
341,23
297,51
424,98
448,23
437,28
439,75
467,63
437,28
403,42
401,36
341,79
von
Egiits
Max
370
der Infektionsstelle
infizierten, die
Rezipienten an
der
laufen,
Darauf
verband sie mit den
die
Ausschlag
-f Pole befanden
gesunden Hälfte.
und schloß den Versuchskasten.
ersten
Die
angebracht.
an
Luftleitung,
Drahtgitterkammer
die
bedeckte
Pole
—
mit
sich
schloß
an
der
man
die
Absorptionsgefäßen,
wasserdurchtränktem Verbandstoff
Nach zwei Stunden bestimmte
man
den
des Galvanometers und ließ zehn Minuten den Luftstrom
ohne die Luft in die
Absorptionsgefäße
zu
leiten.
Darauf wurde
die
Luft durch entsprechende Drehung der Dreiweghähne, in die Absorp¬
tionsgefäße geleitet und die Luftstromgeschwindigkeit durch Abdrosseln
der Vakuumschläuche
301Ö
mit
den
Präzisionsquetschhähnen
Ô0
SO
Objekh
ÄWate?
Abb. 25.
Temperaturzum
und Kohlensäurekurven
Anlage
Versuch
6, Objekt 133.
Temperaturkurven.
eingestellt.
ausschläge gemessen,
durchgeführt.
die
ccm
133
Abb. 26.
und der
Nach
der Thermoelemente
Eezipienten. Infektionstufe
bei Versuch 6.
Kohlensäurekurve.
die Minute
auf 2 bis 3
Hälfte natürlicher Größe.
fünf Stunden
wurden
Absorptionsgefäße gewechselt
In Tabelle 6 sind die
Ergebnisse
der
die
Galvanometer¬
und die Titrationen
Temperatur-
und Kohlensäure¬
an
zusammengefaßt.
abgegebenen
Kohlensäuremengen sind in Prozent, bezogen auf die ausgeschiedenen
Kohlensäuremengen der gesunden Gewebe, ausgedrückt. Die Oberflächen
der Gewebe, an denen die Kohlensäureabgaben gemessen
wurden, ließen
sich nicht völlig präzise berechnen, da sie ihrer Form nach zwischen
Die
messungen
ebener
und
die infizierten Gewebe
sphärischer
Fläche lagen.
Ihre Größe betrug annähernd
Messungen Knollen mit möglichst ebenen und
gleichen Oberflächen gewählt wurden, konnten die Abweichungen von
2,99
qcm.
Da
für
die
dieser angenommenen Größe
sehr gering sein und wuraen bei der
nur
Auswertung der gewonnenen Zahlen nicht in Betracht gezogen. Abb. 25
gibt die Temperatur- und Kohlensäurekurven graphisch wieder. Aus
Abb. 26 ersieht
man
die
Anlage
der Thermoelemente und
stufe beim Abschluß des Versuches.
die Infektions¬
Der Einfluß der Infektion auf die
Ein
5
1/20
n
soll die
Beispiel
371
usw.
der Kohlensänreabgabe erläutern.
Barytlauge entsprachen 11,683 com
Berechnung
annähernd
der
ccm
Temperatur
1/10
n
der
annähernd
Salzsäure.
Faktor der Säure
Titer der
Lauge
0,9646.
nach
Absorption
der Kohlensäure
9,695
ccm
der annähernd
1/20
n
Salzsäure.
Differenz des Titers 1,988
1,988
1
1/20
ccm
Die in
2,109
=
X Faktor
cem
0,9646
entspricht 1,1
1,9176
—
fünf Stunden
von
den
n
Salzsäure.
exakt
ccm
1/20
n
Salzsäure.
mg Kohlensäure.
Salzsäure
n
1/20
annähernd
ccm
infizierten Geweben
abgegebene Kohlensäuremenge
mg.
an der gesunden Hälfte abgegebene Kohlensäuremenge
0,451
abgegebenen Kohlensäuremenge der infizierten Gewebe, bezogen
Zur selben Zeit
Prozent der
Abgabe
die
der
=
gesunden Gewebe
=
2,109 X 100
7yÄK\
=
mg.
auf
467,63 %•
Tabelle 7.
Ergebnisse
an
halbierter, mit
Bac.
der
phytophthorus
Temperaturdifferenzen
der infizierten Gewebe
Jh
1>
Ö
R
42
rg
"-H
nnd
Temperatur-
Kohlensäureniessungen
infizierter Knolle der Sorte Kaiserkrone.
(Versuch 7. Objekt 134.)
°
C, Kohlensäureabgabe der gesunden Gewebe in mg,
in °/,, bezogen auf die Abgabe der gesunden Gewebe.
in
Temperaiuruuiereiizen
Kohlensäureabgabe
in
v
v
O
^1
3
m
«
=2
hm
5
-0,01958
0,02244
0,02244
0,01897
0,01795
0,01979
10
15
25
30
35
-
-
+
-
-
-
-
-
0,10424
-0,10771
-0,13321
60
-
-
65
70
75
-
80
-
85
-
-
95
100
140
Phyiopath.
4-
-)+
44+
+
4-
-
Heft
-
-
0,00640
-
0;00931
-
0,04113
0,04190
0,05607
0,05568
0,05141
0,04481
0,04326
0,04074
0,03880
-
4
-
0,01164
0,00425
0,00637
0,00598
0,00560
0,00733
0,01023
-
-
0,02716
0,03861
0,00367
-|-0,01119
0,01100
0,00989
0,01183
0,01998
+ 0,02891
0,09649
0,04814
Z. Bd. 4
-
-
-
-
.
0,01621
0,02316
0,03281
+ 0,03879
1
-
-
-
r
4- 0,04675
4 0,04540
-
-
-
-\- 0,04947
-0,16136
+ 0,15769
4- 0,14606
0,13668
-0,12852
0,12240
-
—
-f 0,05180
0,14158
0,14015
0,14015
-
135
0,00272
0,00989
0,00989
0,00695
0,00427
-f- 0;05451
-0,14015
-0,14015
0,15994
90
130
-
-
55
125
-
-
50
120
-
0,02468
L
0,03080
0,04039
0,05651
0,08017
45
115
-
-
-
40
110
-
-
20
105
-
-
erkrankter
Gewebe
Gewebe
mg
la
0,640
0,474
0,380
0,377
0,365
86,57
144,74
175,70
176,90
150,29
159,32
157,06
165,17
183,76
200,96
214,20
240,00
371,56
733,44
723,93
763,86
957,91
913,72
917,82
998,78
960,37
936,45
561,16
258,91
Element 7
Element 5
Element 3
gesunder
0,05365
0,04748
0,03667
4- 0,03551
0,03628
0,03435
A 0,04381
0,04439
0,04227
+ 0,03957
0,03725
0,03493
0,03339
0,03127
~i
0,02169
-
-
-
|
-
'
'
,
!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,342
0,361
0,353
0,333
0,332
0,336
0,334
0,347
0,333
0,346
0,352
0,335
0,348
0,351
0,349
0,348
0,352
0,347
0,346
0,353
0,350
0,346
0,348
231,23
234,24
73,70
31,10
26
Max
372
7, Objekt 134. Infektionsstelle innerhalb des Kezipienten.
Versuch
63 Stunden
Versuchsobjekt
der
Sorte
sechs
vor
Die
Kultur.
alter
Beginn
messungen fünf Stunden nach Infektion.
der
und
Thermoelemente
des
Bacillus
Temperatur-
ersten
Die Infektionsstufe beim Abschluß
halbierte
des Versuches
Infektionsmaterial
,.Kaiserkrone".
Tage
Eglits:
Das
Übrige
phytophtJiorus
wie bei
in Abb. 28
aus
Kohlensäure¬
und
Versuches sowie
Rezipienten sind
Knolle
die
Versuch 6.
Anlage
der
Der
dargestellt.
+ Pol des Thermoelementes 3 befand sich innerhalb des Rezipienten.
an
ZCOz
1000
10
30
20
40
50
60
70
90
80
100 110 120 130 «Ostunden
Abb. 27.
und Kohlensäurekuryen
Temperatur-
zum
der
der
Infektionsstelle,
sterilen Hälfte.
nicht infizierten
2 cm,
Element
Versuches sind
Die
—
Pol innerhalb des anderen
aus
4
cm
Objekt
134.
Rezipienten,
an
der
Rezipienten, an die
der Richtung zum Kronenende, Element 5,
Die Ergebnisse des
entfernt vom Element 3.
übrigen
Gewebe, in
7,
Versuch 7,
Kohlensäurekurve.
Temperaturkurven,
Elemente außerhalb der
der Tabelle 7 und Abb. 27
zu
ersehen.
Versuch 8, Objekt 135. Infektionsstelle innerhalb des Rezipienten.
Versuchsobjekt eine 64 Stunden vor Beginn des Versuches halbierte
Knolle der Sorte „Kaiserkrone". Infektionsmaterial Bacillus phytophtJiorus
Als
aus
acht
Tage
alter Kultur.
durchgeführter Infektion
Die
erste
Temperaturmessung sofort
und Abschluß des
nach
Versuchskastens, die folgenden
Der Einfluß der Infektion auf die
nach
Messungen
je fünf
Versuchsergebnisse
Stunden.
in
sind
anschaulicht die thermischen
Übrige
Das
Tabelle
Temperatur
wie
bei Versuch 6.
Die
29
ver¬
zusammengefaßt.
8
in
Vorgänge
373
usw.
Abb.
der infizierten Hälfte und
die
Tabelle 8.
Ergebnisse
an
halbierter,
mit Bac.
phytophthorus
(Versuch 8.
Temperaturdifferenzen
~
o
C ^5
œ
Element 3
Element 5
lu
der
Sorte
Kaiserkrone.
Objekt 135.)
auf die
°/0, bezogen
O-eiiiperaiiuuiuereiizeju
a
u
CO
Knolle
infizierter
C, Kohlensäureabgabe
°
in
der infizierten Gewebe in
ö
nnd Kohlensäuremessungen
Temperatur-
der
O
der
gesunden Gewebe
Abgabe
der
gesunden
in mg,
Gewebe.
Kohlensäureabgabe
/
v^
gesunder
erkrankter
Gewebe
Gewebe
Element 7
mg
0,01836
0,02856
—
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
-
0,05006
0,06283
+ 0,09323
U 0,10384
0,10547
-0,10404
0,10465
0,09649
0,08405
-0,07936
0,08384
0,08629
+ 0,08588
-j- 0,08609
-j- 0,09241
-0,10118
0,10363
0,10669
0,10730
0,11363
-
-
-
-
-
>-
-
-
-
-
-
-
115
+ 0,11893
+ 0,12811
120
4-
110
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
215
220
225
0,13036
0,13586
0,13648
0,13852
0,14402
0,14892
0,15341
-0,15341
0,15422
-0,15810
-0,17177
-
-
-
-
-
-
-
0,13199
-0,12485
0,09751
-
-
-
-
-
-
—
-
0,05590
0,05426
0,04141
0,02468
0,00102
0,00204
0,02774
—
0,01377
-0,02910
0,03958
0,04947
-
-
-
-
0,05296
0.05432
-
0^05374
-
-0,04113
+ 0,02184
-0,01959
-0,01591
0,02153
0,02563
-
-
0,02153
-
-0,01610
-0,01513
-0,01876
0,02076
0,02153
0,02483
0,02813
0,03065
1- 0,02966
0,03104
0,03182
-0,03162
0,03201
-0,03162
0,03317
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,03725
-j- 0,03861
4- 0,03764
0,03492
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,03240
0,03162
0,03667
0,03725
0,03550
0,03162
0,02677
0,02018
0,01707
0.01009
0,00444
-0,01139
0,02084
0,02818
0,04381
0,05732
0,05848
0,06215
-
-
-
-
-
-
-
0,06755
-
0,06697
0,05848
0,04825
0,04536
0,04439
0,04458
+ 0,04362
0,04497
0,04709
0,05037
0,05327
0,05539
0,05848
0,06060
r 0,06504
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,06755
0,07083
0,07180
0,06948
0,07450
0,07662
0,08125
0,07894
0,07855
0,07894
0,08492
0,08415
0,08396
0,06427
0,05404
0,05462
0,05423
0,04806
-0,03146
0,02355
-
-
-
-
0,774
0,196
0,314
0,312
0,314
0,318
0,311
0,313
0,312
0,318
0,315
0,314
0,317
0,319
0,317
0,314
0,312
0,318
0,313
0,317
0,312
0,316
0,314
0,313
0,318
0,312
0,316
0,313
0,318
0,312
0,313
0,312
0,318
0,316
0,313
0,317
0,320
0,317
0,320
0,323
—
—
0,318
280,82
122,70
194,95
207,82
223,99
225,67
304,78
382,04
589,12
546,00
493,27
546,96
570,90
569,10
571,91
580,41
632,65
633,33
682,37
672,11
674,83
667,79
747,64
774,92
801,68
904,08
894,30
882,71
860,94
864,97
869,82
871,09
636,36
519,46
472,20
287,92
99,34
95,65
96,48
93,09
—
—
94,28
26*
Eglits:
Max
374
Kohlensäureabgabe
der Infektionsstelle.
an
die
stufe beim Abschluß des Versuches und
der
der Thermoelemente
Anlage
3
Die Pole des Thermoelementes
Rezipienten.
und der
Thermoelement 7
Rezipienten angebracht.
ment
^3
3
innerhalb
waren
entfernt
cm
Ele.
vom
4
Element 5
Nabelende,
am
entfernt
2
die Infektions¬
zeigt
Abb. 30
cm
Kronenende.
am
Versuch
Objekt
9,
tionsstelle innerhalb des
Infek¬
136.
Ver¬
Rezipienten.
suchsobjekt frühe Speisekartoffel „Fischli".
Stunden
71
vor
Beginn
Versuches
des
Infektionsmaterial Bacillus
halbiert.
tophthorus
aus
sieben
Tage
alter
phy-
Kultur.
Temperaturmessung sofort
Die erste
nach
Infektion und Abschluß des
durchgeführter
Versuchskastens, die folgenden Messungen
Abb. 32 zeigt die
nach je fünf Stunden.
13^
ObjeKr
Abb. 28.
der Thermoelemente
Anlage
und der
suches und die
Die Infektionsstufe bei Versuch 7.
ende,
cm
entfernt
fläche.
Die
von
Anlage
Rezipienten. Element 5 am
Element 3 am Kronenende,
den Polen des Elementes
Versuchsergebnisse
sind
Nabel¬
beide
unweit der verkorkten Schnitt¬
7,
Tabelle 9 und Abb. 31
aus
Ver¬
des
der Thermoelemente
und der
Hälfte natürlicher Größe.
4
Abschluß
beim
Infektionsstufe
Rezipienten.
zu
ersehen.
SCO.,
-\10OO
"
000
'"
'-
0bjekM35
°c
om
^
/
-
,
016
ou
Oll
''
-
\
U04
A
y£$^
'
010
\
^_^^
*'
;
-
^-^
.—-y
üg^-2"—
"
/tf
Element
5
500
\
\\___^
^,
^
w—-""'
002
-
\
/"^
\
ooa
006
~^\
r-J
-
V^
____
L-
\
^"^V^"
0
1
1
10
ZO
30
i
i
i
i
40
50
60
70
SO
90 100 110 110 130 140 150 160 170 ISO 190200210 220 Stunden
Abb. 29.
Temperatur-
und Kohlensäurekurven
Temperaturkurven,
Versuch
pienten.
Beginn
10, Objekt
Versuchsobjekt
137.
frühe
des Versuches halbiert.
zum
Versuch
8, Objekt
135.
Kohlensäurekurven.
Die Infektionsstelle außerhalb des Rezi¬
Speisekartoffel .,Fischli",
Infektionsmaterial
71 Stunden
Bacillus
vor
phytophthorus
fünf Tage alter Kultur.
Die erste Temperaturmessung sofort nach
durchgeführter Infektion und Abschluß des Versuchskastens. Die folgenden
aus
Der Einfluß der Infektion auf die
Temperatur
375
usw.
Tabelle 9.
Ergebnisse
der
Temperatur-
und
Kohlensäuremessungen
phytophthorus infizierter Knolle der Sorte
(Versuch 9. Objekt 136.)
Temperaturdifferenzen in c C, Kohlensäureabgabe der gesunden Gewebe
an
halbierter,
mit Bac.
der infizierten Gewebe in
S
prt
n
a
&>
o
Temperaturdifferenzen
in
+^
J S"2
S
U/0I bezogen
auf
Koblensäureaba'abe
J
Element 7
Element 3
Element 5
Cm
+ 0,00592
4- 0,01000
0,00386
0,01274
-0,01698
0,01988
-
5
-
10
15
BO
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
-
-
20
25
-1-
-
0,02567
0,03567
0,02528
+ 0,02316
|- 0,02593
-j- 0,02702
-)- 0,03300
-0,03242
-| 0,02992
+ 0,02895
-|- 0.02779
-j- 0,02856
'4- 0,02007
-0,01563
-f- 0,01409
-0,01467
-0,02316
-0,02895
-
-
-
-
-
h
120
4-
-
-
i
-
0.03783
-
-
0,04671
i-
0,05385
-
135
4- 0,06427
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
-
-
r
-
-
0,06562
0,07585
0,06948
362,22
678,91
614,29
666,67
732,35
701,12
744,44
726,06
715,63
702,53
—
0,193
0,191
0,180
0,189
0,172
0,175
0,00291
0,00340
0,00194
0,00155
0,00116
0,00039
0,00407
0,170
0,168
0,00078
0,174
0,180
0,178
0,184
0,177
0
0,00039
0,00253
0,00194
0,00155
0,00058
—0,00136
0,00136
0,00116
0,00194
0,00175
0,00039
-
0.189
—
0,185
0,174
—
;
0.168
-
0,180
0,178
-
-
0,187
-
0,180
0,175
0,178
—
+
0
0,181
-|- 0,00233
4- 0,00213
4- 0,00058
0,00039
0,185
0,185
0,174
0,00039
0,00233
0,00776
0,01319
0,01785
0,01824
0,01846
0,172
0,178
0,185
0,01940
0,02018
0,02173
0,185
0,179
0,188
0,178
0,179
-
-
-
-
-
-
—
-
0,146
0,156
0.176
—
-
h
—
0,00136
0,00194
0,00194
+ 0,00601
+ 0,00795
+ 0,00621
0.03455
-
7o
-j- 0,00407
0,04555
-
mg
+ 0,00621
-
0,02528
-0,01737
-0,01370
-0,01158
0,00907
-0,00811
0,00637
0,00579
0,00222
Gewebe
0,02081
-0,01734
0,01387
0,01040
0,00612
-
0,06659
0,06404
0,06099
0,05558
erkrankter
Gewebe
0,02326
-
-
0;02244
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 0,06311
150
—
—
-
-j-0,06176
-
—
0.01285
0,01204
0,01142
0,01204
0,01163
0,01204
-0,01040
-0,01142
0,01285
0,01795
0,02448
0,02448
130
-T-
—
-
125
145
-
-
-
140
—
0,01081
0,01428
0,01428
-
-
115
.
0,01428
0,01469
-0,01693
-0,01632
-
-
—
0,00938
0,00714
-
-
gesunder
+ 0,00388
—
-0.01326
-
—
—
—
-
—
—
—
-
-
0,00245
0,00102
0,00184
0,00102
0,00041
0,00755
0,01000
0,01346
0,01244
0,01224
0,01265
0,01224
0,178
0,188
0,175
—
-
—
—
—
—
—
—
—
—
0,01163
-
0,01163
—
0,01163
in mg,
die Abgabe der gesunden Gewebe.
C
°
Fischli.
-
0,02153
0,02134
0,176
0,184
0,189
0,188
!
558,54
470,00
436,90
362,44
346,11
321,91
325,71
341,46
352,53
282,94
219,05
187,90
288,17
421,82
690,48
836,84
883,73
885,71
941,24
1000,57
1009,20
1063,41
950,30
828,39
772,62
730,29
748,80
657,23
541,01
512,99
425,71
300,00
242,37
131,55
88,76
Max
376
Messungen nach je fünf Stunden.
Abschluß
des Versuches
Beide
Rezipienten.
die
und
Rezipienten
+ Pol des Elementes 7
an
Eglits-
zeigt
der Thermoelemente
also
—
Pol
der sterilen Hälfte.
7, an
ben, Element 3
Element
7
ment
cm
suchsergebnisse sind
die
entfernt
aus
Abb. 30.
Anlage
elemente und der
der Thermo
Kohlensäureabgabe
Rezipienten.
Hälfte der natürlichen Größe.
Objekt
7, Objekt
°/0, beim Versuch 8, Objekt 135 nach
such 9, Objekt 136 nach 160 Stunden mit
säureabgabe schnell bis unter die Norm
20
hal¬
in
den
ange¬
erheblichen
einer
Im
Versuch
6,
schon nach 60 Stunden ein
467
°/0
der
Kohlensäure¬
gesunden Gewebe. Beim
der
Ver¬
134 tritt das Maximum nach 100 Stunden ein und erreicht
999
10
an
ergeben, daß
133 tritt das Maximum der Kohlen¬
beträgt
abgabe
such
Geweben
säureabgabe
und
Die Ver¬
Tabelle 10 und
Steigerung unterliegt.
Die Infektionsstufe beim Abschluß
Ele¬
vom
Kohlensäuremessungen
griffenen
vom
infizierten Gewe¬
bierten infizierten Knollen
>I35
inner¬
entfernt
ersehen.
zu
Die
cm
den Nabelenden.
an
Abb. 33
2
nicht
5
Rezipienten,
gleichen Ende
am
Element 5
Rezipienten,
halb der
des Versuches 8.
der
Der
der Infektionsstelle außerhalb des
+3
Objekr
und
nicht infizierten Geweben.
an
Kronenende der einen Hälfte der Knolle, der
am
die Infektionsstufe beim
Abb. 34
Anlage
30
40
50
60
70
60
130 Stunden mit 904
1063
der
°/0.
°/0,
Darauf sinkt die Kohlen¬
gesunden Gewebe.
00 100 110 120 130 140 150 160 170 1BO 190 200 210 220 Stunden
Abb. 31.
Temperatur-
beim Ver¬
und Kohlensäurekurven
Temperaturkurven,
zum
Versuch 9,
Objekt
Kohlensäurekurve.
136.
Der Einfluß der Infektion auf die
Temperatur
377
usw.
Die Kohlensäureabgabe der gesunden Gewebe ist bei den zwei an¬
gewandten Sorten verschieden. Bei der Sorte „Kaiserkrone" schwankt
Bei „Fischli-1 ist sie
sie im Bereich von 0,31—0,47 mg in fünf Stunden.
Diese großen Differenzen
erheblich niedriger und beträgt 0,17—0,20 mg.
beruhen wohl teilweise auf
auf
Provenienz
und
dem
teilweise vielleicht
Sorteneigentümlichkeiten,
Alter
Knollen.
der
„Kaiserkrone"
Die
Knollen
stammten
der
von
der
Sorte
Ernte des
Jahres
1931, die der „Fischli-' von 1932. Auch
die Temperatursteigerungen bei
der Sorte
„Kaiserkrone-' sind erheblich größer und er¬
reichen im Versuch 8 0,17177 ° C. Bei „Fischli"
ist die höchsterzielte Temperatursteigerung
Objekl"
Objekt-
137
136
Abb. 32.
Die Infektionsstufe
20
10
30
40
SO
60
beim Abschluß des Versuches 9.
Anlage
der Thermoelemente
und der
70
aO
100 110 120 130 140 «OStunder»
90
Abb. 33
Temperatur-
Rezipienten.
und Kohlensaurekurven
10, Objekt
Versuch
zum
—Temperaturkurven,
Hälfte naturlicher Große.
137
Kohlensaurekurve
im Versuch 4, Objekt 38, und betragt nur 0,11995° C.
Die ausgeprägte
Zweigipfligkeit der Kohlensäurekurve im Versuch 9, Objekt 136, ist wohl
auf den unregelmäßigen Verlauf der Infektion
des Versuches zurückzuführen.
Beginn
zu
lativ ist die
Steigerung
der infizierten
Re¬
Kohlensäareabgabe
der
Gewebe bei den beiden Sorten
annähernd
Die
gleich.
Temperatur-
verlaufen nicht ganz
der
absoluten
13 7
darstellen,
Abb. 34.
Die Infektionsstufe
oeim
Abschluß des Versuches 10.
Anlage
nur
Rezipienten.
Hälfte natürlicher Größe.
die
Dieses
auch
war
bei
erwarten,
zu
Kohlensäuremengen
fünfstündiger
Temperaturmessungen
einen
Produktion
von
die Differenzen
zum
Moment der
dagegen
Messungen
angeben.
der Thermoelemente
und der
Wert
parallel.
Methode
die gemessenen
da
ObjeKI-
angewandten
und Kohlensäurekurven
Versuch
tionsstelle
10, Objekt 137,
außerhalb
des
mit der Infek¬
Rezipienten, bringt
daß auch in
den scheinbar ge¬
Infektionsherdes,
säureabgabe stattfindet. Infolgedessen ist anzunehmen,
daß auch die Tem-
sunden
Geweben,
den
außerhalb
Nachweis,
des
eine
erhöhte Kohlen¬
378
Max
peratursteigerungen
der Wärme
Eglits:
in diesen Geweben nicht auf mechanischer
Infektionsherd beruhen,
vom
sondern
Ausbreitung-
bei der Infektion
daß
physiologischer Prozeß stattfindet, der auch die vom Parasiten nicht
direkt angegriffenen Gewebe der Wirtspflanze in Anspruch nimmt.
ein
Aus den vorstehenden Versuchen lassen sich noch keine
endgültigen
Temperatursteigerungen und der erhöhten
Kohlensäureabgabe ziehen. Im gegebenen Falle scheint die von Schellen
berg wie auch Palladin, Fischer und Gäumann, 1929, S. 372, ver¬
tretene Anschauung sich zu bestätigen, daß es sich bei der Infektion um
Stoffwechselprodukte oder toxische Stoffe handelt, die vom Parasiten aus¬
Schlüsse
zu
einer Theorie der
-
Tabelle 10.
Ergebnisse der Temperaturan
halbierter,
mit Bac.
(Versuch
Temperaturdifferenzen
und
in
°
10.
Kohlensäuremessungen
infizierter Knolle der Sorte Fischli.
phytophthorus
Objekt 137.)
C, Kohlensäureabgabe
der durch Infektion beeinflußten Gewebe in
der
gesunden
u/(, bezogen
auf
Gewebe in mg,
die
Abgabe
der
gesunden Gewebe.
r-*
^
iraturdilferenzen in
Kohlensäureabgabe
n
v^
~
<D
Ö
Temp
c
*
—
O
gesunder
ja
-^£0 0
œ öm
5
Element 7
+ 0,00058
+ 0,00174
10
-j- 0,00579
15
+ 0,00772
+ 0,01312
+ 0,01158
+ 0,01756
+ 0,01853
+ 0,02799
4- 0,04304
+ 0,04246
+ 0,04632
+ 0,04748
+ 0,05057
+ 0,05365
0,05848
20
25
30
35
40
45
50
55
60
.65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
-
0,05922
0,06369
0,07122
0,07604
0,07334
0,07257
-0,06639
0,06533
0,06562
+ 0,06533
+ 0,05674
+ 0,05230
+ 0,04786
+ 0,03918
HL- 0,02567
-
-
-
-
-
-
-
-
Element 5
+ 0,00601
+
0
0,00019
0,00175
0,00233
0,00504
0,00776
0,00679
+ 0,00834
+ 0,01416
+ 0.01358
+ 0,01688
+ 0,01688
+ 0,01921
+ 0,02192
+ 0,02658
+ 0,02774
+ 0,02949
+ 0,03414
+ 0,03861
+ 0,03686
+ 0,03473
-0,02871
0,02755
0,02522
0,02561
0,02309
0,02056
-0,01610
0,00970
0,00757
+
+
+
+
+
+
-
-
Element 3
—
-
-
-
+ 0,00041
+ 0,00224
+ 0,00265
+ 0,00245
+ 0,00265
+ 0,003ü9
0,00408
-
-
-
-
-
-
-
-0,01122
0,01244
0,01346
0,01224
0,00979
0,00836
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00388
0,00428
0,00530
0,00836
0,00877
+ 0,00836
-
-
0,00204
+ 0,00163
-
-
0,02448
0,01428
0,00326
-
-
-
-
0.00755
0,00673
0,00653
0,00612
0,00551
0,00326
0,00265
Gewebe
d. Infektion
beeinflußter
von
Gewebe
mg
7.
0,229
0,205
0,197
0,195
0,192
0,195
0,188
0,191
0,188
0,180
0,177
0,180
0,184
0,178
0,180
0,185
0,183
0,177
0,180
0,178
0,177
0,184
0,187
0,185
0,177
0,175
0,178
0,175
0,178
0,176
152,31
170,46
187,10
197,28
200,00
189,62
182,48
192,22
207,34
213,53
219,76
214,71
233,53
264,29
282,35
281,33
288,95
298,80
292,35
228,69
158,68
128,07
98,30
82,18
63,47
49,70
33,93
33,93
29,17
28,92
Der Einfluß der Infektion auf die
geschieden werden
und die auf die Gewebe der
Infektion
einwirken,
die Gewebe
379
usw.
Wirtspflanze
ähnlich den
Stoife,
Beginn
Reizwirkungen hervor,
dieser
Schwache Dosen
Narkotika einwirken.
auf
Temperatur
rufen
die
zu
gesteigerte Kohlensäureabgabe auslösen, stärkere Dosen, die
schreiten der Infektion entstehen, wirken dagegen hemmend.
der
die
Vor¬
beim
Zusammenfassung der Ergebnisse.
1. Es wird eine
differenzen
Die
schrieben.
gemessen, die
Apparatur
und Methode
Kohlensäureabgabe
und
Messung
von
Temperatur¬
Kartoffelknollen
werden auf elektrometrischem
Temperaturdifferenzen
Kohlensäureabgabe wird
2. Die Infektion mit Bacillus
steigerungen
zur
infizierten
an
durch Titration
be¬
Wege
bestimmt.
phytopkthorus ruft wesentliche Temperatur¬
in infizierten Geweben hervor. Diese
Temperatursteigerungen
Kohlensäureabgabe begleitet.
Temperatursteigerungen und die erhöhte Kohlensäureabgabe
in den angegriffenen Geweben auf, sondern es werden
nur
sind mit erhöhter
3. Die
nicht
treten
alle Gewebe der infizierten Knolle in Mitleidenschaft gezogen. Am stärksten
macht sich
Erscheinung
diese
jedoch
4. Die erhöhte
Kohlensäureabgabe
Objekten
Nach
Temperatursteigerungen
gewisser Zeitspanne, die
Depression ein, die sich
gleiche ist, tritt
angegriffenen, wie auch auf
die
nicht
sowohl auf die direkt
und die
Erscheinungen.
sind keine andauernden
bei allen
Infektionsherd bemerkbar.
am
die scheinbar
gesunden
Gewebe bezieht.
5. Diese
Erscheinung beruht
ausgeschieden
Parasiten
offenbar auf toxischen
Stoffen, die vom
Wirtspflanze
die auf die Gewebe der
werden und
einwirken.
Zitierte Literatur.
Evans, I. B. P.
infected
Fischer,
and
Eise
M. P., 1922.
E.,
1929.
1932.
Über
Gäumann,
Ed. und
in
Temperature
of
Living
Plant Tissue when
S. 480-481.
Nature, CX,
by Parasitic Fungus.
Biologie
der
pflanzenbewohnenden parasi¬
tischen Pilze.
G aß
n
er,
G. und
Goeze, G.,
milationsgröße
von
Weizenblättern.
der Deutschen Botanischen
Lieb,
H. und Kr ai
durch
nasse
nick,
H.
Gesellschaft, La,
G.,
Verbrennung.
den Einfluß der
Festschrift
1931.
Eine
Mikrochemie,
zur
Kaliernährung auf die Assijährigen Bestehens
Feier des 50
S. 412—483.
Mikrob^stimmung des Kohlenstoffs
Jahrgang IX, Neue Folge, Band III,
neue
S. 367—384.
Pregl, Fr., 1930. Die quantitive organische Mikroanalyse.
Tiessen, H., 1912. Über die im Pflanzengewebe nach Verletzung auftretende Wund¬
wärme.
Beiträge zur Biologie der Pflanzen, 11, S. 53—106.
Tob 1er, Fr., 1931, Untersuchungen über Immunität und Immunisierung im Pflanzen¬
Die Naturwissenschaften, 19. S. 413—416.
reich.
•
Curriculum vitae.
Ich, Max Eglits, Sohn des Jakob Eglits und seiner Ehefrau
Anna, geb. Lap sin, bin geboren am 13. April 1892 in Gut Starti, Kreis
Cesis, Lettland. Ich besuchte die Börsenkommerzschule in Riga, bestand
1910 die Maturität kommerzwissenschaftlicher Richtung, welche die gleichen
Rechte verleiht wie die Realmaturität.
1910—1918 studierte ich
an
der
landwirtschaftlichen Fakultät des
polytechnischen Institutes in Riga und
Moskau, da das Institut inzwischen dorthin
evakuiert war, das Diplom eines gelehrten Agronomen erster Kategorie.
Nach dem Befreiungskriege trat ich im Jahre 1922 als Assistent
für Pflanzenpathologie der Lettländischen Universität in
am Katheder
Riga ein. Im Jahre 1926 habilitierte ich mich für das Fach „Pflanzen¬
erwarb
im Jahre
pathologie
1918
in
und Pflanzenschutz"
und wurde
zum
Leiter des
logischen Kabinettes der Lettländischen Universität
Jahre 1928 wurde ich
zum
in
Riga
pflanzenpatho¬
ernannt.
Im
Dozenten ernannt.
1930, 1931 und 1932 habe ich je im Sommersemester
spezielle Botanik der Eidgenössischen Technischen Hoch¬
schule bei Herrn Professor Dr. E. Gäumann über pflanzenpathologische
Fragen gearbeitet.
In den Jahren
im Institut für