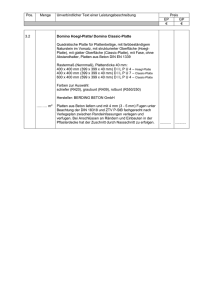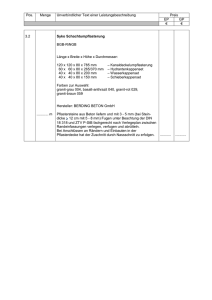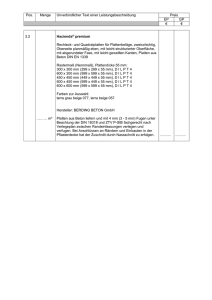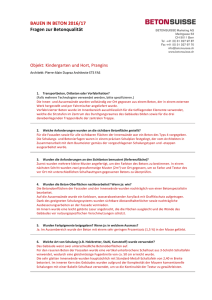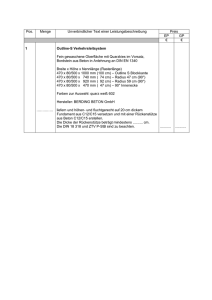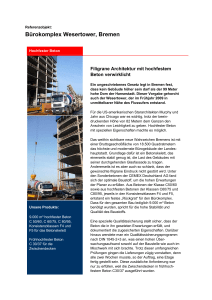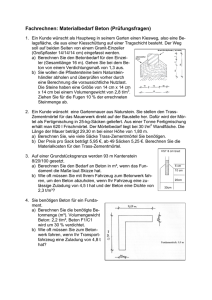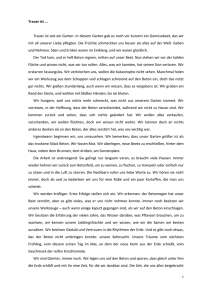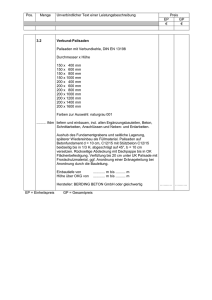MPVA-Spektrum Beton
Werbung

MPVA-Spektrum Beton Schäden an Bauteilen aus Beton (Teil 5) Schäden an Betonbauteilen durch eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) An stark durchfeuchteten Bauteilen aus Beton, insbesondere wenn weitere Belastungen wie der Eintrag von Alkalien von außen oder starke dynamische Beanspruchungen vorliegen, kann es zu einer schädigenden Alkali-KieselsäureReaktion (AKR) im Beton kommen. Diese kann letztendlich zu einer völligen Zerstörung des Betonbauteils führen. National wie international sind viele AKR-Schäden, insbesondere an Fahrbahndecken und Flugplatzbelägen sowie an Küstenbauwerken und Brücken dokumentiert. Diese Schäden zeichnen sich üblicherweise aus durch: • die Entstehung eines maschenartigen Rissbildes und • die Bildung von Sekundärmineralien und Gel in den Rissen. AKR-Schäden • sachgerechte Erhebungen zum Bauwerk und den verwendeten Ausgangsstoffen; • eine genaue Aufnahme des Schadensbildes und • die Durchführung von Untersuchungen an Ausbauproben lässt sich die Schadensursache häufig trotzdem ermitteln. Besondere Bedeutung kommt hierbei der mikroskopischen und petrografischen Untersuchung der Proben zu. Rissbildung aufgrund einer AKR In vielen Fällen sind die Sekundärmineralien oder das Gel in den Rissen zum Zeitpunkt der Probenahme z. B. aufgrund der Auswaschung durch Regenwasser nicht mehr nachweisbar. Voraussetzung für eine betonschädigende Alkali-Kieselsäure-Reaktion sind: • ein ausreichendes Alkalipotenzial; • alkaliempfindliche gen; Eine Abgrenzung zu anderen rissbildenden Schadensmechanismen ist nicht immer einfach. Zur Festlegung eines sachgerechten Sanierungsvorschlags ist die genaue Kenntnis der Schadensursache jedoch zwingend notwendig. Durch Gesteinskörnun- • eine ausreichende Feuchtezufuhr. So lassen sich charakteristische Merkmale für bestimmte Betonschäden wie auch der AKR durch licht- und rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen erkennen. Weitere Hinweise auf die AKR als mögliche Schadensursache können durch • Alkaligehaltsbestimmungen; • Untersuchungen mit Uranylacetat; • Nebelkammerversuche bzw. • Schnelltests an Ausbauproben gewonnen werden. _______________________________________________________________________________________________________________________________________ Ausgabe 2010 MPVA Neuwied GmbH, Sandkauler Weg 1 in 56564 Neuwied Tel.: 02631 / 39 93-0 • Fax: 02631 / 39 93-40 • e-Mail: [email protected] • Internet: www.mpva.de Schäden an Bauteilen aus Beton (Teil 5) Seite 2 ___________________________________________________________________ Nebelkammerlagerung Betone mit einem ausreichenden Widerstand gegen Frost- bzw. Frost-Taumittel-Angriffe können nach DIN 1045-2 bis zur Expositionsklasse XF3 ohne Einsatz eines Luftporenbildners hergestellt werden. In diesem Falle muss der Beton im allgemeinen einen w/z-Wert von < 0,50 und eine Festigkeitsklasse von > C35/45 aufweisen. Bei Betonen der Expositionsklasse XF4 muss nach den Normvorgaben im Gegensatz dazu ein Luftporenbildner eingesetzt werden. Hierbei sind die Luftporengehalte im Frischbeton nach DIN EN 12 350-7 nachzuweisen. Da beim Pumpen des Betons die Gefahr der Reduzierung der für die Frost-Taumittelbeständigkeit relevanten Luftporen besteht, sollte die Prüfung des Luftgehaltes i. d. R. nach dem Pumpen erfolgen. Betonabplatzungen aufgrund eines nicht ausreichenden Frost- und Frost-Taumittelwiderstandes des Betons Immer wieder sind Abplatzungen an Betonbauteilen, die dem Frost ausgesetzt sind, die Ursache für Beanstandungen. Die Sachverständigen haben im Schadensfall bei diesen Schäden üblicherweise u. a. die Frage zu beantworten, ob es sich bei dem eingebrachten Beton um einen Beton mit einem ausreichenden Widerstand gegen Frost- bzw. FrostTaumittel-Angriffe handelt. Frostschäden Sind keine Ergebnisse entsprechender Prüfungen am Frischbeton verfügbar, so kann eine nachträgliche Beurteilung des Frost-Taumittelwiderstandes des Betons nur anhand von Proben erfolgen, die aus dem Bauteil entnommen werden. An diesen Proben können im Labor die sog. Luftporenkennwerte (Gesamtluftgehalt und Abstandsfaktor) mikroskopisch ermittelt werden. Auf Grundlage dieser Ergebnisse kann der Widerstand des Betons gegenüber Frost-Taumittel-Angriffen nachgewiesen werden. Betonabplatzungen wegen nicht ausreichender Gefrierbeständigkeit des Betons Neben den oben erwähnten Schäden aufgrund eines nicht ausreichenden Widerstandes gegen Frost- bzw. Frost-Taumittel treten während der Bauphase in der kalten Jahreszeit häufig Betonabplatzungen auf, welche auf die einmalige Einwirkung von Frost auf den noch nicht ausreichend erhärteten Beton zurückzuführen sind. Diese Schäden werden vielfach ebenfalls als Frostschäden bezeichnet, wobei dieser Schaden aufgrund der andersartigen Schadensentstehung vielmehr als Gefrierschaden bezeichnet werden sollte. Diese Schäden können auch bei Betonen mit erhöhtem Widerstand gegen Frost-Taumittel-Angriffe auftreten. _______________________________________________________________________________________________________________________________________ MPVA Neuwied GmbH, Sandkauler Weg 1 in 56564 Neuwied Tel.: 02631 / 39 93-0 • Fax: 02631 / 39 93-40 • e-Mail: [email protected] • Internet: www.mpva.de Schäden an Bauteilen aus Beton (Teil 5) Seite 3 ___________________________________________________________________ Gefrierschäden sind ursächlich darauf zurückzuführen, dass der Beton zum Zeitpunkt der ersten Frostbeanspruchung noch keine ausrei2 chende Druckfestigkeit (> 5 N/mm ) besitzt. Ein Gefrierschaden zeichnet sich durch geringe Betondruckfestigkeiten und starke Gefügestörungen im oberflächennahen Beton aus. Häufig sind unter dem Mikroskop oder sogar augenscheinlich Eisnadelabdrücke im Betongefüge erkennbar. Derartige Gefrierschäden können dadurch vermieden werden, dass Bauteile, die kurz vor einem Frosteinbruch betoniert werden, vor dem oberflächlichen Gefrieren geschützt werden (Winterbaumaßnahmen). Alternativ können, nach Rücksprache mit dem Planer, höherwertige bzw. schneller abbindende Betone eingesetzt werden. In den tiefer liegenden Bereichen der Bauteile weist der Beton normalerweise keine signifikanten Qualitätsbeeinträchtigungen auf, so dass die üblicherweise betroffenen Bauteile aus Beton (häufig handelt es sich um Bodenoder Deckenplatten) im Normalfall nicht vollständig rückgebaut werden müssen. Vielmehr sind üblicherweise nur die geschädigten Betonrandzonen zu entfernen und im Rahmen einer sachgerechten Sanierung mit geeigneten Ersatzsystemen wieder neu aufzubauen. Bei der Auswahl des Zementes thermisch beanspruchter Betonbauteile ist zu bedenken, dass Portlandzement bei einer Temperatur von ca. 600°C einen Festigkeitsverlust von annähernd 50% aufweisen können. Bei derartigen Bauteilen empfiehlt es sich über die Verwendung eines Tonerdeschmelzzementes nachzudenken. Im Rahmen von Schadensfällen an Betonen, die im Zugangsbereich zu keramischen Brennöfen verwendet wurden, traten häufiger Betonabplatzungen auf, die auf Volumenausdehnungen der enthaltenen Gesteinskörnungen zurück zu führen waren. Das nachfolgende Bild zeigt einen Beton, der bei einer Temperatur von 350°C gelagert worden ist und bei dem sich Risse und in der Folge Betonabplatzungen gezeigt haben, die ursächlich in der Verwendung schieferhaltiger Gesteinskörnungen begründet waren. Thermisch bedingte Risse in der Gesteinskörnung Betonabplatzungen aufgrund einer nicht ausreichenden Temperaturbeständigkeit Neben den Frostschäden können Betonabplatzungen auch aufgrund einer nicht geplanten thermischen Beanspruchung entstehen. Die DIN 1045 deckt ausschließlich Temperaturen bis 250°C ab. Für Betone, die Temperaturen über 250°C ausgesetzt werden, müssen ausreichende Erfahrungen vorliegen. Hierbei ist zu bedenken, dass bei deutlich erhöhten Temperaturen • zum einen ein Festigkeitsverlust des Zementsteins und • zum anderen ggf. Schäden an den im Beton enthaltenen Gesteinskörnungen Die Ursache dieser Betonabplatzungen sind darauf zurück zu führen, dass die Gesteinskörnung deutlich erhöhte organische Anteile enthält. Bei der thermischen Beanspruchung dieser Gesteinskörnungen werden diese organischen Anteile verflüchtigt und führen zu inneren Spannungen, die in der Folge zu Abplatzungen am Beton führen. Aus diesem Grunde sind spezielle Erstprüfungen an Betonen, die z. B. im Zugangsbereich zu keramischen Brennöfen verwendet werden, durchzuführen. auftreten können. _______________________________________________________________________________________________________________________________________ MPVA Neuwied GmbH, Sandkauler Weg 1 in 56564 Neuwied Tel.: 02631 / 39 93-0 • Fax: 02631 / 39 93-40 • e-Mail: [email protected] • Internet: www.mpva.de Schäden an Bauteilen aus Beton (Teil 5) Seite 4 ___________________________________________________________________ Betonabplatzungen durch Holzeinschlüsse Bei horizontalen Betonplatten wie z. B. bei Industrieböden finden sich immer wieder Abplatzungen oberhalb von Holzeinschlüssen. Holzeinschlüsse Darüber hinaus verstärkt das Befahren von Industrieböden das Ausmaß der optischen Beeinträchtigung, da die entstehenden hohen Punktlasten in den Bereichen mit Holzeinschlüssen nicht sachgerecht aufgenommen werden können und zur Bildung von Ausbrüchen führen. Bezüglich der leichtgewichtigen Bestandteile ist Ingenieurbüros, die horizontale Betonplatten z. B. in Baumärkten, Lagerhallen oder bei Sichtbetonbauteilen planen, zu empfehlen, dass diese die Baustofflieferanten im Rahmen der Bestellung speziell darauf hinweisen, dass bei diesen Flächen erhöhte Anforderungen an die Betonoberfläche gestellt werden. Baumarktfläche Ist Holz in den Ausgangsstoffen (i. d. R. in den Gesteinskörnungen) enthalten, so schwimmt dieses beim Einbringen und Verdichten des Betons auf und reichert sich - nur bedeckt von einer dünnen Zementsteinschicht - knapp unterhalb der Oberfläche des Industriebodens an. Nach DIN EN 12620 handelt es sich bei diesen holzartigen Stoffen um sog. leichtgewichtige organische Bestandteile. Sowohl nach DIN V 20000-103 als auch nach der neuen DIN 1045-2 ist die Menge dieser Bestandteile normativ bei • feinen Gesteinskörnungen auf < 0,5 M.-%; • groben Gesteinskörnungen auf < 0,1 M.-% begrenzt. Erhöhte Anforderungen finden sich z. B. in der ZTV-Ing., in der diese Bestandteile bei • feinen Gesteinskörnungen auf < 0,25 M.-%; • groben Gesteinskörnungen auf < 0,05 M.-% begrenzt werden. Auch bei diesen Mengen handelt es sich jedoch um so hohe Gehalte, dass zum Teil erhebliche Mengen an Holz im Bereich der Bauteiloberflächen auftreten können. Bei Einwirkung von Wasser quillt das Holz und sprengt die aufsitzende Zementsteinschicht ab. Selbstverständlich wird im Streitfall immer wieder darüber diskutiert, wer ggf. aufgetretene Abplatzungen zu beseitigen bzw. zu bezahlen hat. Selbst wenn der Planer im Rahmen der Ausschreibung darauf hingewiesen hat, dass der Lieferant „eine Gesteinskörnung völlig frei von leichtgewichtigen Bestandteilen“ einzusetzen hat, variiert die Gutachtermeinung zur Verantwortung für den Schaden stark. _______________________________________________________________________________________________________________________________________ MPVA Neuwied GmbH, Sandkauler Weg 1 in 56564 Neuwied Tel.: 02631 / 39 93-0 • Fax: 02631 / 39 93-40 • e-Mail: [email protected] • Internet: www.mpva.de Schäden an Bauteilen aus Beton (Teil 5) Seite 5 ___________________________________________________________________ Einige Sachverständige sind der Ansicht, dass der Bauherr derartige Schäden akzeptieren muss, da sich eine vollständige Freiheit von leichtgewichtigen Bestandteilen auch bei größter Sorgfalt nicht sicherstellen lässt. Andere meinen, dass anstelle der normalen Gesteinskörnungen in diesen Fällen gebrochene Gesteinskörnungen eingesetzt werden müssen. Wieder andere vertreten die Meinung, dass in diesen Fällen der Gesteinskörnungsproduzent die Verantwortung für den Schaden hat, da er den Lieferbedingungen (vollständige Freiheit von leichtgewichtigen Bestandteilen) zugestimmt hat. In jedem Falle handelt es sich hierbei um ein großes Beschäftigungfeld für Sachverständige und Juristen. Hohlstellen bei Industrieböden inkl. Betonflächen mit Einstreuungen Grundsätzlich ist festzustellen, dass ein Industrieboden nicht grundsätzlich frei von Hohlstellen sein muss. Einzelne kleinere Hohlstellen können auch bei sachgerechter Arbeitsweise auftreten und stellen nicht automatisch einen Mangel dar. Andererseits können die hohen Punktlasten bei Industrieböden auch bei kleinen Hohlstellen schnell zur Überlastung der Konstruktion im Bereich der Hohlstellen führen. Hohlstellen Hohlstellen, die zu Rissschäden geführt haben Häufig sind Hohlstellen zwischen Hartstoffschichten (Einstreuung oder Estrich) und dem Beton darauf zurückzuführen, dass der richtige Zeitpunkt der Aufbringung der Hartstoffschicht verpasst worden ist und der Untergrundbeton zu diesem Zeitpunkt bereits zu stark angezogen war. Nicht selten wird bei der Einbringung von Industrieböden unterschätzt, wie stark das Abbindeverhalten zementgebundener Baustoffe von den Umgebungsbedingungen beeinflusst wird. So kann der Betrieb von Klimabzw. Lüftungsanlagen zum Zeitpunkt der Einbringung des Industriebodens das Zeitfenster bis zur Aufbringung der Hartstoffschicht erheblich verkürzen. Ähnliche Probleme ergeben sich bei Hallenböden, die sehr frühzeitig intensiver Zugluft ausgesetzt werden. Offen stehende Hallentore stellen hierbei einen Klassiker dar. Hohlstellen und Risse sind die Folge. Aus diesem Grunde wird in der einschlägigen Fachliteratur darauf hingewiesen, dass bei „ungünstigen Baustellenbedingungen (z. B. Zugluft, nicht geschlossene Fenster und Türen oder intensive Sonneneinstrahlung“) mit „kleineren Haftzugwerten“ als üblich zu rechnen ist. Hohlstellen bei Industrieböden aufgrund der Verwendung von PCE bei der Betonherstellung In den letzten Jahren haben Polycarboxylatether (kurz PCE) bzw. Kombinationsmittel aus PCE und Ligninsulfonaten aufgrund ihrer stark verflüssigenden Wirkung und langen Wirkungsdauer sich als wesentlicher Bestandteil im Fließmittelmarkt fest etabliert. _______________________________________________________________________________________________________________________________________ MPVA Neuwied GmbH, Sandkauler Weg 1 in 56564 Neuwied Tel.: 02631 / 39 93-0 • Fax: 02631 / 39 93-40 • e-Mail: [email protected] • Internet: www.mpva.de Schäden an Bauteilen aus Beton (Teil 5) Seite 6 ___________________________________________________________________ Durch die Verwendung der PCE lässt sich das Ausbreitmaß von Betonen deutlich erhöhen, ohne dass die Entmischungsneigung signifikant steigt und ohne dass die Druckfestigkeit des Betons reduziert wird. In direktem Anschluss an die Hohllagen finden sich üblicherweise Ausbrüche und Risse. Ausbrüche neben den Hohlstellen Gerade in den letzten Jahren traten aber Schadensfälle bei Industrieböden auf, bei denen der Beton unter Verwendung von PCE hergestellt worden ist. Diese Schäden äußerten sich in Form von Hohllagen und Rissbildungen im Industrieestrich bzw. in Hartstoffeinstreuungen. Typisch für diese Schäden ist die Ausbildung von Rissen in der Kontaktzone zwischen Beton und Industrieestrich bzw. Hartstoffeinstreuung (Hohlstellen). Die Risse verlaufen in erster Linie parallel zur Oberfläche des Industriebodens und setzen sich nicht in den Beton fort. Hohlstellen aufgrund der Verwendung von PCE im Rahmen der Betonherstellung Werden die Hohlstellen überbohrt, so zeigt sich hier, dass die Abrissfläche zwischen dem Beton und der Industriebodenoberfläche i. d. R. glatt ist. Raue Bruchkanten liegen kaum vor. Somit ist davon auszugehen, dass der Estrich bereits kurz nach der Herstellung zumindest kleinflächig parallel zur Oberfläche verlaufende Risse aufwies. Der Haftverbund zwischen dem Beton und der Industriebodenoberfläche war von vornherein sehr schlecht. Detailaufnahme der Abrissebene Auch finden sich häufig Aussinterungen in der Abrissfläche, was darauf hindeutet, dass der Estrich in dieser Ebene über einen längeren Zeitraum mit Wasser in Kontakt stand. Hohlstellen aufgrund der Verwendung von PCE im Rahmen der Betonherstellung Abrissfläche im Bereich einer Hohlstelle mit Aussinterungen _______________________________________________________________________________________________________________________________________ MPVA Neuwied GmbH, Sandkauler Weg 1 in 56564 Neuwied Tel.: 02631 / 39 93-0 • Fax: 02631 / 39 93-40 • e-Mail: [email protected] • Internet: www.mpva.de Schäden an Bauteilen aus Beton (Teil 5) Seite 7 ___________________________________________________________________ Im Rahmen der mikroskopischen Untersuchung von Proben aus derartigen Schadensfällen zeigte sich, dass sich aufgrund der Verwendung der PCE teilweise hohe Luftporengehalte im Beton ausbilden, die sich aufgrund des Glättens noch an der Betonoberfläche anreichern. Die Applikation von Hartstoffeinstreuungen oder auch Hartstoffestrichen auf luftporenhaltigen Betonen ist als ausgesprochen kritisch einzustufen und führt aufgrund der Schwächung der Verbundzone sehr häufig zu Schäden in Form von Verbundproblemen zwischen dem Beton und dem Estrich. Stereomikroskopie einer Probe aus einem geschädigten Bereich mit erhöhten Porengehalten Haftzugfestigkeiten von Industrieböden inkl. Betonflächen mit Einstreuungen Entgegen der weit verbreiteten Annahme müssen flächenfertige Industrieböden nicht die in der Rili-SIB genannte mittlere Haftzugfestig2 2 keit von > 1,5 N/mm (Kleinstwert >1,0 N/mm ) aufweisen. Normativ bestehen keinerlei Anforderungen an die Haftzugfestigkeit von Verbundestrichkonstruktionen oder Einstreuschichten. Polarisationsmikroskopie einer Probe aus einem geschädigten Bereich mit erhöhten Porengehalten Trotzdem muss natürlich ein für den Verwendungszweck ausreichender Verbund zwischen den einzelnen Schichten einer Verbundestrichkonstruktion oder auch einer Einstreuung vorliegen. Die Erfahrung zeigt, dass Verbundestriche ohne Fahrbeanspruchung mindestens 2 eine mittlere Haftzugfestigkeit von > 0,5 N/mm aufweisen sollten. Flächen mit Fahrbeanspruchung sollten eine mittlere Haftzugfestigkeit 2 von > 0,8 N/mm besitzen. Gipsputzablösungen Betonen auf hochwertigen Das Haftvermögen von Gipsputzen auf Putzuntergründen wird in erster Linie durch die mechanische Verkrallung der Reaktionsprodukte des Bindemittels mit dem Putzuntergrund bestimmt. Hohe Betongüten wirken sich ebenso wie glatte Stahlschalungen negativ auf die mögliche Verkrallung von Gipsputzen auf dem Untergrund aus. Gipsputzablösungen Obwohl es sich bei dem oben dargestellten Beton nicht um einen Luftporenbeton handelt, wies dieser einen Luftporenanteil von ca. 5,7 Vol.-% auf. Derartig hohe Luftgehalte liegen deutlich über den üblichen Gehalten von nicht luftporenhaltigen Betonen. Ursächlich werden diese hohen Luftgehalte durch die Polycarboxylatether in den Beton eingebracht und lassen sich durch übliche Verdichtungsverfahren nicht aus dem Beton austreiben. _______________________________________________________________________________________________________________________________________ MPVA Neuwied GmbH, Sandkauler Weg 1 in 56564 Neuwied Tel.: 02631 / 39 93-0 • Fax: 02631 / 39 93-40 • e-Mail: [email protected] • Internet: www.mpva.de Schäden an Bauteilen aus Beton (Teil 5) Seite 8 ___________________________________________________________________ Auch hohe Oberflächenfeuchtigkeiten des Betons erschweren die mechanische Verkrallung der Gipsputze, da das in den Betonporen enthaltene Wasser die Poren des Betons verschließt. Dieser Effekt tritt z. B. bei hohen Restfeuchten im Beton oder bei Betonoberflächen auf, bei denen eine Taupunktunterschreitung erfolgt und die kondensierte Feuchtigkeit als Trennfilm fungiert. Neben der Einschränkung der primären Verkrallung des Gipsputzes in der Betonoberfläche kann das Haftvermögen des Gipsputzes auch durch Sekundärreaktionen reduziert werden. Kommt der Gipsputz nach der Erhärtung intensiv mit Wasser in Kontakt, so wird der Gips gelöst, wobei ggf. enthaltene Alkalien die Löslichkeit des Gipses weiter erhöhen. Kristallisiert der Gips beim Austrocknen wieder aus, so verändert sich die Kristallstruktur und die Ausrichtung der Gipskristalle, wodurch der Haftverbund zum Untergrund reduziert wird. Das für das Lösen des Gipses verantwortliche Wasser kann sowohl aus dem Beton stammen (sehr hohe Restfeuchten) als auch nachträglich, z. B. durch die intensive Verwendung von Tiefengrund, auf den Gipsputz aufgebracht worden sein. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied GmbH Sandkauler Weg 1, 56564 Neuwied Tel.: 0 26 31 / 39 93-0 • Fax: 0 26 31 / 39 93- 40 www.mpva.de _______________________________________________________________________________________________________________________________________ MPVA Neuwied GmbH, Sandkauler Weg 1 in 56564 Neuwied Tel.: 02631 / 39 93-0 • Fax: 02631 / 39 93-40 • e-Mail: [email protected] • Internet: www.mpva.de