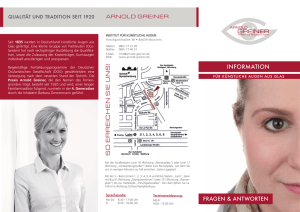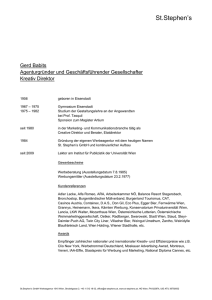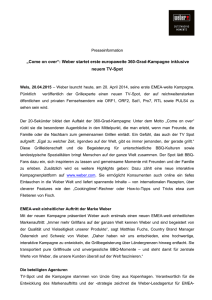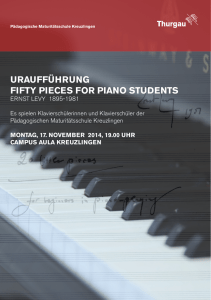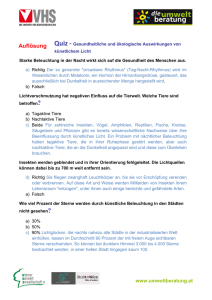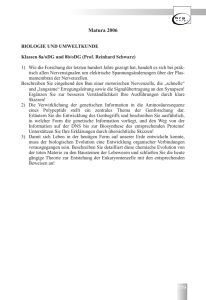Daniel Sperl 8. Klasse 1998/99 Prof. Hans Stummer, Informatik RG
Werbung

Daniel Sperl 8. Klasse 1998/99 Künstliches Leben Digitale Evolution 1 Prof. Hans Stummer, Informatik RG Lambach IN H A L T : 0. VORWORT ............................................3 LEBEN IM KLASSISCHEN SINN .............................4 2. DEFINITIONSVERSUCHE VON LEBEN 5 1. 2.1. DIE ENTSTEHUNG DES LEBENS AUF DER ERDE – EVOLUTION 6 3. KÜNSTLICHES LEBEN – EINE NEUE WISSENSCHAFT WIRD GEBOREN . . . 9 3.1. VORGESCHICHTE 10 3.2. DAS KINEMATISCHE MODELL 11 3.3. ZELLULARE AUTOMATEN 12 3.4. INFORMATION – KOMPLEXITÄT 15 3.5. BOTTOM-UP 16 3.6. KL-1 IN LOS ALAMOS 17 4. DIE NÄCHSTE GENERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.1. DER GENETISCHE ALGORITHMUS 20 4.2. EVOLUTIONÄRES WETTRÜSTEN 21 4.3. DER BALDWIN-EFFEKT 22 4.4. KL-ROBOTER 23 5. CREATURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5.1. „ALBIA“ – EINE KÜNSTLICHE WELT 26 5.2. DIE BIOLOGIE DER NORNS 27 • • • • • 5.3. ZENTRALES NERVENSYSTEM VERDAUUNGSSYSTEM FORTPFLANZUNGSSYSTEM IMMUNSYSTEM STOFFWECHSEL DAS POTENTIAL DER NORNS 6. GEFAHREN – PERSPEKTIVEN 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 6.1. CHIP-EVOLUTION 32 6.2. COMPUTERVIREN 32 6.3. KL – CHANCE ODER GEFAHR? 33 7. ANHANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 LITERATUR 36 PROTOKOLL 37 INHALT DER DISKETTE 38 2 0. VORWORT Als ich mich entschloss, eine Fachbereichsarbeit in Informatik zu schreiben, war es für mich zunächst klar, dass sie Künstliche Intelligenz zum Thema haben musste, da ich mich schon lange für dieses Gebiet interessierte. Auf der Suche nach Literatur stieß ich jedoch auf ein Buch des amerikanischen Autors Stephen Levy: „KL – Künstliches Leben aus dem Computer“. Entgegen meiner anfänglichen Vermutung, dass es sich bei Künstlichem Leben um ein Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz handelte, stellte ich fest, dass KL ein noch sehr junges Forschungsgebiet darstellt, das sich klar von den Prinzipien der Künstlichen Intelligenz abgrenzt. Schließlich entschloss ich mich dazu, dass meine Fachbereichsarbeit über KL handeln musste. Stephen Levys Buch bietet einen Überblick über die gesamte bisherige Geschichte von KL. Nicht zuletzt da es mein Ziel war, ein nachvollziehbares Bild der Theorien dieses Forschungsgebietes zu bieten, anstatt die technischen Details detailliert zu beschreiben, entnahm ich einen Großteil meiner Informationen aus diesem Buch. Der Autor schaffte es, die komplizierten Zusammenhänge und Theorien, die die Forscher in den letzten fünfzig Jahren aufgestellt hatten, anschaulich und sogar unterhaltsam zu erklären. Ich hoffe, dass ich die Faszination, die ich beim Lesen des Buches empfand, zumindest teilweise auch auf diese Arbeit übertragen konnte. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel für Künstliches Leben fand ich in der Computersimulation „Creatures“. Das Programm ist zwar auf den Massengeschmack zugeschnitten, doch dies äußert sich nur insofern, da man es auch ohne Hintergrundwissen leicht bedienen kann. Für Interessierte bietet es nämlich die Möglichkeit, Künstliches Leben dem aktuellen Forschungsstand entsprechend zu Hause am eigenen Computer zu simulieren. Es ist wirklich erstaunlich, wie lebensnah hier biologische Zusammenhänge imitiert werden – vom Hormonhaushalt über ein komplexes Gehirn bis hin zu einem funktionierenden Immunsystem – und sich zu einem scheinbar lebendigen Ganzen zusammenfügen. Schlussendlich muss ich noch all jenen danken, die mich während der letzten Monate unterstützt haben, besonders meinem Klassenvorstand Prof. Hans Stummer. Er half mir nicht nur, meine Arbeit zusammenzustellen und zu strukturieren, sondern hatte auch stets Zeit für meine zahlreichen Fragen. Obwohl das Schreiben dieser Fachbereichsarbeit sehr viel Zeit und Arbeitsaufwand beanspruchte, war es doch eine interessante und lehrreiche Erfahrung. Stadl-Paura, Februar 1999 3 1. L E BE N IM K L A S S IS C H E N S IN N „Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, und bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: fünfter Tag. Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es. Gott machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle Arten von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, dass es gut war.“ Genesis 1, 20-25 4 DEFINITIONSVERSUCHE VON LEBEN1 1.1. Künstliches Leben (kurz: KL) ist der Name eines jungen Forschungsgebiets, das in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts als kleine mathematische Spielerei begann. KL widmet sich der Erschaffung und Erforschung lebendiger Organismen und Systeme, die von Menschen geschaffen wurden. Schon seit jeher beschäftigte die Menschen die Frage, wie das Leben auf der Erde entstand. Wohl die wichtigste Aufgabe der Weltreligionen war und ist es, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie und warum Leben - speziell das Leben des Menschen - entstand, und was der Sinn des Lebens sei. Doch es gibt noch eine essentielle Frage, die sich früher oder später stellt, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt: Was ist eigentlich Leben? Die Frage scheint simpel, trotzdem sind schon unzählige Gelehrte und Philosophen daran gescheitert, sie eindeutig zu beantworten. „In der Philosophie der Antike wurde der Begriff mit dem Vermögen der Selbstbewegung gleichgesetzt. Als treibende Kraft des Lebendigen galt die Seele, die sich in der Körperlichkeit des Belebten verwirklicht. Aristoteles differenzierte das Lebendige hierarchisch in vegetatives, sensitives und geistiges Leben: Dabei kommt das geistig-seelische Leben allein dem Menschen zu, das sensitive hingegen den Tieren; das Vegetative ist die Lebensform der Pflanzenwelt.“2 Als ein entscheidendes Kriterium für Leben galt also damals das Vermögen der Selbstbewegung. 2000 Jahre nachdem dieser Definitionsversuch gemacht wurde, kann man ihn nicht mehr guten Gewissens als ausreichend gelten lassen. Der offensichtlichste Beweis dafür sind wahrscheinlich die mehr als 3 Millionen Automobile (automobil = selbstbewegend), die jeden Tag auf Österreichs Straßen verkehren. Das zweite Kriterium, die Existenz einer Seele, ist auf der Suche nach der Definition des Lebens ebenso ungeeignet, da deren Existenz bis heute noch nicht bewiesen werden konnte. Doch selbst wenn man einen Beweis finden könnte, würde das nur weitere Fragen aufwerfen, denn dann wäre man gezwungen, den Begriff „Seele“ zu definieren (was wahrscheinlich genauso schwierig ist, wie „Leben“ zu erklären). Schon Aristoteles erkannte, dass dieser Definitionsversuch nicht vollständig sein konnte. Er überarbeitete deshalb die Definition des Lebens. Er machte die Beobachtung, „Leben zu besitzen“ bedeute, „dass Dinge sich selbst ernähren können, aber auch vergänglich sind“3. Außerdem stellte er fest, dass die Fähigkeit zur Fortpflanzung eine weitere unbedingt notwendige Voraussetzung sei. Versucht man jedoch, diese Kriterien weiter zu verfeinern und zu vervollständigen, wird man mit Sicherheit schnell auf Probleme stoßen. Man könnte eine lange Liste von Eigenschaften erstellen, doch diese wären entweder zu hoch oder zu niedrig angesetzt. Die Wesen aus Creatures (vgl. Kapitel 4) beispielsweise zeigen viele der von Aristoteles geforderten Eigenschaften, aber sogar ihre Erzeuger bezeichnen sie nicht als wirklich lebend im herkömmlichen Sinne. Deshalb geben manche Wissenschafter zu bedenken, der Ansatz, Leben direkt definieren zu wollen, führe in die Irre. Ihrer Ansicht nach sollte Leben anhand einer allgemeinen Werteskala beurteilt werden. In der Nähe der oberen Grenze stünden wir Menschen sowie der große Bereich von Tieren und Pflanzen. Viren, die von einigen Wissenschaftern als lebend angesehen werden, von anderen dagegen nicht, würden im oberen Mittelfeld liegen. Unterhalb davon befände sich dann ein komplexes System von Dingen, 1 vgl. Stephen Levy: KL – Künstliches Leben aus dem Computer; Droemer Knaur Verlag; 1. Auflage 1993 2 Microsoft Encarta 99 Enzyklopädie 3 Stephen Levy: KL – Künstliches Leben aus dem Computer, S. 13 5 die man nicht als lebend im eigentlichen Sinne bezeichnen kann, die aber dennoch so etwas wie eine Art Eigenleben entwickeln können, beispielsweise ein Auto. Diese Ansätze sind zwar allesamt interessant, aber irgendwie sehr unbefriedigend. Schließlich sollte Leben - das wird von allen Religionen der Welt gelehrt - etwas Besonderes sein, nicht nur eine unscharfe Linie auf einer Werteskala. Deswegen wird die Aufklärung dieser Frage im Rahmen dieser Arbeit zunächst „vertagt“. Während der nächsten Kapitel wird die Definition dann Schritt für Schritt erweitert werden. Ob sie jemals vollständig sein wird, kann hier jedoch nicht beantwortet werden. 1.2. DIE ENTSTEHUNG DES LEBENS AUF DER ERDE - EVOLUTION4 Die Erde entstand vor etwa vier bis fünf Milliarden Jahren. Vor drei Milliarden Jahren gab es bereits Lebewesen; das beweisen Fossilien, sogenannte Stromatolithen (schichtförmig aufgebauten Gesteine), die auf die Existenz mikroskopisch kleiner bakterienähnlicher Organismen hinweisen. Man vermutet, dass sich das Leben auf der Erde vor etwa vier Milliarden Jahren gebildet hat. Die Erdatmosphäre bestand in dieser Frühzeit vorwiegend aus Wasserdampf, Methan, Ammoniak, Wasserstoff, Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff. Der Biochemiker Stanley Miller ahmte diese Bedingungen 1953 in seinem berühmten Experiment in einem abgeschlossenen System im Labor nach. Er führte dieser Versuchsanordnung Energie in Form von elektrischen Entladungen zu, was Blitze auf der Urerde simulieren sollte. Nach einigen Tagen hatten sich bereits mehrere organische Verbindungen gebildet, darunter Fettsäuren, Zucker und insbesondere einige Aminosäuren. Dies sind die Bausteine der Proteine, die zur Steuerung aller chemischen Abläufe in Lebewesen entscheidend sind. In späteren Experimenten entstanden außerdem noch wichtige Bestandteile der Nucleinsäuren Ribonucleinsäure (RNA) und Desoxyribonucleinsäure (DNA), aus denen in allen Lebewesen die Erbsubstanz aufgebaut ist und die die Fähigkeit zur Selbstverdoppelung besitzen. Damit ist es wahrscheinlich, dass diese Substanzen auch in der Erdfrühzeit entstanden, womit die Entstehung des Lebens von den chemischen Voraussetzungen her nachvollziehbar ist. Das Meer war also zu einer sogenannten „Ursuppe“ aus organischen und anorganischen Verbindungen geworden, welche die Bedingungen für Leben darstellten. Das Vorhandensein dieser Verbindungen reichte allerdings zur Lebensentstehung allein nicht aus. Die entscheidende Voraussetzung dafür war die Bildung selbstreplizierender Moleküle. Das erste sich selbst verdoppelnde Molekül war wahrscheinlich die RNA, die chemisch nahe mit der DNA verwandt ist und der auch heute noch in allen lebenden Zellen wichtige Funktionen zukommen. Es ist aber auch möglich, dass die erste Verdoppelungseinheit ein ganz anderes Molekül war. Nachdem durch Zufall die ersten selbstverdoppelnden Moleküle entstanden waren, konnte die natürliche Auslese im Sinne Darwins auf molekularer Ebene stattfinden. Durch zufällige Veränderungen (Mutationen) bei der Verdoppelung entstanden neue Verbindungen mit veränderten Eigenschaften. Verbindungen, die sich exakter und schneller verdoppeln konnten als andere, gewannen in der Ursuppe die Oberhand und verdrängten schnell die Konkurrenten. Am besten konnten sich diejenigen Verbindungen durchsetzen, die sich spezieller Hilfsmittel bedienten und daher besonders effektiv waren. Solche Hilfsmittel entstanden wahrscheinlich durch Abwandlung von in der Umgebung vorhandenen Molekülen, wie z.B. von Proteinen. Ein ebenso wichtiges Element waren die ersten Vorläufer der biologischen Membranen; diese bestehen aus einer dünnen Schicht von Fettmolekülen in bestimmten Anordnungen, die einen abgegrenzten Raum bilden. Dadurch können hier bestimmte Bedingungen im Unterschied zur Umge4 vgl. Microsoft Encarta 99 Enzyklopädie 6 bung aufrechterhalten werden, wodurch der Ablauf chemischer Reaktionen stark beeinflusst wird (beschleunigt oder verzögert, teilweise auch überhaupt erst ermöglicht). Es dauerte jedoch noch sehr lange (etwa eine Milliarde Jahre vor heute), bis sich die ersten eukaryotischen Zellen (Zellen, die einen Zellkern mit Doppelmembran und Chromosomen besitzen) bildeten, aus denen alle höheren Lebewesen (Pflanzen, Pilze, Tiere und der Mensch) bestehen. Man nimmt an, dass dieser Zelltyp aus einer Art Symbiose hervorging, die zu einer neuen Form des Lebens führte, welche die nun folgende Evolution entscheidend beeinflusste. Die gesamte übrige Evolution kann man als Fortsetzung dieser grundlegenden Abläufe betrachten: Die natürliche Selektion wirkte auf die sich selbst verdoppelnden Moleküle, also die Gene. Dabei konnten sich diejenigen am besten durchsetzen, welche die wirkungsvollsten Hilfsmittel einsetzten, um sich selbst zu erhalten und fortzupflanzen zunächst einfache Zellen, später immer kompliziertere und schließlich vielzellige Lebewesen. So bevölkerten die entstandenen Organismen nach und nach das Meer, wobei sich ein komplexes Ökosystem von konkurrierenden Lebewesen bildete. Durch die Entwicklung der Photosynthese wurde schließlich die Atmosphäre der Erde mit Sauerstoff angereichert, der die Grundlage für Atmung bildete, wie sie heute bei Pflanzen, Pilzen und Tieren allgemein verbreitet ist. Auf diese Weise wurden schließlich alle Lebensräume auf der Erde besiedelt. Ermöglicht wurde diese Evolution durch die Weitergabe der Erbinformation. Alle Lebewesen besitzen eine Erbsubstanz, das Genom, das die Gesamtheit der Gene für alle Funktionen eines Organismus enthält. Die Informationen, die in der Erbsubstanz enthalten sind, werden durch Nucleinsäuren codiert. In der Regel handelt es sich dabei um die DNA, bei einigen Viren erfüllt die RNA diese Funktion. Die genetische Information wird dabei mit Hilfe der Basen Adenin (A), Thymin (T), Cytosin (C) und Guanin (G) (bei RNA: A, U (Uracil), C und G) codiert und kann durch Aufspaltung exakt repliziert werden. Die in der DNA gespeicherte Erbinformation wird jedoch nicht nur weitergegeben, sondern sie kann außerdem durch Mutationen verändert werden. Dies ist neben der Anpassung oder Adaptation eine Grundlage der Evolution, der Höherentwicklung des Lebens. Als Charles Darwin 1859 sein Werk „Über die Entstehung der Arten“ veröffentlichte, waren die Reaktionen sehr unterschiedlich. Erst nach vielen Jahren wurde es auch von der Kirche anerkannt. Darwin erkannte und veröffentlichte darin erstmals das der Evolution zugrunde liegende Prinzip der natürlichen Selektion. Die heutige Theorie der natürlichen Selektion auf genetischer Grundlage lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Die Gene einer Population untereinander kreuzbarer Tiere, Pflanzen oder anderer Lebewesen bilden einen so genannten Genvorrat oder Genpool. In diesem Genpool konkurrieren die Gene ähnlich wie die ersten selbstverdoppelnden Moleküle in der Ursuppe. Die Gene befinden sich dabei entweder in einem Körper, für dessen Entstehung sie gesorgt haben, oder sie wandern bei der sexuellen Fortpflanzung mit Samen- und Eizellen von einem Körper zum nächsten. Durch die sexuelle Fortpflanzung werden die Gene vermischt und ausgetauscht. Jedes einzelne Gen ist aus dem Genpool durch Mutation hervorgegangen, also durch einen zufälligen Kopierfehler während der Genverdoppelung. Eine solche Mutation kann sich dann durch sexuelle Vermehrung im Genpool ausbreiten. Mutationen sind die Ursache aller genetischen Abwandlungen. Für ihre schnelle Verteilung und Neukombination sorgen dann die sexuelle Fortpflanzung und die genetische Rekombination. Durch „Crossing-Over“ werden hierbei die Chromosomen beider Elternteile aneinandergelagert. An den Kreuzungsstellen brechen sie und heilen neu kombiniert wieder an. Dadurch hat der Nachkomme auf seinen Chromosomen sowohl Gene des Vaters als auch der Mutter (Abb. 1).5 5 Schirl, Ruttner: Über die Natur 8; 1997 E.DORNER GmbH Wien; S.27 7 Bedeutet eine Mutation einen Vorteil für das Individuum, d.h. hat es in der Zukunft bessere Überlebens- und Fortpflanzungschancen, trägt es in Zukunft mehr Gene zum Genpool bei, sodass Gene, die für die Entstehung eines gut an die Umweltbedingungen angepassten Organismus sorgen, schließlich die Oberhand gewinnen. Dasselbe Prinzip behält auch im Makrokosmos seine Gültigkeit: Durch das Prinzip der natürlichen Selektion vermehren sich die am besten Abbildung 16 angepassten Lebewesen am schnellsten, und weniger gut angepasste Lebewesen werden bald von der Bildfläche verschwinden. Das Ziel von KL ist es, eben diese Prinzipien auch in künstlichen Universen zu realisieren. 6 Schirl, Ruttner: Über die Natur 8, S.27 8 2. K ÜN S T L IC H E S L E BE N - E IN E N E UE W IS S E N S C H A FT W IR D G E BO R E N „Innerhalb von fünfzig bis einhundert Jahren wird voraussichtlich eine neue Klasse von Organismen entstehen. Diese Lebewesen werden in dem Sinne künstlich sein, als sie von Menschen gestaltet wurden. Dennoch werden sie sich fortpflanzen und in Formen umwandeln, die anders als ihr Ursprung sind. Sie werden ‚leben‘ in des Wortes eigentlicher Bedeutung. (...) Der Beginn einer Ära des Künstlichen Lebens wird das wichtigste historische Ereignis seit der Entstehung des Menschen sein ...“7 7 aus einer Zusammenfassung der Ergebnisse von AL-1 (vgl. 2.6.) in Los Alamos von J. D. Farmer; nach Steven Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer, S. 11 9 VORGESCHICHTE8 2.1. Leben wird seit Menschengedenken mit einer göttlichen Macht in Verbindung gebracht. Der Unterschied zwischen toter und lebender Materie war, so glaubte man, der Besitz von Lebenskraft, der „vis vitalis“. Diese Lebenskraft stammte von Gott. Der biblischen Schöpfungsgeschichte zufolge formte „... Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen.“9 Trotzdem versuchte man schon immer, das göttliche Phänomen des Lebens nachzuahmen. Bereits in der griechischen Mythologie wird von Versuchen erzählt, Kreaturen künstlich zu schaffen, und laut einer jüdischen Fabel erschuf ein Rabbi aus einem Lehmklumpen einen Golem, der seinem Erschaffer zunächst diente, ihm aber bald nicht mehr wohlgesonnen war. Ein klassisches Beispiel für den Versuch des Menschen, Gott zu imitieren, ist Mary Shelleys „Frankenstein“, in dem der wahnsinnige Erfinder aus Leichenteilen ein Monster erschafft, das sich letztlich gegen ihn stellt. Seit der Neuzeit mit ihrem rasanten technischen Fortschritt wurde schon mehrmals versucht, die Schaffung künstlichen Lebens auch jenseits der Literatur in Wirklichkeit umzusetzen. Ein frühes Beispiel dafür ist die Turmuhr in Bern, die ca. 1530 gebaut wurde. Zu jeder vollen Stunde marschierten lebensecht animierte Figuren um einen amüsiert nickenden Uhrenkönig. Der Perfektion einen Schritt näher ist die künstliche Ente, die Jacques de Vaucanson um 1738 konstruierte. Die Ente konnte trinken, fressen, quaken, im Wasser planschen und sogar ihr Futter verdauen. Zeitgenössische Autoren waren fasziniert von der lebensechten Choreographie der Ente, die aus über tausend beweglichen Einzelteilen bestand (allein die Flügel bestanden aus je 400 beweglichen Teilen). Diese beiden Modelle erhoben jedoch nicht den Anspruch, wirklich lebendig zu sein; sie beschränkten sich lediglich darauf, die Natur möglichst realistisch zu kopieren. Den ersten Schritt in Richtung KL vollzog der Mathematiker Alan Turing. Er entwarf 1936 einen imaginären Automaten, die sogenannte „Finite State Machine“ (FSM) oder „Turing Maschine“. Diese Maschine ist weit davon entfernt, ein Lebewesen darzustellen, man muss sie sich eher als eine Art weiterentwickeltes Tonbandgerät vorstellen. Die FSM besteht aus einem Endlosband, das mit einem Schreib-Lese-Kopf ausgestattet ist (da es sich um ein Gedankenexperiment handelt, spielen die Länge des Bandes und die damit verbundenen Ladezeiten keine Rolle). Die Zeit des FSM-Universums läuft in sehr kleinen Abschnitten ab. Wird ein neuer Zeitabschnitt erreicht, sucht der Schreib-LeseKopf auf dem Band nach Informationen, die die weitere Handlung bestimmen, oder er schreibt neue Daten auf das Band. Die folgende Reaktion ist also einerseits vom Zustand der Umgebung abhängig, andererseits von den Daten auf dem Endlosband. Ein einfaches Beispiel für die Vorgangsweise bietet das Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“, bei dem die Mitspieler bei Musikuntermalung um einen Kreis von Stühlen laufen und sich niedersetzen müssen, sobald die Musik abgeschaltet wird. Die Mitspieler fungieren als FSM, wobei folgende Regeln (Daten) auf dem Band gespeichert sein müssen: 1. 2. 3. 4. Wenn man sitzt und keine Musik gespielt wird, den Zustand beibehalten. Wenn man sitzt und es wird Musik gespielt, in den gehenden Zustand wechseln. Wenn man geht und es wird Musik gespielt, den Zustand beibehalten. Wenn man geht und es wird keine Musik gespielt, in den sitzenden Zustand wechseln, sofern ein Stuhl vorhanden ist, und in den gehenden Zustand, wenn kein Stuhl vorhanden ist. 5. Wenn man sich im stehenden Zustand befindet, aus dem Spiel ausscheiden. 8 9 vgl. Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer Genesis 2, 7 10 6. Wenn man aus dem Spiel ausgeschieden ist, diesen Zustand beibehalten. Das außergewöhnliche an der Turing Maschine war die beinahe unbegrenzte Speicherfähigkeit des Endlosbandes. Turing gelang es später, mathematisch zu beweisen, dass seine Maschine einen universellen Computer darstellte. Das bedeutet, dass man mit ihr (wenn genügend Zeit zur Verfügung steht) jede beliebige Maschine nachahmen konnte, deren Verhalten in allen Einzelheiten beschrieben werden kann. Turing stellte außerdem die Hypothese auf, dass das nicht nur für Maschinen, sondern auch für die Natur gelte. DAS KINEMATISCHE MODELL10 2.2. Als geistiger Vater von KL wird John von Neumann gesehen. Die Turing Maschine hatte schon bald nach ihrem Entwurf seine Aufmerksamkeit geweckt. Er war überzeugt, dass ein universeller Computer tatsächlich die geistigen Funktionen jedes Lebewesens darstellen konnte. Auf der Basis dieser Aussage entwarf er einen Lebensautomaten, das „Kinematische Modell“. Von Neumann stattete den Automaten mit dem wichtigsten Kriterium des Lebens aus: Die Fähigkeit der Selbstreproduktion. Neben den computerinternen Bestandteilen besaß der Automat mehrere Elemente zur Manipulation (Schneiden, Verbinden usw.), sensorische Elemente sowie Bausteine eines Informationsspeichers. Der Lebensraum des Automaten bestand aus einem riesigen See, aus genau den Bausteinen, die er zu seiner Replikation benötigte. Das Wesen bestand aus vier Komponenten: Die erste, Komponente A, war eine Art Fabrik, die Bausteine aus dem See sammelte und sie entsprechend bestimmter Anweisungen zusammensetzte. Komponente B fungierte als Duplikator und las und kopierte die Anweisungen. Komponente C stellte den Rechner selbst dar. Die Informationen waren wie bei der Turing Maschine auf Komponente D entlang eines Trägerbandes binär abgespeichert. Die Reproduktion sah folgendermaßen aus: Komponente C las die Informationen vom Trägerband und übermittelte sie an Komponente B, die diese Anweisungen kopierte und an Komponente A, die Fabrik, weitergab. Gleichzeitig durchsuchte das Wesen den See nach passenden Bauteilen, die die Fabrik Stück für Stück gemäß der Anweisungen zu einem neuen Automaten zusammensetzte. Den Abschluss der Reproduktion stellte die Duplikation des Trägerbandes dar. Dies war die revolutionäre Neuerung gegenüber der Turing Maschine: Nachdem das Trägerband in den duplizierten Automaten eingepflanzt wurde, war er fähig, von sich selbst neue Kopien herzustellen. Das Trägerband hatte also eine ähnliche Funktion wie die DNA bei organischen Lebewesen. Von Neumann hatte erkannt, dass eine wichtige Voraussetzung des Lebens das Vorhandensein und die Weitergabe von Informationen darstellte. Und das, obwohl das Kinematische Modell einige Jahre vor der Entdeckung des DNA-Moleküls entworfen wurde. Da beim Kopiervorgang durchaus Fehler entstehen konnten, würde es sogar zu einer Form der Mutation kommen, die zwar meistens tödlich war, aber andererseits - wie in der Natur - auch zur Ausbildung neuer Eigenschaften führen konnte. Das Kinematische Modell hatte jedoch auch einen ernüchternden Kritikpunkt: Es gab zu viele offene Fragen, die Gleichung hatte zu viele Unbekannte. Woher kamen beispielsweise die „Arme“ und die „Sensoren“? Und wie funktionierten sie? Schließlich kam von Neumann zur Erkenntnis, dass er zwar die logischen Voraussetzungen des Problems lösen hatte können, die Technologie zur Umsetzung seiner Idee würde jedoch auch Jahrzehnte später noch nicht realisiert sein. 10 vgl. Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer 11 Nach dem Vorbild des Kinematischen Modells startete die NASA am Beginn der achtziger Jahre übrigens ein Projekt, um selbstreplizierende Mondfabriken zu entwickeln. Es wurde jedoch zugunsten des „Star Wars“-Programms Ronald Reagans abgebrochen. ZELLULARE AUTOMATEN11 2.3. Als John von Neumann erkannte, dass es in absehbarer Zeit unmöglich war, das Kinematische Modell in Wirklichkeit umzusetzen, und es außerdem für mathematische Analysen ungeeignet war, versuchte er, das Modell in eine realisierbare Form zu bringen. Aufgrund von Vorschlägen seines Freundes, des Mathematikers Stanislaw Ulam, übertrug er das Kinematische Modell in eine Umgebung, die nur auf Gesetzen der Logik beruhte. Das neue Universum bestand aus einem riesigen, zweidimensionalen Gitter, einer Art Schachbrett, dessen Felder 29 verschiedene Zustände einnehmen konnten, die einem bestimmten Regelwerk folgten. Jede Zelle fungierte also als Finite State Machine. Ein Wesen, das sich in diesem Lebensraum befand, umfasste etwa 200 000 Zellen. Das Verhalten der Kreatur wurde durch die jeweilige Kombination dieser Zellen bestimmt. Das Ganze hatte die Form eines Rechtecks mit einem langen Schwanz (Abb. 2). Das Rechteck war in Bereiche aufgeteilt, die die Funktionen der Komponenten A, B und C des Kinematischen Modells übernahmen. Der Schwanz stellte den Konstruktionsplan dar, der etwa 150 000 Zellen umfasste. Die Reproduktion der Kreatur funktionierte prinzipiell in der selben Weise wie beim Kinematischen Modell. Da dieser Zellularautomat rein auf Logik und Information beruhte, war er mathematisch eindeutig ausdrückbar und existent. Es gab keine offenen Fragen oder technische Hindernisse. Das machte die Faszination des Zellularautomaten aus. Leider konnte von Neumann seinen Entwurf nicht mehr fertigstellen, da er 1954 unheilbar an Krebs erkrankte und bald darauf starb. In den späten sechziger Jahren wären die Theorien des John von Neumann schon beinahe in Vergessenheit geraten, hätte nicht der Mathematiker John Horton Conway an der Universität in Cambridge das Thema wieder aufgegriffen. Er schuf den wahrscheinlich bekanntesten und populärsten aller Zellularautomaten: „Life“. Abbildung 212 11 12 vgl. Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer, S. 59 12 Conway war fasziniert von den Möglichkeiten des von Neumannschen Automaten. Er glaubte jedoch, dass man einen akzeptablen Zellularautomaten auch mit sehr viel einfacheren Regeln schaffen könnte. Statt der sehr komplexen 29 verschiedenen Zellzustände des Automaten von John von Neumann entwarf er ein System, dessen Zellen nur zwei verschiedene Zustände einnahmen: schwarz oder weiß, tot oder lebendig. Diese Zellen, die wie bei von Neumanns Automaten auf einem riesigen, zweidimensionalen Gitter angeordnet waren, folgten sehr einfachen Regeln: 1. Jede Zelle überlebt den nächsten Taktzyklus, wenn zwei oder drei ihrer Nachbarn leben. 2. Sie stirbt, wenn es mehr oder weniger sind 3. Sie kann wiedergeboren werden, wenn sie genau drei lebendige Nachbarn hat. Mit diesen einfachen Regeln entstanden aus zufälligen Anfangskonstellationen eine Vielzahl von Mustern, die stabil wurden oder periodisch wechselten, die zerbrachen und wieder neue Muster bildeten. Ganz offensichtlich gehorchten die Zellen einem Prinzip der Selbstorganisation, denn die meisten Anordnungen strebten einem stabilen Zustand zu. Conway war der Überzeugung, dass man innerhalb dieses Zellularautomaten einen universellen Computer nachbauen konnte. Hierzu mussten auch Muster vorhanden sein, die die Aufgaben von Computerteilen wie Schalter, Uhr und Speicher übernehmen konnten. Den ersten Hinweis, dass dies wirklich möglich war, erhielt er, als sein Team eine stabile, sich fortbewegende Konstellation von fünf Zellen entdeckte: den „Gleiter“ (Abb. 3). Das Gebilde bewegte sich alle vier Taktzyklen um ein Feld weiter. Die Gleiter konnten also als Taktgeber für den Computer fungieren.13 Life war, wie ein Brettspiel, auf einem riesigen „Spielfeld“ am Boden eines Büros in Cambridge gestartet worden. Da das Spiel jedoch bald enorme Ausmaße erreichte, suchte man andere Wege, den Zellularautomaten zu simulieren. Schließlich kam man auf die Idee, Life auf Computern zu programmieren, die zu jener Zeit gerade die Rechenka- Abbildung 3 pazität erreicht hatten, welche dazu nötig war. Mit Hilfe des Computers war es möglich, die Simulation in hoher Geschwindigkeit ablaufen zu lassen, und so fand man schließlich alle Zellkombinationen, die für einen universellen Computer nötig waren. Unter anderem entdeckte man eine „Gleiterkanone“, die in regelmäßigen Abständen Gleiter in die Umgebung aussandte, und eine „Dampfeisenbahn“, die auf dem Gitter entlangfuhr und eine konstante Spur lebender Zellen als „Dampf“ hinter sich ließ. Schließlich gelang es sogar einigen Studenten, innerhalb dieses Automaten die Funktionsweise eines Computers nachzuahmen. Conway selbst war der Ansicht, dass Life auch Leben hervorbringen konnte. „In einem ausreichend großen Maßstab müsste man wirklich lebende Anordnungen erkennen können“, sagte er. „Lebend in des Wortes eigentlicher Bedeutung, welche Definition man auch verwenden mag. Die Wesen würden sich entwickeln und vermehren, sich um Territorien streiten, immer intelligenter werden und schließlich sogar ihre Doktorarbeit schreiben. Auf einem ausreichend großen Spielbrett, und daran zweifle ich nicht im geringsten, würden Dinge dieser Art passieren.“14 (Optimistische Zeitgenossen vermuteten, dass das Spielbrett die Größe des Sonnensystems haben müsste, andere befürchteten, dass dafür selbst unser Universum zu klein sei.) 13 14 Auf der beiliegenden Diskette befindet sich eine Visual Basic - Version von Life. Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer, S. 75 13 Einen anderen Zellularautomaten entwarf zu Beginn der achtziger Jahre der Wissenschafter Stephen Wolfram. Sein eindimensionaler Automat überzeugte vor allem durch seine Einfachheit. Die Zellen waren in einer Linie nebeneinander angeordnet und konnten ebenfalls nur die Zustände lebend oder tot einnehmen. Bei jedem neuen Zeitzyklus wurde eine neue Linie unter die alte gesetzt, deren Zellen in Abhängigkeit der jeweils drei über ihnen liegenden ihren Zustand wechselten.15 (Abb. 4) Insgesamt gab Abbildung 4 es 256 mögliche Regelsätze, die Wolfram alle untersuchte. Aufgrund der Ergebnisse teilte Wolfram Zellularautomaten allgemein in vier Klassen ein: • • • • Klasse 1: es entsteht Dunkelheit (alle Zellen leben) oder Leere (alle Zellen sind tot) Klasse 2: eine Konfiguration, bei der sich schnell stabile Verhältnisse einstellen Klasse 3: relativ ungeordnete Muster Klasse 4: nicht ungeordnete, aber langlebige und komplexe Muster Betrachtet ein Beobachter Klasse 3, so würde er vermuten, dass die Zellen rein zufällig verteilt worden wären. Wahrscheinlich hätte diese Person den Eindruck, als ob der An- und Abschaltmechanismus genauso zufällig vonstatten gehen würde wie das Werfen einer Münze. Genauso ergeht es uns, wenn wir die Natur betrachten: Sie folgt großteils einfachen Regeln, doch aufgrund unserer beschränkten Einsicht in die Vorgänge erkennen wir sie einfach nicht. Einen Hinweis darauf könnte die verblüffende Ähnlichkeit zwischen zweidimensionalen Zellularautomatenmustern mit bestimmten Schneckenschalen sein (Abb. 5). Abbildung 516 Auch Craig Reynolds teilte diese Ansicht. Er war fasziniert vom scheinbar komplexen Schwarmverhalten von Vögeln, das für einen Zuschauer immer den Eindruck erweckt, als ob eine übergeordnete Macht jedem einzelnen Vogel Anweisungen gäbe. Reynolds schaffte es jedoch, das perfekte Flugverhalten auf einfache Regeln zurückzuführen. Mit Hilfe eines Zellularautomaten setzte er diese Regeln im Computer um, und das Ergebnis war ein verblüffend lebensnahes Schwarmverhalten (Abb. 6). Ob die Vögel in Wirklichkeit ähnlichen Regeln folgen, ist 17 freilich nicht beweisbar. Abbildung 6 15 Auf der beiliegenden Diskette befindet sich eine Visual Basic - Version eines eindimensionalen Zellularautomaten. 16 Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer, S. 95 17 Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer, S. 102 14 INFORMATION - KOMPLEXITÄT18 2.4. Bei Experimenten mit Zellularautomaten häuften sich die Hinweise, dass auch die Natur einfachen Gesetzen folgt. Ein Ziel der Wissenschafter war es, die Gesetze der Komplexität und der Selbstorganisation, die der Natur allem Anschein nach zugrunde liegen, zu ergründen. Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik strebt alle Materie und Energie im Universum einer größtmöglichen Unordnung, der Entropie, zu. Bei allen Beobachtungen von Leben im Allgemeinen oder komplexen Strukturen in Zellularautomaten bemerkte man jedoch eine Kraft, die diesem Gesetz entgegenwirkt. Normalerweise löst die Entropie die Ordnung auf; die Evolution bewegt sich jedoch im Gegensatz dazu durch die Kraft der Selbstorganisation immer weiter in Richtung zunehmender Ordnung. Sie scheint damit den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu ignorieren. James Doyne Farmer, ein amerikanischer Pionier auf dem Gebiet der Chaostheorie, sagte dazu einmal: „Ich verstehe die Selbstorganisation im Widerstreit zu dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik als wichtiges physikalisch Prinzip. Ich glaube, dass es ein unumstößliches Prinzip gibt, das in umfassender Weise in die Physik eingebettet ist, also ein sehr wichtiges physikalisches Gesetz.“19 Aber worum handelte es sich bei diesen Prinzipien, und wie konnte man sie finden? Farmer war der festen Überzeugung, dass man diese Fragen beantworten könne. Nur mit der Entdeckung dieser Gesetze sei es möglich, die Geheimnisse des Lebens zu ergründen und damit die Grundlagen zu schaffen, Leben künstlich zu erzeugen. Am Beginn der achtziger Jahre fühlte sich ein anderer junger Mann von der Idee, Leben künstlich zu erschaffen, angezogen. Sein Name war Christopher Gale Langton. Bezeichnet man von Neumann als den Vater des Künstlichen Lebens, so ist Langton sein Geburtshelfer. Langtons Einstieg in die Wissenschaft vollzog sich, als er zum ersten Mal das Spiel Life auf einem Computer ablaufen sah. Fasziniert von den Entdeckungen, die auf dem Gebiet des KL zu machen waren, forschte er mehrere Jahre - ohne von den Anstrengungen anderer Wissenschafter zu wissen. Nachdem er Literatur über von Neumanns ZellularautoAbbildung 720 maten gelesen hatte, entwarf er ein neues System, dessen Zellen statt 29 nur acht unterschiedliche Zustände benötigten. Es entstand ein lebensähnliches System selbstreproduzierender Schleifen (Abb. 7). Lässt man diesen Automaten gemäß seiner Regeln operieren, verlängert sich der Schwanz der Qförmigen Wesen und bildet schließlich eine Tochterschleife. In weiterer Folge entwickelt sich die Population der Wesen ähnlich wie ein Korallenriff. Es entsteht also Ordnung im System. Dieses Verhalten wird nur durch die Zustände der Zellen und den dazugehörigen Gesetzen bestimmt, jedoch in keiner Weise direkt durch den Programmcode. Auch wenn wahrscheinlich kein Biologe an dieser Stelle die Entstehung von Leben prognosti18 vgl. Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer, S. 112 20 Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer, farbiger Mittelteil 19 15 ziert hätte, waren diese Schleifen doch ein phantastischer Durchbruch: Sie besaßen einen Genotyp, also eine Reihe von Kernzellen, die die Information für die Reproduktion enthielten. Außerdem gab es einen Phänotyp, einen neuen Organismus, der durch kodierte Informationen entstanden war. Eine mögliche Mutation des Genotyps konnte in der Folge einen Vorteil für den Phänotyp darstellen. Der Prozess der Fortpflanzung wäre also der gleiche wie bei natürlichen Organismen, wobei die Evolution nicht simuliert, sondern echt wäre. BOTTOM-UP21 2.5. Langton entwarf in Folge noch mehrere ähnliche Systeme und beobachtete verschiedene Automaten, unter anderem eine Simulation des Verhaltens von Insekten, „Vants“ (Virtual Ants)22. Das Ziel von Langton war es, die Gesetze, denen komplexes Verhalten zugrunde lag, zu ergründen. Offensichtliche Beispiele dafür fand er unter anderem in Ameisen- und Termitenpopulationen. „Verschiedene Termiten vollbringen ganz offenbar ihre erstaunlichen Leistungen durch etwas, das Computerwissenschafter dynamische Programmierung nennen. Nach jedem Schritt der Operation wird das Resultat bewertet und das entsprechende Programm (eines von mehreren, die zur Verfügung stehen) für den nächsten Schritt ausgewählt und aktiviert. Daher muss keine der Termiten als Aufseher mit einem Plan in der Hand fungieren.“23 Als Langton diese Zeilen las, erkannte er im letzten Satz eine Aussage, die unbewusst die Verknüpfung zwischen Zellularautomaten und Natur zum Ausdruck brachte. Langton fasste die Quintessenz dieses Ansatzes kurz und prägnant zusammen: bottomup, von der Basis zur Spitze. Der Wissenschafter erkannte damit einen Trick der Natur, der wahrscheinlich eines der fundamentalen physikalischen Gesetze ist. Es beschreibt die Kollektivkraft kleiner Aktionen, die sich nach oben ausbreiten und andere Aktionen hervorrufen, bis ein erkennbares Muster einer Verhaltensweise entsteht. Bottom-up war die Ursache für den Beginn des Lebens, von der Bildung organischer Moleküle über Einzeller bis hin zum Menschen. Jede Zelle eines Lebewesens fungiert als Finite State Machine; jedes Verhalten, das auf einer höheren Ebene als das individuelle Programm abläuft, ist daher neu entstanden. Die Gesamtheit ist mehr als die Summe der Einzelkomponenten. Der nächste Schritt war, herauszufinden, welche Universen Leben hervorbringen konnten. Langton wollte die Klassifizierung Wolframs verbessern. Zu diesem Zweck machte er Tausende von Versuchen mit Zellularautomaten, experimentierte mit den Parametern und entwarf neue Systeme. Wie Langton richtig vermutet hatte, gehörte die Weiterleitung und das Speichern von Informationen zu den unverzichtbaren Merkmalen des Lebens. Doch nur in einem bestimmten Maße konnte die Information auch den vermeintlichen Widerspruch zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik erzeugen und somit einen Zustand zunehmender Ordnung aufrechterhalten. Zur Berechnung und Darstellung dieses Systems führte er ein „mathematisches Instrument zur Einstellung der Dynamik“ ein: den λ-Parameter. Während seiner Versuche benötigte er einen Parameter, der den Punkt des optimalen Informationsflusses festlegte. Der λ-Wert, der zwischen Null und Eins lag, entsprach diesem Punkt. 21 vgl. Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer Eine Version von Vants, die auf denselben Regeln wie Langtons System beruht, befindet sich auf der beiliegenden Diskette. 23 E. O. Wilson; aus: Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer, S. 131 22 16 Wenn der λ-Wert sich gegen Null näherte, waren die Informationen eingefroren. Information konnte ohne weiteres erhalten werden, aber sich nicht weiterbewegen, ähnlich der festen Struktur von Eismolekülen. Wenn der λ-Wert jedoch sehr hoch war, bewegten sich die Informationen frei und chaotisch und waren nur schwer zu erhalten (ähnlich der Moleküle in einem Gas). Diese beiden Zustände entsprachen Wolframs Klasse 1 und 2 bzw. 3 und konnten Leben nicht unterstützen. Jene Zellularautomaten, die einen mittleren λ-Wert hatten, waren am interessantesten. Sie gehörten zur Klasse 4, also zu jenen Zellularautomaten, die wimmelnde Aktivität im Überfluss entwickelten, beispielsweise Gleiterkanonen. Diese Automaten unterstützten eine universelle Rechenleistung, so wie das Spiel Life, dessen λ-Wert übrigens 0,273 betrug. In diesem Zustand war nicht nur die Entropie im optimalen Verhältnis vorhanden, sondern auch maximale Komplexität gegeben - genau wie in lebenden Systemen. Der Punkt, an dem eine universelle Rechenleistung wahrscheinlich wurde, befand sich an einer besonders interessanten Stelle in Langtons Wertetabelle (Abb. 8). Wenn der λ-Wert diesen kritischen Punkt erreichte, vollzog sich eine Phasenumwandlung, also ein plötzlicher Wechsel von einem Zustand zum anderen (ähnlich des Wechsels vom gefrorenen zum flüssigen Zustand in Abbildung 824: Der Punkt, an dem Leben möglich der natürlichen Welt). Mit anderen wird, befindet sich entlang eines schmalen Grats Worten hieß das: Das Schlüsselele- im mittleren, komplexen Bereich. ment des Lebens - der ausgewogene Komplexitätsgrad, durch den es möglich wird, die Entropie „auszutricksen“ - balanciert auf einem schmalen Grat, begrenzt von einem unfruchtbaren Gebiet zur einen und einem reißenden Strudel von Informationen zur anderen Seite. Leben existiert am Rande des Chaos. KL-1 IN LOS ALAMOS25 2.6. Langton war bis zu diesem Zeitpunkt in der Welt der Wissenschaft nicht sehr aufgefallen, und seine Kollegen und Professoren hatten seine Arbeit oft belächelt. Es gab an Universitäten kaum Forschungsprojekte, die sich mit Künstlichem Leben beschäftigten. Die meiste wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiet war von einzelnen Forschern im Alleingang gemacht worden, wobei jeder das „Rad“ immer wieder neu hatte erfinden müssen. 1987 bekam Langton jedoch das Angebot, am CNLS (Center for Nonlinear Studies) in Los Alamos zu arbeiten, eine Abteilung, die komplexe, nichtlineare Systeme untersuchte. Er nutzte seine dortigen Möglichkeiten, um sämtliche Forscher, die bereits im Bereich des KL gearbeitet hatten, zu finden und zusammenzuführen. Der Wissenschafter setzte eine Konferenz, die später unter dem Namen KL-1 in die Geschichte eingehen sollte (engl.: AL-1), für den 21. September 1987 in Los Alamos an. Die Nachricht wurde durch Aushänge in Bibliotheken, durch Botschaften in Computernetzwerken, durch Schleichwerbung im Scientific American sowie durch offizielle Konferenzankündigungen verbreitet. Und siehe da: Langton stach mit seinem Aufruf in ein Wespennest: 160 Computerwissenschafter, Anthropologen, Populationsgenetiker, Biochemiker, Ver- 24 25 Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer, S. 138 vgl. Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer 17 haltensforscher, Physiker und auch einige, die man nicht ohne weiteres einem speziellen Fach zuordnen konnte, kamen zu der Konferenz. Obwohl viele der Wissenschafter bisher vollkommen unabhängig voneinander gearbeitet hatten, also ohne zu wissen, dass es kleine Gruppen von Leuten gab, die sich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigten, war es doch erstaunlich, wie ähnlich ihre Erfahrungen und auch Frustrationen waren. Eine Frage, die während der Konferenz ständig auftauchte, war: Was ist Leben? Denn wie sollte man Leben erschaffen, ohne zu wissen, was es eigentlich ist? Und: Würde man erkennen, dass man es geschaffen hatte? Mit dem gleichen Problem hatten sich auch die Forscher der Künstlichen Intelligenz Jahre zuvor beschäftigt. In diesem Fall war der Lösungsvorschlag von Alan Turing gekommen: Er schlug vor, dass man einen Menschen und einen Computer in einen Raum setzen sollte, um Fragen zu beantworten. Wenn nun ein Zuschauer anhand der Antworten nicht mehr unterscheiden konnte, wer Mensch und wer Computer war, dann hatte der Computer den Test bestanden. Einige Leute auf der KL-1 erfanden nun de Vaucanson zu Ehren den „Enten-Test“: Wenn etwas wie eine Ente aussieht und wie eine Ente quakt, gehört es auch zu der als Enten bezeichneten Gruppe. Dieser Test war zwar sehr subjektiv, aber wahrscheinlich auch nicht subjektiver als der Turing-Test. Nach KL-1 kam es endlich zu einer Erhöhung der Anstrengungen auf dem Gebiet des Künstlichen Lebens, und die neue Wissenschaft machte sehr schnell große Fortschritte. 18 3. D IE N Ä C H S T E G E N E R A T IO N Information und Leben: Ein universeller Computer ist tatsächlich universell und kann jeden Prozess nachbilden (Turing) (II) Die Substanz des Lebens ist ein Prozess (von Neumann) (III) Es gibt Kriterien, nach denen wir lebende von nicht lebenden Dingen unterscheiden können. Akzeptiert man (I), (II) und (III), gesteht man die Möglichkeit von Leben in einem Computer zu. (I) Leben und Wirklichkeit: (IV) Wenn es jemandem gelingt, Leben in einem Computer umzusetzen, das die Bedingungen von Punkt (III) erfüllt, folgt aus Punkt (II), dass diese Lebensformen genauso leben wie Sie und ich. (V) Ein solcher künstlicher Organismus müsste eine Realität R2 wahrnehmen können, die für ihn genauso real ist, wie unsere „wirkliche“ Realität R1 es für uns ist. (VI) Aus Punkt (V) kann geschlossen werden, dass R1 und R2 einen identischen ontologischen Status haben. Obwohl R2 in einer sehr materialistischen Weise in R1 eingebettet ist, ist R2 doch unabhängig von R1. 26 26 Steen Rasmussen, KL-2 in Los Alamos; aus: Stephen Levy: KL – Künstliches Leben aus dem Computer, S. 180 19 DER GENETISCHE ALGORITHMUS27 3.1. Was in den meisten bisherigen Modellen für künstliches Leben fehlte, war ein ausgereiftes System der Evolution. Veränderungen zwischen den Generationen hatte es, wenn überhaupt, nur durch Mutation gegeben. Orientiert man sich allerdings an der Natur - was in der KL-Forschung unerlässlich ist - wird man feststellen, dass Mutation im Vergleich zu einem bestimmten anderen System eine untergeordnete Rolle spielt: dem Crossing-Over. Dabei werden Teile von Chromosomen beider Elternteile untereinander ausgetauscht. In der Folge hat der Nachkomme sowohl Gene des Vaters als auch der Mutter.28 Der Amerikaner John Henry Holland hatte die geniale Idee, dieses System im Computer umzusetzen. Durch einen genetischen Algorithmus übersetzte er den Prozess in den Bereich der Mathematik, wobei das Genom als eine binäre Zahlenkette behandelt wurde. Zu Beginn des Experiments wurden mehrere binäre Ketten zufällig erzeugt. Im nächsten Schritt überprüfte man die Fähigkeiten der entstandenen Organismen. Da man natürlich nicht wie in der natürlichen Welt die Gesetze der Auslese wirken lassen konnte, wurden die Kriterien für die bevorzugte Anpassung vom Programmierer bestimmt. Die besten zehn Prozent der Population wurden dann untereinander gekreuzt, d.h. ihre „Gene“ wurden durch Crossing-Over vermischt und durch Mutation verändert, wodurch wieder die ursprüngliche Zahl an Organismen vorhanden war. Dieser gesamte Prozess wurde nun viele Generationen lang wiederholt, bis die Population die vom Programmierer auferlegten Kriterien perfekt erfüllten. Ein Beispiel: Auf einem schachbrettartigen Gitter von 32×32 Feldern wurde ein Pfad markiert, der aus 89 Quadraten bestand. Ziel des Versuchs war es, ameisenähnliche Kreaturen zu züchten, die diesem Weg folgten (Abb. 9). Die Kreaturen bestanden eigentlich nur aus Ketten von 450 binären Bits, die der Computer zufällig setzte. Der Inhalt der Ketten und die Umweltbedingungen legten das Verhalten für den nächsten Zeitabschnitt fest, also ob sich die Kreatur nach vorne bewegen oder nach links oder rechts drehen sollte. Zunächst wurde nun eine Population von ca. 65 000 „Zufallsameisen“ gebildet. Wie zu erwarten war, bewegten sich die meisten Abbildung 929: Die grauen Felder überhaupt nicht oder nur in eine Richtung. Einimarkieren den kürzesten Weg durch ge Ameisen bewegten sich jedoch mehrere Felden lückenhaften Pfad. der entlang des Pfades. Die erfolgreichsten 10 Prozent wurden für die Reproduktion ausgewählt und gemäß des genetischen Algorithmus untereinander gepaart. Generation für Generation bewältigten die Ameisen ein größeres Teilstück des Pfads, und nach siebzig Generationen schafften die ersten Ameisen den gesamten Weg. Das erstaunliche an diesem System war nicht nur, dass man scheinbar aus nichts etwas hervorbrachte, sondern auch die vielen Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel gelang es, durch einen genetischen Algorithmus eine Strategie für eine vereinfachte Schachversion zu finden, oder die Funktionen einzelliger Organismen zu simulieren. 27 vgl. Stephen Levy: KL – Künstliches Leben aus dem Computer Microsoft Encarta 99 Enzyklopädie 29 Stephen Levy: KL – Künstliches Leben aus dem Computer; S. 206 28 20 Außerdem gibt es Anwendungen in der Spieltheorie und sogar in der Diplomatie, sowie in der Computergraphik. EVOLUTIONÄRES WETTRÜSTEN30 3.2. Dennis Hillis entwarf ein ähnliches System. Die Organismen des von ihm entworfenen Universums nannte er Rampen, und die Auswahl zur Reproduktion wurde von ihrer Fähigkeit bestimmt, sechzehn Zahlen in absteigender Reihenfolge zu ordnen. Der beste von Menschen geschaffene Programmier-Algorithmus erledigte diese Aufgabe in sechzig Schritten. Hillis generierte ca. 65 000 zufällige Rampen, die selbstständig einen passenden Algorithmus finden sollten. Nach einigen hundert Generationen hatten die Rampen bereits ein System entwickelt, das die Aufgabe in 65 Schritten lösen konnte. Dann trat jedoch eine evolutionäre Stagnation ein, und die Rampen schienen sich kaum weiterzuentwickeln. Hillis wollte jedoch noch bessere Ergebnisse erzielen. In der natürlichen Evolution wird die Weiterentwicklung von Arten durch sogenanntes „evolutionäres Wettrüsten“ beschleunigt. Dieses Wettrüsten entsteht beispielsweise, wenn sich zwei Populationen in einer Wirt-Schmarotzer-Beziehung gegenüberstehen. Immer dann, wenn der Wirtsorganismus eine Abwehrreaktion zeigt, entwickelt der Parasit eine Gegenreaktion, die das wieder ausgleicht. Dennis Hillis nahm nun Parasiten „Anti-Rampen“ - in sein System auf. Sie wurden danach bewertet, wie stark sie ihre Wirte bedrohen konnten. Ein Angriff von Parasiten stellte sozusagen einen Testlauf für den Algorithmus des Wirts dar, deswegen waren die Rampen gezwungen, ihre Algorithmen zu verbessern. Gelang ihnen dies, verbesserten sich auch die Parasiten, was wieder eine Erhöhung der Anstrengungen der Wirte zur Folge hatte. Durch dieses evolutionäre Wettrüsten entwickelten die Rampen schließlich einen respektablen Algorithmus von 61 Schritten. Alle diese Evolutionssysteme hatten jedoch einen Haken: Die Kriterien der Auslese wurden vom Programmierer bestimmt, was die Evolution in bestimmte Richtungen drängte und ihr Schranken auferlegte. Ein alternativer Ansatz wäre eine Strategie mit offenem Ausgang, in der sich die Kriterien für eine Eignung erst entwickeln würden, wie es ja auch in der Natur geschehen war. Ideal wäre es natürlich, eine virtuelle Ursuppe zu programmieren und dann ein paar virtuelle Milliarden Jahre zu warten, bis sich – hoffentlich – eine Vielfalt von Lebewesen entwickelt, die mit der auf der realen Erde vergleichbar ist. Das ist allerdings weit jenseits der Möglichkeiten. Deshalb mussten die KLForscher ein System programmieren, dessen Organismen bereits in einer späteren Entwicklungsstufe standen. Dem Biologen Thomas Ray gelang es, innerhalb des Computers ein Universum zu realisieren, dessen Organismen zu einer Evolution mit offenem Ende fähig waren. Die Kreaturen in „Tierra“ befanden sich in einem ständigen Wettstreit um Prozessorzeit und Speicherplatz, denn während natürliche Organismen ihre Energie von der Sonne bezogen, gewannen sie ihre Energie aus der CPU des Computers. Die Komponenten des Computers bildeten die Umwelt, und die Kreaturen waren Programme, die auf dem Rechner liefen. Die Evolution wurde unter anderem durch Mutationen und natürlich Crossing-Over in Gang gehalten, außerdem war die Lebenszeit der Organismen begrenzt. Das Experiment übertraf die Erwartungen Rays bei weitem. Zunächst hatte er nur eine Population von Kreaturen ausgesetzt, deren Code (Genom) er selbst programmiert hatte, doch schon nach wenigen Generationen entstanden Mutanten, die aufgrund einer geringeren Größe weniger Rechenzeit benötigten, um sich zu reproduzieren. Sie ge30 vgl. Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer 21 wannen schnell die Oberhand über die ursprünglichen Kreaturen. Kurz darauf bildeten sich Wesen, die nur mehr halb so groß waren wie ihre Vorgänger, da ihnen die Fähigkeit zur Reproduktion fehlte. Erstaunlicherweise gelang es ihnen trotzdem, sich zu vermehren, und zwar indem sie sich einen Wirt suchten, um von ihm den Replikationscode „auszuleihen“. Die Natur Tierras hatte also Parasiten gebildet! In Folge kam es zu einer langen Phase des evolutionären Wettrüstens, und schließlich gelang es den Wirten durch einen Trick sogar, die Parasiten vorübergehend auszurotten. Während der weiteren Evolution der Organismen entwickelte sich jedoch ein neuer Angriffspunkt für Parasiten, die dann auch nicht lange auf sich warten ließen. Während die Natur für einen solchen Vorgang Millionen von Jahren gebraucht hatte, entwickelte Tierra diese Phänomene innerhalb weniger Minuten. Für Evolutionsbiologen war dieses künstlich geschaffene Universum ideal für Versuche bezüglich der Wirkungsweise der Evolution sowie des Zusammenhangs zwischen Evolution und Selektion – vorausgesetzt, sie anerkannten die Ähnlichkeit des Modells mit der Natur. DER BALDWIN-EFFEKT31 3.3. Seit Mendel ist es allgemein bekannt, dass nichts von dem, was Organismen während ihres Lebens lernen, an ihre Nachkommen weitergegeben wird. Die gegenteilige Ansicht vertrat der Lamarckismus, der besagte, dass während des Lebens erworbene Eigenschaften vererbt werden könnten. Die KL-Forscher hielten sich natürlich nicht an die nicht mehr aktuellen Theorien Lamarcks, trotzdem untersuchte der Computerwissenschaftler David Ackley den Einfluss des Lernens auf die Entwicklung von Arten. Er hatte von der Theorie des amerikanischen Philosophen und Psychologen James Mark Baldwin gehört, der annahm, dass die Evolution im Sinne Darwins durch erworbene Fähigkeiten eines Individuums beeinflusst werden könnte. Im Gegensatz zum Lamarckismus wurden jedoch nicht die Gene selbst weitergegeben, sondern nur die Vorteile, die aus dem Gelernten entstehen, was natürlich die Kriterien für Tauglichkeit änderte. Ein Beispiel: Einige Mitglieder einer Eichhörnchenpopulation lernen während ihres Lebens, von Baum zu Baum zu springen. Entwickelt sich jetzt durch eine Mutation beispielsweise eine Haut zwischen den Zehen, stellt diese einen großen Vorteil für die fliegenden Eichhörnchen dar. Ihre am Boden lebenden Verwandten ziehen währenddessen keinen Nutzen daraus, weshalb sich die Mutation bei letzteren nicht im Genpool ausbreitet. Bei den fliegenden Eichhörnchen wird sich diese Eigenschaft jedoch schnell verbreiten, und sie werden bald dazu geboren, von Baum zu Baum zu springen. Was die Vorfahren erlernten, erben die Nachkommen.32 John Holland hatte kurz zuvor eine Routine programmiert, die es künstlichen Wesen ermöglichte, zu lernen. Er benutzte dazu ein Klassifizierungssystem, mit Hilfe dessen die Kreaturen den Erfolg von Handlungen bewerten konnten, um in Zukunft auf diese Erfahrungen zurückzugreifen. Mit Hilfe dieses Systems gelang es künstlichen Kreaturen zum Beispiel zu lernen, wie sie Gefahren entkamen oder ihren Weg durch Labyrinthe fanden. Während das Klassifizierungssytem sich durch Evolution verändern konnte, wurde das Gelernte natürlich nicht an die Nachkommen weitergegeben. Ackley entwickelte nun eine KL-Welt, deren Wesen mit der Fähigkeit ausgestattet waren, zu lernen. In seiner Welt gab es zwei Spezies, die sich bekämpften sowie Pflanzen als Nahrung und Bäume, die zum Schutz dienten. Versuchsweise setzte er in mehreren Durchläufen Kreaturen aus, die die Fähigkeit hatten, zu lernen, sowie andere, die dies nicht konnten. Wie sich herausstellte, hatten letztere im evolutionären Wettkampf keine 31 32 vgl. Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer, S. 326 22 Chance gegen die anderen. Der Baldwin-Effekt schien sich also auch in der Praxis zu bewahrheiten. KL-ROBOTER33 3.4. Bis in die späten achtziger Jahre waren Roboter fast ausschließlich mit den Techniken und Verfahren der Künstlichen Intelligenz (KI) konstruiert worden. Während die Prinzipien der Künstlichen Intelligenz bei Anwendungsgebieten wie Schachprogrammen aufgrund des überschaubaren „Universums“ von 8×8 Feldern sehr gut geeignet waren, hegten einige Wissenschafter Zweifel, ob klassische KI auch bei komplexeren, realitätsnäheren Problemen die passende Lösung darstellte. Die KI-Roboter versuchten, ihre Umgebung im gesamten Ausmaß zu erfassen, um dann ihre Aktionen zu planen. Diese top-down-Technik stellt genau die umgekehrte Methodik des bottom-up dar, das bei Künstlichem Leben verwendet wird. Das Vorgehen der KI-Roboter war in gewisser Weise daran angelehnt, wie Menschen an Probleme herangehen. Jene Roboter hingegen, die auf der Technik des KL beruhten, setzten einige Entwicklungsstufen tiefer an, und orientierten sich eher am Verhalten von Insekten. „Insekten werden normalerweise nicht für intelligent gehalten. Dennoch ... leben sie in einer dynamischen Welt, führen zahlreiche, komplexe Aufgaben durch, wie Jagen, Fressen, Paaren, Nestbau und Aufzucht der Jungen. Es mag Regen und Stürme geben, Feinde können auftauchen, und zuweilen können Futterquellen knapp werden, alles Dinge, die die Überlebenschancen der Insekten beeinträchtigen können. Statistisch gesehen sind die Insekten jedoch erfolgreich. Kein von Menschen geschaffenes System ist auch nur annähernd so zuverlässig.“34 Laut den Ergebnissen der Ethologie35 baut das Verhalten von Insekten und vielen anderen Kleinstlebewesen auf einer hierarchischen Struktur auf. Der Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Niko Tinbergen beispielsweise untersuchte die Verhaltensweisen eines Fisches, des Dreistacheligen Stichlings, und beobachtete eine Struktur, die auf sogenannten Auslösern beruhte. Mithilfe dieser Auslöser konnte man genau sagen, was der Fisch in einem bestimmten Augenblick tun würde. Die KL-Forscher brachten diese Beobachtung natürlich sofort mit Turings Finite State Machine in Verbindung. Die Erkenntnisse Tinbergens konnte man also ohne weiteres im Computer – oder in Robotern – umsetzen. Das Insekt musste seine Umwelt nicht im Gesamten überblicken, ausschlaggebend für jede Handlung war nur die nähere Umgebung. Randall D. Beer, ein amerikanischer Wissenschafter, schuf wahrscheinlich die bis heute komplizierteste Simulation eines Insekts. Bei seiner „Computerschabe“, die zunächst nur innerhalb eines Rechners umgesetzt wurde, stand ein Nervensystem im Mittelpunkt, das an biologische Vorgaben angelehnt war. Das Insekt hatte sechs Beine und zwei lange Fühler. Es war mit einem komplexen neuralen Netz ausgestattet, über das Reize aus der Umgebung aufgenommen wurden und das sein Verhalten bestimmte. Die erste Aufgabe der Schabe war es, gehen zu lernen. Mit Hilfe des neuralen Netzes dauerte es nicht lange, bis die Kreatur eine stabile Gangart entwickelte, bei der, wie bei Insekten, immer drei Beine gleichzeitig den Boden berührten. Unterbrach Beer einige Verbindungen im neuralen Netz, änderte die Schabe ihre Gangart. Sie war also gewissermaßen fähig, sich von Verletzungen zu erholen. 33 vgl. Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer R. A. Brooks: AI Through Building Robots (KI durch Konstruktion von Robotern); aus: Stephen Levy: KL – Künstliches Leben aus dem Computer, S. 348 35 Wissenschaft vom Verhalten und seinen Grundlagen 34 23 Nachdem sich die Schabe mit Hilfe ihres neuralen Netzes einige neue Verhaltensweisen beigebracht hatte, untersuchte Beer ihre Überlebensfähigkeit. Er setzte sie im hungrigen Zustand in einer Art Käfig aus. Darin befand sich eine Futterquelle, die jedoch durch eine längliche Barriere von der Schabe getrennt war. Nachdem die Schabe die Futterquelle gewittert hatte, bewegte sie sich geradlinig in die Richtung des Futters. Als sie an die Barriere stieß, drehte sie sich und lief an ihr entlang, obwohl sie sich damit von der Futterquelle entfernte. Bei diesem Vorgang verminderte sich das FuttersuchVerhalten, während sich das Folge-der-Barriere-Verhalten allmählich verstärkte. Nachdem die Schabe das Ende der Barriere erreicht hatte, hatte sie die Witterung des Futters endgültig verloren. Das Wandverfolge-Verhalten wurde nun durch ein Erkundungsverhalten ersetzt. Die Kreatur streifte herum und nahm schließlich die Witterung der Futterquelle wieder auf, was sich durch ein kurzes Zögern zeigte. Nun bewegte sie sich schnurstracks zur Futterquelle und begann zu fressen. Genau wie bei einer echten Schabe war auch in diesem Experiment keine Voraussage des Verhaltens möglich, da es nicht programmiert war, sondern sich entwickelte. Ein Zuschauer hätte das Verhalten der Computerschabe wahrscheinlich nicht von dem einer echten unterscheiden können. Die Ansammlung von Pixeln auf dem Computerbildschirm schien einem das Gefühl zu geben, zumindest für einen kurzen Moment, dass sie wirklich lebte. Die Anwendungsgebiete solcher Roboter sind erstaunlich: Die Möglichkeiten gehen vom staubsaugenden Haushaltsroboter bis hin zum Mars-Erkundungsroboter. Die NASA-Forscher spielen sogar mit dem Gedanken, statt eines großen, teuren Roboters, der die Landestelle für eine mögliche Mars-Mission vorbereiten soll, die Kollektivkraft hunderter kleiner Roboter zu verwenden, die mit KL-Techniken durch Selbstorganisation und Schwarmverhalten diese Aufgabe schneller und vor allem billiger lösen könnten. Sollte nun der Anspruch erhoben werden, dass die Computerschabe und ähnlich fortgeschrittene KL-Simulationen lebende Wesen darstellten? Seit Chris Langton mit seinem λ-Faktor eine Quantifizierung für lebende Systeme schuf, versuchten viele Wissenschafter, sein System zu erweitern oder andere Maßstäbe für das Leben zu finden. Eine plausible, allgemeingültige Einteilung für lebende und tote Materie hat jedoch niemand gefunden; jene Klassifikationen, die bisher gemacht wurden, sind nicht in allen Gebieten der Wissenschaft anerkannt oder lassen zuviel Spielraum bei der Beurteilung. Wahrscheinlich ist es jedem selbst überlassen, ob er Computern zugesteht, Leben – gemäß einer eigenen Definition – entwickeln zu können. Paul Viola, ein Roboterkonstrukteur, sagte einmal, dass es sein Ziel sei, einen Roboter zu bauen, der sich in jeder Situation wie ein Hund verhält, praktisch ein Hund war. Falls es ihm gelänge, würde er den Hund nach Hause nehmen und ihn den Kindern seines Freundes zeigen. Wenn sie ihn liebgewinnen würden, dann wäre der Hund lebendig. 24 4. C R E A T UR E S „Die gleichen Prozesse, die zur Entstehung von Leben geführt haben, wurden in Software umgesetzt, und das Ergebnis ist überwältigend. Ich habe dieses Programm zum ersten Mal in der Woche gesehen, in der Anzeichen für Leben auf dem Mars entdeckt wurden. Das hier ist aufregender.“ Douglas Adams („Per Anhalter durch die Galaxis“) „Das beeindruckendste Beispiel für Künstliches Leben, das ich je gesehen habe ...“ Richard Dawkins, Zoologe an der Universität Oxford36 36 MegaSeller, Ausgabe 1; TREND Redaktions- und Verlagsgesellschaft mbH 25 „ALBIA“ – EINE KÜNSTLICHE WELT37 4.1. Ende des Jahres 1996 erschien das hochgelobte Computerspiel „Creatures“ (Abb. 10). Nicht umsonst erregte es nicht nur Aufsehen in Computerzeitschriften, sondern auch in der Welt der Wissenschaft. Mit Creatures hat erstmals auch der Privatanwender die Möglichkeit, mit Künstlichem Leben zu experimentieren, denn die Simulation ist auf jedem gewöhnlichen Personal Computer lauffähig. Dabei muss der Spieler freilich nichts über die Technik des KL wissen; die Simulation macht Interessierte spielerisch mit dem Thema vertraut. Der Spieler beobachtet bei der KL-Simulation die Welt „Albia“ von der Seite und kann mit Hilfe der Computermaus in das Geschehen eingreifen. Die Wesen, die Albia bevölkern, heißen Norns und sind verhältnismäßig intelligent. Sie sind in der Lage, mit Hilfe eines neuralen Netzes zu lernen, und verfügen über ein ausgeklügeltes Stoffwechselsystem. Während ihres Lebens, das durchschnittlich 12 bis 14 Spielstunden lang ist, durchlaufen sie sechs verschiedene Entwicklungsstufen – von der offenen, neugierigen Haltung eines Norn-Babys über das Erreichen der Geschlechtsreife bis zum behäbigen, krankheitsanfälligen Greis. Durch Verwendung der Maus kann der Spieler in die Welt eingreifen; er kann die Aufmerksamkeit der Kreaturen auf ein bestimmtes Objekt lenken oder seine Schützlinge z.B. nach erfolgreichen Aktionen anerkennend streicheln oder rügend schlagen. Nachdem die Norns einige Wörter gelernt haben, kann dieses Vorgehen durch Eintippen der Befehle „ja“ und „nein“ ersetzt werden. Durch eine primitive, aber zweckmäßige Verb-ObjektSprache können Spieler und Norn miteinander kommunizieren. Ab dem Alter von etwa einer Stunde sind die Norns fortpflanzungsfähig. In Albia tragen die Weibchen die Eier aus, die der Spieler dann in einen Brutkasten legen kann, sobald er sie ausbrüten will. Abbildung 10 Die Gene des Neugeborenen entstehen durch Vermischung der Erbanlagen von Vater und Mutter, also durch einen genetischen Algorithmus sowie durch Crossing-Over. Außerdem kann es zu Mutationen kommen.38 In Albia lebt noch eine zweite Rasse: die „Grendels“; sie sind nornähnliche, aber bösartige Wesen, die Krankheiten übertragen und einen schlechten Einfluss auf Norns ausüben. In der Welt gedeihen außerdem nachwachsende Nahrungsmittel wie Karotten oder Zitronen sowie eine Pflanzenwelt und diverse Insekten und Fische. Albia erstreckt sich über zahlreiche Bildschirme. Ihre Zeit vertreiben sich die Norns neben Entdeckungsreisen mit diversen Spielsachen (z.B. Ball, Kreisel, Radio). Albia birgt aber auch einige Gefahren wie giftige Pflanzen oder die schon erwähnten Grendels. 37 38 vgl. MegaSeller, Ausgabe 1 Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 10/1996; Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, S. 14-19 26 Das faszinierende an Creatures ist, dass niemand vorhersagen kann, wie die Albia sich entwickelt. Durch die große Verbreitung der Simulation auf der ganzen Welt können tausende von unterschiedlichen Erbanlagen entstehen. Da es möglich ist, Norns über das Internet zu verbreiten, können viele Züchter auf ein großes Potential an genetischem Material zurückgreifen. Als Züchter übernimmt der Spieler die Aufgabe, die Kriterien für die Auslese zu bestimmen. So wie ein Hundezüchter nur die Hunde mit einem hervorragenden Stammbaum (= einwandfreie Gene) für die Paarung auswählt, ist es dem Spieler überlassen, welchen Norns er es erlaubt, sich fortzupflanzen. Damit kann er die Evolution – so weit es die Simulation zulässt – in eine bestimmte Richtung lenken. Selbst Merkmale wie Körperfarbe, Gangart und die Form der Ohren sind erblich bestimmt (Abb. 11). Der Entwickler von Creatures ist übrigens kein bekannter KLForscher, sondern ein Autodidakt, nämlich der Engländer Stephen Grand. Das Programm wurde von der Firma Cyberlife entwickelt und wird in einer englischen, französischen und deutschen Version vertrieben. 40 Abbildung 1139 DIE BIOLOGIE DER NORNS41 4.2. Norns stehen bereits auf einer relativ hohen Entwicklungsstufe. Sie verfügen über ein Gehirn, einschließlich eines Kurz- und Langzeitgedächtnisses; simuliert werden außerdem Verdauungssystem, Hormonhaushalt und Sinnesorgane. Norns können sehen, hören und riechen, sie sind fähig, Wärme und Kälte sowie Schmerz zu empfinden, und handeln manchmal aufgrund ihrer Triebe. Alle Eigenschaften der Individuen sind in ihrem Erbgut festgelegt. Ihr Verhalten entwickelt sich spontan aus dem gegenwärtigen Zustand, aus persönlichen Erfahrungen, momentanen Stimmungen sowie Umwelteinflüssen. Ihre Reaktion auf eine bestimmte Situation ist nicht vorhersehbar, deshalb wird der Beobachter immer wieder durch unerwartete Aktionen überrascht. Durch Nahrungsknappheit wird der Überbevölkerung vorgebeugt, außerdem bedrohen zahlreiche Bakterien die Norns. Krankheiten können durch Niesen oder Husten übertragen werden. Deshalb ist es beispielsweise gefährlich, Norns aus dem Internet herunterzuladen, da der Fremde unter Umständen einen gefährlichen Virus einschleppen könnte, gegen den die eigenen Norns noch keine Abwehrstoffe entwickelt haben. Da das Spiel auch für Laien konzipiert wurde, mussten freilich einige Kompromisse gegenüber der strengen KL-Philosophie gemacht werden. Albia ist im Prinzip zweidimensional und wurde absichtlich sehr überlebensfreundlich gestaltet, um den Schwierigkeitsgrad in anwenderfreundlichen Regionen zu halten. Das Lernen der Norns wird aufgrund einiger angeborener Instinkte beschleunigt, sodass die Norn-Babys zum Beispiel jeden erreichbaren Gegenstand sofort in den Mund stecken und somit wahrscheinlich schnell etwas Nahrhaftes erwischen. Auch die Vererbung wurde zugunsten schneller Zuchterfolge etwas vereinfacht, sodass Mutationen nur sehr selten tödlich enden.42 Trotzdem ist die Biologie der Norns sehr komplex: Das Innenleben der Kreaturen lässt sich in mehrere Bereiche gliedern: 39 Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 10/1996, S. 16 Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 10/1996, S. 14-19 41 vgl. MegaSeller, Ausgabe 1 42 Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 10/1996, S. 14-19 40 27 Zentrales Nervensystem Das neurale Netz, das äußere Reize und die momentane Gefühlslage zu einer Handlung verarbeitet, ist – wie beinahe alle anderen Eigenschaften eines Norns – genetisch bestimmt. Es ist möglich, dass spätere Generationen über veränderte Gehirne verfügen, aber der Selektionsdruck wird die ursprüngliche Form wahrscheinlich lange stabil halten. Eine wesentliche Funktion des Gehirns ist es, aus den individuellen Erfahrungen des Norns zu lernen. Zu diesem Zweck spezialisieren sich bestimmte Neuronen des neuralen Netzes auf Kombinationen von Ereignissen, die dann verknüpft werden. Die Erfahrung folgt weitgehend dem Behaviorismus43, da dieser eine verhältnismäßig einfache Gehirnstruktur erlaubt. Ein Beispiel: während ein Ball hüpft, erregt zufällig der Ofen die Aufmerksamkeit eines Norns; er berührt ihn und verbrennt sich dabei die Finger. Das Gehirn speichert daraufhin folgende Erfahrungsregel: „Wenn der Ball hüpft und der Ofen in der Nähe ist, dann ist es schmerzhaft, den Ofen anzufassen.“ Das Gehirn ist in der Lage, diese Situation zu verallgemeinern; wenn der Norn später den Ofen ohne Ball sieht, wird er trotzdem vermeiden, ihn zu berühren. Die Erfahrungsregeln werden nicht direkt, sondern durch Veränderung der Gewichtung von synaptischen Neuronen abgespeichert. Statt in richtigen Synapsen findet die Rückkoppelung bei den Kreaturen auf simuliertem chemischem Wege statt: eine angenehme Erfahrung setzt beispielsweise einen Erfolgsstoff frei; bei schlechten Erfahrungen entsteht ein Misserfolgsstoff. 44 Das Gehirn eines Norns ist in verschiedene Abschnitte (Lobi) aufgeteilt, die über Sinnesorgane mit der Außenwelt in Verbindung stehen oder mit anderen Gehirnabschnitten interagieren. Die wichtigsten Lobi sind: • Sinnes-Lobi • Konzeptraum (Speicherung von Ereignissen) • Entscheidungsschicht • Aufmerksamkeitsschicht • Biochemie Verdauungssystem Die Hauptenergiequelle in der Nahrung der Norns ist Stärke. Sie wird in Glucose umgewandelt, die direkt von energieverbrauchenden Organen, wie Muskeln, genutzt werden kann. Wird Glucose nicht direkt in Energie umgeformt, wandelt sie der Körper langsam in Glycogen um, das – ähnlich einem Fettpolster – eine langfristige Energiereserve darstellt. Der Hunger eines Norns wird außerdem durch Zucker gesenkt. Ein Norn, der energiearme Nahrung zu sich nimmt, die jedoch viel Zucker enthält, glaubt, seinen Hunger gestillt zu haben und wird eine Weile nichts essen, obwohl er nicht genügend Nährstoffe zu sich genommen hat. Dies wird den Norn langfristig schwächen. Fortpflanzungssystem Männchen sind in Albia ab der Pubertät immer fortpflanzungsfähig, während Weibchen einen Ovulationszyklus haben und deshalb nur zu bestimmten Zeitpunkten fruchtbar sind. Dieser Zyklus wird durch das Hormon Östrogen gesteuert. Lässt es der Sexualtrieb zu, gehen die Norns auf Partnersuche. Man erkennt die Paarung zweier Norns an einem langen Kussgeräusch mit einem „Plop“ am Schluss. Wird eine Eizelle befruchtet, wird das Nornweibchen schwanger, und es legt ein hartschaliges Ei. Da das Schlüpfen temperaturabhängig ist, kann der Spieler den Prozess beschleunigen, indem er das Ei in einen Brutkasten legt. 43 Forschungsströmung, in der Verhalten (Reaktionen) in Beziehung zur Umgebung (Reize) gesehen wird. 44 Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 10/1996, S. 14-19 28 Immunsystem Da es in Albia verschiedene krankheitserregende Bakterien gibt, benötigen Norns ein leistungsfähiges Immunsystem – von seinem Zustand hängt es ab, ob sie erkranken. Bakterien sind – wie in der Realität – mit einer Chemikalie namens Antigen beschichtet, die in verschiedenen Varianten vorkommt. Entdeckt das Immunsystem ein Antigen, beginnt es, Antikörper zu produzieren, die sich schließlich an die Antigene hängen und so die Bakterien töten. Bis es dem Immunsystem möglich ist, Antikörper zu bilden, vergeht jedoch einige Zeit, in der die Bakterien Schadstoffe auf den Norn loslassen. Diese Schadstoffe können Husten oder Niesen auslösen, gefährlichere Varianten verursachen raschen Nahrungsverlust (Glucoseverlust). Die Bakterien Albias können sich weiterentwickeln. Mutierte Bakterienformen mit unbekannten Antigenen und wirksameren Schadstoffen können entstehen, die sich dann, verglichen mit weniger ansteckenden Varianten, schneller verbreiten werden. Kranke Norns sollten deswegen auf einem isolierten Teil der Insel in Quarantäne gehalten werden. Stoffwechsel Das Körpersystem von Norns basiert auf komplexen chemischen Reaktionen einer Vielzahl von Stoffen. Einige dieser Stoffe kann der Spieler den Norns direkt injizieren. Chemikalien regeln Verdauungsprozesse, Fortpflanzungszyklen und Krankheitswiderstand, wirken auf das Gehirn und regeln das Verhalten (Abb. 12). • • • • • • • • • • • • 45 Endorphin: reduziert Schmerzwahrnehmung Bestrafung / Belohnung: fördert / hindert das Wachstum von Nervenver- Abbildung 12: Wenn der Norn den heißen Ofen berührt, steigt der Schmerz rasant an, bindungen ConASH, DecASH: Regelt den Verfall lässt aber relativ schnell nach, während der Zorn anhält. Erst nach einer Weile erwacht von Nervenverbindungen im Gehirn 45 Triebchemikalien: Schmerz, Genuss- wieder das Genussbedürfnis. bedürfnis, Hunger, Kälte, Erschöpfung, Schläfrigkeit, Einsamkeit, Beengtheit, Angst, Langeweile, Ärger, Sexualtrieb Stärke, Glucose, Glycogen, Hexokinase: zur Energiespeicherung notwendig. Kohlendioxyd: Endprodukt der Energieproduktion Testosteron, Östrogen, Progesteron, Gonadotropin: Fortpflanzungshormone Alkohol: sinnestäuschende Wirkung Adrenalin: Produktion wird durch Stress verursacht Histamin:: bewirkt Irritationen Antikörper: Verteidigung gegen Infektionen Antigene: Anzeichen einer Infektion Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 10/1996, S. 17 29 DAS POTENTIAL DER NORNS46 4.3. Die Entwickler von Creatures legten großen Wert darauf, dass Norns sich verhalten wie zutrauliche, neugierige Haustiere. Wie bei allen KL-Simulationen kann jedoch niemand sagen, wie sich das System entwickelt. Es gab bereits unzählige unerwartete Beobachtungen: Beispielsweise spielten zwei Norns Ball miteinander – offensichtlich hatten die beiden entdeckt, dass ihnen das Spaß machte. Ein männlicher Norn rannte eine Weile hinter einem Weibchen her, aber sie lief ihm davon, da sie gerade keine Lust dazu hatte; schließlich gab er es auf und legte sich frustriert schlafen. Ein Benutzer fand einmal, nachdem er das Spiel kurz unbeaufsichtigt gelassen hatte, eine viel größere Zahl an Kindern vor – ein Norn hatte entdeckt, dass er sich Spielgefährten verschaffen konnte, indem er Eier zur Reifung in den Brutkasten legte. Auch auf genetischer Ebene gab es bereits interessante Entwicklungen: Mehrere Benutzer berichten von der Bildung eines sogenannten „Highlander“-Gens. Diese Mutation bewirkt, dass Norns ca. zwei- bis dreimal länger leben als üblich. Außerdem wurde nicht nur ein „Im-Stehen-Schlafen-Gen“ gefunden, sondern auch unzählige andere teils sinnlose, teils faszinierende Veränderungen des Erbguts entdeckt. Da alle chemischen Reaktionsgleichungen Bestandteile des Erbmaterials sind, ist es gut möglich, dass auch sie eines Tages mutieren. Vielleicht entsteht einmal eine Reaktion, die bewirkt, dass eine Kreatur dreimal so viel Glucose aus Glycogen erzeugt wie zuvor. Unsterblichkeit ist ebenso denkbar wie unbegrenzte Eierproduktion.47 Ob sich diese Merkmale jedoch durchsetzen, liegt einzig und allein in der Hand des Spielers. Ende des Jahres 1998 erschien übrigens ein zweiter Teil von Creatures. Neben den Grendels gesellen sich in Creatures 2 die gutmütigen, intelligenten Ettins zu den Norns. Das Spielareal ist etwa um das Doppelte gewachsen, außerdem gibt es neue Maschinen und Spiele für die Kreaturen. Im Gegensatz zum ersten Teil gibt es auch ein Spielziel: Die genetische Verschmelzung der drei Spezies mit Hilfe einer versteckten Maschine.48 46 vgl. Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 10/1996, S. 14-19 Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 10/1996, S. 14-19 48 GameStar Ausgabe 11/1998; IDG Entertainment Verlag GmbH, S. 180 47 30 5. G E FA H R E N - P E R S PE K T IVE N „Wie kannst du es wagen, so mit dem Leben zu spielen? Tu deine Schuldigkeit mir gegenüber, und ich tue dir und der ganzen Menschheit gegenüber meine Schuldigkeit. Wenn du auf meine Bedingungen eingehst, werde ich sie und dich in Frieden lassen. Aber wenn du dich weigerst, werde ich das gefräßige Maul des Todes füllen, bis es vom Blut deiner noch lebenden Lieben gesättigt ist.“ Frankenstein 31 CHIP-EVOLUTION49 5.1. Ein relativ neues Anwendungsgebiet der digitalen Evolution findet man in der Entwicklung von Computerchips. Dabei werden KL-Techniken verwendet, um Chips möglichst effizient zu entwerfen. In der University of Sussex in Brighton verwendet man dazu einen „XC6216“-Chip der kalifornischen Firma „Xilinx“. Die Konfiguration dieser Chips ist nicht unveränderlich vordefiniert, sondern kann durch eine Folge von „Konfigurationsbits“ bestimmt werden. Diese Bits werden als Erbgut betrachtet und durch den genetischen Algorithmus solange miteinander gekreuzt, bis der Chip die Anforderungen optimal erfüllt. Beispielsweise wird einem Chip zunächst die Aufgabe gestellt, zwischen zwei Frequenzen zu unterscheiden – ein Baustein bei der Entwicklung eines Spracherkennungssystems. Zuerst wird eine Zahl zufälliger Bitfolgen erzeugt. Diese werden am Chip angewendet und ihre „Fitness“ überprüft, indem man testet, wie gut die Schaltungen die Frequenzen unterscheiden können. Die fittesten Varianten werden dann mit Hilfe des genetischen Algorithmus untereinander gekreuzt. Nach etwa 4000 Generationen entstand dadurch bei einem Versuch mit einer anfänglichen Zahl von fünfzig Bitfolgen ein perfekter Chip. Die Evolution erzeugte eine Schaltung, die so bizarr verschachtelt war, dass es beinahe unmöglich war, ihre Funktionsweise zu durchschauen. Ein Mensch hätte für die Schaltung zehn- bis hundertmal so viele Bauelemente benötigt. COMPUTERVIREN50 5.2. Ein sehr gefährliches Beispiel für Programme, die auf KL-ähnlichen Techniken beruhen, findet man in Computerviren. Der amerikanische Student Fred Cohen unternahm 1983 als erster den Versuch, ein selbstreplizierendes Programm unter kontrollierten Verhältnissen in einem Computernetzwerk auszusetzen. Er hatte den Virus so geschrieben, dass er in einem Netzwerk Programme infizierte, die gerade aktiv waren. Diese Programme modifizierte der Virus dann, indem er eine Kopie von sich selbst anhängte. Auf diese Weise gelang es innerhalb kürzester Zeit, bis zum Rechner des Systemverwalters vorzudringen und Cohen dessen Rechte zu verschaffen. Cohens erkannte, dass seine Erkenntnisse hochbrisant waren und wollte weitere Experimente durchführen. Die Verantwortlichen der Computernetzwerke verweigerten ihm jedoch oftmals die Erlaubnis, seine Experimente darin durchzuführen. Noch dramatischer wurden die Reaktionen, als Cohen seine Ergebnisse in der Öffentlichkeit diskutieren wollte. Nach einem Vortrag auf einer Konferenz über Computersicherheit in Kanada informierte ihn beispielsweise ein US-Beamter, dass er die Erlaubnis zu sprechen nicht bekommen hätte, wenn das Außenministerium über den Inhalt seiner Rede aufgeklärt gewesen wäre. Cohen wurde schließlich als Vater der Computerviren bekannt – eine zweifelhafte und nicht unbedingt karrierefördernde Ehre. Auch zuvor hatte es jedoch schon Versuche mit virenähnlichen Programmen gegeben. Mitte der siebziger Jahre schrieben zwei Forscher ein selbstreplizierendes Programm, einen „Wurm“, der die Produktivität eines Netzwerkes von 100 Computern erhöhen sollte. Der komplette Wurm bestand aus mehreren Segmenten, d.h. mehreren Teilprogrammen. Diese Teilprogramme schickte der Wurm an gerade nicht benutzte Computer des Netzwerkes, wo sie abgearbeitet wurden. Die geballte Rechenkraft der Computer des Netzwerks konnte so für ein einziges Problem aufgewendet werden. Eines Tages kam der Wurm jedoch außer Kontrolle. Anscheinend war bei einem Kopiervorgang ein Fehler unterlaufen, der den ursprünglichen Code des Wurmes verändert hatte – eine Mutation war entstanden, die dem Netzwerk großen 49 50 vgl. Konr@d, Ausgabe 4/98 (Oktober/November), S.47-54 vgl. Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer 32 Schaden zufügte. Nur durch eine „Notbremse“, die den Würmern befahl, sich selbst zu löschen – in weiser Voraussicht hatten die Wissenschafter dies in den Code implementiert – gelang es, das Netzwerk von den nunmehr schädlichen Programmen zu befreien. Einer der ersten weitverbreiteten Viren wurde unter dem Namen „Brain“ bekannt. Entwickelt hatte man ihn 1986 in Pakistan. Es handelte sich dabei um einen raffinierten Boot-Virus, der beim Computerstart im Laufwerk befindliche Disketten infizierte und dabei entweder freie Cluster belegte, oder – wenn kein freier Platz mehr vorhanden war – Daten überschrieb, also löschte. Die damals gängigen Virenschutzprogramme konnten ihm nichts anhaben. Es wird geschätzt, dass der Virus eine Verbreitung von ca. einhunderttausend Kopien erreichte. Inzwischen wurden zwar längst wirkungsvolle Schutzprogramme entwickelt, doch solange das Betriebssystem MS-DOS noch in Verwendung ist, wird der Virus nicht völlig ausgerottet werden. Ob man Computerviren wirklich als Beispiel für Künstliches Leben bezeichnen kann, ist umstritten. Viren weisen eine beunruhigende Ähnlichkeit zu ihren biologischen Namensvettern auf. Auch bei diesen „echten“ Viren ist es umstritten, ob man sie dem Bereich des Lebens zuordnen kann. Computerviren zeigen evolutionäres Verhalten, obwohl die Veränderung des Erbmaterials (Programmcode) zur Zeit noch hauptsächlich durch das Zutun menschlicher Programmierer entsteht; Mutationen sind für Computerviren meist tödlich, und bisher gibt es keinen, der zu einer Art offenen Evolution fähig ist. Dies wird aber bereits für die nähere Zukunft erwartet (und befürchtet). KL – CHANCE ODER GEFAHR?51 5.3. Bei der Arbeit im jungen Forschungsgebiet des KL stellt sich eine zwingende Frage: Soll Künstliches Leben überhaupt entwickelt werden? Die Gefahr der Computerviren ist nur die erste Stufe der Bedrohung, die auf uns zukommt, wenn mit den neuen Erkenntnissen nicht verantwortungsvoll umgegangen wird. In Los Alamos wurde am 16. Juli 1945 die erste Atombombe entwickelt sowie kurz danach die Wasserstoffbombe52 - sollte nun durch die Entwicklung des Künstlichen Lebens eine vielleicht ebenso große potentielle Gefahr hier ihren Ursprung finden? Was wird beispielsweise geschehen, wenn man die KL-Techniken durch militärischen Einsatz missbraucht? 1990 wurde den Forschern von der Regierung der Vereinigten Staaten angeboten, Computerviren für militärische Zwecke zu entwickeln. Was wäre der nächste Schritt? Militärische Kampfroboter? Es klingt nach Science-fiction, doch wahrscheinlich sollte man sich schon sehr bald mit diesen Problemen auseinandersetzen, auch wenn die Forschung noch in den Kinderschuhen steckt. James Farmer war einer der ersten Wissenschafter, die sich mit diesem Problem intensiv auseinandersetzten. Er gibt zu bedenken: „Wenn selbstreplizierende Kriegsmaschinen erst einmal installiert sind, könnte eine Demontage unmöglich werden, selbst wenn wir unsere Absichten änderten und einen dementsprechenden Konsens erzielten: Sie könnten buchstäblich außer Kontrolle geraten. Ein eskalierender technologischer Krieg, einschließlich der Schaffung künstlicher Armeen, würde wahrscheinlich damit enden, dass die Beteiligten selbst zerstört würden. Und dies ermöglichte das Entstehen einer Generation von Lebensformen, die sogar noch feindlicher und zerstörerischer wären als ihre menschlichen Vorfahren.“53 51 vgl. Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer Microsoft Encarta 99 Enzyklopädie 53 Stephen Levy: KL – Künstliches Leben aus dem Computer, S. 411f 52 33 Diese Aussicht mag phantastisch klingen – aber befindet sich nicht mit Computerviren bereits eine Technologie außerhalb unserer Kontrolle, mit der jeder Student in der Lage ist, die Arbeit von Millionen von Menschen zunichte zu machen? Leben lässt sich nicht planen, geschweige denn unter Kontrolle bringen. Eines der berühmten drei Robotergesetze des Science-fiction Autors Isaac Asimov besagt, dass ein Roboter ein menschliches Wesen nicht verletzen darf. Man könnte nun Roboter mit dieser Regel programmieren – wer garantiert jedoch, dass diese Regel während der Evolutionsprozesse erhalten bleibt? Da es aus dem Blickwinkel des Roboters einen Vorteil darstellen würde, diese Regel nicht mehr beachten zu müssen, würde sich diese Mutation schnell im Genpool verbreiten, und Generationen von Robotern hätten keine Gewissensbisse mehr, Menschen Schaden zuzufügen. Demselben Gedankenspiel folgend ist es auch unmöglich, eine Notbremse, einen „Ausschaltknopf“, in die Kreaturen einzubauen. Einige Wissenschafter gehen sogar so weit, dass sie annehmen, künstliche Kreaturen könnten das Ende des gesamten biologischen Lebens bedeuten. Ihrer Meinung nach ist KL nur die nächste Stufe der natürlichen Evolution. Es kann entweder zu einem friedlichen Zusammenleben zwischen biologischem und Künstlichem Leben kommen, oder – es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen biologischem und digitalem Leben, aus der nur eine Partei als Sieger hervorgehen kann. Farmer schrieb dazu: „Nach dem Auftreten Künstlichen Lebens könnten wir die erste Art sein, die ihre eigenen Nachfolger erschafft.“54 Einmal angenommen, es käme zu einer friedlich Koexistenz: Welche Auswirkungen hätte das auf unsere Weltanschauung? „Welche Auffassung hat der Mensch von sich selbst? Heute ist er stolz auf seine Einmaligkeit. Wie würde er aber damit fertig werden, wenn er nur ein Vertreter unter anderen „intelligenten Kreaturen“ wäre? Aber auch das Leitbild ‚Gott‘ könnte auf ähnliche Weise zerstört werden wie das Idealbild ‚Mensch‘. Immerhin ist Gott einmalig, da er uns geschaffen hat. Wenn wir aber eine andere Rasse von Wesen schaffen, sind wir dann nicht auch in ganz ähnlicher Weise Götter?“55 Die Fragestellungen sind damit noch nicht am Ende. Hätten die künstlichen Lebensformen beispielsweise eine Seele? Welche Rechte würden sie fordern? Sollte man ihnen beispielsweise Bürgerrechte zusprechen? Die Fragen mögen grotesk klingen, aber sie müssen früher oder später beantwortet werden. Wir können uns der Verantwortung nicht entziehen, die nach der Schaffung neuen Lebens auf uns zukommt. Die KL-Forscher sind in einem Gewissenskonflikt. Während sie eine potentiell nutzbringende Technologie erschaffen, die die Schönheit lebender Systeme mehr als alles bisher Dagewesene vor Augen führt, legen sie möglicherweise den Grundstein für das Ende ihrer eigenen Art. Die sicherste Kontrolle, die es gibt, wäre: Einfach damit aufhören. Doch ist der Nutzen, den Menschheit aus Künstlichem Leben ziehen könnte, nicht das Risiko wert? Ein enormes Potential ruht in der Erforschung von KL, ein Potential, das weit über unsere Vorstellungskraft hinausreicht. Vielleicht liegt es in der Natur des Menschen, sein Wissen ständig zu erweitern, vielleicht hat die Evolution selbst uns diese Neugier mit auf den Weg gegeben. James Farmer sagte einmal: 54 55 Stephen Levy: KL – Künstliches Leben aus dem Computer, S. 422 NASA Conference Publication 2255 (1982); Stephen Levy: KL – Künstliches Leben aus dem Computer, S. 427 34 „... meiner Meinung nach ist die Neugierde eine unbändige Kraft, die nicht gezügelt werden kann. Ich glaube außerdem, dass Lernen um seiner selbst willen so etwas wie eine Macht ist, über die wir nicht Herr sind.“56 56 Stephen Levy: KL – Künstliches Leben aus dem Computer, S. 422 35 ANHANG QUELLEN Literatur: • Stephen Levy: KL - Künstliches Leben aus dem Computer; Droemer Knaur Verlag; 1. Auflage 1993 • Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 10/1996; Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH • Schirl, Ruttner: Über die Natur 8; 1997 E.DORNER GmbH Wien • Microsoft Encarta 99 Enzyklopädie • MegaSeller Ausgabe 1; TREND Redaktions- und Verlagsgesellschaft mbH • GameStar Ausgabe 11/1998; IDG Entertainment Verlag GmbH • Konr@d, Ausgabe 4/98 (Oktober/November) Internet: • http://www.creatures.co.uk • http://htm.com/cwr/boids.html • http://www2.brunel.ac.uk:8080/departments/AI/alife/al-loops.htm • http://www.heise.de/tp/deutsch/special/robo/6220/1.html • http://www.heise.de/tp/deutsch/special/bio/2158/1.html • http://rhein-zeitung.de/on/98/02/23/topnews/webrobo.html • http://alife.santafe.edu 36 PROTOKOLL 1998: 21.09.: Besuch der Studienbibliothek in Linz; endgültige Entscheidung für Thema KL 25.09.: Erstes Treffen mit Prof. Hans Stummer; Ausfüllung der FBA-Formulare 09.10.: Erneute Besprechung mit Prof. Stummer; allgemeine Hinweise zum Arbeitsvorgang; 11.10.: Beginn der Lektüre der gesammelten Literatur 16.10.: Abgabe eines vorläufigen Inhaltsverzeichnisses; Beginn der Niederschrift des 1. Kapitels 27.10.: Fertigstellung des 1. Kapitels 30.10.: Besprechung mit Prof. Stummer; allgemeine Hinweise und Verbesserungsvorschläge bez. des 1. Kapitels 16.11.: Informationssuche im Internet 23.11.: Beginn der Niederschrift des 2. Kapitels 30.11.: Besprechung mit Prof. Stummer; anschließend Informationssuche im Internet 10.12.: Experimente mit „Creatures“ 14.12.: Informationssuche im Internet 21.12.: Besprechung mit Prof. Stummer über 2. Kapitel sowie weitere Vorgehensweise 25.12.: Fertigstellung und Überarbeitung des 2. Kapitels 27.12.: Beginn der Niederschrift des 3. Kapitels 1999: 02.01.: Fertigstellung von Kapitel 3 03.01.: Überarbeitung von Kapitel 3 04.01.: Beginn der Niederschrift von Kapitel 4 08.01.: Fertigstellung von Kapitel 4 09.01.: Beginn der Niederschrift von Kapitel 5 12.01.: Fertigstellung von Kapitel 5 14.01.: Abgabe der vorläufigen Version der Fachbereichsarbeit bei Prof. Stummer 18.01.: Besprechung mit Prof. Stummer 19.01.: Einfügen der Bilder 22.01.: Besprechung mit Prof. Stummer; 23.01.: Überarbeitung von Kapitel 1 25.01.: Überarbeitung von Kapitel 2 und 3 28.01.: Überarbeitung von Kapitel 4 und 5 01.02.: Besprechung mit Prof. Stummer 05.02.: Einfügen des Anhangs 07.02.: Überarbeitung des Layouts 08.02.: Schreiben des Vorworts 22.02.: Letzte Besprechung mit Prof. Stummer 24.02.: Überprüfung der Arbeit hinsichtlich der neuen Rechtschreibung von der Lehrerin Maria Müller 26.02.: Benutzung des Internetzugangs eines Schulfreundes aufgrund organisatorischer Probleme beim Zugang des Realgymnasiums 27.02.: Gestaltung des Titelbildes 01.03.: Binden und Abgabe der Arbeit 37 INHALT DER DISKETTE Auf der beiliegenden Diskette befindet sich neben den von mir programmierten Versionen von Life, Vants und einem eindimensionalen Zellularautomaten auch die KLSimulation Biotopia 2, ein Freeware-Programm. Sollten die VB-Programme nicht starten, muss zuerst die Datei „vbrun300.dll“ (befindet sich im Hauptverzeichnis der Diskette) in das Verzeichnis „Windows\System“ kopiert werden. Verzeichnisstruktur: \1D-ZA 1dza.exe eindimensionaler Zellularautomat 1dza.frm Visual Basic Quellcode 1dza.mak Visual Basic Quellcode \Life Life.exe Conways Life - Simualtion Life.frm Visual Basic Quellcode Life.mak Visual Basic Quellcode \Vants Vants.exe Virtual Ants - Simulation Vants.frm Visual Basic Quellcode Vants.mak Visual Basic Quellcode back1.bmp Umgebungsgraphik (editierbar) \Biotop !biotop2.exe KL-Simulation Biotopia 2 Bio1.cgf Programmdatei Bio2.cgf Programmdatei Bio3.cgf Programmdatei Biotopia.doc Hintergrundinformationen Biotopia.pal Programmdatei Cells.bio Programmdatei Envir.bio Programmdatei 38