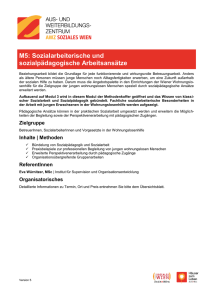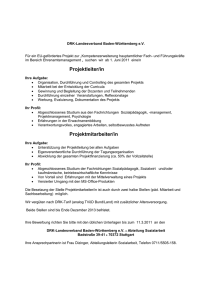Eine diversitätsbewusste und subjektorientierte Sozialpädagogik:
Werbung

Auf dem langen Weg zu einer diversitätsbewussten Sozialpädagogik 1 (Rudolf Leiprecht) 1. Einleitung Im folgenden Beitrag möchte ich den langen Weg zu einer diversitätsbewussten Sozialpädagogik skizzieren. Dabei versuche ich, die Notwendigkeit dieses Weges zu begründen und auf einige weit verbreitete Fallstricke und Missverständnisse hinzuweisen. Obwohl ich hier eine diversitätsbewusste Perspektive einnehme, ist bei den Beschreibungen und Argumentationen deutlich, dass ein wichtiger Ausgangspunkt meine eigene Geschichte als Sozialpädagoge und Interkultureller Pädagoge darstellt, wobei ich die Rassismusforschung und Rassismuskritik stets als unverzichtbaren Bestandteil dieser (Teil-) Disziplinen der Erziehungs- und Bildungswissenschaften betrachtet habe. 2. Zum spezifischen Begründungsdiskurs von Diversity/Diversität in den Erziehungsund Bildungswissenschaften Wissenschaftliche Begriffe stellen theorie- und forschungsbezogene Verdichtungen dar, mit deren Hilfe komplexe Sachverhalte aufgeschlüsselt werden sollen. Sie funktionieren im Wissenschaftsdiskurs häufig wie Metaphern, die eine Signalfunktion haben und auf zentrale Merkmale aufmerksam machen. Allerdings können Begriffe gewissermaßen untreu gegenüber denjenigen werden, die sie mit spezifischen Begründungen formuliert haben. Sie können eine Eigendynamik entfalten, in deren Verlauf sich die zentralen Begriffsinhalte von den Absichten und Motiven ihrer Autorinnen und Autoren entfernen. Wir beobachten oft, dass Begriffe abgelehnt und verworfen, aber eben auch aufgegriffen, in bestimmter Weise besetzt, ja umbesetzt und in ihrer Aussagerichtung umformuliert werden. Meist finden dann Deutungskämpfe um diese Besetzungen und Lesarten statt. Solche Deutungskämpfe sind in der Wissenschaft durchaus sinnvoll, wenn sie mit wissenschaftlichen Begründungen und Argumentationen geführt werden, allerdings – und wir dürfen hier nicht naiv sein – geht es auch im Wissenschaftsbereich leider nicht nur um bloße Erkenntnis, sondern oft eben auch um egoistischen Narzissmus, einseitigen Machtgewinn, politischen Einfluss und um partikulare Gruppeninteressen, die als angebliche Allgemeininteressen ausgegeben werden. Gleichzeitig – und dies ist für Erziehungs- und Bildungswissenschaften von besonderer Relevanz – kommt es nicht nur im Wissenschaftsbereich, sondern auch im Alltag zu unter1 Eine stark gekürzte Version dieses Beitrages ist in der Zeitschrift Neue Praxis erschienen (vgl. Leiprecht 2008). Gegenüber dem dortigen Text sind die Abschnitte 1, 2, 5, 6 und 8 völlig neu verfasst. Zum Gebrauch des Begriffs Sozialpädagogik vgl. die Fußnote 1 im Beitrag von Heike Fleßner im vorliegenden Band. 1 schiedlichen Lesarten, Interpretationen und Assoziationen, wobei Wissenschaftsdiskurs und Alltagsdiskurs durchaus miteinander in Verbindung stehen. 2 Aus dem Begriff kann hier ein bloßes Wort werden, das nicht nur mit einer spezifischen begriffsbezogenen Begründung und Bedeutung benutzt wird, sondern eine ganze Bandbreite von weiteren Begründungen und Bedeutungen transportiert. In unserem Gegenstandsbereich bringt dies einige Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel dazu, in Fortbildungskontexten das Wort Kultur zu vermeiden und statt dessen das Wort Lebenswelt zu benutzen: Kultur führt durch seine parallele Verwendung in den politischen und alltäglichen Diskursen in der Tat sehr schnell zu Lesarten, die einheitliche und in sich geschlossene Nationalkulturen assoziieren, und Lebenswelt scheint hier zunächst unverfänglicher und viel deutlicher auf individuelle und möglicherweise heterogene Kontexte zu verweisen. 3 Mit dem expliziten Gebrauch des Begriffs Diversity/Diversität sind die Fachdiskurse der Erziehungs- und Bildungswissenschaften jedenfalls spät dran, wobei die Entwicklung in Deutschland noch zusätzlich verzögert erfolgt. 4 Es geht hier also nicht so sehr um eine exklusive Begründung, die gleichsam zum ersten Mal in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften stattfindet, sondern eher um eine Umbesetzung und Neuverwendung, die sich auch mit den Begründungs- und Bedeutungsmustern in anderen Disziplinen auseinandersetzen muss. So findet sich im Wissenschaftsdiskurs von Biologie und Umweltwissenschaften bereits seit mehr als dreißig Jahren der Begriff Biodiversität. Damit ist die biologische Vielfalt der Arten auf der Erde, die Vielfalt innerhalb der Arten sowie die Vielfalt von Ökosystemen gemeint (vgl. Wilson 1988). Diversität an sich wird in diesem Kontext als etwas Positives gesehen: Genetische Vielfalt innerhalb von Arten gilt als eine Voraussetzung, sich verändernden Umweltbedingungen anpassen zu können, und mit dem Begriff Biodiversität wird die Ausrottung von Arten und ihrer Varietäten kritisiert, wie sie durch die rücksichtslosen Eingriffe von Menschen in die Umwelt und ihre Folgen für Flora und Fauna hervorgerufen werden. Im Kontext von Erziehungs- und Bildungswissenschaften muss jedoch deutlich sein, dass es hier bei Diversität um Prozesse geht, die auf spezifisch Menschliches verweisen und nicht auf Biologisches reduziert werden können, d.h. es geht um Einteilungen innerhalb der 2 Mit dem Forschungskonzept zu Sozialen Repräsentationen von Serge Moscovici lassen sich solche Verbindungen gut untersuchen (vgl. Moscovici 1995). 3 Wenn dies auch, wenn wir uns auf der begrifflichen Ebene bewegen und uns die sozialwissenschaftliche Begriffsgeschichte näher anschauen, ein Missverständnis ist. So formuliert Georg Auernheimer als Ergebnis einer vergleichenden Untersuchung der Begriffe ‚Kultur‘ und ‚Lebenswelt‘: „Lebenswelt hat alle Merkmale eines kritisierten Kulturverständnisses: unhistorisch, statisch, nicht dynamisch, hermetisch geschlossen, den Beteiligten nicht reflexiv verfügbar und nicht verhandelbar.“ (Auernheimer 2002, S. 96) 4 Wichtige Publikationen stellen für den deutschsprachigen Fachdiskurs der Erziehungs- und Bildungswissenschaften zum Beispiel die Arbeiten von Annedore Prengel (1993) und Helma Lutz/Norbert Wenning (2001) und Ulrike Hormel/Albert Scherr (2004) dar. 2 Menschenwelt, die im Rahmen historischer und gesellschaftlicher Prozesse von Menschen gemacht und mit bestimmten sozialen Bedeutungen versehen wurden. Dies bedeutet auch, dass die Thematisierung von Diversität nicht per se darauf zielt, Diversität einen positiven Wert beizumessen oder Diversität zu erhalten. Diversität muss in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften vielmehr thematisiert werden, a) weil zu beobachten ist, dass entsprechende ‚Einteilungen‘ mit Zuschreibungs- und Bewertungsprozessen und mit Festlegungen verbunden sind, die soziale Ungleichheit und Benachteiligung unterstützen und rechtfertigen; b) weil eine Ignoranz gegenüber den vorfindbaren ‚Einteilungen‘ keine Möglichkeit eröffnet, sie in kritischer Perspektive zu thematisieren und diesbezüglich Veränderungsprozesse einzuleiten; c) und weil ein solche Ignoranz auch bedeuten würde, Macht, Dominanz und Privilegierung auf der Seiten derjenigen, die sich eine diesbezügliche Ignoranz am Ehesten leisten können, da sie sich hinsichtlich spezifischer ‚Einteilungen‘ in einer relativ privilegierten Position befinden, aus der Wahrnehmung auszuklammern. Doch nicht nur im Verhältnis zum Fachdiskurs in Biologie und Umweltwissenschaft, sondern auch in Bezug auf den Fachdiskurs im Bereich der Wirtschafts- und Betriebswissenschaften sind die Erziehungs- und Bildungswissenschaften mit einem eigenständigen Begriff von Diversität spät dran. Auch dort hat der Begriff Diversität/Diversity bereits seit vielen Jahren Einzug gehalten, meist in der Kombination mit dem Begriffsteil ‚Managing‘. Es ist für den hier interessierenden Gegenstandsbereich wichtig, sich den zentralen Fachdiskurs genau anzuschauen, dies auch deshalb, weil sich viele Pädagoginnen und Pädagogen, die DiversityPrinzipien aufgreifen, auf Ansätze aus dem Bereich von Betriebswirtschaft und Wirtschaftsunternehmen beziehen (so etwa Gather Thurler 2006, 5; Sielert 2006, 7). Dies ist nicht unproblematisch. Deutlich muss sein, dass im Wirtschaftsbereich und im Bereich von Erziehungsund Bildungswissenschaften Ansätze des Managing Diversity bei aller Ähnlichkeit doch auf unterschiedlichen Grundlagen aufbauen und mit unterschiedlichen Logiken und Handlungsvoraussetzungen zu tun haben. Im Wirtschaftsbereich steht der so genannte Business Case im Vordergrund: Managing Diversity muss zur Förderung von Geschäftsinteressen bzw. zur Gewinnmaximierung beitragen, darf diese zumindest nicht behindern. Bezeichnend ist, dass dabei ‚Soziale Klasse‘ oder ‚Soziale Schicht‘ bei Managing Diversity im wirtschafts- und betriebswissenschaftlichen Fachdiskurs bzw. auf der Ebene von an Gewinn orientierten nichtöffentlichen Unternehmen in aller Regel nicht thematisiert werden. 5 Zu deutlich wird mit dem Hinweis auf solche ‚Einteilungen‘ die im Wirtschaftssystem übliche Hierarchisierung und Differenzierung nach Bildung, Einkommen und Status innerhalb eines Unternehmens thematisiert. Die in der Logik des Wirtschaftens in kapitalistischen Gesellschaften durchaus notwendige Orientierung am Business Case – so machen zum Beispiel die im Bereich von Busi5 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Scherr im vorliegenden Band, dort Abschnitt 2. 3 ness Management und Industrial Relations in London und Warwick arbeiteten Wirtschaftswissenschaftlerinnen Gill Kirton und Anne-marie Greene deutlich – führt zudem oft zu einem Verharren am Status Quo gegebener Zuschreibungsverhältnisse: Das Personal wird nach den Bedürfnissen der Organisation modelliert, wobei die Bedürfnisse des Personals nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen – es sei denn, sie sind mit dem Business Case vereinbar (vgl. Kirton/Greene 2000/2005II, 239). Dabei kommt es im Rahmen einer Betriebspolitik, die Managing Diversity mit der Frage nach den Human Ressources im Unternehmen verbindet, nicht selten zur Unterstützung von Prozessen der Essentialisierung und Stereotypisierung, etwa durch das Reden über gruppenbezogene Potentiale (Stichwort ‚weibliches Arbeitsvermögen‘), die für das Unternehmen nutzbar gemacht werden sollen (vgl. ebd., 241). Anders als bei der Führung eines Wirtschaftsunternehmens sollten in Organisationen der institutionalisierten Erziehung und Bildung bei Managing Diversity Ziele wie Chancengleichheit und Soziale Gerechtigkeit im Vordergrund. Dies muss auch in den Wissenschaftsdisziplinen, die sich auf diese Praxisfelder beziehen, reflektiert werden. Das Projekt der Bildungsgerechtigkeit ist zunächst eine ethische Frage von gesamtgesellschaftlichem Format, wenngleich es sich durchaus mit Überlegungen nach mittel- oder längerfristigen sozialen und ökonomischen Folgekosten verbinden kann: Es steht zunächst für sich selbst, einerlei, ob es direkte oder vermittelte Gewinne für eine Organisation verspricht, und es muss notwendig ein nachhaltiges und langfristiges Projekt sein, das nicht durch eine negative Gewinnentwicklung oder durch Kursverluste an den Börsen gestoppt werden darf (vgl. Kirton/Greene 2000/2005II; ähnlich Hubertus Schröer 2006, 60). Managing Diversity in Organisationen von institutionalisierter Erziehung und Bildung sollte zudem eng mit Diversity Education (vgl. Appelbaum 2002) verbunden sein, d.h. es geht um ein inhaltliches Prinzip in der professionellen Praxis, es geht um eine bestimmte – auf Wissenschaft bezogene – Theorie und Praxis von Pädagogik (vgl. Hormel/Scherr 2004, 203ff.). 6 Dies gilt selbstverständlich auch für die Sozialpädagogik und Sozialarbeit, der ich mich im Folgenden zuwenden möchte. 3. Geschlecht, Ethnizität und Klasse im Fachdiskurs von Sozialpädagogik und Sozialarbeit Ein zentrales Segment von Sozialarbeit/Sozialpädagogik betrifft „die Unterstützung von psychosozialem Gleichgewicht, Handlungsfähigkeit und Bewältigungskompetenz in Situationen, die durch prekäre Verhältnisse, erhöhte Risikolagen und kritische Lebensereignisse gekennzeichnet sind“ (Leiprecht 2009a, 212). Da solche Situationen häufig mit sozialen Ungleichheiten, Benachteiligungen, Diskriminierungen und Ausgrenzungs- und Zuschreibungsmustern 6 Allerdings ohne damit eine neue Teildisziplin innerhalb der Erziehungswissenschaften begründen zu wollen (siehe hierzu ausführlicher unten, 5. und 6.). 4 verbunden sind, die entlang spezifischer Differenzlinien wie Geschlecht, Ethnizität und Klasse verlaufen, gehört die kritische Reflektion solcher Differenzlinien und ihrer Wirkungen eigentlich zu den Kernaufgaben von Sozialarbeit/Sozialpädagogik. 7 Zudem lässt sich in der Entwicklungsgeschichte dieser Disziplin eine Grundlinie ausmachen, die Lothar Böhnisch, Wolfgang Schröer und Hans Thiersch als „Hilfe zur Lebensbewältigung im Horizont sozialer Gerechtigkeit“ beschreiben (Böhnisch/Schröer/Thiersch 2005, 15). Vor diesem Hintergrund sollte man meinen, hier mit der Forderung und Betonung eines bewussten Umgangs mit Differenzlinien wie Geschlecht, Ethnizität und Klasse offene Türe einzurennen und einen Gegenstandsbereich zu benennen, der in der Sozialpädagogik/Sozialarbeit wenn denn nicht schon immer, so doch zumindest in den letzten 30 Jahren eine zentrale Rolle gespielt hat. Leider ist dies jedoch nicht der Fall. Schauen wir uns die Thematisierung/Nicht-Thematisierung der einzelnen Differenzlinien genauer an. 3.1 Soziale Klasse/Migration/Interkulturalität Nur eine der oben genannten Differenzlinien befand sich – um materielle Armut und soziale Not herum gruppiert – gewissermaßen von Beginn an im Kern der Entwicklungsgeschichte von Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Es handelt sich um soziale Schichtungen wie den Stand (genauer: die niedrigen Stände) in agrarischen Ständegesellschaften bzw. später die soziale Klasse oder soziale Schicht in industriellen Klassengesellschaften (genauer: die Arbeiterklasse, auch das Proletariat/das Lumpenproletariat; in anderen Theoriediskursen: die Unterschicht) (vgl. hierzu auch Lamp 2007, 11ff.). In der Tat waren Begriffe wie Klasse oder Schicht zum Beispiel in den 1960er und 1970er Jahren wichtige Begriffe in den Debatten der Sozialpädagogik/Sozialarbeit, und dies nicht nur bei eher marxistischen Ansätzen wie etwa von Walter Hollstein und Marianne Meinhold, die 1976 eine Funktionsbestimmung von Sozialarbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen versuchten (vgl. Hollstein/Meinhold 1976). Auch Ansätze, die eher dem Symbolischen Interaktionismus nahe standen, kamen um Begriffe wie Klasse oder Schicht nicht herum und warnten beispielsweise vor der „Mittelschichtdominanz“ in der sozialpädagogischen Beratung und betonten, dass der Professionelle stets seine Schichtzugehörigkeit im Umgang mit den Adressaten zu reflektieren hat, um die eigenen „meist mittelständischen moralischen Vorstellungen“ – so etwa Hans Thiersch 1973 – nicht auf die Adressaten zu übertragen (Thiersch 1977, 16). Interessant ist nun, dass im Kontext dieser sozialen Schichtungen eine bestimmte Gegebenheit aus der Wahrnehmung ausgeklammert wurde. Die frühe Entwicklungsgeschichte der Sozialpädagogik/Sozialarbeit zeigt, dass sie zu Beginn – also im 15. und 16. Jahrhundert in der Vorform der Armenfürsorge – wesentlich davon bestimmt war, Regulierungen zu finden, „durch die ‚fremde‘ Arme unterschiedlich behandelt werden konnten“ (Müller 1997, 137). 7 Vgl. hier auch den Text von Albert Scherr im vorliegenden Band. 5 Vielfältige Wanderungsprozesse – vom Land in die Stadt, von ärmeren Gebieten in reichere Regionen – und – in den Worten von Burkhard Müller – „aus allen Arten von unterprivilegierten Rändern dieser Welt in die Metropolen, in denen das gute Leben erwartet wird, oder wenigstens ein klein wenig besseres Leben - das hat soziale Arbeit entstehen lassen als den kombinierten Versuch, ‚fremde‘ Arme draußen zu halten und, wo dies nicht ging, sie wenigstens als ‚eigene‘ Arme unter Kontrolle zu kriegen“ (ebd.). Eine kritische Reflexion dieser Entwicklungsgeschichte müsste – so Burkhard Müller – dazu führen auch „die gegenwärtige Praxis und die Theorie sozialer Arbeit neu zu lesen“ und migrationsbezogenen und interkulturellen Überlegungen einen wichtigen Platz einzuräumen (ebd., 133). Wer sich aber die Fachdiskurse der letzten 30 Jahre anschaut, muss konstatieren, dass Interkulturalität und Migration „in der deutschen sozialpädagogischen Diskussion nur als ein Sonderproblem behandelt worden“ sind (Böhnisch/Schröer/Thiersch 2005, 210). 3.2 Geschlechterverhältnisse Ähnliches lässt sich über weite Strecken auch für die Differenzlinie Geschlecht sagen: Erst in den 1990 Jahren, und dann auch nur teilweise, erreichte die Frauenforschung die Sozialpädagogik (vgl. Böhnisch/Schröer/Thiersch 2005, 52), obwohl von der Frauenbewegung um die Jahrhundertwende und in der Weimarer Republik „wohl am Entschiedensten um die sozialpädagogischen Aufgaben angesichts der (damaligen) gesellschaftlichen Umgestaltung gestritten wurde“ (ebd., 44), einer Transformation, die Gertrud Bäumer damals mit der Formel „Von der Caritas zur Sozialpolitik“ auf den Begriff brachte – also vom mildtätigen Geben und der Wohltätigkeit hin zu den rechtlich verbürgten Basissicherheiten in einem Sozialstaat. Gleichzeitig waren es Frauen wie Maria Baum und Helene Weber, die in den 1920er Jahren darauf hinwiesen, dass die „Fürsorgerin (…) gleichzeitig rational-methodisch arbeiten und den Klienten mit ‚Wärme und Liebe‘ entgegen treten (sollte), damit sie nicht als ‚Fall‘ im behördlichen Apparat nur ‚bearbeitet‘ würden“ (Böhnisch/Schröer/Thiersch 2005, 48); eine sehr moderne und immer noch hoch aktuelle Frage. Zudem machten sie auf den unbefriedigenden Zustand aufmerksam, dass die Struktur der Arbeit geschlechtstypisch geteilt sei: Während die Frauen dem „praktische(n) Außendienst“ nachgingen, wurde „den Männern der administrative, letztentscheidende Innendienst zugewiesen“ (ebd.). In den 1960er und 1970er Jahren bekam die Differenzlinie Geschlecht durch die neue Frauenbewegung zwar ein größeres Gewicht in den Debatten der Sozialpädagogik/Sozialarbeit, wobei sich die bewegten Frauen gegen die Dominanz der Klassenfrage, die von vielen zum Hauptwiderspruch erhoben worden war, durchsetzen mussten, um sich mit den als Nebenwiderspruch abqualifizierten Geschlechterverhältnissen im Fachdiskurs Stimme und Gehör zu verschaffen. Der Erfolg ist zwar beachtlich (vgl. hierzu z.B. bereits 1997 Friebertshäuser et al.), jedoch keineswegs so umfassend, wie er sein sollte: Angesichts eines dominierenden Leitbildes 6 geschlechtsneutraler Professionalität sprechen Lothar Böhnisch, Wolfgang Schröer und Hans Thiersch heute denn auch von einem eher „verdeckte(n) Gender-Curriculum unterhalb einer geschlechterneutralisierenden Fachkultur“ (Böhnisch/Schröer/Thiersch 2005, 52). Eine geschlechterbewusste Perspektive sieht jedenfalls anders aus. 8 3.3 Wandlungen im Fachdiskurs Dennoch hat sich unbestreitbar etwas bewegt im Fachdiskurs, und um dies anschaulich zu machen, möchte ich einen kleinen Gang durch einige ausgewählte Werke der Fachliteratur in der Sozialpädagogik/Sozialarbeit machen. Ein Beispiel für den Wandel in neuerer Zeit, von Mitte der 1980er Jahre bis kurz nach der Jahrtausendwende, bietet das Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik, das zuerst 1984 von Hanns Eyferth, Hans-Uwe Otto und Hans Thiersch herausgegeben wurde und dann 2001 in einer völlig neuen Überarbeitung erschienen ist, jetzt herausgegeben von den beiden letztgenannten. Was hat sich über 17 Jahre hinweg in diesem Standardwerk der Sozialarbeit/Sozialpädagogik verändert? Zunächst fällt auf, dass das Nachschlagewerk noch umfangreicher geworden (von 1.322 Seiten auf 2.044 Seiten), die Schrift ist noch kleiner und das Papier noch dünner geraten und es finden sich viel mehr Stichwortartikel (von 104 auf 189). Aufschlussreich ist es, sich in vergleichender Perspektive die Stichwortartikel anzuschauen, die im Kontext einer diversitätsbewussten Sozialpädagogik/Sozialarbeit interessieren. Dazu habe ich eine Auswahl der Stichwortartikel getroffen, die a) die verschiedenen Positionen im Lebenslauf charakterisieren, die sich b) im weitesten Sinne auf im internationalen Fachdiskurs bedeutsame Differenzlinien wie race, class und gender beziehen und die c) auf einen Blick über Ländergrenzen aufmerksam machen. Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik 1984 Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik 2001 Kindheit Kinder Kinderpolitik Kinderrechte Erwachsene Jugend: Strukturwandel und Problemlagen 8 Jugend Neue Jugendkulturen Vgl. hierzu ausführlich den Beitrag von Heike Fleßner im vorliegenden Band. 7 Altenarbeit Alter Altenarbeit Altenpolitik Alter, alte Menschen Gewalt und Alter Selbsthilfe im Alter Generationen Lebenslauf Biographie a) Stichwortartikel zu verschiedenen Positionen im Lebenslauf Übersicht 1: Im Vergleich der Ausgaben wird zunächst deutlich, dass sich bei den lebenslaufbezogenen Stichwortartikeln vor allem der Bereich „Altenarbeit“ und „Alter“ deutlich ausgeweitet hat und mit „Generationen“, „Lebenslauf“ und „Biographie“ drei neue Beiträge hinzu gekommen sind, die in übergreifender Weise Positionen und Prozesse von Kindheit über Jugend und Erwachsenalter bis hin zum Alter zu beschreiben suchen. Nun haben die neuen Stichworte zu Alter zweifellos zu tun mit der größeren Bedeutung von sozialpädagogischer Altenhilfe in einer Gesellschaft mit einem deutlich höheren Anteil an alten Menschen wie früher. Und selbstverständlich charakterisieren Kinder- und Jugendhilfe klassische Arbeitsfelder von Sozialpädagogik/Sozialarbeit, weshalb hierzu auch nach wie vor ein entsprechender Stichwortartikel zu finden ist. Dennoch kann man davon ausgehen, dass die Vielzahl der neuen Stichworte im Handbuch von 2001 zugleich auch eine höhere Aufmerksamkeit im Fachdiskurs für lebenslaufbezogene Differenzlinien (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alte Menschen) signalisiert; eine Aufmerksamkeit, wie sie im Fachdiskurs etwa auch durch Ansätze wie die „Sozialpädagogik der Lebensalter“ (Böhnisch 2001) zum Ausdruck kommt. b) Stichwortartikel in Bezug auf Differenzlinien wie race, class und gender Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik 1984 Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik 2001 Klasse und Schicht Arbeiterbewegung und Arbeitsrecht Arbeiterjugend Sozialistische Erziehung Arbeits-, Schicht- und Klassengesellschaft Arbeiterbewegung und Soziale Arbeit Frauen Geschlechterforschung Geschlechterpolitik: Feminismus Gewalt gegen Kinder, Frauen und in Familien 8 Soziale Arbeit als Frauenberuf Mädchenarbeit Jungenarbeit Männer Ausländer Ausländerrecht Interkulturelle Arbeit Migration Rechtsextremismus/Rechtsradikalismus Behinderung Behinderung Übersicht 2: 9 Bei den im weitesten Sinne auf race, class, gender bezogenen Stichwortartikeln fällt auf, dass in der neuen Ausgabe Klasse etwas weniger umfangreich vertreten ist, dafür aber vor allem Geschlecht eine erhebliche Ausweitung erfahren hat. Zudem zeigt sich, dass die Stichworte – entsprechend der Entwicklung der Fachdiskurse – moderner (oder sollte man formulieren: postmoderner) geworden sind, dabei aber zugleich einen Paradigmenwechsel vollzogen haben: eben von „Frauen“ zu „Geschlecht“ (Stichworte „Geschlechterforschung“ und „Geschlechterpolitik: Feminismus“), wobei dann neben „Mädchenarbeit“ auch „Jungenarbeit“ und „Männer“ jetzt mit eigenen Stichworten genannt werden. So richtig (post-) modern geht es freilich noch nicht zu, denn es fehlen zum Beispiel Stichwortartikel zu Transgender, zu sexueller Orientierung und Heteronormativität. Eine vergleichbare Erneuerung findet statt, wenn das Stichwort „Ausländer“ durch Stichworte wie „Interkulturelle Arbeit“ und „Migration“ ersetzt wird. Mit Interkulturalität – so jedenfalls der Anspruch – sollen mehrere Seiten – also auch die Mehrheitsgesellschaft – in den Blick genommen werden: Interkulturalität geht alle an, eine Beschränkung auf Minderheiten gilt als unzureichend. Anders als bei Geschlecht fällt hier jedoch die Ausweitung in der aktuelleren Handbuchausgabe deutlich geringer aus, und noch stärker als bei Geschlecht zeigt sich, dass deutliche Lücken festzustellen sind: So fehlen zum Beispiel Beiträge zu Rassismus, Alltagsrassismus, Rassismuserfahrungen oder antirassistischer Arbeit, 9 und auch innerhalb der Stichwortartikel selbst tauchen diese Begriffe nur vereinzelt und Begriffe wie Transmigration oder Transnationalismus 10 überhaupt (noch) nicht auf. Das Stichwort „Behinderung“ ist auch in der neuen Ausgabe einmal vorhanden, jedoch gewinnt man den Eindruck, dass der Diskurs zu den Verbindungs- und Trennungslinien zwischen Sozialpädagogik/Sozialarbeit und Sonderpädagogik/Rehabilitationspädagogik noch nicht sehr viel weiter gekommen ist. So sollten zum Beispiel dominierende Vorstellungen und Diskurse zu Gesundheit und Körperlichkeit und Abweichungen von solchen Vorstellungen und Diskursen und deren jeweilige Bedeutung für die Praxis von Lebensführung zu wichtigen Themen auch der Sozialpädagogik/Sozialarbeit gehören. 9 Der Begriff Rassismus findet sich erstaunlicherweise nicht einmal innerhalb des Stichwortartikels zu „Rechtsextremismus/Rechtsradikalismus“ (geschrieben von Roland Merten), wohl aber – wenn auch eher am Rande – innerhalb der Stichwortartikel zu „Migration“ (geschrieben von Franz Hamburger) und „Interkulturelle Arbeit“ (geschrieben von Wolfgang Nieke). 10 Vgl. zu Transmigration/Transnationalismus/Transnationalität zum Beispiel Otto/Schrödter (2007) oder Homfeldt/Schröer/Schweppe (2008). 10 c) Stichwortartikel, die auf einen Blick über Ländergrenzen aufmerksam machen Übersicht 3: Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik 1984 Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik 2001 DDR: Jugendkriminalität und Jugendhilfe Sowjetunion: Soziale Probleme und Sozialpolitik DDR: Gesundheits-, Sozialwesen, Jugendhilfe Soziale Arbeit in Osteuropa Dritte Welt: Erziehungsprobleme Soziale Arbeit in Asien Soziale Arbeit in Lateinamerika Soziale Arbeit in den USA Soziale Arbeit: Internationale Schaut man auf die Auswahl der Stichwortartikel, die explizit auf internationale Zusammenhänge verweisen, so zeigt sich wiederum, dass eine sehr deutliche Ausweitung stattgefunden hat, wobei für das Stichwort „DDR“ sich eine Wandlung von einem Blick auf „verschiedene Gesellschaftssysteme und verschiedene Länder“ (so noch der Hinweis aus der Vorbemerkung der Ausgabe von 1984, XI) zu einem historischen Blick vollzieht und das Stichwort „Sowjetunion“ durch „Soziale Arbeit in Osteuropa“ ersetzt wurde. Es fällt allerdings auf, dass sich 1984 beim Stichwort „Dritte Welt“ immerhin noch ein kritischer Bezug auf Kolonialismus findet, der in den neueren internationalen Stichwortartikeln dann völlig fehlt, genauso wie zum Beispiel ein Hinweis auf Soziale Arbeit in Afrika. Auffällig ist, dass auch einige neue Stichwortartikel zu verzeichnen sind, die in unserem Zusammenhang von Interesse sein könnten: So finden sich zum Beispiel zwei Artikel, die einen selbstkritischen Blick auf Soziale Arbeit im Nationalsozialismus werfen (vgl. Sünker 2001), ein Artikel zu Menschen-, Bürger- und Grundrechten (vgl. Narr 2001) und zwei Artikel zu „Religiösität“ (vgl. Braz 2001) und „Religiöse Erziehung“ (vgl. Schweitzer 2001), wobei der erste allerdings völlig ohne Hinweise auf den Islam in Deutschland auskommt, während der zweite immerhin mit zwei (wenn auch sehr knappen) Bemerkungen auf muslimische Jugendliche aufmerksam macht (vgl. ebd., 1493/1496). 11 Der Blick auf die Entwicklung des Handbuchs scheint die Entwicklung des Fachdiskurses wiederzuspiegeln. Es gibt eine gewisse Kontinuität, auf die die Herausgeber 2001 selbst hinweisen, in dem sie in der Einleitung darauf aufmerksam machen, dass „sich die Grundfragen 11 „Eine angemessene friedliche Wahrnehmung und Achtung z.B. muslimischer Kinder in Deutschland muss auch deren Religion oder Glaubenseinstellungen einschließen.“ (Schweitzer 2001, 1493) 11 Sozialer Arbeit weiterhin in der aktuellen Auseinandersetzung mit Armut und Abweichung, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität mit Benachteiligten“ entwickeln (Otto/Thiersch 2001, V). Und gleichzeitig sind Veränderungen festzustellen: Eine zunehmende Internationalität ist zu beobachten, und die Thematisierung von Geschlechterverhältnissen, Migration und Interkulturalität scheint – nimmt man die Entwicklung des Handbuchs als Indiz – in der bundesdeutschen Fachdebatte immerhin angekommen zu sein. Man könnte also, wenn man von diesem Ungleichgewicht und den festgestellten Lücken absieht, einigermaßen zufrieden sein. Dieser halbwegs positive Eindruck verändert sich allerdings, wenn man davon ausgeht, dass die Berücksichtigung verschiedener Differenzlinien im Fachdiskurs jetzt auch wirklich dazu führt, dass die Auseinandersetzung damit als eine Querschnittsaufgabe in jedem Teilgebiet der Disziplin geführt wird. Dies ist keineswegs der Fall, und dies wird deutlich, wenn man zum Beispiel nach diesen Themen in Einführungswerken oder Lehrbüchern zur Sozialpädagogik/Sozialarbeit sucht: Man findet in aller Regel weder die Differenzlinien in der Form von besonderen Einzelthemen noch ihre Verankerung als Querschnittsaufgaben. So lässt beispielsweise die systemtheoretische Einleitung von Winfried Noack „Sozialpädagogik – Ein Lehrbuch“ (2001) jeden systematischen Bezug auf Geschlechterverhältnisse, Interkulturalität, Migration, Rassismus etc. vermissen; ebenso wie beispielsweise die Einführung von Johannes Schilling „Soziale Arbeit – Geschichte – Theorie – Profession“, die 2005 in einer zweiten Auflage erschienen ist. Auch beim einführenden Band von Michael Erler – als überarbeitete Fassung 2005 zum fünften Mal herausgegeben – stellt sich dies kaum anders dar. Es findet sich leider – wie in vielen anderen Einführungstexten auch – keine explizite Auseinandersetzung mit diesen Themen, und die Verankerung dieser Themen in Form von Querschnittsaufgaben, die bei jedem Teilthema von Sozialpädagogik/Sozialarbeit mit zu berücksichtigen wären, ist nicht in Sicht. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang übrigens die 2003 erschienene „Einführung in die Sozialpädagogik“ von Franz Hamburger, der hier einen anderen Weg gewählt hat. Über viele Seiten hinweg werden die Leser/innen über wichtige Fragen und Themen der Sozialpädagogik unterrichtet, eine systematische Berücksichtigung von Geschlechterverhältnissen, Interkulturalität, Rassismus oder Migration fehlt jedoch, wobei Hamburger – allerdings erst nach 207 Seiten und am Ende des Buches – unter der Überschrift „Abrundung und Ausblick“ (Hamburger 2003, 207) darauf aufmerksam macht, dass er „Geschlechterverhältnisse (…) nur punktuell angesprochen“ hat (ebd., 208) und „‚Migration‘ (…) bisher keine explizite Rolle spielte“ (ebd., 209). Gleichzeitig betont er die große Bedeutung des Projekts einer „geschlechterbewussten Sozialpädagogik“ (ebd., 208) und beschreibt „Migration“ als „eine der Mütter der Sozialen Arbeit“ (ebd., 209). Immerhin weist er auf beide Differenzlinien und ihre Relevanz ausdrücklich hin und gibt zusätzliche Leseempfehlungen. Reicht dies aus? Oder erweckt die Anordnung nicht doch eher den Eindruck, als ob ‚Geschlecht‘ und ‚Migration‘ in Form eines zusätzlichen Sonderthemas behandelt werden könnten? 12 Anders vorgegangen wird im einführenden Handbuch „Grundriss Soziale Arbeit“, das zuerst 2002 und dann 2005 in einer korrigierten zweiten Auflage von Werner Thole herausgegeben wurde. 12 Unter der Kapitelüberschrift „Arbeitsfelder und AdressatInnen Sozialer Arbeit“ finden sich auch die bisher thematisierten Differenzlinien. Übersicht 4: Thole, Werner (Hrsg.) (2002/2005II): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Arbeitsfelder und AdressatInnen Sozialer Arbeit (S. 8f): Karin Bock Die Kinder- und Jugendhilfe Hans-Günther Homfeldt Soziale Arbeit im Gesundheitswesen und in der Gesundheitsförderung Cornelia Schweppe Soziale Altenarbeit Timm Kunstreich/Michael Lindenberg Die Tantalus-Situation – Soziale Arbeit mit Ausgegrenzten Margrit Brückner Soziale Arbeit mit Frauen und Mädchen: Auf der Suche nach neuen Wegen Albert Scherr „Männer“ als Adressatengruppe und Berufsgruppe in der Sozialen Arbeit Friedhelm Vahsen/Dursun Tan Interkulturelle Pädagogik und Soziale Arbeit Der Herausgeber Werner Thole begründet die Hinzunahme von Artikeln zu geschlechtsbewussten und interkulturellen Ansätzen in das Einführungswerk „Grundriss Soziale Arbeit“ folgendermaßen: „Damit wird der Tatsache entsprochen, dass in den letzten anderthalb Jahrzehnten adressatInnenbezogene Angebote an Bedeutung gewonnen haben und sich die Soziale Arbeit für neue Problemkonstellationen sensibilisiert hat.“ (Thole 2005, 24) 12 Wenig zufrieden stellt allerdings die Beobachtung, dass bei dem sehr gut recherchierten Artikel zum „Personal der Sozialen Arbeit“ (Closs/Züchner 2005, 711ff.) zwar bemerkt wird, dass Soziale Arbeit früher wie heute ein Feld ist, „in dem sich überwiegend Frauen beruflich engagieren“ (ebd., 723), jedoch sich den Autoren nicht einmal die Frage zu stellen scheint, ob und in welchem Umfang es Professionelle mit eigenen Migrationserfahrungen oder Professionelle mit einem familiären Migrationshintergrund gibt. Zweifellos dürfte es schwierig sein, hierzu angemessenes statistisches Datenmaterial zu beschaffen, aber bezeichnet ist, dass den beiden Autoren diese Lücke nicht mal aufzufallen scheint. 13 4. Orientierung an Adressatinnen und Adressaten Eine Begründung, die auf eine größere Bedeutung von „adressatInnenbezogene(n) Angebote(n)“ (Thole 2005, 24) zielt, reicht jedoch nicht aus. Zwar ist eine Orientierung an Adressatengruppen in der praktischen Arbeit unverzichtbar, eine ausschließliche Orientierung an Adressatinnen und Adressaten zur Begründung interkultureller und geschlechtsbewusster oder auf Jugendliche und alte Menschen sich konzentrierende Ansätze wäre allerdings zu wenig, ja es besteht tendenziell immer die Gefahr, das eigene Tun zu eng mit einer bestimmten sozialen Gruppe 13 zu verbinden und sich auch dort zu deren Fürsprecherin oder Fürsprecher zu machen, wo dies eigentlich nur im Eigeninteresse des Erhalts der jeweiligen Einrichtung, des eigenen Arbeitsplatzes oder der eigenen (Teil-) Disziplin geschieht. Die Folge sind dann öffentliche Skandalisierungen und Dramatisierungen auch dort, wo es nicht nötig wäre, und entlang solcher Skandalisierungen und Dramatisierungen werden Prozesse eingeleitet oder unterstützt, die zu einer (zusätzlichen) Stereotypisierung und Stigmatisierung der jeweiligen Gruppe beitragen können. Zudem können durch eine zu einseitige Orientierung an Adressatengruppen der kritische Bezug und die notwendige Distanz zum eigenen Arbeitsfeld verloren gehen. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass in der einseitigen Konzentration der Blick auf die ‚andere Seite‘ vernachlässigt wird, also auf diejenigen, die im Verhältnis zur Adressatengruppe die Privilegierten, die Mehrheit, die Norm, etc. repräsentieren, oder besser als Prozess und Struktur formuliert: Die gleichsam unthematisierten und unsichtbaren Interpretationsfolien durch die vorherrschenden gesellschaftlichen Praxisformen und Normalisierungsmuster werden aus der ‚Bearbeitung‘ ausgeklammert. Gleichzeitig haben eng adressatenorientierte Auffassungen dazu beigetragen, dass die Beschäftigung zum Beispiel mit Interkulturalität und Rassismus nur dort Gültigkeit zu haben scheint, wo Angehörige bestimmter Gruppen in ausreichender Anzahl vorhanden sind, nach dem Motto: „Es gibt hier keine Ausländer im Jugendhaus, also geht uns auch das Thema Rassismus nichts an!“ In der Geschichte von Migrationsforschung und Interkultureller Pädagogik war beides immer wieder zu beobachten, und es ist vor allem der Rassismusforschung und Ansätzen antirassistischer Arbeit zu verdanken, dass auch auf die Praxisformen der Mehrheiten, die ja oft als dominierende die Lebensverhältnisse und Handlungsmöglichkeiten bestimmter Adressatengruppen von Sozialpädagogik/Sozialarbeit ganz wesentlich mitgestalten, immer wieder – wenn auch sicher noch viel zu wenig – aufmerksam gemacht wurde. Eine professionelle Perspektive, die über die einzelnen Adressatengruppen hinausgeht, ohne sie völlig zu vernachlässigen, und die von ihrem Ansatz her breiter orientiert ist und mit 13 Der Begriff ‚soziale Gruppe‘ ist zwar in den Sozialwissenschaften (vor allem der Sozialpsychologie) weit verbreitet. Es handelt sich jedoch um einen Begriff mit Assoziationen, die nicht unproblematisch sind. Bei ‚sozialen Gruppen‘ handelt es sich zum Beispiel nicht um überschaubare Kleingruppen, deren Mitglieder sich gegenseitig kennen. Eher schon geht es um ‚Großgruppen‘, die aufgrund von Fremdzuschreibungen, aber auch aufgrund von Selbstidentifikationsprozessen gebildet werden. 14 Diversitätsbewusstsein die Notwendigkeit eines bestimmten Reflexionsvermögens in den Mittelpunkt stellt, könnte hier Abhilfe schaffen. 5. Mechanismen, Minimalstandards der Theoriebildung, Verharmlosungen Geht es in der Theorie und Praxis von Sozialpädagogik/Sozialarbeit um Geschlechterverhältnisse, um Ethnisierungsprozesse oder um soziale Schichtungen, dann ist zu beobachten, dass ähnliche Mechanismen oft eine wichtige Rolle spielen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Konstellationen, in denen Marginalisierung, Benachteiligung, Ausbeutung und/oder Gewalt gerechtfertigt werden. Nicht selten sind solche Rechtfertigungsmuster mit Zuschreibungen verbunden, die in der Form einseitiger Stereotypisierungs- und Stigmatisierungsprozesse auftreten und sich mit reduktionistischen Defizitorientierungen verbinden. Dabei kommt es meist zur Dichotomisierung, d.h. es werden im Rechtfertigungsdiskurs zwei konträre Gruppen konstruiert, wobei beide Seiten als einheitliche Größen mit einem unveränderbaren inneren Wesen dargestellt werden (sie werden also in der Vorstellung essentialisiert). Eine Seite wird zum Thema gemacht, indem ihr bestimmte – meist negative – Merkmale zugeschrieben werden, und die andere Seite bleibt gleichsam unthematisiert im Verborgenen; für sie wird gewissermaßen im Umkehrschluss implizit das (oft: positive) Gegenteil behauptet. Gelingt die Dichotomisierung, dann wird über Kräfteverhältnisse und Bewegungen auf beiden Seiten der vereinheitlichenden Konstruktion nicht mehr geredet. Solche Mechanismen – also Fremdzuschreibung, Stereotypisierung, Stigmatisierung, Defizitorientierung, Dichotomisierung, Homogenisierung, Essentialisierung – können unter dem Dach Diversität zum gemeinsamen Thema für unterschiedliche Adressatengruppen gemacht werden. Ihre kritische Durchleuchtung kann ein guter gemeinsamer Ausgangspunkt sein, und wechselseitig lässt sich hier sehr viel lernen. Insgesamt kommt es dabei allerdings darauf an, ab einem bestimmten Punkt nicht nur die Gemeinsamkeiten, sondern auch die Unterschiede, die sich durch den jeweiligen Inhalt ergeben, wahrzunehmen, also etwa auf eine unterschiedliche Geschichte und auf unterschiedliche Kräfte- und Machtverhältnisse in Bezug auf unterschiedliche Differenzlinien zu achten. Es ist vor diesem Hintergrund sehr günstig, dass in der Interkulturellen Pädagogik und der Geschlechterpädagogik ähnliche Entwicklungen in der Theoriebildung festzustellen sind; Entwicklungen, die auch als gemeinsame Mindeststandards formuliert werden können, worauf ich gemeinsam mit Helma Lutz an anderer Stelle bereits hingewiesen habe (vgl. Leiprecht/Lutz 2006, 222). So wird in diesen beiden Teildisziplinen der Erziehungs- und Bildungswissenschaften für zentrale Kategorien – Geschlecht, Kultur, Ethnizität – das Prinzip der sozialen Konstruktion in den Mittelpunkt gestellt, u.a. auch, um sich damit gegen Biologisierungen bzw. Naturalisierungen zu wenden. Zudem ist in beiden Teildisziplinen das Prinzip der Mitgestaltung und Reproduktion der Verhältnisse in den letzten Jahren in immer 15 stärkerem Maße bedeutsam geworden, – mit Begriffen wie doing gender, doing culture oder doing ethnicity gefasst. Es gibt also viele Anknüpfungspunkte, die eine gemeinsame Perspektive sowohl sinnvoll (gemeinsame Thematisierung von feststellbaren Mechanismen) als auch realisierbar (Stand der Theorieentwicklung) erscheinen lassen. Dabei wurden zwei zentrale Notwendigkeiten noch gar nicht angesprochen: a) Mit einer diversitätsbewussten Perspektive steht nicht mehr ein einzelnes und isoliertes Gruppenmerkmal im Mittelpunkt – wie zum Beispiel die andere Kultur –, ein zugeschriebenes Merkmal mit einer bestimmten inhaltlichen Qualität, das sich – so Wolfgang Schröer und Lothar Böhnisch – „zum Stigma entwickeln kann, sondern es wird zuerst nach den Kontexten […] gefragt“ (Böhnisch/Schröer 2007, 35): Weshalb, in welcher Weise und mit welchen Folgen spielt ein bestimmtes Ensemble von Differenzlinien in einem konkreten sozialen Kontext eine Rolle? Und danach: Weshalb, in welcher Weise und mit welchen Folgen wird in diesem sozialen Kontext beispielsweise die Frage nach der Kultur besonders bedeutsam? b) Es dürfte nur sehr wenige Konstellationen geben, in denen eine exklusive Wirkung einer einzigen Differenzlinie zu beobachten ist. Tatsache dürfte vielmehr sein, dass Menschen an unterschiedlichen Schnittpunkten auf unterschiedliche Weise mit den verschiedensten Differenzlinien zu tun haben. Damit kommt ein zentrales Konzept in den Blick, das für eine diversitätsbewusste Herangehensweise unverzichtbar ist: Es handelt sich um die Intersektionalitätsanalyse, mit deren Hilfe mehr als eine Differenzlinie thematisiert wird, um herauszufinden, in welcher Weise verschiedene Differenzlinien in einem konkreten Fall oder in einer konkreten Konstellation zusammenspielen. 14 Ein wichtiges Ergebnis solcher Analysen ist oft, dass eine soziale Gruppe keineswegs homogen ist, sondern von verschiedenen Differenzlinien markiert wird. Solche empirischen Ergebnisse sind wichtig, nicht nur, weil sie zu einer differenzierteren und realitätsgerechteren Wahrnehmung führen, sondern weil sie sich gegen gängige Vereinheitlichungstendenzen nach dem Muster die Arbeiter, die Frauen, die Türken, die Russen, die Homosexuellen, die Jugendlichen usw. stellen. Insgesamt ist deutlich, dass für die einzelnen Differenzlinien und ihre Verschränkungen die Theorieentwicklung vorangehen muss, und zwar in der Perspektive der Weiterentwicklung von gemeinsamen Mindeststandards, um die Anschlussfähigkeit der einzelnen Teilbereiche zu erhalten und auszubauen. Außerdem gilt es, weitere empirische Untersuchungen durchzuführen, die die konkrete Bedeutung einer Konstellation von Differenzlinien zeigen. Dabei geht es um zweierlei: 14 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Ann Phoenix im vorliegenden Band. 16 a) Es ist zweifellos richtig, dass es nicht ausreicht, nur bis drei zählen zu können und ausschließlich die bekannte Trias von race, class, gender in den Blick zu nehmen. Aus der Geschichte und Erfahrung der Sozialpädagogik/Sozialarbeit heraus müssen – und dies könnte ein nächster Schritt für Studien in Deutschland sein – im Kontext von Geschlecht, Ethnizität und Klasse mit Generation/Alter und Behinderung/Gesundheit zwei weitere wichtige Differenzlinien ebenfalls fokussiert werden. b) Nicht alle möglichen Diversitäten – und dies ist mir sehr wichtig – haben eine vergleichbare Relevanz. Um Verharmlosungen zu vermeiden, müssen Theorie und Empirie herangezogen werden, damit begründete, aber auch immer wieder revidierbare Entscheidungen über ihre – u.U. auch bereichsspezifische Bedeutung – getroffen werden können. In Sätzen wie zum Beispiel dem folgenden steckt eine erhebliche Verharmlosung: „Ach was, Diskriminierung … . Wer wird denn eigentlich nicht diskriminiert? Schwarze, Eingewanderte, dicke Menschen, kleine Menschen, Brillenträger, Glatzköpfe … und Raucher, so wie ich!“ 15 Es mag für Raucherinnen und Raucher unangenehm sein, draußen in der Kälte zu stehen und zu kleinen Grüppchen zusammengepfercht nur an bestimmten Stellen auf Flughäfen und Bahnhöfen ihrem Genuss frönen oder ihrer Sucht nachgeben zu können, und möglicherweise wird dies auch als Diskriminierung empfunden. Wenn diese Erfahrungen und deren Gründe jedoch zum Beispiel auf eine Ebene mit den Erfahrungen und deren Gründe von schwarzen Deutschen oder von schwarzen Eingewanderten gestellt werden, dann wird auch eine jahrhundertealte Geschichte von Sklaverei, Kolonialismus und Rassismus dethematisiert; eine Geschichte, deren Spuren auch heute noch in Praxisformen, in Texten, im Denken und Handeln festzustellen ist, nicht zuletzt auch in der verbreiteten Vorstellung davon, wie eine Deutsche bzw. wie ein Deutscher auszusehen hat: Deutschsein scheint untrennbar an Weißsein gekoppelt zu sein, anders gesagt: die übliche Beschreibung von Deutschsein hat auch eine meist versteckte rassialisierende Komponente. 15 Dieser Satz stammt aus einer Reflexionsübung, die für die Arbeit mit Jugendlichen konzipiert wurde (vgl. Leiprecht, Rudolf/Kreuger, Marcel 1995)). Dabei geht es darum, zunächst in Kleingruppen Aussagen oder Situationen zu diskutieren, die als Kärtchen vorliegen (wofür der obige Satz ein Beispiel ist), und jeweils geeignete Reaktionsweisen zu finden. Unter Umständen müssen zur jeweiligen Aussage oder Situation auch noch zusätzliche Materialien und Informationen bereitgestellt werden. Die in der Kleingruppe gefundenen Reaktionen und die damit verbundenen Begründungen werden dann der Gesamtgruppe präsentiert (diese Präsentation kann auch in Form des Vorspielens kleiner Szenen oder des Aufbauens von ‚Statuen‘ geschehen) und in einem größeren Rahmen diskutiert, und eventuell finden (gleichsam experimentell) verbale (oder gespielte) Umbaumaßnahmen statt, wobei es stets darauf ankommt, auch die jeweiligen Begründungen herauszuarbeiten. 17 6. Soziale Emanzipationsbewegungen: Hauptwidersprüche, Nebenwidersprüche, Intersektionalität Zu einem diversitätsbewussten Ansatz gehört – wie deutlich wurde – die Frage nach Intersektionalität. Das Nachdenken über und Fragen zu Verbindungen verschiedener sozialer Positionierungen hat eine lange Geschichte und eine noch längere Vorgeschichte, und in den USA und Großbritannien hat sich hierzu seit vielen Jahren eine explizite Debatte entwickelt, die vor allem von schwarzen Feministinnen vorangetrieben wurde, wobei es die Rechtswissenschaftlerin Kimberlé Crenshaw war, die den Begriff Intersektionalität in die Debatte eingeführt hat (vgl. Crenshaw 1994; Smith 1998). Es waren soziale Emanzipationsbewegungen und sich darauf beziehende Prozesse in der Theoriebildung, an denen entlang sich diese Debatte entwickelte. Soziale Emanzipationsbewegungen haben meist die Tendenz, sich zu einem bestimmten Verhältnis von Ungerechtigkeit, Benachteiligung, Ausgrenzung und/oder Unterdrückung zu formieren und zugleich eine bestimmte Gruppe ansprechen zu wollen, die von diesem Verhältnis in besonderer Weise betroffen ist. Solche Prozesse gehen in aller Regel mit einer entsprechenden Identitätspolitik einher, die zur Mobilisierung von Betroffenen unverzichtbar erscheint, es allerdings erschwert, Unterschiede innerhalb der eigenen Bewegung zu thematisieren. 6.1 Die Studentenbewegung: Hauptwiderspruch Kapital und Lohnarbeit In Deutschland konnten solche Prozesse beispielsweise in marxistisch inspirierten Bewegungen beobachtet werden, die die Frage der Klassenverhältnisse in den Mittelpunkt stellten und insbesondere die Arbeiterschaft in den Fabriken ansprechen wollten, um ihre Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung zu erreichen, wobei diese Veränderung als eine gesamtgesellschaftliche Emanzipation gesehen wurde. Auch die antiautoritäre Studentenbewegung der 1960er Jahre verstand sich als eine Bewegung, die sich auf marxistische Theorien und den Widerspruch von Kapital und Lohnarbeit bezog. Der Arbeiterklasse – dem Industrieproletariat – wurde aufgrund seiner Stellung im Produktionsprozess des Kapitalismus eine führende Rolle zugesprochen. Und wenn auch nicht alle Wortführer der Studentenbewegung von den Studierenden (und dies waren zu Beginn in der Tat vor allem Männer) einen ‚individuellen Klassenverrat‘ verlangten, so stand doch die unbequeme Frage nach der eigenen Klassenverortung im Raum, die sich die Bewegung mit dem Marxismusbezug eingehandelt hatte: Welche Rolle konnten gerade Studierende und akademisch Gebildete spielen, um dem Industrieproletariat zu einem wirklichen Klassenbewusstsein zu verhelfen? 16 16 Angesichts dieser Frage wies beispielsweise Hans Jürgen Krahl – einer der führenden Theoretiker des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) – damals darauf hin, dass „ohne die organisierte produktive wissenschaftliche Intelligenz die Bildung eines auf die bürgerliche Gesellschaft insgesamt bezogenen Klassenbewusstseins auch im Industrieproletariat unmöglich ist“ (Krahl 1969; hier nach Krahl 1971/1977III, 335). 18 Jedenfalls stand für viele der Grund- oder Hauptwiderspruch von Kapital und Lohnarbeit im Mittelpunkt, und andere Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnisse wurden – wenn überhaupt – zunächst allenfalls als Nebenwidersprüche diskutiert, die erst später – also nach der revolutionären Umwälzung – und nachrangig – also wenn hierdurch der Hauptwiderspruch aufgelöst ist – angegangen werden könnten. Genau gegen eine solche Sicht- und Handlungsweise opponierte 1968 der Aktionsrat zur Befreiung der Frauen. Mit einem Hinweis auf erste eigene Mobilisierungserfolge unter Frauen betonte die Sprecherin des Aktionsrates Helke Sander in ihrer berühmten Rede auf der 23. Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS): „(W)ir sehen, welche Bretter ihr vor den Köpfen habt, weil ihr nicht seht, dass sich ohne euer Dazutun plötzlich Leute organisieren, an die ihr überhaupt nie gedacht habt, und zwar in einer Zahl, die ihr für den Anbruch der Morgenröte halten würdet, wenn es sich um Arbeiter handeln würde.“ (Sander 1968/2008, 62) Die Thematisierung der gesellschaftlichen Unterdrückung von Frauen wurde eingefordert und eine Reduktion der Studentenbewegung auf die Frage nach der Arbeiterklasse und der industriellen Arbeit abgelehnt. Zudem wurde klargestellt, dass mit einer Lösung der Frauenfrage – in den Worten von Helke Sander – „nicht auf Zeiten nach der Revolution“ gewartet werden kann, „da eine nur politisch-ökonomische Revolution die Verdrängung des Privatlebens nicht aufhebt (…)“ (ebd., 61). Dem SDS wurde als „Spiegelbild gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse“ (ebd., 60) vorgeworfen, dass auch er – so Helke Sander – „einen bestimmten Bereich des Lebens vom gesellschaftlichen abtrennt, ihn tabuisiert, indem man ihm den Namen Privatleben gibt. (…) Diese Tabuisierung hat zur Folge, dass das spezifische Ausbeutungsverhältnis, unter dem die Frauen stehen, verdrängt wird, wodurch gewährleistet wird, dass die Männer ihre alte, durch das Patriarchat gewonnene Identität noch nicht aufgeben müssen.“ (ebd.) In diesem „Privatbereich“, der nach Helke Sander ebenfalls politisiert werden muss, übernehmen dann Männer die Rolle von Ausbeutern und Unterdrückern. Diese Denkbewegung, die man auch als eine Frage nach der Bedeutung von Haupt- und Nebenwidersprüchen formulieren kann, ist auch für die Diskussion zu Intersektionalität relevant, wobei – und dies möchte ich besonders hervorheben – Helke Sander nicht davon ausging, dass die Studentenbewegung aufgelöst werden müsste oder die Klassenfrage bedeutungslos geworden wäre. Die Genossen – so Helke Sander – sind „auch (…) unterdrückt, was wir ja wissen. Wir sehen es nur nicht mehr länger ein, dass wir ihre Unterdrückung, mit der sie uns unterdrücken, weiter wehrlos hinnehmen sollen.“ (ebd., 62) Obwohl diese Rede ein wichtiges Element des Beginns der neueren Frauenbewegung in Westdeutschland markiert, wäre es völlig verfehlt, der Frauenbewegung die Verantwortung für das baldige Ende der Studentenbewegung Ende 1969 zuzuschreiben. Hierfür war schon 19 eher die Zersplitterung der Bewegung in eine unüberschaubare Vielzahl von (großteils sich als marxistisch-leninistisch oder maoistisch bezeichnende) Sekten, Fraktionen, Splittergruppen oder Kleinstparteien verantwortlich, eine Fragmentierung, die in den unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen, die zur Bewegung führten, vermutlich bereits angelegt war (vgl. Mosler 1977/1980IV, 239). 6.2 Die Frauenbewegung und der Hauptwiderspruch Geschlechterverhältnisse Jedenfalls wurde 16 Jahre später diese Frauenbewegung – wiederum auf einer großen öffentlichen Veranstaltung – mit einer ähnlichen Denkbewegung konfrontiert. In Frankfurt fand 1984 der „Erste gemeinsame Kongress ausländischer und deutscher Frauen“ statt. Helma Lutz bewertet diese Tagung als politischen Wendepunkt 17 in der bundesdeutschen Diskussion der Frauenbewegung zu eingewanderten und schwarzen Frauen: „Zum ersten Mal sahen sich deutsche ‚Inländerinnen‘ der öffentlichen, radikalen und sehr emotionsgeladenen Kritik ‚ausländischer Frauen‘ ausgesetzt.“ (Lutz 1991, 1) Und sie zitiert aus der Tagungsdokumentation: „Einige der ausländischen Frauen hatten – wie sie sagten – schon sehr lange auf diese Gelegenheit gewartet, und sie attackierten uns sehr scharf. Ihren ganzen Frust und ihre ganze Wut über den langjährigen Rassismus der deutschen Frauen und der Frauenbewegung schleuderten sie uns entgegen.“ (Arbeitsgruppe Frauenkongress 1984, 162) Kritisiert wurde vor allem der Universalitätsanspruch der feministischen Bewegung, welcher gleichzeitig implizit und explizit vom Modell ‚deutscher Frauen aus der Mittelschicht‘ ausgehe. Dadurch würden die Unterschiede in den Lebenssituationen von deutschen und eingewanderten bzw. schwarzen Frauen nicht wahrgenommen, genauso wenig wie die unterschiedlichen Zuschreibungs- und Unterdrückungsformen, denen Frauen unterschiedlicher Gruppen ausgesetzt seien. Die dominierende Praxis innerhalb der Frauenbewegung, die hier scharf kritisiert wurde, lässt sich auch als ein Festhalten am Hauptwiderspruch Geschlechterverhältnisse und den damit verbundenen Unterdrückungsformen interpretieren, wodurch Formen rassialisierender und kulturalisierender Stigmatisierung und Diskriminierung entlang von Merkmalen wie Hautfarbe, Kultur und Sprache als Nebenwiderspruch und damit als weniger bedeutsam bewertet werden. Das Handeln und Denken von ‚feministischen Frauen der Mehrheitsgesellschaft‘, die auf diese Weise zum selbstverständlichen Zentrum der Bewegung werden, kann so auch nicht auf die jeweils eigene Beteiligung an der Unterdrückung anderer Gruppen befragt werden. Eine ähnliche Kritik gegenüber ihrer spezifischen Zentrierung musste die neuere Frauenbewegung in ihrer kurzen Geschichte übrigens auch in anderer Weise erfahren, also wenn es beispielsweise um die Ignoranz gegenüber den Lebenssituationen von Arbeiterfrau17 Ilse Lenz bezeichnet die Konferenz als ein „Schlüsselereignis“ und Teil eines längeren Prozesses „konfliktueller Differenzierung“ (Lenz 2008, 707). Damit will sie darauf aufmerksam machen, dass innerhalb der Frauenbewegung von einigen Frauen zum Beispiel Texte aus den USA zu race – class – gender bereits rezepiert wurden, bevor es zur öffentlichen Auseinadersetzung von 1984 kam. 20 en, homosexuellen Frauen und Frauen mit Behinderungen ging. 18 Trotz deutlicher inhaltlicher Unterschiede lassen diese Erfahrungen einen vergleichbaren Mechanismus erkennen: Mit der Fokussierung eines Hauptwiderspruches wird die eigene Beteiligung an der Unterdrückung anderer – auch innerhalb der eigenen Bewegung – verkannt. Interessanterweise haben solche Debatten in den USA bereits sehr viel früher stattgefunden, wobei im Unterschied zu Deutschland eine explizite Debatte zu Diversity vor allem in den USA, Kanada und Großbritannien sich sehr viel ausgeprägter im Zusammenhang mit politischen Forderungen von Minderheiten entwickelt hat. 19 Einen Hinweis hierzu finden wir beispielsweise bei Patricia Hill Collins: 20 „African-American women intellectuals have been ‚talking quite a bit‘ since 1970 and have insisted that both the masculinist bias in Black social and political thought and the racist bias in feminist theory be corrected.“ (Hill Collins 1990/1991, 9) 21 Ein Ausdruck davon ist das berühmte Combahee River Collective, das 1974 in Boston gegründet wurde. Diese Gruppe schwarzer lesbischer Feministinnen reflektierte ihre Erfahrungen, die von einer Desillusionierung auch innerhalb sozialistischer, feministischer und antirassistischer Emanzipationsbewegungen geprägt war, und als Konsequenz beschlossen sie nach neuen Politikformen zu suchen und sie zu erproben, „a politics that was antiracist, unlike those of white women, and antisexist, unlike those of black and white men“ (Combahee River Collective 1982, 13). 6.3 Heterogenität und Unterdrückung in den ‚eigenen‘ Reihen wahrnehmen, ohne Handlungsfähigkeit zu verlieren Es ist nahe liegend, dass sich in solchen Auseinandersetzungsprozessen stets auch neue Fraktionen, vielleicht sogar neue Bewegungen bilden. Dennoch ist mir wichtig, zu verdeutlichen, dass die Organisation einer Emanzipationsbewegung mit der Konzentration auf eine bestimm18 Vgl. hierzu die Materialien in der von Ilse Lenz herausgegebenen Quellensammlung, so zum Beispiel „Warum sich eine Frauengruppe gebildet hat, wie sie entstand, was sie bis jetzt getan hat und welches ihre Ziele sind (1972)“ (Lenz 2008, 236) oder „Geschlecht: Behindert. Besonderes Merkmal: Frau. Ein Buch von behinderten Frauen (1985)“ (ebd., 652). 19 Hierauf weist auch Albert Scherr in seinem Beitrag (dort im Abschnitt 2) zum vorliegenden Band hin und benennt zugleich einige Folgen, die mit diesem Unterschied verbunden sind. 20 Vgl. zu dieser Geschichte auch Bamara (1970) und Lerner (1972). 21 Patricia Hill Collins bezieht sich mit dem Binnenzitat in dieser Textpassage ironisierend auf die biographische Erzählung der schwarzen Feministin Septima Clark, die beschreibt, wie sich ihr politisches Selbstbewusstsein in ‚geschlechtergemischten‘ Treffen afro-amerikanischer Organisationen entwickelte: „I used to feel that women couldn’t speak up, because when district meetings were being held at my home … I didn’t feel as if I could tell theme what I had in mind. … But later on, I found out that women had a lot to say, and what they had to say was really worthwhile. … So we started talking, and have been talking quite a bit since that time.“ ( Zitiert nach Hill Collins 1990/1991, 9) 21 te Unterdrückungsform vermutlich unverzichtbar ist. Damit ist allerdings oft die Schwäche verbunden, auch ‚nach innen‘ Heterogenität zu wenig wahrzunehmen und die eigene Teilnahme an der Unterdrückung anderer bzw. eigene Privilegierungen aus der Wahrnehmung auszuklammern. Allzu leicht wird dann eine entsprechende eigene ‚Reinheit‘ und ‚Unschuldigkeit‘ als Opfer von Klassenunterdrückung oder von Sexismus oder von Rassismus oder von Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen usw. imaginiert. Zudem kann es zu Essentialisierungen kommen, in deren Kontext für die eigene ‚Gruppe‘ ursprüngliche Wesensmerkmale behauptet werden, die sie allen anderen ‚Gruppen‘ überlegen macht. Ich denke deshalb, dass es für solche Emanzipationsbewegungen sehr hilfreich sein kann, diesbezüglich eine selbstkritische Haltung zu entwickeln. Eine solche Haltung bedeutet jedoch keineswegs, dass die jeweilige Emanzipationsbewegung sich deshalb auflösen oder auf eine Identitätspolitik verzichten müsste. Dies wäre unsinnig, denn die zentralen Fragen und Gründe zu den jeweils spezifischen Unterdrückungsformen, um die herum sich eine Emanzipationsbewegung gebildet hat, bleiben ja leider nach wie vor relevant. Dennoch ist es nützlich, die Reduktion auf einen exklusiven Hauptwiderspruch aufzugeben, denn dadurch können eigene Schwachstellen und Anschlussmöglichkeiten für die Unterdrückung anderer innerhalb und außerhalb der ‚eigenen‘ Reihen wahrgenommen und thematisiert werden. Es geht also eher um eine andere politische Haltung, eine Haltung, die weniger eindimensional, selbstgefällig und unbeweglich und mehr multiperspektivisch und selbstkritisch ist, ohne dabei handlungsunfähig in der Auseinandersetzung gegen Unterdrückung zu werden. Und es geht um die Bereitschaft und Fähigkeit von Akteuren einer Emanzipationsbewegung zur Kooperation und zu Bündnissen mit Akteuren anderer Emanzipationsbewegungen. Dies gilt wechselseitig für die Akteure verschiedener Emanzipationsbewegungen und setzt auf den jeweiligen Seiten Information und Anerkennung voraus, aber auch eine Form der Kritik, die konstruktiv und respektvoll ist, ‚gehört‘ werden kann und auf Zusammenarbeit zielt. In dieser Weise kann das Aufgeben der Reduktion auf einen exklusiven Hauptwiderspruch eine Stärkung der jeweiligen Emanzipationsbewegung bedeuten. 7. Zur Möglichkeit und Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Wissenschaftsdisziplinen In vergleichbarer Weise kann auch über Identitätsdynamiken durch und innerhalb von Wissenschaftsdisziplinen diskutiert werden, genauso wie durch und innerhalb von Professionen, die auf diese Wissenschaftsdisziplinen bezogen sind. Wir werden hier ähnliche Prozesse der Zentrierung und Exklusion feststellen können, wenn auch sich die Ziele, Begründungen, Aufgaben, Tätigkeiten und Handlungskontexte von Emanzipationsbewegungen unterscheiden. So sind Wissenschaftsdisziplinen zum Beispiel von der Förderung und Verortung innerhalb akademischer Institutionen und der Bereitstellung von Steuermitteln und Mitteln verschiedener Auftraggeber abhängig, genauso wie Professionen von der Beauftragung und Finanzierung 22 durch entsprechende Geldgeber (Kommunen, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Vereine, Betriebe, etc.). Im Kontext solcher zwangsläufigen Abhängigkeiten ist leider zu beobachten, dass das Stichwort Diversität/Diversity paradoxerweise auch benutzt wird, um Zusammenfassungen und Vereinheitlichungen zu rechtfertigen und durchzuführen. So kommen Universitätsleitungen, die vor Ort eine wissenschaftliche Einrichtung haben, die sich mit Geschlechterverhältnissen befasst und eine andere, die sich auf Rassismen und Migrationsprozesse konzentriert, auf die Idee, beide zu einer Einrichtung unter einem Namen, der irgendwie auf Diversität/Diversity hinweist, zusammenzufügen. Hiermit sollen dann in der Regel Ressourcen (Geld, Personal, Räume, etc.) eingespart werden. Und nicht selten überlegen sich Stadtoder Gemeinderäte aus denselben Motiven heraus, die Stelle der Frauen- und/oder Genderbeauftragten zu einer allgemeinen Gleichstellungsstelle umzuformen, die gemäß dem Gesetz zur Gleichstellung (AGG) zugleich ein wachsames Auge auf die Gleichstellung von eingewanderten Gruppen, Homosexuellen und Menschen mit Behinderungen wirft. Solche Entwicklungen zeichnen sich leider ab, und es ist zu befürchten, dass die entstehenden Einrichtungen ihrer Aufgabe nicht gerecht werden können, da sie zu komplex ist und zu viele unterschiedliche Bereiche umfasst, für die jeweils spezielles Wissen und spezielle Herangehensweisen erforderlich sind. Für die Bewältigung der wissenschafts- und praxisbezogenen Aufgaben und Herausforderungen ist es zweifellos angemessener, genau umgehrt zu argumentieren, zudem würde dies auch der Diversity-Idee entsprechen: Ein deutliches Mehr an spezialisierten Einrichtungen ist notwendig, um angemessen auf spezifische Bedürfnisse reagieren zu können. Die Berücksichtigung von Diversity ist das Gegenteil von Angleichung und Gleichmacherei. Dies gilt ebenso für eine diversitätsbewusste Perspektive der Sozialpädagogik/Sozialarbeit: Sie muss sich auf weitere fachliche Disziplinen stützen können, die sich mit verschiedenen Differenzlinien befassen – also etwa die Geschlechterpädagogik, die Interkulturelle Pädagogik und die Sonderpädagogik (vgl. hierzu auch Lamp 2007, 224). Eine diversitätsbewusste Perspektive kann diese speziellen Disziplinen, nicht ersetzen. Sie sind unverzichtbar, nicht nur, weil ein besonderes und vertieftes Wissen zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte und Aktualität der jeweiligen Differenzlinien notwendig ist, sondern auch, weil es in allen Fachdebatten der Erziehungs- und Bildungswissenschaften – also zum Beispiel in der Systematischen Pädagogik, der Historischen Pädagogik, der Schulpädagogik, aber eben auch der Sozialpädagogik/Sozialarbeit qualifizierte Stimmen geben muss, die die allgemeine Berücksichtigung dieses besonderen und vertieften Wissens begründen und einklagen können. Solche Stimmen kommen – dies zeigt die Erfahrung – in aller Regel nicht aus ohne den Rückhalt durch die Beiträge der genannten Spezialisierungen. Von selbst entsteht in sich als allgemein und universell verstehenden Disziplinen keine Wahrnehmung von ‚Heterogenität als Normalfall‘ (vgl. hierzu auch Krüger-Potratz 1994; Krüger-Potratz 2005). In diesem Prozess ist es 23 notwendig, dass von den genannten speziellen (Teil-) Disziplinen immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird, dass beispielsweise die Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit, ein egalitärer Umgang mit Homosexualität, eine kritische Perspektive gegenüber Kulturalisierungstendenzen, die angemessene Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit, eine Sensibilisierung gegenüber subtilen Formen von Sexismus und Rassismus usw. als Querschnittsaufgaben gesehen werden müssen, die in allen pädagogischen Disziplinen und Praxisfeldern zu berücksichtigen sind, um wirksam den Herausforderungen begegnen zu können und Veränderungen zu unterstützen. Dabei gilt es auch, in Theorie und Praxis einer ausgrenzenden Besonderung dieser Thematiken entgegen zu wirken. Allerdings – und hier greift die Aufforderung zu Diversity und Intersektionaliät – müssen die speziellen Disziplinen (Interkulturelle Pädagogik, Geschlechterpädagogik, Sonderpädagogik) und die speziellen praxisbezogenen Ansätze (also beispielsweise die geschlechterbewusste und sexismuskritische Mädchen- und Jungenarbeit und die interkulturelle und rassismuskritische Jugendarbeit) auch in der Lage sein, die Anschlussmöglichkeiten und Verbindungen zu den jeweils anderen Differenzlinien zu denken. Bei einer diversitätsbezogene Perspektive kann es zudem nicht um das Aufgeben von speziellen (Teil-) Disziplinen gehen, sondern nur darum, für die jeweiligen (Teil-) Disziplinen nach solchen Anschlussmöglichkeiten und Verbindungen zu fragen, genauso wie nach den Behinderungen, auf die solche Fragen treffen und den Möglichkeiten, den Weg hin zu ihrer Beantwortung produktiv voranzutreiben. 8. Subjektorientierte Sozialpädagogik/Sozialarbeit Sozialpädagogik/Sozialarbeit lässt sich als eine Disziplin beschreiben, in der – so Franz Hamburger – „das Verhältnis des Individuums zur sozialen Welt in den Vordergrund gerückt wird“ (Hamburger 2003, 15). Dabei wird von der prinzipiellen Anerkennung jedes Menschen als Subjekt ausgegangen (vgl. Winkler 1988, 147; Hamburger 2003, 123). Gerade für eine diversitätsbewusste Sozialpädagogik/Sozialarbeit ist eine sich hieraus ergebende Subjektorientierung unverzichtbar, die an verschiedene theoretische Implikationen gekoppelt ist: Zunächst muss deutlich sein, dass ein Denken von Makro-Struktur und Individuum als einfaches Ableitungsmodell das Individuum auf ein determiniertes Wesen reduzieren würde. Dies ist unbefriedigend, denn Sozialpädagogik/Sozialarbeit ist – wie die Pädagogik überhaupt – darauf angewiesen, Veränderungsprozesse zu denken. Wird ein Individuum nur als etwas Bestimmtes und Festgelegtes betrachtet, kann man sich kaum erklären, wie Veränderungen zustande kommen sollen und von wem sie initiiert und getragen werden. Man braucht hier also einen Begriff, mit dem sich das Individuum als ein sich selbst veränderndes und – in einem bestimmten Maßstab – die sozialen Kontexte mit veränderndes fassen lässt. Gleichzeitig kann das einzelne Individuum nicht völlig losgelöst von der Geschichte, den materiellen Verhältnissen, den Strukturen, den Diskursen, den Gruppenbeziehungen, den Zuschreibungsmustern – kurzum: den konkreten sozialen Kontexten, in denen es sich befindet 24 – gedacht werden. Es ist nicht völlig frei, es steht nicht ‚freischwebend‘ im Raum. Es ist und bewegt sich in konkreten Gesellschaften, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Konstellation. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es keine Eins-zu-Eins-Übersetzung von der MakroStruktur zum einzelnen Individuum geben kann. Die Individuen stehen in einem Verhältnis zur Makro-Struktur und gehen damit um, sie sind jedoch nicht identisch mit dieser MakroStruktur. Wenn wir also in diversitätsbewusster Perspektive auf der Seite von MakroStrukturen Begriffe wie Geschlecht, Ethnizität, Klasse, Generation usw. zu fassen versuchen, müssen wir genau dieses Anschlussverhältnis – diese Nicht-Gleichsetzung – mitdenken. Als nützlich erweist sich meines Erachtens hier der von Klaus Holzkamp formulierte Begriff Subjektiver Möglichkeitsraum (vgl. Holzkamp 1983, 368ff.). Mit Einführung dieses Begriffs geht es mir nicht darum, den gesamten Begriffsapparat der Kritischen Psychologie, der von Klaus Holzkamp und vielen anderen entwickelt wurde, zu übernehmen. Eine bescheidenere Adaption ist durchaus möglich, wobei ich dies hier nur andeuten kann: In den jeweils subjektiven Möglichkeitsraum gehen auch die Einteilungs- und Zuschreibungsmuster zu Geschlecht, sozialer Klasse, Ethnizität und Generation ein, ebenso wie die jeweilige körperliche Konstitution, die gesellschaftlichen Möglichkeiten und Einschränkungen, die sich daraus durch eine bestimmte Einrichtung der Verhältnisse ergeben, und die sozialen Bedeutungen, die damit verbunden sind. Gleichzeitig ist es der jeweilige Umgang mit diesen Bedingungen und Bedeutungen – das je eigene doing ethnicity, doing gender, doing class –, das diesen Möglichkeitsraum verändert, also langfristig auch einschränkt oder erweitert, und natürlich spielen hier Ideologien, nahe gelegte Denkangebote, aber auch soziale Unterstützung, Ermunterung, Förderung, Anerkennung, genauso wie Bedrohungsmomente, Abwertungserfahrungen usw. eine wichtige Rolle. Grundlegend ist jedoch immer eins: Das einzelne Subjekt ist nicht völlig festgelegt, es ist aber auch nicht völlig frei. Das Subjekt hat in seinem subjektiven Möglichkeitsraum die Möglichkeit, sich „So-und-auch-anders“ (Holzkamp) zu verhalten, und für diese konkrete Alternative hat es auch eine eigene Verantwortung, wobei zur Selbstaufklärung dieses subjektiven Möglichkeitsraumes zwar unterstützend beigetragen werden kann, eine gültige Antwort kann letztlich jedoch nur das jeweilige Subjekt selbst geben. M.a.W.: Es handelt sich beim „Subjektiven Möglichkeitsraum“ um einen sozial—psycho—logischen Begriff, einen Begriff, der die subjektiven Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, Sinnstrukturen und Funktionalitäten im Verhältnis zum sozialen Kontext thematisiert und der Selbstklärung und Selbstreflexion dient. 9. Abschluss Diversitätsbewusste Sozialpädagogik/Sozialarbeit ist eine Dachkonstruktion zur Orientierung, deren tragende Säulen die Perspektive der Antidiskriminierung, die Intersektionalität und die Subjektorientierung sind. Mit dieser Dachkonstruktion lassen sich theorie- und praxisbezoge25 ne Ansprüche formulieren, die die Sozialpädagogik/Sozialarbeit auch in ein realistisches Verhältnis zu den aktuellen Anforderungen setzt, die sich aus einer pluriformen Einwanderungsgesellschaft ergeben. Dabei kann es nicht um das Ersetzen von Teildisziplinen und Spezialisierungen gehen. Ein zentrales Element diversitätsbezogener Perspektiven ist es vielmehr, nach wechselseitigen Anknüpfungs- und Verbindungskonstellationen zu fragen. Zudem wird die Möglichkeit zu einer Kooperation mit Geschlechterpädagogik, Interkultureller Pädagogik und Sonderpädagogik verbessert, da deutlich ist, dass in Bezug auf die Theorieentwicklung zu Diversity/Diversität und Diversity Education eine gemeinsame Grundlage geschaffen werden kann, von der aus die jeweiligen Anknüpfungs- und Verbindungskonstellationen auch wirklich passgenau herausgearbeitet werden können. Literatur: Appelbaum, Peter (2002): Multicultural and Diversity Education: a Reference Handbook. Santa Barbara/Denver/Oxford: ABC-CLIO. Auernheimer, Georg (2002): Kultur, Lebenswelt, Diskurs – drei konkurrierende Konzepte. In: Tertium Comparationis – Journal für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft. Heft Nr. 2, 8. Jg. Münster: Waxmann. S. 93-103. Bambara, Toni Cade (1970): The Black Women: An Anthology. New York: Signet. Braz, Heiner (2001): Religiösität. In: Otto, Hans-Uwe/Thiersch, Hans (Hg.) (2001II): Handbuch Sozialarbeit – Sozialpädagogik. Neuwied: Luchterhand. S. 1499-1506. Böhnisch, Lothar (2001): Sozialpädagogik der Lebensalter. Weinheim/München: Juventa. Böhnisch, Lothar/Schröer, Wolfgang/Thiersch, Hans (2005): Sozialpädagogisches Denken. Wege zu einer Neubestimmung. Weinheim/München: Juventa. Böhnisch, Lothar/Schröer, Wolfgang (2007): Politische Pädagogik. Eine problemorientierte Einführung. Weinheim/München: Juventa. Combahee River Collective (1982): A Black Feminist Statement. In: Hull, Gloria T./Scott, Patricia Bell/Smith, Barbara (Hg.) (1982): But Some of Us Are Brave. Black Women's Studies. Old Westbury. S. 13-22. Crenshaw, Kimberlé (1994): Mapping the margins: intersectionality, identity politics and violence against women of color. In: Fineman, Martha/Mykitiuk, Rixanne (Hg.) (1994): The public nature of private violence. New York: Routledge. S. 93-118. Hamburger, Franz (2003): Einführung in die Sozialpädagogik. Stuttgart: Kohlhammer. Hollstein, Walter/Meinhold, Marianne (Hg.) (1973): Sozialarbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen. Bielefeld: AJZ. Holzkamp, Klaus (1983): Grundlegung der Psychologie. Frankfurt a.M./New York: Campus. Holzkamp, Klaus (1993): Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Frankfurt a.M./New York: Campus. Homfeldt, Hans Günther/Schröer, Wolfgang/Schweppe, Cornelia (Hg.) (2008): Soziale Arbeit und Transnationalität. Herausforderungen eines spannungsreichen Bezugs. Weinheim/München: Juventa. Hormel, Ulrike/Scherr, Albert (2004): Bildung für die Einwanderungsgesellschaft. Perspektiven der Auseinandersetzung mit struktureller, institutioneller und interaktioneller Diskriminierung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 26 Erler, Michael (1993/2004V): Soziale Arbeit. Ein Lehr- und Arbeitsbuch zu Geschichte, Aufgaben und Theorie. Weinheim/München: Juventa. Eyferth, Hanns/Otto, Hans-Uwe/Thiersch, Hans (Hg.) (1984I): Handbuch Sozialarbeit – Sozialpädagogik. Neuwied: Luchterhand. Friebertshäuser, Barbara/Gisela Jakob/Renate Klees-Möller (Hg.) (1997): Sozialpädagogik im Blick der Frauenforschung. Reihe: „Einführungen in pädagogische Frauenforschung“ der Kommission Frauenforschung in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Weinheim: Beltz/Deutscher Studienverlag. Gather Thurler, Monica/Schley, Wilfried (2006): Diversität als Chance. In: Journal für Schulentwicklung, 10. Jg., Heft 1, 2006. Themenheft: Next Practice. Studienverlag: Innsbruck. S. 21-33. Hill Collins, Particia (1990/1991II): Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. New York/London: Routledge. Kirton, Gill/Greene, Anne-marie (2000/2005II): The Dynamics of Managing Diversity. A Critical Approach. Oxford/Burlington: Butterworth-Heinemann/Elsevier. Krahl, Hans-Jürgen (1969): Thesen zum allgemeinen Verhältnis von wissenschaftlicher Intelligenz und proletarischem Klassenbewusstsein. In: Socialistische Korrespondenz – Info. Nr. 25. Frankfurt. Hier zitiert nach Krahl, Hans-Jürgen (1971/1977III): Konstitution und Klassenkampf. Zur historischen Dialektik von bürgerlicher Emanzipation und proletarischer Revolution. Schriften, Reden und Entwürfe aus den Jahren 1966–1970. Frankfurt a.M.: Neue Kritik. S. 330-347. Krüger-Potratz, Marianne (1994): Interkulturelle Pädagogik als Kritik der ‚gegebenen Pädagogik‘. Eine disziplintheoretische Skizze am Beispiel der Historischen Pädagogik. In: Luchtenberg, Siegrid & Nieke, Wolfgang (Hg) (1994): Interkulturelle Pädagogik und Europäische Dimension. Herausforderungen für Bildungssystem und Erziehungswissenschaft. Festschrift für Manfred Hohmann. Münster/New York: Waxmann. S. 199-208. Krüger-Potratz , Marianne (2005): Interkulturelle Bildung. Eine Einführung. Münster: Waxmann. Lamp, Fabian (2007): Soziale Arbeit zwischen Umverteilung und Anerkennung. Der Umgang mit Differenz in der sozialpädagogischen Theorie und Praxis. Bielefeld: Transcript. Lenz, Ilse (Hg.) 2008): Die neue deutsche Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied. Eine Quellensammlung. Wiesbaden: VS. Leiprecht, Rudolf (2008): Eine diversitätsbewusste und subjektorientierte Sozialpädagogik: Begriffe und Konzepte einer sich wandelnden Disziplin. In: Neue Praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 38. Jg., 2008. S. 427-439. Leiprecht, Rudolf (2009a): Diversitätsbewusste Sozialpädagogik. Ein Beitrag zur Politischen Bildung. In: Unsere Wirklichkeit ist anders. Migration und Alltag. Perspektiven politischer Bildung. Herausgegeben von Lange, Dirk/Polat, Ayça (2009). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. S. 211-223. Leiprecht, Rudolf (2009b): Pluralismus unausweichlich? Zur Verbindung von Interkulturalität und Rassismuskritik in der Jugendarbeit. In: Scharathow, Wiebke/Leiprecht, Rudolf (Hg.) (2009): Rassismuskritische Bildungsarbeit (Rassismuskritik Band II). Schwalbach i.T.: Wochenschau-Verlag. S. 244-265. Leiprecht, Rudolf/Kreuger, Marcel (1995): Voorordelen, Racisme, Discriminatie. MBO-Module rond de film ‚Het zit toch dichterbij ...‘. Rotterdam: ARIC. Leiprecht, Rudolf/Lutz, Helma (2005/2006II): Intersektionalität im Klassenzimmer: Ethnizität, Klasse, Geschlecht. In: Leiprecht, Rudolf/Kerber, Anne (Hg.) (2005/2006II): Schule in der Einwanderungsgesellschaft. Schwalbach im Taunus: Wochenschau. S. 218-234. Lerner, Gerda (Hg.) (1972): Black women in white America. A documentary history. New York: Vintage. Lutz, Helma (1991): Welten verbinden. Türkische Sozialarbeiterinnen in den Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt: IKO. Lutz, Helma/Wenning, Norbert (Hg.) (2001): Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft. Opladen: Leske & Budrich. 27 Moscovici, Serge (1995): Geschichte und Aktualität sozialer Repräsentationen. In: Flick, Uwe (Hg.) (1995): Psychologie des Sozialen. Repräsentationen in Wissen und Sprache, Hamburg: Rowohlt. S. 266-314. Mosler, Peter (1977/1980IV): Was wir wollten, was wir wurden. Studentenrevolte – Zehn Jahre danach. Reinbek: Rowohlt. Noack, Winfried (2001): Sozialpädagogik – Ein Lehrbuch. Freiburg im Breisgau: Lambertus. Müller, Burkhard (1995): Sozialer Friede und Multikultur. Thesen zur Geschichte und zum Selbstverständnis sozialer Arbeit. In: Müller, Siegfried/Otto, Hans-Uwe/Otto, Ulrich (Hg.) (1995): Fremde und Andere in Deutschland. Nachdenken über das Einverleiben, Einebnen, Ausgrenzen. Opladen: Leske & Budrich. S. 133-148. Otto, Hans-Uwe/Thiersch, Hans (Hg.) (2001II): Handbuch Sozialarbeit – Sozialpädagogik. Neuwied: Luchterhand. Otto, Hans-Uwe/Schrödter, Mark (Hg.) (2007): Neue Praxis – Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik. Sonderheft 8. Thema: Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft – Multikulturalismus – Neo-Assimilation – Transnationalität. Lahnstein: Neue Praxis. Prengel, Annedore (1993): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in interkultureller, feministischer und integrativer Pädagogik. Opladen: Leske & Budrich. Prengel, Annedore (2007): Diversity Education – Grundlagen und Probleme der Vielfalt. In: Krell, Gertraude/Riedmüller, Barbara/Sieben, Barbara/Vinz, Dagmar (Hg.) (2007): Diversity Studies. Grundlagen und disziplinäre Ansätze. Frankfurt a.M./New York: Campus. S. 49-68. Sander, Helke (1968): Rede auf der 23. Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS). In: Lenz, Ilse (Hg.) 2008): Die neuen deutsche Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied. Eine Quellensammlung. Wiesbaden: VS. S. 59-63. Schilling, Johannes (1997/2005 II): Soziale Arbeit – Geschichte – Theorie – Profession. München/Basel: Reinhardt – UTB. Sielert, Uwe (2006): Worum geht es? Ohne Angst verschieden sein können und die Kraft der Vielfalt nutzen. In: Journal für Schulentwicklung, 10. Jg., Heft 2, 2006. Themenheft: Diversity Management. Studienverlag: Innsbruck. S. 7-14. Smith, Valerie (1998): Not just race, not just gender. Black feminist readings. London: Routledge. Schröer, Hubertus (2006): Vielfalt gestalten. Kann Soziale Arbeit von Diversity-Konzepten lernen? In: Migration und Soziale Arbeit (iza). 28. Jg. Heft 1. S. 60-68. Schröer, Wolfgang (2006): Zu Diversity. Internes Papier der Abteilung Sozialpädagogik an der Universität Hildesheim. Nicht veröffentlicht. Hildesheim: Universität. Schweitzer, Friedrich (2001). Religiöse Erziehung. In: Otto, Hans-Uwe/Thiersch, Hans (Hg.) (2001II): Handbuch Sozialarbeit – Sozialpädagogik. Neuwied: Luchterhand. S. 1490-1498. Thiersch, Hans (1973): Aggressives Verhalten als Problem für den Pädagogen. Zuerst in: Neidhardt, Friedhelm et al. (Hg.) (1973): Aggressivität und Gewalt in unserer Gesellschaft. München. S. 105ff. Wieder abgedruckt in und hier zitiert nach: Thiersch, Hans (1977): Kritik und Handeln. Interaktionistische Aspekte der Sozialpädagogik. Gesammelte Aufsätze von Hans Thiersch unter Mitarbeit von Anne Fromann und Dieter Schramm. Neuwied/Darmstadt: Luchterhand. S. 10-23. Thiersch, Hans/Fromann, Anne/Schramm, Dieter (1976): Sozialpädagogische Beratung. Zuerst in: Zeitschrift für Pädagogik. S. 715ff. Wieder abgedruckt in und hier zitiert nach: Thiersch, Hans (1977): Kritik und Handeln. Interaktionistische Aspekte der Sozialpädagogik. Gesammelte Aufsätze von Hans Thiersch unter Mitarbeit von Anne Fromann und Dieter Schramm. Neuwied/Darmstadt: Luchterhand. S. 95-130. Thiersch, Hans (1984): Verstehen oder Kolonialisieren? Verstehen als Widerstand. In: Müller, Siegfried/Otto, Hans-Uwe (Hg.) (1984): Verstehen oder kolonialisieren? Grundprobleme sozialpädagogischen Handelns und Forschens. Im Auftrag des Vorstands der Kommission Sozialpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Wissenschaftliche Reihe Bd. 21. Bielefeld: Kleine. S. 15-30. Thole, Werner (2002/2005II): Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Wiesbaden: VS. 28 Winkler, Michael (1988): Eine Theorie der Sozialpädagogik. Stuttgart: Klett-Cotta. 29