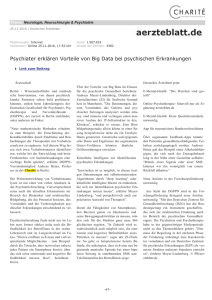Psychiatrie und Populationszugehörigkeit
Werbung

2 Zum Thema Psychiatrie und Populationszugehörigkeit D ie beiden großen diagnostischen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV werden derzeit in zahlreichen Expertengruppen mit unterschiedlicher thematischer Ausrichtung umfassend überarbeitet. Dabei wird eine größtmögliche Harmonisierung beider Klassifikationssysteme angestrebt. Folgende Entwicklungslinien zeichnen sich ab: eine Integration sowohl dimensionaler als auch kategorialer Konzeptionen, die Berücksichtigung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere im Bereich der Molekularbiologie und Genetik sowie der modernen Bildgebung und eine umfassende Berücksichtigung der Populationszugehörigkeit. Der Einfluss der Populationszugehörigkeit auf die Entwicklung, Symptomausgestaltung und den Verlauf psychischer Störungen blieb in den traditionellen Klassifikationssystemen bisher weitestgehend unberücksichtigt. Im Zuge des Revisionsprozesses von ICD-10 und DSM-IV rückte die Bedeutung der Populationszugehörigkeit stärker in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses. Bereits 2002 legte eine gemeinsame Arbeitsgruppe der American Psychiatric Association und des National Institute of Mental Health die Eckpfeiler für die Entwicklung eines zukünftigen „physiologisch basierten Klassifikationssystems“ vor (1). Angestrebt wird eine bessere Phäno- und Genotypisierung psychischer Störungen, die eine mehr an den biologischen Ursachen orientierte Therapie ermöglichen. Die Ergebnisse der in 28 Ländern weltweit durchgeführten WHO World Mental Health Survey Initiative belegen, dass lediglich eine sehr kleine Gruppe von Patienten mit psychischen Störungen eine qualitativ hochwertige psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung erfährt (vgl. Beitrag von R. C. Kessler et al.). Die Populationszugehörigkeit umfasst ein weites Feld unterschiedlicher Konzeptionen. Dazu zählen die Krankheitskategorien im engeren Sinne mit ihren vielfältigen engen Beziehungen zwischen Soma und Psyche, der Lebenszyklus (2), das „biologische“ (Sex) und das „psychosoziale“ (Gender) Geschlecht (3), die Zugehörigkeit zu bestimmten ethnischen Gruppen, biologisch verankerte Krankheitsdispositionen im Sinne einer erhöhten Vulnerabilität sowie unterschiedliche neurobiologische und behaviorale Phänotypen (4, 5, 6). Die soziale Herkunft und Schichtzugehörigkeit sowie psychosoziale Einflüsse, z.B. im Zusammenhang mit kriegsbedingten Traumatisierungen und Migration, spielen für das Verständnis der Entstehungsbedingungen und des Verlaufs psychischer Erkrankungen eine herausragende Rolle. Die Kenntnis der Populationszugehörigkeit ist eine conditio sine qua non für die Entwicklung einer personalisierten Medizin und einer personenzentrierten integrativen Diagnostik (7). Die Manifestation und der Verlauf psychischer Erkrankungen werden wesentlich durch die jeweilige Phase des Lebenszyklus geprägt. Denken, Fühlen und Handeln sind einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess unterworfen und äußern sich in den verschiedenen Perioden des Lebenszyklus unterschiedlich. Die Entwicklungspsychopathologie entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem integrativen und interdisziplinären Forschungsgebiet und wird als Bindeglied zwischen der Entwicklungsphysiologie, der Entwicklungsneurologie und der Entwicklungspsychologie betrachtet. Frühkindliche Erfahrungen und Lernprozesse ermöglichen die Ausbildung einer adaptiven neuronalen Netzwerkstruktur. Die Die Psychiatrie 1/2009 © Schattauer GmbH Downloaded from www.die-psychiatrie-online.de on 2017-08-22 | IP: 88.99.70.242 For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved. Prof. Franz MüllerSpahn, Basel 3 Zum Thema Notwendigkeit der psychosozialen Anpassung impliziert, eine „lebenslang zu erbringende Leistung, eine subjektiv akzeptable und sozial abgestimmte Antwort auf innere Reifungsvorgänge, einschneidende Lebenserfahrungen und soziale Anforderungen innerhalb eines aktuellen Entwicklungskontextes zu finden“ (2). Spezifische Temperamentsmerkmale sind für die Entwicklung psychischer Störungen maßgeblich verantwortlich (vgl. Beitrag von K. Schmeck und M. Schmid). Entscheidend für eine mögliche Entwicklung von Störungen sei, inwieweit Temperamentsmerkmale des Kindes und Anforderungen der Umwelt zueinander passten. So haben z.B. gehemmte Kinder mit erhöhtem physiologischem Arousal ein deutlich größeres Risiko als andere Kinder, eine emotionale Störung zu entwickeln. Die Interaktion zwischen kindlichen Temperamentsmerkmalen und mütterlichem Erziehungsverhalten gilt als wichtiger Prädiktor für die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten. Tiefgreifende Entwicklungsstörungen, wie z.B. Autismus oder auch das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, treten deutlich häufiger bei Jungen auf, Essstörungen, Depressionen und soziale Ängste mit Beginn in der Adoleszenz häufiger bei Mädchen. Traumatisierende Kindheitserlebnisse tragen erheblich zur Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung bei, Misshandlungen sind häufig mit Störungen der Bindungsfähigkeit, der Emotionsregulation sowie Insuffizienzgefühlen assoziiert. Der Beitrag von A. Karenberg befasst sich mit der Geschichte des Persönlichkeitsbegriffes. Die von Franz Josef Gall mit entwickelte Lokalisationslehre wird als erster Versuch einer differenziellen Psychologie und deren neuroanatomische Absicherung dargestellt. Protoformen heutiger Persönlichkeitskonzepte im Sinne einer Katalogisierung unabhängiger Variationen tauchten primär in der Psycho- pathologie und erst sekundär in der Psychologie auf. Abschließend formuliert Karenberg die provozierende Frage, inwieweit die „neuen“ Diagnosesysteme weitgehend als eklektische Reformulierungen älteren Gedankengutes erscheinen würden. Patienten mit somatischen Erkrankungen und psychischen Störungen stellen eine weitere Population innerhalb der Psychiatrie dar, die sich zum Teil sowohl phänomenologisch als auch ätiologisch von den klassischen psychischen Störungen unterscheiden (vgl. den Beitrag von P. Bartels et al.). Alkoholassoziierte Störungen sind nach den Anpassungsstörungen und den organischen Psychosyndromen die häufigsten psychischen Begleiterkrankungen bei Patienten, die aufgrund einer körperlichen Grunderkrankung in Allgemein-Krankenhäusern behandelt werden. Depressive Syndrome bei multimorbiden Patienten stellen eine besondere therapeutische Herausforderung dar. Die Kenntnis tradierter Wertnormen, religiöser Überzeugungen und ethnisch unterschiedlicher psychopathologischer Ausdrucksformen und Konfliktbewältigungsstile ist für die Gesamtbeurteilung der Pathogenese psychischer Erkrankungen unerlässlich. Die ethnische Herkunft und die mit Migrationsprozessen verbundenen psychosozialen Belastungen werden im klinischen Versorgungsalltag von Migranten noch unzureichend berücksichtigt (vgl. Beitrag von H. Assion und A. Weiss). So läge das Risiko für die Entwicklung einer Schizophrenie bei Migranten höher, auch erführen an Schizophrenie Erkrankte in Abhängigkeit von ihrer ethnischen oder rassischen Zugehörigkeit eine unterschiedliche psychopharmakologische Behandlung. Mangelnde Sprachkenntnisse erschwerten den Zugang zu psychiatrischen Versorgungssystemen und erhöhten den psychosozialen Stress. Untersuchungen in Großbritannien in den 1980erJahren zeigten besonders hohe Ein- Die Psychiatrie 1/2009 weisungsraten in psychiatrische Krankenhäuser aufgrund einer Schizophrenie unter Migranten mit afrokaribischer Herkunft. Neuere Untersuchungen ließen vermuten, dass das Risiko für eine Schizophrenie für Migranten der ersten Generation niedriger liegt als für Migranten der zweiten Generation, ebenfalls sei das Risiko geringer für Migranten aus höher entwickelten Herkunftsländern im Vergleich zu weniger entwickelten Ländern. Die Autoren resümierten abschließend, dass unabhängig von den biologischen Besonderheiten bestimmter Ethnien durch Migration bedingte Stressfaktoren zum Krankheitsausbruch der Schizophrenie beitragen. Somit gelten Migranten als Hochrisikogruppe für Schizophrenie. In diesem Zusammenhang werden drei Hypothesen zur Wechselwirkung von sozio-biologischen Faktoren diskutiert, nämlich die Selektionshypothese, die Akkulturation-Stress-Hypothese sowie das Diathese-Stressmodell. Ethnopharmakologische Aspekte der Schizophreniebehandlung wurden bisher wenig beachtet. Dabei ist gut belegt, dass Ethnizität das Verordnungsverhalten beeinflusst. Gleiches gilt auch für ethnische Unterschiede in der Metabolisierung von Psychopharmaka. Der Schlussfolgerung der Autoren, dass die Versorgung von Migranten mit psychischen Störungen auf vielen Ebenen ein „kultursensitives Vorgehen“ verlange, damit die Angebote auf einem chancengleichen Niveau für Einheimische lägen, ist voll zuzustimmen. Der Einfluss des Geschlechtes auf die Prävalenz psychischer Störungen, auf die Symptomausgestaltung, den Krankheitsverlauf, das Inanspruchnameverhalten psychiatrischer Versorgungsinstitutionen und die Therapieresponse ist seit Jahren Gegenstand intensiver wissenschaftlichen Untersuchungen. Geschlechtsunterschiede wurden darüber hinaus in vielen Bereichen der Neurobiologie und der Reagibilität auf Stress beobachtet. © Schattauer GmbH Downloaded from www.die-psychiatrie-online.de on 2017-08-22 | IP: 88.99.70.242 For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved. 4 Zum Thema Viele psychische Erkrankungen treten bei Frauen und Männern unterschiedlich häufig auf (vgl. Beitrag A. Riecher). So leiden Frauen z.B. häufiger als Männer an Essstörungen, Depressionen und Angststörungen, Männer dagegen häufiger an Suchterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen. Ungeachtet der speziellen geschlechtsspezifischen Bedürfnisse, die sich aus Unterschieden in Erkrankungshäufigkeit und -alter, im Krankheits- und Bewältigungsverhalten bzw. aufgrund biologischer Besonderheiten ergeben, sei eine geschlechtersensible Therapie immer noch ein vernachlässigtes Thema. Psychische Störungen nach Extrembelastungen in Zusammenhang mit weltweiten Naturkatastrophen, Kriegen und terroristischen Anschlägen rücken zunehmend mehr in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit (vgl. Beitrag von M. Graf et al.). Standardisierte psychologische Debriefingverfahren bei traumatisierten Personen werden hinsichtlich ihrer Wirksamkeit offensichtlich weit überschätzt. Neue Befunde weisen auf einen engen Zusammenhang zwischen neurobiologischen Veränderungen, wie z.B. Polymorphismen des Serotonin-Transporter-Gens, hippokampalen Dysfunktionen sowie Störungen der Stressachsenregulation und einem höheren Risiko für die Entwicklung belastungsreaktiver Störungen hin. Allen Autoren sei an dieser Stelle herzlich für ihre Beiträge gedankt. Univ.-Prof. Dr. F. Müller-Spahn Literatur 1. Kupfer DJ, First MB, Regier DA. A research agenda for DSM-V. Washington: American Psychiatric Association 2002. 2. Kapfhammer HP. Psychosoziale Entwicklung im jungen Erwachsenenalter. Entwicklungspsychopathologische Vergleichsstudien an psychiatrischen Patienten und seelisch gesunden Probanden. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1995. 3. Narrow W, First M, Sirovatka P, Regier A. Age and gender considerations in psychiatric diagnosis. Washington: American Psychiatric Association 2007. 4. Müller-Spahn F. Individualized preventive psychiatry: syndrome and vulnerability diagnostics. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008; 258 (Suppl 5): 92–97. 5. Van den Bergh B, Van Calster B et al. Antenatal maternal anxiety is related to HPA-axis dysregulation on self-reported depressive symptoms in adolescence: A prospective study on the fetal origins of depressed mood. Neuropsychopharmacology 2007; 1–10. 6. Canli T, Lesch K. Long story short: the serotonin transporter in emotion regulation and social cognition. Nat Neurosci 2007; 10: 1103–1109 7. Mezzich J, Salloum I. Clinical complexity and person-centered integrative diagnosis. World Psychiatry 2008; 7: 1–2. IN EIGENER SACHE Jahresregister Die Psychiatrie 2008 jetzt online Damit Sie sich einen Überblick über die im letzten Jahr in Die Psychiatrie publizierten Arbeiten verschaffen können, steht Ihnen das Jahresregister 2008 unter www.die-psychiatrie-online.de als pdf-Dokument zum kostenlosen Herunterladen zur Verfügung. Neben einem Autorenregister finden Sie die Beiträge nach Themengebieten geordnet, Schlüsselwörter bzw. Keywords erleichtern das Auffinden bestimmter Themen. Wie die Funktion „Zeitschriften durchsuchen“ erleichtert das Jahresregister Ihnen die Suche beim Recherchieren und Verfassen von Publikationen sowie das korrekte Zitieren. Die Psychiatrie 1/2009 © Schattauer GmbH Downloaded from www.die-psychiatrie-online.de on 2017-08-22 | IP: 88.99.70.242 For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.