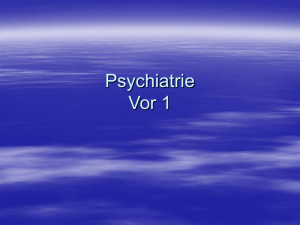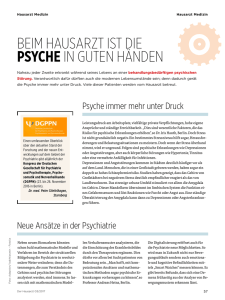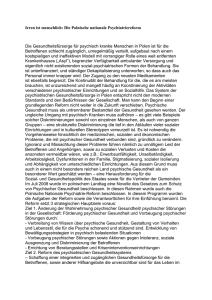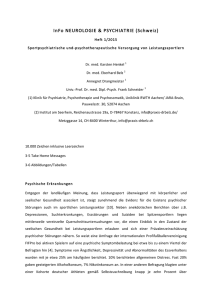Psychiater erklären Vorteile von Big Data bei psychischen
Werbung

Thema: Neurologie, Neurochirurgie & Psychiatrie 25.11.2016 | Deutsches Ärzteblatt Medienquelle: Internet Seitenstart: Online 25.11.2016, 17:52 Uhr Visits: 1.507.619 Anzahl der Zeichen: 4382 Psychiater erklären Vorteile von Big Data bei psychischen Erkrankungen Link zum Beitrag Ärzteschaft Berlin - Wissenschaftliche und methodische Innovationen, von denen psychisch kranke Patienten schon bald profitieren könnten, stehen beim Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN), der zurzeit in Berlin stattfindet, unter anderem im Fokus. "Neue mathematische Methoden erlauben es zum Beispiel, die Einschätzung des Krankheitsbildes durch Eindrücke und Beobachtungen der Therapeuten mit Verhaltensanalysen zu ergänzen: Auf diesem Weg lassen sich etwa Verhaltensmuster identifizieren, welche bei der Entwicklung und beim Fortbestehen von Suchterkrankungen eine wichtige Rolle spielen", erklärte DGPPNVorstandsmitglied Andreas Heinz, Professor an der Charité in Berlin. Die Weiterentwicklung von Verhaltensanalysen ist nur einer von vielen Ansätzen in der Psychiatrieforschung. Vielversprechend seien auch die aktuellen Erkenntnisse im Bereich der Biomarker und strukturellen Bildgebung, die das Potenzial besitzen, das Verständnis und die Vorhersagbarkeit psychischer Erkrankungen entscheidend zu verbessern. Psychiatrieforschung finde nicht nur im Labor statt. Immer stärker stehe auch die Befindlichkeit der Betroffenen in der realen Lebenswelt und im Langzeitverlauf im Fokus. "Hierzu eröffnen sich neue und vielversprechende Möglichkeiten - zum Beispiel durch die Tatsache, dass inzwischen nahezu jeder Patient ein Smartphone besitzt, über das sich seine emotionale und kognitive Befindlichkeit messen lässt", berichtete Heinz. Deutsches Ärzteblatt print Über die Vorteile von Big Data im Einsatz für die psychische Gesundheit berichtete Andreas Meyer-Lindenberg, Direktor des Zentralinstituts (ZI) für Seelische Gesundheit in Mannheim. "Die Datenmengen, die zum Verständnis des Gehirns und psychischer Störungen analysiert werden müssen, sind immens und verlangen einen massiven Ausbau der IT-Infrastruktur in den Kliniken", schickte er voraus. Eine Hirnbildgebungsstudie allein könne in einer Sitzung beispielsweise mehr als ein Terabyte Daten generieren. Genetische und epigenetische Daten und Ergebnisse der sogenannten Omics-Verfahren könnten ähnliche Größenordnungen erreichen. Künstliche Intelligenz zur Identifikation psychischer Erkrankungen "Inzwischen ist es möglich, in diesen riesigen Datenmengen mit selbsttrainierenden Algorithmen durch "deep learning" oder künstliche Intelligenz Muster zu entdecken, die sich zur Identifikation psychischer Erkrankungen nutzen lassen", erklärte MeyerLindenberg, "und perspektivisch auch zur präziseren Auswahl von Therapien". Durch die Fähigkeiten von Smartphones, den Besitzer genau zu lokalisieren und seine Bewegungsaktivitäten zu messen, würden sich für die Medizin ganz neue Möglichkeiten ergeben. "In Zukunft wird es wahrscheinlich auch möglich sein, die emotionale und kognitive Befindlichkeit eines Patienten zu messen", sagte der ZI-Direktor. So gebe es beispielsweise bereits Befunde, die nahelegten, dass sich eine neu beginnende manische Episode bei einer bipolaren Störung in zunehmenden SMS und Telefonanrufen des Betroffenen zeige. -47- E-Mental-Health: "Die Weichen sind gestellt" Online-Psychotherapie: Sinnvoll nur als Ergänzung aerzteblatt.de E-Mental-Health: Klare Qualitätsstandards notwendig App für traumatisierte Bundeswehrsoldaten Über sogenannte Feedback-Apps könnte den Patienten gesundheitsschädigendes Verhalten zurückgespiegelt werden. Andreas Heinz gab das Beispiel eines Alkoholabhängigen, der sich nach der Entzugsbehandlung in der Nähe einer Gaststätte aufhalte: "Mittels eines Signals oder einer SMS könnten wir ihn womöglich von einem Rückfall abhalten." Neue Ansätze in der Forschungsförderung notwendig Aus Sicht der DGPPN sind in der Forschungsförderung dringend neue Ansätze notwendig. "Mit den Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung (DZG) hat die Bundesregierung ein Instrument geschaffen, das sich zur strukturellen Förderung auch im Bereich der psychischen Gesundheit eignet. Die Psychiatrie und Psychotherapie habe in der gegenwärtigen Förderperiode nicht zu den Themenfeldern gehört. "Hier muss die Regierung in der nächsten Phase der Förderung unbedingt eine Kurskorrektur vornehmen und ein Deutsches Zentrum für psychische Erkrankungen (DZP) als vernetzte Struktur mehrerer Standorte einrichten", forderte Meyer-Lindenberg. © PB/aerzteblatt.de