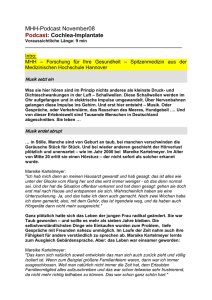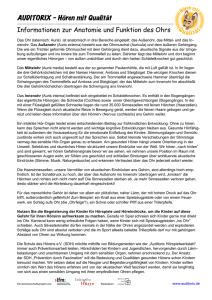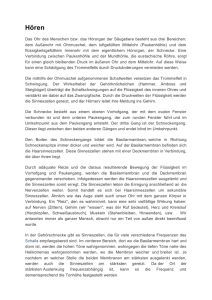Professor Dr. Thomas Lenarz Leiter der HNO
Werbung

Sendung vom 8.3.2017, 20.15 Uhr Professor Dr. Thomas Lenarz Leiter der HNO-Abteilung Medizinische Hochschule Hannover Deutsches HörZentrum im Gespräch mit Antje Maly-Samiralow Maly-Samiralow: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum alpha-Forum. Dass Sie hier aufmerksam zuhören, wenn Sie uns eingeschaltet haben, davon gehe ich aus, aber heute wollte ich Sie bitten, noch ein ganz klein wenig aufmerksamer zuzuhören, vor allem dann, wenn Sie nicht gut hören. Denn bei uns geht es heute um gutes oder weniger gutes Hören und um die Frage, was man tun kann, wenn Letzteres zutrifft. Dazu begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Gast Professor Thomas Lenarz. Herr Lenarz, Sie sind der Leiter der HNO-Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover und spezialisiert auf die Implantologietechnik insbesondere der Cochlea-Implantate. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Ich habe auf Ihrer Homepage die Zahl gelesen, dass alleine in Deutschland 15 Millionen Menschen eine behandlungsbedürftige Schwerhörigkeit haben. Das ist eine große Zahl, die mich zumindest zunächst ratlos zurücklässt. Was heißt denn "behandlungsbedürftig" im Zusammenhang mit Schwerhörigkeit bzw. Hörbehinderung? Lenarz: Das bedeutet, dass diese Menschen eine Einschränkung ihrer Hörfähigkeit haben im Hinblick auf das Sprachverstehen. Das heißt, sie bekommen im Alltag in verschiedenen Situationen nicht mehr alles mit. Demzufolge müssen sie nachfragen oder sich in irgendeiner Form anders damit arrangieren. Man kann also sagen, sie können nicht mehr normal am Alltagsleben teilnehmen. Maly-Samiralow: Wir sprechen damit von einem Siebtel oder einem Achtel der Bevölkerung bei uns in Deutschland: Das sind doch relativ viele Menschen. Sind das vor allem Erwachsene im fortgeschrittenen Alter, d. h. sprechen wir hier von erworbener Hörschädigung? Oder sprechen wir hier eher von einer angeborenen Hörschädigung? Lenarz: Die Mehrzahl sind Erwachsene, denn mit zunehmendem Alter nimmt die Zahl der Betroffenen und damit auch der Prozentsatz in der Bevölkerung zu: Das Gehör nutzt sich sozusagen ab. Aber die Schwerhörigkeit ist etwas, das es in allen Lebensaltern gibt, also auch bei Kindern, bei Neugeborenen: aufgrund verschiedener Einflüsse während der Geburt, aber auch aufgrund genetischer Ursachen, d. h. dass man von Geburt an schwerhörig ist. Im Lauf des Lebens können selbstverständlich auch verschiedene Einflüsse hinzukommen, die zu Schwerhörigkeit führen: Unfälle, Infektionskrankheiten, bestimmte Medikamente usw. Neben dem Alter wirkt sich vor allem Lärm als Ursache für Schwerhörigkeit aus: Das ist die Schädigung des Gehörs durch zu laute Schallereignisse. Maly-Samiralow: Wie hoch würden Sie denn die Lautstärke jetzt gerade in unserer Kommunikation einschätzen? Bei wie viel Dezibel liegen wir da ungefähr? Lenarz: Das sind ungefähr 60 Dezibel, die Umgangslautstärke. Maly-Samiralow: Bis zu welcher Dezibelzahl halten Sie ein gutes Verstehen noch für möglich? Lenarz: Sie meinen das vom Hörverlust her? Maly-Samiralow: Ja. Lenarz: Bis zu 30 Dezibel kann man das ganz gut kompensieren. Maly-Samiralow: Durch Hörgeräte? Lenarz: Nein, auch so, ohne Geräte. Wenn wir normal sprechen und Sie hätten meinetwegen einen geringgradigen Hörverlust, könnten Sie das in ruhiger Umgebung weitgehend durch aufmerksames Zuhören ausgleichen. Sie müssen sich dabei zwar mehr anstrengen, aber Sie bekommen das Gespräch noch mit. In dem Moment, in dem diese ruhige Situation jedoch nicht mehr gegeben ist, wenn also viele Menschen durcheinander sprechen oder wenn es ein Umgebungsgeräusch wie meinetwegen Straßenlärm usw. gibt, würde das bereits nicht mehr funktionieren. In dieser Situation bräuchte jemand, der einen solchen Hörverlust hat, bereits eine Verstärkung. Das heißt, ich müsste lauter sprechen, damit Sie mich noch verstehen können. Maly-Samiralow: Bleiben wir doch zunächst einmal bei normalen Hörgeräten. Diese verstärken ja das akustische Signal, das noch wahrgenommen werden kann – je nachdem, in welchem Frequenzbereich man möglicherweise Defizite hat. Diese Geräte sind heute so ausgelegt, dass man das wohl ganz gut einstellen kann. Lenarz: Richtig. Maly-Samiralow: Ab wann empfehlen Sie denn Hörgeräte? Lenarz: Wir empfehlen immer dann ein Hörgerät, wenn ein Mensch nicht mehr in der Lage ist, z. B. Frauenstimmen gut zu hören. Denn Frauenstimmen sind höherfrequent und die meisten Schwierigkeiten treten eben in den hohen Frequenzen auf. Die Fähigkeit, hohe Frequenzen zu hören, nimmt einfach im Laufe des Lebens ab. Maly-Samiralow: Woher kommt das? Lenarz: Weil das Gehör in diesem Bereich empfindlicher ist. Es gibt im Ohr eine Art Aufteilung der gehörten Töne: Der gesamte Schall muss immer erst über die Bereiche laufen, in denen die hohen Töne im Ohr sozusagen repräsentiert sind. Das heißt, diese Bereiche werden definitiv mehr beansprucht und dadurch kommt es auch zu einer schnelleren Abnutzung. Wir haben bei der Geburt jedoch eine große Reserve: Wir können da ganz hohe Töne hören, die wir im Prinzip im Alltag oder auch für das Musikhören gar nicht brauchen. Diese Fähigkeit nimmt im Laufe des Lebens dann immer mehr ab, d. h. der Hörverlust verschiebt sich dann immer mehr in den Bereich, den wir für das Sprachverstehen und auch für das Musikhören – wenn wir jetzt mal an etwas Schönes denken – benötigen. Irgendwann macht sich das dann einfach bemerkbar. In welchem Alter das passiert, ist jedoch unterschiedlich. Es gibt Menschen, bei denen das relativ früh einsetzt, während dieser Hörverlust bei anderen noch bis ins hohe Lebensalter nur relativ gering ausgeprägt ist; es gibt auch 80-Jährige, die hier vergleichsweise geringe Probleme haben. Die Menschen weisen eine stark unterschiedliche Empfindlichkeit auf, was die Abnahme des Hörvermögens betrifft. Maly-Samiralow: Bei anderen Sinneseindrücken ist das ja ähnlich. Wir beide tragen eine Brille, andere Menschen brauchen selbst im hohen Alter keine. Aber klar ist, dass in der Regel die Sehfähigkeit mit zunehmendem Alter abnimmt. Man kann aber auch bereits mit einer Sehschädigung geboren werden. Lenarz: So ist es. Hier kommen eben verschiedene Einflüsse zum Tragen: Wie viel Lärm hat man im Laufe des Lebens abbekommen? Denn die Lebenslärmbilanz ist sozusagen vorgegeben. Es gibt aber auch verschiedene Krankheiten, die einen Einfluss auf unser Gehör ausüben: Stoffwechselstörungen, Bluthochdruck usw. Ein wesentliches Moment bei all dem ist jedoch die genetische Ausstattung. Es gibt sehr viele Gene, die mit dem Hören zusammenhängen. Manche dieser Gendefekte führen ganz drastisch zu einer Taubheit oder zu einem hochgradigen Hörverlust, der bereits bei der Geburt vorhanden ist oder sich innerhalb der ersten Lebensjahre bemerkbar macht. Aber auch für die Resistenz gegenüber Lärm z. B. gibt es eine genetische Grundlage. Manche Menschen werden daher durch Lärm eher und stärker geschädigt als andere. Maly-Samiralow: Lärm per se ist ja auch ein Stressparameter, d. h. das Gehirn muss all diese akustischen Reize verarbeiten. Wenn man schlechter hört, dann muss man sich mehr konzentrieren und alle Hintergrundgeräusche lösen dann sozusagen per definitionem Stress aus, weil man diese nämlich herausfiltern muss. Lenarz: Das ist richtig. Maly-Samiralow: Wir leben mittlerweile leider Gottes in einer Welt, in der es fast nirgends mehr ruhig ist. Selbst im stillsten Wäldchen kann es einem passieren, dass über einem eine Drohne schwebt: Da ist es dann aus mit der Ruhe. Das ist eine Tendenz, mit der wir zwangsläufig leben müssen. Was empfehlen Sie denn grundsätzlich den Menschen – nicht nur Patienten, sondern überhaupt –, wie sie sich vor Lärm schützen können? Ich nenne hier nur mal das Stichwort "Kopfhörer", die bei der jungen Generation ja enorm beliebt sind. Lenarz: Genauso ist es. Wir brauchen im Prinzip auch Lärmpausen bzw. Geräuschpausen, wenn ich das mal so sagen darf, damit sich das Ohr erholen kann und wir unser Sinnessystem schärfen können. Diese Lärmpausen sind deshalb wichtig, weil dadurch die Sinneszellen die Chance haben, ihren Stoffwechsel gewissermaßen wieder zu bereinigen. Maly-Samiralow: Sie brauchen die Pause, um regenerieren zu können? Lenarz: Ja, um zu regenerieren. Bei sehr lauten Ereignissen gibt es im Ohr nicht nur eine mechanische Schädigung in dem Sinne, dass diese Sinneszellen, dass diese Haarzellen – sie werden so genannt, weil sie so kleine Härchen haben, die durch die Schallwellen umgebogen werden – verletzt werden, wodurch dann ein Problem beim Hören eintritt. Der eigentliche Grund für die Schwerhörigkeit aufgrund sehr lauter Ereignisse ist jedoch ein anderer: Das Ohr braucht sehr viel Energie für das Hören. Im Ohr sind Sinneszellen vorhanden, die die eingehenden Schallwellen sortieren. Manche der eingehenden Schallwellen werden verstärkt und andere bewusst abgedämpft. Das verbraucht sehr viel Energie: In Relation zum Gewicht des Ohres sind das diejenigen Zellen des menschlichen Körpers, die den höchsten Energiebedarf haben. Man kann sich nun gut vorstellen, dass diese Sinneszellen bei Lärm sehr stark beansprucht werden: Sie verbrauchen dabei sehr viel Sauerstoff und kommen dann auch in einen Stoffwechsel, den man anaerob nennt, d. h. der Sauerstoff alleine reicht nicht mehr als Energiequelle und diese Sinneszellen müssen daher auf andere, zusätzliche Energiequellen umschalten. Bei diesen anderen, zusätzlichen Energiequellen entstehen aber gefährliche Produkte, nämlich sogenannte freie Radikale. Wenn sich nun diese freien Radikalen im Ohr anhäufen und es keine Lärmpausen gibt, in denen diese wieder beseitigt werden können, dann führen die freien Radikalen zu bleibenden Schäden an diesen Sinneszellen: Deren Membranen werden geschädigt und auf diese Weise sterben diese Zellen z. T. auch ab oder werden irreversibel in ihrer Funktion beeinträchtigt. Maly-Samiralow: Für die Ohren gilt also das, was auch für alle anderen Organe des menschlichen Körpers gilt: Man sollte sie nicht überbeanspruchen, weil sonst schlicht und ergreifend ihre Reserven ausgebeutet werden und sie letztlich Schaden nehmen. Lenarz: Richtig, so kann man sich das vorstellen und es ist auch so. Wenn man in einem Konzert oder in der Diskothek gewesen ist, hat man hinterher schon mal das Gefühl, dass man alles nur noch so leicht gedämpft hört. Am nächsten Morgen ist dieses Gefühl dann jedoch schon wieder weg. Diese Erfahrung haben sicherlich schon sehr viele Menschen gemacht. Wenn die Lärmpause aber nicht ausreichend lange andauert, dann summiert sich das sozusagen auf und man bekommt einen dauerhaften Lärmschaden, der nicht mehr verschwindet. Maly-Samiralow: Haben Sie denn in den vielen Jahren und Jahrzehnten, in denen Sie als HNO-Arzt tätig sind, die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die eine Hörschädigung haben, immer jünger werden? Denn seit beinahe 40 Jahren gibt es da ja ein bestimmtes Phänomen: Angefangen hat es damals mit dem Walkman und heute gibt es auf diesem Gebiet ganz neue Techniken, aber das Resultat ist, dass sich heutzutage die jungen Leute in der Öffentlichkeit mehrheitlich mit Stöpseln im Ohr bewegen. Lenarz: Ja, es gibt so etwas wie eine Verlagerung des Alters nach vorne, in dem Hörschäden eintreten: Das heißt, die Menschen, bei denen Probleme mit dem Gehör einsetzen, werden jünger. Das hat sicherlich mit dem zivilisatorischen Lärm zu tun. Aber das muss man natürlich auch differenziert betrachten, denn es gibt ja auch Lärmarbeiter, Personen also, die in ihrem Beruf ganz einfach Lärm ausgesetzt sind. In früheren Jahren war diese berufsbedingte Lärmschwerhörigkeit stärker ausgeprägt, und zwar schlicht deswegen, weil die Schutzmaßnahmen sehr viel schwächer waren. Es gab darüber hinaus auch viel mehr Berufe mit einer sehr starken Lärmexposition. Denken Sie an die Männer, die in den Bergwerken gearbeitet haben oder an Kesselschmiede … Maly-Samiralow: … beim Straßenbau … Lenarz: Genau, diese Berufe waren mit sehr großem Lärm verbunden. Aber durch das konsequente Einführen von Lärmschutzmaßnahmen … Maly-Samiralow: … Lehrer fallen mir da noch an. Lenarz: Ja, auch die, ebenso die Orchestermusiker, denn bei denen ist es natürlich ganz schwierig, eine Prophylaxe zu machen. Maly-Samiralow: Der Mann neben der Pauke! Lenarz: Ja, das ist ganz schwierig. Das sind jedenfalls alles Berufe, in denen klar ist, dass eine berufsbedingte Lärmschwerhörigkeit auftritt bzw. auftreten kann. Dies muss man aber unterscheiden vom Zivilisationslärm, dem wir uns zunehmend aussetzen. Wir haben ja um uns herum einen permanenten Lärmteppich, wie Sie bereits erwähnt haben. Das summiert sich auf und es gibt, wie wir das nennen, eine Lebenslärmbilanz: Das heißt, man hat einen bestimmten Vorrat, und in der Zeit kann man Lärm gut ab, ohne dass etwas passiert. Aber wenn dieser Vorrat aufgebraucht ist, setzt eben diese Lärmschwerhörigkeit ein. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Ja, es ist so, dass das heute früher der Fall ist. Das Alter, in dem heute Schwerhörigkeit auftritt, ist also im Vergleich zu früher nach vorne verlagert. Maly-Samiralow: Wir sprechen ja jetzt vom Ohr als solchem, das à la longue geschädigt werden kann. Aber das Gehirn braucht ja auch immer wieder Ruhepausen: Nach einem Input muss immer wieder eine Ruhepause einsetzen, damit die Informationen verarbeitet werden können und das Gehirn regenerieren kann, oder? Das sind sozusagen zwei Baustellen: nicht nur das Gehör, sondern auch die Hirnleistung. Lenarz: Das ist richtig. Das Gehörte ist ja sozusagen ein Informationsfluss, der verarbeitet werden muss im Gehirn. Es ist so, dass das Hören im Gehirn eine sehr große Bedeutung hat: Praktisch alle Hirnanteile sind mit dem Ohr verbunden. Das zeigt eben auch, welche Bedeutung das Hören für die menschliche Kommunikation, für die Emotionen, aber auch für die Anregungen der Hirnfunktion insgesamt hat. Aus diesem Grund braucht das Gehirn eben auch diesbezüglich seine Pausen, um das Gehörte verarbeiten zu können. Umgekehrt heißt das aber auch: Wenn man schlecht hört, leidet auch die allgemeine Hirnaktivität darunter. Das heißt, hier gibt es einen wichtigen Zusammenhang. Bei Kindern, die mit einer Schwerhörigkeit geboren werden, geht es hier natürlich um die Sprachentwickelung. Wenn ein Kind taub ist, dann findet die Sprachentwicklung zunächst einmal nicht so statt, wie man sie normalerweise kennt. Deswegen muss man versuchen, möglichst früh das Hören sozusagen herzustellen, damit diese stattfinden kann. Bei Erwachsenen ist es so, dass wir mittlerweile doch sehr viele Belege dafür haben, dass Schwerhörigkeit mit Demenz verbunden sein kann. Maly-Samiralow: Ist es so? Lenarz: Ja, das ist so. Das heißt, der Zeitpunkt, an dem sich eine Demenz bemerkbar macht, liegt bei schwerhörigen Personen deutlich früher als bei Personen, die ein ausreichendes Hörvermögen haben. Andersherum heißt das aber auch: Wenn man die Schwerhörigkeit therapiert, kann man dadurch zumindest einen positiven Einfluss auf diese Demenzentwicklung nehmen. Maly-Samiralow: Heißt das, dass bestimmte Areale im Gehirn einfach nicht mehr angesteuert werden und dementsprechend atrophieren, wenn man schwerhörig ist? Wie muss man sich das vorstellen? Lenarz: Es ist wohl so, dass ein bestimmtes Aktivitätsniveau durch den Input, also durch das, was reinkommt … Maly-Samiralow: Sie meinen den akustischen Input? Lenarz: Ja, durch den akustischen Input wird immer ein bestimmtes Aktivitätsniveau angeregt. Diese Aktivitätsanregung läuft in unserem Gehirn ganz automatisch ab. Diejenigen, die normal hören, machen sich dazu überhaupt keine Gedanken – und müssen sich darüber auch keine machen. Aber das ist eben etwas, das dann nicht mehr so selbstverständlich ist, wenn eben nicht mehr alles gehört wird oder wenn, was sehr häufig der Fall ist, jemand, der schwerhörig ist, sich aus bestimmten Situationen zurückzieht, weil er das rein akustisch nicht mehr verstehen kann. Maly-Samiralow: Das heißt, so jemand begibt sich in die Isolation. Lenarz: Genau. Maly-Samiralow: So jemand begibt sich also letztlich auch in die soziale Isolation. Lenarz: Ja, und so jemand verringert dann auch noch durch das eigene Verhalten diesen Input zusätzlich. Dies hat dann eine Folge von Effekten, die letzten Endes wahrscheinlich auch zu einer früheren Entwicklung von Demenz führen können. Maly-Samiralow: Kommen wir kurz zu Ihrer Person: Sie haben in Erlangen, Tübingen und Heidelberg Medizin studiert und waren während des Studiums auch kurze Zeit in London. Mit 36 Jahren wurden Sie als einer der jüngsten Professoren für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde an die Universität in Hannover berufen. Sie haben dort, aufbauend auf die Arbeit Ihres Vorgängers, das "Cochlear Implant Centrum" auf- und ausgebaut. Heute ist das eines der größten Zentren dieser Art auf der Welt. Ist es das Größte überhaupt? Lenarz: Wir sagen immer, wir sind das weltgrößte Zentrum dafür – aber gut, wir wissen nicht so genau, was China macht auf diesem Gebiet. Maly-Samiralow: Sind wir also ein bisschen bescheiden und sagen, dass es eines der weltweit größten Zentren auf diesem Gebiet ist. Wie kam es dazu, woher kam bei Ihnen das Interesse dafür und welcher Art waren die Vorarbeiten? Lenarz: Ich hatte schon seit Längerem ein Interesse am Hörbereich. Angefangen habe ich mit HNO 1981, habe mich aber schon während des Studiums mit der Physiologie des Hörens beschäftigt. In Erlangen gab es damals schon einen Schwerpunkt für Hörforschung. Ich habe dann auch meine Promotion in diesem Bereich gemacht. Es war so, dass für mich meine Station in Tübingen entscheidend gewesen ist; dort gibt es ja bis heute ebenfalls einen Schwerpunkt für Hörforschung. Ich konnte dort meine Erkenntnisse systematisch vom Labor zum Patienten übertragen. Ich war dann einer der Wenigen, der sich schon sehr früh mit dem CochleaImplantat beschäftigt hat, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Grundlagen, sondern eben auch im Hinblick auf die Klinik. Ich war dann noch zwei Jahre in San Franzisco in einem Forschungslabor, das sich nur mit Hören beschäftigt. Dort habe ich einige experimentelle Grundlagen für Cochlea-Implantate mit erforschen können. All das zusammengenommen hat dann dazu geführt, dass ich letztlich für diese Position in Hannover qualifiziert war. Mein Vorgänger hatte dort ein Cochlear-Implant-Program aufgebaut, denn er hatte sehr früh erkannt, dass es eben darum geht, für die Patienten, die gar nichts hören, entsprechende Strukturen zu schaffen. Man muss sie vorher untersuchen, um herauszufinden, ob sie geeignet sind. Denn es geht ja darum, dass diese Cochlea-Implantate das Hören nicht komplett wieder herstellen, sondern sie müssen auf den einzelnen Patienten eingestellt werden; man muss mit den Patienten das Hören üben usw. Er hat daraus also ein Programm gemacht: zunächst nur für Erwachsene, dann aber auch für Kinder. Das war sozusagen die Basis, auf der das dann weiter ausgebaut werden konnte. Dieses Programm war damals bereits führend in Deutschland und auch in Europa, d. h. das war eine Ausgangssituation, die natürlich sehr gut ist, wenn man etwas aufbauen kann und will, das ein Gebiet praktisch komplett verändert. Maly-Samiralow: Wir sprechen ja jetzt bereits vom Cochlea-Implantat, aber die meisten unserer Zuschauer werden wahrscheinlich gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Die Cochlea ist die Hörschnecke, die durch dieses Implantat quasi imitiert wird. Lenarz: Richtig. Maly-Samiralow: Sie haben uns ja ein bisschen was mitgebracht. Könnten Sie mir an diesem Modell vielleicht zeigen und erklären, wie gesundes Hören im Normalfall funktioniert, was gestört ist im Fall einer Schwerhörigkeit – wobei natürlich klar ist, dass das unterschiedliche Gründe sind – und wo dann so ein Implantat platziert wird? Lenarz: Dann will ich mal versuchen, das an diesem Modell eines Ohres darzustellen (erläutert das Folgende mithilfe eines Querschnittmodells des Ohrs). Das, was wir außen als Ohr sehen, ist ja nur die Ohrmuschel und der Eingang in den Gehörgang: Das ist der Schalltrichter, der den Schall aufnimmt. Der Schall wird im Gehörgang weitergeleitet, bis er hier zum Trommelfell kommt. Das Trommelfell ist einfach nur eine schwingende Membran. Die Schwingungen werden über kleine Knöchelchen, nämlich über die Gehörknöchelchen, in das Innenohr, die Hörschnecke weitergeleitet. Maly-Samiralow: Die Hörschnecke heißt Cochlea. Lenarz: Genau. Hier daneben gibt es noch das Gleichgewichtsorgan, das an dem Ganzen mit dranhängt, aber das wollen wir momentan nicht weiter betrachten. Es ist so, dass dann in diesem Innenohr der eingehende Schall letztlich in Nerveninformationen umgesetzt wird. Das Innenohr ist also, wenn man so will, ein Mikrofon: Es nimmt Schall auf und macht daraus Strom. Dieser Strom wird dann über den Hörnerv zum Gehirn geleitet. Maly-Samiralow: Welche Rolle spielen dabei die Haarzellen? Lenarz: Die Haarzellen sind im Prinzip diese sogenannten Mechanotransduktoren, d. h. diese Sinneszellen sind in der Lage, die Schallwellen aufzunehmen, denn sie haben so kleine Härchen, weswegen sie, wie gesagt, als Haarzellen bezeichnet werden. Diese Härchen werden durch die Schallwellen bewegt und das löst wiederum in diesen Sinneszellen elektrische Ströme aus. Man muss sich das ungefähr so vorstellen: Diese Sinneszellen schwimmen in einer elektrisch geladenen Salzlösung und wenn sich die Härchen in eine Richtung bewegen, dann wandern Ladungsträger, sogenannte Ionen, in die Zelle ein. Dies führt zur Erzeugung einer Spannung, die wiederum die Hörnervenfasern stimuliert. Dieser Hörnerv ist so etwas wie ein Kabel, das einfach die Information zum Gehirn weitergibt. Im Gehirn befinden sich verschiedene Analysestationen, die letzten Endes bis zum bewussten Hören führen. Maly-Samiralow: Die Interpretation findet dann im Gehirn statt. Lenarz: Genau. Sie müssen sich das so vorstellen: Das sind Hochleistungsrechner, die eine Mustererkennung durchführen und einen Abgleich mit dem vornehmen, was in unserem großen Hörspeicher vorhanden ist. Auf diese Weise können wir z. B. erkennen, was gesprochen wurde, oder wir können Musik wiedererkennen usw. Wenn Sie so wollen, ist das Ohr also ein biologisches Mikrofon. Der Apparat davor, also alles von der Ohrmuschel bis zum Trommelfell, dient einfach nur dazu, dem Innenohr den Schall möglichst optimal zuzuleiten. Sie haben ja vorhin die Zahl genannt: Es gibt in Deutschland etwa zwölf Millionen Menschen, die eine Innenohrschwerhörigkeit haben. Diese Sinneszellen sind nämlich sehr empfindlich, d. h. sie können durch die vorhin genannten Ursachen geschädigt werden. Maly-Samiralow: Auch durch Virusinfektionen, Unfälle usw. Lenarz: Genau. Vor dem Innenohr gibt es natürlich auch Schwerhörigkeiten. Das sind Schwerhörigkeiten, die mit dem Mittelohr zu tun haben und weniger mit dem Gehörgang. Das Mittelohr ist anfällig gegenüber Entzündungen: Das fängt bei Kindern ja schon an, das gibt es aber auch bei Erwachsenen. Durch Entzündungen kann es zur Zerstörung des Trommelfells oder der Gehörknöchelchen kommen. Das führt dann dazu, dass der Schall nicht mehr so laut wahrgenommen wird: Er wird dem Innenohr weniger intensiv zugeleitet. Aber man ist dadurch nicht taub, man besitzt dann immer noch eine Hörfähigkeit, wenn auch eine verminderte. Maly-Samiralow: Und würde nun ein Hörgerät als verstärkendes Element Sinn machen? Lenarz: Ja, man kann den eintretenden Schall durch ein Hörgerät schlicht lauter machen. Dadurch würde man diese Blockade in der Schallleitung überwinden. Oder man kann durch Operationen das Trommelfell reparieren oder die Gehörknöchelchen ersetzen. Im Innenohr ist das anders. Die Sinneszellen des Innenohrs wachsen, wenn sie geschädigt sind, nicht mehr nach. Das heißt, da gibt es keine Regeneration. Wir Menschen haben bei der Geburt diesbezüglich eine Einmal-Ausstattung, die ein ganzes Leben lang reichen muss. Das sind pro Ohr jedoch nur ungefähr 30000 Zellen, das ist nicht so viel. Maly-Samiralow: Das sind diese Haarzellen? Lenarz: Genau. Diese Haarzellen müssen daher geschont werden, wenn man das so sagen darf, denn sie wachsen nicht nach. Wenn die Sinneszellen nur zum Teil geschädigt sind, dann kann man z. B. ebenfalls durch ein Hörgerät nachhelfen. Wenn die hohen Frequenzen schlechter gehört werden, kann man diese durch ein Hörgerät entsprechend anheben in der Lautstärke und dadurch wieder hörbar machen. Wenn jedoch das Ausmaß der Schädigung sehr groß ist, weil nur noch wenige Sinneszellen übrig sind oder weil jemand zwar noch etwas hört, das Gehörte aber nicht mehr versteht, dann ist die Grenze einer mechanischen, einer akustischen Verstärkung erreicht. Denn das, was das Innenohr macht, ist ja nicht nur, dass der dort ankommende Schall einfach nur so in Nerveninformationen übersetzt wird. Stattdessen ist das Innenohr ein Frequenzanalysator, d. h. die einzelnen Tonhöhen werden im Ohr an verschiedenen Stellen so verstärkt, dass dann die dort zugehörigen Nervenfasern – man muss sich das so vorstellen, dass an jeder Sinneszelle quasi ein Kabel dranhängt – genau angesteuert werden: Für jede Frequenz gibt es genau einen Ort im Innenohr, der dafür sozusagen optimal ausgestattet ist. Wenn in diesen Sinneszellen beispielsweise Lücken sind, dann würde man eben bestimmte Tonhöhen nicht mehr hören: Sie fehlen dann einfach. Wenn ein Schallmuster jedoch lückenhaft ist, dann klingt das nicht mehr gut und ist vor allem auch nur mehr schwer zu erkennen. Ich habe hier noch etwas mitgebracht, um zu zeigen, wie groß bzw. wie klein das Ganze eigentlich ist. Das, was hier eingegossen ist, sind zwei echte menschliche Innenohren. Maly-Samiralow: Bei der Geburt sind wir damit bereits in deren endgültiger Größe ausgestattet, d. h. die Innenohren wachsen nicht mehr. Lenarz: Genau. Das Interessante ist, dass das Innenohr praktisch schon vor der Geburt seine endgültige Größe hat. Wir hören bereits vor der Geburt im Mutterleib, so etwa ab der 25. Woche. Das Innenohr ist also bei der Geburt praktisch schon voll ausgewachsen, voll funktionstüchtig. Das hat sicherlich den Grund, dass das Gehör möglichst frühzeitig den Kontakt zur Außenwelt herstellen soll, und zwar noch früher als das Auge. Maly-Samiralow: So viel gibt es im Mutterleib ja auch nicht zu sehen, d. h. da würde ein gutes Auge keinen Sinn machen. Lenarz: Stimmt, da ist alles dunkel. Aber hören kann man bereits einiges. Ich habe diese echten Innenohren mitgebracht, damit man mal die Dimensionen sieht, in denen sich das Ganze abspielt. Die Empfindlichkeit der Sinneszellen ist extrem. Man muss sich vorstellen, dass sich in einer Flüssigkeit Moleküle bewegen – die kleinsten chemischen Einheiten sind Moleküle –, und dass dieses Molekülrauschen gerade nicht gehört wird: Die Auslenkung dieser Sinneshärchen an den Sinneszellen muss nur 10 hoch minus acht Meter betragen – das ist der Durchmesser eines Wasserstoffatoms, d. h. das ist etwas unglaublich Kleines, mit dem wir alle eigentlich nichts anfangen können –, um wahrgenommen zu werden. Auf der anderen Seite kann aber unser Ohr einen millionenfach höheren Schallpegel ebenfalls sofort wahrnehmen, ohne dass da eine lange Zeit der Wahrnehmung und "Berechnung" vergehen müsste: Der Schall kann sozusagen ohne Zeitverzug wahrgenommen werden. Und wir können mit diesem Innenohr sehr gut und sehr schnell sich ändernde Schallsignale analysieren. Das ist die Grundlage für Spracherkennen, denn Sprache ist ja nicht ein konstanter Ton, sondern es wechseln sich ständig verschiedenste Töne, Lautstärken usw. ab. Und diese Analyse beherrscht unser Ohr eben sehr gut: Es ist ein, wie man wohl sagen kann, sehr schnelles Sinnesorgan. Maly-Samiralow: Sie haben uns ja ein paar Cochlea-Implantate mitgebracht. Können Sie mir am Beispiel von einem dieser Implantate erklären, wo es angebracht wird und welche Funktionen des geschädigten Ohrs es übernimmt? Lenarz: Wenn die Sinneszellen nicht mehr funktionieren, dann kann man die Funktion der Sinneszellen, nämlich die Umwandlung von Schall in elektrische Impulse, durch ein elektrisches Reizsystem ersetzen. Hier habe ich in meiner Hand so eine Elektrode – ich hoffe, die Kamera kann das gut erkennen –, die wie eine ganz kleine Spirale aussieht. Sehen Sie, hier am Ende dieses Silikonteils, dieses längeren, dünnen "Schlauchs" befindet sich diese Spirale. Das, was Sie hier sehen, ist die Originalgröße, d. h. diese Spirale ist sehr klein. Diese Elektrode wird dann in das Innenohr – so ein Innenohr in Originalgröße habe ich Ihnen ja ebenfalls schon gezeigt – eingeführt. Diese Elektrode hat eine bestimmte Zahl von Reizkontakten, die an verschiedenen Stellen im Innenohr liegen und damit eben auch verschiedene Nervenfasern erregen können. Man baut sozusagen das nach, was das Ohr normalerweise macht: dass nämlich die einzelnen Töne sozusagen an verschiedene Stellen geleitet werden. Auf diese Weise kann daher der Patient, der so ein CochleaImplantat hat, wieder verschiedene Tonhöhen unterscheiden: Die tiefen Töne gehen mehr an die Spitze der Schnecke, die hohen Töne sind mehr am Anfangsteil der Schnecke, und dazwischen liegen die anderen Töne. Maly-Samiralow: Das, was so aussieht wie eine Spirale, wird also während einer Operation ins Innenohr eingesetzt, also implantiert. Lenarz: Genau, diese Elektrode wird eingesetzt. Letztlich ist so ein CochleaImplantat so etwas wie ein Mikrocomputer, der mit der Außenwelt über einen Magneten und eine Empfangsspule verbunden ist. Maly-Samiralow: Und das alles befindet sich dann unterhalb der Schädeldecke. Lenarz: Genau, der Patient trägt dieses Gerät dann hinter dem Ohr unter der Haut. Über diese Silikonleitung wird es mit dem Innenohr verbunden, in das diese Spirale eingesetzt wird. Maly-Samiralow: Intern? Lenarz: Ja, intern, das ist der innere Teil, das eigentliche Implantat. Außen trägt der Patient fast so etwas wie ein Hörgerät. Maly-Samiralow: Das sieht auch so aus. Lenarz: Ja, es hat hier außen noch eine Spule dran und diese Spule ist sozusagen die Sendespule, die die elektrischen Impulse von diesem Teil hier außen durch die Haut auf das Implantat überträgt. Und im Implantat selbst werden diese elektrischen Impulse dann sortiert und auf die entsprechenden richtigen Elektrodenkontakte übertragen. Das geschieht in einer sehr hohen Geschwindigkeit: Bis zu 90000 Impulse pro Sekunde werden erzeugt und auf die verschiedenen "Kontakte" im Innenohr verteilt. Maly-Samiralow: Ist das batteriebetrieben? Lenarz: Ja, das ist batteriebetrieben: In diesem Außenteil ist ein Akku oder eine Batterie, die der Patient selbst austauschen kann. Hier bei diesem Cochlea-Implantat gibt es noch ein Mikrofonteil usw., d. h. da gibt es ganz verschiedene Bauarten. Letztlich wird das Außenteil wie ein Hörgerät an das Ohr angebracht. Maly-Samiralow: Kann man das abends abnehmen? Denn ich stelle es mir eher ungemütlich vor, wenn ich abends ins Bett gehe und immer noch diese Kapsel am Ohr habe. Die Brille nehme ich ja auch ab. Lenarz: Das nimmt man einfach ab. Man hört dann aber nichts mehr. Natürlich geht die Entwicklung dahin, dass man das alles voll implantierbar machen möchte, dass man also auch den Akku, den man wieder aufladen kann, und auch das Mikrofon unter die Haut setzt. Maly-Samiralow: Es ist aber so, Sie haben das schon angedeutet, dass ein Mensch mit einem Cochlea-Implantat – weil seine Sinneszellen zerstört sind – nicht so hört, wie ein gesund hörender Mensch bzw. wie er vorher gehört hat, falls er vorher normal hören konnte. Inwiefern unterscheidet sich denn das Hören mit Cochlea-Implantat vom "normalen" Hören? Lenarz: Die Patienten, die vorher schon mal gehört haben, geben an, dass das technisch klingen würde: Es fehle so ein wenig die Melodie, es fehlt das, was eine Stimme meinetwegen weich macht, sondern das klingt eher blechern. Maly-Samiralow:. Liegt das daran, dass eben nicht alle diese fein austarierten Frequenzbereiche, die zum melodiösen Hören gehören, empfangen bzw. interpretiert werden können? Lenarz: Das stimmt. Wir müssen nämlich zuerst einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht in der Lage sind, viele Tausend Sinneszellen ersetzen zu können. Dazu ist die Technik heute jedenfalls noch nicht in der Lage. Stattdessen können wir maximal 22 getrennte Elektrodenkontakte realisieren. Das hat etwas mit der Größe zu tun, die wir im Ohr haben, das hat auch etwas mit … Maly-Samiralow: Das liegt also sozusagen am Platz, den man hat? Lenarz: Es ist vor allem so, dass die Nervenfasern sich nicht direkt mit dem Metall verbinden, sondern dazwischen ist eine kleine Distanz. Diese kleine Distanz führt leider dazu, dass sich dieser Strom, wenn er von der Elektrode abgegeben wird, etwas ausbreitet, d. h. er breitet sich fächerförmig aus. Statt nur einer Nervenfaser werden auch benachbarte Nervenfasern etwas miterregt. Dadurch kommt es zu so einer Art "übersprechen": Das begrenzt dann natürlich die Zahl der getrennten Informationskanäle. Das Ziel der Forschung besteht daher darin, dass wir dafür sorgen wollen, dass sich diese Nervenfasern nach Möglichkeit direkt mit den Elektrodenkontakten verbinden. Dann würde es auch Sinn machen, 100 oder 200 Kontakte zu bauen – denn mikrotechnologisch wäre das ja bereits möglich. Momentan wird das nämlich nicht gemacht aufgrund der noch nicht möglichen Direktverbindung mit den Nerven. Maly-Samiralow: Das ist ja eine Operation am Kopf, am Schädel, d. h. da wird gefräst und gebohrt: Das klingt alles sehr martialisch – zunächst einmal. Bei Kindern wird dabei auch die Hirnhaut freigelegt? Lenarz: Man macht ein Knochenbett, damit das Ganze nicht verrutscht. Maly-Samiralow: Wie riskant ist denn ein solcher Eingriff? Die FDA führt ja eine ganze Liste von Risiken und Nebenwirkungen auf. Aber es ist natürlich so, dass jeder operative Eingriff per se mit Risiken behaftet ist. Wie informieren Sie die Patienten, die zu Ihnen kommen? Denn diese Informationen gehören ja mit dazu. Denn letztlich ist das ja eine wichtige Entscheidung, die man da treffen muss. Lenarz: Ja, absolut. Es ist so, dass die Erfahrungen, die wir auf diesem Gebiet seit einigen Jahrzehnten gemacht haben, dazu geführt haben … Maly-Samiralow: Sind das 40 Jahre Erfahrung? Lenarz: Maximal, ich würde sagen, dass wir gut 30 Jahre intensive Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt haben. Das hat dazu geführt, dass man das Operationsverfahren standardisiert hat, dass man die Risiken alle kennt, dass man weiß, was wirklich wichtig ist bei so einer Operation. Diese Operation ist jedenfalls wie eine Ohroperation, d. h. wir machen keine Hirnoperation oder Kopfoperation im Sinne eines neurochirurgischen Eingriffs, sondern das ist eine Ohroperation, bei der wir unter dem Mikroskop arbeiten und dieses Teil einsetzen. Die Risiken selbst sind dabei sehr gering. "Gering" heißt, dass wir heute genau wissen, wie häufig z. B. eine Infektion vorkommt, wie häufig es zu einer Schädigung des Gesichtsnervs kommt usw. Diese Risiken sind also sehr gering, zum Glück, wie man sagen muss. Maly-Samiralow: Aber solche Dinge kommen vor? Lenarz: Es gibt viele Hilfsmittel, die man miteinsetzt. Maly-Samiralow: Aber es kommt vor? Lenarz: Ja, so etwas kann vorkommen, das muss man einfach sagen, denn es wäre völlig unrealistisch, wenn wir das verneinen würden. Aber man hat das eben auch so standardisiert, dass man das selbst bei Kindern machen kann, bei Kindern, die erst einige Monate alt sind, bei denen man entdeckt hat, dass sie taub sind. Bei solchen Kindern kommt es natürlich darauf an, dass man ihnen so früh wie möglich das Hören ermöglicht, damit sich ihr Sprachvermögen entwickeln kann. Maly-Samiralow: Es gibt ja immer wieder mal Rückrufaktionen unterschiedlichster Hersteller aufgrund von technischen Problemen. Das bedeutet ja, wenn so ein Implantat bereits eingesetzt worden ist, muss es wieder herausgenommen und durch ein anderes ersetzt werden. Ich habe das mal näher angeschaut, denn die Schweizer haben das relativ gut dokumentiert, denn sie haben dort … Lenarz: Ja, die Schweizer haben dafür ein nationales Register. Maly-Samiralow: Wenn ich die Zahlen richtig interpretiert habe, waren es in der gesamten Zeit etwas unter zehn Prozent defekte Cochlea-Implantate. Lenarz: Das war bei einzelnen Implantaten so. Wir haben als Einzelklinik ungefähr 10000 Implantate, die wir überblicken … Maly-Samiralow: Das heißt, so viele wurden an Ihrer Klinik bis heute implantiert? Lenarz: Richtig. Wir können das also für die verschiedenen Generationen von Cochlea-Implantaten genau angeben. Maly-Samiralow: Wie hoch ist diese Rate bei Ihnen? Lenarz: Über die gesamte Zeit beträgt die technische Ausfallrate vier Prozent. Sie ist immer geringer geworden, weil man die Implantate eben immer besser gemacht hat. Trotzdem ist es immer so, dass bei jeder Generation von neuen Implantaten zuerst einmal die Frage lautet: Halten diese Geräte? Die Ausfallrate heutzutage bei den Geräten mit neuester Technologie beträgt nur noch ungefähr ein Prozent – bezogen auf einen bestimmten Beobachtungszeitraum. Man nennt das kumulative Fehlerrate, denn im Lauf der Zeit wird diese Fehlerrate natürlich etwas ansteigen. Aber für Cochlea-Implantate ist diese Fehlerrate, verglichen mit anderen medizinischen Implantaten, wirklich gering. Hüftprothesen haben eine höhere Fehlerrate, aber die sind natürlich auch mechanisch bewegt: Das ist der eigentliche Grund … Maly-Samiralow: Da weiß man von vornherein, dass sie nicht lebenslang halten werden. Lenarz: Genau. Auch bei Zahnimplantaten ist diese Rate deutlich höher. Das liegt eben daran, dass das Cochlea-Implantat, wenn es einmal eingewachsen ist, wirklich geschützt ist. Da gibt es dann auch keine Gefahr mehr durch Infektionen, weil das einfach überwachsen ist mit Bindegewebe oder mit Schleimhaut. Eine Mittelohrinfektion z. B. kann sich dann nicht mehr auf das Implantat ausbreiten. Insofern hat man da an sich eine vergleichsweise günstige biologische Grundsituation. Maly-Samiralow: Ich würde jetzt gerne noch einmal auf die Kinder zu sprechen kommen. Sie haben es ja bereits angedeutet, dass bei Kindern z. T. schon im ersten Lebensjahr ein solches Implantat eingesetzt wird. Dass bereits so kleine Kinder operiert werden, wird ja auch durchaus kontrovers diskutiert. Zum einen spricht dafür, Sie haben es gerade schon gesagt, dass man in möglichst jungen Jahren, wenn die Plastizität des Gehirns noch gegeben ist, sicherstellen möchte, dass diese Reizverarbeitung stattfindet, damit diesen Kindern der Spracherwerb ermöglicht wird, weil deren Gehirn bei der Reizverarbeitung quasi eine entsprechende Symbolik entwickeln kann. Die Kritik kommt aus der Richtung, dass Kinder mit einem Cochlea-Implantat nicht zwangsläufig richtig sprechen lernen. Wobei natürlich die Frage ist, was "richtig sprechen lernen" heißt. Sie kennen ja sicherlich die Arbeiten von Frau Professor Szagun, die zumindest in einer Studie bei ungefähr der Hälfte der Kinder, die sie beobachtet hat, zum Ergebnis kommt, dass sie sich sehr gut artikulieren können, dass sie also über eine gute Sprechfähigkeit verfügen, während bei anderen Kindern das immer noch sehr verzögert war. Ich habe das so verstanden, dass es offenkundig keine Erklärung dafür gibt, warum das bei manchen Kindern gut funktioniert und bei anderen weniger gut. Lenarz: Man muss natürlich auch sagen, dass die Daten, die Frau Szagun erhoben hat, bereits einige Jahre alt sind. Damals sind auch noch Kinder implantiert worden, die bereits älter waren. Man weiß, der eigentliche Einflussfaktor bei einer angeborenen Taubheit ist tatsächlich der Zeitpunkt der Implantation. Wir haben für die Entwicklung ein Zeitfenster, eine kritische Periode: Diese kritische Periode liegt in den ersten vier Lebensjahren – eher sogar in den ersten beiden Lebensjahren. Je früher ein Kind zum Hören gebracht wird, desto vollständiger ist der Spracherwerb, und das auch in Situationen, die schwieriger sind, weil es z. B. Störgeräusche usw. gibt. Man setzt also bei diesen kleinen Kindern in beide Ohren ein solches Cochlea-Implantat, damit man das beidohrige Hören ausnutzt – so wie wir von Natur aus Hörende das ja auch tun. Damit kann man bei einem sehr hohen Prozentsatz der Kinder – er liegt bei weit über 90 Prozent – eine Sprachentwicklung erreichen. Maly-Samiralow: Was heißt "Sprachentwicklung" in diesem Fall genau? Lenarz: Wie gut das funktioniert, ist natürlich eine wichtige Frage. Wenn ein Kind in Bayern aufwächst, dann wird es einen bayerischen Dialekt annehmen, wenn beide Eltern zu Hause Bayrisch sprechen. Das zeigt ja gerade, wie differenziert das Signal aufgenommen und umgesetzt wird – obwohl das Implantat das Gehörte ja nicht vollständig wiedergibt. Maly-Samiralow: Das ist aber der springende Punkt, auf den ich ganz gerne noch einmal hinaus wollte. Wenn wir hier im Studio miteinander sprechen, dann nennen wir das quasi ein normales Sprechen. Wenn Eltern zu Ihnen in die Beratung kommen, klären Sie diese dann auch dahingehend auf, dass Sie nicht garantieren können, dass das Kind ein vollständig normales Sprechen erwerben, erlernen wird? Lenarz: Was man auf jeden Fall ermitteln muss, ist, ob ein Kind Zusatzbehinderungen hat. Maly-Samiralow: Gehen wir mal nicht von einer Zusatzbehinderung aus. Wie ist das grundsätzlich? Lenarz: Wenn ein Kind keine Zusatzbehinderung hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer frühen Implantation das Kind Sprache erwirbt, extrem hoch. Warum? Weil ein Kind einen natürlichen Sprachantrieb hat. Wenn das Kind also einer entsprechenden akustischen Umgebung ausgesetzt ist, dann funktioniert das Meiste zwar auch nicht ganz von alleine – so weit würde ich nicht gehen –, aber der Spracherwerb ist doch sehr viel leichter als dann, wenn das Kind bereits vier Jahre alt ist bei der Implantation. Denn bis zum vierten Lebensjahr ist nun einmal auch im Gehirn bereits sehr viel passiert, was nicht auf dem Hören basiert. Das ist an sich das eigentliche Problem. Natürlich muss man ganz klar sagen, was trotz einer Implantation immer vorhanden sein wird: Das Kind wird durch so ein Implantat ja nicht komplett normal hörend, sondern es ist weiterhin hörgeschädigt, es hat also eine Schwerhörigkeit. Die höhere Anstrengung, die so ein Kind aufbringen muss, also die kognitive Last, wie man das nennt, durch das Hören, ist bei ihm daher höher als bei einem normal hörenden Kind. Deswegen macht es natürlich auch Sinn, diesen Kindern zusätzliche Hilfen zu geben. Maly-Samiralow: Das ist aber genau der springende Punkt. Ich habe im Zuge der Recherche auch mit dem Bundeselternverband gehörloser Kinder gesprochen. Dort suchen sich ja genau diejenigen Eltern Beratung, deren Kinder diese Probleme haben. Die Dame aus dem Beratungsteam, mit der ich gesprochen habe, sagte mir, dass es tatsächlich Kinder gibt, die trotz einer Cochlea-Implantation keine Sprechfähigkeit entwickeln. Diese Kinder stehen dann vor dem großen Problem, dass sie ohne eine wie auch immer geartete Sprachlichkeit eingeschult werden: Sie können keine Gebärdensprache und sie können nicht sprechen, können also gar nichts diesbezüglich. Das nächste Problem ist, dass Kinder, die so ein Implantat haben und in eine Regelschule gehen, sich oft nicht trauen, zu sagen: "Das ist jetzt zu laut für mich, das ist jetzt zu anstrengend für mich, ihr müsstet jetzt ein bisschen Rücksicht nehmen auf mich!" Das trauen sie sich oft nicht, weil sie ja ohnehin schon stigmatisiert sind mit diesem Implantat. Da scheint es also doch ganz offenkundig Probleme in der Nachsorge, in der Nachbetreuung zu geben. Denn wenn man diesen Kindern ein "normales" Leben ermöglichen möchte, dann muss man sie vermutlich viel differenzierter und gezielter betreuen und auch fördern. Lenarz: Ja, das stimmt und diese Betreuung gibt es natürlich: Es gibt für hörgeschädigte Kinder ja alle Einrichtungen, die natürlich von den Kindern mit Cochlea-Implantaten genauso genutzt werden wie von den Kindern mit Hörgeräten. Es gibt da im Bildungswesen alle möglichen Differenzierungen … Maly-Samiralow: Reicht das denn aus? Lenarz: Wenn Kinder mit dem Cochlea-Implantat alleine nicht zur Sprache finden, dann lernen sie praktisch alle zusätzlich noch die Gebärdensprache. Das ist z. B. auch die Aufgabe dieser Einrichtungen, dass sie … Maly-Samiralow: Empfehlen Sie das? Lenarz: Ja, natürlich. Alles, was die Kommunikation der Kinder verbessert, empfehlen wir. Viele Kinder brauchen das nicht, sie würden es auch gar nicht akzeptieren, dass sie jetzt auch noch gebärden sollen. Aber diejenigen, die das brauchen, machen das. Es ist ganz interessant zu sehen, wie die Kinder sich das auch von sich aus holen. Maly-Samiralow: Sie plädieren also für eine "bilinguale" Lösung? Lenarz: Wenn das für das Kind notwendig ist, dann natürlich schon, das ist ganz klar. Denn man muss letzten Endes dafür sorgen, dass diese Kinder – und das ist ja das Ziel – in unserer Gesellschaft bestehen können. Die große, lebensentscheidende Veränderung, die das Cochlea-Implantat gebracht hat, ist ja, dass man diesen Kindern ganz andere Bildungs- und Berufschancen eröffnet hat. Heute ist es so, dass mehr als 70 Prozent dieser Kinder eine Regelschule besuchen; das war früher völlig unmöglich. Heute können diese Menschen Berufe ergreifen, die voll auf das Hören abzielen, Berufe also, in denen man Sprachverstehen und Sprachfähigkeit zwingend braucht. Das zeigt meines Erachtens, dass das eine lebensentscheidende Maßnahme ist – bei aller Kritik, die man anbringen muss, das ist ganz klar. Wir sind nicht perfekt, deswegen wollen wir ja auch die Implantate so verbessern, dass wir wirklich dahin kommen, dass sie möglichst komplett das Gehör ersetzen. Maly-Samiralow: Herr Professor Lenarz, eine Frage habe ich noch am Ende unseres Gesprächs: Was empfehlen Sie unseren Zuschauern im Hinblick auf die Pflege ihres Gehörs? Was kann, was sollte man tun, damit man möglichst lange höraktiv bleibt? Lenarz: Ich empfehle unseren Zuschauerinnen und Zuschauern: Suchen Sie Orte der Stille auf, werden Sie sich der Leistung Ihres Gehöres bewusst. Und wenn sie merken, dass Ihr Gehör nachlässt, dann suchen Sie möglichst frühzeitig professionelle Hilfe, damit Sie sich nicht vom Hören zurückziehen. Maly-Samiralow: Herr Professor Lenarz, herzlichen Dank für das Gespräch und dafür, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Liebe Zuschauer, das war es für heute wieder einmal mit dem alpha-Forum. Ich hoffe, Sie haben gut zugehört. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie es gut. © Bayerischer Rundfunk