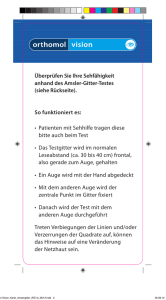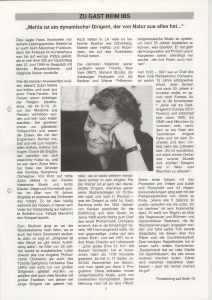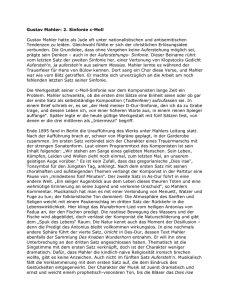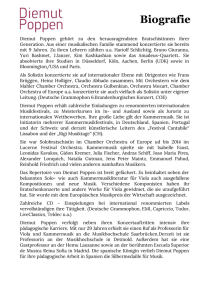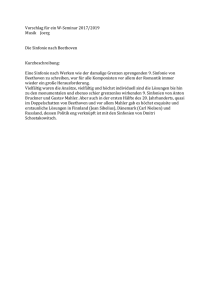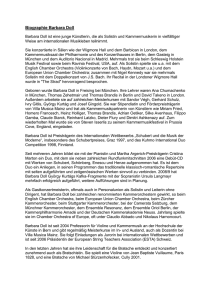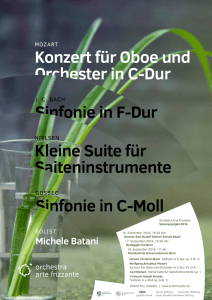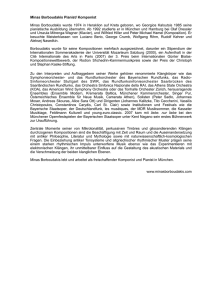Rafał Blechacz Mahler Chamber Orchestra Daniel Harding
Werbung

Klassiker! 5 Rafał Blechacz Mahler Chamber Orchestra Daniel Harding Donnerstag 30. Mai 2013 20:00 13550_KM_30-05-13_d.indd U1 27.05.13 17:25 Bitte beachten Sie: Ihr Husten stört Besucher und Künstler. Wir halten daher für Sie an den Garderoben Ricola-Kräuterbonbons bereit und händigen Ihnen Stofftaschentücher des Hauses Franz Sauer aus. Sollten Sie elektronische Geräte, insbesondere Handys, bei sich haben: Bitte schalten Sie diese zur Vermeidung akustischer Störungen aus. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Bild- und Tonaufnahmen aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet sind. Wenn Sie einmal zu spät zum Konzert kommen sollten, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir Sie nicht sofort einlassen können. Wir bemühen uns, Ihnen so schnell wie möglich Zugang zum Konzertsaal zu gewähren. Ihre Plätze können Sie spätestens in der Pause einnehmen. Sollten Sie einmal das Konzert nicht bis zum Ende hören können, helfen wir Ihnen gern bei der Auswahl geeigneter Plätze, von denen Sie den Saal störungsfrei (auch für andere Konzertbesucher) und ohne Verzögerung verlassen können. Mit dem Kauf der Eintrittskarte erklären Sie sich damit einverstanden, dass ihr Bild möglicherweise im Fernsehen oder in anderen Medien ausgestrahlt wird oder auf Fotos in Medienveröffentlichungen erscheint. 13550_KM_30-05-13_d.indd U2 27.05.13 17:26 Klassiker! 5 Philharmonie für Einsteiger 6 Rafał Blechacz Klavier Mahler Chamber Orchestra Daniel Harding Dirigent Donnerstag 30. Mai 2013 20:00 Pause gegen 20:50 Ende gegen 22:00 19:00 Einführung in das Konzert durch Oliver Binder Förderer der MCO Residenz NRW: Kunststiftung NRW und das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen 13550_KM_30-05-13_d.indd 1 27.05.13 17:26 PROGRAMM Hans Werner Henze 1926 – 2012 Sonata per archi (1957/58) für Streichorchester Allegro 32 Variazioni Robert Schumann 1810 – 1856 Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 54 (1841 – 45) Allegro affettuoso Intermezzo. Andante grazioso Rondo. Allegro vivace Pause Robert Schumann Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 (1850) (»Rheinische«) für Orchester Lebhaft Scherzo. Sehr mässig Nicht schnell Feierlich Lebhaft 2 13550_KM_30-05-13_d.indd 2 27.05.13 17:26 ZU DEN WERKEN DES HEUTIGEN KONZERTS Nicht Ballast, sondern Reichtum – Hans Werner Henze: Sonata per archi Antifaschist, Kriegsgegner, Bohemien und engagierter Linker – der 1926 in Gütersloh geborene und vor gut einem halben Jahr verstorbene Hans Werner Henze hatte viele Facetten. Und so mannigfaltig wie der Mensch, so vielseitig war auch der Musiker Henze. In seinen frühen Jahren schlug er die Pauke im Orchester, arbeitete jahrelang am Theater, dirigierte, lehrte an den Musikhochschulen in Salzburg und Köln, erwarb sich Verdienste als Kulturmanager und – dies natürlich vor allem – als Komponist. Wie kaum ein anderer Musikschöpfer seiner Generation hat Henze, dieser immens Produktive, die zeitgenössische Musik um Opern, Ballette, Sinfonik, Kammer- sowie Filmmusik bereichert und sich mit seiner unmittelbar zugängigen, fein ziselierten, expressiv-sinnlichen und von schwelgerischem Klangkolorit beseelten Schreibweise ein breites Publikum erobert. »Musik soll zu den Menschen gehen, freundlich und dienend, sie soll nützlich sein und lehrreich, soll Empfindungen möglich machen«, formulierte Henze einst sein musikalisches Credo. Diesem Ideal ist er bis zuletzt treu geblieben – wenngleich sein kompositorisches Schaffen durchaus so manche Wandlung durchlief. Henzes Kindheit und Jugend war geprägt von der Herrschaft der Nationalsozialisten. 1943 begann er an der Staatsmusikschule Braunschweig Klavier und Schlagzeug zu studieren, wurde aber noch in den letzten Kriegsmonaten zur Wehrmacht eingezogen und geriet in englische Gefangenschaft. 1946 setzte Henze sein Studium am Kirchenmusikalischen Institut in Heidelberg bei Wolfgang Fortner fort, lernte bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt René Leibowitz kennen und ließ sich von ihm in die Zwölftontechnik einweisen. Doch das seiner Ansicht nach verbissene Suchen nach Neuem, Nochnie-Dagewesenem war seine Sache nicht. Zudem stieß Henzes Vorliebe fürs Melodische ebenso auf die geballte Gegnerschaft der Darmstädter Avantgarde-Kollegen wie die Tatsache, dass der sensible Schönheitssuchende es noch wagte, Sinfonien und Streichquartette zu schreiben – woraufhin Henze sich enttäuscht und verbittert zurückzog. 3 13550_KM_30-05-13_d.indd 3 27.05.13 17:26 1953 siedelte Henze nach Italien um, in das zur deutschen Enge und Bürgerlichkeit so konträre Land der Erfüllung seiner Sehnsüchte und Hoffnungen. In eine verträumte, realitätsferne Welt eingesponnen, lebte und arbeitete der Individualist aber mitnichten. Vielmehr hatte er die aktuellen zeitgeschichtlichen Entwicklungen immer fest im Blick, dachte politisch und sozial. Mit Musik gesellschaftsverändernd zu wirken, war sein Ziel. Und das bewies Henze sowohl als Komponist, wenn er mit seinen Werken beispielsweise auf die 68er-Bewegung, den Vietnam-Krieg oder Aids reagierte; aber auch als Kulturmanager, unter anderem als Leiter des 1976 ins Leben gerufenen Cantiere Internazionale d’Arte im toskanischen Montepulciano, bei dem er neue Formen einer bevölkerungsnahen Musikvermittlung erprobte, oder als Gründer der Münchener Biennale, mit der Henze ein weithin beachtetes Forum für junge Opernkomponisten schuf. Zur Musikgeschichte hatte Henze zeitlebens ein unverkrampftes Verhältnis. »Die Werke und Formen der Vergangenheit sind dazu da, vom Menschen angeeignet zu werden. Sie sind für mich nicht Ballast, sondern Reichtum«, betonte er. Dies spiegelt auch die zweisätzige Sonata per archi von 1957/58 wider, die der bedeutende Schweizer Dirigent und Mäzen Paul Sacher bei Henze in Auftrag gegeben hatte und in Zürich zur Uraufführung brachte. So ist das einleitende Allegro vom Konzept der klassischen Sonate geprägt, während der zweite Satz die Idee des Variationssatzes aufgreift. Der energiereiche erste Satz erinnert an Strawinsky, verquickt Reihenelemente mit heftig pulsierender Motorik, setzt rhythmisch prägnante Floskeln gegen flächige Akkorde, aus denen heraus sich immer wieder wilde, expressive Kantilenen aufbäumen. Der Schwerpunkt der Komposition aber liegt auf dem zweiten Satz, den 32 Variationen über ein achttaktiges, von der Solovioline vorgestelltes Thema. Die Achttaktigkeit wird bei allen Verwandlungen beibehalten. Darüber hinaus folgt Henze dem Prinzip einer zunehmenden Freiheit, involviert erst nach einigen den hohen Streichern vorbehaltenen Variationen auch die tiefen Instrumente, konzentriert sich dann auf die Verwandlung einzelner Aspekte des Ursprungsthemas, verschleiert und verdichtet den Gesamtzusammenhang und lässt das Werk schließlich in einen frenetischen Schluss im vierfachen Forte münden. 4 13550_KM_30-05-13_d.indd 4 27.05.13 17:26 Aus einem Guss – Robert Schumann: Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 54 Als Musiker sein Leben zu fristen war wohl zu allen Zeiten eine finanziell unsichere Sache. Auch die gut situierte Familie Schumann, die ihren Lebensunterhalt im Verlagsgeschäft verdiente, erachtete den Beruf des Musikers, gar des Komponisten, für ihren jüngsten Sohn als wenig lukrative Lebensperspektive und hatte vermeintlich Besseres im Sinn. Und so fügte sich Robert Schumann nach dem frühen Tod des Vaters dem Wunsch seiner Mutter und studierte Jura. Doch schon bald ward ihm, der sich seit seinen Kindheitstagen mit dem Klavier und der Musik aufs Innigste verbunden fühlte, die Sache zu dröge; und nach zwei Jahren zermürbenden Ringens und einem Kurztrip nach Italien hatte er sich endgültig entschieden: »Ich bleibe bei der Kunst […], ich kann und muss es.« Zehn Jahre später, anno 1841, konnte Schumann bereits auf ein respektables Klavier- sowie Liedœuvre verweisen. Und mit seinem gerade uraufgeführten sinfonischen Erstling, der »Frühlingssinfonie«, machte er sich sogar überregional einen Namen. Seine im Mai desselben Jahres komponierte Fantasie für Klavier und Orchester ließ sich deshalb allerdings noch lange nicht leichter unter die Leute bringen. Doch so frustriert der 31-Jährige auch gewesen sein mag, letztlich erwies sich die Tatsache, dass kein Konzertveranstalter die Klavierfantasie ins Programm nehmen und kein Verlag das Stück drucken wollte, als Glücksfall. Denn vier Jahre später knöpfte sich Schumann sein Unikum erneut vor, komplettierte es zum ausgewachsenen Klavierkonzert – seinem einzigen Beitrag zu dieser Gattung – und landete damit einen Bestseller, der schon aufgrund seines kunstvoll ineinander verflochtenen Klavier-Orchester-Gespinsts und seiner schwärmerisch-rauschhaften Musik bis heute seinesgleichen sucht. Dabei folgt Schumann weder der seinerzeit so modischen Manier des virtuos überdrehten Solistenkonzerts noch dem strengen Arbeitskanon der Klassik. Sein Konzept ist – obwohl formal in 5 13550_KM_30-05-13_d.indd 5 27.05.13 17:26 die klassische Anlage mit zwei im weitesten Sinne sonatenhauptsatzartigen Ecksätzen und einem ruhigen Brückensatz gegossen – vielmehr ein genuin romantisches, dabei ganz und gar individuelles, das sich auf folgenden Nenner bringen lässt: Man ersinne ein Thema, so lyrisch und schön, aussagekräftig und zugleich wandelbar, dass der Hörer gar nicht genug davon bekommen und ein fantasievoller Komponist spielend drei Sätze daraus zu speisen vermag. Was Schumann wie folgt umsetzte: Eine Handvoll deftiger Klavierakkorde, um die Hörer wachzurütteln, und schon erklingt, freudig aufsteigend und gedankenvoll zurücksinkend, besagtes lyrisches Thema. Der Solist träumt es dem Orchester nach, bald spinnen es die beiden Partner im unternehmungslustigen Wechselspiel fort, dann verirrt es sich poetisch sinnierend in unendlich ferne Tonarten, verwandelt sich in einen flüsternden Klarinetten-Klavier-Dialog, umgibt sich mit getürmten Oktaven. Es windet, wendet und tummelt sich in einer der Klassik ganz unbekannten Freiheit, erscheint in immer neuem Lichte und neuen Klangkombinationen. Auf ein gattungstypisches Gegenthema verzichtet Schumann, entscheidet sich erst spät für eine das aufgestellte Material verarbeitende Durchführung, die wiederum dem anfänglichen Thema größte Bedeutung einräumt, kommt zur Reprise und zur anfangs nachdenklichen, hernach furios dahinjagenden Abschlusskadenz des ersten Satzes. Dann schält Schumann aus dem Hauptthema des Kopfsatzes den Achtelaufgang heraus und generiert damit, in Sechzehntel umgemünzt, die graziöse Plauderei des Intermezzos, das durch eine raffiniert eingeflochtene Reminiszenz an das Kopfsatzhauptthema ohne Pause ins gleichermaßen tänzerische wie rasende und – gemäß Konzept – trotz neuer Motive im Wesentlichen aus der anfänglichen Themenwurzel erwachsende Allegro vivace mündet. Wie im Freudentaumel treiben sich Orchester und Klavier dort gegenseitig vorwärts, auf einen kühlen Kopf, sprich: souveränen Dirigenten vertrauend, der ihr Zusammenspiel heil durch die metrischen Klippen leitet. 6 13550_KM_30-05-13_d.indd 6 27.05.13 17:26 Luftveränderung – Robert Schumann: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 (»Rheinische«) »Wenn der Deutsche von Sinfonien spricht, so spricht er von Beethoven: Die beiden Namen gelten ihm für eines und unzertrennlich, sind seine Freude, sein Stolz«, schrieb Schumann in seinen frühen Jahren mit einer eigentümlichen Mischung aus Respekt und Frustration über die Stellung der Gattung im 19. Jahrhundert. Und doch: Schon mit seiner bereits erwähnten ersten Sinfonie gelang es ihm – spielerischer als seinem Kollegen Johannes Brahms –, sich vom übermächtigen Schatten Ludwig van Beethovens frei zu machen und neue kompositorische Lösungen zu finden. Vier autorisierte Werke hat Schumann insgesamt zu dieser Gattung beigetragen. Und ob in besagter »Erster« oder in seiner heute zu hörenden, schaffenschronologisch gesehen letzten Sinfonie, die allerdings als Nummer 3 in die Öffentlichkeit kam: Stets spielt der zyklische Gedanke, die Idee – wie schon im Klavierkonzert –, durch kompositorische Kniffe alle Sätze miteinander zu verzahnen, eine tragende Rolle. Der Anblick des seinerzeit noch immer unvollendeten, aber bereits den Status eines nationalen Symbols annehmenden Kölner Doms gab wohl – so der frühe Schumann-Biograf Wilhelm J. Wasielewski, auf den auch der populäre Beiname »Rheinische« zurückgeht – den Anstoß zur Es-Dur-Sinfonie. Nur zwei Monate nach dem Umzug von Dresden nach Düsseldorf, wo Schumann die Stelle des Städtischen Musikdirektors antrat, hatte er die Komposition in Angriff genommen. Und es ist erstaunlich, welch enorm inspirierende und beflügelnde Wirkung – ähnlich dem befreienden Fluidum der Umsiedelung von Hans Werner Henze nach Italien – diese Luftveränderung – die neue Umgebung, die so anders gesinnten Menschen, der majestätisch dahinströmende Rhein und das neue berufliche Umfeld – auf Schumanns Psyche und Schaffenskraft hatte. Die Skizze zum ersten Satz der Sinfonie hatte er – kaum zu glauben – in nur zwei Tagen niedergeschrieben und in weiteren dreißig Tagen, zwischen dem 7. November und dem 9. Dezember 7 13550_KM_30-05-13_d.indd 7 27.05.13 17:26 1850, die gesamte Sinfonie komplett fertiggestellt. Um seinem Anspruch, alle Sätze möglichst eng miteinander zu verzahnen und so den zyklischen Gedanken zu manifestieren, gerecht zu werden, wandte Schumann einige Kniffe an. Vor allem ist es das markante Quart-Intervall, das in fast allen, stilistisch und charakterlich so vielfältigen Themen – vom Volkslied bis zum Choral, vom Ernst bis zur festlichen Turbulenz – bedeutsam ist und das Werk zu einer Sinneinheit zusammenschweißt: gleich zu Beginn, auf- und absteigend, im durch synkopische Überbindungen eigenwillig rhythmisierten und die Periodik unbekümmert missachtenden Hauptthema sowie als absteigendes Intervall im untergeordneten Seitenthema des mit Drive dahinstiebenden Kopfsatzes; auch im Grundmotiv des zweiten sowie in der Melodie des intermezzoartigen dritten Satzes erklingt das Intervall; und schließlich taucht es als Folge von Quartschritten im zunächst von Posaune und Horn vorgestellten Thema des feierlichen vierten Satzes auf sowie im Finale zu Beginn des ersten Themas und der Coda, die eine Brücke zurück zum feierlichen Choral des vierten Satzes schlägt. Aber auch die formale Anlage der Sinfonie mit ihren beiden durchaus frei gehandhabten Sonatenhauptsätzen als Klammer und einer vom Kopfsatz auf das Finale hin ausgerichteten Entwicklung unterstützt die Stringenz und den Zusammenhalt der Sinfonie nach Kräften: So werden zum einen die Tempi von Satz zu Satz langsamer, um sich dann – wie nach einem tiefen Luftholen – wieder an den »lebhaften« ersten Satz anzulehnen. Zum anderen fasst das Finale, in dem sich beschwingt Melodie an Melodie reiht, in einer Art Rückschau und Synthese die Charaktere der vorigen Sätze – den volkstümlichen Habitus, die lebensfrohe Heiterkeit und das euphorisch-turbulente Vorwärtsdrängen sowie den Tonfall des Scherzos und des Chorals – kaleidoskopartig zusammen. Apropos formale Anlage: Auffallendstes Merkmal der »Rheinischen« ist natürlich ihre von der Tradition abweichende Fünfsätzigkeit. Kein Wunder, dass dieser »überzählige«, an vierter Stelle platzierte Satz Schumanns Zeitgenossen irritierte und ihnen Kopfzerbrechen bereitete. Zumal er mit seinem ungewöhnlichen Religioso-Charakter sowie dem damit einhergehenden 8 13550_KM_30-05-13_d.indd 8 27.05.13 17:26 archaisch-pathetischen Tonfall und seiner teils strengen kontrapunktischen Faktur von den übrigen Sätzen absticht. »In diesem Satz sehen wir gotische Dome, Prozessionen, stattliche Figuren in den Chorstühlen, […] Posaunen, die wie drei behäbige Prälaten den Segen erteilen, worauf es wie Orgelklang leise zurückwallt«, schrieb der Rezensent der Rheinischen Musikzeitung in seiner Kritik zur Uraufführung. Vielleicht hielt sich auch deshalb – und gestützt durch die ursprüngliche Überschrift »Im Charakter der Begleitung einer feierlichen Zeremonie«, die Schumann erst bei Drucklegung der Sinfonie tilgte – hartnäckig jenes mittlerweile widerlegte Gerücht, der Komponist habe selbst an der Kardinalserhebung des Kölner Erzbischofs teilgenommen und sei dadurch zu dem Satz inspiriert worden. Ulrike Heckenmüller 9 13550_KM_30-05-13_d.indd 9 27.05.13 17:26 BIOGRAPHIEN Rafał Blechacz Der polnische Pianist Rafał Blechacz wurde 1985 geboren. Bereits im Alter von fünf Jahren erhielt er Klavierunterricht, später führte er seine Studien an der Artur Rubinstein State School of Music in Bydgoszcz fort. 2007 schloss er seine Studien an der Feliks Nowowiejski Music Academy in Bydgoszcz bei Katarzyna Popowa-Zydron ab. Im Oktober 2005 gewann er einen herausragenden Ersten Preis beim 15. Warschauer Chopin-Wettbewerb (ein Zweiter Preis wurde nicht vergeben, um die einzigartige Begabung des Pianisten zu betonen und für sich stehen zu lassen). Der junge Musiker gewann im Rahmen dieses renommierten Wettbewerbs außerdem den von Krystian Zimerman gestifteten Preis für die beste Sonaten-Interpretation, den polnischen Radio-Preis für die beste Aufführung einer Mazurka, den Preis der Nationalen Philharmonie Polens für die beste Konzertaufführung, den Preis der Chopin Gesellschaft für die beste Interpretation einer Polonaise sowie den Publikumspreis. Inzwischen konzertiert Rafał Blechacz weltweit mit bekannten Orchestern wie dem NDR Sinfonieorchester, dem Radio-Symphonieorchester Wien, der Sinfonia Varsovia, dem Orchestre de Paris, dem Orchestra dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia und dem Tonhalle-Orchester Zürich. Darüber hinaus gibt er Soloabende in berühmten Konzertsälen wie der Philharmonie Berlin, dem Herkulessaal München, der Liederhalle in Stuttgart, der Salle Pleyel Paris, der Royal Festival Hall und der Wigmore Hall in London, dem Concertgebouw Amsterdam, La Scala in Mailand, dem Wiener Konzerthaus, der Tonhalle Zürich, dem Palais des Beaux-Arts in Brüssel, der Suntory Hall Tokio und der Avery Fisher Hall in New York. In dieser Saison ist Rafał Blechacz neben den Konzerten in der Kölner Philharmonie u. a. auch in der Tonhalle Düsseldorf sowie beim Rheingau Musik Festival zu erleben. Darüber hinaus spielt er in der Kammermusikreihe der Berliner Phillharmoniker und ist 10 13550_KM_30-05-13_d.indd 10 27.05.13 17:26 als Solist beim Royal Scottish National Symphony Orchestra und auf den Tourneen des Tonhalle-Orchesters Zürich und des Mahler Chamber Orchestra mit Konzerten in Berlin, Köln, Hannover, Dortmund, Luxembourg und Zürich zu hören. Rafał Blechacz unterzeichnete 2006 einen Exklusiv-Vertrag und kann seitdem auf vier sehr erfolgreiche CD-Einspielungen zurückblicken. Seine erste CD mit Préludes von Chopin (2007) erreichte nur einen Tag nach dem Verkaufsstart in Deutschland Goldstatus und wurde 2008 mit dem ECHO Klassik sowie dem französischen Diapason d’Or ausgezeichnet. Die zweite CD mit Sonaten von Haydn, Mozart und Beethoven erreichte die Auszeichnungen Gold und Platin. Die dritte Einspielung wurde anlässlich des Chopin-Jahres mit den beiden Klavierkonzerten unter der Leitung von Jerzy Semkow und dem Königlichen Concertgebouworchester Amsterdam aufgenommen; Rafał Blechacz wurde dafür im Herbst 2010 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Im Februar 2012 wurde seine Einspielung von Werken von Debussy und Szymanowski veröffentlicht. Auszeichnungen dafür sind u. a. die »Aufnahme des Monats« des britischen Gramophone-Magazins sowie der ECHO Klassik 2012 in der Kategorie »Solistische Einspielung des Jahres (20./21. Jhd)«. In der Kölner Philharmonie war Rafał Blechacz zuletzt erst im Februar zu Gast. 11 13550_KM_30-05-13_d.indd 11 27.05.13 17:26 Mahler Chamber Orchestra In den 15 Jahren seines Bestehens hat sich das Mahler Chamber Orchestra (MCO) zu einem der künstlerisch interessantesten und erfolgreichsten Ensembles des internationalen Musiklebens entwickelt. Das MCO ist rund 200 Tage im Jahr unterwegs – mit längeren Aufenthalten in seinen Residenzen und auf ausgedehnten, weltweiten Konzerttourneen. Die Residenzen des Orchesters liegen in drei verschiedenen Ländern Europas: In der norditalienischen Stadt Ferrara, im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen (im Verbund der Städte Dortmund, Essen und Köln) sowie jeden Sommer beim Lucerne Festival in der Schweiz, wo das MCO auch den Kern von Claudio Abbados Lucerne Festival Orchestra bildet. In der Saison 2012/13 gastiert das Orchester in 13 europäischen Ländern sowie in Bahrain, Japan und Australien. Im Frühjahr 2011 wurde das MCO zum Kulturbotschafter der Europäischen Union ernannt. Mit der MCO Academy und mit dem Education- und Outreach-Programm MCO Landings engagiert sich das Orchester zunehmend auch im pädagogischen und sozialen Bereich. Das Mahler Chamber Orchestra wurde 1997 von ehemaligen Mitgliedern des Gustav Mahler Jugendorchesters gegründet, 12 13550_KM_30-05-13_d.indd 12 27.05.13 17:26 die weiterhin gemeinsam musizieren wollten. Unterstützt von Claudio Abbado bauten sie ihr eigenes Ensemble auf und verfolgen seither ihre Vision eines freien internationalen Orchesters mit höchstem Qualitätsanspruch. Der Durchbruch gelang dem Ensemble bereits wenige Monate später, im Sommer 1998, beim Opernfestival in Aix-en-Provence mit der Aufführung der Mozartoper Don Giovanni unter der Leitung von Claudio Abbado. Die 45 Mitglieder der MCO-Kernbesetzung stammen aus 20 verschiedenen Nationen und leben in ganz Europa. Neben den Mitgliedern umschließt das MCO ein sorgfältig aufgebautes und gepflegtes Netzwerk hervorragender Musiker, die je nach Projekt hinzugezogen werden können. Kernrepertoire des Orchesters sind Sinfonik und Opernliteratur der Wiener Klassik und der frühen Romantik. Dank seiner flexiblen Struktur ist es dem MCO jedoch möglich, ein sehr breites Repertoire zu spielen, das von Kammermusik bis zur groß besetzten Sinfonie und Oper, vom Barock bis zu Uraufführungen reicht. Der Name des Orchesters verweist auf die Wurzeln des Ensembles im Gustav Mahler Jugendorchester. Der Begriff »Chamber« bezieht sich weniger auf die Besetzungsgröße als auf die von allen MCO-Musikern geteilte kammermusikalische Grundhaltung, die ihr Zusammenspiel charakterisiert. Das Mahler Chamber Orchestra befindet sich in keiner öffentlich-rechtlichen Trägerstruktur und finanziert sich hauptsächlich aus den Konzerteinnahmen, ergänzt durch Spenden und Sponsoring. Das MCO wird von Orchestervorstand und Management in engem Dialog geführt, mit demokratischem Mitspracherecht der Mitglieder. Der Sitz des MCO-Managements liegt in Berlin. Neben dem Gründungsdirigenten Claudio Abbado hat vor allem Daniel Harding das MCO geprägt: Er wurde bereits 1998 als 22-jähriger zum Ersten Gastdirigenten, 2003 zum Musikdirektor und 2008 zum Principal Conductor gewählt. Im Sommer 2011 ernannte das Orchester Daniel Harding einstimmig zum Conductor Laureate. Eine weitere zentrale Stellung nimmt der norwegische Pianist Leif Ove Andsnes ein, der dem MCO seit 2012 als Artistic Partner verbunden ist. Unter dem Titel »The Beethoven Journey« sind Andsnes und das MCO 2012 – 2015 mit einem 13 13550_KM_30-05-13_d.indd 13 27.05.13 17:26 Beethoven-Zyklus unterwegs, wobei Andsnes das MCO vom Klavier aus leitet. Beethovens fünf Klavierkonzerte und die Chorfantasie gelangen in mehr als 60 Konzerten in über zehn Ländern zur Aufführung und werden auf CD veröffentlicht. Das MCO hat 25 zum Teil preisgekrönte Alben eingespielt. Zuletzt erschienen im September 2012 der erste Teil der »Beethoven Journey« mit Leif Ove Andsnes und den Klavierkonzerten Nr. 1 und 3 sowie 2013 George Benjamins neue Oper Written on Skin, die das Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung des Komponisten beim Festival d’Aix-en-Provence 2012 zur Uraufführung brachte. In der Kölner Philharmonie war das Mahler Chamber Orchestra zuletzt im Februar zu hören. 14 13550_KM_30-05-13_d.indd 14 27.05.13 17:26 Danke – und auf Wiedersehen, NRW! Mit diesem Konzertprogramm endet die Residenz des Mahler Chamber Orchestra in Nordrhein-Westfalen. Vier Jahre lang, von 2009 bis 2013, waren das Konzerthaus Dortmund, die Philharmonie Essen, die Kölner Philharmonie und das Orchesterzentrum | NRW dem MCO eine kreative Heimat. Die Kunststiftung NRW und das Land Nordrhein-Westfalen begleiteten uns als Partner und Förderer. Das Mahler Chamber Orchestra spielte im Rahmen der Residenz insgesamt 45 Orchesterkonzerte und konzertante Opern sowie zahlreiche Kammermusikkonzerte. Entdecken und bespielen durften wir auch Orte außerhalb der großen Bühnen, wie das Dortmunder U, das Museum Folkwang Essen und den Alten Wartesaal Köln, um nur drei Beispiele zu nennen. Zur Residenz gehörten außerdem verschiedenste Education-Projekte: So besuchten Musiker des MCO regelmäßig Schulklassen in Dortmund, MCO-Solisten spielten mit einem türkischen Baglama-Ensemble in Essen, und das Orchester brachte sein großes Projekt »Feel the Music«, das die Welt der Musik für gehörlose Kinder öffnet, nach Köln. Einen Grundpfeiler der Residenz bildete in Zusammenarbeit mit dem Orchesterzentrum | NRW in Dortmund der Aufbau der MCO Academy. In kurzer Zeit hat sie sich als attraktives Ausbildungsmodell etabliert, das jungen professionellen Musikern hochqualifizierte Orchestererfahrung sowie eine einzigartige Plattform für internationalen Austausch und Vernetzung bietet. Wir freuen uns außerordentlich, dass die MCO Academy auch nach dem Ende dieser Residenz bestehen bleibt und sprechen dem Land NRW unseren herzlichsten Dank für diese Unterstützung aus. Dortmund, Essen und Köln sind dem MCO sehr ans Herz gewachsen. Die regelmäßigen Aufenthalte in der NRW-Residenz bildeten eine wunderbare Konstante im Orchesterleben. Das fantastische Publikum und unsere Freunde und Partner in den drei Konzerthäusern und im Orchesterzentrum | NRW haben uns Nordrhein-Westfalen zu einem Stück Heimat werden lassen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir auch in Zukunft – wenn auch nicht als Residenzorchester – regelmäßig nach NRW zurückkehren werden. Ihr Mahler Chamber Orchestra 15 13550_KM_30-05-13_d.indd 15 27.05.13 17:26 Die Besetzung des Mahler Chamber Orchestra Violine I Abigail Young Konzertmeisterin Michael Brooks Reid Annette zu Castell Kirsty Hilton May Kunstovny Alexander Robson Geoffroy Schied Henja Semmler Timothy Summers Lina Tur Bonet Laurent Weibel Yi Yang Flöte Chiara Tonelli Júlia Gallégo Oboe Mizuho Yoshii-Smith Emma Schied Klarinette Andreas Sunden Jaan Bossier Fagott Audun Halvorsen Joost Bosdijk Violine II Yun-Jin Cho * Michiel Commandeur Daniel Frankel Christian Heubes Paulien Holthuis Jana Ludvickova Sonja Starke Anna Theresa Steckel Adriane Tilanus Malin William-Olsson Horn René Pagen François Bastian Stefán Jón Bernhardsson Björn Olsson Trompete Christopher Dicken Paul Sharp Viola Joel Hunter * Béatrice Muthelet * Florent Bremond Yannick Dondelinger David Lau Hanne Skjelbred Delphine Tissot Anna Puig Torné Posaune Andreas Klein John Tony Randall Mark Hampson Violoncello Johannes Rostamo * Natalie Caron Stefan Faludi Samuel Lutzker Christophe Morin Philipp von Steinaecker * Stimmführer Pauke Martin Piechotta Kontrabass Burak Marlali * Xiao-Yin Feng Juan José Marquez Fandino Axel Ruge Johane Gonzalez Seijas 16 13550_KM_30-05-13_d.indd 16 27.05.13 17:26 Daniel Harding Daniel Harding, in Oxford geboren, begann seine Laufbahn als Assistent von Sir Simon Rattle beim City of Birmingham Symphony Orchestra, mit dem er 1994 auch sein Debüt als Dirigent gab. Danach arbeitete er mit Claudio Abbado bei den Berliner Philharmonikern, die er 1996 bei den Berliner Festspielen erstmals dirigierte. Er ist Erster Gastdirigent des London Symphony Orchestra, Musikdirektor des Swedish Radio Symphony Orchestra, Ehrendirigent des Mahler Chamber Orchestra und künstlerischer Partner des New Japan Philharmonic. Zuvor war Daniel Harding unter anderem Chefdirigent des Trondheim Symfoniorkester (1997 – 2000), Erster Gastdirigent beim schwedischen Norrköping Symphony Orchestra (1997 – 2003) sowie Musikdirektor der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen (1997 – 2003) und des Mahler Chamber Orchestra (2003 – 2011). Daniel Harding ist regelmäßiger Gast bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden und den Wiener Philharmonikern, die er beide bei den Salzburger Festspielen dirigiert hat, bei den Berliner Philharmonikern, dem Königlichen Concertgebouworchester Amsterdam, dem Gewandhausorchester Leipzig und dem Orchestra Filarmonica della Scala. Außerdem dirigierte er das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die Münchner Philharmoniker, das Orchestre National de Lyon, das Oslo Philharmonic, das London Philharmonic, das Royal Stockholm Philharmonic, das Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, das Orchestra of the Age of Enlightenment, das Rotterdam Philharmonic, das hr-Sinfonieorchester und das Orchestre des Champs-Élysées. Zu den amerikanischen Orchestern, die Harding dirigiert hat, gehören das New York Philharmonic, das Philadelphia Orchestra, das Los Angeles Philharmonic und das Chicago Symphony Orchestra. 2005 eröffnete Daniel Harding die Saison an der Mailänder Scala mit dem Dirigat von Idomeneo. 2007 kehrte er dorthin zurück, um Salome zu dirigieren, 2008 leitete er eine Doppelvorstellung von 17 13550_KM_30-05-13_d.indd 17 27.05.13 17:26 Herzog Blaubarts Burg und Il Prigionero und 2011 Produktionen von Cavalleria Rusticana und I Pagliacci, für die er den renommierten Abbiati-Preis erhielt. Seine Opernengagements umfassten zudem The Turn of the Screw und Wozzeck am Royal Opera House sowie Ariadne auf Naxos, Don Giovanni und Le nozze di Figaro bei den Salzburger Festspielen mit den Wiener Philharmonikern. Dem Festival von Aix-en-Provence eng verbunden, hat Daniel Harding dort Neuproduktionen von Così fan tutte, Don Giovanni, The Turn of the Screw, La Traviata, Eugen Onegin und Le nozze di Figaro dirigiert. Weitere Engagements waren unter anderem Die Zauberflöte in Wien, Die Entführung aus dem Serail an der Bayerischen Staatsoper in München und Jenůfa an der Welsh National Opera. Daniel Harding dirigierte in dieser Spielzeit Falstaff an der Scala und gab seine Debüts an der Deutschen Staatsoper in Berlin und an der Wiener Staatsoper mit dem Fliegenden Holländer. Daniel Hardings jüngste Aufnahmen von Mahlers zehnter Sinfonie mit den Wiener Philharmonikern und Orffs Carmina Burana mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wurden von der Kritik hoch gelobt. Unter den zuvor eingespielten Aufnahmen befinden sich Mahlers Sinfonie Nr. 4 mit dem Mahler Chamber Orchestra, die Sinfonien Nr. 3 und Nr. 4 von Brahms mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, Billy Budd mit dem London Symphony Orchestra, Don Giovanni und The Turn of the Screw (mit dem Choc de l’Année 2002, dem Grand Prix de l’Academie Charles Cros und einem Gramophone Award ausgezeichnet) mit dem Mahler Chamber Orchestra, Werke von Lutosławski mit Solveig Kringelborn und dem Norwegian Chamber Orchestra sowie Werke von Britten mit Ian Bostridge und der Britten Sinfonia (mit dem Choc de l’année 1998 ausgezeichnet). 2002 verlieh die französische Regierung Daniel Harding den Ehrentitel eines Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 2012 wurde er zum Mitglied der Royal Swedish Academy of Music ernannt. In der Kölner Philharmonie dirigierte Daniel Harding zuletzt im Oktober 2010 das Königliche Concertgebouworchester Amsterdam. 18 13550_KM_30-05-13_d.indd 18 27.05.13 17:26 NACH DEM KONZERT INS FUNKHAUS Lassen Sie den Abend genussvoll ausklingen mit Wein, Cocktails u.v.m. Wallrafplatz 5 • 50667 Köln • www.funkhaus-koeln.de So-Do 8:30-24:00 Uhr • Fr-Sa 8:30-1:00 Uhr Warme Küche bis 23:00 Uhr 13550_KM_30-05-13_d.indd 19 27.05.13 17:26 KÖLNMUSIK-VORSCHAU Juni FR 07 20:00 SO 02 Christianne Stotijn Mezzosopran Königliches Concertgebouworchester Amsterdam Gustavo Dudamel Dirigent 11:00 Jugend musiziert Konzert der Bundespreisträger aus Nordrhein-Westfalen Esteban Benzecry Colores de la cruz del sur für Orchester KölnMusik gemeinsam mit dem Landesmusikrat NRW Peter Lieberson Neruda Songs für Mezzosopran und Orchester SO Antonín Dvorák Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 B 178 »Aus der Neuen Welt« 02 20:00 Gefördert durch das Kuratorium KölnMusik e.V. Krystian Zimerman Klavier Internationale Orchester 5 Claude Debussy Estampes L 100 (1903) Johannes Brahms Sonate für Klavier fis-Moll op. 2 (1852) SO 09 Claude Debussy Préludes (1er livre) L 117 (1909 – 10) Auszüge 15:00 Filmforum Karol Szymanowski Andante ma non troppo op. 1,1 Andante con moto op. 1,2 Andante ma non troppo op. 1,8 aus: 9 Präludien op. 1 (1899 – 1900) Der Lieblingsfilm von … Gustavo Dudamel Der Pate (The Godfather) Francis Ford Coppola Regie Gangsterfilm (USA 1971), 176 Min., deutsche Fassung Variationen h-Moll über ein polnisches Thema op. 10 (1900 – 04) KölnMusik gemeinsam mit Kino Gesellschaft Köln € 7,50 | ermäßigt: € 7,– Für Abonnenten der KölnMusik mit Abo-Ausweis: € 6,– Karten an der Kinokasse 20 13550_KM_30-05-13_d.indd 20 27.05.13 17:26 Foto: Felix Broede Montag 3. Juni 2013 20:00 Academy of St. Martin in the Fields Murray Perahia Klavier und Leitung In einer Doppelfunktion als Pianist und Dirigent ist der dreifache Grammy-Gewinner und ECHO-Preisträger Murray Perahia, von Königin Elisabeth II zum »Knight Commander of the British Empire« ernannt, gemeinsam mit der Academy of St. Martin in the Fields in Köln zu Gast. Orchester und Perahia – derzeit Erster Gastdirigent der Academy – präsentieren Mozart pur mit der »Serenata notturna«, dem »Krönungskonzert« und der Sinfonie Es-Dur KV 543. 13550_KM_30-05-13_d.indd 21 27.05.13 17:26 IHR NÄCHSTES ABONNEMENT-KONZERT MI Liebe Konzertbesucher, liebe Abonnenten! 12 mit dem heutigen Konzert endet Ihr Abonnement »Klassiker!«. Auch für die kommende Spielzeit haben wir Ihnen ein Abonnement mit fünf hochkarätigen Konzerten, zusammengestellt. 20:00 Artemis Quartett Vineta Sareika Violine Gregor Sigl Violine Friedemann Weigle Viola Eckart Runge Violoncello Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Spielzeit als Abonnenten begrüßen zu können! Felix Mendelssohn Bartholdy Streichquartett e-Moll op. 44,2 Streichquartett a-Moll op. 13 Weitere Einzelheiten zu dieser Reihe entnehmen Sie bitte unserer neuen Vorschau »Kölner Philharmonie 2013/2014«, die am 17. Mai 2013 erschienen ist. Alberto Ginastera Streichquartett Nr. 2 op. 26 In der neuen Vorschau finden Sie neben den Konditionen für den Erwerb Ihres Abonnements auch Informationen zu unserer Aktion »Abonnenten werben Abonnenten«! Johann Sebastian Bach / Astor Piazzolla Präludien und Fugen Quartetto 5 SO 16 18:00 Igor Levit Klavier Orchestre Philharmonique du Luxembourg Thomas Søndergård Dirigent Johannes Brahms Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur op. 83 Richard Strauss Eine Alpensinfonie op. 64 Tondichtung für großes Orchester 11:00 Bergisch Gladbach Lückerath Blickwechsel Musik und Natur: »Waldeslauschen – Der Berg ruft« Kölner Sonntagskonzerte 5 22 13550_KM_30-05-13_d.indd 22 27.05.13 17:26 Mittwoch 19. Juni 2013 20:00 Foto: Florian Profitlich Concerto Köln Johann Sebastian Bach Brandenburgische Konzerte Nr. 1 bis 6 BWV 1046 – 1051 Seit mehr als 25 Jahren zählt Concerto Köln zu den führenden Ensembles im Bereich der historischen Aufführungspraxis. Die Musiker mit Sitz in Köln-Ehrenfeld wurden von der EU-Kommission zu kulturellen Botschaftern der Europäischen Union ernannt. In der Kölner Philharmonie sind sie nun mit der Aufführung der kompletten, dem Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg-Schwedt gewidmeten Brandenburgischen Konzerte von Johann Sebastian Bach zu Gast. 13550_KM_30-05-13_d.indd 23 27.05.13 17:26 Philharmonie-Hotline 0221 280 280 koelner-philharmonie.de Informationen & Tickets zu allen Konzerten in der Kölner Philharmonie! Kulturpartner der Kölner Philharmonie Herausgeber: KölnMusik GmbH Louwrens Langevoort Intendant der Kölner Philharmonie und Geschäftsführer der KölnMusik GmbH Postfach 102163, 50461 Köln koelner-philharmonie.de 13550_KM_30-05-13_d.indd 24 Redaktion: Sebastian Loelgen Corporate Design: hauser lacour kommunikationsgestaltung GmbH Textnachweis: Der Text von Ulrike Heckenmüller ist ein Originalbeitrag für dieses Heft. Fotonachweis: Felix Broede S. 10; Deutsche Grammophon/Julian Hargreaves S. 17; Sonja Werner S. 12 Gesamtherstellung: adHOC Printproduktion GmbH 27.05.13 17:26 13550_KM_30-05-13_d.indd U3 27.05.13 17:26 Foto: Christophe Abramowitz Samstag 22.06.2013 20:00 Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 Domkantorei Köln Männerstimmen des Kölner Domchores Vokalensemble Kölner Dom Solisten Gürzenich-Orchester Köln Kurt Masur Dirigent koelner-philharmonie.de Roncalliplatz, 50667 Köln direkt neben dem Kölner Dom (im Gebäude des RömischGermanischen Museums) 13550_KM_30-05-13_d.indd U4 Neumarkt-Galerie 50667 Köln (in der Mayerschen Buchhandlung) Philharmonie-Hotline 0221 280 280 27.05.13 17:26