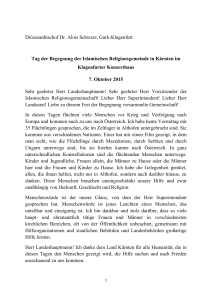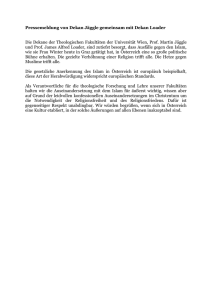Hausarbeit zu: Wolf von Niebelschütz, Die Kinder der Finsternis
Werbung

1 Die Darstellung islamischer Kultur in Die Kinder der Finsternis von Wolf von Niebelschütz Gliederung 1. Vorgehensweise 2. Darstellungsweise und Stellenwert des Maurenmotivs 3. Darstellung einzelner Aspekte im Roman und ihr Bezug zur historischen Realität 3.1. Räumliche und zeitliche Lokalisierung der Maurenkultur 3.2. Heiliger Krieg 3.3. Historische Vorbilder für Personen und Personenkonstellationen 3.4. Bereiche kulturellen Transfers 3.4.1. Land- und Wasserwirtschaft bei den Mauren 3.4.2. Wissenschaften im Islam 3.4.3. Kunst und Architektur der Mauren 3.5. Bereiche kultureller Verschiedenheit 3.5.1. Struktur der mittelalterlichen islamischen Gesellschaft 3.5.2. Der Islam als Religion und die Frage der religiösen Toleranz 3.5.3. Haremskultur, Sexualität und die Stellung der Frau 3.6. Exotik und orientalische Eigenheiten 4. Schluß 5. Benutzte Literatur 5.1. Primärliteratur 5.2. Sekundärliteratur 2 1. Vorgehensweise In dieser Hausarbeit möchte ich mich mit der Frage auseinandersetzen, welche Rolle die Darstellung maurischer Kultur in Wolf von Niebelschütz’ historischem Roman Die Kinder der Finsternis1 spielt und inwieweit das Dargestellte mit der historischen Realität übereinstimmt bzw. welchen Anteil die historische Fiktion einnimmt 2. Bei der Auswahl der Gliederungspunkte des Hauptteils orientiere ich mich primär an den im Roman thematisierten Aspekten islamisch-maurischer Kultur (bzw. ihrer Konfrontation mit der christlichen); andere Gesichtspunkte werden unter Umständen erwähnt, jedoch nicht weiter ausgeführt. Zunächst werde ich mich kurz mit der Art der Darstellung beschäftigen, sowie mit der Frage nach dem Stellenwert, den das Motiv der Maurenzivilisation im Roman einnimmt (Punkt 2.). Den Hauptteil dieser Arbeit wird die Untersuchung einzelner Gesichtspunkte ausmachen (Punkt 3.). Dabei beginne ich mit der Frage nach der räumlichen und zeitlichen Lokalisierung der Maurenkultur (Punkt 3.1.), dem Heiligen Krieg (Punkt 3.2.) und der Frage nach etwaigen historischen Vorbildern der Personenkonstellationen (Punkt 3.3.). Anschließend werde ich mich mit den kulturellen Aspekten selbst beschäftigen, wobei ich jene Gebiete, auf denen Kulturtransfer stattgefunden hat (Punkt 3.4.), von solchen, die im scharfen Kontrast oder gar Konflikt zur christlich-abendländischen Kultur stehen (Punkt 3.5.), unterscheide. Abschließend werde ich die Ergebnisse kurz zusammenfassen und versuchen, einen Schluß aus ihnen zu ziehen. 2. Darstellungsweise und Stellenwert des Maurenmotivs Das zweite noch zur Exposition gehörende Kapitel beginnt mit den Worten: „Mauretanische Mark hieß das kaiserliche Grenzland nach seinen morddurstigen Nachbarn am Meer, den Mauren, Mohren oder Sarazenen; ...“ (S.13); es ist die erste inhaltlich relevante Erwähnung des Motivs der maurischen Kultur, das sich von nun an bis hinein ins letzte Kapitel durch das ganze Buch ziehen wird. Die meiste Zeit hindurch bleibt es ein Thema im Hintergrund, mit dem der Leser nur indirekt konfrontiert wird, entweder durch Informationen von seiten des auktorialen Erzählers, der den historischeen und geographischen Rahmen erläutert (vgl. die eben zitierte Textstelle), oder durch die Erwähnung, die es in den Gesprächen der Protagonisten findet (vgl. die Gespräche im Kapitel „Der schwarze Satan“ ab Seite 52). 1 Wolf von Niebelschütz, Die Kinder der Finsternis (München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1995). Alle Zitate mit Seitenzahlen im Text nach dieser Ausgabe. 2 Wenn ich hier von „historischer Realität“ und „Fiktion“ spreche, so bin ich mir der Problematik dieser Begriffe bewußt und benutze sie unter Vorbehalt aus Gründen der Einfachheit. Was bei der Beurteilung der Darstellung einer fremden Kultur, die noch dazu in zeitlicher Ferne liegt, „real“ und was „fiktiv“ genannt wird, ist extrem abhängig von der Quellenlage und der (kulturellen) Perspektive des Beurteilenden. Um eine Einengung dieser Perspektive zu vermeiden, habe ich mich um die Benutzung verschiedener sekundärliterarischer Werke (vgl. 5.2.) und um gegebenenfalls vorsichtige Formulierungen bemüht und spreche von „Realität“ und „Fiktion“ nur dort, wo ich es für vertretbar halte. 3 Obwohl es als Motiv durchgängig ist, gibt es viele Passagen, in denen es so gut wie keine Rolle spielt, d.h. bestenfalls am Rande erwähnt wird, etwa in den Kapiteln, die sich mit der Verfolgung und Bestrafung Walos befassen. Dem gegenüber stehen Kapitel, wenngleich es wenige sind, in denen dieses Motiv völlig dominiert; es sind die Kapitel, in denen sich die Handlung (größtenteils) auf maurischem Boden bzw. im maurischen Lager abspielt, z.B. „Das Treffen im Gebirge“, „Dschondis“ und „Fatima“. In den beiden erstgenannten Kapiteln geht es um das Duell des Markgrafen und des Emirs zur Beilegung des Grenzkonflikts, der militärisch unentscheidbar geworden ist, und um das Schließen einer Freundschaft zwischen Barral und Salâch; das letztgenannte Kapitel behandelt den Verbleib der auf Wallfahrt verschollenen Fastrada. In allen drei Kapiteln werden für die Handlung entscheidende Weichenstellungen vorgenommen, so daß die Vermutung naheliegt, daß es sich bei dem Maurenmotiv um mehr handelt als bloß um exotisches Dekorum, worauf auch die bereits erwähnte zentrale Stellung in der Exposition hinweist. Trotzdem hat es ohne Zweifel auch eine dekorative Funktion inne: Die orientalische, im „Fatima“-Kapitel fast märchenhafte Atmosphäre dieser Abschnitte verleiht dem Buch eine zusätzliche Faszination. Niebelschütz spielt z.T. sogar ganz bewußt mit dem Element des Exotischen und der von ihm ausgehenden Faszination. So spricht er auf S. 130 explizit von der „Verlockung des Fremdartigen“ (in Bezug auf den in Dschondis weilenden Peregrin) und spielt auf S. 507 mit dem exotischen Klang orientalischer Begriffe und deren oft simpler Bedeutung: „...aber Si Kara wußte nichts von Si Iskander, so wenig wie Herr Alexander von Herrn Kara.“ Doch wäre es zuviel gesagt, wollte man es als ein Hauptanliegen Niebelschütz’ bezeichnen, die maurische Kultur zu jener Zeit darzustellen, denn dafür wird dieses Thema nicht tief genug behandelt. Viele Aspekte werden nur stichwortartig erwähnt oder an der Oberfläche berührt, etwa die Rechtsvorstellungen, die in der verbalen Äußerung „Ein Prozess? bei uns ersticht man sofort.“ (S. 136) und den Äußerungen herrschaftlicher Willkür (man denke an den Kalifen im „Fatima“-Kapitel, der schwangere Haremsdamen enthaupten läßt) anklingen, aber an keiner Stelle weiter expliziert werden. Dieses wird auch an der Behandlung der maurischen Religion, des Islam, deutlich, die ausschließlich in ihrer Funktion als politischer Machtfaktor Berücksichtigung findet, nicht aber in ihrer Relevanz für das Selbst- und Weltverständnis der gläubigen Moslems jener Zeit, was eine kulturelle Innenperspektive voraussetzen würde, wie Niebelschütz sie beim Christentum zum Tragen kommen läßt. Doch welche Funktion hat dieses Motiv, wenn es wichtig erscheint, ohne jedoch inhaltlich vertieft zu werden? Auffällig ist, daß beide Kulturen, Islam und Christentum, die sich zu jener Zeit in einer kriegerischen Konfrontation befanden, bei Niebelschütz gleichermaßen ambivalent dargestellt werden: Niebelschütz betreibt keine Schwarz-Weiß-Malerei, sondern stellt beide Kulturen als mit Fehlern behaftet aber auch als mit Vorzügen ausgestattet dar; findet man auf christlicher Seite Ketzerverfolgung und Inquisition, so finden sich bei den Mauren etwa der Sklavenhandel oder die massive Unterdrückung der Frau; analog stehen Akte christlicher Nächstenliebe der Edelmut und der unglaublichen Kultiviertheit des sarazenischen Lebensstils gegenüber; keine Kultur steht der jeweils anderen in puncto Grausamkeit und Tu- 4 gendhaftigkeit um etwas nach3. So scheint es, daß Niebelschütz das Maurenmotiv nicht als Selbstzweck, sondern vielmehr als kulturellen Kontrast einbringt, um die eigene Kultur, nämlich die christlich-abendländische, in Abgrenzung gegen eine fremdartige deutlicher in ihrer Eigenart zu konturieren, ohne dabei eine von beiden als höherwertig einzustufen. Niebelschütz’ Standpunkt ist also der eines Kulturrelativisten. Konsequenterweise fehlt im Roman eine übergeordnete, externe Instanz, die einen Maßstab zur Verfügung stellen könnte, anhand dessen man einer Kultur den Vorzug vor der anderen geben könnte. Das gilt analog für das Judentum (repräsentiert durch Jared) und die heidnische Religion Maitagorrys. 3. Darstellung einzelner Aspekte im Roman und ihr Bezug zur historischen Realität 3.1. Räumliche und zeitliche Lokalisierung der maurischen Kultur Ich möchte mich nur ausschnittsweise mit der Ausdehnung der islamischen Einflußsphäre befassen, d.h. vor allem mit jenen Gebieten im Südwesten Europas, die eine vorübergehende Islamisierung erlebten, da in Hinblick auf den Roman Die Kinder der Finsternis, dessen Handlung im 12. Jahrhundert angesiedelt ist, vorwiegend diese von Relevanz sind. Getrieben vom messianischen Eifer der Gläubigen begann sich der Islam nach dem Tode Mohammeds im 7. Jahrhundert von seinem Ursprungs- und Kerngebiet, den Wüsten Arabiens, in alle Richtungen auszudehnen. Im Osten wurde er bis nach Indien getragen, im Westen ergoß er sich in den Mittelmeerraum, den das islamische Reich zeitweise zu gut zwei Dritteln umschloß. Im östlichen Mittelmeerraum kam es zur Konfrontation mit dem Oströmischen oder auch Byzantinischen Reich, das im Laufe der Auseinandersetzung, die im 8. Jahrhundert begann und bis zum 11. Jahrhundert andauerte, immer weiter zurückgedrängt und seiner Hegemonie in dieser Region beraubt wurde. In der Endphase dieser Auseinandersetzung übernahmen die seldschukischen Türken die Rolle der Araber und eroberten 1071 Kleinasien. Außerdem wurden kleine Teile Griechenlands vorübergehend von den Moslems erobert, ebenso wie Kreta, wo sie von 826 bis 961 herrschten, und Zypern. Etwas weiter westlich ist die Eroberung Siziliens durch die Heerscharen des Propheten zu nennen. Die dem italienischen Festland vorgelagerte Insel war von 902 bis 1060 unter islamischer Herrschaft, die zu erringen es mehr als siebzig Jahre gebraucht hatte; endgültig beendet wurde diese dann um 1090 durch die Normannen. Festlanditalien erlebte immer wieder kurze, räuberische Vorstöße der Araber, die aber zu keiner dauerhaften Etablierung von Herrschaft führten, doch gab es in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts zwei kurzlebige arabische Emirate in Bari und Tarent. Von größerer Bedeutung für die europäische Geschichte ist allerdings die Entwicklung im westlichen Mittelmeerraum. Die Araber eroberten binnen kurzer Zeit Nordafrika, wo 3 Die angeschnittenen Einzelaspekte werden weiter unten näher behandelt. 5 sie sich u.a. mit den Berbern mischten und von wo aus sie im Jahre 711 über die Meerenge von Gibraltar setzten und so auf die Iberische Halbinsel gelangten. Von dort aus drangen sie rasch bis über die Pyrenäen nach Norden vor. In Südfrankreich wurde dieser Eroberungszug 732 durch die Truppen Karl Martells zwischen Tours und Portiers gestoppt, so daß sich die Eroberer bis hinter die Pyrenäen zurückzogen. Es kam zu einer Etablierung arabisch-berbischer oder: maurischer4 Herrschaft auf etwa drei Vierteln der Iberischen Halbinsel, die bis 1492 andauerte, sich zuletzt aber auf den Süden beschränkte und von der Reconquista der Christen beendet wurde. In dieser Zeit gab es immer wieder einzelne Vorstöße der Araber nach Frankreich, in die Provence, und z.T. bis in die Schweiz und nach Norditalien, auch von der Berberei aus, doch handelte es sich dabei nicht um Eroberungs-, sondern ausschließlich um Beutezüge. Cordoba war in jenen Tagen neben Bagdad im Osten ein wichtiges kulturelles und geistiges Zentrum innerhalb des islamischen Reichs und die durch die Eroberung bedingte Berührung von Islam und Christentum gilt trotz des kriegerischen Vorzeichens als die fruchtbarste überhaupt (dazu später mehr). Nun stellt sich die Frage, inwieweit der Roman auf diese geo-historischen Verhältnisse Bezug nimmt bzw. wo er davon abweicht. Zunächst ist festzustellen, daß an einigen Stellen im Roman die arabisch-berbische Herrschaft in Nordafrika und auf der Iberischen Halbinsel erwähnt wird, ohne aber eine wichtige Rolle zu spielen, z.B. auf S. 275: „Er war Arzt gewesen, bevor man ihn zur Lehre des Talmud berief; sie sprachen Sarazenisch, er kam aus dem Kalifat Cordoba.“ Und zwei Seiten später: „Sie [die Schlinge] konnte lebenslang locker bleiben; konnte auch plötzlich gezurrt werden. Sie wurde gezurrt jenseits des Meeres in der Berberei durch den neuen Sultan.“ Von größerem Interesse ist dann aber die Frage nach Dschondis, genauer: danach, welche Stadt Dschondis entspricht und ob sie im 12. Jahrhundert (oder überhaupt irgendwann) ein Emirat gewesen ist. Vergleicht man die Karte, die Niebelschütz dem Buch am Ende beigefügt hat, mit einer geographischen und bezieht in die Betrachtung die im Nachwort von Ilse von Niebelschütz auf S. 591 unterhalb der Mitte gegebenen geographischen Hinweise, sowie die im Roman auf den Seiten 130 und 131 gegebenen Informationen, daß Dschondis von der Landseite her durch „steile, waldbedeckte Gebirgszüge; tief eingeschnittene Talschrunden“ geschützt und in einer „vom Meere aus uneinnehmbaren Bucht“ gelegen war, mit ein, so ist der Schluß zwingend, daß Dschondis geographisch mit Toulon identisch ist. Hinweise auf eine historische Identität hingegen gelang es mir nicht zu finden; Toulon scheint zu keiner Zeit ein Emirat gewesen zu sein und insofern ist Dschondis 4 Zur Erläuterung des Begriffs „maurisch“ möchte ich Brett und Forman zitieren: „Der Name Maure war die Bezeichnung, die die Christen den Muslimen Andalusiens und Nordafrikas gaben. Er leitet sich aus einem alten Wort für Nordafrika ab, das sich im Namen Mauretanien erhalten hat, der römischen Bezeichnung für Marokko. Mit dem Begriff sollte Dunkelhäutigkeit, sogar schwarze oder negroide Gesichtsfarbe angedeutet werden - in dem Sinne, wie man sich Othello in Shakespeares Mohr von Venedig vorzustellen hat. Als Unterscheidung von hellhäutigen Muslimen wurde es sogar notwendig, von ‘weißen Mauren’ zu sprechen. Das Wort Mauren vor allem mit Dunkelhäutigkeit in Verbindung zu bringen, kommt wahrscheinlich daher, daß im Laufe der Jahrhunderte ungeheuer viele Sklaven aus dem westlichen und mittleren Sudan importiert wurden, die als Diener, Konkubienen oder Soldaten Verwendung fanden.“ (aus: M. Brett und W. Forman, Die Mauren: Islamische Kultur in Nordafrika und Spanien (Luzern und Herrsching: Atlantis Verlag, 1986), S.25. 6 eine historische Fiktion5, die ihr Vorbild vermutlich in den bereits erwähnten kurzlebigen Emiraten in Bari und Tarent auf dem italienischen Festland hat. Die innere Zerstrittenheit und der Fall Dschondis’ an die Christen am Ende des Buches kann als Widerspiegelung der Verhältnisse auf der Iberischen Halbinsel angesehen werden, wo innerer Unfrieden die Mauren geschwächt hatte und sich der Islam zu dieser Zeit bereits auf dem Rückzug befand. Schließlich sind da noch die „immergrünen vulkanischen Smaragd-Inseln im Ozean“ (S. 507), auf denen die Handlung zu Beginn des „Fatima“-Kapitels spielt. Da nicht angegeben ist, in welchem Ozean sie gelegen sind und auch sonst kaum weitere Informationen gegeben werden, ist man in bezug auf ihre etwaige historisch-geographische Entsprechung auf Spekulationen angewiesen. Am ehesten kommen die Kanarischen Inseln in Frage, da sie vulkanischen Ursprungs sind, dicht vor der Küste Nordafrikas im Ozean liegen und die Urbevölkerung berberischen Einschlag hat; auch paßt ihre Lage in Äquatonähe zu der auf Seite 513 erwähnten Regenzeit. Doch finden sich in der Geschichte dieser Inseln keine Spuren islamischer Herrschaft, so daß die Entsprechung von Roman und Realität hier, wenn überhaupt vorhanden, ähnlich wie bei Dschondis nur eine geographische sein kann. 3.2. Heiliger Krieg In den „Kindern der Finsternis“ finden diverse Kriege zwischen Islam und Christentum Erwähnung, doch wird nur der Krieg zwischen Kelgurien und Dschondis für den Leser greifbar und anschaulich, während alle anderen Kriege entweder in wenigen Sätzen abgehandelt werden (z.B. auf S. 582: „Helena weilte bereits in Mirsalon, dessen Flotte auslief, und veranlaßte das gleiche in Genua. Dom Gero Sartena und Dom Rafael Bramafan zogen kampflos durch das Mohrengebirge. Die Kriegsgaleeren des berberischen Sultans wurden auf hoher See geentert, in Grund gebohrt, verbrannt oder zum Abdrehen genötigt.) oder für die Handlung nur durch indirekte Auswirkungen von Bedeutung sind (vgl. das Kapitel „Folgen der Kreuznahme“, in dem es um die Auswirkungen von Markgraf Karls Entschluß, an einem Kreuzzug teilzunehmen, geht). Neben den Kreuzzügen, auf die ich hier nicht weiter eingehen möchte, weil sie Bestandteil der christlichen (Un-)Kultur waren, und den schlichten Beuteund Zerstörungskriegen der Mauren, wie sie etwa in der Gestalt der Zerstörung Ghissis im Roman auftauchen, wird an mehreren Stellen der Heilige Krieg, der Djihad, erwähnt. Da dieser ein wichtiges Element der (damaligen) islamischen Weltsicht ist, möchte ich näher auf ihn eingehen. Bedingt durch die Tatsache, daß im (frühen) Islam, anders als im frühen Christentum, Politik und Religion keine zwei Dinge waren, weil sich die frühen Moslems, im Gegensatz zu den frühen Christen, nicht gegen einen sie verfolgenden Staat (Rom) zur Wehr setzen mußten, 5 Unter historischer Fiktion verstehe ich hier die Bezugnahme auf Personen, Personenkonstellationen, politische Ereignisse, Orte, u.ä., für deren Existenz sich in der Geschichtsschreibung keinerlei Belege finden lassen, die aber für die fiktive Historie des Romans sehr wohl von Bedeutung sind. Da sie dabei mit überprüfbaren historischen Fakten oft eng verkettet sind (man denke an die Erwähnung von Päpsten, Bischöfen, Kaisern, Kriegen, Ländern, usw.), ist es oft schwer auszumachen, wo die Fiktion in Realität übergeht und umgekehrt. 7 sondern ihren eigenen Staat bildeten, ist ein utopischer, idealstaatlicher Anspruch integraler Bestandteil der Heilsleere des Islam6. Dieses Ideal besteht in einer Theokratie, in der der Staat hinsichtlich seiner Legitimation und Organisation auf der religiösen Offenbarung basiert und die es aufgrund des Universalanspruchs des Islam zu verbreiten gilt. Hieraus wird im Koran die ständige Pflicht eines Moslems bzw. der moslemischen Gemeinschaft abgeleitet, den Islam zu verteidigen und zu verbreiten; der Djihad7 ist also ein Dauerzustand, der erst dann endet, wenn der Islam seinem Anspruch auf universale Gültigkeit gemäß die ganze Welt umspannt. Die göttliche Gnade bezeugt sich den Gläubigen hierbei in dieser Welt durch den Sieg und die Herrschaft des Islam — eine Position, die in der Anfangsphase der unvergleichlich rasanten Ausbreitung dieser Religion durch die überwältigenden Erfolge der moslemischen Heere bestätigt zu werden schien, die später jedoch, als es herbe Rückschläge wie den Verlust Spaniens gab, relativiert werden mußte. In jener Zeit war die Welt aus der Sicht der Moslems ganz klar zweigeteilt: Es gab das „Gebiet des Islam“ und auf der anderen Seite den Rest der Welt, der je nach Zustand „Gebiet des Krieges“ oder „Gebiet des Friedensschlusses“ (oder auch: „des Vertrages“) genannt wurde. Verträge und Friedensschlüsse mit nichtmoslemischen Mächten waren möglich, wenn sie opportun waren, d.h. wenn der Gegner nicht besiegt werden konnte. Der Djihad wurde bei solchen Gelegenheiten gewissermaßen zurück-, nicht jedoch eingestellt, auch kam es in solchen Situationen teilweise zur Substituierung der kriegerischen Form des Djihad etwa durch gute Taten oder durch friedliche Missionierung. Der Vertrag zwischen Kelgurien und Dschondis in den „Kindern der Finsternis“ ist ein gutes, wenngleich fiktives Beispiel hierfür, denn die Vereinbarung von Tributzahlungen, wie sie vom Markgrafen Rodero auf S. 55 unten erstmals in Erwägung gezogen werden, waren ein durchaus gängiges Muster im Umgang mit andersgläubigen Gemeinschaften. Tributzahlungen bedeuteten aus der Sicht der Rechtsgelehrten des Islam, daß diese andere Gemeinschaft sich dem Islam unterwirft, dafür toleriert wird und unter Umständen dafür sogar Schutz erhält; sie wurden als ein Sieg des Islam und als ein Schritt in Richtung auf das Endziel einer universellen Islamisierung gewertet. Eine zentrale Gestalt im Djihad, wie im Islam überhaupt, ist der Imam (in der Anfangsphase des Islam noch bedeutungsgleich mit Kalif). Er ist der religiöse und politische Führer, der u.a. die Aufgabe hat, zum Krieg gegen die Ungläubigen aufzurufen. Zuvor muß er aber, wie es das islamische Recht verlangt, die Andersgläubigen (schriftlich, falls es „Leute der Schrift“, z.B. Juden und Christen, waren) zum Wechsel ihrer Religion aufgefordert und (gegebenenfalls) anschließend den Krieg erklärt haben. Auch bei Niebelschütz findet die zentrale Stellung des Imam ihre Berücksichtigung: 6 Mit Bezug auf den Kaiser Konstantin, der die Verquickung von Christentum und Staat begründete, bringt Bernhard Lewis dieses in Das Vermächtnis des Islam (herausgegeben von J. van Ess und H. Halm, Zürich und München: Artemis Verlag, 1980), Bd.1, S.193, sehr treffend auf die Kurzformel: „Der Gründer des Islam war sein eigener Konstantin.“ 7 Die Gleichsetzung von Djihad und Heiliger Krieg, wie ich sie hier stillschweigend vornehme, bedarf der Relativierung, da Djihad eigentlich „Anstrengung“ (nämlich für die Sache Gottes und des Islam) bedeutet und es im Islam auch Auslegungen gibt, die kriegerische Anstrengungen als „kleinen Djihad“, Wohltätigkeit und geistige Anstrengungen zur Selbstvervollkomnung des Moslems hingegen als „großen Djihad“ bezeichnen -- diese Sichtweise entstammt hauptsächlich der Sufi-Mystik. 8 Weder der Sultan, noch der Emir, noch die Brüder, noch Dschondis überhaupt, wollten Krieg. Sie konnten aber weder dem Imâm, noch dem Mufti, noch seinen Hodschas und Mullas gestehen, daß sie nicht wollten. (S. 277) Hierbei wird zum einen deutlich illustriert, wie sehr Glaube und Politik im Islam in eins gehen (es ist jedoch fraglich, ob dieses im damaligen Christentum so anders war), zum anderen aber auch gezeigt, wie weltliche und religiöse Interessen auch im Islam begonnen hatten zu divergieren. Denn gab es in der ersten Generation nach dem Tode Mohammeds noch die völlige Einheit des Religiösen mit dem Politischen, so hatte sich im Laufe der Zeit letzteres doch zusehends verselbstständigt und war oft zum Primat geworden, nicht zuletzt durch die Aufspaltung des Islam in verschiedene Strömungen (z.B. Sunniten, Kharidjiten und Schiiten), Reiche und Dynastien (z.B. Umayyaden und Abbasiden) infolge der Streitigkeiten in der Frage der Nachfolge im Amt des Kalifen bzw. des Imam. Bei Niebelschütz findet diese Divergenz schließlich in der Hinrichtung und Entmachtung von Geistlichen ihren krassesten Ausdruck: Der Emir schaffte das priesterliche Mitspracherecht ab, köpfte drei Dutzend Mullas und Ulemas, die anderer Meinung waren, und schickte einigen seiner Brüder, betagten Prinzen, die seidene Drosselschnur, mit deren Hilfe sie ehrlich ins Paradies gelangten. Salâch selbst wurde auf offener Straße durch den Pascha der eigenen Leibwache ermordet“ (S.582) Ob es ein historisches Vorbild für diese Ereignisse gibt, gelang es mir leider nicht herauszufinden, doch ist die Verschiebung der Machtverhältnisse in der damaligen islamischen Welt weg von religiösen, hin zu sekulären Autoritäten bzw. die zunehmende Beschränkung der religiösen Führer auf repräsentative Aufgaben eine historisch verbürgte Tatsache8. Ein wichtiger Gesichtspunkt, der auch in den Kindern der Finsternis seinen Niederschlag findet, bleibt noch zu erwähnen: Die Ursache für den unglaublichen Eifer, mit dem die islamischen Krieger (damals wie heute) in die Schlacht ziehen. Es handelt sich um den im Jenseits zu erwartenden Lohn des Märtyrers, der im Kampf für die Sache des Islam stirbt. Niebelschütz läßt den Markgrafen Rodero auf Seite 55 drastisch, doch sachlich treffend formulieren: Wir können nicht mehr. Der Mohr kann auch nicht mehr. (...) Wenn Imâm und Mufti sagen, der Prophet habe geweint, weil der Tec noch immer nicht muselmanisch fließt, dann kann der Mohr, dann stürmt er. Das ist eine Religion mit Verstand: hopp! vom Schlachtfeld ins Paradies, ohne langes Warten auf Jüngstes Gericht. Vetter, frommer Mann, es verhält sich so, der Mohr, ob es wehtut oder nicht, stirbt mit Vergnügen, weil ihm für da oben ein Harem versprochen wurde, den er hienieden sich nicht leisten kann, und wovon er da oben sofort etwas hat. Haben wir eigentlich etwas davon, wenn wir Dschondis erobern?“ Hier wird unverblümt der psychologische Mechanismus bloßgelegt, der Menschen zum Äußersten treiben kann: Die „gute Sache“ als Zweck und Legitimation des Handelns und 8 Vgl. hierzu das Kapitel Politik und Kriege, insb. die Seiten 200 - 213, in: J. van Ess und H. Halm (Hrsg.), Das Vermächtnis des Islams (München und Zürich: Artemis Verlag, 1980) 9 eine alles sonst Erreichbare übersteigende Belohnung im Falle des Verlusts des eigenen Lebens. Abschließend läßt sich hierzu sagen, daß der Heilige Krieg, der Djihad, in Niebelschütz’ Roman eine der historischen Realität adäquate Darstellung gefunden hat; selbst wenn das im Vordergrund stehende Beispiel, der Krieg um Dschondis, fiktiver Art ist, so spiegeln die einzelnen geschilderten Aspekte doch die Verhältnisse in jener Zeit wider. 3.3. Historische Vorbilder für Personen und Personenkonstellationen An dieser Stelle hatte ich mir eigentlich vorgenommen, historische Vorbilder für die Personen Salâch und seinen Vater Sâfi, den „schwarzen Satan“ (S.55), sowie für die Konstellationen Rodero-Sâfi (bzw. für das Duell der beiden Herrscher) und Salâch-Barral aufzuzeigen. Leider gelang es mir nicht in der erwünschten Weise, solche Vorbilder aufzuspüren. Einzig einen annährungsweisen Parallelfall zur Freundschaft Salâchs 9 und Barrals konnte ich finden: Im 10. Jahrhundert waren das Kalifat Cordoba (moslemisch) und das Königreich Navarra (christlich) Verbündete, die einander in Konfliktfällen mit dritten unterstützten. Es gab sogar einen Fall von Heirat: Der König Sancho II. von Navarra gab dem maurischen Herrscher Almanzor seine Tochter zur Frau; das Kind aus dieser Verbindung, Sanchuelo („kleiner Sancho“), wurde sogar kurzfristig Herrscher, kam jedoch bald in einer Revolte ums Leben. Doch findet sich im Miteinander von Navarra und Cordoba eine noch intressantere Parallele zu Niebelschütz’ Roman: Die Königin Theuda von Navarra ließ die Fettsucht ihres Enkels durch den jüdischen Leibarzt des Kalifen heilen 10. Dieses wäre ein Parallelfall zur Heilung Peregrins von seinen ihn permanent quälenden Kopfschmerzen durch die Leibärzte des Emirs. Noch eine weitere Parallele gelang es mir zu finden: Der Beiname Sâfis als der „schwarze Satan“ (S. 49) findet seine Entsprechung beim marokkanischen Sultan Abu alHassan, der in der Mitte des 14. Jahrhunderts den Beinahmen „der Schwarze“ erhielt. Brett und Forman betonen, daß sich die Assoziation des islamischen Herrschers mit der Farbe Schwarz nicht von der Dunkelhäutigkeit vieler Mauren ableiten dürfte, sondern vielmehr von der „Vorstellung, daß diese [Andersgläubigen] vom Teufel, dem schwarzen Feind angeführt würden“11. Niebelschütz betont diese damals übliche Assoziation des Islam mit den Attributen „schwarz“ und „teuflisch“ sogar noch, indem er Sâfi an kaum einer Stelle beim Namen nennt, sondern zumeist vom Emir oder eben vom „schwarzen Satan“ spricht (vgl. das Kapitel „Treffen im Gebirge“), sogar ein Kapitel so benennt und Rodero von den Mauren im allgemeinen als „Satan“ sprechen läßt (etwa auf den Seiten 52 und 53, jeweils unten). Was die einzelnen Figuren und deren Konstellationen angeht, so ist hier der Grad der Fiktivität also sehr hoch zu veranschlagen; es scheint keine unmittelbaren historischen Vorbil9 Dessen Name, der in voller Länge Salâch-ed-Din (S. 123) lautet, könnte von dem Herrscher über Ägypten und Eroberer Jerusalems, Salâch-ad-Dîn, entlehnt sein, der sogar im 12. Jahrhundert gelebt hat, nämlich von 1138 bis1193; vgl. Eberhard Serauky, Geschichte des Islam (Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1991), S. 510. 10 Vgl. hierzu: Brett und Forman, 1986, S. 112. 11 Brett und Forman, 1986, S. 25. 10 der dafür zu geben, obwohl entfernte Parallelen, etwa in der Namensgebung, sicher Pate gestanden haben, wie ich zu zeigen versucht habe. Diese Fiktionalität ist auch nicht besonders verwunderlich, da der Roman auf der fiktiven Biographie Barrals, des Hauptcharakters, aufbaut, so daß die um ihn herum gruppierten Figuren ebenfalls überwiegend fiktiv sein müssen, wenigstens wenn sie in enger Beziehung zum Hauptcharakter stehen. 3.4. Bereiche kulturellen Transfers 3.4.1. Land- und Wasserwirtschaft bei den Mauren In den Kindern der Finsternis besitzt ein Motiv großes Gewicht: die Urbarmachung von Land. So begreift sich denn auch die zentrale Figur des Romans, Barral, in erster Linie als Bauer. Deutlich wird dieses Selbstverständnis als Bauer auf Seite 585, wo Barral Maitagorry auf deren Frage nach den Gründen seiner Abdankung mit „Weil ich ein Bauer bin.“ antwortet, und in in seinem Lamento auf den Seiten 556 und 557, wo er äußert.: Ich will kein Zerstörer sein. Ich will, daß Kelgurien atmen kann. (...) Was ich zu schaffen gedachte, das grünende Paradies Lorda, mißrät, meine schwindenden Jahre werden mißbraucht. Ein schwacher Mann, unerleuchtet, gehe ich durch die Welt meines Alters, Herzog statt Bauer, säe Tränen statt Korn, schmiede Schwerter statt Pflugschaaren, schreibe mit Tinte auf Pergament statt mit Wasser auf Erde, gründe Burgen an den Grenzen statt Dörfer auf den Feldern und weiß nicht, welcher der Wege mein Weg ist. In seinen Bestrebungen, Ghissi und später die Gegend zwischen Lorda und dem Kelmarin-Bach, den er zu diesem Zweck teilen und umleiten will, (wieder) urbar zu machen, ist Barral immer wieder auf die Hilfe der Mauren und auf deren Know-How angewiesen. Beim Besuch in Dschondis lernt er durch seinen Freund Salâch erstmals die überlegenen Landbaumethoden der Mauren kennen und bewundern, insbesondere die ausgeklügelten Systeme von Bewässerungskanälen, die „Instrumentarien“ zur Landvermessung (die ihn von Anfang an faszinieren, ihm jedoch lange von Salâch vorenthalten werden), die Düngemethode mit Taubenmist und die verschiedenen angebauten Pflanzensorten, darunter Reis, Baumwolle und Zitrusfrüchte. Schließlich erbittet Barral die Entsendung eines Wassermeisters nach Kelgurien (vgl. hierzu die Seiten 142 - 144). Doch erst bei einem Besuch Salâchs in Ghissi, fünfzehn Jahre später, wird der versprochene Wassermeister verbindlich zugesagt. Zudem erläutert Salâch Barral, auf welche Weise er mit Hilfe von Schöpfrädern, Wasserleitungen, Sammelbecken mit Schaffs, Kanälen, Mühlschiffen und Zisternen das Wasser der Gallamassa optimal für Ghissi nutzen könnte (vgl. hierzu die Seiten 282 - 284); wenig später sind diese Pläne Wirklichkeit geworden. Zur Urbarmachung der Kelmarien-Gegend erhält Barral schließlich noch das langersehnte „Instrumentarium“ (S. 553) und als Krönung ein System von „hundert Schöpfräder[n], getrieben durch eine bislang streng gehütete muselmanische Neuigkeit, nämlich hundert Windmühlen aus Gestänge und Segeln, hoben das Wasser in steiler Treppe auf 11 die Kuppe des vermergelten Kiesrückens, dessen Boden angegraben und zerwaschen wurde“ (S. 582). Ob und inwieweit der bei Niebelschütz dargestellte Vorgang des Kulturtransfers so auch tatsächlich stattgefunden hat, ist nur schwer zu klären, da die Quellenlage sehr schlecht ist und vieles Vermutung bleiben muß. Zwar ist man relativ gut über die Anbau- und Bewässerungsmethoden im maurischen Spanien informiert (während man über Sizilien wenig mehr weiß, als daß die Maurenherrschaft eine Blütezeit der Landwirtschaft bedeutete), doch läßt sich nur schwer ausmachen, was hier echte Neuerung war und was nicht, weil aus der vormaurischen Zeit kaum etwas bekannt ist. Auch aus der Zeit der Maurenherrschaft stammende Überbleibsel im Wortschatz (der Spanier und Sizilianer) können nur als Indiz gelten. So waren etwa Reis und Baumwolle, die neben Zuckerrohr, Zitrusfrüchten, u.ä. oft als maurische Neuerung genannt werden, schon im alten Rom bekannt. Auch kannte man Bewässerungskanäle, strömungsgetriebene Wasserräder und einfache Schöpfgeräte bereits im vormaurischen Spanien; nur die tiergetriebenen Wasserräder und die Quanate (künstliche unterirdische Wasserläufe durch die Verbindung mehrerer Quellbrunnen, die den Wassertransport über große Entfernungen ermöglichten) waren wirklich neu. Doch ist wohl die Hypothese zulässig, daß die Mauren enorm zur Verbreitung und Verfeinerung der genannten Anbau- und Bewässerungsmethoden in den von ihnen eroberten (und in den benachbarten) Gebieten beigetragen haben, denn die Eroberungen sind als Ursache der damaligen Blüte der Landwirtschaft und eines entsprechenden Transfers durchaus plausibel, wenngleich nicht beweisbar. (Die Neuerungen hinsichtlich der angebauten Pflanzen sind weniger bedeutend, da sie immer nur eine Bereicherung am Rande blieben bzw. erst sehr viel später zu Schlüsselrohstoffen bestimmter Regionen wurden, z.B. die Baumwolle, bedingt durch die industrielle Revolution.) 12 Ansonsten muß man aber der Darstellung bei Niebelschütz eine hohe Treue zu den historischen Verhältnissen bescheinigen. Man vergleiche hierzu auch die oben bereits erwähnten Ausführungen Salâchs auf den Seiten 282 bis 284 (für ein Zitat zu umfangreich) mit denen von Brett und Forman: Im Maghreb waren auch Gemüsesorten wie Auberginen und Spargel eingefürt worden. Auch Reis, Baumwolle und Zuckerrohr waren hier bisher unbekannte Pflanzen. Einige dieser Pflanzen bedurften der regelmäßigen Wasserzufuhr, was die Entwicklung von künstlichen Bewässerungssystemen gefördert hatte. Dazu benötigte man vor allem die Noria, das Wasserrad, mit dessen Hilfe Eimer um Eimer voll Wasser in ein Becken Gekippt wurde, von dem die Kanäle ausgingen, die die Felder mit Wasser versorgten. Es entstand ein Bewässerungssystem, welches in der Lage war, das Wasser, das aus einer einzigen Quelle stammte, auf alle Grunstücke aller Eigentümer für gleichgroße Zeitspanne in gleichgroßer Menge zu verteilen. Dieses ausgeklügelte System hat sich auch in christlicher Zeit an der spanischen Mittelmeerküste erhalten. Die Gesetze, mit denen die Wasserverteilung geregelt wird, tragen noch heute deutliche Spuren ihrer Herkunft aus Syrien und dem Jemen.13 Und: 12 Zu dieser zurückhaltenden Bewertung des Transfers auf land- und wasserwirtschaftlichem Gebiet vgl.: M. A. Cook, „Wirtschaftliche Entwicklungen“, in: Ess und Halm,1980,Bd.1. 13 Aus: Brett und Forman, 1986, S. 45. 12 Durch diese Mühle [Wassermühle bei Cordoba, die auch als Noira (s.o.) diente und deren Überreste bis heute erhalten sind] wurde das Wasser doppelt fruchtbar, denn es trieb auch die Mühlräder an, die das Mehl für das tägliche Brot mahlten. Nach der Anzahl seiner Mühlen bemaß man den Reichtum eines Landes.14 Die Übereinstimmungen sprechen für sich. Niebelschütz hat offenbar gut recherchiert, obgleich es mir nicht gelungen ist, Hinweise auf Mühlschiffe und Systeme, die Wasser mit Hilfe von Windkraft Berghänge hinauftransportieren, zu finden; es könnte sich dabei also theoretisch um Erfindungen des Autors handeln, die dann aber sehr passend zum historischen Tatsachenbestand konstruiert wären. 3.4.2. Wissenschaften im Islam Im Mittelalter läßt sich in den Wissenschaften eine unglaubliche Überlegenheit der islamischen Kultur gegenüber der christlichen verzeichnen, von der letztere enorm profitiert hat. Man kann mit Recht sagen, daß die islamischen Einflüsse auf diesem Sektor z.T. entscheidende Weichenstellungen in der Entwicklung des christlichen Abendlandes bedeuteten, die unsere Kultur und unser Denken bis heute beeinflussen. Als Wiege der islamisch-orientalen Wissenschaftskultur gilt die antike Kultur der Griechen, was Albert Dietrich in der Kurzformel, daß die geistige Kultur des Islam im Grunde islamisierter Hellenismus sei, zusammenfaßt15. Im 8. bis 10. Jahrhundert wurden in Bagdad, dem östlichen kulturellen Zentrum des Islam, zahlreiche griechische Schriften ins Arabische übersetzt, wobei die Moslems zumeist nur als Auftraggeber fungierten und die Übersetzungstätigkeit fast ausschließlich von (syrischsprachigen) Orientchristen, die mit der griechischen Sprache durch das Neue Testament vertraut waren, ausgeübt wurde. (Daß dabei haupsächlich philosophische und wissenschaftliche Werke übersetzt wurden, nicht aber literarische wie z.B. Epen, Komödien oder Tragödien, mag an der Interessenlage der Auftraggeber gelegen haben, die primär durch Nützlichkeitserwägungen bestimmt war.) Auch später spielten die echten Araber bei der Entwicklung der Wissenschaften eine eher unbedeutende Rolle, doch fungierte ihre Sprache als kulturelle Klammer und als unverzichtbare Basis für den geistigen Austausch der gebildeten Elite der islamischen Welt (die häufig aus Persern, arabisierten Christen und Juden bestand), so daß die Rolle des Arabischen im Orient der des Lateinischen im Okzident entspricht. Die verschiedenen Kulturzentren der islamischen Welt wetteiferten um die Vorreiterschaft im wissenschaftlichen Fortschritt, wobei sich schließlich die in Nordafrika und auf der Iberischen Halbinsel herrschende Omaijaden-Dynastie als große Förderin der Wissenschaften auszeichnete, so daß diese unter ihrer Herrschaft hervorragend gedeien konnten. Der Wissenstransfer vom Orient zum Okzident fand etwa ab dem 10. Jahrhundert vor allem in 14 Aus: Brett und Forman, 1986, S. 54, Bilduntertitelung. Vgl. Albert Dietrich, „Das wissenschaftliche Erbe der Antike im Islam“, in: Ruprecht Kurzrock, Die islamische Welt II (Berlin: Colloquium Verlag, 1984), S. 65. 15 13 Spanien (später auch in Sizilien und Italien) statt, wo zu jener Zeit erste wichtige wissenschaftliche Werke aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt wurden. Nach der Beendigung der Maurenherrschaft auf Sizilien und der Iberischen Halbinsel traten verschiedene christliche Herrscher als Förderer orientalischer Wissenschaftlichkeit auf, allen voran König Alfons X. (reg. 1252 - 1284), der daher den Beinamen „der Weise“ erhielt und der z.B. für die Zusammenfassung der astronomischen Ergebnisse orientalischer Wissenschaftler sorgte, auf welchen später Galileo Galilei aufbaute. Auch hatten die Juden in Spanien nach der Vertreibung der Mauren aufgrund ihrer mehr oder weniger tolerierten Stellung in beiden Kulturkreisen, dem islamischen und dem christlichen, und ihrer tragenden Funktion in der islamischen Wissenschaft einen großen Anteil an der Übermittlung des orientalischen Wissens an die Europäer. Ähnlich wie im mittelalterlichen Christentum war auch im Islam jener Zeit das Verhältnis von Wissenschaft und Religion gestaltet: Die Wissenschaftler sahen ihr Wirken in der Regel als eine Bestätigung der religiösen Offenbarung mit den Mitteln der menschlichen Vernunft und stellten es ausdrücklich in den Dienst der Religion. Doch befanden sie sich dabei nicht selten im Kampf mit der religiösen Orthodoxie, die diese Tätigkeit der menschlichen Ratio als eine eitle Überheblichkeit gegenüber der geoffenbarten „Wahrheit“ empfand und z.B. medizinische Grundlagenforschung mit religiösen Tabus behinderte; so war etwa das Sezieren von Leichen aus religiösen Gründen kaum möglich. Zu den Gebieten, auf denen die islamische Wissenschaft große Verdienste beanspruchen kann, gehören die Philosophie, wo vor allem die Überlieferung der Texte des Aristoteles (der dem Christentum bis dahin völlig unbekannt war) und deren Kommentierung durch Averroes für den Okzident bedeutsam waren, die Medizin und die Pharmakologie, in denen die Moslems neben der Kommentierung antiker Texte, etwa von Hippokrates und Galen, derartig viel geleistet haben, daß das christliche Abendland bis ins 16. Jahrhundert hinein davon zehrte, die Alchemie, die den Mauren u.a. die Einführung der experimentellen Methode verdankt (hier waren die Ergebnisse der islamischen Wissenschaftler für die Europäer bis ins 18. Jahrhundert maßgebend), die Astronomie und die Mathematik. Auch die beiden letztgenannten Gebiete waren enorm wichtig für die Entwicklung der abendländischen Wissenschaften: Galileo baute, wie bereits gesagt, auf Erkenntnissen orientalischer Astronomen auf, bis heute benutzen wir arabische Zahlen und die Weiterentwicklung der Trigonometrie ermöglichte es den islamischen Wissenschaftlern, neue Verfahren der Land- aber auch der nautischen und astronomischen Vermessung zu entwickeln. Dadurch kam es u.a. zur ersten exakten Kartographierung des Mittelmeerraumes; auch wären die großen Entdeckungsfahrten der Europäer zur See im ausgehenden Mittelalter ohne diese Leistungen nicht denkbar gewesen (Vasco da Gama hatte sogar einen arabischen Kapitän an Board). In Niebelschütz’ Roman Die Kinder der Finsternis findet aus diesem Spektrum der Wissenschaften nur eine exemplarisch Berücksichtigung: die Medizin (die Landvermessung wird mit dem von Barral begehrten „Instrumentarium“ angesprochen, nicht aber ausgeführt; vgl. hierzu Punkt 3.4.1.). Der Grund hierfür ist in der Ausrichtung des Romans auf den Leben- 14 salltag der breiten Bevölkerung anstelle einer Orientierung an der intellektuellen Kultur der geistigen Elite und Oberschicht (wie man es in Ecos Der Name der Rose findet) zu suchen. Die Art und Weise, wie die medizinischen Fähigkeiten der Mauren von Niebelschütz dargestellt werden, verträgt sich dabei gut mit der historischen Wirklichkeit. So entspricht die auf Seite 128 dargestellte Einbalsamierung des Leichnams des Markgrafen mit diversen Kräuteressenzen dem hohen Kenntnisstand der Mauren auf dem Gebiet der Pharmakologie; gleiches gilt für die allmähliche Anästhesierung Peregrins zur Vorbereitung seiner Hirnoperation, wie es auf Seite 130 geschildert wird (ob anästhetische Methoden zu jener Zeit bereits bekannt waren, ist allerdings noch umstritten.). Auch die Durchführung der Operation selbst (wie auf den Seiten 134 und 135 beschrieben) ist plausibel: Chirurgische Eingriffe galten im Orient zwar als letztes Mittel der Wahl, da das Risiko und eine gewisse religiöse Ehrfurcht vor dem Lebenden geboten, zunächst alle anderen möglichen Methoden der Heilung zu probieren (etwa durch die Gabe von Medizin), doch wurden sie durchaus vorgenommen. Die Fähigkeiten der Sarazenen auf dem Gebiet der Chirurgie waren verhältnismäßig hoch entwickelt; so wurden z.B. bereits Operationen an den Nieren durchgeführt. Inwieweit allerdings Operationen am Gehirn vorgenommen wurden, gelang es mir nicht herauszufinden. Ein anderes Detail deutet jedenfalls auf eine genaue Recherche des Autors hin: Auf Seite 130 finden wir geschrieben: Nach zwei Monaten eröffnete man ihm, er habe den Stein im Hirn, das Hirn brauche einen Ausgang, durch den es atmen könne, dafür sei eine bestimmte Sternkonstellation nötig, die man errechnen werde nach des erhabenen Fürsten Horoskop; ... Und tatsächlich waren Medizin und Astrologie eng gekoppelte Disziplinen in jener Zeit und wurden oft von ein und derselben Person betrieben. Es wurden den verschiedenen Körperteilen jeweils verschiedene Sternkonstellationen zugeordnet, z.B. beherrschte der „Löwe“ das Herz, der „Widder“ den Kopf, usw.; das Verhältnis der Planeten zu den Sternbildern floß dann ein in Diagnose, Prognose und Therapie. Daß zur Diagnose natürlich die vorherige Beobachtung des Krankheitsverlaufs gehörte, galt als selbstverständlich und klingt in den ersten drei Worten des letzten Zitats an („Nach zwei Monaten ...“). Auch die hygienischen Vorkehrungen, die bei der Operation Peregrins vorgenommen werden („...sie (...) rasierten ihm eine Tonsur, (...) wuschen ihn mit Wassern und Essenzen und und deckten weiße Tücher über die Ränder der Tonsur, die sie, während Musik einsetzte, mit schnellem Kreuzschnitt häuteten.“, S.134), entsprechem dem, was man über die damalige islamische Medizin weiß: Auf Hygiene wurde bereits Wert gelegt — nicht nur in der Medizin. Es bleibt ein Gesichtspunkt zu erwähnen, der bei Niebelschütz allerdings nicht auftaucht: Die Mauren verfügten bereits über eine beachtliche, ja: vorbildliche Infrastruktur, was die medizinische Versorgung betraf. Es gab Apotheken, medizinische Bäder und vor allem zahlreiche Krankenhäuser (im Cordoba des 10. Jahrhunderts soll es knapp fünfzig Stück gegeben haben!), deren Leistungen zudem für die Hilfesuchenden kostenlos waren. 15 Abschließend läßt sich zu diesem Punkt sagen, daß die Episode um den Kopfschmerz Peregrins und dessen Heilung ein adäquates, wenngleich nicht vollständiges Bild des damaligen Standes der Medizin bei den Mauren vermittelt. Das gilt auch in Hinblick auf die hoffnungslose Überlegenheit der sarazenischen Heilmethoden gegenüber denen der Europäer; schließlich hatte Peregrin zuvor nichts unversucht gelassen, sich seines Leidens zu entledigen, wie in einer Äußerung Rodros diesem gegenüber deutlich wird: Ihr solltet einen Arzt fragen, keinen Mönch, Jared besorgt Euch das aus Dschondis oder sonstwoher, einen Juden, einen Sarazenen, einen der gegen Geld arbeitet, das ist billiger als Christi Barmherzigkeit, und erfolgreicher. (S. 57) 3.4.3. Kunst und Architektur der Mauren Dieser Gesichtspunkt findet bei Niebelschütz keine nennenswerte Berücksichtigung, sondern gehört wie vieles andere in die Kategorie der zwar stichwortartig erwähnten, nicht aber ausgeführten Dinge. Diese Erwähnungen erzeugen beim Leser via Assoziation mit Klischeebildern (die deshalb nicht weit von der Realität entfernt sein müssen) das lebendige Bild einer orientalischen Sphäre, z.B. Dschondis. In Hinlick auf die Architektur verzichtet Niebelschütz auf die (sich anbietende) aufwändige Beschreibung einzelner Bauwerke, etwa von Palästen und Moscheen, und beschränkt sich, wohl im Vertrauen auf die Eigendynamik der beim Leser vorhandenen stereotypen Vorstellungen, auf stichwortartige Schilderungen z.B. Dschondis’: Er [Dom Karl] sah (...) Landhäuser in Palmenhainen, am Hafenrund zehnstöckig getürmte Wohnviertel; Moscheen, Minarette; Dachgärten mit blühenden Sträuchern und bunten Schirmen, holzvergitterte Altane; verschleierte Frauen, Turbane überall. (S.131) Unnötig zu sagen, daß diese äußerst knappe Schilderung architektonischer Gegebenheiten kaum von der Wirklichkeit abweichen kann. Bis auf die „zehnstöckig getürmten Wohnviertel“, wo es mir nicht gelang, Hinweise auf eine solch vielstöckige Bauweise zu finden, waren Landhäuser, Moscheen, Minarette und Altane gängige Bauelemente einer islamischen Stadt und ihres Umlandes in dieser Zeit. Daß in den Kindern der Finsternis kaum Fälle architektonischen Transfers zu finden sind, verträgt sich recht gut mit der Historie, da außer in Zentralspanien nennenswerte Einflüsse maurischer Architektur im Mittelalter nicht vorkommen. Vor der Renaissance war es in der Architektur nicht üblich, kulturfremde Elemente zu übernehmen, so daß in der Regel ein Baustil die Grenzen seiner Stammkultur nicht überschritt. (Erst ab dem 18. Jahrhundert findet sich hier ein nennenswerter islamischer Einfluß, der aber in erster Linie über die Türkei zustande kam; man denke hierbei an Moscheeimitationen in den englischen Landschaftsgärten der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.) Eine Ausnahme im Roman bildet der „maurische Hof“ (S. 530/531) Fastradas, den sie nach ihrer Rückkehr von den Smaragdenen Inseln mit Hilfe eines Bau-, eines Wasser- und 16 eines Brunnenmeisters, die ihr der Kalif zusammen mit „farbigen Steinen für die Mosaiken“ (S. 530) zum Abschiedsgeschenk gemacht hatte, erbauen läßt. Niebelschütz läßt nicht erkennen, inwieweit Fastradas Palast, der oft der „maurische Hof“ genannt wird, tatsächlich ein Werk maurischer Architektur ist; nur die Mosaiken werden explizit erwähnt (s.o.). Für die Übernahme dieser dekorativen Elemente maurischer Baukunst gibt es aber mögliche historische Vorbilder; so erwähnen Brett und Forman z.B. desöfteren den „Alcázar von Sevilla, der in Nachahmung der Alhambra von König Pedro dem Grausamen von Kastilien erbaut wurde. Der König brachte in der Mitte des 14. Jahrhunderts Handwerker aus Granada an seinen Hof, die die Arbeit leisten sollten.“16 (Es handelte sich dabei um die Rekonstruktion eines zerstörten maurischen Palastes.) Andere Aspekte werden noch beiläufiger erwähnt als die Architektur; etwa die orientalische Musik mit ihren hypnotischen Harmonien, mit deren Hilfe Peregrin in Schlaf versetzt wird (vgl. S. 123), und die hochentwickelte Textilkunst, z.B. in Form von Sâfis „goldbesticktem Turban“ (S. 135), Gazevorhängen (vgl. S. 130) und Wandteppichen (vgl. S. 146). Auch hier verträgt sich die Darstellung gut mit der historischen Realität. Besonders die Textilkunst (inklusive Teppichweberei), aber auch die Kleinkunst im allgemeinen, wozu ich u.a. Metallarbeiten, Keramiken, Buchmalerei und Elfenbeinschnitzereien zähle, beeindruckten die Europäer und fanden wegen ihres hohen dekorativen Wertes eine weite Verbreitung und Nachahmung im christlichen Europa, das bei aller Feindschaft diese Seite islamischer Kultur sehr zu schätzen wußte. Schon im 12. und 13. Jahrhundert wurden islamische Textilmuster von europäischen Webern übernommen; der Fund eines orientalischen Knüpfteppichs aus dem frühen 15. Jahrhundert in einer Dorfkirche in Nordschweden dürfte als Kuriosum die Popularität islamischer Kunst in etwas späterer Zeit illustrieren. Schließlich findet sich noch die Zeltstadt der Mauren im Gebirge, wie sie auf den Seiten 121 und 122 beschrieben wird, die in ihrer aufwändigen Machart (vgl. die entsprechende Passage) als ein Beispiel islamischer Kunst gewertet werden kann, ebenso wie (im weitesten Sinne des Wortes) als eines der islamischen Architektur. Die Anregung hierfür mag Niebelschütz aus entsprechenden Buchillustrationen empfangen haben, wie sie in Chroniken üblich waren (vgl. hierzu die Abbildung bei Brett und Forman, 1986, S. 16). Tatsächlich haben sich in Zeiten der Expansion Heerlager desöfteren zu Städten ausgewachsen; Basra im Irak und das heutige Kairo in Ägypten sind Beispiele dafür. Auch hier also wahrt Niebelschütz den Bezug zu historischen Vorbildern. Insgesamt läßt sich feststellen, daß Niebelschütz diesen nur oberflächlich berührten Aspekten, Kunst und Architektur, offensichtlich kein großes Gewicht zumißt und daß, bedingt durch die Oberflächlichkeit der Darstellung, sich die Frage nach der historischen Stimmigkeit fast nicht sinnvoll stellen läßt. 3.5. Bereiche kultureller Verschiedenheit 16 Aus: Brett und Forman, 1986, S.81, Bilduntertitelung. 17 3.5.1. Struktur der mittelalterlichen islamischen Gesellschaft In diesem Abschnitt möchte ich verschiedene Aspekte der Maurenkultur zusammenfassen, da sie zum einen in engem Zusammenhang untereinander stehen und zum anderen bei Niebelschütz eine teilweise nur oberflächliche Behandlung erfahren. Letzteres trifft vor allem auf das Rechtssystem und das Handelswesen zu, was ich hier gemeinsam mit der Sklaverei und der Hierarchie der islamischen Gesellschaft abhandle. Beginnen möchte ich mit dem orientalischen Handelswesen jener Zeit. Auf diesen Gesichtspunkt geht Niebelschütz an einer Stelle ein wenig näher ein, ohne dabei ausführlich zu werden: Auf den Seiten 138 ff. wird geschildert, wie Barral von einem arabisierten Europäer, der als Sklave zu den Sarazenen kam, in Dschondis herumgeführt wird und dabei mit dem arabischen Geschäftsleben in Berührung kommt. Barral erlebt das „bunte Gewühl des Marktes“ (S. 138) und sieht sich besonders mit dem Sklavenhandel konfrontiert — zunächst auf dem Markt, dann im Hause des Sklavenhändlers selbst, der sich als der Jude Jared erweist, welcher in Dschondis, anders als in der christlichen Welt, ein angesehener Kaufmann ist („..., hier ist Jared frei und ein Herr...“ (S. 141); überhaupt wird dem Juden im Roman die Rolle des Mittlers und Pendlers zwischen den beiden so verschiedenen Welten zugeordnet, wobei Niebelschütz sich an der Tatsache orientiert, daß die Juden, denen es in der arabischen Welt damals erheblich besser ging als in der christlichen, diese Brückenfunktion tatsächlich erfüllten, da sie in beiden Kulturkreisen wichtige Wirtschaftsfaktoren darstellten — man denke nur an das Kredietwesen, denn es war weder Moslems noch Christen erlaubt, Zinsen zu nehmen.). Mit dem Marktwesen wird ein tragendes Element islamischer Kultur angesprochen, wenngleich nicht weiter ausgeführt: Der Islam ist eine sehr wirtschaftsfreundliche Religion; die Infrastruktur islamischer Gebiete beruht (bis heute) ganz wesentlich auf dem Handel bzw. auf den Händlern und auch in der religiösen Unterweisung werden häufig Beispiele aus dem Handelswesen gewählt. Man spricht daher von einer Bazarökonomie. Hierunter versteht man eine Ökonomie, die gekennzeichnet ist durch eine enge räumliche und personelle Verknüpfung von Produktion und Vertrieb mit dem Markt als wirtschaftlichem und sozialen Dreh- und Angelpunkt. Dem periodischen Markt, wie er vor allem in ländlichen Gegenden aber z.T. auch in der Stadt üblich war (bzw. ist), steht der fest installierte und nach Branchen gegliederte Bazar der Stadt mit seinen Läden gegenüber; dieser befand (bzw. befindet) sich meist auf dem Grund und Boden religiöser Stiftungen. Wichtige organisatorische Kräfte waren dabei der mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattete Marktaufseher, der für Ruhe und Ordnung, Hygiene und die Eindämmung betrügerischer Geschäftsmethoden zuständig war, sowie die hierarchisch strukturierten und an religiösen Maßstäben orientierten Kaufmanns- und Handwerkergilden, die ähnlich wie die Zünfte in den Städten Europas den Wettbewerb und die Ausbildung des Nachwuchses überwachten. Ein weiterer wichtiger Faktor der islamischen Ökonomie ist die Existenz eines recht weit entwickelten Kreditwesens: Es gab Institutionen 18 wie Banken und teilweise sogar bargeldlose Zahlungsmittel wie Cheques.17 Die Handelsbeziehungen der Moslems reichten im Osten zeitweise bis nach China und im Norden bis nach Skandinavien. (Selbst in Haitabu wurden zahlreiche arabische Silbermünzen gefunden.) So galten die wohlhabenden Händler als wichtige Träger der Islamischen Kultur, auch was die Verbreitung des Islam mit nicht-militärischen Mitteln betraf. Die bereits erwähnten Sklaven bildeten dabei einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor (bis hinein in die Neuzeit — im Osmanischen Reich gab es bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine sehr einflußreiche Sklavenkaste, die eigens für die Ausübung wichtiger Staatsämter herangebildet worden war), so daß Niebelschütz diesen Aspekt orientalischen Wirtschaftslebens nicht zu Unrecht hervorhebt; die islamische Gesellschaft war nicht zuletzt über lange Jahrhunderte hinweg, ähnlich den antiken griechischen und römischen Kulturen, eine Sklavenhaltergesellschaft. Sklaven wurden aus nahezu allen an islamisches Territorium angrenzenden Gebieten „gewonnen“, entweder durch Überfälle (in Westafrika sprach man von Sklavenernten) oder durch die Verwendung von Kriegsgefangenen. Dabei fällt auf, welch vielfältige Verwendung Sklaven fanden: Auf dem Podest wurden numidische Mädchen versteigert; indische; schwarze von den afrikanischen Küsten; Köchinnen aus der Tatarei; ältliche Wirtschafterinnen, die sehr viel kosteten; ein muskulöser Mohr, als Pflüger versteigert; nebenan, umlagert von Kunden, blonde Knaben zu Hunderten.“ (S. 138) Niebelschütz bleibt hier an der historischen Realität: Sklaven wurden in nahezu allen Bereichen eingesetzt. Auch der Handel mit Lustknaben, den Niebelschütz auf den Seiten 139 bis 141 eingehender beschreibt, ist recht plausibel, da sexuelle Kontakte von Sklaven und ihren Besitzern durchaus erlaubt waren und Homosexualität (obwohl im Islam bei Prügelstrafe verboten) eine normale Erscheinung in städtischen Hochkulturen (und eine solche war bzw. ist der Islam in seinen Zentren) darstellt; auch war (und ist) homosexuelle Prostitution der islamischen Welt ebensowenig fremd wie der unsrigen. Eine Sonderrolle in der islamischen Gesellschaft nahmen die Kriegssklaven, Mamluken genannt, ein. Sie waren in dem Maße ein zunehmend wichtiges Standbein des Kriegswesens, in dem sich die Einflußsphäre des Islam ausdehnte und die moslemische Bevölkerung relativ betrachtet nicht mehr zahlreich genug war, um den Bedarf an Soldaten zu decken. Niebelschütz beschreibt dabei völlig korrekt die kulturelle Integration der Sklaven und deren gesellschaftliche Aufstiegschancen, insbesondere der Mamluken aus der Sicht eines ehemaligen solchen, der jetzt freier Moslem ist: „Das Heer, Herr , sind fast alles Christen, nur die höheren Ränge nicht. Die mittleren wie ich traten dem Glauben des Propheten bei.“ (S. 138) In Ägypten und Syrien erwuchs aus dieser Kaste sogar eine Herrscherdynastie, die ab 1250 bis zur osmanischen Eroberung von 1517 dort mit unabhängigen Sultanen die Macht innehatte. Auch Niebelschütz’ Aussagen über die rechtliche Stellung der Sklaven entspricht den Tatsachen. Sie waren durch das Recht geschützt, selbst allerdings nur bedingt rechtsfähig; ein17 Vgl. hierzu auch die Einträge unter „Handel“ und „Marktordnung“ in: A. T. Khoury, L. Hagemann u. P. Heine, Islam-Lexikon (Freiburg i. Br.: Herder Verlag, 1991, 3 Bde.). 19 geschränkt waren vor allem die Freizügigkeit, der Erbanspruch und das Recht auf Eigentum. 18 Ansonsten gilt, was Barrals Führer in Dschondis äußert: Hat man [als Sklave] den Verkauf hinter sich, so genießt man den Schutz der Gesetze. Wer geprügelt wird, klagt; wenn der Richter den Herrn schuldig findet, ist man frei und tut die Ohrringe ab. (S. 139) Sonst finden sich im Roman wenig Hinweise auf die Rechtsvorstellungen und das Rechtssystem im Islam der damaligen Zeit. Einzig die Äußerung Salâchs zum Thema Ehebruch („‘Wie?’ rief der Prinz. ‘Ein Prozess? bei uns ersticht man sofort und niemand fragt.’“, S. 136) und das uneingeschränkte Walten herrscherlicher Willkür, wie es im Falle des Kalifen der smaragdenen Inseln auftritt, der die von seinem Vater schwangeren Haremsdamen kurzerhand enthaupten läßt, lassen wage Spekulationen zu, die aber nur ein sehr diffuses und ungenaues Bild beim Leser entstehen lassen. Die islamischen Rechtsvorstellungen sind für unser westliches Verständnis heute sehr rigide und die Strafen oft drakonisch — das gilt nicht nur fürs Mittelalter, wo europäische Rechtssysteme dem islamischen an Rigidität und Härte der Strafen sicher um nichts nachstanden. Man denke nur an das heutige Pakistan oder Saudi-Arabien, wo wo diese Rechtspraxis bis heute ausgeübt wird. Das Kompendium islamischer Gestze, Scharia genannt, orientiert sich an den oft sehr klaren Vorgaben des Korans und der Sunna (d.i. die Überlieferung von Gewohnheiten, Entscheidungen, Verhaltensweisen und Aussprüchen Mohammeds und seiner unmittelbaren Nachfolger), in denen das Strafmaß für die jeweiligen Vergehen festgelegt ist; hin und wieder gibt es auch Ermessensspielräume des Richters, der immer ein Einzelrichter ist. Die Scharia hat den Anspruch, für alle Lebensbereiche gleichermaßen zuständig zu sein, angefangen von den Fragen der Religion bis hin zu solchen des Handels, des Erbschaftsrechts oder des Umgangs mit Straftaten. Interpretiert wird sie von den Muftis, den Rechtsgelehrten, die die exekutiven Instanzen, nämlich den Herrscher und den Kadi (d.i. der Richter) beraten, in der Regel aber selbst kein Richteramt ausüben.19 Hatte ursprünglich der Herrscher die Anwendung der Gesetze unter seiner Gewalt und waren ihm die Kadis dabei unterstellt, so fand ab dem 8. Jahrhundert eine Trennung beider Instanzen statt: Die Kadis hatten sich zu einer unabhängigen Autorität emanzipiert, dafür nahmen sich die Herrscher kraft ihrer Macht häufig einfach heraus, selbst Recht zu sprechen, soweit es ihre Interessensphäre betraf, etwa in Steuerfragen aber auch in Kriminalfällen. Diese herrscherliche Art der Rechtsprechung wurde von den Kadis und Muftis zumeist geduldet oder sogar gestützt, zeichnete sich durch ein hohes Maß an Willkür aus und orientierte sich dementsprechend nicht bzw. nicht in erster Linie in der Scharia. Niebelschütz’ Darstellung despotischer Willkür, wie sie im oben genannten Fall des Kalifen und seiner Haremsdamen oder im Falle Salâchs, der seinen Brüdern nach einer mißglückten Verschwörung den Selbst18 Vgl. hierzu die Eintragung unter „Sklaven“ bei Khoury, Hagemann u. Heine, Islam-Lexikon, 1991. Natürlich gab und gibt es verschiedene Rechtsschulen im Islam, die sich in der Interpretation der Gesetze uneinig sind, doch geht es dabei — von außen betrachtet — eher um Detailfragen; auch würde eine solche Erörterung hier zu weit führen. 19 20 mord befielt (vgl. S. 582), zum Tragen kommt, entbehrt also nicht der Grundlage; die islami schen Herrscher jener Tage konnten sich nach Belieben zu Richtern über ihre Untertanen aufschwingen, auch, oder: gerade in Fragen von Leben und Tod. Im Falle des Ehebruchs jedoch dürfte Niebelschütz ein wenig von der damals (und z.T. heute noch) gängigen Praxis abweichen. Zwar ist die Todesstrafe für ehebrechende Frauen in der Scharia vorgesehen (allerdings nur bei Geständigkeit; bei Verurteilung aufgrund von Zeugenaussagen wird „nur“ lebenslanger Hausarrest verhängt), doch war diese Frage in der Regel vor dem Kadi zu klären und wurde nicht der Selbstjustiz überlassen. Allerdings gibt es eine Geschichte aus Tausendundeiner Nacht, die von der Duldung der Selbstjustiz durch die Öffentlichkeit („...und niemand fragt ...“, S.136) berichtet, wenn der betrogene Ehemann das betreffende Pärchen auf frischer Tat ertappt und im Affekt sofort tötet. Über Hierarchie und Struktur der damaligen islamischen Gesellschaft wird in den Kindern der Finsternis nahezu nichts ausgesagt. Zwar finden die verschiedenen Herrschertitel (Kalif, Sultan, Emir) Erwähnung, ebenso einzelne Berufsstände wie Händler, Wassermeister, Wesire, Sklaven, Bader, Ärzte, usw., daneben auch noch religiöse Würdenträger wie Mullas und Imam, sowie die rechtsgelehrten Muftis 20. Doch wird an keiner Stelle näher auf das Verhältnis, in dem diese Gruppen und Personen innerhalb der Hierarchie zueinander stehen, eingegangen. Die einzige Ausnahme ist das Verhältnis vom Emir zum berberischen Sultan und Imam, wo an einigen Stellen die Machtverhältnisse angedeutet werden; so auf Seite 277, wo die Abhängigkeit des Emirs von Dschondis vom Sultan und Imam der Berberei in Nordafrika explizit erwähnt wird: Sie [die Schlinge] wurde gezurrt jenseits des Meeres in der Berberei durch den neuen Sultan. Der Imâm der Berberei wetterte gegen das Wohlleben jenseits des Meeres; das Wohlleben von Dschondis habe den Propheten weinen gemacht. Glaubenskrieg müsse sein. Ebenso auf Seite 138, wo beschrieben wird, wie Salâch nach seiner Amtsübernahme über das Meer segelt, um „sich vor dem Sultan der Berberei niederzuwerfen [und] danach in der Moschee die schneeweißen Füßchen des Imâms zu küssen.“ Diese Darstellung ist historisch plausibel, sowohl was die Rolle des Imam in Sachen Djihad angeht (vgl. hierzu das unter Punkt 3.2. Gesagte), als auch in bezug auf den berberischen Sultan, denn in jener Region war damals die Berberei neben dem islamisierten Spanien das größte Machtzentrum, zu dessen Einflußsphäre kleinere Gebiete im Mittelmeerraum gehörten, z.B. Sizilien.21 Auch wenn, wie gesagt, der Struktur- und Hierarchie-Aspekt bei Niebelschütz kaum behandelt wird, möchte ich ihn hier kurz ausführen, weil er im Rahmen des betrachteten Gegenstandes, nämlich des Islam, von Wichtigkeit ist. Ursprünglich handelte es sich bei der isla20 Auf Seite 277 verwendet Niebelschütz den Begriff des Muftis übrigens nicht ganz korrekt, wenn er schreibt: “... und in den Moscheen peitschte der Mufti die Menge ...“, da der Mufti als Rechtsgelehrter sein Wirkungsfeld nicht als Prediger, sondern als Exeget der Scharia findet, was sich in der Sache aber durchaus ähnlich auswirken kann. 21 Zwischen den moslemischen Herrschern in Spanien und denen in Nordafrika gab es daher auch „naturgemäß“ häufig Konflikte, die in Spanien zu häufigen Machtwechseln, sowie zur Zersplitterung der Macht führten. 21 mischen Gesellschaft um eine Theokratie, in der religiöse und weltliche Macht in eins fielen. Die Gemeinschaft der Gläubigen, die Umma, verstand Allah als ihr Oberhaupt, dessen Stellvertreter auf Erden zunächst Mohammed, später dann seine Nachfolger, die Imame oder Kalifen waren. Wichtig ist dabei, auch den sozial-utopischen Universalanspruch des Islam zu sehen (siehe hierzu Punkt 3.2.). Das Ideal der Gleichheit aller Gläubigen als Bestandteil dieser utopischen Seite des Islam stand allerdings zu allen Zeiten im krassen Gegensatz zu den tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnissen. Dazu paßt auch die allmähliche Fortentwicklung von der Theokratie hin zu einem „Absolutismus legitimistischer und religiöser Färbung“ 22: Das Amt des Kalifen (anfänglich noch identisch mit dem des Imam), dem die Verwaltung und Lenkung der Umma oblag, wurde nach dem Tode Mohammeds zunächst noch durch Wahl und Qualifikation besetzt, entwickelte sich dann aber unter den Omayyaden und Abbasiden, sowie durch persische Einflüsse rasch zu einer Form erblicher Herrschaft, die einen zunehmend weltlichen Schwerpunkt besaß. Diese Entwicklung verlief parallel zur Ausbreitung des Islam, so daß der Imam/Kalif später nur noch als nominelles Oberhaupt der Umma fungierte, die längst über verschiedene islamische Reiche verstreut war. Die zunehmende Trennung weltlicher und geistlicher Macht bzw. die zunehmende Emanzipation ersterer von letzterer findet in Niebelschütz’ Roman ihren Ausdruck in dem (letztlich gescheiterten) Versuch Salâchs, den Einfluß der Religion auf die Staatsgeschäfte zurückzudrängen.23 Die zeitliche und räumliche Ausdehnung des Phänomens Islam macht es kaum möglich, konkrete Aussagen über die Hierarchie der islamischen Gesellschaft zu machen. Dieses ist selbst dann noch problematisch, wenn man einen eingegrenzten Raum zu einer bestimmten Zeit betrachten will, da diese Gesellschaft immer „unstarr und beweglich“ 24 blieb. Charakteristisch war nur der absolutistische Herrscher (wie er bei Niebelschütz ja auch wiederzufinden ist), der mittels eines Beamtenapparats regierte. Eine grobe hierarchische Einteilung wäre die in Herrscher, Wesire (hohe Beamte, die in der Regel durch Qualifikation zu ihren Ämtern gelangten), normale Beamte (die durch die verschiedensten Faktoren zu ihren Posten kamen: von Begabung und Fleiß bis hin zu Geld und Familientradition [obgleich die Ämter an sich nicht erblich waren] ), Mittelstand (als der ökonomisch tragenden Schicht: Handwerker, Händler u.ä.) und Sklaven, sowie „Gesindel“. Für eine gewisse feste Struktur sorgten etwa ab 900 auch die bereits erwähnte und in ihrer Funktion unseren Zünften ähnlichen Gilden, sowie das Stiftungswesen, dem viele Bazare, Schulen, Bibliotheken, Krankenhäuser u.ä. Einrichtungen ihre Existenz verdanken25. Theologen und Rechtsgelehrte gehörten keiner eigenen Hierarchie an, wie das im Christentum der Fall ist, sondern waren (sind) in die verschiedenen Ebenen integriert und primär durch Qualifikation zu ihren Ämtern gelangt. Ein Grund für die „unstarre und bewegliche“ Struktur dieser Gesellschaft ist sicher in der hohen Durchlässigkeit 22 Aus: G. E. von Grunebaum, Der Islam im Mittelalter (Zürich: Artemis Verlag, 1963), S. 199. Vgl. hierzu die entsprechenden Passagen auf den Seiten 277 und 582, die ich unter Punkt 3.2. in einem Ähnlichen Zusammenhang bereits zitiert habe. 24 Aus: G. E. von Grunebaum, 1963, S. 273. 25 Noch heute spielen Stiftungen in der Islamischen Welt eine große Rolle. Die auf die ägyptische Moslembruderschaft zurückgehende Hisbolla ist nicht zuletzt deswegen in der palästinensischen Bevölkerung so beliebt, weil sie neben ihren militärischen Aktivitäten als ein wichtiger Träger sozialer Einrichtungen fungiert — ein in der aktuellen Berichterstattung oft übersehener Aspekt. 23 22 zwischen den Schichten zu suchen: Es gab soziale Aufstiegsmöglichkeiten, die im Extremfall Sklaven (über mehrere Generationen) zu Herrschern machten; auch konnte durch fürstliche Willkür ein unmittelbarer Wechsel der gesellschaftlichen Schichtzugehörigkeit erfolgen (natürlich in beide Richtungen: nach oben wie nach unten). Vielleicht kann man hierin doch eine praktische Auswirkung des Ideals der Gleichheit aller Gläubigen erblicken. Es verbleibt in diesem Zusammenhang noch die Frage nach der Nachfolgeregelung im Amt des Herrschers zu betrachten. Niebelschütz beschreibt wiederholt (auf den Seiten 133, 137 und 277), daß stets der jüngste Sohn des verstorbenen Herrschers dessen Position übernehme, um so „der Mordlust einen Riegel vor[-zuschieben]“ (S. 138). Einmal abgesehen von der Tatsache, daß diese Begründung für eine solche Nachfolgeregelung keinerlei Sinn ergibt (der Letztgeborene kann durch den Zweitletztgeborenen ebenso umgebracht werden wie der Erstgeborene durch den Zweitgeborenen und tatsächlich entgeht Salâch mehreren Anschlägen auf sein Leben nur knapp), gelang es mir nicht, Hinweise auf eine entsprechende Reglung in der Historie zu finden. Allerdings kann ich Niebelschütz’ Aussage auch nicht entkräften, da ich umgekehrt in der von mir benutzten Sekundärliteratur keinen Hinweis auf die umgekehrte Regelung finden konnte, daß der jeweils älteste Sohn zum Nachfolger ernannt würde — möglicherweise deshalb, weil die Autoren dieses als selbstverständlich voraussetzen. Zu diesem Abschnitt läßt sich abschließend sagen, daß Niebelschütz’ knappe Ausführungen nur selten und dann auch nur in Details von den historischen Gegebenheiten abweichen (z.B. in punkto Ehebruch oder bei der Verwendung des Wortes Mufti). Auch beleuchtet der Roman die hier behandelten Aspekte islamischer Kultur und Gesellschaft nur schlaglichtartig, so daß beim Leser ein eher undifferenziertes Gesamtbild entsteht, wobei zu vermuten ist, daß Niebelschütz diesen Aufwand als für seine Zwecke (vgl. hierzu Punkt 2.) ausreichend erachtet. 3.5.2. Der Islam als Religion und religiöse Toleranz An dieser Stelle möchte ich vor allem auf jene Punkte eingehen, die in den Kindern der Finsternis berücksichtigt werden, nämlich die Frage der Toleranz des Islam gegenüber anderen Religionen, das Verhältnis des Islam zu der Gestalt Jesus Christus (nur kurz) und den Stellenwert der Astrologie im Islam sowie die Vorstellung vom Jenseits. Weitgehend aussparen möchte ich hingegen den Islam als solchen, also in Hinblick auf seine Dogmen, Zeremonien usw., da er bei Niebelschütz in seiner religiösen Dimension nicht thematisiert wird, sondern nur insofern Erwähnung findet, als es um die gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen desselben geht (vgl. hierzu die entsprechenden Punkte, unter denen etwa der Djihad, die Rechtsvvorstellungen, u.ä. behandelt werden). So möge es hier genügen, über den Islam selbst nur zu vermerken, was ohnehin größtenteils Gemeingut ist, nämlich daß es sich um eine monotheistische Offenbarungsreligion handelt, die durch ihre (bis heute) rigiden Rechtsvorstellungen und ihre stark expansive Orientierung auffällt und die trotz einer gewissen Ausge- 23 richtetheit auf ein jenseitiges Paradies durch einen sehr diesseitigen Pragmatismus gekennzeichnet ist. In den Kindern der Finsternis wird der Islam als eine sehr tolerante Religion und Kultur dargestellt. So hat der Jude Jared als Ungläubiger in Dschondis einen erheblich besseren Status als in der Christlichen Welt; ungehindert kann er als der wohlhabende (Sklaven-) Händler und Geschäftsmann, der er ist, und sogar als Unterhändler auftreten, ohne dabei gedemütigt oder schikaniert zu werden. Aber auch die Christen haben nichts auszustehen; auf Seite 129 finden wir folgende Passage: Diese Kirche [die Krypta von Sankt Peter und Paul zu Dschondis], eine mirsalonische Prälatur, hatten die Mohren erlaubt, seit eh und je. Sie behinderten niemand, selbst wenn ein Chorbischof oder ein Patriarch visitierte. Sie legten auf Bekehrung ihrer christlichen Haustiere keinen Wert, ja sie erschwerten den Glaubenswechsel, indem sie ihn fühlbar besteuerten. Auch wenn es nicht zu allen Zeiten und allerorten im Islam so tolerant zuging, wie bei Niebelschütz dargestellt, so muß man ihm doch bescheinigen, daß er sich auch in diesem Punkte an historisch Verbürgtem orientiert hat: Der Islam tritt in jener Zeit, wenigstens verglichen mit dem damaligen Christentum, das als Minoritäten ohnehin nur die Juden zuließ und dieses auch nur unter z.T. unwürdigen Bedingungen (gesellschaftliche Ausgrenzung, Progrome, u.ä.), tatsächlich sehr tolerant auf, insbesondere dort, wo er vormals christliche Gebiete erobert, etwa im heutigen Spanien. Der Islam regelt sein Verhältnis zu Minderheiten normalerweise durch Verträge. Die im Djihad Unterworfenen verpflichteten sich zu Tributzahlungen bzw. zu Abgaben und Steuern vielerlei Art und erhielten im Austausch dafür den Status als Schutzbefohlene, Dimmi genannt, deren Rechte und Leben von den Gesetzen geschützt waren. Vor diesem Hintergrund wird auch die von Niebelschütz erwähnte Besteuerung des Glaubenswechsels glaubhaft, zumal die Steuern der Dimmi meist nicht unerhebliche Posten im Staatshaushalt ausmachten. Diese religiösen Minderheiten, soweit sie Christen, Juden oder Zoroastier (Persien) waren, erfuhren für damalige Verhältnisse einen sehr hohen Grad an Toleranz. So genossen sie die bereits im Koran verbürgte Religionsfreiheit („Es gibt keinen Zwang in der Religion.“ 26), die sogar eine eigene Gerichtsbarkeit miteinschloß, wenngleich die öffentlich-demonstrative Ausübung der jeweiligen Religion verboten war und die Ausführungen von Kulthandlungen in der Privatsphäre oder den entsprechenden Gebäuden (Kirchen und Synagogen)stattzufinden hatten. Dementsprechend waren Zwangsbekehrungen äußerst selten und wurden dann auch nur bei arabischen Christen vorgenommen (hierzu paßt die Aussage, daß auf die „Bekehrung der christlichen Haustiere kein Wert“ gelegt wurde); auch gab es Progrome gegen Ungläubige erheblich seltener als im Christentum, wo Judenprogrome ein regelmäßig wiederkehrendes Phänomen waren (und offensichtlich bis in dieses Jahrhundert hinein sind). Trotz der Religionsfreiheit ist der Islam eine „abschließende Religion“27, die prinzipiell keine Gleichheit von Gläubigen und Ungläubigen kennt; die Toleranz wurde im Bewußtsein der eigenen Überle26 27 Koran (2,256), zitiert nach Khoury, Hagemann und Heine, 1991, S. 719. Aus: Grunebaum, 1963, S. 227. 24 genheit gewährt. So waren Nichtmoslems Bürger zweiter Klasse, Minderwertige, die sich dieser Minderwertigkeit nur durch Konversion entledigen konnten, die isoliert, von der Macht ausgeschlossen und rechtlich nicht voll gleichgestellt waren (z.B. galten Ihre Zeugenaussagen weniger als die von Moslems) und die nicht selten gedemütigt wurden. Zugleich hatten sie aber Zugang zu allen Berufen, vom Gerber bis hin zum Hofarzt und Gelehrten und genossen volle Geschäftsfähigkeit sowie den Schutz ihres Eigentums, was Niebelschütz am Beispiel Jared illustriert, so daß sie, obwohl nominell (d.h. nach der Scharia) von der Machtausübung ausgeschlossen, oft einflußreiche Positionen bekleideten. Auch im privaten Bereich gab es keine totale Isolation; so durfte ein moslemischer Mann durchaus eine jüdische oder christliche Frau heiraten (obwohl das nicht immer gern gesehen war), nicht allerdings umgekehrt, da darin eine Gefährdung des Glaubens der allgemein für wankelmütiger gehaltenen Frau gesehen wurde. Die Situation Andersgläubiger im Islam war im Mittelalter also in der Regel erträglicher als im christlichen Kulturkreis, doch keineswegs ideal im Sinne einer vollen Gleichberechtigung. Es läßt sich dabei bedauerlicherweise eine bis heute fortdauernde Auseinanderentwicklung und Entfremdung von Islam auf der einen und Juden- und Christentum auf der anderen Seite feststellen — im Mittelalter wesentlich durch die Kreuzzüge und die Reconquista bedingt, was jeweils (besonders im letzteren Fall) einen Machtverlust des Islam bedeutete, der sich deutlich negativ auf das bis dahin recht tolerante Klima auswirkte. (Schließlich geht Machtverlust an die Substanz einer Glaubensgemeinschaft, die sich von Gott dafür auserwählt hält, die ganze Welt mit ihrer „Wahrheit“ zu beglücken: ein Faktor, der das Verhältnis des Islam zum „siegreichen“ Westen bis heute belastet und wesentlich für das Fundamentalismus genannte Gegenwartsphänomen verantwortlich ist!) Ein anderer Punkt, der das Verhältnis von Islam und Christentum betrifft, wird bei Niebelschütz zweimal beiläufig erwähnt: das Verhältnis des Islam zur Gestalt Jesus Christus. Auf Seite 120 ist von „Jesus dem Gesalbten, den ja auch wir [Moslems] als Propheten verehren“ die Rede; auf Seite 582 äußert Helena: „Ohnehin verehren sie [die Moslems] alle unsere Heiligen, die bis zu Mohammeds Geburt gelebt haben, Christus also auch, den Heiligen Guilhem also nicht.“ Niebelschütz weist damit auf eine fundamentale Asymmetrie im Verhältnis der beiden Religionen hin: Die eine, nämlich der Islam, akzeptiert (wenigstens theoretisch) die Grundlage der anderen als legitim (obwohl die Vorstellung, Jesus sei Gottes Sohn, ausdrücklich als mit der islamischen Gottesvorstellung unvereinbar abgelehnt wird), nicht jedoch andersherum; Mohammed bleibt dem Christentum fremd. Daß Niebelschütz ein echtes gegenseitiges Verständnis beider Religionen für möglich hält,das über bloße Toleranz hinausgeht und das auf der Grundlage eines gemeinsamen Kerns von Christentum und Islam eine zukünftige Synthese denkbar werden läßt, deutet er auf Seite 508 im Zwiegespräch von Fatima und dem Kalifen an, wenn dort zwischen „wahrer“ und „falscher“ Frömmigkeit unterschieden wird und Niebelschütz den Kalifen sagen läßt: Es gefällt mir, (...) wie du den Glauben als solchen auffaßt, den meinen wie den deinen. Meine Muftis und Mullas verwerten ihn als irdische Daumenschraube, Fatima zieht seine innere Essenz. 25 Dieses Zugeständnis des Kalifen soll zum einen illustrieren, daß auf der Basis eines ernst gemeinten Dialogs Verständnis und Koexistenz möglich sind, zum anderen, daß beide Religionen nur zwei Dialekte einer Sprache sind, daß sie sich nur der Form nach („Frömmigkeit bei den Moslemun, Frömmigkeit bei den Christen“, S. 508), nicht aber der Substanz, der “inneren Essenz“ nach unterscheiden und daß also (diesen Schluß erlaube ich mir) der Antagonismus beider Religionen als in einer Synthese überwindbar erscheint. Obwohl Niebelschütz, wie gesagt, den Islam als solchen kaum berücksichtigt, widmet er einem Phänomen innerhalb desselben vergleichsweise große Aufmerksamkeit: der Astrologie. Die Astrologie war (und ist es zum großen Teil bis heute) ein in den Islam fest integriertes Element, das, anders als im Christentum, nicht als Aberglaube aufgefaßt wurde. Sie hat ihre Wurzeln zum einen in den Traditionen der arabischen Wüstenvölker, die sich auf ihren Wanderungen an den Gestirnen zu orientieren verstanden, zum anderen in von den Griechen übernommenen Vorstellungen — hier ist als wichtigste Quelle ein Werk namens Almagest von Ptolemaios zu nennen. Die islamische Astrologie hatte wesentlichen Einfluß auf entsprechende Vorstellungen in Europa, die z.T. bis heute überdauert haben (denn auch heute wird ja noch Astrologie betrieben). Entsprechend der Tatsache, daß astrologische Werke der Griechen gemeinsam mit solchen der Philosophie, der Naturkunde und der Medizin ins Arabische übertragen wurden, galt die Astrologie im islamischen Mittelalter als angesehene Wissenschaft (wärend man heute bei solch einer Zuordnung eher zögern würde). Das Amt des Hofastrologen war ein sehr wichtiges und einflußreiches — eine Tatsache, der auch Niebelschütz Rechnung trägt, indem er die Entscheidungen der Mauren oft als abhängig von den Berechnungen des Hofastrologen beschreibt. So wird der Termin für das Duell des Emirs und des Markgrafen aufgrund von Horoskopen festgesetzt, ebenso der für einen Angriff auf Rodi, „weil die Sterne günstig standen“ (S. 137). Niebelschütz bescheibt hier, wie auch in anderen Lebensbereichen, die Rolle der Astrologie völlig adäquat: Es war durchaus üblich, günstige Zeitpunkte für Kriegszüge, die Errichtung von Bauten, die Gründung von Städten, das Einbringen von Saatgut in die Erde, u.ä. aus dem Lauf der Gestirne zu errechnen. Dies galt auch für die Medizin, in der die Astrologie eine nicht unerhebliche Rolle spielte; bedeutende Ärzte waren zugleich auch immer Sternkundige. Auch das findet im Roman seinen Niederschlag: Nach zwei Monaten eröffnete man ihm, er habe einen Stein im Hirn, das Hirn brauche einen Ausgang, durch den es atmen könne, dafür sei eine bestimmte Sternkonstellation nötig, die man errechnen werde aus des erhabenen Fürsten Horoskop. (S. 130) Neben der Errechnung „günstiger Zeitpunkte“ für alle möglichen Belange gab es die Versuche, in den Horoskopen Vorhersagen über die Zukunft zu machen, sowohl was den allgemeinen Lauf der Dinge betraf (politische und Naturereignisse), als auch in Hinblick auf die individuelle Zukunft. Auf den Seiten 136 und 137 führen Barral und Salâch eine Diskussion über die Validität von Horoskopen, wobei Barral skeptisch bleibt: 26 Und wenn alles von den Sternen entschieden wird, warum sorgt ihr euch noch ums Regieren? Bei uns ergibt sich die Zukunft aus der Vergangenheit. Wir vertrauen auf Gott und wenn es gehen heißt, gehen wir gefaßt. (S. 136) Auch bereitet ihm der Gedanke, die eigene Zukunft zu kennen, Unbehagen: „Ich werde Achtzig. Mehr brauche ich nicht.“ (S. 137) Zwar kann Salâch seinen Freund nicht überreden, sich sein Horoskop stellen zu lassen, doch läßt dieser sich schließlich mit einem glücksbringenden Talisman, einem Amulett beschenken, welches das Auge Roderos enthält. Auch dieses ist damals eine recht gängige Praxis gewesen: Die Kraft der Sterne galt als auf Talismane übertragbar; entsprechend sagt Salâch: „Du sollst dieses Amulett haben, und dein Aufgang soll errechnet sein aus dem Untergang deines betränten Ghissi.“ (S. 137) Interessant ist, daß Niebelschütz die Astrologie in den Kindern der Finsternis als ein tatsächlich funktionierendes Mittel der Weltdeutung darstellt. Dieses wird zum einen in Beiläufigkeiten deutlich, wie etwa auf Seite 144: „Sie schieden, als der hohe Herbst überging in den ersten Winterfrost, an einem Tag, den die Sterndeuter berechnet hatten.“ Zum anderen aber auch am Verlauf der Handlung: Barral ist wirklich vom Glück verlassen, als er Fastrada sein Amulett leiht. Mit dem Horoskop, das Salâch schließlich ohne Wissen des Freundes über diesen anfertigen läßt (vgl. S. 284 - 286), wird klar, daß Sterndeuterei in den Kindern der Finsternis „real“ wirkende Kräfte beschreiben soll: Auf den Seiten 285 und 286 wird recht detailliert und vor allem zutreffend über den weiteren Verlauf von Barrals Leben und die dabei entstehenden Personenkonstellationen geweissagt; so wird seine Krise, die er beinahe mit dem Leben bezahlen wird, („Jene spätere der feindseligen Konstellationen, mit unsagbaren Durchgängen, zermalmt ihn zwischen seinen eigenen Kindern. (...) Ich finde nichts, was auf Entrinnen deutet. Er wäre dann sechsundfünfzig, nicht alt, kein Erzvater der Seinen, ein gestrandetes Schiff.“, S. 285) ebenso vorausgesagt wie seine Abhängigkeit von seinen zahlreichen Frauen („Seine Größe ruht auf den Frauen.“, S. 286) und die damit in Verbindung stehenden Ereignisse, etwa Frastradas Odyssee („Selbst die mittlere, die sich so lange entzieht, die auf dem Meer fahrende ...“, S. 286). Der Grund dafür, daß Niebelschütz den Einfluß der Gestirne auf das Leben der Menschen als einen „realen“ Faktor beschreibt, kann in dem Streben nach Authentizität vermutet werden: Für die Menschen damals waren übernatürliche Phänomene einfach „wirklich“; die Vorstellung eines durch Naturgesetzlichkeiten bestimmten Laufs der Welt hat sich erst später durchsetzen können. Niebelschütz beschränkt die Darstellung von Übernatürlichem demgemäß auch nicht auf die Astrologie, sondern läßt es regnen nachdem Barral Maitagorry auspeitscht, läßt Judith und Dom Guilhem als Erscheinungen auftreten und Judith ein glühendes Eisen tragen. Ein letzter Aspekt sei noch angesprochen, in dem eine Darstellung der Relativierung bedarf: Niebelschütz läßt Rodero auf Seite 55 sagen, daß den Kriegern im Djihad das Paradies „ohne langes Warten auf [das] Jüngste Gericht“ versprochen würde. Zwar stimmt es, daß den Streitern für die Sache des Islam der Platz im Paradies sicher zugesagt ist, doch erfolgt nach islamischer Vorstellung der Wechsel dorthin nicht so unvermittelt, wie die Äußerung Roderos den Anschein erweckt: Es gibt eine Art Zwischengericht, zu dem man von einem Todesengel 27 geführt wird, und eine darauf folgende Befragung im Grab, die beide darüber entscheiden, ob der Verstorbene für das Paradies oder die Hölle bestimmt ist. Anschließend dämmert er im Grab dem Jüngsten Tag entgegen, an dem endgültig darüber befunden wird, ob der Gestorbene ins Paradies kommt. Das Jüngste Gericht wird also keineswegs ausgespart; im Gegenteil: Der Weg ins Paradies ist sogar komplizierter, wenn auch nicht länger als nach christlicher Vorstellung. 3.5.3. Haremskultur, Sexualität und die Stellung der Frau Dieser Themenkomplex findet in den Kindern der Finsternis eine, verglichen mit vielen anderen Aspekten islamischer Kultur, stärkere Berücksichtigung, insbesondere im „Fatima“-Kapitel. Doch geschieht die dort stattfindende Darstellung der Haremskultur trotzdem eher beiläufig; sie tritt hinter den Fortgang der Handlung, die sich hier mit dem Verbleib Fastradas beschäftigt, zurück und fungiert hauptsächlich, aber nicht nur, als Dekorum. Über die Stellung der Frau in der islamischen Gesellschaft finden sich dementsprechend nur Andeutungen; trotzdem möchte ich damit beginnen. Vorausschicken möchte ich, daß vieles von dem, was ich hier anführen werde, natürlich eine grobe Verallgemeinerung darstellt, die zwar überwiegend, aber eben nicht für alle Zeiten und alle islamisch geprägten Gebiete gilt. Beispielsweise trifft das meiste des Folgenden auf die Tuareg, ein nordafrikanisches Nomadenvolk mit mutterrechtlichen Wurzeln, nicht zu, obwohl sie dem Islam zugehören. Rein theologisch betrachtet, gelten Männer und Frauen im Islam als gleich — gleich vor Gott. Beide können gleichermaßen gottgefällig oder sündig leben und haben dafür mit den gleichen Konsequenzen nach dem Tode zu rechnen. Diese Gleichheit vor Gott hat aber für das Leben im Diesseits kaum Folgen. Vielmehr wird in der — für die Praxis höchst folgenreichen — Theorie von einer „natürlichen“, gottgegebenen Überlegenheit des männlichen Geschlechts ausgegangen (eine Position, die erst in jüngster Zeit von islamischen Feministinnen hinterfragt wird). Im Koran steht explizit, daß der Mann von Gott über die Frau gesetzt wurde; dort wird sogar soweit gegangen, dem Mann ein Recht auf Züchtigung der ungehorsamen oder widerspenstigen Frau einzuräumen. (Dazu muß gesagt werden, daß die Lehren des Propheten oft inkonsistent sind, so auch in dieser Hinsicht: An manchen Stellen wird nämlich gefordert, die Frauen gut zu behandeln. Auch kennt die Geschichte des Islam weibliche Heilige und Mystikerinnen.) Aus dieser naturrechtstheoretischen Position heraus wird eine in jeder Hinsicht untergeordnete Position der Frau gerechtfertigt: Die Frau ist vom öffentlichen Leben nahezu völlig ausgeschlossen, insbesondere zu Zeiten und in Gegenden, in denen in denen es üblich war (ist), den Lebenskreis der Frau auf das Haus und dort bevorzugt auf den dafür speziell vorgesehenen Teil des Hauses, den Harem, zu beschränken. Diese Praxis der „Abschließung“ (ein Euphemismus, da es sich um einen Lebenslangen Hausarrest handelt) war (ist) eine eher in Städten anzutreffende Sitte, ebenso wie die der Verschleierung (bei Niebelschütz nur beiläufig auf Seite 131 erwähnt), die in ihrer Extremform durch den Koran nicht abgedeckt ist. Beides 28 galt als ein Wohlstand signalisierendes Previleg der Oberschicht, die es sich leisten konnte, auf die Arbeitskraft der Frau außerhalb des Hauses zu verzichten; die Frauen ärmerer Schichten durften bzw. mußten unverschleiert auf dem Feld arbeiten. Da Schleier und Harem (im oben genannten, ursprünglichen Sinne des Wortes) Statussymbole waren, verwundert es nicht, daß bis in die Gegenwart hinein von Frauen berichtet wird, die stolz darauf sind, den Harem nur einmal im Leben verlassen zu haben: bei der Heirat, als sie ins Haus des Mannes übersiedelten. Auch in anderen Bereichen zeigt sich der Patriarchalismus des Islam sehr deutlich. Es wird kaum verwundern, daß die Bezeichnung Patriarchat ganz wörtlich zu nehmen ist: Frauen wurden von der Herrschaft ausgeschlossen, was natürlich die Einflußnahme mittels Intrigen nicht verhindern konnte; es handelte sich aber stets um eine indirekte Form der Machtausübung. Rechtlich waren (sind) sie ebenfalls nicht gleichgestellt. So zählt die Zeugenaussage einer Frau halbsoviel wie die eines Mannes, Töchter erben nur die Hälfte dessen, was Söhne erben, die Scheidung der Ehe kann in der Praxis nur als Verstoßung der Frau durch den Mann vorkommen (theoretisch gibt es jedoch für die Frau die Möglichkeit, sich aus der Ehe freizukaufen) und auch im Bereich des Sexualstrafrechts ist die Frau z.T. erheblich stärkeren Restriktionen und Strafen unterworfen als der Mann: Ihr Ehebruch kann (bei Geständigkeit) sogar mit dem Tode bestraft werden; in einigen Regionen, etwa in Ägypten, ist sogar bis heute die (noch aus vorislamischer Zeit stammende) Praxis der Klitorisbeschneidung üblich, die dem Ehebruch bzw. dem vorehelichen Geschlechtsverkehr vorbeugen soll. Der Hintergrund dieser drakonischen Maßnahmen kann wohl in der Sorge der Männer um die Legitimität der Nachkommen vermutet werden, der in der islamischen Gesellschaft große Bedeutung beigemessen wird (ein Problem, das in mutterrechtlichen Gesellschaften übrigens nicht auftaucht, da Zweifel an der Mutterschaft kaum möglich sind). Trotz der umfassenden Benachteiligung der Frau muß fairerweise angemerkt werden, daß der Islam in der arabischen Welt zunächst eine Verbesserung der Lage der Frau bedeutete, da sie zuvor vom Erb- und Besitzrecht völlig ausgeschlossen war und auch keinerlei Rechtsschutz genoß, was der Islam änderte, z.B. hat die Frau freie Verfügung über ihr (in die Ehe als Mitgift eingebrachtes) Eigentum. Nichts von alledem findet sich bei Niebelschütz, doch hat er im Harem des „Fatima“Kapitels ein eindrucksvolles Bild gefunden, welches als Exponent der ihm zugrundeliegenden Verhältnisse eben diese verdeutlicht. Dabei stellt Niebelschütz den Harem nicht einmal besonders detailliert dar, sondern läßt nur einige Gestalten aus der Haremshierarchie in Erscheinung treten und überläßt den Rest der Imagination des mit Klischeevorstellungen in der Regel hinreichend ausgestatteten Lesers. Die eben erwähnten Figuren sind die „Oberhofdame Fatima“ (S. 507), die sich später als die verschollene Fastrada erweisen soll, der „Obereunuch“ (S. 513) nebst anderen Eunuchen und natürlich die Haremsdamen. Tatsächlich fanden sich in den Harems diese Rollen: Besonders Eunuchen waren von der Oberschicht als Haremswächter und -betreuer geschätzt, von der breiten Bevölkerung allerdings verachtet. (Der Eunuchenhandel wurde übrigens zumeist von Christen und Juden betrieben, was in den Kindern der Finsternis in der Gestalt Jareds, der neben gewöhnlichen Sklaven auch mit Eunuchen handelt, 29 seinen Niederschlag findet. Vgl. S. 138 ff.) Neben den Eunuchen gab es im Harem, der meist eine strenge Hierarchie von Ehefrauen, Nebenfrauen und Sklavinnen aufwies, häufig auch ältere Aufseherinnen, hier durch die Figur Fatima vertreten. Die Haremsdamen erhielten zumeist eine hervorragende Ausbildung, die Schreiben, Tanzen, Musizieren, Handarbeit und gutes Benehmen umfaßte und die sie unter Umständen für spätere Tätigkeiten, etwa als Gouvernante, qualifizierte. Nicht selten, auch da liegt Niebelschütz wieder richtig, waren diese Frauen Christinnen oder Sklavinnen aus anderen angrenzenden Kulturkreisen. Eine Grundlage der Institution des Harems (der übrigens keine ursprünglich islamische Einrichtung ist, sondern aus Byzanz und Persien übernommen wurde) ist natürlich die Polygamie des Mannes, die seiner in der Theorie behaupteten „natürlichen“ Überlegenheit entspricht und die durch den Koran legitimiert wird, der dem Mann mehrere (häufigste Auslegung: bis zu vier) Frauen zubilligt. Die „Vielehe“ (bei Niebelschütz wiederum nur kurz und beiläufig auf Seite 531 erwähnt) ist dabei oft auf die Oberschicht beschränkt, wo dann zu der vom Koran gebilligten Ehe mit mehreren Frauen noch das Konkubinat mit Sklavinnen trat. Die andere Grundlage der Haremskultur ist das positive Verhältnis des Islam zu Sexualität und Erotik, was sich z.T. sogar in der religiösen Dichtung der Mystiker niederschlägt, die sich häufig erotischer Motive zur Veranschaulichung mystischer Einsichten bedient. Im Islam wird die Sexualität, ganz anders als im Christentum (das als Randerscheinung allerdings auch eine Brautmystik kennt), als eine Gabe Gottes bejaht; sie gilt nicht als sündig, solange sie sich nicht als Homosexualität, Prostitution, Ehebruch oder vorehelichem Geschlechtsverkehr manifestiert. Allerdings — und das kommt ja in der Institution des Harems recht deutlich zum Ausdruck — ist all das vom Mann her gedacht: Im Koran wird die Frau als „Saatfeld“ des Mannes betrachtet und ein auf Mohammeds Nachfolger Ali zurückgeführter Ausspruch besagt: „Die beste Frau ist für euch die, die ihre Scham in Keuschheit hütet (aber) ihrem Mann in Sinnenlust zugetan ist.“28 Hier wird ein Anspruch auf die sexuelle Verfügbarkeit der Frau deutlich, wie er uns auch bei Niebelschütz begegnet. Als, wie auf den Seiten 513 bis 515 beschrieben wird, neue Haremssklavinnen eintreffen, macht der Kalif diesen Anspruch geltend: Eine der „künftigen Beischläferinnen“ (S. 513), Aurora, die auch als „schimmernde[s] Fleisch, das ihn verlockte,“ (S. 513) bezeichnet wird, weigert sich, als einer der „vielerlei Brunnen, die Glut [des Kalifen] zu löschen“, (S. 515) zu dienen, woraufhin sie zunächst vom Obereunuchen, dann vom Kalifen selbst geprügelt wird. Zwar läßt der Kalif daraufhin von ihr ab, doch „kühlte [er] seinen Liebesdrang an einer Willigeren“ (S. 514). Sowohl das Geschehen, als auch die Wortwahl Niebelschütz’ (Aurora wird zum „verlockenden Fleisch“ reduziert) illustrieren die Rolle und den Stellenwert der Frau als ein unfreies, den Bedürfnissen des Mannes untergeordnetes und dienendes Wesen. Auch wenn der Kalif Fatima/Fastrada und Aurora schließlich freigibt, wird eben darin auch die Unterworfenheit der Frau unter die Willkür des Mannes deutlich: Er mußte sie nicht freilassen, sondern hätte sie ebensogut züchtigen oder enthaupten lassen können, wie er es zuvor mit den von seinem Vater schwangeren Ha- 28 Aus: Peter Antes u.a., Der Islam: Religion - Ethik - Politik (Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1991), S. 109. 30 remsdamen tat. Durch den Mund von Fatima kritisiert Niebelschütz die Haltung männlicher Moslems ihren Frauen gegenüber: „Dein Leib hat nicht mehr geliebt? er mag nicht mehr lieben?“ - „Das ist ihm vergangen. (...) Auch wegen der armen Mädchen, die meiner Fürsorge anvertaut waren. Was habe ich an Tränen und an Verzweiflung sehen müssen! Wir Weiber, ob christlich oder muselmanisch, haben eine Seele, die lieben und geliebt werden will. Ihr beraubt euch des Schönsten, weil Schwierigsten.“ - „Liebe ist schwierig?“ - „Sehr. Liebe ist Rücksicht und Opfer.“ (S. 511) Indem er durch Fastrada ausdrücklich betont, daß auch die Frau ein beseeltes und liebebedürftiges Wesen ist, bezieht Niebelschütz Stellung und lehnt die Reduktion der Frau zum stets verfügbaren Lustobjekt des Mannes ab; darauf deutet auch die Reaktion des Kalifen auf diese Äußerung hin, die Einsicht signalisiert: „Si Achmed überlegte lange. ‘Ich will daran denken’, sagte er nicht ohne Ergriffenheit.“ (S. 511) Hinweise auf die in den Kindern der Finsternis erwähnten Hinrichtungen von Haremsfrauen, die von Fremden beschlafen wurden (vgl. S. 144) oder die vom Vorgänger im Herrscheramt schwanger waren (vgl. S. 507), gelang es mir nicht zu finden. Zwar erscheinen sie durch das ausgeprägte Patriarchat in Verbindung mit der totalitären Herrschaftspraxis jener Zeit plausibel; ob es sie aber tatsächlich in dieser Form gegeben hat, vermag ich nicht zu sagen. Als letztes möchte ich noch auf Tausendundeine Nacht hinweisen, dessen Rahmenhandlung Niebelschütz möglicherweise zu der Personenkonstellation Fatima-Kalif Achmed das Vorbild geliefert haben könnte, so wie diese umgekehrt eine Hommage an dieses reichhaltige Werk orientalischer Volkspoetik darstellen könnte: In Tausendundeine Nacht ist es die kluge Scheherazade, die ihrem künftigen Gatten, den König von Samarkant, mit ihren spannenden Erzählungen von seinem Vorsatz, sie töten zu lassen, abbringt — in den Kindern der Finsternis ist es die weise Fatima, die ihren Herrn, den Kalifen Achmed, durch ihren Wert als kluge Gesprächspartnerin davon abhält, sie für ihre Widerspenstigkeit enthaupten zu lassen. Will man diese Parallele gelten lassen, so könnte man hier von Intertextualität sprechen (der wohl einzigen in diesem Roman, wenn man einmal von der Bibel absieht).29 3.6. Exotik und orientalische Eigenheiten In den Kindern der Finsternis werden wir mit verschiedenen, immer wiederkehrenden Stereotypen hinsichtlich des Erscheinungsbildes des Orients konfrontiert, wobei sich die 29 Ich halte es für denkbar, daß Niebelschütz, was die Personenkonstellationen anbetrifft, noch weitere Anleihen bei Tausendundeine Nacht gemacht hat, doch reicht meine Kenntnis nicht aus, um diese Vermutung zu untermauern. 31 Frage stellt, inwieweit diese eine Grundlage haben und ob der Autor sie bewußt oder unbewußt verwendet. Einer dieser Stereotypen ist die Vertragstreue der Moslems. Niebelschütz greift dieses auf Seite 277 an einer Stelle auf, wo er den (auktorialen) Erzähler eine Argumentation Barrals paraphrasieren läßt; dort finden wir explizit: „Beschworene Verträge waren den Mohren heilig.“ Zwar fand ich hierfür keine Belege, doch wirkt dieses einigermaßen glaubwürdig, wenn man die Bedeutung des Handels in der islamischen Welt in Betracht zieht (vgl. Punkt 3.5.1.), für den die Verläßlichkeit von Verträgen (wenigstens im Regelfall) eine unabdingbare Voraussetzung ist. Zu einem weiteren Stereotyp, dem der Despotie, habe ich mich bereits unter Punkt 3.5.1. geäußert. Die historische Grundlage hierfür (nämlich der absolutistische Status des jeweiligen Herrschers) ist so unübersehbar, daß der orientalische Despotismus üblicherweise schlicht konstatiert wird, etwa bei Ess und Halm an einer Stelle, an der es um den Blickwinkel des 18. Jahrhunderts auf den Orient geht: „Der Despotismus sei ein beklagenswertes politisches System, das aber angemessen untersucht und wie jedes andere System im ökologischen und gesellschaftlichen Zusammenhang erklärt werden müsse.“ 30 Damit in engem Zusammenhang steht die von Niebelschütz auf Seite 515 erwähnte (und auf den vorhergehenden Seiten illustrierte) Grausamkeit: „‘Und Ihr Moslemun’, erwiederte sie [Fatima], gleichfalls auf Sarazenisch, ‘verschwendet Eure Grausamkeiten, um Eure Edelmut zu verhüllen.’“ Ich erwähnte bereits weiter oben, daß dieser Zug in der islamischer Kultur durchaus zu entdecken ist, insbesondere, wenn man an die Rechtsvorstellungen in der moslemischen Welt denkt. Als „Eigenheit“ dieses Kulturkreises erscheint das aber nur aus heutiger Sicht; im Mittelalter dürften sich Christentum und Islam im Ausmaß der verübten Grausamkeiten kaum unterschieden haben. Auf Seite 136 wird die Gastfreundschaft, die in dem betreffenden Kapitel („Dschondis“) ausgiebig illustriert wird, erwähnt: „‘... heilig ist dem Propheten die Gastfreundschaft. Schlummere süß, Gastfreund, Rosenträume mögen deine Seele erheitern.’“ Hier bewegt Niebelschütz sich auf sicherem Grund: Die orientalische Gastfreundlichkeit, speziell in islamischen Ländern, ist mehr als nur eine Klischeevorstellung. Der Koran fordert ausdrücklich die Gastfreundschaft gegenüber Reisenden. Es handelt sich dabei um eine aus vorislamischer Zeit übernommene Sitte, die ihre Wurzeln im Nomadentum der Araber hat. Diese Sitte hat zum einen eine sehr pragmatische Seite, da das Wesen des Nomadentums die Ortsungebundenheit ist und sich potentiell jeder einzeln Reisende einmal in der Position des Gastfreundschaft Suchenden befinden kann (zudem bietet die Gastfreundschaft Ausgestoßenen eine Überlebensgrundlage), zum anderen gilt sie als ein Mittel des friedlichen Wettstreits unter den rivalisierenden und verfeindeten Nomadenstämmen: Wer in dieser Hinsicht Großzügigkeit an den Tag legt, signalisiert damit Macht und Wohlstand, was einen erheblichen Prestigegewinn bedeutet. Einen Aspekt der orientalischen Lebensweise hebt Niebelschütz besonders stark hervor: die lebensbejahende Grundhaltung der Moslems und die damit verbundene Vorliebe für aufwändigen Luxus (jedenfalls was die Oberschicht betrifft). Die Kapitel „Das Treffen im Ge30 Ess und Halm, 1980, Bd. 1, S. 56. 32 birge“ und „Dschondis“ leben von der detailreichen Illustration dieses Lebensstils. Niebelschütz schafft so eine Atmosphäre des Exotischen, die er durch Kontrastierung mit der christlichen Lebensweise noch verstärkt: Bei den Ungläubigen, die auch, wennschon anders, glaubten, saß man auf Polstern am Boden, aufrecht, in artiger Haltung, die Füße gekreuzt; schöne Gewebe hingen von den Wänden; das Gespräch blieb leise. Auf Stein und Holzbänken räkelte sich zu Cormons die Ritterschaft; Weinsäure, Ziegenkäse und Gegröl stieg aus ihren Schlünden; Knoblauch, Bocksdunst und Schweiß aus den Kleidern. (S. 146) Auf Seite 139 wird dann auch ausdrücklich betont: „Hier [in Dschondis] zieht man es vor zu leben.“ Zur Illustration dieser Seite islamischer Kultur taugt am besten der Besuch entsprechender historischer Bauwerke, allen voran der Alhambra in Granada, oder die Betrachtung entprechend illustrierter Bücher31; der Eindruck, den man dabei erhält, gibt Aufschluß über die unvorstellbar luxuriöse Lebensweise der damaligen Oberschicht und bestätigt insofern das Bild, das Niebelschütz in seinem Roman vermittelt. Daß Niebelschütz diesem Aspekt soviel Platz in seinem Buch einräumt, hat seine Berechtigung: Das Abendland war bei nicht- oder nachkriegerischen Begegnungen mit dieser unglaublichen Lebenskultur stets zutiefst beeindruckt und tendierte häufig zur Nachahmung; so kam es auch im 12. Jahrhundert z.T. zur modebedingten Übernahme bestimmter Gebräuche, etwa des Sitzens auf Teppichen, und Kleidungsweisen; selbst die moslemische Architektur wurde stellenweise nachgeahmt, angeregt durch die Hinterlassenschaften der Moslems auf der Iberischen Halbinsel (vgl. Punkt 3.4.3.). Eine Entsprechung zum Lebensstil findet sich in Niebelschütz’ Buch in Gestalt der „blumigen Reden“ (S. 508), die den Moslems zueigen sind und für die es zahlreiche Beispiele gibt, besonders in den Äußerungen Salâchs und des Kalifen Achmed (vgl. etwa Salâchs Ratschläge zur Nutzung des Flußwassers auf den Seiten 282 bis 284). Auf Seite 488 wird sogar von der Berühmtheit der „rosenschwellenden Verbrämung ihrer [der Sarazenen] wahren Gefühle“ gesprochen. Auch die Verwendung dieses Stereotyps hat ihre Berechtigung: Die Mauren waren tatsächlich berühmt für ihre Zungenfertigkeit, die Dichtkunst war hochentwickelt und konnte auf eine lange, wiederum bis in die vorislamische Zeit zurückreichende Tradition zurückblicken und die Beschäftigung mit der Poesie war in der Oberschicht ein wichtiges Element des Bildungskanons; entsprechend waren (Hof-)Dichter hoch angesehen. Selbst vom Koran wird bisweilen gesagt, er besteche durch die Schönheit seiner Verse stärker als durch die wörtliche Bedeutung des Textes. Es sei hierbei bemerkt, daß nicht nur die gesprochene Sprache der Araber, sondern auch die Schrift extrem ästhetisch ist: Die Kalligraphie der Araber darf wohl als eine der höchstentwickelten (wenn nicht sogar als die höchstentwickelte) der Welt gelten. In den beiden Kapiteln „Das Treffen im Gebirge“ und „Dschondis“ sowie im Kapitel „Fatima“ wird mittels der bereits erwähnten Beschreibung „aller vergleichslosen Feinheit [des] äußeren Daseins“ (S. 510) sowie der sonstigen Eigenheiten der Moslems eine ganz spe31 Vgl. etwa: Oleg Grabar, Die Alhambra (Köln: Du Mont Buchverlag, 1981). 33 zifische Atmospäre der Exotik geschaffen. Fatima nennt es ganz offen eine „Welt des Märchens, aus der ihr [d.h. die Moslems bzw. Si Achmed], weil es für Euch kein Märchen ist, nicht hinauswollen werdet.“ (S. 509) Hier haben wir wieder eine mögliche Anspielung auf Tausendundeine Nacht, vor allem aber eine Anspielung auf das Orientbild des Abendlandes, in dem in der Außenperspektive, für die hier stellvertretend Fatima/Fastrada steht, verklärt wird, was für die Angehörigen des betreffenden Kulturkreises Normalität und Alltag ist. Eigenheiten werden erst aus der Distanz sichtbar bzw. werden durch eine distanzierte Perspektive überhaupt erst zu solchen. Die eben zitierte Textstelle läßt vermuten, daß Niebelschütz sehr bewußt mit exotischen Stereotypen umgeht, worauf auch das unter Punkt 2. schon erwähnte Spiel mit dem exotischen Klang orientalischer Begriffe („Si Iskander“/“Herr Alexander“, S.507) und die Ausdrücklichkeit, mit der die jeweiligen Eigenheiten und sogar die „Verlockung des Fremdartigen“ (S. 130) selbst benannt werden (vgl. die oben angeführten Zitate), hinweisen. Er weiß sowohl um das Wesen der Stereotypen bzw. der Exotik, d.h. um deren Bedingtheit durch die Außenperspektive, als auch um deren oftmalige Nähe zu tatsächlichen Gegebenheiten einer Kultur (schließlich muß ein Stereotyp oder eine Klischeevorstellung nicht zwangsläufig ein Vorurteil sein). In der Verwendung exotischer Motive steht Niebelschütz dabei in einer langen, zumeist aber weniger reflektierten Tradition: Besonders seit dem 19. Jahrhundert entfaltet der Reiz orientalischer Exotik seine Wirkung im künstlerischen Schaffen Europas; stellvertretend sei hier nur Goethes West-östlicher Divan genannt, dessen romantisches Orientbild vor allem von Tausendundeine Nacht und von Hafiz’ Divan, einer mystischen Liebesdichtung aus Persien, inspiriert war. Dieser Exotizismus ist (nicht nur in der Literatur) bis heute ungebrochen mit dem kleinen Unterschied, daß mittlerweile der auch der hintere Orient in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist, z.B. in Hermann Hesses Siddhartha. 4. Schluß Im Nachwort zu den Kindern der Finsternis zitiert die Witwe des Autors, Ilse von Niebelschütz, den als Übersetzer von Joyce und Poe bekannt gewordenen Hans Wollschläger, der von den Kindern der Finsternis spricht als einem „Literatur gewordenen Stück Erinnerung an Unserer Aller Vorzeit, in die das dichterische Gedächtnis tiefer zurückreicht als alle Dokumente“ (S. 590), und fügt an, daß dieses „zugleich die Antwort auf Leserfragen nach Archivund Quellenmaterial, das es nicht gab“ (ebd.), sei. Dieses ist auch der Eindruck, den ich bei der Beschäftigung mit dem Maurenmotiv in diesem Werk gewann: Den Schilderungen islamischer Kultur haftet eine Authentizität an, die nicht auf gezieltem Quellenstudium zu fußen scheint — denn sonst wären die entsprechenden Passagen im Roman sicher konkreter, detailreicher und länger — sondern eher auf einer breiten allgemeinen Kenntnis der historischen Gegebenheiten, die in Verbindung mit der fiktionalen Handlung einen lebendigen Eindruck dieser Kultur vermittelt. 34 Wie ich versucht habe darzustellen, trifft Niebelschütz die historische Vorlage überwiegend gut, besonders dort, wo er ausführlicher wird, wie z.B. bei der Wasserwirtschaft, dem Lebensstil der Oberschicht, dem Djihad oder der Rolle der Frau im Islam. Nur selten hatte ich den Eindruck, daß der Autor Irrtümern aufsitzt, blind Klischees folgt (wo er dieses tut, geschiet es offenbar sehr bewußt) oder ohne Grundlage fabuliert (hier denke man an die Regelung der Tronnachfolge des jeweils jüngsten Sohnes). Um es mit Etiketten zu versehen und zu quantifizieren: In der Darstellung islamisch-maurischer Kultur scheint das meiste „historisch korrekt“, vieles „plausibel“ und nur weniges „falsch“ zu sein. Zu diesem Bild paßt auch die Aussage von Ilse von Niebelschütz, die mir, nachdem ich sie um Hinweise in einigen Detailfragen bat, schrieb, daß ich ganz sicher sein könne, „daß sich WvN bei seinen Arbeiten niemals von ‘Klischeevorstellungen’ leiten ließ. Von Jugend auf galt sein Interesse der Geschichte, Kunstgeschichte, Religionswissenschaft etc., pragmatischer Geschichtsschreibung also, zu der später auch noch Wirtschaftsgeschichte hinzukam. Er war nicht nur unglaublich belesen, sondern konnte sich auch in die Kulturen (und Menschen in besonderen Situationen) aller Zeiten so intensiv hineindenken, als hätte er in ihnen gelebt.“32 32 Sie verwies mich in Hinblick auf Detailfragen an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach (Postfach 1162, 71666 Marbach a. N.), in dem sich der Nachlaß von Niebelschütz befindet, darunter die Bände mit den Vorarbeiten zu den Kindern der Finsternis. Da der entsprechende Zeitaufwand aber dem Gewicht meiner Fragen nicht angemessen gewesen wäre, habe ich auf die Nutzung dieser Informationsquelle verzichtet. 35 5. Benutzte Literatur 5.1. Primärliteratur Niebelschütz, Wolf von. Die Kinder der Finsternis. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1995. 5.2. Sekundärliteratur Antes, Peter u.a.. Der Islam: Religion - Ethik - Politik. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1991. Brett, Michael u. Forman, Werner. Die Mauren: Islamische Kultur in Nordafrika und Spanien. Luzern u. Herrsching: Atlantis Verlag, 1986. Ess, J. van u. Halm, H. (Hrsg.). Das Vermächtnis des Islams, 2 Bde.. Zürich u. München: Artemis Verlag, 1980. Grabar, Oleg. Die Alhambra. Köln: Du Mont Buchverlag, 1981. Grunebaum, Gustav E. von. Der Islam im Mittelalter. Zürich: Artemis Verlag, 1963. Grunebaum, Gustav E. von. Studien zum Kulturbild und Selbstverständnis des Islams. Zürich: Artemis Verlag, 1969. Khoury, Adel Tjeodor / Hagemann, Ludwig / Heine, Peter. Islam-Lexikon, 3 Bde.. Freiburg i. Br.: Herder Verlag, 1991. Khoury, Raif Georges. Der Islam: Religion, Kultur, Geschichte. Mannheim: B.I.-Taschenbuchverlag, 1993. Kurzrock, Ruprecht (Hrsg.). Die islamische Welt II. Berlin: Colloquium Verlag, 1984. Lutherisches Kirchenamt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche u. Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.). Was jeder vom Islam wissen muß. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn, 1991. Schulze, Helmut (Hrsg.). Alexander Weltatlas. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1976. Serauki, Eberhard. Geschichte des Islam. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1991.