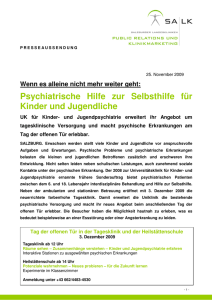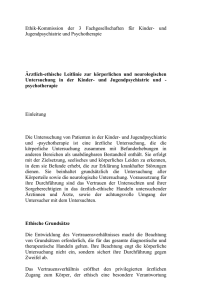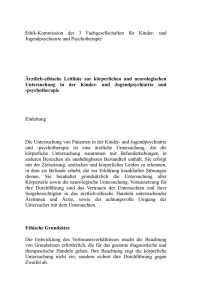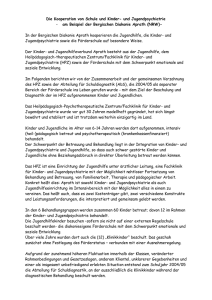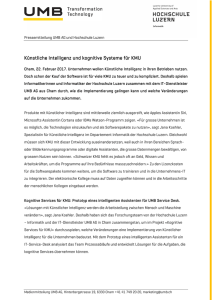4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Ju
Werbung

Alexander Trost 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie Vorbemerkung und Gliederung Entwicklungsverzögerungen und psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen haben in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen. Unter dem Stichwort „Neue Morbidität“ wird von den Fachgesellschaften seit vielen Jahren eine Verschiebung von den somatischen zu den seelischen Störungen konstatiert. Die Häufigkeit von Störungsbildern mit behandlungsbedürftigem Krankheitswert wird je nach Studie mit 15 – 22 % aller Kinder und Jugendlichen bis ins junge Erwachsenenalter angegeben. Sozio-ökonomische, psychische und somatische Bedingungsfaktoren lassen diese Zahl in besonders benachteiligten gesellschaftlichen Subgruppen bis zu 40 % ansteigen. Die Arbeit mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen sowie ihren sozialen Systemen folgte immer schon einem interdisziplinären Ansatz, unter besonderer Beteiligung von Fachkräften der Sozialen Arbeit und der Pädagogik. Führende Forscher gehen zudem davon aus, dass die allermeisten psychischen Störungen ihren Anfang im Kindesalter haben. Sie müssen daher primär auf dem Hintergrund der psychischen, sozialen und somatischen Entwicklung von der Schwanger­­schaft bis zum Erwachsenenwerden gesehen werden. Im Rahmen eines Lehrbuchs der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie kommt der Darstellung der Entwicklungsstörungen und der psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter daher eine wichtige Rolle zu. Die Ziele dieses Kapitels sind: • eine allgemeine Einführung in die Geschichte, derzeitige Situation des Fachgebiets und seine Bedeutung für die Soziale Arbeit zu geben. • Als nächstes wird die KJP als Entwicklungspsychopathologie dargestellt. • Es folgen Fragen zur Klassifikation psychischer Störungen im Kindesund Jugendalter. • Nach einem Überblick über die wichtigsten kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnosen werden exemplarisch 71 B 8205 Umb 001-584.indd 71 14.09.2012 14:37:04 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie • die Sprachentwicklungsstörung als Beispiel für eine Umschriebene Entwicklungsstörung • die Autismus-Spektrum-Störungen, sowie • das ADHS, eine besonders häufig diagnostizierte psychiatrische und zugleich Entwicklungs­störung, dargestellt. • Es folgt ein allgemeines Kapitel zu Symptomen, Diagnostik und Therapie • Zum Schluss wird ein Überblick über die Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit in der Behandlung psychisch auffälliger Kinder und Jugendlicher erstellt. 4.1 Einführung Lange vor der ersten Nennung des Begriffs der Kinderpsychiatrie durch den Franzosen N. Manheimer („psychiatrie infantile“) 1899 haben Philosophen, Theologen und Pädagogen sich mit geisteskranken, sinnesbehinderten und verhaltensauffälligen Kindern befasst. Schon bei John Locke (1693 und Jean-Jacques Rousseau (1762) wurde der Begriff der heilenden Pädagogik verwandt. Im deutschsprachigen Raum wurde der Name Heilpädagogik erst 1861 durch Georgens und Deinhardt geprägt, die erstmals eine systematische und wissenschaftliche Theorie der Heilpädagogik als Zwischengebiet von Medizin und Pädagogik entwickelten. 1864 gründete H. Hoffmann an der Frankfurter Städtischen Anstalt für Irre und Epileptische die erste Kinderabteilung. Sein als Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn selbst gestaltetes Bilderbuch „Der Struwwelpeter“ ist das meistverkaufte und in unzählige Sprachen übersetzte Kinderbuch aller Zeiten. Er beschreibt und illustriert darin auf anschauliche Weise und im moralisierend-repressiven Stil seiner Zeit einige kinderpsychiatrische Störungen, die auch heute noch bedeutsam sind: das Hyperkinetische Syndrom (Zappelphilipp), die Magersucht (Suppenkasper), Dissozialität und Verwahrlosung (Struwwelpeter, Bitterböser Friedrich und Paulinchen). Ein erstes Lehrbuch der „psychischen Störungen im Kindesalter“ schrieb 1887 der Freiburger Psychiater Emminghaus. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) als medizinische Disziplin hatte zwei Wurzeln: Die Erwachsenenpsychiatrie, und die Kinderheilkunde. Hinzu kamen wichtige Impulse aus der Psychologie, der Psychoanalyse, der Pädagogik, aus den Sozialwissenschaften, aus dem Recht sowie der Jugend- und Sozialhilfe. Es war und ist ein langer und noch andauernder Prozess, diese verschiedenen Einflüsse zusammenzuführen. Leo 72 B 8205 Umb 001-584.indd 72 14.09.2012 14:37:04 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie Kanner, einer der berühmten Kinder- und Jugendpsychiater der früheren Zeit sagte, dass in der ersten Phase des Fachgebietes über das Kind nachgedacht wurde. In der zweiten Phase hat man an Kindern gearbeitet. In der dritten Phase arbeitete man für Kinder; in der vierten arbeitete man mit dem Kind. Heute kann man am ehesten sagen, dass man mit dem Kind, mit seiner Familie und dem sozialen Kontext arbeitet. Damit ist der interaktionelle Aspekt der Diagnostik und Behandlung in den Vordergrund gerückt. Das beinhaltet einen zunehmenden Emanzipationsprozess für das Kind, aber auch für die Fachdisziplin. Es besteht mittlerweile Übereinstimmung darüber, dass psychische Störungen bei Kindern multifaktoriell bedingt sind. Das bedeutet auch für die Therapie ein multidirektionales Vorgehen. Dabei wurden im Laufe der Zeit die therapeutischen Aktivitäten immer mehr vom Individuum zur Familie und zum sozialen Umfeld hin verlagert. Dies schließt insbesondere sozialpsychiatrische Aspekte und Methoden ein, die in den letzten zehn Jahren in der Therapie, wie auch in Prävention und Rehabilitation immer größere Bedeutung erlangt haben. Zunehmend fließen auch die Forschungsergebnisse aus der Neurobiologie und der Bindungsforschung in den Alltag der KJP ein. Wie später zu zeigen sein wird, revolutionieren die Erkenntnisse • zum Zusammenhang zwischen sozio-emotio­nalen Umgebungsbedingungen und Hirnentwicklung, • zur Bedeutung akuter und anhaltender Traumatisierung und • zur Bedeutung von Bindungssicherheit für die spätere Entwicklung psychischer Störungen die Theorie und Praxis der KJP in noch nicht abzuschätzendem Ausmaß. 1940 wurde in Wien die „Deutsche Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und Heilpädagogik gegründet, ein Vorläufer der heutigen Fachgesellschaften. Als eigenständige Fachdisziplin existiert die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland erst seit 1968. Nach den Richtlinien der Bundesärztekammer (1988) umfasst sie die „Erkennung, nichtoperative Behandlung, Prävention und Rehabilitation bei psychischen, psychosomatischen, entwicklungsbedingten und neurologischen Erkrankungen und Störungen sowie der psychischen und sozialen Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen sowie Heranwachsenden und jungen Volljährigen mit Entwicklungs­verzögerung, denen eine psychische Erkrankung oder eine Fehlentwicklung der Per73 B 8205 Umb 001-584.indd 73 14.09.2012 14:37:04 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie son zugrunde liegt, einschließlich der Psychotherapie als Einzel- Gruppen und Familientherapie.“ Anders als bei den anderen medizinischen Spezialisierungen ist die Versorgung mit kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen, vor allem mit ambulanten Angeboten, noch nicht flächendeckend gewährleistet. Als bis vor kurzem einzige Fachgruppe unter den Ärzten haben die Kinder- und Jugendpsychiater die Möglichkeit zu einer sozialpsychiatrisch geführten Praxis. Dies bedeutet, dass sie u.a. SozialarbeiterInnen, Heilund SozialpädagogInnen einstellen können und dafür von der gesetzlichen Krankenkasse honoriert werden. Damit wird die KJP zu einem gefragten Arbeitsfeld für die genannten Berufsgruppen. Außerdem wird dadurch der überragenden Bedeutung psychosozialer Bedingungen für die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung psychischer Gesundheit Rechnung getragen. Die kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaften, insbesondere die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJPP) und der Berufsverband (BKJPP) verfolgen neben den rein fachlichen auch sozial- und gesundheitspolitische Ziele, insbesondere im Hinblick auf eine entwicklungsfördernde Lebensumwelt für Kinder, Jugendliche und Familien und eine effektive Prävention psychischer Störungen. Dies ist umso notwendiger, als nach allgemeiner Erkenntnis die Zahl der psychisch belasteten Kinder und Jugendlichen stetig zunimmt. „Der Stress der Erwachsenen ist bei den Kindern angekommen“ Psychosomatische Beschwerden wie Kopf- und Bauchschmerzen, Nervosität und Unkonzentriertheit sind die Folgen. Depressionen, Ängste und Störungen des Sozialverhaltens belasten Kinder, ihre Eltern und Erzieher erheblich. Schon im Kindergarten zeigen 20% aller Kinder, meist Jungen, Verhaltensauf­fälligkeiten wie Aggressivität, Hyperaktivität oder Aufmerksamkeitsschwäche. Dazu finden sich bei über 25% der Vorschulkinder Entwicklungsstörungen im Sinne motorischer Entwicklungs­rückstände, Sprachentwicklungsstörungen oder Wahrnehmungs­v erarbeit­u ngs­ störungen. 4.2 Kinderpsychiatrie als Entwicklungspsychopathologie Deutlicher noch als bei psychiatrischen Störungen im Erwachsenenalter ist die Entstehung von seelischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen mit dem aktuellen Entwicklungsstand im zeitlichen Verlauf seiner 74 B 8205 Umb 001-584.indd 74 14.09.2012 14:37:04 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie Individuation vom Säugling zum Heranwachsenden verknüpft. Aus diesem Grund spricht man heute von „Entwicklungspsychiatrie“ (HerpertzDahlmann et al.2008), um die untrennbare Verbindung zwischen Entwicklungs- und Störungsaspekt hervorzuheben. Menschliche Entwicklung ist ein mehrdimensionales Geschehen auf den Ebenen der biologischen, psychologischen und sozialen Abläufe. Psychische Störungen zeigen sich immer auf allen genannten Ebenen, wenn auch mit jeweils unterschiedlicher Akzentuierung. Entwicklung ist ein zirkuläres Wechselspiel zwischen Individuum und Umwelt, das nicht-linearen Kausalitäten folgt. Heute spricht man von transaktionellen oder systemischen Erklärungsmodellen. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Rückwirkung des Säuglings auf seine Mutter. Es ist bekannt, dass der Säugling, der in seiner Entwicklung die Erwartungen seiner Mutter erfüllt, verstärkt ein positives Erziehungsbemühen und die Zu­wend­ung der Mutter erfährt. Reagiert das Kind nicht hinreichend, z. B. wegen einer muskulären Hypotonie oder einer Hörschwäche, kommt es zunächst nochmals zu einer Intensivierung der Erziehungs- und Zuwendungs­anstreng­ungen, dann gibt die Mutter häufig auf, und vermindert ihre Bemühungen. Damit wirken das Kind wie die Mutter steuernd auf die eigene Entwicklung, in diesem Beispiel allerdings auf eher ungünstige Weise. Das NichtReagieren eines Kindes wird aber von Eltern meist als Kränkung und Zurückweisung verarbeitet, ebenso wie Kinder ein Erleben von fehlender Selbstwirksamkeit häufig depressiv verarbeiten. An einem solchen Punkt setzt dann häufig ein Problembewusstsein ein, das im günstigen Fall zu professioneller Hilfe bei der Gestaltung der MutterVater-Kind-Beziehung führt. Die Ergebnisse der neueren Säuglingsforschung (z. B. Stern 2000, 2007) zeigen u.a., dass bereits das Ungeborene – durch seine Bewegungs­­aktivität – die Beziehung zur Mutter aktiv mitgestaltet. Damit gilt die früher oft vertretene Annahme, dass das hilflose Säuglingskind wie ein leeres Blatt auf die Eltern trifft, die es dann „verderben“ oder zu einem „tollen Kind“ machen, nicht mehr uneingeschränkt. 4.2.1 Pathogene und protektive Faktoren der Entwicklung Eine Schädigung, z. B. im Sinne einer seelischen oder körperlichen Traumatisierung oder einer längerfristigen Entwicklungsbehinderung hat somit nicht bei jedem Individuum in jeder Familie und zu jedem Zeitpunkt 75 B 8205 Umb 001-584.indd 75 14.09.2012 14:37:04 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie die gleiche Symptomatik zur Folge. Diese triviale Aussage hat erhebliche Folgen für die Betrachtung von Problemen: Ein massives Trauma, wie z. B. der sexuelle Missbrauch, kann sehr unterschiedliche Auswirkungen auf das betroffene Kind haben, abhängig von dem komplexen Zusammenspiel unterschiedlicher (personaler, zeitlicher und Entwicklungs-) Faktoren, die auf eine oft nicht vorhersehbare Weise den weiteren Verlauf bestimmen. Allgemein können vier Dimensionen unterschieden werden. Dabei ereignet sich jede Störung jeweils in allen Dimensionen, mit unterschiedlicher Gewichtung: 1. biologische Faktoren: Geschlecht, genetische Ausstattung, konstitutionelle Faktoren, somatische Vorerkrankungen, Unfälle, Behinderungen, Ernährung 2. psychosoziale Faktoren: individuelle psychosoziale Entwicklung, familiäre, schulische und Peergruppen- Sozialisation 3. soziokulturelle Faktoren: sozioökonomische Bedingungen, epochale, historische und politische Bedingungen wie Migration, Krieg etc., kulturelle Bedingungen wie Medieneinflüsse, religiöse Prägungen etc. 4. aktuelle Lebensumstände: situative Faktoren und Belastungen wie Trennung, Scheidung, Schulwechsel, akute Krisen Tab. 1: Ätiologische Dimensionen psychischer Störung Es leuchtet unmittelbar ein, dass z. B. eine Entwicklungsverzögerung aufgrund von Geburtskomplikationen einen jeweils anderen Verlauf nimmt, abhängig von • Dimension1: den funktionellen Förderungsmöglichkeiten wie Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie • Dimension 2: der Ausgestaltung der Bindungsbeziehungen, und der psychischen Sicherheit • Dimension 3: der Zugehörigkeit zu einer sozialen und kulturellen Gruppe • Dimension 4: den situativen Belastungen bzw. Ressourcen 76 B 8205 Umb 001-584.indd 76 14.09.2012 14:37:04 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie Der Ausgang einer solchen Problemlage hängt nur zum kleineren Teil von der primären Ursache, sondern vielmehr vom Zusammenwirken der Bedingungsfaktoren im Gesamtverlauf ab. So kann bei günstiger Konstellation die Entwicklungs­verzögerung vollständig behoben werden, im ungünstigsten Fall jedoch in eine chronifizierte somatische, emotionale, kognitive oder soziale Behinderung führen, mit dem Ergebnis reduzierter Teilhabe und Selbstverwirklichung in vielen Lebensbereichen. In allen Dimensionen werden protektive (=schützende) oder Ressource-Faktoren und Risiko- (=Vulnerabilitäts-)faktoren wirksam (s. Abb.1). Mittlerweile gibt es einen recht guten Kennt­niss­tand zu den Risikofaktoren: • Jungen haben bis zur Pubertät ein 2-5-fach erhöhtes Risiko für Entwicklungs­störungen, Teilleistungsschwächen, Hyperkinetische Störungen und für aggressive Verhaltensauffälligkeiten. Sie gelten als insgesamt verletzlicher durch äußere und innere Belastungen, besonders im Zentralnerven­system. Ihr Entwicklungstempo und die Stabilität der Reifung sind langsamer als bei Mädchen. • Gleichzeitig konsumieren Jungen noch mehr als Mädchen Medien, die Gewalt als alleinige Konfliktlösung propagieren, muten sich mehr ihre Hirnentwicklung gefährdende Inhalte zu, und blockieren damit tendenziell schulischen Lernerfolg (z. B. Spitzer 2003). • Kinder mit zerebralen Schädigungen haben je nach Ausprägung und Lokalisation ein bis zu 10 x höheres Risiko für psychische Störungen als gesunde. • Familiäre Belastungen bei gesunden Kindern erhöhen dieses Risiko um nahezu den gleichen Faktor. Dazu zählen u.a.: psychische Erkrankung oder Delinquenz eines Elternteiles, dauerhafte Streitatmosphäre, Elternverlust durch Scheidung, körperliche und psy­­­­­­­­­­­­chi­sche Vernachlässigung und Misshandlung. • Eine problematische sozioökonomische Situation allein vergrößert die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Störung bei einem Kind um den Faktor 2 – 3. 77 B 8205 Umb 001-584.indd 77 14.09.2012 14:37:05 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie Risikofaktoren: - Individuelle - familiäre - Soziale - Umwelt Protektive Faktoren: - Individuelle - Soziale Ressourcen Angeborene und erworbene Vulnerabiltät / Protektion Allgemeines Coping Stressoren, Entwicklungsaufgaben Traumatisierung Manifestation psychischer Störung Störungsspezifisches Coping; Therapie, Erziehung, Begleitung Störungsspezifische Belastungsfaktoren Systemische Stressreaktionen W e ite r e r V e r la u f: - Bewältigung /Kompensation, Weiterentwicklung - Aufrechterhaltung, Verstärkung, Chronifizierung der Störung Abb. 1: Prozessmodell psychiatrischer Störungsverläufe • Eine große angelegte US-amerikanische Studie, die Adverse Childhood Experiences Study (ACE, Felitti et al., 2002, 2005) untersuchte mehr als 17 000 Mitglieder einer Krankenversicherung bezüglich negativer Kindheitserfahrungen und ihrer Auswirkungen im späteren Leben. Das überraschende Ergebnis war eine gesicherte Dosis-Wirkungsrelation von belastenden Lebenserfahrungen durch Vernachlässigung, Misshandlung, länger andauernden sexuellen Missbrauch, aber auch durch psychisch kranke oder inhaftierte Elternteile mit allen sozialmedizinisch bedeutsamen körperlich und psychischen Erkrankungen in späteren Lebensaltern. Je früher, mehr und intensiver Belastungsfaktoren auf die jungen Menschen einwirkten, umso wahrscheinlicher war eine soziale, emotionale oder kognitive Beeinträchtigung bis hin zu psychosozialer Behinderung, chronisch körperlicher 78 B 8205 Umb 001-584.indd 78 14.09.2012 14:37:05 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie Erkrankung und einem früheren Tod. Diese weltweit anerkannte und in ihren Konsequenzen noch nicht ansatzweise umgesetzte Studie weist eindrücklich auf die ausschlaggebende Bedeutung der frühen Kindheit für körperliche und seelische Gesundheit im gesamten Lebensverlauf hin. Vergleichsweise jung ist die Erforschung protektiver Faktoren. Im Sinne der Salutogenese (Antonovsky) scheint es bedeutsam, mehr darüber herauszufinden, wieso ca. 25% der Kinder und Jugendlichen gegen ungünstige Entwicklungsbedingungen nahezu immun zu sein scheinen. Hier eine auszugsweise Auflistung bislang bekannter Aspekte: Individuelle protektive Faktoren, die den Kindern erleichtern, „es zu schaffen“, trotz widriger äußerer Umstände: • Kinder, die ein heiteres, fröhliches Grundtemperament mitbringen, haben auch unter schwierigen Umweltbedingungen bessere Entwicklungs­chancen • Kinder mit besonders guten Aufmerksamkeits- und Reaktionsfähigkeiten. • Kinder die weniger leicht zu irritieren sind und bei ihren einmal gesteckten Zielen bleiben. Diese Kinder können unangenehme Situationen relativ gut aushalten und ihr Kern-Selbst vor Verletzungen schützen. • Kinder, die bereits eine Beziehung erlebt haben, die getragen hat; wenn mindestens ein Jahr lang eine gute Mutter-Kind- Beziehung bestanden hat. (selbst, wenn das Kind später von der Mutter misshandelt wird!) • Kinder, die es auch in schlechteren Verhältnissen schaffen, gut durchzukommen, fallen in Heimen oft dadurch auf, dass sie sich stärker für andere in der Gemeinschaft engagieren, und es gleichzeitig fertigbringen, sich eine Privatsphäre zu schaffen. Äußere protektive Faktoren: • Eine stabile und gute familiäre Atmosphäre, mit emotionaler Verbundenheit, Förderung von Autonomie der Familienmitglieder, eindeutiger Kommunikation, konsequenter Erziehungshaltung und klarer Aufgabenverteilung liefert beste Entwicklungs­bedingungen, auch bei ansonsten belastenden Risikofaktoren. 79 B 8205 Umb 001-584.indd 79 14.09.2012 14:37:05 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie • Früherkennung von medizinisch-neurologischen Risikofaktoren trägt zur Verhinderung bzw. Begrenzung von körperlichen Behinderungen (Sekundäre Schäden) bei. Tertiäre Folgen wie Neurotisierung und negative psychosoziale Interaktionen können eher begrenzt bzw. verhütet werden. • Ein „wissender Zeuge“ (Alice Miller): ein Mensch, der nicht direkt in die problematischen Umstände verwickelt ist, dem das Kind aber als Vertrautem etwas davon erzählen kann (entfernt wohnender Großvater, Lehrer, ältere Geschwister etc.), der dem Kind das Gefühl vermittelt: Hier ist jemand, der zu mir steht, mir ein Stück Wert gibt und der mir eine Reflektion über das Erlebte ermöglicht. • Größere soziale Netze bieten mehr Sicherheit vor psychischer Erkrankung. Eine isoliert lebende Zwei- oder Dreikopffamilie birgt ein höheres Risiko als eine stärker sozial vernetzte größere Familie. Wenn mehrere Erwachsene als Bezugspersonen zur Verfügung stehen, kann das Kind zwischen ihren Verhaltensweisen differen­zieren lernen. Es ist nicht nur einer Sichtweise ausgeliefert, und es kann sich bei Schwierigkeiten mit dem einen auf den anderen stützen. Das Zusammenspiel von Risiko- und Protektionsfaktoren, von Krankheits- und Bewältigungsvariablen (Coping) entscheidet wesentlich über Entstehung und Verlauf einer psychischen Störung. Neuere Erkenntnisse zeigen, dass biologische Risiken sich primär in Beeinträchtigungen von motorischen Entwicklungen bemerkbar machen, während der Einfluss psychosozialer Risiken sich stärker in der kognitiven und sozioemotionalen Entwicklung niederschlägt. Dabei ändert sich auch die relative Bedeutung der Risikofaktoren im Verlauf der Entwicklung: während biologische Risiken mit zunehmendem Alter an Bedeutung verlieren, wächst im Gegenzug der Einfluss von psychosozialen Risiken. 4.2.2 Gehirnentwicklung und Psyche Die durch die Weiterentwicklung der modernen bildgebenden Verfahren heute mögliche Erforschung neurobiologischer Zusammenhänge mit psychischen Prozessen kommt zu noch weitergehenden Schlussfolgerungen: Hirnforscher wie Spitzer (2000), Hüther (2001) oder Roth (2004) betonen heute immer stärker die psychischen Voraussetzungen für eine adäquate somatische Entwicklung des Gehirns. Ausgeprägter als bei anderen Pri80 B 8205 Umb 001-584.indd 80 14.09.2012 14:37:05 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie maten ist das menschliche Gehirn angewiesen auf intensive, angemessene und konstante Beziehungen, um ausreifen zu können. Hüther weist nach, dass „Liebe ein Naturgesetz ist und das Gehirn ein Sozialorgan“. Das menschliche Gehirn ist vom Aufbau her optimiert für „psychosoziale Kompetenz“. Dabei ist die strukturelle Ausformung, die Vernetzung einzelner Hirnareale zu funktionellen Einheiten zu einem großen Teil nutzungsabhängig, und nur in Grundzügen genetisch bestimmt. Um die für funktionelle Netzwerke erforderlichen, hochkomplexen Verschaltungen ausbilden zu können, müssen Kinder möglichst viele und möglichst unterschiedliche eigene Erfahrungen machen. Dazu brauchen sie vielfältige stimulierende (ihre emotionalen Zentren aktivierende) Angebote und Herausforderungen und – um diese annehmen und erfolgreich bewältigen zu können – Sicherheit- und Orientierung-bietende Bindungsbeziehungen. Nur unter dem einfühlsamen Schutz und der kompetenten Anleitung durch erwachsene „Vorbilder“ können Kinder vielfältige Gestaltungsangebote auch kreativ nutzen und dabei ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten erkennen und weiterentwickeln. Nur so kann im Frontalhirn ein eigenes, inneres Bild von Selbstwirksamkeit stabilisiert und für die Selbstmotivation in allen nachfolgenden Lernprozessen genutzt werden. Emotionale Prozesse stellen eine wesentliche Komponente für die Fokussierung von Aufmerksamkeit, Verarbeitungstiefe von Ereignissen, für Lernen und für Motivation dar. Jegliches Lernen – auch von Sprache, motorischen Fertigkeiten und sozialer Kompetenz – ist damit immer eingebettet in emotionale Bewertung. Vertrauensvolle emotionale Bindungen sind für Kinder die wichtigste Ressource zur Bewältigung von Unsicherheit, Angst und Stress. Die Ausformung und Stabilisierung sicherer Bindungsmuster hängt davon ab, ob ein Kind die wiederholte Erfahrung machen kann, dass es in der Lage ist, neue Anforderungen, die zu einer Störung seines emotionalen Gleichgewichtes führen, mit der Unterstützung einer primären Bezugsperson bewältigen zu können. Die im kindlichen Gehirn angelegten neuronalen und synaptischen Verschaltungs­muster sind weitaus (ver-)formbarer als bisher angenommen. Die am stärksten durch die jeweiligen Nutzungsbedingungen strukturierte Hirnregion ist der frontale Kortex. Die in dieser Region während der Kindheit herausgebildeten Verschaltungen sind für die Steuerung der wichtigsten späteren Leistungen des menschlichen Gehirns zuständig: 81 B 8205 Umb 001-584.indd 81 14.09.2012 14:37:05 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie • • • • • Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugungen Motivation Impulskontrolle Handlungsplanung soziale und emotionale Kompetenz. Emotionale Verunsicherung führt zur Aktivierung unbewusst reagierender limbischer und anderer stress-sensitiver neuro-endokriner Regelkreise und zwingt das Kind, nach Strategien zur Wiederherstellung seines inneren Gleichgewichtes zu suchen. Solche stressinduzierte, in der Regel unbalancierte Bahnungsprozesse führen zwangsläufig zu defizitären Entwicklungen in anderen Bereichen: Wahrnehmung, Motorik, Lernverhalten, Motivierbarkeit, Sozialverhalten. Wenn während der frühkindlichen Entwicklung Erfahrungen aus der Umwelt vorenthalten werden, beispielsweise durch mangelhafte Angebote an Sinnesreizen, aber auch im Bindungsaufbau, können Hirnfunktionen irreversible Schäden erleiden. Fazit: Erfährt das kindliche Gehirn nicht genügend auf seine Struktur hin angepasste Zuwendung, wird es – bedingt kompensierbar – unter seinen Möglichkeiten für kognitive und psychosoziale Kompetenz, Liebes- und Lernfähigkeit bleiben. Bei Kindern, die aufgrund wiederholter emotionaler Traumatisierungen oder chronischer Vernachlässigung keine geeignete Strategie zur Wieder­ herstellung ihres emotionalen Gleichgewichtes finden, kommt es zu einer lang anhaltenden, unkontrollierbaren Aktivierung ihres neuroendokrinen Stress-Systems mit nachhaltigen destabilisierenden Auswirkungen auf • psychischer (z. B. Angststörungen oder Persönlichkeitsstörungen) und/oder • körperlicher Ebene (adaptive Veränderungen endokriner und vegetativer Regelkreise, Umbau neuronaler Netzwerke). Chronischer Stress, messbar am Serum-Cortisolspiegel, zerstört neuronale Strukturen des limbischen Systems, u.a.: • im Hippocampus (Zentrum für Gedächtnis), • in der Amygdala (Mandelkern, Zentrum für Emotionen, v.a. Angst) und • bremst die Hemisphärenvernetzung im Corpus callosum (der „Balken“, die Faserstränge zwischen den Hirnhemisphären) Damit werden organisch begründ­bare Regulationsstörungen verursacht, die später in komplexe Störungen von Lernen, Emotionen und Verhalten münden können. Man geht davon aus, dass diese Störungen abhängig 82 B 8205 Umb 001-584.indd 82 14.09.2012 14:37:05 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie von der Art und Dauer der schädigenden Einwirkungen reversibel sind, wenn das Beziehungs- und Erziehungsmilieu entsprechend verbessert wird. Studien zu stark deprivierten rumänischen Waisenkindern (Rutter 2006) haben gezeigt, dass nur bei drastischer Milieuverbesserung vor dem 18. Lebensmonat gute Aufholeffekte im Kognitiven, Motivationalen und Sozialen zu erzielen sind. Andererseits wird aus dem Beschriebenen nochmals deutlich, dass ernste psychische Störungen auf der Grundlage andauernder früher Stressbelastungen entstehen. Zusammengefasst: Die ersten Lebensjahre sind entscheidend für den ungestörten Aufbau eines gesunden Gehirns, entscheidende Voraussetzung für Selbstbewusstsein, angemessene Selbstregulation und kompetentes Verhalten auf allen Ebenen. 4.2.3 Psychische Störung und Krise Es ist ein Grundmerkmal menschlicher Entwicklung, dass sie sowohl kontinuierlich, als auch sprunghaft verläuft. Dazu gehört das Durchleben von Krisen ebenso wie Perioden scheinbarer Ruhe. Ein Sprichwort sagt: „Das einzig Beständige ist der Wandel“. Der größte Teil der „normalen“ Krisen wird vom Individuum eigenständig bewältigt: In der Pubertät beispielsweise findet ein gravierender Umbruch auf allen Ebenen statt: Zum körperlichen Gestaltwandel kommt mit der aufkeimenden Sexualität ein verändertes psychisches Erleben und eine notwendige Neudefinierung der sozialen Rolle, kurz: die persönliche Identität muss neu gefunden werden. Der größte Teil der Jugendlichen schafft das recht gut, trotz schwieriger werdender gesellschaftlicher Bedingungen. Ein kleinerer Teil bedarf stützender Hilfe seitens der sozialen Primärgruppen wie Familien, Schule, Peers. Erst bei erheblichen Einschränkungen des Erlebens von Autonomie und Selbstwert mit entsprechender Symptombildung wird professionelle Hilfe erforderlich. Dabei werden in der Regel zunächst sozialpädagogische oder psychologische Beratungsangebote in Anspruch genommen. Wird die Krise überdeutlich, wie z. B. bei der Pubertätsmagersucht, einer Adoleszentenpsychose oder einem akuten Suizidversuch, ist medizinisch-jugend­psychiatrische Hilfe unabweisbar notwendig geworden. Der Ausgang der Krise ist nicht allein von der Intervention abhängig: Wie bei allen menschlichen Systemen finden sich in einem nichtlinearen „chaotischen“ Zusammenspiel aller Elemente (Personen, Institutionen, Risiko- und Schutzfaktoren, Zeit und Ort) neben vorhersehbaren Ergebnissen auch oft überraschende Lösungen. 83 B 8205 Umb 001-584.indd 83 14.09.2012 14:37:06 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie Meine eigene Arbeit hat sich in den vergangenen Jahren dahingehend gewandelt, vielen Menschen, die mit ihren Kindern in meine Praxis kommen, zu verdeutlichen, dass keine (langfristige) Therapie notwendig ist. Das stärkt die oft verschüttete Überzeugung der Klienten, dass auch „etwas Gutes“ an ihnen, ihrem Beziehungsverhalten und ihren Erziehungsbemühungen ist. Schließlich kommen viele Eltern mit sehr schlechten Gefühlen über sich und ihr Kind, mit Schuldgefühlen und Verunsicherung, weil sie keine Modelle haben, wie sie gut mit ihren Kindern umgehen können. Der Anteil pädagogischer und sozialarbeiterischer Interventionen in der kinderpsychiatrischen Praxis ist gegenüber den medizinisch-therapeutischen mit der Zunahme erzieherischer Hilflosigkeit bei den Bezugspersonen erheblich größer geworden. Es geht also nicht darum, dass wir jedes Problem bis ins Letzte lösen, das entspricht nicht dem Leben. Es geht darum, dass blockierte Entwicklung – da wo der Lebensfluss ins Stocken gekommen ist, wo eine Stromschnelle am Weiterschwimmen hindert – wieder „in Fluss kommt“. Das kann sich auf das Individuum Kind mit all seinen körperlichen, seelischen und geistigen Aspekten als auch auf seine Familie oder sein weiteres Umfeld beziehen. Wenn dann längerfristige Entwicklungsstörungen bei einem Kind vorliegen sollten, ist es vielleicht notwendig, das Kind und seine Eltern ein Stück „an die Hand zu nehmen“, und zu begleiten, um einiges nachzuholen, anderes zu lassen, oder den Blick nach vorne zu lenken. Dabei steht Begleiten und Anstoßen im Vordergrund, und weniger „Verändern“ und „In-der-Tiefe-Graben“. Exkurs: Was ein Kind braucht: • G eborgenheit und Sicherheit, einen klaren Platz im Mikrokosmos • Zuwendung und Beachtung, liebevolles Interesse • Verständnis für Möglichkeiten und Grenzen des jeweiligen Entwicklungsstandes • Anerkennung für Initiative, Kontaktbereitschaft und Leistung 84 B 8205 Umb 001-584.indd 84 14.09.2012 14:37:06 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie 4.2.4 Normale und gestörte Entwicklung: Entwicklungsaufgaben und ihre Bewältigung „Entwicklungsaufgaben sind (nach Havighurst) voraussehbare und reguläre Anforderungen, die sich dem Individuum und seiner Familie zu einer bestimmten Zeit in seiner Biographie stellen und deren erfolgreiche Bewältigung für die weitere Entwicklung von großer Bedeutung ist.“ Das Modell der Entwicklungsaufgaben orientiert sich wie andere, frühere Phasenmodelle an bestimmten Entwicklungsperioden, betont aber gegenüber diesen das Moment der aktiven Auseinandersetzung und die Selbstregulation von Entwicklungsprozessen. Psychische Störungen können aus diesem Verständnis heraus als: • Inadäquate Lösungsversuche für anstehende Entwicklungsaufgaben • Ergebnis unzureichender Bewältigung früherer Entwicklungsaufgaben • Hindernis für die Bewältigung aktueller Entwicklungsaufgaben angesehen werden. In tabellarischer Form werden nun die Entwicklungsperioden mit den dazugehörigen vorherrschenden Entwicklungsaufgaben dargestellt, zusätzlich die psychosexuellen Phasen nach Freud und die psychosozialen Konfliktthemen (Erikson) der jeweiligen Periode. Die Aufstellung gibt eine Orientierung; je nach Autor werden die Perioden etwas unterschiedlich eingeteilt. Betrachten wir das Phänomen „psychische Störung“ vorrangig unter einem Entwicklungsaspekt. so zeigt jede Entwicklungsphase ihre typische Ausformung: Säuglingsalter (1. Lebensjahr): Schon die Schwangerschaft, vor allem aber die ersten Lebensmonate sind eine besonders chancenreiche, aber auch vulnerable Zeit für die Ausbildung „guter“ Interaktionszyklen zwischen dem Kind und seinen primären Bezugspersonen. Besonders in Fällen einer nicht geglückten Anfangsphase der Beziehung ist die Entstehung einer ungünstigen psychosozialen Entwicklung, von psychischer Auffälligkeit und Anfälligkeit für Suchtprobleme bei den betroffenen Kindern wahrscheinlich. Ein frühzeitiges Erkennen und Behandeln solcher Probleme kann die Ausbildung von destruktiven Zyklen in der 85 B 8205 Umb 001-584.indd 85 14.09.2012 14:37:06 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie Entwicklungsperiode Entwicklungsaufgaben Psychosexuelle Phase /Themen Säuglingsalter – Aufbau früher interpersoneller Bindung – Oral – Physiologische und sensomotorische 0 – 6 – 12 Monate Regulation – Urvertrauen vs. – Spannungs- und Erregungskontrolle Urmisstrauen – Elementare Kommunikation mit der Umwelt Kleinkindalter – Motorische Kontrolle – Anal – Stabile Bindung 12 – 24 – 36 Monate – Kognitive und sprachliche Funktionen – Autonomie vs. – Erkundungsverhalten Scham und Zweifel Kindergartenalter – Realitätsprüfung – phallisch-ödipal – Grundlagen der Autonomieentwicklung 3 – 5 Jahre und Selbstkontrolle: Ausscheidung, – Initiative vs. motorische Fähigkeiten Schuldgefühl – Sprachentwicklung – Spiel und Fantasie Vorschul- und frühes – Impulskontrolle – Latenz Schulalter – Einfache moralische Unterscheidungen – Geschlechtrollenidentifikation – Fleiß vs. Minder5 – 7 Jahre – Beziehung zu Gleichaltrigen wertigkeitsgefühl – Spiel in Gruppen Grundschulalter – Soziale Kooperation in der Gruppe – Latenz – Freundschaften 7 – 11 Jahre – Arbeitshaltung – Fleiß vs. Minder– Kulturtechniken wertigkeitsgefühl – Kompetenzerleben und Selbstbewusstsein Pubertät – Auseinandersetzung mit körperlichen – Pubertät Veränderungen 11 –15 Jahre – Auseinandersetzung mit psychischen – Identität vs. IdentiVeränderungen (Emotionalität, tätsdiffusion Sexualität) – Abstrakt-formales Denken Mittlere Adoleszenz – Gemeinschaft mit Gleichaltrigen – Genital – Heterosexuelle Beziehungen 15 – 17 Jahre – Stabilisierung der – Identität vs. IdentiGeschlechtsrollenidentität tätsdiffusion – Auseinandersetzung mit moralischen Prinzipien Späte Adoleszenz – Ablösung von den Eltern – Genital – Stabilisierung eines internalisierten – Intimität und 17 – 21 - 25 Jahre moralischen Bewusstseins Distanzierung – Berufswahl versus. Selbstbezogenheit Tab. 2: Entwicklungsaufgaben 86 B 8205 Umb 001-584.indd 86 14.09.2012 14:37:06 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie Beziehungsgestaltung zwischen Mutter (Vater) und Kind verhüten, und aus beginnenden Teufelskreisen „Engelskreise“ (Papoušek 2004) werden lassen. Neuere Forschungsergebnisse (Laucht, Esser & Schmidt 1997) zeigen auf, dass gerade in belasteten Familien wesentliche Grundlagen für Resilienz und Ressourcen in den Anfängen der Eltern-KindKommunikation zu finden sind. Im frühesten Lebensalter reagieren Kinder noch überwiegend motorisch und vegetativ auf Irritationen. Der obere Magen-Darmtrakt (Gewöhnung an orale Ernährung) und die Haut (Kontaktaufnahme zur Umwelt) stehen als Austragungsort im Vordergrund. Die Probleme zeigen sich als frühkindliche Regulationsstörung der postnatalen Anpassungs- und Reifungsprozesse: • im Schlaf-Wach-Rhythmus • bei der Nahrungsaufnahme und Verdauung: Fütter- und Gedeihstörungen SÄUGLING Gute selbstregulatorische Fähigkeiten Zufriedene Dyade Entwicklungsförderung Positive Gegenseitigkeit Vorsprachliche Kommunikation MUTTER „Hinreichend gute Mutter“ (Winnicott) Mutter-Kind-Beziehung Schwieriger Säugling Negative Gegenseitigkeit Vernachlässigung Misshandlung ● ● ● Schwieriges Temperament Regulationsprobleme: - Nahrungsaufnahme - Schlaf-Wachrhythmus - Aufmerksamkeit - Schreien somatische, neurologische und seelische Störungen ● ● ● ● ● ● ● Psychosozial hochbelastete Mutter Sozio-ökonomische Faktoren Körperliche / psychische Störungen Chronische Partnerkonflikte Beziehungskonflikte zum Kind, Rollenumkehr „Gespenster im Kinderzimmer“ Unangemessene entwicklungspsychologische Vorstellungen Gewalt tolerierender oder rigider Erziehungsstil Abb. 2 87 B 8205 Umb 001-584.indd 87 14.09.2012 14:37:06 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie • bei der Spannungs- und Affektregulierung: exzessives Schreien, motorische Unruhe • in einem überwachen oder gedämpften Explorationsverhalten. Bei seinen komplexen Adaptationsprozessen ist das Baby existentiell auf äußere Hilfe angewiesen. Mary Ainsworth beschrieb elterliche Feinfühligkeit als Fähigkeit, die angeborenen, in Belastungs- und Gefährdungssituationen aktivierten Signale des Kindes (Rufen, Schreien, Anklammern, Nähesuchen etc.) wahrzunehmen und sie richtig zu interpretieren (z. B. als Suche nach Körperkontakt, Hunger etc.) und sie prompt und angemessen zu befriedigen. Dieser Austausch von Signalen und Reaktion geschieht jeden Tag unzählige Male, seine Qualität entscheidet wesentlich über die Art der Bindungsbeziehung, die sich dabei herausbildet. Das Kind, so wissen wir heute, ist jederzeit mitgestaltender Akteur und bestimmt durch sein Temperament und seine Interaktionsbereitschaft den Ausgang eines jeden Interaktionszyklus mit. Von H. und M. Papoušek stammt das erweiterte Konzept der intuitiven elterlichen Kompetenzen. Damit sind Fertigkeiten der vorsprachlichen Kommunikation gemeint, die ein Spektrum von typischen Verhaltensmustern umfassen: • Dialogabstand, Grußreaktion • Ammensprache – erhöhte Stimmlage • Verlangsamtes Tempo, prototypische Melodik • Prototypische Mimik • Imitationsneigung • Interaktive Spielchen • Gemeinsame Ausrichtung der Aufmerksamkeit • Entwicklungsphasenspezifische Anpassungen und Verhaltensmuster „Das elterliche Kommunikationsverhalten kompensiert die anfängliche Unreife und unterstützt die postnatalen Regulations- und Anpassungsprozesse des Säuglings. Es erleichtert den Übergang zu Schlaf oder zu guten Wachphasen, in denen der Säugling aufnahme- und interaktionsbereit ist, Blickkontakt einüben kann und lernt, seine Erfahrungen mit der Umwelt gut zu integrieren und ruhige Kommunikationsformen zu entwickeln.“ (M. Papoušek, 1995). Unter hinreichend entspannten und ressourcevollen Bedingungen gelingender Elternschaft kommt es in den Wochen nach der Geburt in hochkomplexen Rückkoppelungsprozessen zu einer individuellen Abstimmung zwischen Säugling und Mutter. Wäh88 B 8205 Umb 001-584.indd 88 14.09.2012 14:37:06 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie rend das Baby diese Erfahrungen im prozeduralen (nicht bewusstem, vorsprachlichen) Gedächtnis speichert und zur Grundlage seines „Arbeitsmodells“ der Bindungserfahrungen macht, bezieht die Mutter ihre eigene Bindungsrepräsentation als Niederschlag der eigenen Bindungserfahrungen unbewusst, aber wirksam strukturierend in den Kommunikationsprozess ein. Wenn dies nicht in positiver, entwicklungsförderlicher Weise möglich ist, aufgrund einer nicht zustande gekommenen oder unterbrochenen Hinwendung (Frühgeburt mit Krankenhausaufenthalten, frühe Trennungen, Misshandlung in der Schwangerschaft, …) können die genannten Symptome auftreten (vgl. Trost, 2010). Das Gleiche gilt für Mütter und Väter, die sich aufgrund eigener Sorgen oder Krisen nicht auf das Kind einstellen können: Psychische Krankheit oder Traumatisierung, Suchtproblematik, Ablehnung in der eigenen Ursprungsfamilie, ausgeprägte Beziehungsstörungen oder andere existentielle Sorgen können Gründe dafür sein. Das führt häufig dazu, dass kindliche Signale ignoriert oder verzerrt wahrgenommen werden. Selma Fraiberg nannte dies die Wirkung der „Gespenster im Kinderzimmer“, die nur schwer bewusst kontrolliert und die genuinen elterlichen Kompetenzen überlagern oder abschwächen können. Im extremen Fall frühkindlicher Deprivation kann eine anaklitische Depression mit Apathie, wimmerndem Weinen, motorischen Stereotypien und starker Selbstbezogenheit entstehen. Hilfebedürftiger „Patient“ in dieser Lebensphase ist immer die Dyade Mutter-Kind oder die Triade Mutter-Vater-Kind, nie das Kind allein. Dabei werden regulationsgestörte Säuglinge selten dem Kinderpsychiater vorgestellt, häufiger in kinderärztlichen Praxen oder den zunehmend eingerichteten „Schreiambulanzen“. MitarbeiterInnen der sozialen Dienste sollten eine Sensibilität diesen Problemen gegenüber entwickeln und im Sinne einer primärpräventiven Sozialarbeit ihren KlientInnen lösungsund ressourcenorientierte Hilfen anbieten. Dabei führt eine Kombination von körperlicher und psychischer Entlastung, praktischer Anleitung und Familienberatung nahezu immer zum Erfolg. Für junge Eltern bedeutet die Geburt eines Kindes keineswegs nur ungetrübte Freude: In dieser Zeit erweist es sich, ob die Beziehung auch unter der täglichen Belastung trägt, ob hinreichende Abgrenzungen zu den jeweilige Ursprungsfamilien erreicht werden konnten, ob brauchbare Regeln für das Zusammenleben entwickelt werden konnten. Für die Familienentwicklung ist darüber hinaus bedeutsam, dass durch die neu entstandene Dreiersituation (Triade) erstmalig Koalitionen möglich sind, 89 B 8205 Umb 001-584.indd 89 14.09.2012 14:37:06 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie bei der eine(r) ausgeschlossen werden kann. Daher ist es auch und gerade in dieser Phase wichtig, die Paarbeziehung zu stärken, Rollen und Aufgaben partnerschaftlich auszuhandeln und dabei für individuelle Unterschiede Raum zu lassen. Kleinkindalter (2. und 3. Lebensjahr) Exkurs: Zur Entwicklung und Bedeutung von Bindung Im Zuge der interaktionellen Erfahrungen des ersten Lebensjahres entwickelt sich beim Kind ein stabiles Bindungsverhalten, dessen Qualität im psychologischen Verfahren der „Fremden Situation“ (Ainsworth, M. et. al. 1978) erfasst werden kann. Dieses Verhaltensmuster zeigt die emotionale und motivationale Antwort des Kleinkindes auf eine experimentelle, kurze Trennung von seiner Hauptbezugsperson. Man unterscheidet Kinder mit organisierten und nicht organisierten Bindungsstilen. Organisiert bedeutet, dass die Kinder über eine Bindungsstrategie verfügen, auf die sie in Situationen von Angst und Stress zurückgreifen können. Dazu gehören die sicher gebundenen (ca. 50 – 60%), die unsicher-vermeidenden (30 – 40%) sowie unsicher-ambivalent (10 – 20%) gebundenen Kinder. Ein nicht organisierter Bindungsstil wird bei traumatisierten und vernachlässigten Kindern gefunden, entweder als desorganisierte Bindung auf dem Hintergrund eines der drei organisierten Muster oder als nicht klassifizierbarer Bindungsstil im Sinne einer Bindungsstörung. Auch eine bedeutsame Traumatisierung der Mutter führt häufig zu einem desorganisierten Bindungsmuster bei ihrem Kind. Mit zunehmender Reifung des Gehirns und der psychischen Funktionen entsteht aus dem Bindungsmuster die, meist das ganze Leben lang bestimmende Bindungsrepräsentation als differenzierte Fühl-, Denk-, Sprach-, und Handlungsstrategie. • Unsicher-vermeidende Kinder – und später auch Erwachsene – zeigen Misstrauen in die Hilfsbereitschaft anderer und eine Idealisierung der eigenen Kompetenzen, sie scheinen von ihren (Bindungs-) Gefühlen abgekoppelt und leugnen eigene Verwundbarkeit. Im Spiel mit anderen Kindern werden sie eher zu „Tätern“, aggressiv und verletzend. • Unsicher-ambivalente Kinder zeigen ein stark anklammerndes und wenig selbstvertrauendes Verhalten, sie überlassen anderen die Initiative, werden eher „Opfer“, erfahren durch ihre mangelnde Autonomie letztlich ebenso Ablehnung. 90 B 8205 Umb 001-584.indd 90 14.09.2012 14:37:06 Uhr 4. Entwicklungsstörungen und Kinder- und Jugendpsychiatrie • Desorganisiert gebundene Kinder zeigen immer wieder motorische Stereotypien, ratloses Innehalten oder „Eingefrorene Wachsamkeit“. Das Paradox der Mutter als gleichzeitig potentiell sicherem Hafen und Quelle von Angst und Gefahr führte zur Aushebelung jeglicher funktionellen Bindungsstrategie. Es wundert nicht, dass Jugendliche in Heimerziehung nur zu 3 – 5% eine sichere Bindung aufwiesen, während 43% organisiert- unsichere Bindungsrepräsentationen zeigten, und 54% nicht klassifizierbare/desorganisierte BR (Schleiffer 2002). Sichere emotionale Bindungen sind für Kinder die wichtigste Ressource zur Bewältigung von Unsicherheit, Angst und Stress. Die Ausformung und Stabilisierung sicherer Bindungsmuster hängt davon ab, ob ein Kind die wiederholte Erfahrung machen kann, dass es in der Lage ist, neue Anforderungen, die zu einer Störung seines emotionalen Gleichgewichtes führen, mit der Unterstützung einer primären Bezugsperson bewältigen zu können. (Hüther, G. 2001) Bei mindestens 70% der Kinder entspricht das Bindungsverhalten der Bindungsrepräsentation der primären Bezugsperson, i.d.R. der Mutter. Derzeit wird noch erforscht, wie Änderungen dieser „Bindungstransmission“ im Sinne einer günstigeren Entwicklung zu erreichen sind. Unterschiede in der Auswirkung von Bindung bei Kindern (…und Jugendlichen) Bindungstyp sicher gebunden unsicher gebunden Sozioemotionale Kompetenz – wenig aggressiv – mehr soziale Kompetenz im Umgang mit anderen Kindern – öfter feindselig, wütend – Isolation, Anhänglichkeit Selbst- und Persönlichkeits-entwicklung – beziehungsorientiert – eher angemessenes Selbstbild – höhere Ich-Flexibilität – bessere Emotionsregulierung – bessere Verhaltensregulierung – auf sich selbst fixiert – idealisiertes oder negatives Selbstbild – weniger Ich-Flexibilität – schlechtere Emotions­und Verhaltensregulierung Kognitiver Bereich – planvolleres Handeln – höhere Effektivität – planloseres Handeln – niedrigere Effektivität Tab. 3 91 B 8205 Umb 001-584.indd 91 14.09.2012 14:37:07 Uhr