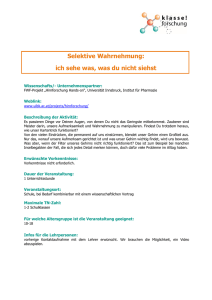SWR2 Aula
Werbung

SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Aula Neuronaler Dschungel Die Grenzen der Hirnforschung Von Dr. Matthias Eckoldt Sendung: Sonntag, 5. Oktober 2014, 8.30 Uhr Redaktion: Ralf Caspary Produktion: SWR 2014 Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Service: SWR2 Aula können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/aula.xml Die Manuskripte von SWR2 Aula gibt es auch als E-Books für mobile Endgeräte im sogenannten EPUB-Format. Sie benötigen ein geeignetes Endgerät und eine entsprechende "App" oder Software zum Lesen der Dokumente. Für das iPhone oder das iPad gibt es z.B. die kostenlose App "iBooks", für die Android-Plattform den in der Basisversion kostenlosen Moon-Reader. Für Webbrowser wie z.B. Firefox gibt es auch sogenannte Addons oder Plugins zum Betrachten von E-Books: Mitschnitte aller Sendungen der Redaktion SWR2 Aula sind auf CD erhältlich beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden zum Preis von 12,50 Euro. Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de Ansage: Mit dem Thema: „Neuronaler Dschungel – Die Grenzen der Hirnforschung“. Die modernen Neurowissenschaften haben mindestens zwei Nüsse zu knacken: Erstens gibt es völlig neue Erkenntnisse über die Funktions- und Arbeitsweise des Gehirns, die bisherige Konzepte ad absurdum führen und zu einem Umdenken zwingen. Zweitens gibt es deutliche Grenzen dieser Disziplin: Sie wird es wohl niemals schaffen, das Rätsel des Bewusstseins, des Selbstbewusstseins zu lösen, was ja auch logisch ist: Neurowissenschaft geht es um Neuronen und biochemische Prozesse im Gehirn, nicht um so etwas Unfassbares wie das Selbstgefühl. Der Philosoph Matthias Eckoldt über die Grenzen der Hirnforschung. Matthias Eckoldt: „Kann eigentlich ein Gehirn ein Gehirn verstehen?“ Mit dieser Frage provozierte der österreichisch-amerikanische Kybernetiker Heinz von Foerster seine Kollegen, die sich in den fünfziger und sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts mit der Erschaffung der Künstlichen Intelligenz befassten und vollmundig erklärten, dass sie in absehbarer Zeit das menschliche Hirn nachbauen könnten. Diese Hoffnungen bremste von Foerster, der wegen seiner enthüllenden Fragemethodiken auch des öfteren als der moderne Sokrates bezeichnet wurde. Denn um eine Sache nachbauen zu können, muss man sie erste einmal verstanden haben. Kann also ein Gehirn ein Gehirn verstehen? Formallogisch ist das nicht möglich. Denn zum Verständnis einer Sache braucht der Verstehende einen zumindest etwas höheren Komplexitätsgrad als die Sache selbst. Spielen wir das also durch: Ein Gehirn würde ein Gehirn verstehen und hätte damit einen höheren Komplexitätsgrad als das Gehirn. Damit jedoch wäre das Gehirn kein Gehirn mehr. Von Foersters Frage führt also direkt in die Paradoxie hinein. Und der gegen seinen Willen als Erfinder des Konstruktivismus in die Philosophiebücher eingegangene Kybernetiker sollte auch – zumindest bis heute – recht behalten. Das Gehirn zu verstehen ist eine paradoxe Angelegenheit, die der Computerwissenschaftler Emerson Pugh Ende der Siebziger Jahre in folgenden Apercu goss: "Wenn das Hirn so einfach wäre, daß wir es verstehen könnten, dann wären wir so einfach, daß wir es nicht könnten." Trotzdem ist nicht zu übersehen, dass die Hirnforschung boomt, seit George Bush – wohlgemerkt der Vater von George W. Bush – 1990 das letzte Jahrzehnt des zweiten Jahrtausends zur Dekade des Hirns erklärt hat. Neuro-Konzepte grassieren unter Beratern Psychologen und Pädagogen, ebenso wie unter Philosophen und anderen Geisteswissenschaftlern. So ist jüngst gar von der „Neurosoziologie“ und NeuroTheologie die Rede, an Neuro-Education hat man sich bereits gewöhnt. Die Neurowissenschaft ist dabei, zu einer Art Leitwissenschaft des 21. Jahrhunderts zu werden. Und das, obwohl sie selbst in einer handfesten Krise steckt. Dass man von der Krise nur wenig hört, mag daran liegen, dass die Massenmedien im Fall der Neurowissenschaften eine Ausnahme von ihrem sonstigen Sendemotto zu machen scheinen. Wenn es um Hirnforschung geht, heißt es nicht: „Bad news are good 2 news“. Hier zählt nur der Erfolg, auf dass die Hoffnung auf ein umfassendes Verständnis unseres Denkorgans weiterhin genährt wird. Dabei wurde längst aus dem Herzen der Neurowissenschaften selbst Skepsis laut. Bereits vor zehn Jahren veröffentlichten führende Hirnforscher ein Manifest zum Stand ihres Faches, indem sie für Naturwissenschaftler untypische Töne anstimmten. Fast melancholisch klingen Aussagen wie – Zitat: „Nach welchen Regeln das Gehirn arbeitet, wie das Gehirn die Welt so abbildet, dass unmittelbare Wahrnehmung und frühere Erfahrung miteinander verschmelzen und wie es zukünftige Aktionen plant, ist nicht einmal in Ansätzen klar. Und es ist nicht klar, wie man dies überhaupt erforschen könnte. In dieser Hinsicht befinden wir uns noch auf dem Stand von Jägern und Sammlern.“ Zehn Jahre später sieht die Sache nicht besser aus. Viele, zum Teil wirklich bahnbrechende Erkenntnisse sind seitdem gewonnen worden, aber die Hirnforschung erweist sich als eine Art Wunderbrunnen, der immer tiefer wird, je mehr man schöpft. Die Neurowissenschaftler bekommen in vielen Bereichen nicht Antworten auf ihre Fragen, sondern müssen einsehen, dass die Fragen, die sie an ihren Forschungsgegenstand hatten, falsch gestellt waren. So markiert der Nachweis der Plastizität des Gehirns einen entscheidenden Einschnitt in der Geschichte der Neurowissenschaft. Mit Plastizität benennen die Hirnforscher die erstaunliche Eigenschaft des Gehirns, die es ihm ermöglicht, lebenslang seine neuronale Struktur in Abhängigkeit von seiner Benutzung zu verändern. Das heißt im Umkehrschluss: Die Fähigkeiten, die wir entwickeln, sind nicht von vornherein in unserem Hirn angelegt, sondern werden im Prozess des Erlernens in die neuronalen Muster eingeschrieben. Diese Erkenntnis arbeitete sich nur langsam durch die scientific community, da ihr ein ganz entscheidendes Dogma des Faches widersprach. So war es bis zum Ende des 20. Jahrhunderts Konsens in den Neurowissenschaft, dass sich Neuronen nicht neu bilden können. Man ging davon aus, dass unser Hirn wesentlich von genetischen Programmen bestimmt ist. Der genetische Bauplan, so die Vorstellung, legte fest, was auf welche Weise im Hirn verdrahtet wird. Im Prinzip seien also alle Vorgänge im Hirn determiniert. Vom ersten Feuern der Neurone bis zum langsamen Absterben stünde alles fest. Eine naturwissenschaftliche Art der Schicksalsgläubigkeit, die mit purer Mathematik ausgehebelt werden kann: Denn die Gesamtverschaltung in unserem Gehirn hat eine Informationstiefe von 1016 Bit. In unserem Genom sind hingegen lediglich 109 Bit vorhanden. Insofern kann es rein rechnerisch überhaupt keine genetische Festlegung der Verschaltungen geben. Die genetischen Programme legen eher die Spielregeln des Selbstorganisationsprozess im Gehirn fest, sie schaffen die Bedingungen der Möglichkeit seiner Entwicklung. Erst ab Ende des 20. Jahrhunderts gelangen durch die Einführung bildgebender Verfahren erste Durchbrüche, als man beobachten konnte, dass sich im Hirn Strukturen umbauen, wenn die Probanden neue Erfahrungen machten oder bestimmte Fertigkeiten trainierten. Eine Studie an Londoner Taxifahrern war ausschlaggebend für die Entdeckung der Neuroplastizität beim Menschen. Mithilfe bildgebender Verfahren konnte man nachweisen, dass sich bei dieser Berufsgruppe der Hippocampus vergrößerte – also die unter anderem für das Gedächtnis sowie 3D-Bewegungen zuständige Gehirnregion. Tests jeweils vor und nach dem 3 mehrjährigen Taxi-Schein-Kurs ergaben, dass die maßgebliche Veränderung der Hirnstruktur erst beim von den Prüfern geforderten Einprägen von 25.000 Straßen geschieht. Das hieß erstens, dass sich Erfahrungen in die neuronale Architektur einschreiben, und zweitens, dass Neurone tatsächlich vom Hirn neu gebildet werden können. Anders sind auch die teilweise erstaunlichen Rehabilitationsleistungen von Schlaganfallpatienten nur schwer zu erklären. In diesem Kontext befreite ausgerechnet die harte Naturwissenschaft auch die Psychotherapie von allen Zweifeln an ihrer Wirksamkeit, da man nun subjektiv empfundene Heilungserfolge tatsächlich mit Veränderungen in den Hirnstrukturen objektivieren konnte. Neue Erfahrungen können uns Menschen in jedem Alter auf andere Lebens- und Gehirnbahnen katapultieren. Das gilt auf individueller, aber ebenso auf kultureller Ebene. So kommt auch der Altmeister der Medientheorie Herbert Marshall McLuhan zu seinem neurobiologischen Recht. McLuhan ging bekanntlich davon aus, dass sich das Medium zur Botschaft macht. Die Hirnforschung eröffnet nun den Blick dafür, dass sich mediale Erfahrungen – jenseits ihrer Inhalte – in die Hirnstrukturen einschreiben und die Wahrnehmung von Wirklichkeit verändern. So lief Wahrnehmung im Gutenberg-Zeitalter nach Maßgabe der Zerlegung der Welt gemäß des typografischen Prinzips ab. Auf A folgte B, folgte C, folgte D. Alles nacheinander, alles an seinem Platz. Die Welt bestens geordnet. Das detailversessene Kleinklein des Gutenbergszeitalters wurde von den elektronischen Medien aufgelöst, die Raum und Zeit zusammenschmelzen lassen im so genannten Globalen Dorf. Doch die jeweiligen medialen Erfahrungen, die wir machen, schreiben sich als Wahrnehmungsmuster ins Hirn ein. Die Hirnforscher sprechen bei dem Prozess der Neuronenbildung und –verbindung von Bahnung. Gebahnt werden nach neustem Kenntnisstand eben jene Strukturen, die wir besonders intensiv benutzen. „Im Hirn eines Menschen“, sagt der Neurobiologe Gerald Hüther, „werden immer dann entsprechende Netzwerke stabilisiert, wenn ihm die Sache unter die Haut geht“. Die Plastizität scheint im evolutionären Sinn eine noch verhältnismäßig junge Strategie zu sein. Anzeichen sprechen dafür, dass bis zu den Dinosauriern die Hirne der Wirbeltiere fest verdrahtet waren. Sie kamen mit einem arteigenen Programm auf die Welt, das die neuronalen Bahnen im Gehirn bis in die kleinste Gabelung vorschrieb. Eine derart determinierte Struktur ist in sich sehr stabil. Die Kehrseite dieser Stabilität liegt jedoch in einem nur geringen Entwicklungspotenzial. Genau das aber ist in einer sich ständig wandelnden Umwelt lebensgefährlich. Die Festverdrahteten hatten keine Chance, in existentiellen Situationen wie plötzlicher Nahrungsknappheit oder dramatischer Klimaveränderung kreativ zu werden und neue Strategien auszuprobieren. Das Resultat ist bekannt. Die neue evolutionäre Strategie der eher losen Verdrahtung wird nun mit einer längeren Verweildauer im elterlichen Nest bezahlt, da alles, was zum Überleben in der Umwelt nötig ist, erst erlernt werden muss. Je plastischer das Hirn, so könnte man sagen, desto länger muss sein Träger bei den Eltern bleiben. So erklärt sich auch die im gesamten Tierreich beispiellos lange Nesthockerzeit des Menschen. Keine andere Art verbringt fast ein Viertel seines Lebens als Schutzbefohlene. Dieser Umstand zeigt zugleich, wie extrem formbar die neuronalen Strukturen des 4 Menschen sind. Unser Hirn kommt in gewissem Sinne als ein leeres Gefäß zur Welt, das im Laufe der Entwicklung erst gefüllt werden muss. Die Entdeckung der erfahrungsabhängigen Plastizität des menschlichen Hirns ließ nicht nur das auf der Genetik ruhende Paradigma platzen, das davon ausging, dass die neuronalen Strukturen determiniert sind und keine Neuronen neugebildet werden. Auch die als unhintergehbar angesehene Lokalisationstheorie der Neurowissenschaft geriet in den letzten Jahren arg ins Wanken. Diese fußt auf der Idee der Hirnkarten, die bestimmte Funktionen in eng umschriebenen Arealen verorten. Sie geht zurück auf den Beginn der modernen Hirnforschung im 19. Jahrhundert, als die Biologen mit dem Studium neurologischer Ausfallerscheinungen begannen. Prominent wurde in diesem Zusammenhang der Fall des amerikanischen Sprengmeisters Phineas Gage, dem bei einer Sprengung unglücklicherweise eine drei Zentimeter dicke und ein Meter lange Eisenstange durch den Kopf schoss. Sie trat am linken Wangenknochen ein und oben am Kopf wieder aus. Erstaunlicherweise überlebte Gage diesen Unfall und blieb sogar die ganze Zeit über bei vollem Bewusstsein. Er brauchte nur wenige Wochen zur Erholung. Intellekt, Wahrnehmung, Sprachmächtigkeit und Motorik blieben in vollem Maße erhalten. Allerdings veränderte sich sein Wesen nach und nach. Dass aus dem verantwortungsbewussten Mann ein impulsiver Kindskopf wurde, legte nahe, dass die von der Eisenstange getroffene Hirnregion etwas mit dem Charakter zu tun hatte. Die Idee der Hirnareale, die jeweils verschiedene Zuständigkeiten haben, war damit in der Welt. Wenig später entdeckte Paul Broca das Sprachzentrums. Erste Hirnkarten entstanden und wurden durch die Untersuchung der zahllosen Hirnschussverletzungen im Ersten Weltkrieg immer ausgefeilter. Nicht von ungefähr schreibt der Soziologe Dirk Baecker, dass sich der Entwicklungsschub der Neuroanatomie der Protokollierung von Gehirnläsionen verdankt, mit denen – Zitat: „die Ärzte in den Kriegen des 19. und 20. Jahrhunderts großzügig versorgt wurden.“ Die Entdeckung der Neuroplastizität des Hirns kratzte an der Lokalisationstheorie. Denn wenn sich Strukturen im Hirn allein aufgrund gemachter Erfahrungen auf- und umbauen konnten, musste die Hirnarchitektur doch wesentlich dynamischer sein als es die Hirnkarten suggerierten. Hinzu kam in den letzten Jahren noch eine zweite Entdeckung. Die bunten Bilder vom Hirn, die seit der Karriere der bildgebenden Verfahren die Zeitschriften füllen, scheinen der Lokalisationstheorie erst einmal recht zu geben. Dabei muss man jedoch im Hinterkopf haben, wie diese Bilder entstehen: Mit den MRT-Untersuchungen, die zu diesen Bildern führen, werden Hirnaktivitäten nämlich sehr indirekt gemessen. Letztlich geben die Bilder weder über Gedanken noch über elektrische Potenziale Auskunft, sondern lediglich über Veränderungen der Sauerstoffaufnahme im Blut in verschiedenen Bereichen. Daraus wird dann auf die Aktivität der einzelnen Areale geschlossen. Um nun aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, nimmt man nur die Aktivitäts-Spitzen, die in den Hirnbildern bunt eingefärbt werden. Was man dabei methodisch übersieht, ist die Aktivität in den anderen Hirnstrukturen. Denn der Unterschied im Aktivitätsniveau der eingefärbten und der nicht eingefärbten Stellen ist gering. Wesentlich geringer als es die leuchtenden Farben in den Aufnahmen suggerieren. 5 Als man nun die Perspektive umgedreht und den sogenannten Ruhe-Zustand untersucht hat, zeigte sich, dass auch während das Hirn vermeintlich nichts tut, enorm viel Aktivität da ist. Im Grunde genommen ist das Hirn andauernd aktiv. Versuche am Max-Planck-Institut für Neurowissenschaften bei Angelika Friederici in Leipzig zeigten, dass der Unterschied zwischen den aktiven Arealen und dem Rest des Hirns bei lediglich fünfzehn bis zwanzig Prozent liegt. Wenn das aktive Areal also zu einhundert Prozent aktiv ist, stellt man im Rest des Hirns immer noch eine Aktivität von achtzig bis fünfundachtzig Prozent fest. Somit ist aber die Annahme, dass ein bestimmtes Areal allein eine bestimmte Leistung vollbringt, irrig. Die spezifische Funktion und Leistung ist immer das Resultat eines Netzwerkes und nicht eines einzelnen Areals. Aber es kam noch schlimmer: Denn es wurde weiterhin deutlich, dass sich die einzelnen Areale nicht nur auf Netzwerke von Aktivitäten stützen, um ihre Funktionen vollbringen zu können, sondern dass diese Areale auch gar nicht unbedingt exklusiv für bestimmte Leistungen zuständig sind. So scheint das Broca-Areal nicht, wie bisher angenommen, exklusiv für die Sprachverarbeitung zuständig zu sein, da sich in entsprechenden Experimenten herausgestellt hat, dass es auch bei der Handlungsplanung innerhalb eines Netzwerkes aktiv ist. Schaut man sich die Gemeinsamkeiten von Sprachverarbeitungs- und Handlungsspanungsprozessen an, so könnte das Broca-Areal bei beiden Prozessen die Funktion der Sequenzierung und Hierarchisierung leisten. Somit steht die Hirnforschung momentan vor der gewaltigen Aufgabe, das statische Hirnkartenmodell der verschiedenen Zentren zu den Akten der Wissenschaftsgeschichte zu legen und durch ein neues, dynamisches Modell der Funktionen zu ersetzen. Die Entdeckung der Neuroplastizität und die vermehrten Zweifel an der Lokalisationstheorie gingen mit einem dritten fundamentalen Erkenntnisschock in der Hirnforschung einher. Bis tief in die Neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts ging die scientific community noch mehrheitlich davon aus, dass man es beim Gehirn – wie bei anderen Organen auch – mit einem passiven, informationsverarbeitenden, reizabhängigen System zu tun hat. Das Scheitern dieser Vorstellung gestehen die Hirnforscher heute ein und sind sich weitestgehend einig, dass unser Gehirn so ziemlich das Gegenteil ist: Nämlich ein aktives System, das in Eigenregie seine inneren Zustände selbst erzeugt. Damit aber ist auch klar, wie der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth formuliert – Zitat: “... dass das Hirn die Welt nicht so wahrnimmt, wie sie ist, sondern so, wie sie für das Überleben des Organismus relevant ist.“ Damit aber stürzt eine ganze sehr wirkmächtige Wissenschaftsrichtung zusammen. Unter dem Stichwort Behaviorismus ging man in vielen Varianten davon aus, dass Menschen im Prinzip – wie der berühmte Pawlowsche Hund – als Reiz-ReaktionsMaschinen zu beschreiben sind. Das würde jedoch in letzter Konsequenz bedeuten, dass menschliche Gehirne auf denselben Reiz immer dieselbe Reaktion auslösen. Allein schon die Alltagsbeobachtung spricht dagegen. Menschen sind, wie es Heinz von Foerster so schön sagte, nichttriviale Maschinen, die eben nicht wie triviale, programmierte Roboter auf immer dieselbe Weise vorhersehbar reagieren, sondern für Überraschungen gut sind. Und dem ist so, weil nichttriviale Maschinen – wie menschliche Hirne – innere Zustände ausbilden. 6 Genau darin liegt offensichtlich die Besonderheit des menschlichen Hirns: Es nimmt die Welt nicht einfach so wahr, wie sie ist, sondern berechnet selbst nach inneren Parametern ein Bild von der Welt. Diese in den letzten Jahren innerhalb der Hirnforschung immer plausiblere erkenntnistheoretische Position ist mittlerweile unter dem Stichwort Konstruktivismus auch in der Philosophie und Gesellschaftstheorie prominent geworden. Wahrnehmung ist demnach kein Reiz-ReaktionsZusammenhang, kein Bild-Abbild-Vorgang, sondern eine aktive Leistung des Hirns. Wir müssen uns die Welt – nichts anderes ist ja genauer betrachtet auch unsere tägliche Erfahrung – wir müssen uns die Welt erarbeiten, müssen und können unsere inneren Zustände nur selbst erzeugen. Das Gehirn ist kein offenes System, in das man nach Lust und Laune hineinwirken könnte, sondern es ist im Gegenteil ein geschlossenes, selbstorganisierendes System. So könnte die Hirnforschung, Eltern und Pädagogen eine drastische Lektion erteilen: Beide müssen von der lieb gewordenen Vorstellung Abschied nehmen, dass man den Kindern Wissen und Verhaltensweisen eintrichtern könne. Im Hirn werden offensichtlich nur längerfristige synaptische Bahnungen angelegt, wenn man selbst etwas versteht, für sinnvoll erachtet und sich dafür begeistert. Tatsächlich bezeichnete der Neurobiologe Gerald Hüther Begeisterung denn auch als eine „neuronale Gießkanne“. Die Wirksamkeit der inneren Beteiligung am Lernprozess ist nicht zu überschätzen. Eltern und Lehrer können lediglich die bestmöglichen Bedingungen schaffen. Was die Lernenden aber daraus machen, mit welchen Schätzen sie ihr Hirngefäß befüllen, das obliegt einzig und allein ihrer eigenen Verantwortung, ihrer Selbstorganisation. Das Konzept der Selbstorganisation, wie es von Heinz von Foerster, Ilya Prigogine, Francisco Varela, Humberto Maturana und anderen entwickelt wurde, befasst sich mit dem Phänomen, dass unter bestimmten Bedingungen aus Chaos Ordnung entsteht. Und das auf verschieden Ebenen: Aus einer Ansammlung von Aminosäuren kann plötzlich eine lebendige Zelle werden. Aus einer Fülle von GeldTransaktionen kann eine Bank oder ein ganzes Finanzsystem entstehen. Eine Vielzahl gesellschaftlicher Handlungen kann bestimmte soziale Systeme wie das Rechts-, das Politik- oder das Kunstsystem herausbilden. Bei Selbstorganisationsphänomenen sticht ins Auge, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. So wie der menschliche Körper weitaus mehr ist als seine einhundert Billionen Zellen, ist eine Firma mehr als ihre Mitarbeiter. Selbst das differenzierteste Wissen über die Körperzellen reicht nicht aus, um einen Menschen zu kreieren. Ebenso genügt es nicht, die Mitarbeiter zu befragen, um ein Unternehmen zu verstehen. Es tritt etwas hinzu, um die neue Struktur zu ermöglichen. Das Konzept der Selbstorganisation beschäftigt sich mit jenem Etwas, das aus der Vielheit von Ereignissen eine neue Einheit zu schaffen vermag. Eben einen Menschen oder eine Firma. Für die Neurowissenschaft heißt das, es genügt nicht mehr, die einzelnen Teile – Neurone, Netzwerke, Areale – zu beschreiben, um das Phänomen Gehirn zu verstehen, sondern man muss das Hinzutretende finden. Auf der Suche danach, was im Hirn das Hinzutretende ist, wie aus dem Chaos neuronaler Zustände die Ordnung von Wahrnehmungen und Gedanken entsteht, befinden sich die Forscher noch am Anfang. 7 Damit verbunden gibt es, metaphorisch formuliert, so etwas wie eine offene Wunde am Leib der Hirnforschung. Die besteht in der Frage nach dem Bewusstsein. In seltener Einhelligkeit erklären die Neurowissenschaftler ihre Ratlosigkeit bei der Beantwortung der Frage, was die biologische Grundlage von Bewusstsein ist. Die Ratlosigkeit der Hirnforscher ist vor allem deshalb prekär, weil die Frage nach dem Wesen und der Funktion des Bewusstseins so drängend ist. Das Wissenschaftsmagazin „science“ führte eine repräsentative Umfrage unter Forschern weltweit zu den 125 Fragestellungen durch, deren Lösung für Wissenschaft und Gesellschaft von eminenter Bedeutung ist. Auf dem zweiten Platz – gleich hinter der Frage, woraus das Universum besteht – landete eben jene Frage nach dem Bewusstsein. Ein hartnäckiger Stolperstein auf dem Weg zur Enträtselung des Bewusstseins stellt das sogenannte Bindungsproblem dar, also die Fähigkeit des Gehirns, aus einer Vielzahl von Sinneseindrücken eine einheitliche Wahrnehmung zu konstruieren. Zum Hintergrund: Fundamentale Prozesse wie beispielsweise Hören, Sehen, Schmecken und dann deren Abgleich mit den jeweiligen Erinnerungen werden im Hirn an ganz verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten verarbeitet. Das kann man gut messen. Trotz dieser verschiedenartigen Verarbeitungsmodi stellen sich uns die Sinnesempfindungen als ein einziger, kontinuierlicher Bewusstseinsstrom dar, der gewissermaßen durch uns durchfließt. Da gibt es kein Stocken, kein Warten auf ausstehende Daten, keine Sanduhr vor unserem inneren Auge wie etwa auf dem Computerbildschirm, wenn noch Rechenprozesse zu erledigen sind. Wie diese Einheitlichkeit des Bewusstseinsstroms zustande kommt, ist den Hirnforschern völlig rätselhaft. Wolf Singer vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main sagt dazu – Zitat: „Die Intuition legt nahe, dass es irgendwo im Gehirn ein Zentrum gibt, in dem alle Informationen zusammengefasst werden, wo Entscheidungen fallen, wo Bewusstsein entsteht und das agierende, bewertende, entscheidende Ich sich konstituiert. Wenn man nun jedoch in die Gehirne hineinschaut und sich die Organisationsprinzipien anschaut, dann findet man diesen Ort nicht.“ Völlig unklar ist damit auch, in welcher Weise Informationen im Hirn überhaupt gespeichert werden, wenn gar kein Zentrum auszumachen ist, in dem Informationen zur Bewertung zusammengeführt werden. Damit platzte auch noch die Bibliotheksmetapher, mit Hilfe derer sich die Neurowissenschaft die Informationsspeicherung lange Zeit zu verdeutlichten versuchte. Wenn es jedoch keinen neuronalen Bibliothekar gibt, der weiß, wie die Bücher geordnet sind, taugt die ganze Bibliothek nichts. Ohne die wissende und ordnende Hand, würden wir ewig nach Informationen suchen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. In unerklärbar rasantem Tempo wissen wir beispielsweise auch über unser Nichtwissen Bescheid. Wissen Sie, welches Spurenelement auf dem Saturn am häufigsten vorkommt? Nein? Ich auch nicht. Warum wissen wir so schnell, dass wir es nicht wissen? Wenn die Informationen in unserem Hirn wie in einer Bibliothek angeordnet wären, müsste doch erst einmal recherchiert werden, ob nicht doch in irgendeiner der grauen Zellen etwas diesbezüglich hängen geblieben ist. Doch die Informationsverarbeitung im Hirn stellt sich nicht nur als Abruf-, sondern auch als Repräsentationsproblem dar. 8 Die Vorstellung, dass die Informationen in einzelnen Neuronen hinterlegt sind, kann nach heutigem Stand der Hirnforschung nicht mehr gehalten werden. Prominent wurde diese Idee unter dem Stichwort “Großmutterneuron”. Demnach sollte je ein Neuron für ein Außenweltobjekt – eben die Großmutter oder den Fernseher oder das Fahrrad – verantwortlich sein. Allerdings sterben pro Tag 85.000 Nervenzellen ab. Da dürfte man mit ziemlicher Sicherheit irgendwann einige Objekte nicht mehr erkennen. Doch zurück zur Bewusstseinsproblematik: Wenn die Neurowissenschaften ihr Objekt auf dem Seziertisch oder im MRT erforschen, dann schauen sie aus der objektivierenden Er-Perspektive der dritten Person auf das Hirn. Aus dieser Perspektive kann man zwar neuronale Zustände sehen, jedoch kein Bewusstsein – weder Gedanken noch Empfindungen. Diese kann man nur aus der ersten Person, der Ich-Perspektive, wahrnehmen, aus der heraus man jedoch wiederum keines einzigen Neurons habhaft wird. Man kommt zu völlig anderen Schlüssen, wenn man subjektiv in sich hineinschaut, als wenn man objektiv das Gehirn als Untersuchungsgegenstand vor sich hat. In dieser Differenz gründet auch der derzeit teils heftig ausgefochtene Disput zwischen Neurowissenschaft und Philosophie, in dem die Philosophen den Hirnforschern Vulgärmaterialismus vorwerfen, da sie die erste und dritte Personenperspektive vermischen und geistige Zustände mit neuronalen Aktivitäten gleichsetzen. Den Philosophen wird, wenn sie auf diese Problematik hinweisen, von den Hirnforschern ein verkappter Dualismus vorgeworfen, der vorwissenschaftlich sei. Diese Debatte wird hier und heute kein versöhnliches Ende finden. Sie soll auch lediglich als Beleg dafür dienen, dass es in der Erkenntnistheorie der Hirnforschung ernste Lücken gibt. Bei der Erforschung des Bewusstseins nun kommt die Differenz zwischen der ersten und der dritten Person besonders zum Tragen, da es dabei ja um – wie auch immer geartetes – inneres Erleben geht. Jenes innere Erleben, das der kleinste gemeinsame Nenner in der Bewusstseinsforschung ist, bezeichnet man auch als Quale, Plural Qualia. Der amerikanische Philosoph Thomas Nagel gab eine eingängige Definition der Qualia – Zitat: „Grundsätzlich hat ein Organismus bewusste mentale Zustände dann und nur dann, wenn es irgendwie ist, dieser Organismus zu sein – wenn es irgendwie für diesen Organismus ist.“ Damit aber stellt sich ein für die Hirnforschung geradezu unüberbrückbarer Abgrund in methodischer Hinsicht dar. Denn was immer sie auch über das Hirn herausbekommen wird, die Erste-Person-Perspektive – wie es sich anfühlt, der und der Mensch zu sein – wird ihr verborgen bleiben. Wie es ist, einen Farbton, ein Geräusch oder einen Geschmack wahrzunehmen, wird sie nicht erschließen können, egal wie präzise sie auch die elektrischen und biochemischen Aktivitäten von den Rezeptoren bis hinein ins Hirn mit seinen weit verteilten Netzwerken zu registrieren vermag. Das ist möglicherweise eine schlechte Nachricht für die Hirnforschung. Für uns Menschen ist diese Nachricht zweifelsohne gut. Unser inneres Erleben – unsere Wahrnehmungen und Empfindungen und Gedanken, unser Bewusstseinsstrom – bleibt auf absehbare Zeit ein von den Wissenschaften unantastbares Privateigentum. Vielleicht kann diese Einsicht zusammen mit den Krisenerfahrungen der Hirnforschung dazu beitragen, die Neuro-Manie ein wenig zu beruhigen. 9 In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag. ***** Zum Autor: Dr. phil. Matthias Eckoldt, Jahrgang 1964, lehrt an der Berliner Freien Universität im Fachbereich Geschichte und Kulturwissenschaft. Er veröffentlichte zahlreiche Features, Essays und Hörspiele. Arbeitsgebiete: Systemtheorie der Massenmedien, Machtanalytik moderner Gesellschaften, Konstruktivistische Paradigmen, Moralphilosophie Bücher (Auswahl): - Kann das Gehirn das Gehirn verstehen? Gespräche über Hirnforschung und die Grenzen der Erkenntnis (zusammen mit Matthias Baxmann). Verlag Carl Auger. 2013 - Woanders ist auch Alltag: Auslandskorrespondenten über die Tücken in der Fremde. Verlag Bastei-Lübbe (erscheint im Oktober 2014) 10