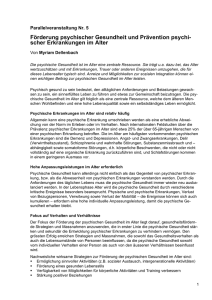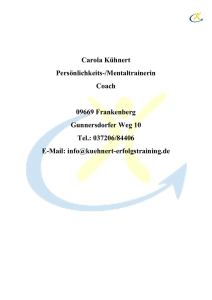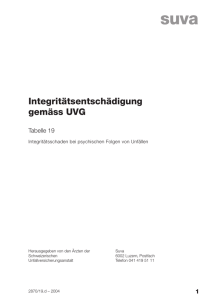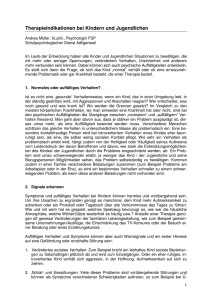Psychische Erkrankungen
Werbung
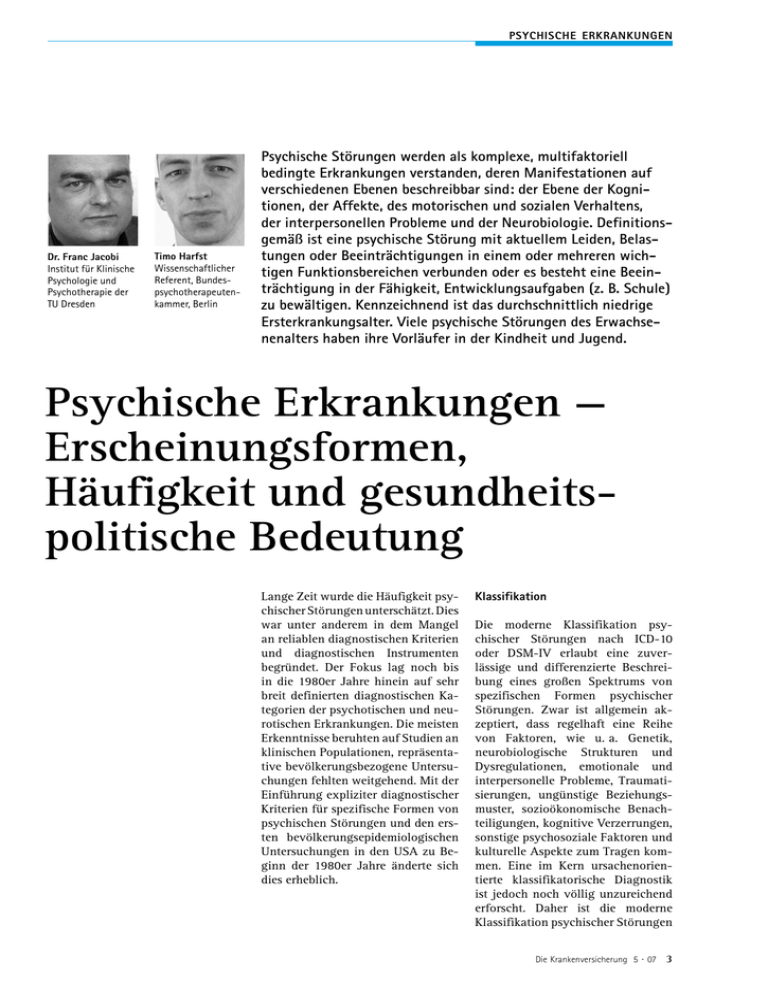
PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN Dr. Franc Jacobi Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie der TU Dresden Timo Harfst Wissenschaftlicher Referent, Bundespsychotherapeutenkammer, Berlin Psychische Störungen werden als komplexe, multifaktoriell bedingte Erkrankungen verstanden, deren Manifestationen auf verschiedenen Ebenen beschreibbar sind: der Ebene der Kogni­ tionen, der Affekte, des motorischen und sozialen Verhaltens, der interpersonellen Probleme und der Neurobiologie. Definitions­ gemäß ist eine psychische Störung mit aktuellem Leiden, Belas­ tungen oder Beeinträchtigungen in einem oder mehreren wich­ tigen Funktionsbereichen verbunden oder es besteht eine Beein­ trächtigung in der Fähigkeit, Entwicklungsaufgaben (z. B. Schule) zu bewältigen. Kennzeichnend ist das durchschnittlich niedrige Ersterkrankungsalter. Viele psychische Störungen des Erwachse­ nenalters haben ihre Vorläufer in der Kindheit und Jugend. Psychische Erkrankungen — Erscheinungsformen, Häufigkeit und gesundheitspolitische Bedeutung Lange Zeit wurde die Häufigkeit psychischer Störungen unterschätzt. Dies war unter anderem in dem Mangel an reliablen diagnostischen Kriterien und diagnostischen Instrumenten begründet. Der Fokus lag noch bis in die 1980er Jahre hinein auf sehr breit definierten diagnostischen Kategorien der psychotischen und neurotischen Erkrankungen. Die meisten Erkenntnisse beruhten auf Studien an klinischen Populationen, repräsentative bevölkerungsbezogene Untersuchungen fehlten weitgehend. Mit der Einführung expliziter diagnostischer Kriterien für spezifische Formen von psychischen Störungen und den ersten bevölkerungsepidemiologischen Untersuchungen in den USA zu Beginn der 1980er Jahre änderte sich dies erheblich. Klassifikation Die moderne Klassifikation psychischer Störungen nach ICD-10 oder DSM-IV erlaubt eine zuverlässige und differenzierte Beschreibung eines großen Spektrums von spezifischen Formen psychischer Störungen. Zwar ist allgemein akzeptiert, dass regelhaft eine Reihe von Faktoren, wie u. a. Genetik, neurobiologische Strukturen und Dysregulationen, emotionale und interpersonelle Probleme, Traumatisierungen, ungünstige Beziehungsmuster, sozioökonomische Benachteiligungen, kognitive Verzerrungen, sonstige psychosoziale Faktoren und kulturelle Aspekte zum Tragen kommen. Eine im Kern ursachenorientierte klassifikatorische Diagnostik ist jedoch noch völlig unzureichend erforscht. Daher ist die moderne Klassifikation psychischer Störungen Die Krankenversicherung 5 ? 07 PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN nach ICD-10 in erster Linie deskriptiv konzipiert. Bei einem Individuum kann eine psychische Störung diagnostiziert werden, wenn es eine bestimmte Mindestzahl diagnostischer Kriterien aus einem definierten Satz von spezifischen Beschwerden und Symptomen aufweist, in der Regel mit der Maßgabe, dass auch das Kriterium des klinisch bedeutsamen Leidens oder Beeinträchtigung erfüllt ist. J Posttraumatische Belastungsstörungen und Anpassungsstörungen, J Nicht-organische Schlafstörungen, J Sexuelle Funktionsstörungen, J Andere Essstörungen J Persönlichkeitsstörungen und Verhaltensstörungen J Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit sowie J Dementielle Erkrankungen. Häufigkeiten Jacobi et al. (2004) ermitteln für Deutschland anhand des Zusatzmoduls „Psychische Störungen“ des BGS bei Erwachsenen eine Ein-Jahres-Prävalenz für psychische Störungen von insgesamt 31,1 %.1 Die Häufigkeitsraten unter den Frauen fallen mit 37 % wesentlich höher aus als unter den Männern mit 25,3 % (vgl. Abb. 1). Diese Raten entsprechen denen, die in vergleichbaren internationalen Studien gefunden wurden.2 Demnach ist davon auszugehen, dass etwa ein Viertel bis ein Drittel der erwachsenen Allgemeinbevölkerung im Laufe eines Jahres die diagnostischen Kriterien für das Vorliegen einer psychischen Störung erfüllt. Über ein Drittel (39,5 %) der Personen, bei denen eine psychische Störung diagnostiziert wurde, wies mehr als eine psychische Störung Für Deutschland dauerte es bis zur Durchführung des Bundesgesundheitssurveys (BGS) in den Jahren 1998/99, der erstmals auch einen eigenen Zusatzsurvey „Psychische Störungen“ einschloss, dass diese Erkenntnislücke geschlossen werden konnte.1 Der Survey ermöglichte mit international üblichen, reliablen diagnostischen Kriterien die Häufigkeitsschätzung eines weiten Spektrums behandelter und unbehandelter psychischer Störungen in der erwachsenen deutschen Durchschnittsbevölkerung im Alter von 18-65 Jahren. Die psychischen Störungen wurden im Zusatzsurvey zum BGS mittels des Münchener Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI) erfasst. Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass im BGS ausschließlich folgende Diagnosegruppen untersucht wurden: J Affektive Störungen, J Angststörungen (inkl. Zwangsstörungen), J Somatoforme Störungen, J Essstörungen (Anorexie und Bulimie), J Substanzbezogene Störungen, J Mögliche psychotische Störungen, J Psychische Störungen aufgrund eines medizinischen Krankheitsfaktors. Nicht erfasst wurden insbesondere folgende psychische Störungen: Die Krankenversicherung 5 ? 07 40 35 30 auf. Als häufigste Diagnosen finden sich Angststörungen, Störungen durch psychotrope Substanzen (vor allem Alkoholmissbrauch bzw. -abhängigkeit), affektive Störungen (vor allem Depressionen) sowie körperliche Beschwerden, für die keine hinreichende organische Ursache gefunden werden kann. Die deutlichsten Geschlechtsunterschiede finden sich hinsichtlich der Angststörungen, körperlichen und depressiven Störungen. Frauen sind davon etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Innerhalb der Gruppe der Angststörungen zeigt sich das vor allem bei den Diagnosen „Agoraphobie“ und „spezifische Phobie“. Bei den Männern findet sich hingegen eine im Vergleich zu den Frauen erhöhte Häufigkeit an Störungen durch psychotrope Substanzen. Insgesamt zeigt sich, dass in der Allgemeinbevölkerung die Häufigkeit psychischer Störungen bei der Mehrzahl von Diagnosegruppen zwischen den Geschlechtern variiert. Kinder und Jugendliche Ein vergleichbarer Survey zur Ermittlung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter in Deutschland im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) befindet Frauen Männer Gesamt 25 20 15 10 5 0 Störungen durch psychotrope Substanzen (F1) Depressive Angststörungen (F40Störungen (F32-F33; F42) F34.1) Somatoforme Störungen (F45) Irgendeine psychische Störung Abbildung 1: Ein-Jahres-Prävalenzen psychischer Störungen bei Erwachsenen von 18 bis 65 Jahren nach Geschlecht. Aufgeführt sind die vier häufigsten Diagnosegruppen gemäß ICD-10 (Mehrfachnennungen). PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN sich erst in der Auswertungsphase. Nach den ersten Zwischenergebnissen bestehen bei jedem fünften Kind Hinweise auf eine psychische Auffälligkeit.3 Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit einer Angststörung wird auf 10 % geschätzt. Weitere häufige psychische Störungen sind Störungen des Sozialverhaltens (7,6 %), depressive Störungen (5,4 %) und das Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS; 2,2 %). In einem aktuellen Überblick über nationale und internationale Studien wird eine mittlere Periodenprävalenz (in der Regel 6-Monats-Prävalenzraten) von 18 % berichtet.4 Wie Ihle und Esser (2002) in ihrer Übersichtsarbeit zeigen können, sind psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter in hohem Maße geschlechtsabhängig. Während Jungen bis zur Pubertät durchgängig höhere Häufigkeitsraten aufweisen, erfolgt bei Beginn des Erwachsenwerdens eine Angleichung der Raten. Im späten Jugendalter finden sich schließlich höhere Krankheitshäufigkeiten bei Mädchen. Soziale Ungleichheit der Krankheitsrisiken Soziale Benachteiligung stellt einen bedeutsamen Risikofaktor für die Entwicklung einer psychischen Störung dar. Entsprechend unterscheiden sich Prävalenzraten psychischer Störungen zwischen den sozialen Schichten erheblich. Die soziale Schicht wurde im BGS über einen mehrdimensionalen aggregierten Index erfasst, der auf Angaben zum Haushaltsnettoeinkommen, zum Bildungsniveau und zur beruflichen Stellung basiert und eine Differenzierung zwischen Unter-, Mittel- und Oberschicht ermöglicht (Winkler-Index). Angehörige der Unterschicht haben mit einer Ein-Jahres-Prävalenz von insgesamt 37 % im Vergleich zu Angehörigen der Mittelschicht (31 %) und der Oberschicht (27 %) ein deutlich höheres 40 35 30 Unterschicht Mittelschicht Oberschicht 25 20 15 10 5 0 Störungen durch psychotrope Substanzen (F1) Depressive Angststörungen (F40Störungen (F32-F33; F42) F34.1) Somatoforme Störungen (F45) Irgendeine psychische Störung Abbildung 2: Ein-Jahres-Prävalenzen psychischer Störungen bei Erwachsenen von 18 bis 65 Jahren nach sozialer Schicht. Aufgeführt sind die vier häufigsten Diagnosegruppen gemäß ICD-10 (Mehrfachnennungen). Risiko, innerhalb eines Jahres unter einer psychischen Störung zu leiden. Bei allen der vier häufigsten Diagnosengruppen bestehen zwischen den Gruppen der sozialen Schicht signifikante Unterschiede hinsichtlich der Prävalenzraten (siehe Abb. 2). Auch bei Kindern und Jugendlichen besteht ein starker Zusammenhang des Erkrankungsrisikos mit der sozialen Schicht. Nach den Daten des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys bestehen bei 31 % der Kinder aus der Unterschicht Hinweise auf eine psychische Auffälligkeit im Vergleich zu 21 % der Kinder aus der Mittelschicht und 16 % aus der Oberschicht. Sozialmedizinische und gesundheitsökonomische Belastungen Neben den direkten Behandlungskosten treten bei einer Reihe von psychischen Störungen in erheblichem Umfang weitere indirekte Kosten durch Minderung der Arbeitsproduktivität, Frühberentungen und Arbeitslosigkeit hinzu. Nach den Ergebnissen der WHO-Studie „Global Burden of Disease“ finden sich allein sechs verschiedene psychische Störungen unter den ersten zwanzig Hauptursachen für so genannte DALYs (disability adjusted life years).5 Das Konzept des DALY berücksichtigt dabei nicht nur die Sterblichkeit, sondern erfasst auch die durch eine Krankheit ver- ursachte Beeinträchtigung des normalen, beschwerdefreien Lebens. In westlichen Industrienationen steht die unipolare Depression unter den Hauptursachen der Krankheitslasten der Bevölkerung an erster Stelle. Darüber hinaus stellen psychische Störungen bei einer Reihe von chronischen körperlichen Erkrankungen, wie Diabetes mellitus oder Koronaren Herzerkrankungen, als komorbide Störungen einen wichtigen Risikofaktor für deren Krankheitsverlauf dar. Übrigens existieren für fast alle der zwanzig Erkrankungen mit der größten Krankheitslast — auch über die psychischen Störungen im engeren Sinne hinaus — klinisch-psychologische bzw. verhaltensmedizinische Interventionen, die sich zumindest als adjunktive Indikationen als effektiv erwiesen haben. Auch die Daten der Kostenträger in Deutschland weisen auf die hohe Bedeutung von psychischen Störungen hin. Beispielsweise weisen die Gesundheitsreporte 2005 sowohl der DAK wie auch der BKK die psychischen Störungen bei den Arbeitsunfähigkeitszeiten als die vierhäufigste Diagnosegruppe aus, die in den letzten Jahren entgegen dem allgemeinen Trend unter allen Erkrankungsgruppen am stärksten zugenommen haben. Dabei zeichnen sich psychische Störungen durch besonders lange Krankheitszeiten pro Fall aus. Die Krankenversicherung 5 ? 07 PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN Im Bundesgesundheitssurvey ist das Vorhandensein einer psychischen Störung im letzten Jahr mit einer Verdopplung der selbstberichteten Ausfalltage (breiter definiert als AU-Tage) assoziiert (M=19,8 Tage vs. M=9,9 Tage bei Personen ohne Lifetimediagnose einer psychischen Störungen). Dagegen weisen Personen mit einer Lifetime-Diagnose einer psychischen Störung, die im Untersuchungszeitraum remittiert war, im Vergleich zu Personen ohne eine psychische Erkrankung in der Vorgeschichte keine Unterschiede hinsichtlich der Ausfalltage im letzten Jahr (M = 9,7 Tage). Auch bei der Berentung wegen Erwerbsminderung kommt den psychischen Störungen eine herausgehobene Bedeutung zu. Nach den Statistiken der Deutschen Rentenversicherung entfiel im Jahr 2005 knapp ein Drittel aller Berentungen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit auf die Gruppe der psychischen Erkrankungen (gegenüber 15 % in 1993). Dabei liegt der Anteil bei Frauen höher als bei Männer (38 % vs. 28 %). Seit 2003 sind jedoch auch bei Männern die psychischen Erkrankungen die Hauptursache für Berentungen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Diese Veränderungen in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren sind maßgeblich auf die starke Abnahme der vorzeitigen Berentungen aufgrund muskeloskelettaler Erkrankungen und anderer somatischer Krankheiten zurückzuführen. Die absolute Zahl der Berentungen wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bei psychischen Erkrankungen ist in diesem Zeitraum weitgehend konstant geblieben. Die Krankenversicherung 5 ? 07 Psychische Störungen — eine Epidemie des 21. Jahrhunderts? Aufgrund der hohen Prävalenzraten psychischer Störungen in aktuellen epidemiologischen Untersuchungen wird häufig die Frage aufgeworfen, ob psychische Störungen in Deutschland und weltweit über die letzten ein bis zwei Jahrzehnte rapide zugenommen haben. Die erforderlichen wiederholten epidemiologischen Surveys, die in entsprechenden zeitlichen Abständen in derselben Population durchgeführt wurden, liegen hierzu bislang nur aus dem angloamerikanischen Raum vor. Aus den Ergebnissen dieser Surveys lassen sich bislang keine Hinweise auf eine dramatische Zunahme psychischer Störungen ableiten.6 Auch Kohortenanalysen zum Bundesgesundheitssurvey, welche das Lebenszeitrisiko für psychische Erkrankungen und das Alter bei Ersterkrankung zwischen den verschiedenen Alterskohorten vergleichen, geben keine Hinweise auf eine epidemische Zunahme. Sie deuten allenfalls auf eine leichte Zunahme psychischer Störungen, insbesondere bei den substanzbezogenen Störungen, in den jüngeren Kohorten hin. Auch eine aktuelle Metaanalyse zur Entwicklung der Prävalenz depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen über einen Zeitraum von dreißig Jahren fand keine Hinweise auf eine relevante Zunahme der Erkrankungshäufigkeit.7 In Anbetracht der hohen Prävalenzraten psychischer Störungen und den damit verbundenen enormen Krankheitslasten sind jedoch die Herausforderungen an die Gesundheitsversorgung und die Gesundheitspolitik auch ohne eine weitere deutliche Zunahme der Erkrankungshäufigkeiten enorm. Anmerkungen 1 Jacobi, F., Wittchen, H.-U., Hölting, C., Höfler, Müller, N., M., & Pfister, H. & Lieb, R. (2004). Prevalence, comorbidity and correlates of mental disorders in the general population: Results from the German Health Interview and Examination Survey (GHS). Psychological Medicine, 34, S. 597–611. 2 Wittchen, H.-U. & Jacobi, F. (2005). Size and Burden of Mental Disorders in Europe – A critical review and appraisal of 27 studies. European Neuropsychopharmacology, 15 (4), S. 357-376. 3 Ihle, W. & Esser, G. (2002). Epidemiologie psychischer Störungen im Kindesund Jugendalter: Prävalenz, Verlauf, Komorbidität und Geschlechterunterschiede. Psychologische Rundschau, 53(4), S.159–169. 4 Ravens-Sieberer, U., Wille, N., Bettge, S. & Erhart, M. (2006). Modul Psychische Gesundheit (Bella-Studie), Vortrag auf dem Symposium des Robert KochInstituts„Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Erste Ergebnisse“ am 25. September in Berlin. 5 Üstün, T. B., Ayuso-Mateos, J.-L., Chatterji, S., Mathers, C., Murray, C. J. L. (2004). Global burden of depressive disorders in the year 2000. British Journal of Psychiatry, 184, S. 386–392. 6 Kessler, R. C., Chiu, W. T., Demler, O. & Walters, E. E. (2005). Prevalence, Severity, and Comorbidity of 12-Months DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry, 62, S. 617–627. 7 Costello, E. J., Erkanli, A., Angold, A. (2006). Is there an epidemic of child or adolescent depression? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47 (12), S. 1263–1271.