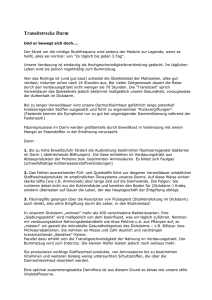Zusammenhänge zwischen Verweildauer und Behandlungserfolg in
Werbung

Aus der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychosomatik Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau Zusammenhänge zwischen Verweildauer und Behandlungserfolg in stationärer und teilstationärer Psychotherapie INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Medizinischen Doktorgrades der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau vorgelegt 2010 von Katharina Anna Schmieder geboren in Filderstadt Dekan: Professor Dr. med. Christoph Peters Erster Gutachter: Professor Dr. med. Carl-Eduard Scheidt Zweiter Gutachter: Professor Dr. med. Dr. phil. Jürgen Bengel Jahr der Promotion: 2010 Danksagung Ich danke meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Scheidt für die Überlassung des Themas, für die freundliche Unterstützung und dafür, dass er sich oftmals auch sehr spontan Zeit für ein Gespräch genommen hat. Mein Dank geht ebenso an Herrn Prof. Dr. Bengel für die Übernahme des Zweitgutachtens. Ich möchte auch Laurence Reuter und Petra Sitta danken für die Einführung in den umfangreichen Datensatz, außerdem den Patienten für ihre Bereitschaft die Fragebögen auszufüllen und an Katamnesegesprächen teilzunehmen. Bei Joachim Marnitz möchte mich mich für die kompetente Beratung in Computerfragen bedanken. Ein besonders großer Dank gilt meinem Bruder Johannes Schmieder, welcher mich in jeder Hinsicht bei meinem Projekt Doktorarbeit unterstützt und beraten hat, sowie meinen Eltern, denen ich mein Studium und noch viel mehr verdanke. Genauso möchte ich Alexander Ritter für das Korrekturlesen aber vor allem für die sehr geduldige moralische Unterstützung und Motivation danken. 3 Zusammenfassung In der vorliegenden Arbeit wird, nach ausführlichen theoretischen Vorüberlegungen, durch empirische Methoden, der Zusammenhang zwischen Verweildauer und Therapieerfolg, im Rahmen stationärer und teilstationärer Psychotherapie untersucht. Die Fragen dabei sind: Welche Patientenvariablen beeinflussen die Verweildauer? Welche beeinflussen das Therapieergebnis? Beeinflusst der Faktor Verweildauer das Ergebnis und wenn ja, wie stark? Dazu wird ein Datensatz der Universitätsklinik Freiburg und der Thure-von-Uexküll-Klinik Freiburg verwendet. Die Datenerhebung erfolgte in den Jahren 2005-2007. Die Patienten wurden zu vier Messzeitpunkten (Aufnahme, Entlassung, 3-Monats-Katamnese, 1-Jahres-Katamnese) mit Hilfe von Fragebögen zu ihren Symptomen befragt. Die Stichprobe mit 604 Patienten entspricht, mit Überwiegen des weiblichen Geschlechts und einem Altersdurchschnitt im mittleren Lebensalter (39 Jahre), einer typischen Stichprobe einer psychosomatischen Klinik. Zur Erfolgsmessung werden Effektstärken berechnet. Als Hauptinstrumente werden, neben anderen Fragebögen, der BDI und der SCL-90-R verwendet. Als statistische Methoden kommen der chi²-Test und der Fisher's Exakt-Test zur Überprüfung von Hypothesen zum Einsatz. Regressionsanalysen dienen dazu, Einflussfaktoren für jeweils Verweildauer und Therapieerfolg zu bestimmten. Es zeigt sich, dass ein hohes Lebensalter und ein Ehepartner einen signifikant verkürzenden Einfluss auf die Verweildauer haben. Eine Essstörung, große Behandlungsmotivation und eine hohe Depressivität bei Beginn der Therapie aber auch eine private Gesundheitsversicherung sind signifikant mit einer längeren Therapiedauer verbunden. Signifikanten positiven Einfluss auf die BDI-Effektstärke haben Kinder, ein hohe Depressivität bei Aufnahme und die Diagnose einer Angststörung. Einen negativen Einfluss zeigen u.a. die Variablen teil-/stationäre Vorbehandlung und die Diagnose einer Somatoformen Störung. Für die SCL-Effektstärke zeigen sich eine große Behandlungsmotivation, sowie eine hohe psychische Belastung bei Aufnahme als positive Einflussfaktoren. Negative Einflüsse sind das Alter, und eine deutliche körperliche Belastung. Die Verweildauer zeigt sich für die BDI-Effektstärke, mit und ohne Kontrolle für weitere Variablen, als hochsignifikanter positiver Prädiktor. Zum Zeitpunkt der 1-Jahreskatamnese sieht man immer noch den signifikanten positiven Einfluss der Verweildauer auf die BDI-Effektstärke. Für die SCLEffektstärke ließ sich kein Zusammenhang herstellen. Die Verweildauer stellt weiterhin für die Erfolgsmaße GAF-Effektstärke und State-Effekstärke einen positiven Einflussfaktor dar. In verschiedenen Diagnosegruppen lässt sich tendenziell ein unterschiedlich großer Einfluss der Verweildauer auf das Ergebnis zeigen. 4 Inhaltsverzeichnis Danksagung….....................................................................................................................................3 Zusammenfassung..............................................................................................................................4 Inhaltsverzeichnis...............................................................................................................................5 1. Einleitung........................................................................................................................................8 2. Theorie...........................................................................................................................................10 2.1. Behandlungsdauer................................................................................................................10 2.1.1. Definition der Verweildauer/ Behandlungsdauer und Empfehlungen der Leitlinien......10 2.1.2. Allgemeine Entwicklung der stationären Verweildauer .................................................11 2.1.3. Theoretischer Hintergrund zum Zustandekommen der Therapiedauer in einer psychosomatischen Klinik........................................................................................................13 2.1.4. Einflussfaktoren auf die Behandlungsdauer....................................................................15 2.1.4.1. Krankheitsbezogene Faktoren.................................................................................15 2.1.4.2. Soziodemographische Variablen.............................................................................17 2.1.4.3. Soziale Faktoren......................................................................................................18 2.1.4.4. Klinikimmanente Faktoren......................................................................................19 2.1.4.5. Personenbezogene Variablen...................................................................................20 2.1.4.6. Faktoren aus dem Behandlungsprozess...................................................................20 2.1.4.7. Ökonomische und versicherungsrechtliche Faktoren..............................................21 2.1.4.8. Disziplinarische Ereignisse und interkurrente Vorkommnisse ...............................21 2.1.4.9. Weitere Einflussfaktoren.........................................................................................21 2.2. Therapieerfolg.......................................................................................................................22 2.2.1. Generic Model of Psychotherapy....................................................................................22 2.2.2. Therapieergebnisforschung.............................................................................................24 2.2.3. Efficacy versus Effectiveness..........................................................................................29 2.2.4. Therapieprozessforschung...............................................................................................30 2.2.4.1. Therapie/Therapeutenbezogene Faktoren ..............................................................31 2.2.4.1.1. Therapieschule (spezifische Wirkfaktoren).....................................................31 5 2.2.4.1.2. Common Factors (unspezifische Wirkfaktoren)..............................................34 2.2.4.2. Extratherapeutische Faktoren..................................................................................40 2.2.4.2.1. Soziodemografische Patientenvariablen..........................................................40 2.2.4.2.2. Krankheitsbezogene Patientenvariablen..........................................................41 2.2.4.2.3. Placebo-Effekt / Erwartungen..........................................................................44 2.2.4.2.4. Psychopharmakologische Einflüsse ................................................................45 2.3. Zusammenhang zwischen Behandlungsdauer und Therapieerfolg.................................45 2.3.1. Zusammenfassung der aktuellen Literatur......................................................................45 2.3.2. Das Dosis-Effekt-Modell................................................................................................49 2.3.3. Das Phasenmodell...........................................................................................................51 2.4. Behandlung in einer psychosomatischen Klinik................................................................54 3. Empirische Untersuchung...........................................................................................................55 3.1. Fragestellung und Zielsetzung dieser Arbeit......................................................................55 3.2. Methodik................................................................................................................................56 3.2.1. Untersuchungsdesign...........................................................................................................56 3.2.2. Datenerhebung und Zusammenstellung der Stichprobe.................................................57 3.2.3. Erhebungsinstrumente.....................................................................................................58 3.2.4. Operationalisierung des Therapieerfolgs .......................................................................63 3.3. Statistische Auswertung.......................................................................................................64 3.3.1. Deskriptive Statistik........................................................................................................64 3.3.2. Hypothesentestung / T-Test.............................................................................................64 3.3.3. Lineare Regression..........................................................................................................66 3.3.4. Umgang mit fehlenden Werten.......................................................................................68 3.4. Ergebnisse..............................................................................................................................69 3.4.1. Beschreibung der Stichprobe / Behandlungsergebnisse.................................................69 3.4.2. Zur Fragestellung 1.........................................................................................................80 3.4.3. Zur Fragestellung 2.........................................................................................................80 3.4.4. Zur Fragestellung 3.........................................................................................................82 3.4.5. Zur Fragestellung 4.........................................................................................................83 3.4.6. Zur Fragestellung 5.........................................................................................................85 3.4.6.1. Behandlungserfolg zum Zeitpunkt der Entlassung.................................................85 3.4.6.2. Der Einfluss der Verweildauer auf weitere Erfolgsmaße........................................89 3.4.6.3. Behandlungserfolg zum Zeitpunkt der Katamnesen...............................................90 6 3.4.6.4. Unterschiede des Einflusses der Verweildauer in verschiedenen Diagnosegruppen..................................................................................................................94 3.5. Diskussion..............................................................................................................................95 3.5.1. Diskussion der Stichprobe..............................................................................................95 3.5.2. Diskussion der Methode..................................................................................................96 3.5.3. Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse........................................................99 3.5.3.1. Zusammenhänge zwischen Verweildauer und Patientenvariablen..........................99 3.5.3.2. Zusammenhänge zwischen Therapieerfolg und Patientenvariablen.....................102 3.5.3.3. Zusammenhang zwischen Verweildauer und Therapieerfolg................................109 3.5.3.4. Fazit und Ausblick.................................................................................................112 Tabellenverzeichnis.........................................................................................................................113 Abbildungsverzeichnis..............................................................................................….................114 Literaturverzeichnis.......................................................................................................................115 Anhang ...........................................................................................................................................133 7 1. Einleitung Psychische Erkrankungen sind in Deutschland und Europa häufig und stellen ein ernstzunehmendes Problem in der Bevölkerung dar. Wie neuere Erhebungen zeigen, durchleben in Deutschland 37 % der Frauen und 25 % der Männer innerhalb eines Jahres eine psychische Störung (RKI, 2008). Man rechnet damit, dass bis zum Jahr 2020 Depressionen in den Industriestaaten die zweit häufigste Ursache von allen Erkrankungen sein werden (Grünbuch der EU, 2005). Die Betroffenen leiden oft lange Zeit psychisch und körperlich, bis ihre Erkrankung erkannt wird und nur 10% von ihnen erhalten eine, im weitesten Sinne, adäquate Therapie nach modernen wissenschaftlichen Kriterien (Wittchen und Jacobi, 2001). Neben den immensen Folgen für die Einzelperson, welche Verlust der Arbeitsfähigkeit oder die soziale Isolation bedeuten können, entstehen wirtschaftliche Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft. Psychische Krankheiten trugen in den letzten Jahren in hohem Ausmaß zu Krankschreibungen und Frühberentungen bei. Laut Angaben des statistischen Bundesamtes entstanden dadurch in Deutschland jährlich Kosten von knapp 23 Milliarden Euro (RKI, 2008). Die Behandlung psychischer Krankheiten ist aufwändig und teuer, doch auch die Nicht- oder Fehl-Behandlung kostet. Folgeerkrankungen psychischer und körperlicher Natur und deren Therapien, so wie der Arbeitskraftausfall bei chronischer Erkrankung machen sich in hohen Summen bemerkbar. Die Ressourcen im deutschen Gesundheitssystem sind knapp. Die steigenden Kosten durch wachsende Nachfrage nach medizinischer Leistung und neue Entwicklungen im Bereich der modernen Medizin, zwingen Krankenkassen und Kliniken ihre Ausgaben sinnvoll zu rationieren. So muss auch im Bereich der Psychiatrie und Psychosomatik über Kosteneinsparung nachgedacht werden. Da die Psychiatrie bisher von der DRG/Fallpauschalen-Regelung ausgenommen ist, konzentrieren sich Kostenträger auf die Möglichkeit zur Kosteneinsparung durch Kürzung der Verweildauer (Richter, 2001). Die Streitfrage, wie sich diese Entwicklung auf die Qualität der medizinischen Versorgung auswirkt, ist umso aktueller. Würde zum Beispiel nach kürzeren Verweildauern die Zahl der schlechten Behandlungsergebnisse steigen und dadurch zu einer vermehrten Wiedereinweisungsrate führen, hätte man den gewünschten Effekt der Kostenersparnis nicht erreicht. Zwar verbessert sich die therapeutische Versorgung im ambulanten Bereich, doch ist nicht klar, in wie weit sich stationäre Therapiemaßnahmen dadurch ersetzen lassen. 8 Zu diesem Thema möchte ich mit meiner Arbeit Beitrag leisten und den Zusammenhang zwischen Verweildauer und Therapieerfolg von stationären Patienten in einer psychosomatischen Klinik untersuchen. Ich werde in einem ersten Teil meiner Arbeit, theoretische Überlegungen als Voraussetzung für eine empirische Untersuchung anstellen. Dabei werde ich die Schwierigkeiten der empirischen Forschung im allgemeinen und im speziellen für dieses Thema aufzeigen. Ich werde als mögliche Methode die Regressionsanalyse beschreiben, durch welche sich Einflussfaktoren auf die Verweildauer oder auch auf den Therapieerfolg bestimmen und quantifizieren lassen können. Diese Methode wird im empirischen Teil angewendet. Verweildauer und Therapieerfolg sollen jeweils im einzelnen genauer betrachtet werden, um Zusammenhänge, welche anschließend beschrieben werden, besser verstehen und einordnen zu können. Es existieren bereits zahlreiche Untersuchungen zur Verweildauer und zur Frage, wodurch sie beeinflusst wird. Die Autoren können jedoch zum Teil nur vage Aussagen machen, nicht selten widersprechen sich die Ergebnisse ihrer Studien. Oft gehen sie nach anderen Methoden vor oder setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Das vermindert die Vergleichbarkeit ihrer Ergebnisse aber folgt aus der Komplexität dieser Fragestellung. Ich möchte die bisher identifizierten Einflussfaktoren vorstellen und damit einen Überblick über die vorhandene Literatur geben. Auch zum Therapieerfolg haben sich, wenig überraschend, schon viele Autoren Gedanken gemacht. Bisher besteht noch keine einheitliche Definition für Therapieerfolg und es wurden vielfältige Methoden für seine Messung entwickelt. Diese Messmethoden und auch unterschiedliche Forschungsansätze, wie die Therapieergebnis- und die Therapieprozess-Forschung sollen in meiner Arbeit vorgestellt werden. Es gibt auch bereits interessante Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Verweildauer und Therapieerfolg. Es wurden zwei Modelle entwickelt, das Phasenmodell und das Dosis-EffektModell, welche die Beziehung genauer beschreiben. Insgesamt lässt sich eine eindeutige Tendenz für einen positiven Zusammenhang erkennen. Trotzdem besteht hier noch Bedarf nach genaueren und ausführlicheren Untersuchungen. Anschließend werde ich im zweiten, empirischen Teil meiner Arbeit, anhand von Daten der Universitätsklinik Freiburg und der Thure-von-Uexküll-Klinik Freiburg, den Einfluss der 9 Verweildauer auf den Therapieerfolg überprüfen. Es handelt sich um die Daten von 604 Patienten, welche in einem Zeitrahmen von drei Jahren behandelt wurden. Mit Vierfeldertafeln werden bereits erste Zusammenhänge zwischen Patientenvariablen und Verweildauer und Patientenvariablen und Therapieerfolg dargestellt. In einem zweiten Schritt sollen verschiedene Regressionsanalysen, unter Verwendung unterschiedlicher Erfolgsmaße und verschiedener Messzeitpunkte, genauere Ergebnisse bringen. Zum Abschluss werden die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert. 2. Theorie 2.1. Behandlungsdauer 2.1.1. Definition der Verweildauer/ Behandlungsdauer und Empfehlungen der Leitlinien Verweildauer: Man versteht darunter die Anzahl der Tage, die ein Patient stationär im Krankenhaus verbringt. Aufnahme- und Entlassungstag zählen zusammen als ein Tag (Bundespflegesatzverordnung, 1994). Behandlungsdauer: Sie unterscheidet sich von der Verweildauer nur in dem einem Punkt: nach einer Probeentlassung wird der Patient, bei Wiederaufnahme als der selbe Fall gezählt. Die Behandlungsdauer ist somit immer gleich lang oder länger als die Verweildauer (Bundespflegesatzverordnung, 1994). Empfehlungen zur Behandlungsdauer: Die AWMF-Leitlinien (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften) empfehlen weder für ambulante noch für stationäre Psychotherapie Richtwerte für die Behandlungsdauer: „Eindeutige Kriterien für die Behandlungsdauer sind angesichts der komplexen Ätiologie und der vielfältigen Interaktionen der Erkrankung mit körperlichen, innerpsychischen und sozialen Faktoren bisher nicht verlässlich entwickelt worden. Kriterien für die Verkürzung oder Verlängerung einer Therapie ergeben sich zudem oftmals erst im Rahmen des therapeutischen Prozesses“ (AWMF – Leitlinien, 2002 ). 10 Auch die S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitline gibt keine Empfehlungen für die Behandlungsdauer, weder für die ambulante, noch für die stationäre Therapie (S3-Leitlinie/NVL 2009). 2.1.2. Allgemeine Entwicklung der stationären Verweildauer Die Verweildauer stationärer Therapien in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken hat sich über die Jahre zunehmend verkürzt. Patienten die früher Monate bis Jahre, manchmal sogar lebenslang, in stationären Einrichtungen verbracht haben, verweilen heute im Durchschnitt wenige Monate (Richter, 2001). 1975 betrug die Verweildauer in allen deutschen psychiatrischen Kliniken bei 67,3 % der Patienten über ein Jahr und bei 31 % der Patienten über zehn Jahre (Lage der Psychiatrie Bonn, 1975). Im Jahr 2004, betrug hingegen die durchschnittliche Verweildauer in Kliniken für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin nur noch 41,4 Tage und in Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie sogar 24,7 Tage. Tageskliniken haben eine mittlere Verweildauer von 7 bis 12 Wochen, 35 – 60 Pflegetagen entsprechend (RKI, 2008). Die mittlere Verweildauer in psychiatrischen-psychotherapeutischen Fachkliniken und Abteilungen in Deutschland verkürzte sich, innerhalb von zehn Jahren von 1994 bis 2004, um 40 % (Spießl, 2006). Es gab vielfältige Ursachen für diese drastische Verkürzung der Behandlungsdauer. Ein Ziel bestand darin, langfristig hospitalisierte Patienten, die für Jahre aus ihrem normalem Umfeld entfernt waren sozial und beruflich zu rehabilitieren (RKI, 2008). Zudem kam es zu einer grundlegenden Veränderung der Entlassungs-Ziele für die Patienten (Bassler et al., 1995). Wo es anfangs um die Entwicklung der Persönlichkeit sowie um den Aufbau einer gesunden psychologischen Struktur ging, stehen heute Reduktion der Symptome, Verbesserung der Medikation und Vorbereitung zum Übergang in die ambulante Versorgung im Vordergrund. Der aktuellste Grund für diese Entwicklung, ist der zwingende Druck zur Kosteneinsparung. Gleichzeitig erfolgte zum Ausgleich der Ausbau von teilstationären und ambulanten Angeboten um die psychiatrische Grundversorgung zu sichern. Auch in anderen Fachabteilungen kam es zu Verkürzungen der Verweildauer. Insgesamt nahm die Verweildauer in deutschen Krankenhäusern von 1991 bis 2007 um knapp 40 % ab. Die durchschnittliche Verweildauer lag 2007 bei 8,3 Tagen (statistisches Bundesamt, 2007). Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich in den USA und in anderen europäischen Ländern, wie den 11 Niederlanden, Norwegen, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Spanien mit einer durchschnittlichen Behandlungsdauer von 5,0 bis 8,5 Tagen. Russland hatte 2006 noch eine durchschnittliche Verweildauer von 13,6 Tagen, Japan von 34,7 Tagen (statistisches Bundesamt, 2007). Da die Zahl der Krankenhausbetten von der unterschiedlichen Bedeutung und Funktion des ambulanten und stationären Sektors in den verschiedenen Ländern maßgeblich abhängt, ist ein internationaler Vergleich problematisch. Generell lässt sich jedoch feststellen, dass das Niveau der stationären Versorgung in Deutschland ausgesprochen hoch ist, in Deutschland sind die Liegezeiten, abgesehen von der Schweiz im europäischen Vergleich, nach wie vor am längsten (RKI, 2006). Unterschiede bestehen auch zwischen den verschiedenen Fachabteilungen der Kliniken, wie die folgende Tabelle zeigt. Object 17 Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2007) 12 2.1.3. Theoretischer Hintergrund zum Zustandekommen der Therapiedauer in einer psychosomatischen Klinik In Bezug auf die beschriebenen Veränderungen der letzten Jahrzehnte, ist es interessant zu verstehen, was die Behandlungsdauer bestimmt und durch welche Faktoren sie beeinflusst wird. Es ist zudem eine Voraussetzung, um darüber nachzudenken, welche Zusammenhänge zwischen der Behandlungsdauer und dem Therapieerfolg bestehen und welche Folgen die abnehmenden Verweildauern in den Kliniken haben. Es lohnt sich also, das komplexe Entstehen der Therapiedauer einmal genau zu betrachten. Da es keine festen Regeln oder Vorgaben der Kostenträger gibt, auch keine Empfehlung der Leitlinien, ist die Therapiedauer der einzelnen Patienten und der verschiedenen Kliniken sehr unterschiedlich und lässt sich schwer vorhersagen. Für ein besseres Verständnis, möchte ich eine Gleichung aufstellen, welche die Therapiedauer beschreibt. Diese steht auf der linken Seite. Auf der rechten Seite stehen die Faktoren, welche Einfluss auf sie nehmen. Es ist die Gleichung einer Regressionsanalyse. y = β1 X (Arzt/Klinikbereitschaft) + β2 X (Patientbereitschaft) + β3 X (Kostenträger) + ε y = Therapiedauer x = Einflussvariable β = Regressionskoeffizient: gibt die Größe des Effekts der Variable wider ε = Residuum: Rest der Dauer, welcher sich nicht durch die Gleichung erklären lässt Vereinfacht kann man annehmen, die Therapie dauert maximal so lange, wie jede der beiden beteiligten Parteien, Arzt/Klinik und Patient, bereit ist fortzufahren. Sobald eine der beiden die Therapie nicht mehr als sinnvoll erachtet, wird das Therapieverhältnis beendet. Dazu kommen die äußeren Einschränkungen, wie Kostenträger, Arbeitgeber usw. Nun gibt es Variablen, welche die Motivation/Bereitschaft des Arztes/Klinik zur Therapie beeinflussen, das heißt, die Variable “Arzt/Klinik-Bereitschaft“ setzt sich zusammen aus anderen Variablen. Dazu gehören zum Beispiel: der vom Arzt erlebte Schweregrad und Leidensdruck des Patienten, eventuell der Familie des Patienten, welche den Arzt motivieren, Sympathie für den Patienten etc.. Außerdem spielen organisatorische Aspekte, wie das Konzept der Klinik, die Zahl der freien Betten, der Personalschlüssel und anderes, eine Rolle. Variablen, welche die Bereitschaft des Patienten bestimmen, sind: Behandlungsmotivation (Leidensdruck oder aber sekundärer 13 Krankheitsgewinn), Schwere der Erkrankung, Kinder, Familienstand, berufliche Situation etc. Mit einem idealen Datensatz, mit allen denkbaren, erklärenden Variablen und einer großen Patientenzahl, ließe sich, durch dieses vereinfachte Modell, mit einer Regressionsanalyse der Einfluss einer jeden Variable heraus rechnen und das Zustandekommen der Behandlungsdauer ließe sich für einen bestimmten Patienten genau erklären. Leider verhält es sich in der Realität komplexer und man stößt auf viele methodische Schwierigkeiten. Einige Variablen nehmen Einfluss auf Arzt und Patienten gleichzeitig. Eine Variable kann die Bereitschaft des Arztes erhöhen und gleichzeitig die Bereitschaft des Patienten vermindern. Ein Beispiel wäre ein schwieriger Arbeitgeber, welcher den Patienten unter Druck setzt, zurück zur Arbeit zu kommen und seine Therapie zu beenden. Dies könnte ein Grund für den Therapeuten sein, dem Patienten durch eine längere Therapie mehr Stabilität zu geben, um sich gegen solchen Druck von Außen besser zur Wehr setzen zu können, während es für den Patienten einen Grund darstellen könnte, die Therapie zu verkürzen oder gar vorzeitig abzubrechen. Von dieser Art lassen sich viele Beispiele finden. Weitere Schwierigkeiten sind Einflussfaktoren, welche sich bei verschiedenen Patienten unterschiedlich auswirken. Zum Beispiel der Schweregrad einer Erkrankung. Eine schwere Depression erfordert eine längere Therapie um eine Veränderung zu schaffen. Doch nicht jeder Patient hat deshalb eine erhöhte Bereitschaft für eine längere Therapie. Gerade Patienten mit schwerer Depression bringen manchmal nicht die Fähigkeit mit, sich einer anstrengenden und tief greifenden Veränderung durch eine lange Therapie zu stellen (Allen, 1985). Folglich lässt sich nicht generalisieren, inwiefern sich die Variable Schweregrad der Erkrankung auf die Therapiedauer auswirkt. Man kann nur die Tendenz herausfinden, indem man viele Patienten in solch eine Regressionsanalyse aufnimmt. Da in der praktischen Forschung leider keine perfekten Datensätze existieren, welche alle Variablen enthalten, von denen man sich vorstellen kann, dass sie Einfluss auf die Therapiedauer nehmen, die Fallzahlen oft klein sind und es bestimmt viele Einflüsse gibt, die noch gar nicht als solche identifiziert wurden, sind die Studienergebnisse in der vorhandenen Literatur oft unbefriedigend. Meist kann nur ein kleiner Teil der Varianz der Behandlungsdauer aufgeklärt werden. Einige Studien widersprechen sich sogar in ihren Aussagen. Um das oben beschriebene Modell zum Zustandekommen der Behandlungsdauer mit seinen Einflussvariablen zu vervollständigen, müssen zuerst Einflüsse festgestellt werde, indem theoretisch 14 über Zusammenhänge nachgedacht wird. Anschließend kann man statistisch testen, ob es z.B. Korrelationen gibt oder ob sich der Effekt in einer Regressionsanalyse bestätigt. Nach diesen theoretischen Überlegungen möchte ich einen Überblick über die vorhandene Literatur zu diesem Thema geben. 2.1.4. Einflussfaktoren auf die Behandlungsdauer Da in den im Folgenden dargestellten Studien oft verschiedene statistische Methoden angewandt wurden, unterschiedliche Zusammensetzungen der Stichproben und Patientenzahlen vorlagen und von Klinik zu Klinik die Behandlungssettings und Behandlungsziele variierten, lassen sich die Studien generell schlecht vergleichen. Ich beschränke mich deshalb darauf einen Überblick über die Ergebnisse zu geben. Zielke et al. (1997) stellten in einer Überblicksarbeit eine umfassende Analyse der Einflussfaktoren vor, welche sowohl theoretisch als auch empirisch nachgewiesen wurden. Ich schließe mich ihrer Einteilung an und stelle zu den einzelnen Punkten Teile der vorhandenen Literatur vor. 2.1.4.1. Krankheitsbezogene Faktoren Watt und Buglass (1966) zeigten, wie später auch andere Autoren, einen signifikanten Zusammenhang zwischen Diagnose und Aufenthaltsdauer in der Klinik (Barnow et al., 1997; von Heymann et al., 2003; Creed et al., 1997; Allen, 1985; Hermann et al., 2007) In einer Studie, die anhand von Patientendaten aus dem Bereich Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin durchgeführt wurde, hatten Patienten mit Zwangsstörungen mit durchschnittlich 71 Tagen die längste Behandlungsdauer (von Heymann et al., 2003). Darauf folgten Patienten mit Persönlichkeitsstörungen mit durchschnittlich 69 Tagen. Patienten mit einer depressiven Episode hatten im Mittel eine Aufenthaltsdauer von nur 44 Tagen. Richter (2001) stellte dagegen für das benachbarte Gebiet Psychiatrie fest, dass einzelne Diagnosen bzw. Diagnosegruppen nur wenig zur Aufklärung der Varianz der Verweildauer beitragen. In seiner Übersicht liegt die Varianzaufklärung der meisten untersuchten Studien zwischen 3 und 10 %. Viele Autoren wiesen auf die Korrelation zwischen Schweregrad der Erkrankung und 15 Aufenthaltsdauer in der Klinik hin (Barnow et al., 1997; Richter, 2001; Creed et al.,1997; von Heymann et al., 2003; Sitta et al., 2006; Hermann et al., 2007). Hermann et al. (2007) konnten zeigen, dass Patienten mit schwerer Erkrankung weniger rasch und weniger stark auf die Behandlung ansprechen. Um den gleichen Behandlungseffekt zu erreichen dauerte es dreimal länger, als bei Patienten mit milderer Erkrankung. Andere Autoren fanden in ihrer Untersuchung jedoch keine Korrelation zwischen Schwergrad der Störung und Behandlungsdauer (Bassler et al., 1995). Des weiteren spielt die Chronizität der Erkrankung eine Rolle (von Heymann et al., 2003). Zielke & Sturm (1994) beschreiben hier ein „chronisches Krankheitsverhalten“, charakterisiert durch Verlust an Selbsthilfemöglichkeiten, Vertrauen zu sich selbst und verstärktes Schonverhalten, welches zu einem erschwerten Ansprechen auf die Therapie und somit zu einer verlängerten Behandlungsdauer führen kann. Ähnliches beschrieben Klose et al. (2006). Sie wiesen auf, dass Patienten mit nervenärztlicher/psychotherapeutischer Vorbehandlung eine deutlich längere stationäre Behandlungsdauer hatten als Patienten ohne Vorbehandlung. Vorangehende Behandlungen würden auf komplexere Krankheitszustände und Chronifizierung der Erkrankung hinweisen, welche für längere Therapiedauern verantwortlich seien. Es besteht auch ein Zusammenhang zwischen psychischer Komorbidität und der Behandlungsdauer. „Mit zunehmender Anzahl psychiatrischer Erkrankungen, verlängert sich die Behandlungszeit nahezu linear. Die Komplexität in der Problemkonstellation führt offensichtlich zu komplexen Behandlungsstrategien mit einem entsprechend höheren Behandlungsaufwand, der sich auch in zeitlicher Perspektive niederschlägt“ (Zielke et al., 1997). Von Heymann et al. (2003) beschreiben die erhöhte Komorbidität als Indikator für einen erhöhten Schweregrad der Erkrankung. Auch Stevens et al. (2001) konnten einen schwachen Einfluss der Komorbidität auf die Behandlungsdauer nachweisen. Schubert et al. (1995) stellten auch den Zusammenhang zwischen physischer Komorbidität und verlängerter Behandlungsdauer bei depressiven stationären Patienten dar. Dem widersprachen jedoch die Ergebnisse der Studie von Borgart & Meermann (1999), die keinen Einfluss der somatischen Erkrankungen auf die Behandlungsdauer zeigten. 16 2.1.4.2. Soziodemographische Variablen Das Lebensalter wurde ebenfalls als Prädiktor für die Behandlungsdauer identifiziert (Richter, 2001; Weyerer & Dilling, 1980; Borgart & Meermann, 1999;). In der Regel haben jüngere Patienten kürzere stationäre Aufenthalte. In einer Studie von Barnow et al. (1997) konnte das Alter der Patienten 50 % der Varianz der Behandlungsdauer aufklären. Die Autoren erklären diesen Umstand damit, dass höheres Alter oft mit zunehmender Chronizität und erhöhter physischer Komorbidität einhergeht. Ein gegensätzliches Ergebnis brachte die Untersuchung von Zielke et al. (1997), in welcher sich ebenfalls ein eindrücklicher Alterseffekt zeigte: Jüngere Patienten hatten in allen Diagnosegruppen die längsten Behandlungsdauern. Eine Anzahl an Autoren konnten das Geschlecht als Einflussfaktor feststellen (Barnow et al., 1997; von Heymann et al., 2003; Zielke et al., 1997; Weyerer & Dilling, 1980). Dabei hatten Frauen im Durchschnitt deutlich längere Behandlungsdauern als Männer. Der Grund dafür könnte sein, dass Frauen meist unter schwereren Depressionen leiden als Männer (Barnow et al., 1997). Andere Autoren konnten diesen Zusammenhang in ihren Studien nicht nachweisen (Stevens et al., 2001; Borgart & Meermann, 1999). Ebenfalls einen Einfluss auf die Verweildauer hat die berufliche Situation/berufliche Status des Patienten (Von Heymann et al., 2003; Borgart & Meermann, 1999). So haben Patienten mit verantwortungsvollen Posititonen, wie z.B. Selbstständige mit mittelgroßen Betrieben, tendenziell kürzere Verweildauern als Patienten in Ausbildung oder ungelernte Arbeiter. Interessanterweise zeigten Hausfrauen mitunter die kürzesten Behandlungszeiten, was jedoch durch den sozialen Rahmen, d.h. sowohl durch die Unterstützung, als auch den Druck der Familie erklärbar ist (Borgart & Meermann, 1999). Zielke et al., (1997) konnte im Bildungsniveau seiner Patienten einen deutlichen Prädiktor für die Aufenthaltsdauer in der Klinik feststellen. Mit zunehmend höherem Bildungsabschluss steigt die stationäre Verweildauer. Zum einen mag der Ausbildungsgrad mit anderen behandlungsrelevanten Variablen, wie z.B. Art und Dauer der Erkrankung in Zusammenhang stehen. Zum anderen ist es möglich, dass Patienten mit einem höheren Bildungsniveau weiterreichende Therapieziele anstreben, deren Umsetzung eine längere Behandlungsdauer erforderlich machen. Die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht hat ebenfalls Auswirkung auf die Behandlungsdauer, 17 wie in verschiedenen Studien belegt wurde (Trojan & Doerner, 1978; Weyerer & Dilling, 1980). In der Studie von Weyerer & Dilling (1980), war dieser Einfluss ebenso groß, wie der von Geschlecht und Familienstand. Die Korrelation zwischen der Zugehörigkeit zu einer der oberen Einkommensschichten und einer kürzeren Verweildauer in der Klinik war auffällig. Die Autoren geben zu bedenken, dass Patienten der unteren Einkommensschichten möglicherweise tendenziell an schwereren Erkrankungen leiden, welche längere Aufenthalte notwendig machen. 2.1.4.3. Soziale Faktoren Zielke et al. (1997) konnte einen deutlichen Einfluss der Partnersituation und des Familienstandes auf die Verweildauer zeigen. Verheiratete und mit einem Partner zusammen lebende Patienten hatten kürzere Behandlungszeiten als in Trennung lebende oder geschiedene Patienten. Die längsten Verweildauern hatten ledige Patienten. Einige Autoren konnten mit ihren Studien diesen Zusammenhang bestätigen (von Heymann et al., 2003; Borgart & Meermann, 1999). Eine zufriedene Partnerschaft und die Unterstützung, die der Patient durch sie erfährt, scheinen den Wunsch zu verstärken nach Hause zurückzukehren und die Klinikbehandlung deutlich zu verkürzen (Zielke et al., 1997). Barnow et al. (1997) konnten ebenfalls den Familienstand als wichtigen Einflussfaktor nachweisen (Witwen/Witwer hatten die längsten Behandlungsdauern, Verheiratete die kürzesten Behandlungsdauern), sie zeigten allerdings auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen auf. Bei letzteren ist der Effekt der Verkürzung der Behandlungsdauer durch Ehe kleiner als bei Männern. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass Frauen generell an schwereren Depressionen leiden als Männer. Andererseits spielt auch die schon länger angestellte Überlegung eine Rolle, dass für depressive Frauen die Ehe weniger protektiv zu sein scheint, als für Männer (Gove, 1972). Gleichzeitig tendieren depressive Männer signifikant dazu, ihre Ehe als besser einzuschätzen als depressive Frauen es tun (Crowhter, 1985). In Creeds et al. (1997) Untersuchung zeigten sich zwei Prädiktoren mit der besten Vorhersagekraft für die zu erwartende Behandlungsdauer. Zum einen die Wohnsituation (alleine lebend oder mit Partner/Familie lebend), zum anderen die generellen sozialen Fähigkeiten, welche durch die SBS (Social Behaviour Scale) bestimmt wurden. Ähnliche Ergebnisse erbrachte die Studie von McCrone und Phelan (1994). Cyr und Haley (1983) fanden heraus, dass generell ein Mangel an sozialen Bindungen einen großen Einfluss auf die Verlängerung der Aufenthaltsdauer hat, was sich gut einfügt in die Reihe der oben aufgezählten Studien. 18 Zielke (1997) stellte in seiner Analyse noch folgende Zusammenhänge dar: Die Anzahl und das Alter der Kinder spielt eine Rolle für die Aufenthaltsdauer. So haben Patienten mit Kindern kürzere Behandlungszeiten als Patienten ohne Kinder. Vermutlich spielen auch hier sowohl Verantwortung als auch Unterstützungsmöglichkeiten eine Rolle. Einen ähnlichen Einfluss haben Geschwister und Freunde, welche sich, wenn vorhanden, auf kürzere Aufenthalte auswirken. „Offensichtlich werden im Umgang mit Geschwistern Verhaltensmuster gelernt, wie größere soziale Kompetenzen, Rangverhalten aber auch Fertigkeiten, sich bei Geschwistern gezielte Hilfen zu holen, die insgesamt im Krankheitsfall kürzere Behandlungszeiten erlauben“ (Zielke et al., 1997). Die Familie hat durch ihre Einstellung zur Erkrankung des Patienten und durch ihre Einstellung zur Therapie weiteren Einfluss auf die Länge der Behandlung (Greenley, 1972; Harty et al., 1981) Harty et al. (1981) zeigten, dass eine Familie, die die Behandlung in der Klinik befürwortet, den Aufenthalt signifikant verlängert. 2.1.4.4. Klinikimmanente Faktoren Verschiedene Autoren zeigten deutliches Auseinanderweichen der Behandlungsdauern zwischen den Kliniken (Sitta et al., 2006; von Heymann et al., 2003; Zielke et al., 1997; Allen, 1985). Als Gründe dafür, wurden die verschiedenen Behandlungskonzepte und Ziele genannt. Allen (1985) beschreibt als Ziel einer möglichen idealen Behandlung, welches während eines längeren stationären Aufenthaltes erreicht werden könnte, ein Ziel, das über die bloße Symptomverbesserung hinausgeht, bis hin zu einer anhaltenden Persönlichkeitsveränderung, welche die Vulnerabilität vermindert und symptomatische Episoden erleichtert. Dies führt selbstverständlich zu einer längeren Behandlungsdauer als eine Therapie, die sich als Ziel eine bessere Symptomkontrolle setzt, um den Patienten stabilisiert entlassen zu können. Der Autor zeigt jedoch auch auf, dass ein Patient, welcher gut in das ambulante Therapiesystem eingebunden ist, einen großen Teil der Therapieziele auch dort verwirklichen kann, was wiederum zu einer relativen Verkürzung der stationären Verweildauer führen kann (Allen, 1985). Von Heymann et al. (2003) und Sitta et al. (2006) weisen auf die unterschiedlichen Patientenkollektive der Kliniken hin, welche zu verschieden langen Behandlungsdauern bei Patienten gleicher Diagnosen führen. Sitta et al. (2006) untersuchten in einer Multicenterstudie die unterschiedliche Patientenzusammensetzung in psychiatrisch-psychotherapeutischen Kliniken. Diese unterschieden sich, selbst innerhalb derselben Diagnosegruppe deutlich durch sozio19 demografische Daten, bezüglich der Krankheitsgeschichte und des Schweregrads der depressiven Erkrankung. Dennoch zeigt diese Studie, dass der Einfluss, der sich unterscheidenden Patientenstrukturen auf die Verweildauern im Verhältnis zu anderen Einflüssen, wie Prozess – und Klinikstrukturvariablen gering war. 2.1.4.5. Personenbezogene Variablen Ein weiterer Einflussfaktor, der von mehreren Autoren beschrieben wurde ist die Therapiemotivation (Zielke et al., 1997; von Heymann et al., 2003; Klauer et al., 2007). In Zielkes et al. (1997) Studie wurden Patienten bei Aufnahme durch einen Anamnesefragebogen befragt, wie stark der Wunsch nach einer Behandlung sei. Patienten, die eine geringe Motivation aufwiesen oder gar unfreiwillig aufgenommen wurden, zeigten meistens kurze Behandlungsdauern und neigten häufiger zu Therapieabbrüchen. Motivierte Patienten dagegen bestärken offensichtlich ihre Therapeuten darin, die Therapie zu verlängern, um die Lernfortschritte soweit es geht auszuschöpfen (Zielke et al., 1997). Klauer et al. (2007) bestimmten zwei motivationale Variablen, welche die Patienten bei einer Befragung angaben, als potente Prädiktoren des Abbruchrisikos: subjektiver Leidensdruck und sekundärer Krankheitsgewinn. Noch höhere Vorhersagekraft ergab das klinische Fremdrating durch den Therapeuten, welches Leidensdruck und die subjektive Wahrnehmung der Eignung zur Psychotherapie einschätzt. Eine weitere Studie, die auf die Bedeutung der Behandlungsmotivation hinweist kam von Eisler und Williams (1972). Sie schreiben der Art der Einweisung (Zwangseinweisung versus Freiwillige Aufnahme) eine größere Bedeutung für die Dauer der Behandlung zu. Patienten mit Freiwilliger Aufnahme hatten die durchschnittlich längeren Behandlungsdauern. In der Studie von Stevens et al. (2001) zeigte sich ein Unterschied bezüglich der geschlossenen oder offenen Abteilungen. Patienten, die auf der offenen Abteilung waren hatten längere Verweildauern, obwohl die Schwere ihrer Erkrankung oftmals geringer war. 2.1.4.6. Faktoren aus dem Behandlungsprozess Von Bedeutung für die Therapiedauer ist wohl auch der Einfluss der Patienten-TherapeutenBeziehung (Allen, 1985; Bassler et al., 1995). Ein schlechtes Bündnis zwischen Therapeuten und 20 Patienten führt in Allens (1985) Studie zu verlängerten Behandlungsdauern. Doch die Beziehung kann sich wandeln, der Therapeut kann wechseln oder das Verhältnis kann so schlecht sein, dass es sogar zum vorzeitigen Abbruch des Aufenthaltes führt. 2.1.4.7. Ökonomische und versicherungsrechtliche Faktoren Es ist anzunehmen, dass auch ökonomische Faktoren einen direkten Einfluss auf die einzelne Verweildauer haben. Stevens et al. (2001) zeigten einen Zusammenhang zwischen Krankenkasse und der Länge des stationären Aufenthaltes. Zielke (1997) beschreibt Einflüsse durch Genehmigungs- und Verlängerungsverfahren, Zuzahlungen der Patienten und den generellen Begrenzungsdruck der Kosten- und Leistungsträger. 2.1.4.8. Disziplinarische Ereignisse und interkurrente Vorkommnisse Es gibt verschiedene Gründe für vorzeitiges Abbrechen einer stationären Behandlung. Unter anderem kann der Abbruch unfreiwillig, als Folge einer schwerwiegenden Regelverletzung sein. Dazu gehören beispielsweise Beschaffung von und Selbstversorgung mit Alkohol bei Alkoholsüchtigen oder Essensbeschaffung oder das Horten von Speisen bei Patienten mit Essstörung. Die Ahndung von Regelverletzungen wird in jeder Klinik unterschiedlich streng geführt. Disziplinarischen Vorkommnisse haben deshalb Einfluss auf die Behandlungsdauern der Kliniken. „Ein „härteres Regiment“ führt unmittelbar zu kürzeren Verweildauern und umgekehrt“ (Zielke et al., 1997). Einen weiteren Einfluss haben Lebensereignisse der Patienten während des Klinikaufenthaltes (Allen, 1987; Zielke et al., 1997; Barnow et al., 1997). So kann eine Scheidung, ein Todesfall oder die Geburt eines Enkelkindes die Behandlungsdauer eines Patienten unerwartet verlängern oder auch verkürzen. 2.1.4.9. Weitere Einflussfaktoren Stevens et al. (2001) beschreibt in seiner Untersuchung auch den möglichen Einfluss von Medikation. Er stellt jedoch die Vermutung auf, dass eher die Symptome, für welche die jeweiligen Medikamente verschrieben werden, die Aufenthaltsdauer bestimmten oder beeinflussen. Zum 21 Beispiel, dass schizophrene Patienten zur Milderung ihrer durch Neuroleptika verursachten Nebenwirkungen anticholinerge Antidepressiva erhalten, der Grund für ihre längere Aufenthaltsdauer jedoch eher ihre Erkrankung selbst ist, als die anticholinerge Medikation. Frick et al. (1999) bestätigten in einer Studie diesen Effekt. Anticholinerge Medikation verlängerte die Aufenthaltsdauer, jedoch auch wenn der verlängernde Effekt einer schizophrenen Störung bereits einberechnet wurde. Stevens et al. (2001) zeigten eine durchschnittlich kürzere Verweildauer für Ausländer und Immigranten. Zu vermuten sind kulturelle Unterschiede und sprachliche Schwierigkeiten, welche Kommunikation zwischen Patienten und Therapeut erschweren können. 2.2. Therapieerfolg 2.2.1. Generic Model of Psychotherapy Ähnlich komplex wie mit der Behandlungsdauer verhält es sich mit dem Therapieerfolg. Er wird durch viele Faktoren bedingt, wie z.B. die Eigenschaften des Patienten, des Therapeuten und ihr Zusammenspiel. Auch äußere Einflüsse können sich auf das Therapieergebnis auswirken. Orlinsky, Grawe und Parks (1994) setzten im „Generic Model of Psychotherapy“ verschiedene, durch die Forschung bestätigte Faktoren und hypothetische Einflüsse zueinander in Beziehung. 22 23 In Abbildung 1 sind oben die verschiedenen Einflussfaktoren auf den Therapieprozess dargestellt. Diese werden als Input bezeichnet und umfassen das Behandlungssetting, die Gesellschaft mit ihren Werten und jeweils den persönlichen Hintergrund von Patient und Therapeut. Beide Teilnehmer spielen in ihrem Leben außerhalb der Therapie noch andere Rollen, wie zum Beispiel die eines Ehemannes oder die eines Berufstätigen (im Falle des Patienten). Ereignisse, welche sich außerhalb der Therapie abspielen, nehmen Einfluss auf die Entwicklung in der Therapie. Der Therapieprozess beinhaltet alle Handlungen und Erfahrungen, die in der Therapie zwischen Patient und Therapeut stattfinden. Auch das Leben außerhalb der Therapie ist Teil des Therapieprozesses. Den InputFaktoren stehen die Output-Variablen, in denen sich die Einflüsse des Therapieprozesses bemerkbar machen gegenüber. Dies kann auf psychologischer, somatischer und sozialer Ebene geschehen. Es wird deutlich, dass Psychotherapie ein komplexes Geschehen ist und Therapieergebnisse nicht leicht zu erklären sind. Therapieforschung kann sich mit verschiedenen Fragen beschäftigen und die verschiedenen Aspekte dieses Modells untersuchen (Orlinsky, Grawe und Parks, 1994). Zwei der großen Forschungsrichtungen sind Therapieergebnisforschung und Therapie- prozessforschung. 2.2.2. Therapieergebnisforschung Die Therapieergebnisforschung, auch Outcomeforschung genannt, beschäftigt sich mit der Frage, wie wirksam/erfolgreich einzelne Therapierichtungen sind. Aber: Was ist Therapieerfolg überhaupt? Und wie soll er gemessen werden? Obwohl die Messung der Ergebnisse einer psychotherapeutischen Behandlung mittlerweile von essentieller Bedeutung für die Forschung ist, ist es bisher nicht gelungen einheitliche Standards zu entwickeln. Wünschenswert wäre eine Vereinheitlichung der Kriterien, wie es für die Diagnosestellung von psychischen Krankheiten bereits der Fall ist. Diese werden durch fortlaufende Konsensuskonferenzen der WHO (ICDSchlüssel) und der American Psychiatric Association (DSM) festgelegt. Eine solche Vereinheitlichung wäre nötig, um Resultate der Forschung untereinander vergleichbar zu machen. Angesichts der Forderungen durch die Politik wissenschaftlich anerkannte, empirisch gestützte Methoden anzuwenden und Qualitätssicherung zu betreiben, gewinnt die Notwendigkeit vergleichbarer Ergebnisse an Bedeutung (Michalak et al., 2003). 24 Klußmann (2000) zeigt folgende Schwierigkeiten bei der Erfolgsbeurteilung von Psychotherapie auf: • Der Begriff „Psychotherapie“ wird noch uneinheitlich gebraucht. • Wird Heilung, Besserung oder Erhaltung des status quo angestrebt? • Wie soll eine „Spontanheilung“ bewertet werden? • Kann zwischen verschiedenen psychotherapeutischen Behandlungsmaßnahmen unterschieden werden? • Wie werden Ergebnisse interpretiert, wenn keine positiven Veränderungen erfolgen? • Kann eine „erfolgreiche Therapie“ immer nachgewiesen werden? • Welche therapeutischen Ziele wurden angestrebt? • Welche Maßstäbe wurden bei der Untersuchung angelegt? • Welche Erwartungen und Interessen bestehen von Seiten des Patienten, des Therapeuten und der Gesellschaft? • Sind eine Veränderung der innerpsychischen Dynamik und/oder ein Symptomwandel eingetreten? • Sind zusätzlich Medikamente gegeben worden? • Inwieweit spielt die Persönlichkeit des Therapeuten eine Rolle? • Wirken zusätzliche (etwa körperentspannende, psychotherapeutische) Maßnahmen mit? • Welche Rolle spielt die soziale und familiäre Umgebung des Behandelten? Klassifikation von Erfolgsmessungen: Es existiert eine Vielfalt an Einteilungsversuchen für den Therapieerfolg. Bei allen Unterschieden sind sich die Autoren einig, dass Therapieerfolg durch multiple Kriterien definiert wird und durch multiple Methoden und auf verschieden Ebenen gemessen werden sollte (Lambert, Shapiro und Bergin, 1986; Schulte, 1993). Schulte (1993) unterschied zwischen dem inhaltlichem und dem methodischen Aspekt bei der Definition für Erfolg. Die Skizze der Abbildung 2 beschreibt die verschiedenen Ebenen der Erfolgsmessung. 25 Object 3 Zum Inhalt der Erfolgsmessung: 1. Ebene: Solange vorwiegend theoretische Vermutungen und kaum hinreichend gesicherte Ergebnisse über die „Ursachen“ von psychischen Störungen vorliegen, müssen theoriespezifische Maße (z.B. psychoanalytische oder verhaltenstherapeutische Maße) angewandt werden – sofern eine Messung auf dieser Ebene überhaupt als erforderlich erachtet wird. 2. Ebene: Auf der Ebene der Symptomatik sind Vereinheitlichungen möglich. Hier können Fragebögen wie z.B. die Symptom- Checkliste – 90 - R zum Einsatz kommen. 3. Ebene: Die möglichen Folgen der Erkrankung lassen sich relativ einheitlich beurteilen, da sie sich hauptsächlich in der Quantität, weniger in der Qualität unterscheiden. 26 Zur Methode der Erfolgsmessung: 1. Die Operationalisierung erfolgt zur Festlegung der Instrumente und der Datenquelle, mit denen die interessierende Variable gemessen werden soll. 2. Soll als Erfolgskriterium eine Veränderung oder eine Zielerreichung gelten? Soll das Ganze ins Verhältnis zum therapeutischen Aufwand gesetzt werden - Veränderung in der Zeit? 3. Zu welchen Zeitpunkten sollen die Messungen stattfinden? Veränderungsmessung versus Retrospektive Erfolgsbeurteilung Eine grundsätzliche Unterscheidung der Verfahren zur Erfolgsmessung erfolgt über den Zeitpunkt zu dem sie stattfindet (Schulte, 1993). Es gibt daher verschiedene Ansätze: Indirekte Veränderungsmessung In den letzten Jahren wurden Prä-Post-Effektstärkemaße vielfach als Standard eingesetzt. Hierbei erfolgt eine mehrfache Statusdiagnostik (Zwei-Punkt-Erhebung), anhand von Fragebögen, meistens vor und nach der Intervention, beliebig auch währenddessen oder längere Zeit nach Abschluss der Behandlung. Es wird die Differenz der zwei Messungen gebildet und ins Verhältnis zur Standardabweichung gesetzt, dadurch ermittelt man das Ausmaß der Veränderung als „Effektstärke“ (Rosnow & Rosenthal, 1988). Eine Alternative zu solchen Veränderungsmaßen sind rückblickende Beurteilungen, welche am Ende einer Therapie erfolgen und mit einer Ein-Punkt-Messung erfasst werden: Retrospektive Erfolgsbeurteilung Diese lässt sich in drei Arten unterscheiden: Direkte Veränderungsmessung: Hierbei wird durch den Patienten, den Therapeuten oder wahlweise durch einen Dritten, gewissermaßen eine eigene Differenzbildung vorgenommen. Am Ende der Therapie wird nach dem Ausmaß der Veränderung gegenüber dem Zeitpunkt zu Beginn der Therapie gefragt (Stieglitz, 1986). Beispiele für solche Fragebögen sind die „Kieler Sensitive 27 Symptomliste (KASSL)“ (Zielke, 1979) und der „Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens“(VEV; Zielke & Kopf-Mehnert, 1978). Goal Attainment Scaling: Es wird am Ende der Behandlung bewertet, in wie weit Ziele, welche zu Beginn zwischen Patient und Therapeut ausgehandelt wurden, erreicht wurden. Auch hier spielt der subjektive Eindruck eine Rolle. Zufriedensheitmaße: Rückblickend wird nach einer Behandlung mit einer Ein-Punkt-Messung der Erfolg und die Zufriedenheit erfragt. In der „Consumer Reports Study“ von Seligman (1995) kam diese Erfolgsbeurteilung unter anderem zum Einsatz. Nach einer Untersuchung von Baumann et al. (1980) korrelierten retrospektive Erfolgsmaße und indirekte Veränderungsmaße nur gering. In der Studie von Michalak et al. (2003) zeigte sich eine hoch signifikante negative Korrelation zwischen retrospektiven Erfolgsmaßen und den Post-Werten der zur Veränderungsmessung eingesetzten Instrumente. Das bedeutet, je größer die Restsymptomatik war, desto geringer fiel die Erfolgsbeurteilung aus. Zu den Prä-Werten zeigte sich nur eine geringe und zudem negative Korrelation. Die Tendenz war also: je größer die Anfangssymptomatik, desto schlechter auch die Erfolgsbeurteilung. Baumann et al. (1980) stellten die Überlegung an, der Patient würde rückblickend statt der Veränderung eher den mehr oder minder befriedigenden Zustand nach Therapieende einschätzen. Die Veränderung vom Ausgangszustand wäre dann demnach weniger wichtig als das Erreichen seiner Ziele und die Zufriedenheit mit der Therapie. Dies entspricht auch den Ergebnissen einer Studie von Kastner & Basler (1997). Michalak et al. (2003) argumentierten, verschieden Erfolgsmaße hätten unterschiedliche Bedeutungen und Aussagefähigkeiten. Während die indirekte Veränderungsmessung quantitative Aussagen machen kann und für einen fairen Vergleich verschiedener Therapieverfahren unerlässlich ist, ist die retrospektive Erfolgsbeurteilung von Nutzen für prognostische Zwecke. Durch sie ließen sich in ihrer Studie, verlässlichere Aussagen machen, z.B. ob ein Patient zum Katamnese-Zeitpunkt noch Medikamente einnahm bzw. sich in Behandlung befand oder nicht. Auch könne eine Therapie nicht als erfolgreich gewertet werden, wenn eine Veränderung zwar nachweisbar sei aber kein subjektives Erfolgsgefühl des Patienten existieren würde. Insofern sind nach Michalak et al. (2003) beide Erfolgsmaße in der Forschung unverzichtbar. 28 2.2.3. Efficacy versus Effectiveness Nachdem die Wirksamkeit von Psychotherapie in vielen experimentellen Studien nachgewiesen wurde, stellt sich die Frage, in wie weit sich die Ergebnisse auf den Versorgungsalltag übertragen lassen. Denn in der Therapieergebnisforschung geht es auch um die erfolgreiche Umsetzung psychotherapeutischer Verfahren. Es werden zwei methodische Ansätze unterschieden, die Wirksamkeit einer Therapie zu beurteilen: Efficacy (Wirksamkeit): Sie wird in kontrollierten klinischen Studien ermittelt, die häufig an Universitäten oder anderen Forschungsinstituten durchgeführt werden. Sie beinhalten Randomisierung, Kontrollgruppen und das Einhalten von Behandlungsmanualen, sodass eine spezifische Therapierichtung untersucht werden kann. Die Patienten sind hinsichtlich ihrer Diagnosen meist homogen und die Anzahl der Sitzungen wird oft auf eine feste Anzahl beschränkt. Ihre Stärke ist daher eine hohe interne Validität. Effectiveness (Klinische Brauchbarkeit): Sie bezieht sich auf die psychotherapeutische Wirksamkeit in der täglichen, klinischen Praxis, z.B. in ambulanten Praxen oder Beratungsstellen. EffectivenessStudien haben ein naturalistisches Design, das heißt, es werden Therapien unter Alltagsbedingungen betrachtet. Es wird eine größere Bandbreite an Therapietechniken, Patientendiagnosen und verschiedenen Behandlungsdauern eingeschlossen. Der Vorteil hierbei ist die hohe externe Validität und die Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Ein bekanntes Beispiel für eine Effectiveness- Studie ist die von Seligman entworfene „Consumer Reports Study“ (Seligman, 1995): Auf eine Befragung durch die Zeitschrift „Consumer Reports“, zur Inanspruchnahme und dem Erfolg einer durchgeführten Psychotherapie, anworteten 7000 Leser. Die Fragebögen waren ausführlich gestaltet, so dass sich detaillierte Informationen entnehmen lassen konnten. Seligman spricht selbst Nachteile dieser Studie an: Selektionsprobleme der Stichprobe, eventuell antworteten Leser mit tendenziell erfolgreicheren Therapien? Auch bestand die Stichprobe nur aus Lesern dieser Zeitschrift, welche im großen Ganzen der Mittelklasse angehören. Die Leser wählten ihre Therapierichtung selbst aus, das heißt, sie brachten eine gewisse Überzeugung mit, dass die Therapie wirken würde. Dies alles könnte die Ergebnisse der Studie positiv beeinflussen. Genauso die Tatsache, dass die Patienten sich ausschließlich selbst beurteilten und eine objektive Einschätzung der Verbesserung fehlte. 29 Es ließe sich noch eine Reihe an methodischen Mängeln finden, doch die Vorteile der Studie sind ebenfalls bemerkenswert: Die Fallzahl ist groß, zum Datum des Erscheinens der Studie übertraf sie damit vermutlich alle bisher veröffentlichten Studien. Es wurden Therapiedauern von weniger als einem Monat und Therapiedauern bis zu zwei oder mehr Jahren beschrieben. Die Therapeuten arbeiteten ohne strenge Manuale, sondern passten ihre Vorgehensweise an den jeweiligen Patienten an. Die Antworten der Leser spiegeln also die Ereignisse wider, wie sie tatsächlich vorkommen. Insofern sind die Behandlungsbedingungen und ihre Ergebnisse realistisch und nicht durch äußere Vorgaben eingeschränkt. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, die Unvoreingenommenheit der Patienten. Sie haben kein Interesse daran, eine Therapierichtung, Medikamente oder ihren Pfarrer als besonders effektiv darzustellen. Sie beschreiben einfach ihr eigenes Befinden. Es gibt noch einige Argumente für und gegen die Consumer Reports Study, die hier nicht alle aufgezählt werden können. Es ist mir wichtig zu zeigen, dass es keine perfekte Studie gibt, sondern, dass der Forscher mit jedem Studiendesign andere Schwerpunkte setzt und andere Aspekte untersuchen kann. Für eine möglichst optimale Studie jedoch, schlägt Seligman die Kombination der Efficacy- und der Effectiveness- Methoden vor (Seligman, 1995). 2.2.4. Therapieprozessforschung Im Gegensatz zur Outcomeforschung, die zur Aufgabe hat, den Erfolg nachzuweisen und zu quantifzieren, geht es hier darum herauszufinden, wie Veränderungen im Therapieprozess entstehen. Nach Grawe (1992) ist dies die zentrale Frage der Psychotherapieforschung. Es geht innerhalb der Prozessforschung um die Klärung, was ohne experimentelle Veränderung beim Patienten und Therapeuten, sowie zwischen den beiden geschieht (Gassmann, 2002). Das Ziel ist, Ergebnisse zu erklären und aufzuschlüsseln, um damit allgemeine und spezifische Wirkfaktoren bestimmen zu können. Gleichzeitig dient ein besseres Verständnis des prozessualen Ablaufs dazu, bestimmende Faktoren für therapeutische Misserfolge aufzudecken (Bastine et al., 1989). Oft werden die Fragen von Prozess und Wirksamkeit auch kombiniert untersucht, in Form der Prozess-Outcomeforschung. Nach Caspar und Jacobi (2004) ist eine strikte Trennung der Fragen nicht sinnvoll, da Prozessanalysen ohne Ergebnis-Bezug genauso unbefriedigend sind wie Erfolgsstudien, welche die Frage, was zum Behandlungserfolg geführt hat, nicht beantworten können. 30 Es wurden bereits einige Wirkfaktoren und Einflussfaktoren erkannt, bzw. diskutiert. 2.2.4.1. Therapie/Therapeutenbezogene Faktoren 2.2.4.1.1. Therapieschule (spezifische Wirkfaktoren) Noch immer nicht entschieden ist die Frage, ob die zahlreichen verschiedenen Therapierichtungen gleiche Erfolge erzielen oder ob nicht doch eine Therapieschule den anderen überlegen ist. Die Diskussion darum hält sich seit langer Zeit und ist noch nicht abschließend beendet, trotz vieler Stimmen, die die These vertreten, dass alle Therapiemethoden gleich wirksam sind. Als Rosenzweig (1936) behauptete, dass vor allem „allgemeine Wirkfaktoren“ für die Wirksamkeit der Therapie verantwortlich seien und es nicht auf die Unterschiede zwischen den Schulen ankäme, zog er den Vergleich zu „Alice in Wonderland“ (Carroll, 1865/1962), in dem der „Dodo-Bird“ am Ende eines Wettrennens verkündete: „Everybody has won, and all must have prizes“ und damit alle Teilnehmer zu Gewinnern auserkor. Nachdem eine umfassende Übersichtsarbeit zur vorhandenen Literatur, über das Thema Therapieerfolg, die Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Therapieschulen bestätigte, wurde diese Gleichwertigkeit als „dodo bird effect“ bezeichnet (Luborsky et al.,1975). Darauf folgten die ersten Meta-Analysen, welche nur, zu vernachlässigende Unterschiede in der Wirksamkeit von behavioralen und nicht-behavioralen (psychodynamische, RogerGesprächstherapie, transaktionsanalytische) Therapierichtungen fanden (Smith et al. 1977; Smith et al., 1980). Eine Meta-Analyse, die hauptsächlich Therapiemethoden aus der Verhaltenstherapie und zum kleinen Teil psychodynamische Methoden verglich, besagte, dass der Einfluss der Therapiemethode auf den Erfolg durch die Effekte anderer Variablen überlagert würde (Shapiro und Shapiro, 1982). Jedoch nicht alle Autoren zeigten sich überzeugt. Generelle Kritik an diesen Meta-Analysen und ihrer Aussagekraft übten Wilson und Rachman (1980 /1983). Sie warfen Shapiro und Shapiro Methodische Mängel vor, wie z.B. die nach strengen Kriterien selektierte Auswahl an Studien, die zwar den Bias des Reviewers minimiert, dafür ihrer Meinung nach, andere methodisch gute Studien nicht beachte. So wurden nur Studien eingeschlossen, welche eine no-treatment Kontrollgruppe hatten, keine Studien die stattdessen mit einer Placebo-Kontrollgruppe arbeiteten, welche jedoch ebenfalls eine experimentelle Form der Kontrolle sei. Eine weitere Kritik an der Arbeit von Smith et al.(1980), war die gleiche Bewertung von methodisch starken und methodisch schwachen Studien, 31 ebenfalls aus dem Grund, um einem Reviewers-bias vorzubeugen und um die Datenanzahl der Analyse zu vergrößern. Wilson und Rachman bezweifeln die gleiche Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer und psychoanalytischer Methoden, da sie der Psychoanalytischen Fachrichtung vorwerfen keine methodisch überzeugenden Studien hervorgebracht zu haben (Wilson & Rachman, 1983). Der Streit um die Überlegenheit einzelner Therapieschulen hielt an, bis der Druck von außen wuchs, sich gemeinsam gegen die zunehmend biologisch orientierte Psychiatrie zu behaupten. In den neunziger Jahren entstanden daraufhin eine Reihe weiterer Studien und Meta-Analysen, die die deutliche Wirksamkeit von Therapie im allgemeinen belegten, gleichzeitig die Gleichwertigkeit der einzelnen Therapieschulen aufzeigten und somit der „dodo-bird-These“ recht gaben (Lambert & Bergin, 1994; Wampold, 1997), unter anderem eine der bis dahin größten Studien, initiiert durch das NIMH, das National Institute of Mental Health (Elkin et al., 1989/1996). Die Psychoanalyse hatte sich in der Tat lange Zeit kaum Mühe gegeben, die Wirksamkeit ihrer Therapie durch Studien zu belegen, doch innerhalb der letzten Jahrzehnte konnte sie dieses Versäumnis aufholen. Es entstanden vermehrt Untersuchungen, die ihr eine sehr gute Wirksamkeit bescheinigten (Franz et al., 2000; Keller et al., 2001; Kächele et al., 2001; Huber et al., 2009; Jakobsen et al., 2007). In einer Meta-Analyse von Leichsenring und Rabung (2004) konnte die Effektivität der STPP (Short-Term Psychodynamic Psychotherapy) belegt werden. Es ist eine Zusammenfassung von 17 Studien, die strenge Einschlusskriterien erfüllen, wie zum Beispiel randomisierte Kontrollgruppen, Behandlung nach Therapiemanualen, Therapeuten, welche speziell für STPP ausgebildet waren oder spezifische Diagnosegruppen. Es wurden große Effektstärken für Lösung der Zielprobleme, generelle psychiatrische Probleme und soziale Funktionalität berechnet (1,39, 0,90, 0,80), welche bis zum Katamnesezeitraum stabil blieben oder sich vergrößerten. Die Effektstärken überstiegen signifikant die Warte-Listen-Kontrollgruppen. Es wurden keine Unterschiede zwischen der Wirksamkeit von STPP und anderen Therapiemethoden gefunden (Leichsenring & Rabung, 2004). Eine weitere Meta-Analyse von Leichsenring und Rabung (2008) umfasst 23 veröffentlichte Studien zu LTPP (Long Term Psychodynamic Pschyotherapy), psychodynamischer Langzeittherapie, aus den Jahren 1960 – 2008. Dies beinhaltet ambulante Therapie mit einer Dauer von über einem Jahr oder eine Mindestanzahl von 50 Sitzungen. Die Ergebnisse wurden mit acht Kontrollstudien zu kürzeren Therapieformen verglichen (kognivitve-analytische Therapie, dialectical32 behaviorale Therapie, Familientherapie und STPP). Es zeigte sich eine signifikant höhere Gesamteffektstärke der LTPP gegenüber den kürzeren Therapieformen (0,96 vs. 0,47), ebenfalls höhere Effektstärken für Zielprobleme (1,16 vs. 0,61) und Personality Functioning (0,90 vs. 0,19). Für komplexe und chronische psychische Störungen waren die Effektgrößenunterschiede zwischen den Therapierichtungen noch größer. In Prozentilen ausgedrückt bedeutet das, dass nach einer LTPPBehandlung die Patienten gesünder waren als 96 % der Patienten in den Vergleichsgruppen. Huber et. al. (2009) gelang ein Nachweis zur Langzeitstabilität der Wirkung einer stationären psychodynamischen Therapie, durch Befragung ehemaliger Patienten verschiedener Diagnosegruppen. Nach einem Katamnesezeitraum von 3 bis 5 Jahren zeigten sich die Verbesserungen noch als hoch signifikant auf der Symptomebene. Auch auf interpersoneller Ebene fanden sich signifikante Verbesserungen. Bisherige Messinstrumente zur Beurteilung des psychotherapeutischen Erfolgs wurden von psychoanalytisch orientierten Forschern oft als ungenügend empfunden (Jakobsen et al., 2007). Da die spezifischen Effekte einer psychoanalytischen Therapie jenseits von Symptomen liegen und tief greifende und zeitstabile Veränderungen am Erleben und Verhalten bewirken sollen. Es wurde der Begriff der „strukuturellen Veränderung“ geprägt, welcher als das allgemein anerkannte Ziel der Psychoanalyse gilt (Moore und Fine, 1990). Es wurde ein Messinstrument entwickelt, das speziell für die Messung der „strukturellen Veränderung“ anwendbar ist, die „Skalen psychischer Kompetenzen“ (Wallerstein, 1994; de Witt et al., 1999). Diese wurden in Untersuchungen von Huber et al. (2005/2006) als reliabel, stabil, valide und änderungssensitiv erwiesen. Die Hoffnung in solch einem neuen Instrument liegt darin, psychoanalysespezifische Effekte zeigen zu können, welche bisher in anderen Studien nicht nachzuweisen waren. Die Frage nach der Überlegenheit einzelner Therapierichtungen relativiert sich allerdings, wenn man bedenkt, wie gering der Beitrag, der spezifischen Techniken zum Erfolg ist. In einer großen Zusammenfassung von über 100 Studien, konnten Lambert und Barley (2001) vier Hauptfaktoren, welche für den Therapieerfolg verantwortlich sind, ausmachen. Sie schrieben nur 15 % des Varianzanteils der spezifischen Therapietechnik zu. Für einen weit größeren Teil der Varianz kommen „allgemeine Wirkfaktoren“, Placebo-Effekte und extratherapeutische Variablen auf. So könnte man sich Grawe (1995) anschließen, welcher über den Grundriss einer „Allgemeinen Psychotherapie“ schreibt, „dass die Forschung einen Punkt erreicht hat, an dem es für ihre 33 Weiterentwicklung angezeigt ist, die bisherige Abgrenzungen aufzugeben und sich für die Zukunft zusammen zu tun, um aus dem getrennt angesammelten Erfahrungsschatz in Zukunft gemeinsam zu schöpfen“ (Grawe, 1995). 2.2.4.1.2. Common Factors (unspezifische Wirkfaktoren) Seitdem Psychotherapie existiert hat es für sie viele Definitionen gegeben. Eine, welche die Therapieergebnisforschung besonders beeinflusste, wurde von Rosenzweig (1936) entwickelt und wurde später von anderen aufgenommen (Horvath, 1988). Nach seinem Verständnis ist Psychotherapie das Produkt von „common factors“ (allgemeinen/unspezifische Wirkfaktoren), welche mehr oder weniger in allen Therapieformen vorkommen und spezifischen Faktoren, welche zu einer bestimmten Behandlungstheorie und Methode gehören. Lambert und Bergin (1994) definierten die „allgemeinen Wirkfaktoren“ als die Elemente oder Dimensionen, welche nicht spezifisch für irgendeine Technik sind. Dazu zählen: Erwartungseffekte, Beziehungsvariablen wie Überzeugungskraft, Wärme, Aufmerksamkeit, Verständnis und Ermutigung. Nachdem das „Dodo – Verdict“ bekannt wurde, herrschte unter vielen Forschern die Meinung, spezifische Faktoren könnten nicht viel zum Therapieerfolg beitragen. Andere gingen weiter zu behaupten, die Wirksamkeit der Therapie würde sich völlig auf die allgemeinen Wirkfaktoren begründen (Lambert et al., 1986; Klein, 1996). Es existieren viele Studien deren Ziel es ist, die Effekte der Common Factors genauer zu bestimmen (Horvath, 1988; Critelli & Neumann, 1984). Die wichtigsten seien hier vorgestellt: Lambert (2001) schätzte in seinem Reviewartikel, dass spezifische Behandlungstechniken (= Inverventionen wie z.B. Biofeedback, Hypnose, Systematische Desensibilisierung) für nur ca. 15 % des Therapieerfolgs verantwortlich seien und 30 % sollten die allgemeinen Wirkfaktoren ausmachen. 15 % des Erfolgs kämen durch Erwartungseffekte (= Placebo-Effekte) zustande. Extratherapeutische Faktoren (= individuelle Eigenschaften des Patienten, die sich auf seine Fähigkeiten und Stärken seines Umfeldes beziehen) klärten 40 % der Varianz auf. Wampold (2001) zeigte in seiner Metaanalyse, dass alle Psychotherapieverfahren im Wesentlichen auf Grund genereller Wirkfaktoren gleichermaßen wirksam sind. Seinen Untersuchungen zufolge machen die allgemeinen Wirkfaktoren rund 70 % der Gesamtwirksamkeit aus. Sein Schluss daraus war, man müsse den Forschungsfokus auf die Behandlungsaspekte legen, welche die Wirkung allgemeiner Faktoren erklären können. 34 Methodisch erscheint es sinnvoll drei Gruppen gegenüber zu stellen (Stevens et al., 2000). Eine Gruppe unter vollständiger Behandlung (bestehend aus spezifischen Techniken und allgemeinen Wirkfaktoren), eine Gruppe, die eine Behandlung erhält, welche nur auf allgemeinen Wirkfaktoren basiert, so wie eine Gruppe ohne psychotherapeutische Behandlung. In Lamberts (1994) Reviewartikel, der nur Studien mit einer solchen Gegenüberstellung berücksichtigte, wurde gezeigt, dass „vollständige Behandlung“ gegenüber einer „allgemeine Wirkfaktoren-Behandlung“ überlegen war. Diese Gruppe wiederum zeigte deutliche Verbesserungseffekte im Vergleich zu der Gruppe, die keinerlei Behandlung erhielt. Stevens et al. (2000) untersuchten die Wirksamkeit der allgemeinen Wirkfaktoren in Bezug auf die Wirksamkeitsebenen des Phasenmodells von Howard und Lüger (1993). Die Beschreibung des Modells folgt in Kapitel 1.3.3.. Sie stellten die Hypothese auf, dass frühe Verbesserungen des Wohlbefindens von Patienten, Resultate der allgemeinen Wirkfaktoren seien. Diese würden zu einem Zeitpunkt schon greifen, wenn die meisten spezifischen Elemente einer Therapietechnik noch nicht aktiviert werden könnten. Dagegen hielten sie es für wahrscheinlich, dass Veränderungen der Persönlichkeit oder Linderung von chronischen Symptomen, also Effekte, welche später in der Behandlung auftreten, eher Folgen der spezifischen Therapietechniken seien. Sie konnten dies nicht an Hand von Zahlen nachweisen, doch lag dies womöglich an den kurzen Behandlungsdauern ihrer Patienten. So erhielten die Patienten nicht genug Therapie um eine Reduktion der Symptome und eine Verbesserung der Funktionalität zu erzielen (Stevens et al., 2000). Orlinsky, Grawe und Parks (1994) fanden in einer umfassenden Metaanalyse für verschiedene Therapierichtungen eine Reihe gemeinsamer Merkmale, welche sie als allgemeine Wirkfaktoren beschrieben. Diese wurden in weiteren empirischen Wirksamkeitsuntersuchungen und ProzessOutcomestudien bestätigt (Grawe, 1995, 1997, 1998). Wirkfaktor Ressourcenaktivierung: Individuelle Merkmale und Eigenarten, die Patienten in die Therapie einbringen, werden als positive Ressourcen für das therapeutische Vorgehen genutzt. Psychotherapie nutzt also vorhandene, motivationale Bereitschaften und Fähigkeiten des Patienten. Wirkfaktor Problemaktualisierung: Schwierigkeiten, die in der Therapie verändert werden sollen, werden durch Interventionen dem Patienten unmittelbar erfahrbar gemacht. Z.B. werden reale Situationen aufgesucht oder hergestellt (Verhaltenstherapie) oder Personen mit einbezogen, die an den Problemen beteiligt sind (Paar- oder Familientherapie), oder die therapeutische Beziehung und die in ihr auftretenden Konflikte und Gefühle genutzt (psychodynamische/psychoanalytische 35 Therapie). Wirkfaktor Problembewältigung: Die Patienten werden mit bewährten problemspezifischen Maßnahmen oder konfliktorientierten Beziehungsangeboten aktiv darin unterstützt, positive Bewältigungserfahrungen im Umgang mit ihren Problemen zu machen. Wirkfaktor motivationale Klärung: Therapien fördern mit geeigneten Maßnahmen das Ziel, dass Patienten Einsichten in ihr konflikthaftes Erleben und Verhalten gewinnen z.B. Förderung von Introspektion und Selbstreflektionsfähigkeit, Konfrontation mit und Deutung von Abwehrmechanismen, Hinweis auf und Veränderung von dysfunktionellen Kognitionen und Beziehungsmustern. Therapeuten-Patienten-Beziehung Ein wichtiges Element der allgemeinen Wirkfaktoren ist die Therapeutische Beziehung, bestehend aus Arbeitsverhältnis und affektiver Bindung. In den letzten zwei Jahrzehnten setzte sich unter Psychotherapeuten und Forschern zunehmend die Meinung durch, dass diese eine essentielle Rolle im therapeutischen Prozess spielte. In einem Review von Horvath und Symonds (1991) wurde gezeigt, dass die Qualität der Beziehung zwischen Therapeut und Patient im Verhältnis zum Therapieerfolg steht. Safran und Muran (1995) behaupteten, die Qualität der Beziehung sei wichtiger für ein positives Therapieergebnis, als die Art der Behandlung. Von Wolfe und Goldfried (1988) wurde sie sogar als die „quintessential integrative variable“ der Therapie bezeichnet. Es wurden verschiedene theoretische Konzepte der Therapeutischen Beziehung entwickelt. Die meisten von ihnen enthalten drei Dimensionen: a) Arbeitsbeziehung, b) affektive Bindung und c) die Fähigkeit des Therapeuten und des Patienten sich auf Behandlungsziele und Aufgaben zu einigen (Horvath und Symonds, 1991; Saunders et al., 1989). Die Therapeutische Beziehung unterscheidet sich von einer freundschaftlichen Beziehung (Bänninger-Huber, 2001). Zwar soll der Therapeut ein verlässliches Arbeitsbündnis schaffen, das dem Klienten ein grundlegendes Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens gibt. Doch nützt diese gute und harmonische Arbeitsbeziehung dem therapeutischen Prozess nur dann etwas, wenn gleichzeitig das Erkennen und Bearbeiten von Konflikten erzielt wird. Martin und Garske (2000) zeigten in ihrer Meta-Analyse eine Korrelation (r =.22) zwischen Therapeutischer Beziehung und Erfolg und schlossen gleichzeitig konfundierende Variablen, die das Verhältnis Beziehung-Erfolg beeinflussen könnten aus. Mit diesen Ergebnissen unterstützten sie die These von Henry und Strupp (1994), dass die Beziehung in sich selbst therapeutisch wirkt. In 36 anderen Worten: Existiert eine gute Beziehung zwischen Patient und Therapeut, wird der Patient die Therapie als heilsam empfinden, unabhängig von anderen psychologischen Interventionen. Patienten tendieren dazu, die Beziehung als stabil zu bewerten, während Therapeuten und dritte Beobachter eher Veränderungen feststellen. Da die Bewertung der Beziehung aus Patientenwahrnehmung eine höhere Korrelation zum Therapieerfolg hat, wäre ein Schluss für Therapeuten daraus, sich besonders zu Anfang zu bemühen, eine gute Beziehung zu etablieren (Martin et al., 2000). Elemente der Therapeutischen Beziehung: Ein Element der Therapeutischen Beziehung ist das mimisch-affektive Verhalten des Therapeuten. 50 - 80 % der interpersonellen Kommunikation wird über nonverbale Kanäle wie Mimik und Gestik vermittelt (Beutler et al., 1994). Die Studie von Beutel und Ademmer (2005) unterstreicht diese Bedeutung der Mimik für den Therapieerfolg. In erfolgreichen Therapien zeigen Therapeuten vorwiegend andere (nicht-reziproke) Affekte als ihre Patienten. Somit kommt es nicht zur Bestätigung maladaptiver Interaktionsmuster. Zeigen Therapeuten ähnliche (reziproke) Affekte, nehmen Therapien häufig ungünstigere Verläufe. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Eine Patientin, erzählt in einer Therapiesitzung, mit Lächeln im Gesicht, wie ihr in der Vergangenheit Schlimmes widerfahren ist. Der erste Therapeut lächelt ebenfalls viel, evtl. um die Bindung zur Patientin zu fördern. Der zweite Therapeut zeigt vorrangig Trauer oder Wut, Affekte, die zu dem Erlebnis passen. Die Therapie des zweiten Therapeuten würde vermutlich erfolgreicher verlaufen, da er der Patientin auf diese Weise, ihre abgewehrten Konflikte zur Bearbeitung zugänglich machen würde, anstatt wie im ersten Fall, die Abwehr zu stärken. Einzeltherapeut Die Person des Therapeuten spielt ebenfalls eine nicht zu vernachlässigende Rolle für den Therapieerfolg. Dies wurde in älteren und neueren Studien wiederholt festgestellt. Luborsky et al. (1985) versuchten in einer Studie den Einfluss des Einzeltherapeuten gezielt gering zu halten, durch spezielles Training, Manuale und Supervision, doch es bestand dennoch eine beträchtliche Varianz der Therapieergebnisse, welche auf die Person des Einzeltherapeuten zurückgeführt wurde. Auch Beutler et al. (2004) kommen in ihrer Studie zu Therapeutenvariablen zu dem Schluss, dass die Effektivität einer Behandlung mehr von den speziellen Überzeugungen und Werten des Therapeuten, als von bestimmten Techniken abhängt. Die Bedeutung dieser Variablen, zusammengefasst als die therapeutische Haltung, wurde von einer schwedischen Arbeitsgruppe 37 innerhalb eines großen Projektes zur Outcomeforschung (STOPP Stockholm Outcome of Psychoanalysis and Psychotherapy Project) bestätigt (Sandell, 2007). Klug et al. (2008) stellten fest, dass die Therapieschule nur gering die therapeutische Haltung des Therapeuten beeinflusst. Dies steht im Einklang zu früheren Studienergebnissen, nach denen mit wachsender Erfahrung der Therapeuten, der Einfluss der theoretischen Orientierung geringer wird (Fiedler, 1950). Schauenburg et al. (2005) zeigten sogar für die stationäre Therapie einen deutlichen Einfluss des Einzeltherapeuten auf das Behandlungsergebnis. So ließen sich 9 % der Varianz des Therapieerfolgs durch den Therapeuten aufklären. Im Gegensatz zu einer älteren Studie von Orlinsky und Howard (1980) in der sechs Jahre Arbeitserfahrung einen Vorteil darstellte, hatte bei Schauenburg et al. (2005) die berufliche Erfahrung der Therapeuten keinen bedeutsamen Einfluss auf den Erfolg. Dafür erzielten weibliche Therapeuten geringfügig bessere Erfolge als ihre männlichen Kollegen. In einem Review von über 2000 Process-Outcome-Studien konnten weitere Therapeutenvariablen identifiziert werden, welche einen positiven Einfluss auf das Therapieergebnis hatten (Orlinsky, Grave & Parks, 1994). Diese waren: Glaubwürdigkeit, empathisches Verständnis und die Fähigkeit sich auf den Patienten einzulassen und ihn beim Fokussieren seiner Probleme zu bestärken. Selbstverständlich wirken sich diese Therapeuteneigenschaften wiederum auf die PatientenTherapeuten-Beziehung aus, weswegen es schwierig ist beide Faktoren konzeptuell vollständig zu trennen. Setting Das Setting bezeichnet die Umgebung, das Arrangement oder die spezifische Gestaltung der Therapie. Es gibt verschiedene Formen, z.B. ambulante oder stationäre Therapie, Gruppen- oder Einzel-Therapie, stationäre oder teilstationäre Therapie. Noch gibt es wenige Untersuchungen zum Einfluss des Settings auf den Gesundungsverlauf (Puschner et al., 2004). Puschner et al. (2004) verglichen die Ergebnisse stationärer und ambulanter Therapien. Die Patienten der beiden Behandlungsgruppen unterschieden sich kaum in ihrer Eingangssymptomatik und zeigten eine große Ähnlichkeit hinsichtlich ihrer Diagnosen. Die Effekte soziodemografischer Variablen wurden in die Ergebnisse mit eingerechnet. Die psychische Beeinträchtigung verringerte sich in der stationären Behandlung 14-mal schneller, als in der ambulanten Therapie. Doch in der katamnestischen Zeit verschlechterten sich die Patienten wieder 38 leicht, so dass nach Ablauf eines Jahres die Effektivität der ambulanten Therapie gleich groß war (Puschner et al., 2004). Ein Reviewartikel von Horvitz-Lennon et al. (2001) zum Thema teilstationäre/stationäre Therapie bei Erwachsenen, fasst die vorhandenen Studien aus 40 Jahren zusammen. Dabei zeigten sich in den meisten Studien eine gleiche Wirksamkeit für beide Settings. Allerdings waren TagesklinikPatienten und deren Angehörige, ein Jahr nach Entlassung, zufriedener als Patienten, welche in stationärer Behandlung waren. Jedoch gibt die Autorin zu bedenken, dass ca. zwei Drittel der untersuchten Studien älter als ein Jahrzehnt waren und genauso viele von minderer Qualität waren. Zeeck et al. (2003) untersuchten die Unterschiede der Behandlungserfolge bei teilstationären und stationären Behandlungen. Die Patientengruppen unterschieden sich nur wenig in Hinblick auf soziodemografische Variablen und Störungsschwere zum Aufnahmepunkt. Unterscheidungspunkte waren Entfernung des Wohnorts, Wohnsituation (Kinder/Partner) und die Diagnose einer Anorexie, welche für die Indikation Tagesklinik oder Station eine Rolle spielten. Für beide Behandlungsgruppen zeigten sich statistisch signifikante Verbesserungen und beide Settings erwiesen sich als ähnlich effektiv (Zeeck et al., 2003). Eine Studie von Geiselmann und Linden (2001) führte einen Vergleich von tagesklinisch und stationär behandelten Patienten so wie Patienten, die das Setting wechselten, durch. Sie fanden Unterschiede für die Belastungsschwere zwischen den Gruppen, wobei sich Tagesklinik-Patienten als tendenziell leichter beeinträchtigt zeigten. Durch eine Regressionsanalyse ließ sich ebenfalls kein signifikanter Einfluss des Settings auf das Therapieergebnis nachweisen. Interessant ist die Frage des Settings für Patienten, deren Übergänge, aus der Klinik nach Hause oder anders herum, flexibler gestaltet werden sollen. Doch auch für Versicherungen ist die Frage aus Kostengründen interessant. Die Hoffnung ist, die stationäre Behandlung verkürzen zu können zu können oder zum Teil sogar durch teilstationäre Therapie ersetzen zu können. Dies wäre eine Möglichkeit Kosten einzusparen (Kulick, 1998). Allerdings fehlen zu diesem Thema noch genauere Analysen für die spezielle Situation in Deutschland, um weitere Schlüsse ziehen zu können (Zeeck et al., 2003). 39 2.2.4.2. Extratherapeutische Faktoren Neben den Faktoren, die der Therapeut bzw. die Klinik bestimmt, kommen auch andere Einflüsse zum Tragen. Nach den Schätzungen von Lambert und Barley (2001), tragen extratherapeutische Faktoren ca. 40 % zur Aufklärung des Verlaufs der Erkrankung bei. Eine Heilung unterliegt dem Einfluss von individuellen Patientencharakteristiken und den Umständen außerhalb der Therapie. 2.2.4.2.1. Soziodemografische Patientenvariablen Die Rolle des Alters im Hinblick auf den Therapieerfolg scheint noch unklar zu sein. Während in manchen Studien überhaupt kein Zusammenhang hergestellt werden konnte (MacDonald, 1994; Smith et al., 1980), stellte sich in der Untersuchung von Fliege und Rose (2001) das Alter als Deckvariable für somatische Komorbidität heraus, welche für schlechte Therapieergebnisse sorgte. Deter (1990) und Nosper (1999) dagegen fanden in einigen Teilbereichen bessere Ergebnisse für jüngere Patienten in einer psychosomatischen stationären Behandlung. Jüngere Patienten erreichten insbesondere mehr Verbesserungen im Bereich der körperlichen Symptomatik, des Selbstwertgefühls und der Problembewältigungskompetenz. Älteren Patienten gelang es dafür besser abweisende und expressive Verhaltensweisen abzubauen (Nosper, 1999). In einer FollowUp-Studie über einen Zeitraum von fünf Jahren, stellte sich ein junges Lebensalter als positiver Prädiktor für gutes psychisches und soziales Befinden heraus (Deter, 1986). Das Geschlecht des Patienten hat nach den Ergebnissen verschiedener Studien (Geiser et al., 2002; Rode, 1987; Garfield, 1994), wenig Einfluss auf das Therapieergebnis. Nosper (1999) fand in diesem Zusammenhang lediglich bei Frauen eine höhere Zufriedenheit mit der stationären Psychotherapie und mit dem Therapeuten. Die Befunde zur Bedeutung einer festen Partnerschaft für den Therapieerfolg sind heterogen. Von verschiedenen Autoren konnte kein Zusammenhang gefunden werden (Fliege et al., 2002; Rode, 1987; Nosper, 1999). Andere Autoren stellten fest, dass verheiratete Patienten eher als „geheilt“ gelten und eine kürzere Behandlungsdauer benötigen (Geiser et al., 2002; Borgart & Meermann, 1999). Studien, welche diesen Zusammenhang genauer untersuchten, fanden, dass nicht die Partnerschaft an sich für einen besseren Therapieverlauf verantwortlich gemacht werden kann, sondern eher der Umstand, dass diese Patienten häufig über ein größeres soziales Netzwerk und verfügen und ihr Tagesablauf geordneter verläuft (House, Robbins & Metzner, 1982). Löhr et al. 40 (2003) zeigten einen positiven Zusammenhang zwischen Merkmalen positiver Partnerschaftsqualität und Therapieerfolg bei Patienten mit Agoraphobie. Ein anderes Ergebnis brachten Keller et al. (1994), welche die Ehe als Risikofaktor für ein längeres Anhalten einer Depression identifizierten. Sie geben jedoch ebenfalls zu bedenken, dass möglicherweise die Beziehungsqualität ausschlaggebend sei. Keinen großen Einfluss auf den Therapieverlauf scheint der Bildungsstand zu haben (Borgart und Meermann, 1999; Geiser et al., 2003; Schmidt, 1991). Riedel (1991) stellte fest, dass Patienten mit niedrigerem Bildungsniveau von ihren Therapeuten als weniger motiviert eingeschätzt wurden. Die Bedeutung des Erwerbsstatus für den Therapieerfolg wurde bisher wenig untersucht. Fliege et al., (2002) konnten für die Patienten einer psychosomatischen Klinik keinen Zusammenhang zwischen Erwerbslosigkeit und Therapieergebnis finden. Wenige Studien weisen auf die Arbeitsbelastung bzw. die Zufriedenheit am Arbeitsplatz als Einflussfaktor auf den Therapieerfolg hin. Nosper (1999) beschreibt, dass Patienten, welche bei Behandlungsbeginn berufliche Probleme hatten, häufig geringe Therapieerfolge aufwiesen. In der Untersuchung von Broda et al. (1996) schätzten beruflich integrierte Patienten den Behandlungserfolg zum Katamnesezeitpunkt positiver ein als Nichtberufstätige. Der subjektive Behandlungserfolg nach einem Jahr zeigte einen deutlichen Zusammenhang zur Zufriedenheit mit der Arbeitssituation. Auch in der Studie von Beutel et al. (2005) wurden berufliche Ereignisse, so wie Schwierigkeiten in der Gestaltung sozialer Kontakte und wenig soziale Ressourcen als wichtige Einflussfaktoren auf den Therapieerfolg bestimmt. 2.2.4.2.2. Krankheitsbezogene Patientenvariablen Fliege et al. (2002) konnten unterschiedliche Therapieerfolge in Abhängigkeit von der Diagnose feststellen. So hatten Angstpatienten zu Beginn eine starke Symptomschwere im Vergleich zu Patienten mit Anpassungsstörungen. Sie wiesen aber im Verlauf der Therapie eine größere Verbesserung auf. In einer Metaanalyse von Steffanowski et al. (2007) wurden unterschiedliche Effektstärken für verschiedene Störungsbilder gezeigt. Nosper (1999) wiederum kommt zu dem Schluss, dass Diagnosen keine Auswirkung auf den Therapieerfolg haben. Er konnte allerdings nachweisen, dass funktionelle Störungen im Vergleich zu psychoneurotischen Störungen einen günstigeren Therapieverlauf haben. 41 Die Unterteilung der Krankheitsbilder nach DSM-IV-Diagnosen wird in diesem Zusammenhang auch kritisch betrachtet (Clarkin und Levy, 2004). Patienten der selben Diagnose stellen keineswegs eine homogene Gruppe dar. Sie haben meist unterschiedliche Symptome und nicht selten zusätzlich komorbide Störungen. Auch soziodemografische Hintergründe können bei Patienten mit ähnlicher Symptomatik sehr verschieden sein. Aus diesen Gründen bewerten Clarkin und Levy (2004) die Ableitung von Zusammenhängen zwischen Diagnosen und bestimmten Behandlungsformen und ihren Erfolgen als zu vereinfacht und irreführend. Auf die Frage, in wieweit der Schweregrad der Erkrankung den Therapieerfolg bestimmt liefert die Literatur ebenso widersprüchliche Antworten. Eine Reihe an Autoren zeigten: je schwerer die Erkrankung der Patienten, desto schlechter ist das Therapieergebnis (Garfield, 1994; Mohr, 1995, Lambert & Anderson, 1996; Luborsky et al., 1988). In einer Untersuchung von McLellan et al. (1994) an opiat-, alkohol- und/oder kokainabhängigen Patienten, welche für ein halbes Jahr in Behandlung waren, zeigte sich die Schwere der Abhängigkeitserkrankung zu Behandlungsbeginn als entscheidender Prädiktor für einen späteren Substanzkonsum, unabhängig von der Art des Suchtmittels. In Untersuchungen anderer Autoren hatte die Symptomschwere zu Beginn der Therapie keinen Einfluss auf das Ergebnis (Joyce & Piper, 1998; Shapiro et al., 1994). Deter et al. (1986) und Mohr et al. (1990) kamen zu dem Schluss, dass ein vom Patienten wahrgenommener hoher Beschwerdedruck sich sogar positiv auf die Behandlung auswirken kann. In einer Untersuchung zum Ergebnis stationärer Psychotherapie von Junge & Ahrens (1996) gaben Patienten mit besonders starker psychischer Belastung zu Beginn, erhoben durch den SCL-90-R (Franke, 1995) und zum Katamnesezeitpunkt eine deutliche Abnahme der Beschwerdeintensität an. Patienten, welche anfangs nur geringe Beschwerden hatten, konnten ein Jahr nach Entlassung deutlich geringere Erfolge in Hinsicht auf die Beschwerdeintensität aufweisen. Ein ähnliches Ergebnis fand Nosper (1999) für die Stärke der Depressionsbelastung, gemessen durch die ADS, Allgemeine Depressions Skala (Hautzinger und Bailer, 1993) seiner Patienten. Schwerer belastete Patienten konnten in stationärer Behandlung eine größere Verbesserung erzielen als weniger Belastete. Komorbidität ist Ausdruck für die Komplexität einer psychischen Erkrankung und bestimmt unter anderem das Ausmaß der psychosozialen Beeinträchtigung (McDermut et al., 1988). Ob eine Mehrzahl an Diagnosen daher Einfluss auf den Therapieverlauf hat, ist nicht abschließend geklärt. Nach Coryell et al. (1994) verschlechtert die Komorbidität mit einer Angststörung die Heilungschancen von Depression. Andere Autoren berichten über schlechtere Therapieergebnisse bei 42 zusätzlicher somatischer Diagnose (Fliege et al. 2002; Keitner et al., 1992). Zielke (1995) und Borgart & Meermann (1999) fanden unterschiedliche Therapieverläufe in Abhängigkeit von Komorbidität. Löschmann (2000) wiederum konnte für Suchtpatienten keinen Einfluss von Mehrfachdiagnosen auf die Abstinenz nach Abschluss einer Entwöhnungstherapie nachweisen. In verschiedenen Studien wurde das Vorhandensein einer Persönlichkeitsstörung zusätzlich zu einer Achse-I-Störung der DSM-IV-Klassifikation, wie z.B. Depression ( Hardy et al., 1995; Shea et al.,1990; Reich & Green, 1991) oder Angststörung (Chambless et al., 1997) als negativer Prädiktor für den Therapieerfolg identifiziert. Es wurde gezeigt, dass Patienten mit zusätzlicher Persönlichkeitsstörung zu schwererer depressiver Symptomatik tendieren und oftmals längere Zeit benötigen um in der Therapie Fortschritte zu machen (Diguer et al. 1993; Pilkonis & Frank, 1988). Leibbrand et al. (1998) konnten keinen solchen Effekt auf die Behandlungserfolge von Patienten mit somatoformen Störungen finden. Auch Bottlender et al. (2003), konnten nach einer Entzugstherapie für Alkoholabhängige nur tendenzielle Unterschiede in der Häufigkeit von Persönlichkeitsstörungen bei rückfälligen Patienten im Vergleich zu Patienten mit regelrechtem Therapieverlauf finden. Sie folgerten daraus, dass die Bedeutung von Persönlichkeitsstörungen für das Therapieergebnis überschätzt wird. Es wird beschrieben, dass Patienten mit geringem Therapieerfolg häufig bereits eine lange Erkrankungsdauer hinter sich haben (Lamprecht & Schmidt, 1990; Deter, 1990; Broda et al., 1996). Eine Vorgeschichte mit depressiven Episoden (Sargeant et al., 1990) und mehreren stationäre Behandlungen (Keitner et al., 1992) sind Risikofaktoren für einen chronischen Verlauf einer Depression. Dementsprechend zeigten einige Autoren günstigere Therapieverläufe bei Patienten, welche vor Beginn der Therapie noch keine psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen mussten (Deter, 1990; Borgart & Meermann, 1999; Sack et al., 2003) Der Zusammenhang zwischen der Einstellung des Patienten gegenüber der Therapie und dem Behandlungserfolg scheint nicht unwichtig zu sein. Schneider & Klauer (1999) beschrieben die Bedeutung der initialen Behandlungsmotivation für das Therapieergebnis. Nosper (1999) zeigt als wichtigsten Erfolgsfaktor die Güte des Prozesserlebens, zu der verschiedene Patientenmerkmale gehören: intensiv gelernte Selbstständigkeit der Problemlösung, aktive Mitarbeit und hoher Therapieoptimismus. Fliege et al. (2002) konnten psychosoziale Morbidität, Pessimismus, Optimismus und Selbstwirksamkeitsüberzeugung als Prädiktoren für Therapieerfolg bestimmen. In einem Review-Artikel von Steenbarger (1994) wurde neben der Interpersonellen Funktionalität und 43 der Fähigkeit Bindungen einzugehen die aktive Teilnahme an der Therapie für Erfolg mitverantwortlich gemacht. Hierin besteht eine enge Verbindung zum Placebo-Effekt. 2.2.4.2.3. Placebo-Effekt / Erwartungen Rosenthal und Frank (1956) erhoben erstmals die These, dass das Placeboparadigma, welches in der pharmazeutischen Therapie bereits schon lange akzeptiert wurde, auch in der Psychotherapie Anwendung finden könne, in Form der allgemeinen Wirkfaktoren. Sie gingen so weit zu behaupten, die Wirksamkeit der Psychotherapie bestünde vor allem in der Fähigkeit, den Patienten davon zu überzeugen, dass ihm geholfen werden könne, also in der Placebowirkung. Lambert und Barley (2001) identifizieren in ihrem Übersichtsartikel die generalisierte Erwartungshaltung als wichtigen Erfolgsfaktor. Sie ist die Voraussetzung für den Placebo-Effekt, der bis zu 15 % des Erfolges ausmacht. Es wurden drei Typen von Erwartungshaltungen beschrieben: 1) Erfolgs- /Verbesserungserwartungen: Sie beschreiben, wie stark der Patient daran glaubt, dass die Therapie ihm helfen wird. 2) Rollenerwartungen: Diese beziehen sich auf Patientenerwartungen, die die Einnahme der Rolle des Patienten oder ihres Therapeuten betreffen. 3) Kontrollerwartungen: Sie beziehen sich auf den Ort der erlebten Kontrolle. Bei interner Kontrollüberzeugung ist der Patient selbst verantwortlich für seine Besserung, bei externer Kontrollüberzeugung liegt die Heilung nicht in seiner Macht, sie kommt von außen, zum Beispiel vom Schicksal. Ein Review zur vorhandenen Literatur beschreibt Zusammenhänge zwischen diesen Erwartungshaltungen und dem Therapieerfolg. Einerseits beeinflussen positive Erwartungen die aktive Beteiligung an der Therapie, zum anderen legen sie die Grundlage für den Placebo-Effekt (Delsignore & Schnyder, 2007). Eine Meta-Analyse, die 130 experimentelle Studien, mit Behandlungsgruppe, Placebo-Kontrollgruppen und Kontrollgruppe ohne Behandlung, verwendete, kam zu dem Schluss, dass Placebotherapien nur kleine oder keine Effekte haben (Hrobartsson & Gotzsche, 2001). Wampold (2005) verwendete die Daten dieser Meta-Analyse ein zweites Mal und konnte durch andere Methoden zeigen, dass der Effekt der Placebo Therapie fast ebenso groß, wie der Effekt der echten Therapie war. Er zieht zwei Hauptschlüsse: Erstens, der Placebo-Effekt ist robust. Zweitens, die Konstruktion eines Placebodesigns ist eine komplexe Angelegenheit. Es ist schwierig, 44 Psychotherapie in charakteristische und zufällige Aspekte zu trennen, von denen nur die Zufälligen in die Placebobehandlung einfließen sollten. Es ist zudem schwierig, eine für den Patienten, nicht als Placebo erkennbare Placebobehandlung zu entwerfen und es ist nicht möglich, die Studie aus Sicht des Therapeuten zu verblinden (Wampold, 2005). Auch wenn man somit von dem Vorhandensein eines Placeboeffektes ausgehen kann, ist noch unklar, von welchem Nutzen er ist. Denn es wurde festgestellt, dass das Anhalten des positiven Effektes nicht besonders lange ist und das Wiederkehren der charakteristischen Symptome nach einer bestimmten Zeit typisch ist (Lambert & Anderson, 1996). 2.2.4.2.4. Psychopharmakologische Einflüsse Ein wichtiger Aspekt ist sicherlich der Einfluss von Psychopharmaka auf den Therapieverlauf. Leider ist dies bereits ein großes Thema für sich, so dass in meiner Doktorarbeit nicht weiter darauf eingegangen werden kann. 2.3. Zusammenhang zwischen Behandlungsdauer und Therapieerfolg Der Zusammenhang zwischen der Therapiedauer und dem Therapieerfolg ist auf Grund der gesundheitspolitischen Situation ein genauso aktuelles, wie umstrittenes Thema. Viele Autoren haben sich mit dem Thema beschäftigt und haben interessante, unterschiedliche Ergebnisse hervorgebracht. 2.3.1. Zusammenfassung der aktuellen Literatur In den siebziger Jahren wurden bereits einige kontrollierte Studien durchgeführt, um den Effekt der Behandlungsdauer auf das Therapieergebnis zu untersuchen. Zu dieser Zeit und auch bei neuerlich wiederholt durchgeführten Meta-Analysen dieser Studien, zeigten sich keine negativen Effekte von 45 kürzeren gegenüber längeren Behandlungen (Caton & Gralnick, 1987). Pfeiffer et al. (1996) kamen nach der Untersuchung mehrerer Studien, überwiegend aus den siebziger Jahren, zu dem Schluss, dass die Dauer der Behandlung keinen signifikanten Einfluss auf das Outcome hat. Die meisten Untersuchungen der neunziger Jahre sprachen jedoch deutlich für positive Effekte einer längeren Behandlungsdauer. Häufig wurde ein Anstieg der Wiederaufnahmerate bei kürzeren Behandlungen gezeigt (Richter, 2001). Richter (2001) erklärt diesen Umstand der neuen Tendenz damit, dass die Verweildauern sich in den vergangenen Jahren so weit reduziert haben, dass sich nun langsam auch Auswirkungen in klinischen Parametern zeigen. Bei den Behandlungsdauern der früheren Jahrzehnte habe noch ein erheblicher Spielraum für die Reduktion bestanden. Allen et al. (1986) boten ebenfalls einen Erklärungsversuch für die Ergebnisse der älteren Studien. Ihrer Meinung nach wurden bisher ungeeignete Erfolgsmaße gewählt, um die Effekte einer längeren Therapie zu erfassen. Sie führten ebenfalls eine Studie durch, jedoch verwandten sie andere, „sensitivere“ Erfolgsmaße. Da das C. F. Menninger Memorial Hospital nach psychodynamischen Ansätzen behandelt, fügten sie entsprechend eine Reihe an Ich-Funktions-Maßen zur gewöhnlichen Symptombeurteilung hinzu. Außerdem verfolgten sie ein individualisiertes Vorgehen. Anstatt die Messung aller Variablen in die Ergebnisse einzubeziehen, benutzten sie hauptsächlich die, den Problembereich des jeweiligen Patienten, beschreibenden Variablen. Zum Beispiel: misst man die Veränderung der Suizidalität eines Patienten, welcher von Anfang an nie suizidal war, erhält man einen Effekt von 0. Es ist also sinnvoll, die Variable Suizidalität nicht in die Erfolgsbemessung mit einzuschließen. Die Ergebnisse ihrer Studie zeigten dann eine klare Korrelation zwischen Behandlungsdauer und Erfolg. Sie erklärten diesen Zusammenhang damit, dass chronisch kranke Patienten längere Zeit brauchen, um einen Heilungsprozess zu durchgehen. Außerdem ermöglicht eine längere Therapiezeit dem Therapeuten Behandlungsprogramme und Ziele anzupassen und zu ändern. Sie fanden auch heraus, dass eine längere Behandlungsdauer mit einer besseren Therapeuten-Patienten-Beziehung einhergeht, welche Voraussetzung für gute Behandlungsergebnisse ist (siehe Kapitel 1.3.4.2.). Lieberman et al. (1998) verglichen die Therapieergebnisse depressiver Patienten, welche zwischen den Jahren 1988 und 1996 in ihrer Klinik behandelt wurden. In diesem Zeitraum hat die durchschnittliche Verweildauer in den Krankenhäusern stark abgenommen. Sie bildeten rückblickend drei Kohorten mit verschiedener durchschnittlicher Behandlungsdauer (KH 1: 26,5 Tage KH 2: 19,5 Tage, KH 3: 8,3 Tage) und verglichen ihre Erfolgswerte. Zwar zeigten die Kohorten am 46 Ende der Therapie ähnliche Werte auf den Skalen für Selbstachtung und Ego-Defense, doch hatten die Patienten der letzten Kohorte signifikant höhere Werte auf der Hamilton Depressionsskala und niedrigere GAF-Werte (Funktionalität). Sie folgerten: bei kürzerer Behandlungsdauer werden Patienten kränker und funktional eingeschränkter entlassen. Im Rahmen einer Evaluierungsstudie von Nosper (1999) wurden an 266 Patienten, in stationärem Setting, die Veränderung der Symptomatik während der Behandlung und am Schluss erfasst. Es zeigten sich bereits nach drei Wochen durchschnittliche Effektstärken von 0,4 (auf dem GSI des SCL-90-R). Bei Entlassung, durchschnittlich nach 45 Tagen, steigerten diese sich jedoch auf Werte von 0,65 bis 0,8. Dies belegt einen positiven Zusammenhang zwischen Behandlungsdauer und Therapieerfolg. Berücksichtigt man die Katamneseergebnisse, wird außerdem deutlich, dass Langzeiteffekte der Behandlung erst nach drei Wochen auftreten. Nach Nosper (1999), sprechen klinische Erfahrung und Ergebnisse der Forschung dafür, dass im Bereich der stationären Psychotherapie und psychosomatischen Rehabilitation ein Behandlungsbedarf von mindestens sechs Wochen besteht. Borgart & Meermann (1999) fanden in ihrer Untersuchung von Patienten einer psychosomatischen Klinik ebenfalls einen deutlich positiven Zusammenhang zwischen Behandlungsdauer und dem von dem Therapeuten eingeschätzten Therapieerfolg. Ebenso zwischen Behandlungsdauer und Arbeitsfähigkeit nach Behandlung. Da das Therapeutenurteil mit dem Patientenurteil korrelierte, kann man davon ausgehen, dass es sich hierbei nicht um eine Dissonanzreduktion handelt, im Sinne von, wer länger bleibt, muss sich auch stärker verbessert haben. Es existieren jedoch auch Studien die diesen Ergebnissen widersprechen. Bassler et al. (1995) konnten für Patienten einer psychosomatischen Klinik keine Korrelation zwischen Behandlungsdauer und Erfolg finden. Auch in einer aktuelleren Untersuchung von Fliege et al. (2002) stellte die Verweildauer in einer Regressionsanalyse keinen Prädiktor für Erfolgsmerkmale dar. Einige Untersuchungen sprachen für einen bedingten Dauer-Erfolg-Zusammenhang: Lamprecht & Schmidt (1990) zeigten im Rahmen der psychosomatischen Rehabilitation auf verschiedenen Veränderungsmaßen, dass eine mittlere Therapiedauer von 6 – 8 Wochen gegenüber längerer (mehr als 8 Wochen) und kürzerer (4-6 Wochen) Dauer, bessere Ergebnisse in der Patientenbeurteilung zu Behandlungsende und katamnestisch bis zu drei Jahre später erbringen. In der Studie von Neeb et al. (2001) erbrachte ebenfalls eine Gruppe mit mittellanger Aufenthaltsdauer die größten Effekte. 47 Sie kamen zu dem Schluss, dass, wenn ein Zusammenhang existiere, so könne er nicht linear sein. Schmitz-Buhl et al. (1999) zeigten den Einfluss von Dauer nur im Zusammenhang mit Therapiemotivation und Beschwerdedruck, der Einfluss der Dauer alleine war schwach. Viele der aktuelleren Untersuchungen zeigten dann doch wieder deutlichere Zusammenhänge. Figuerora et al. (2004) und Heeren et al. (2002) konnten zeigen, dass die Verkürzung der Verweildauer zu höheren Wiederaufnahmeraten führt. Heerens et al. (2002) Studie beschreibt einen Beobachtungszeitraum von 5 Jahren. In dieser Zeit waren die Schweregrade der Erkrankungen gleich geblieben, die durchschnittliche Verweildauer war gesunken und die Wiederaufnahmerate hatte sich verdoppelt. Hermann (2007) führte einen Vergleich verschiedener Kliniken durch, dabei zeigte er, je kürzer die durchschnittliche Behandlungsdauer, desto geringer die erreichten Effektstärken (gemessen durch den BDI und den SCL-90-R). Spießl (2006) beschreibt ebenfalls den sogenannten „Drehtüreffekt“ in einer umfassenden Studie. Die Verweildauer nimmt ab, die Patienten werden bei niedrigerer psychosozialer Leistungsfähigkeit entlassen und die Wiederaufnahmeraten steigen. Dadurch entsteht keine Kosteneinsparung, denn die kumulative Verweildauer bleibt weitestgehend konstant. Auch diese Studie spricht somit für den positiven Zusammenhang zwischen Therapiedauer und Therapieerfolg im stationären Bereich. Auch im ambulanten Setting wurde der Zusammenhang zwischen Dauer und Erfolg belegt. Die Consumer Reports Study von Seligman (1995), welche in Kapitel 1.3.3. näher beschrieben wurde, zeigt größere Therapieerfolge für spezifische Probleme, genauso wie für die allgemeine Lebensqualität, bei längerer gegenüber kürzerer Psychotherapie. In einer Follow-up-Studie für Langzeitanalysen psychoanalytischer Therapie von Keller et al. (2001) zeigte sich ein statistisch bedeutsamer Zusammenhang zwischen einem Globalurteil für den Therapieerfolg und der Behandlungsdauer. Je länger die Behandlungsdauer war, umso erfolgreicher beschrieben die Patienten ihre Behandlung auch noch 6 Jahre nach Beendigung der Therapie. Das Globalurteil der Patienten stimmte gut überein mit dem Globalurteil der Therapeuten. Die stark zurück gehende Inanspruchnahme von Krankenkassenleistungen bestätigte dieses Ergebnis (Keller et al., 2001). In einer Meta-Analyse zur Untersuchung der Wirksamkeit von psychodynamischer Langzeitpsychotherapie, wurde die Korrelation zwischen Anzahl der Sitzungen und dem Therapieerfolg gezeigt, jedoch keine Korrelation zwischen Therapiedauer und Erfolg. Es scheint als wären Anzahl der Sitzungen und Dauer unterschiedliche Parameter, die auf verschiedene Weisen mit dem Therapieprozess und Erfolg in Beziehung stehen. Insgesamt zeigte sich die 48 Langzeittherapie vor allem bei komplexeren Störungen den kürzeren Therapieformen überlegen (Leichsenring & Rabung, 2008). Eine empirische Einzelfallstudie von Milch (2004) deutet darauf hin, dass eine längere Therapiedauer möglicherweise erst die Bearbeitung tiefer liegender Konflikte ermöglicht, was für eine gute Wirksamkeit notwendig ist. Einige Autoren haben versucht, den Dauer-Erfolg-Zusammenhang genauer zu beschreiben: Steenbarger (1994) untersucht in einem Reviewartikel ausgiebig das Verhältnis zwischen Therapiedauer und Therapieerfolg. Er kommt zu dem Schluss, dass es durch ein komplexes Zusammenspiel von Patient, Therapeut und weiteren Kontextfaktoren gezeichnet ist, welches unter bestimmten Bedingungen eine schnellere Besserung zulässt und unter anderen mehr Zeit für eine Veränderung notwendig macht. Als Beispiel für diese Faktoren zählen Patient-TherapeutenBeziehung, Level des Interpersonalen Funktionsniveau des Patienten und Posttherapeutische Events wie Lebensereignisse oder fortgeführte Therapiestunden nach einer stationären Behandlung. Von Fall zu Fall muss der Zeitbedarf individuell abgewogen werden, je nach Patient, Problem und Zielsetzung. So ist auch die Beziehung Dauer-Erfolg nicht durch eine grundsätzliche Funktion beschreibbar, sondern für jeden Patienten unterschiedlich. Der Versuch eine allgemeine Funktion für das Verhältnis Dauer-Erfolg zu finden wurde von Howard, Kopta und Krause (1986) unternommen. Sie beschrieben das Dosis-Effekt-Modell. 2.3.2. Das Dosis-Effekt-Modell Das Dosis-Effekt-Modell entstand durch eine Meta-Analyse von Howard, Kopta und Krause (1986). Sie verwandten 15 unterschiedliche Datensätze mit zusammen 2,400 Patienten, welche ambulant behandelt wurden. Obwohl sie damit einen Zeitraum von 30 Jahren Forschung abdeckten, waren die Studien in ihrem Aufbau vergleichbar und für ein metaanalytisches Pooling geeignet. Bei dieser Analyse zeigten sich folgende Ergebnisse: Bei ca. 15 % der Patienten stellte sich bereits eine messbare Verbesserung des Wohlbefindens (auf einer Art globalen Rating-Skala) ein, bevor überhaupt die erste Sitzung stattgefunden hatte, einfach als Folge einer Terminvereinbarung mit dem Therapeuten und dem Wissen, dass nun Hilfe naht. Dies lässt sich auch als „spontane Remission“ bezeichnen. Bei 50 % der Patienten konnte man nach der 8. Sitzung eine Besserung feststellen. 75 % der Patienten hatten sich nach 26 Therapiesitzungen verbessert, 85 % der Patienten 49 nach einem Jahr. Die Beziehung zwischen Zahl der Sitzungen und dem Anteil der verbesserten Patienten, „dose-effect-relationship“, wird durch eine exponentielle Kurve gezeichnet. Durch eine log-normal Transformation erhielte man eine lineare Funktion. Diese Kurve beschreibt die Tatsache, dass Therapie zu Beginn große Effekte erzielt und mit dem Fortschreiten immer mehr Sitzungen notwendig werden um noch merkliche Verbesserungen zu erzielen. In der Pharmakologie existiert als Kriterium für eine effektive Dosierung, die Dosis, bei der sich bei 50 % der Patienten eine Wirkung zeigt. Als Übertragung in die Psychotherapie ließe sich als geeignetes Maß 8 Sitzungen annehmen. Patienten, die also weniger als 8 Stunden Therapie gehabt hätten, sollten in der Forschung generell als Patienten ohne adäquate Behandlung behandelt werden (Howard et al. 1986). Howard et al.(1986) schlagen als Zeitbegrenzung für Therapien, falls überhaupt nötig, 26 Sitzungen vor, nach denen sich bei den meisten Patienten eine Besserung zeigen würde. Dies heißt allerdings nicht, dass Patienten, welche nach der 26. Sitzung bereits eine Besserung zeigen, ihre maximalen Heilungschancen ausgenutzt haben. Eine weitere Verbesserung kann durchaus möglich sein. Unterschiede befanden sich zwischen den Diagnosegruppen: Depressive Patienten reagierten bereits nach wenig Therapie durch Veränderung, Angstpatienten bei etwas mehr Therapie und Patienten mit Borderline-Psychosen erst bei höheren Therapiedosen. Was ebenfalls interessant zu erwähnen ist: In der frühen Phase der Behandlung, fühlen sich Patienten besser, als sie klinisch erscheinen, später scheint ihnen der subjektive Wandel geringer zu sein, als die klinische Situation aus Sicht der Therapeuten. 50 2.3.3. Das Phasenmodell Das Phasenmodell therapeutischer Veränderungen wurde von Howard et al. (1993) als Erweiterung des Dosis-Effekt-Modells eingeführt. Dieses zeigt, dass sich unterschiedliche Bereiche im Erleben des Patienten, im Verlauf von Psychotherapie, in unterschiedlichem Ausmaß verändern. Das Modell basiert hauptsächlich auf den Arbeiten von Frank und Frank (1991), die drei Phasen einer Behandlung beschrieben. Die Remoralisierung, die Remediation und die Rehabilitation. 1. Remoralisierung: Sie bezieht sich auf die Verbesserung des subjektiv erlebten Wohlbefindens. Diese Wirkung wird durch unspezifische Faktoren erzielt, welche allen Therapien aber auch anderen hilfreichen Beziehungen, wie z. B. Freundschaften oder religiöser Unterstützung gemein ist. Diese Verbesserung tritt relativ schnell ein. Sie kann schon nach der ersten Terminvereinbarung eintreten, durch das Gefühl des Patienten, mit seinem Leiden nicht alleine sein zu müssen. 2. Remediation: Sie beinhaltet die Reduktion der Symptome oder die Lösung aktueller Lebensprobleme oder beides. Sie umfasst ein Erkennen und Bewerten der Symptome, die Mobilisierung vorhandener Bewältigungsmöglichkeiten oder das Lernen alternativer, eher adaptiver Bewältigungsstrategien, sowie die dauerhafte Anwendung dieser Fertigkeiten und Strategien in kritischen Lebenssituationen. 3. Rehabilitation: Sie kann die Wiederherstellung eines früheren Funktionsniveaus bedeuten, das mit den persönlichen Erwartungen und Fähigkeiten des Patienten übereinstimmt oder aber das Erlernen neuer Rollen fördern, die ein besseres Funktionsniveau zur Folge haben. Diese Phase scheint schneller erreicht zu werden, wenn es sich um das Wiederherstellen eines bereits erlebten Funktionsniveaus geht. Sie kann Jahre dauern, wenn neue Wege der Lebensbewältigung erlernt werden sollen. Das Phasenmodell beschreibt Veränderungen, die sequentiell erfolgen. Das heißt, die Phase der Remoralisierung muss in der Regel erreicht sein, um in die Phase der Remediation einzutreten. Diese wiederum ist Voraussetzung für eine Rehabilitation. Die unterschiedlichen Phasen bringen Veränderungen auf verschiedenen Ebenen mit sich, welche durch jeweils spezifische Erfolgsmaße erfasst werden müssen. 51 Howard et al. (1993) führten eine empirische Studie, im ambulanten Setting, zur Unterstützung des Phasenmodells durch. Dabei verwandten sie primär Methoden zur Selbstbeschreibung des Patienten. Für jede Phase wurden verschiedene Items abgefragt. Gemeinsam werden diese erfragten Werte als Gesamtwert zu einer Art Globalmaß für psychische Gesundheit, unter der Bezeichnung Mental Health Index (MHI) kombiniert. Die Abbildung 4 illustriert das Muster der Verbesserung bezogen auf die drei unterschiedlichen Erfolgsebenen des Phasenmodells. Sie zeigt, dass das Wohlbefinden sich deutlich schneller verbessert als die Symptome, welche sich wiederum schneller verbessern, als das allgemeine Funktionsniveau (Howard et al., 1993). Folgt man den beiden beschriebenen Modellen, lässt sich die abflachende Besserungskurve für einen Patienten einer sequentiellen Veränderung und einer zunehmenden Schwierigkeit der Be52 handlungsziele im Verlauf der Therapie zuordnen (Lutz et al., 2001). Allerdings kann der individuelle Verlauf eines einzelnen Patienten stark vom generellen Trend abweichen. In einer neueren Studie von Lutz et al. (2001) fanden die Modelle Bestätigung und ihre praktische Anwendung wurde untersucht. Durch ein spezielles Verfahren (Hierarchisches Lineares Modell), welches bereits in anderen Studien Anwendung fand (Bryk & Raudenbush, 1992) berechneten sie den individuellen Therapieverlauf eines jeden Patienten (mit Hilfe von bekannten Einfluss nehmenden Variablen) und verglichen die vorhergesagten Werte mit den beobachteten Werten. In ihrer Patientenstichprobe befanden sich 11000 Patienten, welche ambulant behandelt wurden. Sie bestätigten mit ihren Daten den phasenhaften Verlauf der Besserung, mit zuerst auftretendem subjektiven Wohlbefinden, dann den abnehmenden Symptomen und zuletzt der zurückkehrenden Funktionalität. Sie zeigten ebenfalls die unterschiedliche Geschwindigkeit der Verbesserung für verschiedene Syndrome/Symptome, z.B. Angststörung vs. Depression und ein Dosis-EffektVerhältnis, vergleichbar zu den Ergebnissen von Howard und Kopta (1986). Ihr Versuch individuelle Therapieverläufe hervor zusagen, war größtenteils gelungen. Der Nutzen darin läge in der Möglichkeit erfolglose Therapien früh zu erkennen und entsprechend umzugestalten. Die Autoren betonten jedoch auch, dass nicht jeder Verlauf diesen Modellen entspricht und daher die Notwendigkeit bestünde, nach weiteren Verlaufsmustern zu suchen. Man kann davon ausgehen, dass ein Zusammenhang zwischen Behandlungsdauer und Therapieergebnis sehr wahrscheinlich ist. Die Art des Zusammenhangs lässt sich bisher jedoch nicht sicher ergründen. Das Dosis-Effekt-Modell und das Phasenmodell sind plausible Ansätze diesen Zusammenhang zu beschreiben und Erklärungen dafür zu finden. Die Beschreibungen der Modelle gelten allerdings lediglich für Therapien im ambulanten Bereich, ob sich diese auch auf das stationäre Setting übertragen lassen, ist bis heute nicht untersucht worden. Zusammenfassend kann man sagen, dass eine längere Therapiedauer, sowohl ambulant, als auch stationär größere Therapieerfolge erzielt, als eine kurze Therapiedauer. Jedoch muss im Einzelfall entschieden werden, ab wann der zusätzliche Nutzen, die Steigerung des Therapieerfolges, zu gering wird, um das Weiterführen einer Therapie zu rechtfertigen. 53 2.4. Behandlung in einer psychosomatischen Klinik Die Behandlung in der Thure-von-Uexküll-Klinik und der psychosomatischen Universitätsklinik erfolgt nach einem multimodalen Ansatz. Es sind Ärzte, Psychologische Psychotherapeuten, Spezialtherapeuten sowie Sozialarbeiter und Pflegepersonal beteiligt. Der Schwerpunkt liegt auf verbalen Interventionen in Gruppen oder Einzelsitzungen, welche einen tiefenpsychologischen Ansatz verfolgen. Diese werden durch vielfältige Körper- und Kreativtherapien, wie KBT, Kunsttherapie oder Physiotherapie ergänzt. Bewegung und körperliche Selbsterfahrung sind wichtige Bestandteile der Therapie, denn das Behandlungskonzept basiert auf einem Gesundheitsverständnis, das von Wechselwirkungen zwischen seelischen, körperlichen und sozialen Faktoren ausgeht. Auch eine Einbindung der Partner/Familie in das Therapiegeschehen kann daher sinnvoll sein. Es finden regelmäßige Körperarzt und Chefarztvisiten statt, um körperliche Probleme zu betreuen und den Verlauf der Behandlung zu überprüfen. Für jeden Patienten wird ein individueller Therapieplan erstellt, je nach Erkrankung und Bedürfnissen des Patienten. Eventuell kommt auch eine medikamentöse Behandlung zum Einsatz. Im Einzelfall wird auch entschieden, ob eine stationäre oder tagesklinische Behandlung durchgeführt werden soll, dies hängt von der Art der Erkrankung und von äußeren Gegebenheiten, wie z.B. der Anfahrtszeit ab. Die Behandlungsdauer variiert in der Regel zwischen 4 und 12 Wochen. Sie ist von Behandlungszielen, der Erkrankungsschwere und dem Therapieverlauf abhängig. 54 3. Empirische Untersuchung 3.1. Fragestellung und Zielsetzung dieser Arbeit Im Theorieteil wird ersichtlich, dass die Verweildauer in der stationären Psychotherapie aus Kostengründen zu einem wichtigen Thema geworden ist und ihre Bedeutung für den Therapieerfolg noch umstritten ist. Zwar wurde bereits durch mehrere Untersuchungen ein Zusammenhang zwischen Dauer und Erfolg gezeigt, doch weiß man noch zu wenig über ihn, als dass man festlegen könnte, wie lange eine optimale Therapiedauer sein müsste. Unklar ist noch die genaue Größe des Einflusses der Therapiedauer, auch im Vergleich zu anderen Einflussfaktoren. Auch ob der Einfluss ab einer gewissen Zeit abnimmt oder ob er für verschiedene Krankheitsbilder oder für verschiedene Schweregrade einer Erkrankung unterschiedlich stark ausgeprägt ist, muss noch gründlicher untersucht werden. Interessant ist auch die Frage wie schnell die verschiedenen Ebenen des Therapieerfolgs auf Therapie ansprechen, ob die Dauer der Therapie für manche Ebenen entscheidender ist als für andere. Bisher existieren auch erst wenige Studien zum Thema Verweildauer und langfristige Therapieerfolge. Diese Arbeit soll einen kleinen Beitrag zur Klärung dieser Fragen leisten. Das Ziel dieser Untersuchung ist es, herauszufinden, ob bei einer stationären Behandlung ein Einfluss der Verweildauer auf den Therapieerfolg besteht und gegebenenfalls, wie groß dieser ist. Außerdem soll der Einfluss der Therapiedauer auf verschiedene Erfolgsmaße und für verschiedene Diagnosegruppen untersucht werden. Anschließend wird betrachtet, welche Rolle die Therapiedauer für Langzeitergebnisse spielt. Dafür untersuche ich zuerst allgemein, welche Patientenvariablen im Zusammenhang mit der Verweildauer und im Zusammenhang mit dem Behandlungserfolg stehen. Anschließend soll der Einfluss der Dauer auf den Erfolg, unter Berücksichtigung dieser Patientenvariablen genauer untersucht werden. Daraus leiten sich folgende konkrete Fragestellungen ab: Fragestellung 1: Unterscheiden sich Patienten mit längerer Verweildauer von Patienten mit kürzerer Verweildauer in soziodemografischen oder krankheitsbezogenen Variablen? 55 Fragestellung 2: Unterscheiden sich Patienten mit größerem Therapieerfolg von Patienten mit geringerem Therapieerfolg, in soziodemografischen oder krankheitsbezogenen Variablen? Fragestellung 3: Unterscheiden sich Patienten mit längerer Therapiedauer und Patienten mit kürzerer Therapiedauer in ihrem Therapieergebnis, bzw. ist Therapieerfolg mit der Verweildauer korreliert? Fragestellung 4: Welche Faktoren beeinflussen die Verweildauer? Fragestellung 5: Welche Faktoren beeinflussen das Therapieergebnis? Beeinflusst der Faktor Verweildauer das Ergebnis und wenn ja, wie stark? Zeigt sich der Einfluss für verschiedene Erfolgsmaße unterschiedlich stark? Zeigt sich der Einfluss der Verweildauer auch noch in Langzeitergebnissen? Zeigt sich der Einfluss der Verweildauer in den Diagnosegruppen unterschiedlich stark? 3.2. Methodik 3.2.1. Untersuchungsdesign Diese Fragen möchte ich in meiner Arbeit anhand einer Patientenstichprobe (N = 604) mit statistischen Methoden untersuchen. Die Patienten wurden in einem Zeitraum von drei Jahren, 2005 bis 2007 in der Thure-von-Uexküll-Klinik und der psychosomatischen Universitätsklinik Freiburg behandelt. Es ist eine naturalistische Studie nach einem Prä-Post-Follow-up-Design, ohne Kontrollgruppe. Die Datenerhebung erfolgte demnach zu Beginn der Therapie, zum Zeitpunkt der Entlassung und nachfolgend zu den Zeitpunkten der 3-Monats- bzw. 1-Jahres Katamnesen. Zum Einsatz kamen valide und reliable Fragebögen (siehe Kap. 2.2.3.), in denen die Patienten ihre Symptome und ihr Befinden selbst beurteilten, außerdem die Psychotherapeuten- Basisdokumentation, die die Einschätzung des Psychotherapeuten wiedergibt. Durch die Auswertung der Fragebögen lässt sich die Größe des Therapieerfolgs (bzw. -Misserfolgs) feststellen. 56 Zur Auswertung des Datensatzes kommen nun deskriptive, Hypothesen-überprüfende und explorative statistische Methoden zum Einsatz: Es werden Hypothesen gebildet und durch den chi²Test und Fisher's Exakt-Test überprüft. Anschließend werden durch Regressionsanalysen Einflussfaktoren für Verweildauer und Therapieerfolg bestimmt, sowie der Einfluss der Dauer auf den Erfolg. 3.2.2. Datenerhebung und Zusammenstellung der Stichprobe Die Datenerhebung erfolgte in den Jahren 2005 – 2007, an der Psychosomatischen Universitätsklinik Freiburg und der Thure-von-Uexküll-Klinik Freiburg. Die Patienten wurden durch Frage-bögen zu ihrer aktuellen Lebenssituation, zur ihrer Erkrankung, ihren Symptomen und ihrem Befinden befragt. Von therapeutischer Seite wurden ebenfalls Fragebögen ausgefüllt, um eine Einschätzung der Erkrankung des Patienten vorzunehmen. Die folgende Tabelle gibt das Schema der Datenerhebung, wie sie zuletzt vorgenommen wurde wider. 57 Die Einführung der Dokumentation erfolgte teilweise erst im Jahr 2006, weshalb die FragebogenWerte nicht für alle Patienten vorhanden sind. Auch auf Grund von fehlerhafter Dokumentation ergeben sich viele fehlende Werte. Dies zeigte sich als Problem bei der Bewertung der Ergebnisse. 3.2.3. Erhebungsinstrumente BDI „Beck Depression Inventory“ Der Beck-Depressionsinventar ist die deutsche Version, welche von Hautzinger aus dem englischen übersetzt wurde (Hautzinger, 1994). Es ist ein Instrument zur Beurteilung der Schwere einer Depression bei Erwachsenen über 18 Jahren, welches besonders aussagekräftig bei mäßigmittelgradigen Depressionen ist. Er wurde primär für den klinischen Gebrauch entwickelt, dennoch wurde die Reliabilität und der Nutzen des Fragebogens für Stichproben einer gesunden Bevölkerung in Studien belegt. Er sollte jedoch nicht als alleiniges Diagnosemittel verwendet werden (Oliver & Simmons, 1984). Ausführung: Es werden 21 Symptome der Depression abgefragt, zu jedem werden 4 Aussagen vorgegeben. Der Patient soll die Aussage auswählen, die am besten sein Befinden der letzten Woche beschreibt. Jedes Item (Aussage) wird auf einer 4-Punkte-Skala bewertet, die von 0 bis 3 reicht. Die Auswertung erfolgt durch Addition der einzelnen Werte. Insgesamt kann ein Maximalwert von 63 Punkten erreicht werden. 58 Beurteilung der Werte: (BDI-Cut-Off-Werte) 0 – 10 Punkte : klinisch unauffällig 11 – 17 Punkte: mild – mäßige Depression 18 – 63 Punkte: klinisch relevante Depression Der Grenzwert von 18 Punkten liegt zwei Standardabweichungen über dem Mittelwert einer gesunden Probandengruppe. SCL-90-R – „Symptomcheckliste von Derogatis“ Verwendet wurde die zweite deutsche Version von Franke (2002). Der SCL-90-R gilt als ScreeningInstrument (Derogatis, 1992) und wird eingesetzt um eine erste Information über das Ausmaß der psychischen Belastung zu erhalten. Es wird die subjektiv empfundene Beeinträchtigung des Patienten, durch seelische und körperliche Symptome, für den Zeitraum der letzten sieben Tage gemessen. Dabei werden neun psychometrische Skalen abgefragt, welche jeweils für die verschiedenen Bereiche stehen: Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Depressivität, Ängstlichkeit, Aggressivität/Feindseligkeit, Phobische Angst, Paranoides Denken und Psychotizismus. Pro Skala werden zehn Items (Symptome) abgefragt. Jedes Item kann vom Patienten in einer von fünf Ausprägungsstufen angekreuzt werden (überhaupt nicht – sehr stark), dabei wird jeder Ausprägung ein Itemwert von 0 – 4 zugeordnet. Die Skalen sind getrennt auswertbar oder durch drei Globale Kennwerte: Der GSI (Global Severity Index) misst die grundsätzliche psychische Belastung, der PSDI (Positive Symptom Distress Index) misst die Intensität der Antworten und der PST (Positive Symptom Total) gibt Auskunft über die Anzahl der Symptome, bei denen eine Belastung vorliegt. Die Auswertung erfolgt durch Transformation der Rohwerte in T-Werte, welche soziodemographische Faktoren berücksichtigen. Diese werden anhand von Normtabellen ermittelt, welche durch eine Normstichprobe erstellt wurde. 59 In meiner Arbeit wird der GSI – Global Severity Index verwendet. Eine Person gilt als psychisch auffällig belastet, wenn: T - GSI ≥ 63 oder T-Wert von 2 Skalen ≥ 63 oder GSI-Cut-Off-Werte: T - GSI 60 - 64: leicht erhöht T - GSI 65 - 69: deutlich erhöht T - GSI 70 - 74: stark erhöht T - GSI 75 - 80: sehr stark erhöht SOMS - „Screening für Somatoforme Störungen“ Das SOMS dient der Erfassung von körperlichen Beschwerden, die nicht auf eine organische Erkrankung zurückzuführen sind (Rief et al., 1997). Es ist ein Instrument zur Klassifikation von Somatisierungspatienten und zur Identifikation von Risikopersonen aus Patientenstichproben. Es werden die Diagnosekriterien nach ICD-10 wie auch nach DSM-IV berücksichtigt. Es gibt unterschiedliche Versionen des SOMS. SOMS-2 erfragt die Symptome der vergangenen 2 Jahre. Er dient zur Statusdiagnostik Es werden 68 Items (Symptome) abgefragt. Anhand der Ergebnisse können drei Indizes erstellt werden: Somatisierungsindex nach ICD-10 Somatisierungsindex nach DSM-IV SAD-Index ICD-10 zur Abklärung einer autonomen somatoformen Störung. Darüber hinaus lässt sich mit SOMS-2 auch ein klassifikationsübergreifender „Beschwerdenindex Somatisierung“ bestimmen, welcher ein gutes Maß für Somatisierungstendenzen aller Art ist. Er ist die Summe aller abgefragten Symptome. Der SOMS-7T wurde zur Veränderungsmessung entwickelt und hat 7 Tage, als Zeitfenster für anzugebende Beschwerden. Er dient zur Therapieevaluation. Bei SOMS-7T lässt sich die Beschwerdeanzahl bestimmen, durch Zusammenzählen aller Symptome, bei denen mindestens ein Wert mit 1 angekreuzt wurde. Es lässt sich jedoch auch ein Intensitätsindex erstellen. Er ist der 60 Mittelwert aller Items, bei denen kein Wert fehlt und sagt somit etwas über die Intensität der Symptome aus. Insgesamt werden 54 Symptome abgefragt, die der Patient auf einer Skala von 0 – 4 (gar nicht bis sehr stark) bewerten muss. Für die Auswertung meiner Ergebnisse kam der Somatisierungsindex nach ICD-10 und der Intensitätsindex zum Einsatz. STAI – ''State Trait Angstinventar'' Es handelt sich um die deutsche Adaptation des von Spielberger, Gorsuch & Lushene (1970) entwickelten «State-Trait-Anxiety Inventory»(Laux et al., 1981). Er besteht aus zwei Skalen zur Erfassung der Angst als Zustandsangst (State-Angst) und der Angst als Eigenschaft (Trait-Angst), welche jeweils mit Items (Feststellungen) abgefragt werden. Spielberger defniert Zustandsangst als einen emotionalen Zustand der gekennzeichnet ist durch Anspannung, Besorgtheit, Nervosität, innere Unruhe und Furcht vor zukünftigen Ereignissen sowie durch eine erhöhte Aktivität des autonomen Nervensystems. Angst als vorübergehender emotionaler Zustand variiert in der Intensität über Zeit und Situationen. Angst als Eigenschaft oder Ängstlichkeit, bezieht sich demgegenüber auf relativ stabile interindividuelle Differenzen in der Neigung, Situationen als bedrohlich zu bewerten und hierauf mit einem Anstieg der Zustandsangst zu reagieren. Hochängstliche tendieren dazu, mehr Situationen als bedrohlich einzustufen und auf solche Situationen mit einem höheren Zustandsangstanstieg zu reagieren als Niedrigängstliche (Spielberger, 1972). Zur Bewertung der Zustandsangst liegen dem Probanden 20 Feststellungen vor. Die Feststellungen (zum Beispiel: „Ich fühle mich ruhig.“), werden vom Probanden bewertet, dies erfolgt auf einer vierstufigen Skala mit Intensitätsangaben: (1) Überhaupt nicht, (2) Etwas, (3)mäßig , (4) sehr Die Bewertung der Angst als Eigenschaft erfolgt ebenfalls an 20 Aussagen. Zur Ermittlung eines Rohwertes eines Probanden, werden für beide Skalen getrennt die Summenwerte der jeweils 20 Aussagen errechnet. Der minimale Summenwert liegt bei 20, der maximale Summenwert bei 80. Der Summenwert der State-Skala (Items 1-20, Form X1) stellt ein Maß dar für die Intensität eines emotionalen Zustands, der gekennzeichnet ist durch Anspannung, Besorgtheit, Nervosität, innerer Unruhe und Furcht vor künftigen Ereignissen. 20 = nicht Vorhandensein dieses Gefühls, 80 = maximale Intensität des Gefühls. Der Summenwert der Trait-Skala (Items 21-40, Form X2) kennzeichnet relativ stabile interindividuelle Differenzen in der Tendenz, Situationen als bedrohlich 61 zu bewerten und hierauf mit einem Anstieg der Zustandsangst zu reagieren. Von der Trait-Angstskala wird sowohl der Bereich der normalen, als auch der neurotischen Angst abgedeckt. Die Grenze lässt sich allerdings nicht durch einen bestimmten numerischen Wert kennzeichnen. Zur groben Beurteilung eines individuellen Trait-Angstwertes hinsichtlich der Abweichung zum Normalen, stehen „Normentabellen“ zur Verfügung. Diese wurden anhand einer Eichstichprobe mit gesunden Probanden erstellt. Anhand der Normentabellen lassen sich T-Werte ablesen, welche sinnvoller zu bewerten sind als die Rohwerte. T-Werte berücksichtigen das Alter und das Geschlecht. FSI – „Fragebogen zur Sozialen Integration“ Der FSI wurde von von Wietersheim et al. (1989) in enger Anlehnung an das „Social Adjustment Scale – Self Report“ (Weissmann & Bothwell, 1976) konstruiert. Soziale Integration beinhaltet, nach von Wietersheim, die Fähigkeit, einer Person, die an ihn gestellten Aufgaben (Erledigung des Arbeitspensums, aktive Teilnahme am Sozial- und Familienleben) bei eigenem Wohlbefinden und gefühlsmäßigem Austausch mit Mitmenschen zu bewältigen. Da die Soziale Integration in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedlich ausgeprägt sein kann, sollte sie getrennt erhoben werden. Der Fragebogen enthält insgesamt 45 Items mit den Skalen Arbeit (6 Items), Freizeit (9 Items), Verwandte (8 Items), Partnerschaft (14 Items), Kinder (7 Items), Finanzen (1 Item). Jedes Item besteht aus einer Frage und fünf abgestuften Antwortmöglichkeiten welchen Rohwerte von 1 bis 5 zugeordnet. Dabei bedeuten kleine Werte eine gute Integration und große Werte eine eher schlechte Integration. Es kann durch Mittelung jeweils ein einzelner Skalenwert berechnet werden. Es ist aber auch die Berechnung eines Gesamtwertes für Integration möglich. Psy-BaDo – „Basisdokumentation in der Psychotherapie“ Die Psychotherapeuten Basis Dokumentation ist ein Instrument zur Qualitätssicherung, welches von zehn psychotherapeutischen Fachgesellschaften, Mitgliedern der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften), gemeinsam entwickelt wurde (Heuft & Senf, 1998). Die Psy-BaDo ist schulenübergreifend und für den ambulanten und stationären Gebrauch einsetzbar. Sie dient zur Diagnostik, sowie zur Erfassung der Prozeß- und 62 Ergebnisqualität. Die Basisdokumentation besteht aus zwei Teilen, der Patienten Selbstauskunft (Patienten-BaDo) zu Beginn, bestehend aus 14 Items (Wohnsituation, Berufliche Situation…), und der Erhebung sachlicher Informationen (Einweiser, Vorbehandlungen…) durch den Therapeuten (Therapeuten-BaDo). Zusätzlich wird durch den Therapeuten der BSS (BeeinträchtigungsSchwere-Score) eingeschätzt, durch den die Beurteilung körperlicher, psychischer und sozialkommunikativer Beeinträchtigungen der letzten 7 Tage und für die letzten 12 Monate vorgenommen wird. Auch eine Einschätzung der Struktur des Patienten, in Bezug auf Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Abwehr, Objektwahrnehmung, Kommunikation und Bindung erfolgt. Ebenfalls Teil der Psy-BaDo ist die GAF – Skala zur globalen Erfassung des Funktionsniveaus, des DSMIV (Saß et al., 1996). Die GAF-Skala dient zur Beurteilung des allgemeinen Funktionsniveaus des Patienten. Diese Information wird zur Therapieplanung, zur Messung ihrer Wirksamkeit und der Prognosestellung verwendet. Es werden nur die psychischen, sozialen oder beruflichen Funktionsbereiche beurteilt. Funktionsbeeinträchtigungen mit körperlicher Ursache sollen nicht berücksichtigt werden. In den meisten Fällen bezieht sich die Beurteilung auf den aktuellen Zeitraum, es können aber auch größere Zeiträume betrachtet werden. Die Skala erstreckt sich von Werten 1 – 100, wobei kleine Werte als ein niedriges Funktionsniveau und größere Werte als ein höheres Funktionsniveau zu verstehen sind. 3.2.4. Operationalisierung des Therapieerfolgs Die Operationalisierung des Therapieerfolgs geschieht durch Bildung von Effektstärken anhand der Fragebögenwerte. Die verwendete Formel wurde von Tscheulin und Schäfer (1993) empfohlen: Effektstärke = Differenz der Werte prä-post ÷ Standardabweichung der Differenzen Es wurden zwar unterschiedliche Varianten für die Berechnung von Effektstärken eingeführt, welche Aspekte von Stichprobengröße und die Abhängigkeit der Messung berücksichtigen. Doch beim Vergleich der verschiedenen Effektstärkeformeln, konnten nur im Bereich von sehr hohen und sehr niedrigen Effektstärken Unterschiede zwischen den Ergebnissen festgestellt werden (Hartmann und Herzog, 1995). 63 Damit wurden für jeden Fragebogen 3 Effektstärken berechnet: • eine Prä-Post-Effektstärke , wobei sich der Postwert auf den Wert bei der Entlassung bezieht. • eine Prä-Kat3-Effektstärke, wobei sich der Postwert auf den Wert zur 3- Monatskatamnese bezieht. • eine Prä-Kat1-Effektstärke, wobei sich der Postwert auf den Wert zur 1- Jahreskatamnese bezieht. 3.3. Statistische Auswertung Alle statistischen Berechnungen werden mit dem statistischen Programmpaket SPSS 17.0 für Windows durchgeführt. Es kommen verschiedene statistische Verfahren zur Anwendung: 3.3.1. Deskriptive Statistik Zur Beschreibung der Stichprobe kommen deskriptive Verfahren zur Anwendung. Zur Veranschaulichung werden Diagramme und Tabellen eingesetzt. 3.3.2. Hypothesentestung / T-Test Zur Fragestellung 1 Unterscheiden sich Patienten mit längerer Verweildauer von Patienten mit kürzerer Verweildauer in soziodemografischen oder krankheitsbezogenen Variablen? Zuerst erfolgt die Bildung von zwei Kohorten. Eine Kohorte mit kurzer Verweildauer (1 - 61 Tage) und eine Kohorte mit langer Verweildauer (62 - 200 Tage). Bei 62 Tagen liegt der Median der Verweildauer, auf diese Weise sind beide Kohorten ungefähr gleich groß. Diese werden auf ihre Zusammensetzung in Bezug auf soziodemografische Faktoren und Patienteneigenschaften untersucht. Die angewendete Methode ist der chi²-Vierfelder- Test oder der Fisher’s Exakte Test für kategoriale Variablen. 64 Es werden zwei Hypothesen gebildet. Durch den chi²- Vierfelder-Test wird beurteilt, ob die Nullhypothese H0 verworfen oder beibehalten werden soll. H0: Die Kohorte „Lange Verweildauer“ unterscheidet sich nicht von der Kohorte „Kurze Verweildauer“ in ihren soziodemografischen und krankheitsbezogenen Eigenschaften. H1: Die Kohorte „Lange Verweildauer“ unterscheidet sich von der Kohorte „ Kurze Verweildauer in ihren soziodemografischen und krankheitsbezogenen Eigenschaften. Als Signifikanzniveau wurde alpha = 0.05 gewählt. Dies entspricht der Irrtums- wahrscheinlichkeit, die man bereit ist, zu akzeptieren, falls das Testverfahren eine Ablehnung der Nullhypothese ergibt, also mit dem Risiko, einen Unterschied zu behaupten, der in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Einem Signifikanzniveau von alpha = 0,01 entspricht der P-Wert: p < 0,01 und wird als hoch signifikant bezeichnet. Einem Signifikanzniveau von alpha = 0,05 entspricht der P-Wert: p < 0.05 und wird als signifikant bezeichnet. Einem Signifikanzniveau von alpha = 0,1 entspricht der P-Wert: p < 0,1 und wird als Tendenz bezeichnet. Untersucht werden sollen die Variablen Alter, Geschlecht, Nationalität, Beruf, Beschwerdedauer, Partnerschaft, Kinder, frühere Suizidversuche, stat./teilstationäre Vorbehandlungen, Erwerbstätigkeit, Setting (stationär/teilstationär), psychische Komorbidität, psychische und körperliche Beeinträchtigung und Behandlungsmotivation. Zur Fragestellung 2 Unterscheiden sich Patienten mit größerem Therapieerfolg von Patienten mit geringerem Therapieerfolg, in soziodemografischen oder krankheitsbezogenen Variablen? Nach dem selben Prinzip werden zwei Kohorten für den Therapieerfolg gebildet. Eine Kohorte „großer Therapieerfolg“ und eine Kohorte „kleiner Therapieerfolg“.Es werden die Effektstärken des BDI und des SCL-90-R verwendet, da für diese Erfolgsvariablen am meisten Werte vorhanden sind. Der Median der BDI-Effektstärken liegt etwa bei 0,8. Dies bedeutet „großer Erfolg“ > 0,8, „kleiner Erfolg“ ≥ 0,8 65 Der Median der SCL-90-R-Effektstärken liegt etwa bei 0,6. Dies bedeutet „großer Erfolg“ ≥ 0,6, „kleiner Erfolg“ < 0,6. Die entsprechenden Hypothesen lauten: H0: Die Kohorte „großer Therapieerfolg“ unterscheidet sich nicht von der Kohorte „ Kleiner Therapieerfolg“ in ihren soziodemografischen und krankheitsbezogenen Eigenschaften. H1: Die Kohorte „großer Therapieerfolg“ unterscheidet sich von der Kohorte „Kleiner Therapieerfolg“ in ihren soziodemografischen und krankheitsbezogenen Eigenschaften. Zur Fragestellung 3: Unterscheiden sich Patienten mit längerer Verweildauer und Patienten mit kürzerer Verweildauer in ihrem Therapieergebnis? Ist Therapieerfolg mit der Verweildauer korreliert? Um auf einen Unterschied in der Verweildauer zu überprüfen werden die Hypothesen wie folgend gebildet: H0: Die Kohorte „großer Therapieerfolg“ unterscheidet sich von der Kohorte „ Kleiner Therapieerfolg“ nicht in ihrer Verweildauer. H1: Die Kohorte „großer Therapieerfolg“ unterscheidet sich von der Kohorte „Kleiner Therapieerfolg“ in ihrer Verweildauer. Es wird zusätzlich untersucht ob die Variable Verweildauer mit den verschiedenen Erfolgsvariablen korreliert. 3.3.3. Lineare Regression Zur Fragestellung 4: Welche Faktoren beeinflussen die Verweildauer? Die Gleichung einer Regressionsanalyse wurde bereits im Theorieteil an Hand der Verweildauer 66 vorgestellt (Kap.1.2.3.). Sie wird hier zur Beantwortung der Fragen als Methode verwendet. Hintereinander werden verschiedene Modelle gebildet (Modell 1 – 3). Modell 1: y i = β0 + β1 XSoz i + Modell 2: y i = β0 + β1 XSoz i + β2 XKranki + εi nach 'Einschluss' Methode Modell 3: y i = β0 + β1 XSoz i + β2 XKranki + εi nach 'Ausschluss' Methode εi nach 'Einschluss' Methode y = Verweildauer i = Beobachtung β = Regressionskoeffizient ε = Residuum X Soz = Soziodemografische Kontrollvariable X Krank = Krankheitsbezogene Kontrollvariable Zuerst wird in Modell 1 der Einfluss der soziodemografischen Variablen auf die Verweildauer untersucht. Daraufhin werden in Modell 2 Variablen mit in die Gleichung aufgenommen, welche die Art und die Schwere der Krankheit beschreiben. Es wird betrachtet, wie sich die Regressionskoeffizienten verändern und welche Einflüsse sichtbar werden. Dies geschieht mit der ‚Einschluss’- Methode , was bedeutet, dass alle Variablen in das Modell aufgenommen werden, auch wenn ihr Regressionskoeffizient nicht signifikant verschieden von Null ist. In einem letzten Schritt wird durch die ‚Ausschluss’- Methode ein Modell gesucht, das die Verweildauer am besten beschreibt (Modell 3). Dabei werden Variablen, die das Modell nicht signifikant verbessern, (analog ihr Regressionskoeffizient nicht signifikant verschieden von Null ist) ausgeschlossen. Grundlage dafür ist der F-Test, welcher prüft ob bei Ausschluss einer Variable R² (Bestimmtheitsmaß) signifikant sinkt. Zur Fragestellung 5: Welche Faktoren beeinflussen das Therapieergebnis? Beeinflusst der Faktor Verweildauer das Ergebnis und wenn ja, wie stark? Zeigt sich der Einfluss für verschiedene Erfolgsmaße unterschiedlich stark? Zeigt sich der Einfluss der Verweildauer auch noch in Langzeitergebnissen? Zeigt sich der Einfluss der Verweildauer in den Diagnosegruppen unterschiedlich stark? 67 Auch bei dieser Fragestellung kommt die Regressionsanalyse zum Einsatz, dabei werden verschiedene Erfolgsmaße als abhängige Variable verwendet. Es werden nacheinander Modelle gebildet, welche zuerst allein die Beziehung zwischen Dauer und Erfolg beschreiben (Modell A), und dann anschließend weitere Variablen mit einbeziehen (Modell B und C). Es wird auch ein Modell mit der ‚Ausschluss’- Methode gebildet (Modell D). Modell A: y i = β0 + β1 Dauer i + ε Modell B: y i = β0 + β1 Dauer i + β2 XSoz i + Modell C: y i = β0 + β1 Dauer i + β2 XSoz i + β3 XKranki + εi nach 'Einschluss' Methode Modell D: y i = β0 + β1 Dauer i + β2 XSoz i + β3 XKranki + εi nach'Ausschluss' Methode nach 'Einschluss' Methode i ε nach 'Einschluss' Methode i y = Effektstärke i = Beobachtung β = Regressionskoeffizient ε = Residuum X Soz = Soziodemografische Kontrollvariablen X Krank = Krankheitsbezogene Kontrollvariablen Der Fokus liegt in meiner Arbeit auf der BDI-Effektstärke und der SCL-90-Effektstärke, da sie den Erfolg der Therapie allgemeiner beschreiben, als die übrigen Effektstärken und unter ihnen die wenigsten fehlenden Werte vorkommen. Doch auch die Effektstärken der anderen Fragebögen werden untersucht. Weiterhin werden die Effektstärken des BDI und des SCL-90-R zu den Katamnesezeitpunkten betrachtet. Auch hier kommt erst die ´Einschluss`- Methode und dann die ‚Ausschluss’- Methode zur Anwendung. Es werden außerdem Regressionsanalysen mit der abhängigen Variable BDI-Effektstärke, getrennt nach den vier größten Diagnosegruppen durchgeführt, um zu prüfen ob die Verweildauer für verschiedene Diagnosen unterschiedlich bedeutsam ist. 3.3.4. Umgang mit fehlenden Werten Die fehlenden Werte stellen ein beträchtliches Problem für die Auswertung der Daten dar. Da bei den Patienten jeweils unterschiedliche Angaben fehlen, würde sich der Datensatz sehr stark reduzieren (auf 18 Patienten), wenn man nur die Patienten einschlösse, deren Angaben vollständig vorhanden sind. Der Verlust an Informationen wäre damit sehr groß. Aus diesem Grund wurden alle Patienten im Datensatz belassen, und für die einzelnen Rechnungen konnten auf diese Weise höhere 68 Beobachtungszahlen verwendet werden. In den Vierfeldertafeln lässt sich jeweils erkennen, wie groß die Anzahl der fehlenden Werte ist. In die Regressionsanalysen werden nur die Patienten eingeschlossen, deren Daten für alle eingeschlossenen Variablen vollständig sind. Die Beobachtungszahlen sind daher in Bezug auf die Gesamtstichprobe eher gering und für die einzelnen Rechnungen unterschiedlich groß. Auf Grund dieser variierenden Stichprobengrößen unter den Regressionsanalysen, wird zum Schluss die Robustheit der Ergebnisse für die BDIEffektstärke überprüft. Dies geschieht folgendermaßen: Zunächst wird ein Datensatz gebildet, welcher der Teilstichprobe aus Modell C der Tabelle 10 entspricht. In diesem Modell C ist die BDI-Effektstärke abhängige Variable und es wird sowohl auf soziodemografische als auch auf krankheitsbezogene Variablen kontrolliert. Mit diesem Datensatz werden die selben Rechnungen wiederholt durchgeführt (Modell A – D). Daraufhin wird verglichen ob sich die beobachteten Effekte für einen konstanten Datensatz reproduzieren. Als zweiter Test wird ein weiterer Datensatz gebildet, in dem sich jene Patienten befinden, deren Effektstärken zu allen drei Post-Messzeitpunkten vorhanden sind. Es werden Regressionsanalysen für jeden Zeitpunkt durchgeführt, wobei auf soziodemografische und krankheitsbezogene Variablen kontrolliert wird, welche in den vorigen Modellen signifikanten Einfluss auf das Therapieergebnis zeigten. Auch hier wird verglichen, in wieweit sich die Ergebnisse aus den vorigen Rechnungen bestätigen lassen. 3.4. Ergebnisse 3.4.1. Beschreibung der Stichprobe / Behandlungsergebnisse Beschreibung der Stichprobe: Die Stichprobe besteht aus 604 Patienten, welche im Zeitraum von drei Jahren in der Thure-vonUexküllklinik und der psychosomatischen Klinik der Universität Freiburg behandelt wurden. Im Jahr 2005 waren es 211 (34,9 %) Patienten, im Jahr 2006 waren es 207 (34,3 %) Patienten und im Jahr 2007 waren es 186 (30,8 %) Patienten, deren Daten aufgenommen wurden. 69 Geschlechts- und Altersverteilung Insgesamt besteht die Stichprobe aus 435 Frauen (72 %) und 169 Männern (28 %). Das Alter ist normalverteilt. Der Altersdurchschnitt lag bei 38,97 Jahren (Min.: 18 J. Max.: 72 J.), wobei der Durchschnitt der Frauen bei 38 Jahren und der, der Männer bei 41 Jahren lag. Partnerschaft 124 (20,5 %) Patienten waren verheiratet. 110 (18,2 %) Patienten hatten einen festen Partner ohne verheiratet zu sein. 128 (21,2 %) Patienten hatten langfristig keinen Partner. 46 (7,6 %) waren kurzfristig partnerlos und 11 (1,8 %) Patienten gaben an, ihre Partner häufig zu wechseln. Fehlende Werte von 185 (30,6 %) Patienten. Kinder 174 (28,8 %) Patienten gaben an, Kinder zu haben, 244 (40,4 %) Patienten gaben an keine Kinder zu haben. Fehlende Werte von 186 (30,8 %) Patienten. Haushalt 333 (55,1 %) Patienten leben in ihrem eigenem Haushalt, 53 (8,8 %) Patienten sind im Haushalt der Eltern versorgt, 8 (1,3 %) Patienten leben im Haushalt mit Eltern oder Schwiegereltern gemeinsam, 35 (5,8 %) Patienten leben in einer Wohngemeinschaft. 18 (3 %) Patienten führten einen sonstigen Haushalt. Fehlende Werte von 157 (26 %) Patienten. Erwerbstätigkeit 215 (35,6 %) Patienten waren bei Aufnahme erwerbstätig. 39 (6,5 %) Patienten waren noch in Ausbildung. 22 (3,6 %) Patienten waren Hausfrauen/männer, 20 (3,3 %)Patienten befanden sich in Rente/ Pension und 107 (17,7 %) Patienten waren arbeitslos. Bei 17 (2,8 %) Patienten war der Erwerbsstatus unklar. Fehlende Werte von 184 (30,5 %) Patienten. Ausbildungsgrad 183 (30,3 %) Patienten haben eine Lehre absolviert oder eine Fachschule besucht. 8 (1,3 %) Patienten besitzen einen Meistertitel. 95 (15,7 %) Patienten haben einen Fachhochschul- oder Universitätsabschluss. 31 (5,1 %) Patienten sind noch in der Berufsausbildung.65 (10,8 %) der Patienten besitzen keinen Berufsabschluss. 25 (4,1 %) Patienten haben eine sonstige Ausbildung. Fehlende Werte von 197 (32,6 %) Patienten. 70 Nationalität 406 (67,2 %) Patienten sind Deutscher Nationalität, 18 (3 %) Patienten sind Deutsche Übersiedler/Spätaussiedler, 22 (3,6 %) Patienten sind anderer als Deutscher Nationalität. Fehlende Werte von 158 (26,2 %) Patienten Versicherung 534 (88,4 %) Patienten sind bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert. 35 (5,8 %) Patienten sind bei einer privaten Versicherung versichert. 9 (1,5 %) Patienten besitzen eine private Zusatzversicherung, 26 (4,3 %) Patienten sind sonstig versichert. Diagnosen Die häufigste Einweisungsdiagnose war eine Depressive Störung, für 333 (55,1 %) Patienten. Die zweit häufigste Diagnose für 68 (11,3 %) Patienten war eine Essstörung. Darauf folgte die Diagnose Reaktionen auf schwere Belastungen mit 61 (10,1 %) Patienten. An vierter Stelle lagen die Angststörungen mit 60 (9,8 %) Patienten. 55 (9,1%) Patienten hatten die Diagnose einer Somatoformen Störung. Die Einweisungsdiagnose Persönlichkeitsstörung hatten 14 (2,3 %) Patienten. 14 (2,3 %) Patienten hatten eine sonstige nicht näher bezeichnete Einweisungsdiagnose. Psychische Komorbidität 159 (26,3 %) Patienten hatten nur eine Diagnose zu Beginn der Behandlung. 445 Patienten (73,7%) hatten eine oder mehrere zusätzliche Diagnosen, einer psychischen Erkrankung, neben ihrer Einweisungsdiagnose. 273 (45, 3 %) Patienten hatten eine Nebendiagnose, 135 (22,4 %) hatten zwei Nebendiagnosen. 32 (5, 3 %) hatten drei Nebendiagnosen. 5 (0,8%) Patienten hatten vier Nebendiagnosen. Setting 321 Patienten (53,1 %) befanden sich durchgehend in stationärer Behandlung. 176 Patienten (29,1%) wurden in der Tagesklinik behandelt. Die restlichen 107 (17,7 %) Patienten wechselten während der Behandlung das Setting. 77 (12,7 %)Patienten wechselten von der Station zur Tagesklinik, 16 (2,6 %) Patienten wechselten von der Tagesklinik in die stationäre Behandlung. 14 (2,4 %) Patienten wechselten mehrmals das Setting. Behandlungsmotivation Die Patienten wurden zu Beginn der Behandlung nach ihrer Motivation zur vorgesehenen 71 Psychotherapie befragt. 48 (7,9 %) Patienten gaben an sehr motiviert zu sein, 163 (27 %) Patienten gaben an motiviert zu sein, 59 (9,8 %) Patienten waren nur etwas motiviert und 10 (1,7 %) Patienten antworteten darauf, nur kaum motiviert zu sein. Fehlende Werte von 324 (53,6 %) Patienten. Psychotherapeutische Vorbehandlung 125 (20,7 %) Patienten hatten sich zuvor bereits in stationärer oder teilstationärer Behandlung befunden. 164 (27,2 %) Patienten waren noch in keiner stationären oder teilstationären Behandlung gewesen. Fehlende Werte von 315 (52,2 %) Patienten. 224 (37,1 %) Patienten waren in ambulanter Vorbehandlung, 65 (10,8 %) Patienten hatten keine ambulante Vorbehandlung erhalten. Fehlende Werte von 315 (52,2 %) Patienten. Früherer Suizidversuch 43 (7,1 %) Patienten hatten bereits einen Suizidversuch in der Vergangenheit hinter sich. 246 (40,7 %) Patienten gaben an noch keinen Suizidversuch unternommen zu haben. Fehlende Werte von 315 (52,2 %) Patienten. Körperliche Beeinträchtigung der letzten 12 Monate 69 (11,4 %) Patienten gaben bei Aufnahme an eine starke bis extreme körperliche Beeinträchtigung zu verspüren, 106 (17,5 %) Patienten gaben an eine deutliche, 112 (18,5 %) Patienten nur eine leichte oder keine körperliche Beeinträchtigung verspürt zu haben. Fehlende Werte von 317 (52,5 %) Patienten. Verweildauer Die durchschnittliche Verweildauer lag bei 61,66 Tagen. Die kürzeste Verweildauer lag bei 1 Tag, die längste bei 200 Tagen. Die durchschnittliche Verweildauer unter den Frauen lag bei 63 Tagen, unter den Männern bei 58 Tagen. 72 73 74 Behandlungsergebnisse: BDI-Cut-Off-Werte zu Beginn der Behandlung 49 (8,1 %) Patienten zeigten bei Befragung durch den BDI keine auffälligen Zeichen einer Depression.104 (17,2 %) Patienten zeigten eine milde-mäßige Depressivität. 313 (51, 8 %) Patienten zeigten eine klinisch relevante Depressivität. Von 138 (22,8 %) Patienten fehlen die Angaben. BDI-Cut-Off-Werte zum Abschluss der Behandlung 180 (29,8 %) Patienten zeigten sich zum Ende der Behandlung klinisch unauffällig. 87 (14,4 %) Patienten zeigten noch Symptome einer mild-mäßigen Depressivität. 120 (19,9 %) Patienten hatten noch Zeichen einer klinisch-relevante Depressivität. Von 217 (35,9 %) Patienten fehlen die Angaben. Wie in den Abbildungen 5 und 6 ersichtlich ist, fehlen die Werte von einer beträchtlichen Anzahl an Patienten. Bei Entlassung fehlen deutlich mehr Werte. Interessant ist die Frage, ob die BDI-Werte der Patienten, deren Angaben fehlen, sich zum größeren Teil im Bereich „klinisch unauffällig“ oder eher im Bereich „klinisch relevante Depression“ befinden würden oder ob sie sich im gleichen Verhältnis, wie die übrigen Patienten auf alle drei Bereiche verteilen würden. BDI-Effektstärken zum Ende der Behandlung Der Mittelwert der BDI-Effektststärken liegt bei 0,84. Der Median liegt bei 0,77. Die kleinste Effektstärke lag bei -2,6, die größte erreichte Effektstärke lag bei 4,33. 75 SCL-90-GSI-Cut-Off-Werte zu Beginn der Behandlung 78 (12,9 %) Patienten zeigten nach dem GSI des SCL-90, zu Beginn der Behandlung keine erhöhte psychische Belastung. Bei 69 (11,4 %) Patienten war eine erhöhte psychische Belastung messbar, bei 244 (40,4 %) Patienten war eine stark bis sehr stark erhöhte psychische Belastung messbar. Von 213 (35,3 %) Patienten fehlen die Angaben. SCL-90-GSI-Cut-Off-Werte zum Abschluss der Behandlung 151 (25 %) Patienten zeigten bei Ende der Behandlung keine erhöhte psychische Belastung mehr. Bei 60 (9,9 %) Patienten war noch eine erhöhte psychische Belastung messbar, 85 (14,1 %) Patienten zeigten noch eine stark bis sehr stark erhöhte psychische Belastung. Von 308 (51 %) Patienten fehlen die Angaben. Auch beim SCL-90 nimmt die Anzahl der fehlenden Werte zum Zeitpunkt der Entlassung zu. Es stellt sich die selbe Frage, nach der Verteilung auf die drei Bereiche, welche welche die fehlenden SCL-90-Werte der übrigen Patienten einnehmen würden. SCL-90-Effektstärken zum Abschluss der Behandlung Der Mittelwert der SCL-90-Effektstärken liegt bei 0,71 . Der Median bei 0,58. Die kleinste Effektstärke lag bei -1,88, die größte erreichte Effektstärke lag bei 3,45. 76 Katamneseergebnisse: BDI-Effektstärken zum Zeitpunkt der 3 Monats-Katamnese: Der Mittelwert liegt bei 0,55, der Median liegt bei 0,57. Die größte erreichte BDI-Effektstärke liegt bei 3,24, die kleinste erreichte Effektstärke liegt bei -2,48. BDI- Effektstärke zum Zeitpunkt der 1-Jahres-Katamnese: Der Mittelwert liegt bei 0,56, der Median liegt bei 0,37. Die größte erreichte BDI-Effektstärke liegt bei 2,92, die kleinste erreichte Effektstärke liegt bei -1,7. Durchschnittliche BDI-Werte der Stichprobe im Verlauf der Messungen: Der durchschnittliche BDI-Wert zum Aufnahmezeitpunkt betrug 22,84. Zum Entlassungszeitpunkt lag er nur noch bei 13,86. Zum Zeitpunkt der 3-Monats-Katamnese stieg er wieder an und lag bei 16,54 doch zum Zeitpunkt der 1-Jahres-Katamnese fiel er erneut ab und hatte einen durchschnittlichen Wert von 14,52. Insgesamt kann man die Langzeitergebnisse als stabil betrachten. 77 SCL-GSI-Effektstärken zum Zeitpunkt der 3-Monats-Katamnese: Der Mittelwert liegt bei 0,62, der Median liegt bei 0,52. Die größte erreichte SCL-Effektstärke liegt bei 3,39, die kleinste erreichte Effektstärke liegt bei -1,56. SCL-GSI-Effektstärken zum Zeitpunkt der 1-Jahres-Katamnese: Der Mittelwert liegt bei 0,62, der Median liegt bei 0,55. Die größte erreichte SCL-Effektstärke liegt bei 2,99, die kleinste erreichte Effektstärke liegt bei -0,92. Durchschnittliche T-GSI-Werte des SCL-90-R der Stichprobe im Verlauf der Messungen: Der durchschnittliche T-GSI-Wert zum Aufnahmezeitpunkt betrug 75, 28. Zum Entlassungszeitpunkt fiel er auf den Wert 63,06, zum Zeitpunkt der 3-Monats-Katamnese lag er noch relativ konstant bei 63,35 und zum Zeitpunkt der 1-Jahres-Katamnese stieg er wieder leicht an und lag bei 65,19. Somit waren die Langzeitergebnisse ziemlich stabil. 78 3.4.2. Zur Fragestellung 1 Unterscheiden sich Patienten mit längerer Verweildauer von Patienten mit kürzerer Verweildauer in soziodemografischen oder krankheitsbezogenen Variablen? Bei der Untersuchung der Zusammenhänge von Verweildauer und soziodemografischen und krankheitsbezogenen Merkmalen, wurde durch den chi²-Vierfelder-Test die Unabhängigkeit der Kohorten von bestimmten Variablen getestet. Die Nullhypothese konnte für folgende Variablen verworfen werden: Alter, Kinder, Partnerschaft, Setting, Behandlungsmotivation, Komorbidität Es besteht also ein Zusammenhang zwischen kürzerer Verweildauer und höherem Alter, Kindern zu hause haben, und einem festen (Ehe-)Partner. Eine längere Verweildauer wird begünstigt durch Komorbidität, große Behandlungsmotivation und dem Wechsel des Settings. Patienten, welche nur in der Tagesklinik behandelt wurden neigen zu den kürzeren Verweildauern. Für die soziodemografischen Variablen besteht kein Zusammenhang zwischen der Verweildauer und Geschlecht, Nationalität, Ausbildung, Haushaltssituation und Kostenträger. Für die krankheitsbezogenen Variablen besteht kein Zusammenhang zwischen der Verweildauer und Diagnose, Anzahl der Diagnosen, früherer Suizidversuch, BDI-Cut-Off bei Aufnahme, ambulante Vorbehandlung, teil-/stationäre Vorbehandlung und körperliche Beeinträchtigung innerhalb der letzten 12 Monate. (siehe Anhang 1 und 2) 3.4.3. Zur Fragestellung 2 Unterscheiden sich Patienten mit größerem Therapieerfolg von Patienten mit geringerem Therapieerfolg, in soziodemografischen oder krankheitsbezogenen Variablen? Bei der Untersuchung der Zusammenhänge von Behandlungserfolg und soziodemografischen und 80 krankheitsbezogenen Faktoren, wurde durch den chi² - Vierfelder –Test die Unabhängigkeit der Kohorten von diesen Variablen geprüft. Für BDI-Erfolg: Die Nullhypothese konnte für folgende Variablen verworfen werden: früherer Suizidversuch, BDI-Cut-Off bei Aufnahme, teil-/stat. Vorbehandlung, körp. Beeinträchtigung der letzten 12 Monate Es besteht ein Zusammenhang zwischen größerem Therapieerfolg und einem früheren Suizidversuch und einem hohen BDI-Cut-Off bei Aufnahme. Mit einem geringerem Therapieerfolg ist assoziiert: eine teil-/sationäre Vorbehandlung und eine deutliche körperliche Beeinträchtigung. Es konnte kein Zusammenhang festgestellt werden zwischen BDI-Erfolg und den Variablen: Diagnose, Komorbidität, Anzahl der Diagnosen, Setting, ambulante Vorbehandlung und Behandlungsmotivation. Es bestand kein Zusammenhang zwischen BDI-Erfolg und soziodemografischen Variablen. (siehe Anhang 3 und 4) Für SCL-Erfolg: Die Nullhypothese konnte für folgende Variablen verworfen werden: BDI-Cut-Off bei Aufnahme, teil-/stationäre Vorbehandlung Es besteht ein Zusammenhang zwischen größerem SCL-Therapieerfolg und einem hohen BDI-CutOff bei Aufnahme und eine Verbindung zwischen geringerem SCL-Therapieerfolg und einer stationären Vorbehandlung. Es konnte kein Zusammenhang festgestellt werden zwischen SCL-Erfolg und den Variablen Diagnose, Komorbidität, Anzahl der Diagnosen, Setting, Früherer Suizidversuch, ambulante Vorbehandlung, körperliche Beeinträchtigung der letzten 12 Monate und der Behandlungsmotivation. Es bestand kein Zusammenhang zwischen SCL-Erfolg und soziodemografischen Variablen. (siehe Anhang 5 und 6) 81 3.4.4. Zur Fragestellung 3 Unterscheiden sich Patienten mit längerer Verweildauer und Patienten mit kürzerer Verweildauer in ihrem Therapieergebnis? Bei der Untersuchung des Zusammenhangs von Behandlungserfolg und Verweildauer, wurde durch den chi²-Vierfelder-Test die Unabhängigkeit der Kohorten „kleiner“ Therapieerfolg und „großer“ Therapieerfolg von der Verweildauer geprüft. Dies wurde für die Variablen BDI-Effektstärke und SCL-Effektstärke vorgenommen. Die Nullhypothese konnte hierbei nicht verworfen werden. Es konnte kein Zusammenhang festgestellt werden. Es bestand allerdings eine Tendenz für einen Zusammenhang für die BDI-Effektstärke und die Verweildauer. Es zeigte sich eine Korrelation nach Pearson zwischen Verweildauer und Erfolg für zwei Erfolgs-Variablen: BDI- Effektstärke und GAF- Effektstärke. Die Korrelationen sind auf einem Niveau von 0,01 (2 – seitig ) signifikant. Durch diesen Test ließ sich die Nullhypothese widerlegen. Die Alternativhypothese muss angenommen werden: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Verweildauer und Behandlungserfolg. Die Korrelationsanalyse nach Pearson hat für kontinuierliche Variablen eine größere statistische Power als der chi²-Vierfelder-Test. 82 3.4.5. Zur Fragestellung 4 Welche Faktoren beeinflussen die Verweildauer? Die Regressionsanalyse der Verweildauer wurde an Hand mehrerer Modelle durchgeführt. In Modell 1 wurde für soziodemografische Variablen kontrolliert. In den beiden folgenden Modellen (Modell 2 und 3) wurde zusätzlich für krankheitsbezogene Variablen kontrolliert. Das Alter zeigte sich in allen drei Modellen als ein hoch signifikanter negativer Prädiktor für die Verweildauer. Je höher das Alter, desto kürzer war die Dauer. Eine Ehe zeigte sich in Modell 1 und 2 ebenfalls als ein signifikant die Verweildauer verkürzender Faktor. In Modell 2 und 3 konnten die Regressionskoeffizienten folgender Variablen signifikant / hoch signifikant zur Aufklärung der Varianz der Behandlungsdauer beitragen: Die Variablen Privatversicherung, Essstörung, Somatoforme Störung, große Behandlungsmotivation und ein hoher BDI-Prä-Wert zeigten ein positives Vorzeichen. Die Variablen früherer Suizidversuch und stationäres oder teil/-stationäres Setting zeigten ein negatives Vorzeichen, wirkten also Therapie verkürzend. Ein Problem in der Bewertung der Modelle sind die fehlenden Werte. In Modell 2 und 3 befinden sich nur noch etwa die Hälfte der Patienten aus Modell 1. Durch Modell 2 lassen sich 19 % der Varianz, durch Modell 3 lassen sich 21 % der Varianz der Verweildauer aufklären. 83 84 3.4.6. Zur Fragestellung 5 Welche Faktoren beeinflussen das Therapieergebnis? Beeinflusst der Faktor Verweildauer das Ergebnis und wenn ja, wie stark? Zeigt sich der Einfluss für verschiedene Erfolgsmaße unterschiedlich stark? Zeigt sich der Einfluss der Verweildauer auch noch in Langzeitergebnissen? Zeigt sich der Einfluss der Verweildauer in den Diagnosegruppen unterschiedlich stark? 3.4.6.1. Behandlungserfolg zum Zeitpunkt der Entlassung BDI-Effektstärke: Der bivariate Zusammenhang zwischen Verweildauer und BDI-Effektstärke (Modell A) ist hoch signifikant. In Modell B, unter zusätzlicher Kontrolle für soziodemografische Variablen, bleibt ein signifikanter Einfluss der Verweildauer bestehen. Alter und Ehe haben einen signifikanten negativen Koeffizienten, sind also erfolgsmindernd. Kinder dagegen sind mit einem signifikant positiven Koeffizienten erfolgsfördernd. Dieser Einfluss der soziodemografischen Variablen verschwindet allerdings bei Hinzunahme der krankheitsbezogenen Variablen. Signifikante Regressionskoeffizienten mit positivem Vorzeichen haben Verweildauer, Angststörung, früherer Suizidversuch, BDI- PräWert und FSI-Prä-Wert, mit negativem Vorzeichen: Somatoforme Störung, teil-/stationäre Vorbehandlung und der State-Prä-Wert. Die Verweildauer zeigt also mit und ohne Kontrolle für weitere Variablen einen hoch-/signifikanten Einfluss auf die BDI-Effektstärke. Durch Modell C und D lassen sich knapp 40% der Varianz des BDI-Erfolgs aufklären. 85 86 Kontrolle der Robustheit Da sich die Anzahl der Beobachtungen von Modell A bis Modell C um mehr als die Hälfte verringert, wird eine Kontrolle für die Robustheit der Ergebnisse durchgeführt. Dabei wird für alle Patienten aus Modell C die gleiche Reihe an Regressionen (Modell A - D) wiederholt um zu sehen, ob eine einheitliche Stichprobe zu gleichen Ergebnissen führt. Die Regressionskoeffizienten der Verweildauer verändern sich auch für diese Auswahl an Patienten zwischen den einzelnen Modellen wenig. Sie sind insgesamt leicht größer als in Tabelle 11, die Signifikanz bleibt hoch. Es bestätigt sich also die Aussage, dass die Verweildauer – gleichgültig ob und für welche Variablen man kontrolliert einen deutlichen Einfluss auf das Therapieergebnis hat. (siehe Anhang 9) SCL – Effektstärke: In Modell A zeigt sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen Verweildauer und SCLEffektstärke. Auch in den Modellen B-D wird dieser nicht sichtbar. Auch soziodemografische Variablen scheinen keinen Einfluss auf die SCL-Effektstärke zu nehmen. Lediglich in Modell D bildet sich ein Tendenz für den negativen Einfluss des Alters ab. Einen negativen Einfluss auf das Ergebnis zeigen in Modell C: eine deutliche körperliche Beeinträchtigung in den vergangenen 12 Monaten, die Diagnose einer Somatoformen Störung und ein hoher BDI-PräWert. In Modell D kommt mit negativem Einfluss hinzu, eine stationäre Behandlung, die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung und das Alter. Einen positiven Einfluss auf das Ergebnis zeigen in Modell C: Große Behandlungsmotivation und ein hoher SCL-Prä-Wert. In Modell D zeigt sich zusätzlich eine Tendenz für einen positiven Einfluss bei der Diagnose einer Depression. Modell C klärt 43% und Modell D 48% der Varianz der SCL-Effektstärke auf. Auch hier muss bedacht werden, dass Modell C und D auf Grund der vielen fehlenden Werte nur eingeschränkt aussagekräftig sind bzw. für den Gesamtdatensatz verallgemeinerbar sind. 87 88 3.4.6.2. Der Einfluss der Verweildauer auf weitere Erfolgsmaße GAF – Effektstärke Modell C und D bringen hier die gleichen signifikanten Koeffizienten hervor. Die Verweildauer zeigt einen hochsignifikanten positiven Einfluss auf das GAF-Ergebnis. Soziodemografische Variablen hatten keine signifikanten Regressionskoeffizienten. Einen signifikant negativen Einfluss zeigen Komorbidität, früherer Suizidversuch, BDI- Prä-Wert und GAF- Prä-Wert. Einen signifikant positiven Einfluss zeigt eine große Behandlungsmotivation auf das Ergebnis. State- Effektstärke In Modell C, bei Kontrolle auf sämtliche soziodemografische und krankheitsbezogene Variablen, zeigt die Verweildauer als Tendenz einen positiven Einfluss auf den Behandlungserfolg. Diese Tendenz verschwindet in Modell D, nach schrittweisem Ausschluss der Variablen durch SPSS. Weiterhin ist der positive Einfluss der Behandlungsmotivation auf das Ergebnis in beiden Modellen sichtbar, sowie ein hoher State-Wert zu Beginn der Behandlung. Tendenziell positiven Einfluss auf das Ergebnis zeigten die Variablen Tagesklinik und SCL-Prä-Wert. Einen negativen Einfluss auf den Therapieerfolg hat dagegen ein hoher Trait-Prä-Wert, so wie eine teil-/stationäre Vorbehandlung und nur in Modell A tendenziell das Alter, das Vorhandensein einer Essstörung. Trait – Effektstärke Hier hat die Verweildauer keinen sichtbaren Einfluss. Man sieht positive Koeffizienten für die Variablen große Behandlungsmotivation, GAF-Prä-Wert und Trait-Prä-Wert. Negative Koeffizienten zeigen sich für teil-/stationäre Vorbehandlung so wie State-Prä-Wert. Effektstärken für SOMS7 – Intensitätsindex und SOMS7 – Beschwerdeindex Für beide Effektstärken ließ sich auf Grund zu weniger Beobachtungen keine Regressionsanalyse durchführen. In einer bivariaten Untersuchung zeigte sich jeweils kein signifikanter Zusammenhang zwischen Verweildauer und Ergebnis. 89 FSI – Effektstärke In Modell C und Modell D hat ein hoher FSI-Prä-Wert einen signifikant hohen positiven Einfluss auf das Ergebnis. Die Diagnose einer Depression, so wie eine teil-/stationäre Vorbehandlung zeigen einen negativen Einfluss auf das Ergebnis. Kein Zusammenhang besteht zwischen FSI-Effektstärke und Verweildauer. (siehe Anhang 7 und 8) 3.4.6.3. Behandlungserfolg zum Zeitpunkt der Katamnesen Hierfür wurden die Effektstärken des BDI und des SCL- 90 verwendet. BDI- Effektstärke zur 3-Monats-Katamnese: In Modell C ist nur der BDI- Prä-Wert ein signifikanter, positiver Prädiktor. Nach schrittweisem Ausschluss durch SPSS, in Modell D, treten auch die Variablen Erwerbstätigkeit und Essstörung als positive Prädiktoren für das Ergebnis hervor. BDI-Effektstärke zur 1-Jahres-Katamnese: In Modell C zeigt sich wiederum nur die Essstörung als signifikanter, diesmal negativer Einflussfaktor. Ein hoher State- Wert zu Behandlungsbeginn nimmt tendenziell negativen Einfluss auf das Langzeitergebnis. In Modell D werden mehrere Faktoren sichtbar. Einen positiven Einfluss zeigen: Verweildauer, BDI-Prä-Wert und SCL- Prä-Wert, negativen Einfluss nehmen: teil-/stationäre Vorbehandlung, Somatoforme Störung, Essstörung, Depression und ein hoher StateWert bei Aufnahme. Auch hier müssen die Ergebnisse der Regressionsanalyse wegen kleiner Beobachtungszahl mit Vorsicht beurteilt werden. 90 91 Überprüfung der Robustheit: Es wird eine Stichprobe gebildet, welche sich nur aus jenen Patienten zusammensetzt, deren Effektstärken zu allen drei Post-Messzeitpunkten vorhanden sind. Es wird zunächst der bivariate Zusammenhang zwischen Verweildauer und BDI-Effektstärke berechnet und darauf werden Regressionsanalysen für jeden Zeitpunkt durchgeführt, wobei auf soziodemografische und krankheitsbezogene Variablen kontrolliert wird, welche in den vorigen Modellen (Tabelle 14) signifikanten Einfluss auf das Therapieergebnis zeigten. Die Regressionskoeffizienten behalten gleiche Vorzeichen und haben tendenziell ähnliche Größenordnungen. Die Signifikanz der einzelnen Koeffizienten nimmt ab, was bei einer Beobachtungszahl von 46 Patienten zu erwarten ist. Wichtig ist, dass die Regressionsanalysen die gleichen Effekte beschreiben, wie die vorigen. Die Aussagen werden somit bestätigt. (siehe Anhang 10) SCL-90-R-Effektstärke zur 3-Monats-Katamnese: In Modell C, bei Kontrolle für alle soziodemographische und krankheitsbezogene Variablen, lässt sich nur BDI-Prä-Wert mit negativem Vorzeichen und SCL-90-Prä-Wert, mit positivem Vorzeichen als Einflussfaktor identifizieren. In Modell D tritt mit positivem Vorzeichen noch die Behandlung in der Tagesklinik auf, so wie mit negativem Vorzeichen das Alter und eine teil-/stationäre Vorbehandlung. SCL-90-R-Effektstärke zur 1-Jahres-Katamnese: Modell C zeigt als tendenziell negative Prädiktoren: Alter, Erwerbstätigkeit, teil-/stationäre Vorbehandlung, als tendenziell positiven Prädiktor den SCL-Prä-Wert. In Modell D treten signifikant als negative Einflussfaktoren auf: Alter, Erwerbstätigkeit, Essstörung, Somatoforme Störung, Komorbidität, teil-/stationäre Vorbehandlung und keine-geringe körperliche Beeinträchtigung, 12 Monate vor Behandlung. Mit kleinerem Koeffizienten zeigt sich auch deutliche körperliche Beeinträchtigung als negativer Prädiktor. Die dritte Dummy-Variable wäre hier starke-extreme körperliche Beeinträchtigung, welche sich in der Gleichung vermutlich als ein positiver Prädiktor zeigen würde. Einen positiven Einfluss auf das Ergebnis haben Angststörung, große Behandlungsmotivation und ein hoher SCL-Prä-Wert. Die Verweildauer zeigt zu beiden Katamnesezeitpunkten keinen signifikanten Einfluss auf die SCL-Effektstärke. 92 93 Auch hier gilt, wegen der geringen Zahl an Beobachtungen, dass die Ergebnisse nicht repräsentativ für den ganzen Datensatz sind. 3.4.6.4. Unterschiede des Einflusses der Verweildauer in verschiedenen Diagnosegruppen Es wurden Regressionsanalysen mit BDI- Effektstärke als abhängige Variable durchgeführt, dabei wurde auf soziodemografische und krankheitsbezogene Variablen kontrolliert. In den Diagnosegruppen Depressive Störung, Anpassungsstörung und Somatoforme Störung, zeigte die Verweildauer einen signifikant positiven Einfluss auf den Therapieerfolg. Kein sichtbarer Einfluss zeigte sich für die Diagnosegruppen Essstörung und Angststörung. Da durch die Aufteilung des Datensatzes nach Diagnosen nur noch besonders wenige Beobachtungen in die einzelnen Regressionsanalysen eingeschlossen wurden, kann man die Ergebnisse nur noch als mögliche Tendenz betrachten. 94 3.5. Diskussion 3.5.1. Diskussion der Stichprobe Die Stichprobengröße von 604 Patienten lässt sich mit der Stichprobengröße anderer Studien vergleichen (Junge & Ahrens, 1996: 164 Pat.; Fliege et al., 2002: 712 Pat.; Schmitz-Buhl et al., 1999: 686 Pat.; Huber et al., 2009: 437 Pat.; Geiselmann & Linden 2001: 150 Pat.; Schauenburg et al., 2005: 293 Pat.; Creed et al., 1997: 115 Pat.). Da jedoch viele Angaben der einzelnen Patienten fehlen, mussten für die durchgeführten statistischen Untersuchungen Anteile ausgeschlossen werden. Dadurch verringert sich die Aussagekraft der Ergebnisse, da man nicht sicher davon ausgehen kann, dass die Ergebnisse repräsentativ für die Gesamtstichprobe sind oder generell auch für Patienten anderer Kliniken gelten kann. Ein weiteres Problem kleiner Stichproben ist die Gefahr, dass kleine Effekte übersehen werden können. Es lässt sich leider nicht sinnvoll erklären, wieso ein großer Teil der Daten fehlt, auch nicht durch die sequentielle Einführung der Fragebögen, denn auch bei den Fragebögen, welche bereits vor 2005 benutzt wurden, fehlen viele Daten. Es ist vermutlich auf mangelhafte Organisation bei der Erfassung der Daten zurückzuführen. Da die Fragebögen bei Aufnahme und bei Entlassung direkt in der Klinik ausgefüllt wurden, lassen sich nur fehlende Katamnese-Fragebögen auf die eventuell mangelnde Motivation der Patienten zurückführen. Vereinfachend kann man daher annehmen, dass die vorhandenen Daten nicht nach einem bestimmten Muster selektiert wurden, sondern es sich hier um eine Zufallsauswahl handelt und demnach hoffentlich möglichst repräsentativ für den Rest der Stichprobe ist. Es ist möglich, dass zu den Katamnesezeitpunkten eine gewisse Selektion der Patienten stattgefunden hat. Allerdings ist nicht klar, nach welcher Art. Einerseits könnte man annehmen, dass tendenziell eher Patienten mit positiv verlaufener Therapie aus Dankbarkeit oder Freude über ihre Genesung motiviert sind, Fragebögen auszufüllen. Andererseits könnte man ebenso vermuten, dass Patienten, denen es immer noch schlecht geht, das Bedürfnis haben, dies mitzuteilen. Die Mittelwerte der BDI-Effektstärke sind zur 1-Jahreskatamnese etwas schlechter, was einer normalen Entwicklung entspricht und auch in anderen Studien berichtet wurde (Beutel et al., 2005; Sack et al., 2003; Fliege et al., 2002; Steffanowski et al., 2007). Es bleibt dabei unklar in welche Richtung 95 eine mögliche Selektion vor sich ging. Genauso unsicher ist es in wie weit diese Selektion der Patientendaten sich auf die Beantwortung meiner Fragen auswirkt. Es werden auf Grund der fehlenden Werte zwei Verfahren zur Überprüfung der Robustheit der Ergebnisse eingesetzt, welche in Kapitel 2.3.4. und im Kap.2.4. genauer beschrieben werden. Die Geschlechterverteilung ist mit 72 % Frauen und 28 % Männern nicht ausgewogen. Dies entspricht jedoch einem üblichen Verhältnis der Geschlechter von Patienten in psychosomatischen Kliniken (Junge und Ahrens, 1996; Schmitz-Buhl et al., 1999; Tritt et al., 2003; von Heymann et al., 2003). Das Alter der Patienten ist normalverteilt, außer, dass, wie für Erwachsenenkliniken üblich ist, keine Patienten unter 18 Jahren behandelt wurden. Das Durchschnittsalter liegt bei 39 Jahren, welches dem anderer Studien ähnelt (Tritt et al., 2003: 41 J.; Richter, 1999: 42 J.; Stevens et al., 2001: 41 J.; Dinger et al., 2008: 38 J.). Die durchschnittliche Verweildauer von 62 Tagen war ebenfalls mit anderen Kliniken vergleichbar (Junge und Ahrens, 1996: 67 T.; Tritt et al., 2003: 57 T.; Richter 1999: 47 T.; Janssen et al., 1999: 66 T.). 3.5.2. Diskussion der Methode Das Ziel der Studie war nicht der Nachweis der Wirksamkeit von Therapie. Es stand die Frage um die Einflüsse, besonders den der Verweildauer, auf den Therapieverlauf im Vordergrund. Daher ist das naturalistische Design der Studie ein Vorteil, denn es ermöglichte die Untersuchung von Therapie wie sie tatsächlich verläuft. Es wird die Verweildauer beurteilt, wie sie im Klinikalltag vorkommt und nicht, wie sie durch ein Studiendesign vorgegeben wird. Kontrollgruppen oder eine Randomisierung auf verschiedene Behandlungsgruppen wären hinderlich zur Beurteilung der Verweildauer in Hinsicht auf konfundierende Variablen (siehe auch Kap. 1.3.3. Efficacy/Effectiveness). Die Patienten wurden zur Aufnahme, zur Entlassungs und zu Follow-upZeitpunkten befragt, was eine weitere Stärke der Studie ist, denn sie erlaubt dadurch den Ausblick auf längerfristige Effekte. Die Beurteilung des Therapieerfolgs ein komplexes Unterfangen. In Kapitel 1.3.2. wurde ausführlich auf die Schwierigkeiten und die unterschiedlichen Ebenen der Therapieerfolgsmessung eingegangen. Die Operationalisierung des Erfolgs wurde mit Maßen der indirekten Veränderungsmessung vorgenommen. Die Frage nach der Zielerreichung konnte hier nicht beantwortet werden. Dies hat zum Nachteil, dass die Beibehaltung von erwünschten Zuständen genauso mit einer Effektstärke von Null kodiert wird wie die Beibehaltung von unerwünschten 96 Zuständen. Damit wird die tatsächliche Gesamtergebnisqualität unterschätzt. Zur Messung des Therapieerfolges wurden solide Instrumente verwendet, deren Nützlichkeit bereits erwiesen wurde. Der Beck-Depressions-Inventar ist ein weltweit verbreitetes Selbst- beurteilungsinstrument für Depression. Seine Vorteile sind hohe innere Konsistenz, hohe InhaltsValidität, seine Güte bei der Unterscheidung zwischen Depressiven und Gesunden und seine Sensitivität für Veränderung. (Richter et al., 1998; Hautzinger, 2000). Auch der GSI des SCL gilt als valides Instrument zur Erfassung des Therapieerfolges und wurde schon in vielen Studien für diesen Zweck eingesetzt (Franz et al., 2000; Sack et al., 2003; Klages, 2002; Mestel et al., 2000; Nosper, 1999; Jakobsen et al., 2007). Auch die übrigen Fragebögen sind geprüfte, valide Instrumente (Rief et al., 1997; Laux et al., 1981; Wietersheim et al., 1989; Saß et al., 1996). Die Erfolgsbeurteilung erfolgte nicht nur durch den Patienten, sondern auch durch den Therapeuten, was eine gewisse Kontrolle der Ergebnisse erlaubt. Ein Kritikpunkt der Studie ist die Vermischung aller Diagnosegruppen zu einer großen heterogenen Stichprobe und die Verwendung des BDI als eines der Haupt-Erfolgsmaße. Sinnvoller wäre es gewesen jede einzelne Diagnosegruppe für sich, mit dem jeweils für sie spezifischen Fragebogen auf ihren Erfolg hin zu untersuchen. Es ist anzunehmen, dass Depressive mit dem BDI andere Effektstärken erreichen als Patienten mit lediglich einer Essstörung. Möglicherweise hatten manche Patienten vor Beginn der Therapie kaum depressive Symptome gezeigt. Genauso ist auch anzunehmen, dass der Therapiefortschritt der Patienten mit Essstörung durch den STAI (State Trait Angstinventar) nicht adäquat beurteilt wird und doch haben Patienten aller Diagnosegruppen diesen Fragebogen beantwortet. Es kommt also zu dem oben beschriebenem Effekt, dass Patienten, die sich nicht verbessert haben, da sie von Anfang an keine Symptome hatten, das Gesamtergebnis verschlechtern. Allerdings hätte die Trennung in Diagnosegruppen auf Grund der fehlenden Werte zu sehr kleinen Stichproben geführt, was die sinnvolle Bewertung der Ergebnisse erschwert hätte. Zudem hatten 446 von 604 Patienten mehr als nur eine Diagnose, sie wären also nicht nur einer Gruppe zu zuordnen gewesen. Ein weiterer Punkt ist, dass es für die Beantwortung meiner Fragen keine große Rolle spielt wie groß die mittleren Effektstärken ausfallen. Es interessieren vielmehr die positiven und negativen Einflüsse auf das Ergebnis. Die Frage nach dem BDI als eines der beiden Haupterfolgsmerkmale lässt sich hoffentlich so 97 rechtfertigen: Insgesamt hatten 408 Patienten eine depressiven Störung, für 333 Patienten war dies die Erstdiagnose. Nur 48 Patienten waren zu Beginn der Therapie nach dem BDI-Cut-Off-Wert klinisch unauffällig. Hinzu kommt, dass neben dem BDI andere Erfolgsmerkmale ebenfalls zum Einsatz kamen. Der GSI des SCL-90-R eignet sich gut als zweites Haupterfolgsmerkmal, da er generell nach Symptomen fragt, ohne auf eine bestimmte Diagnose zugeschnitten zu sein. Es wäre eine Überlegung wert, zusätzlich zu den üblichen Fragebögen, Erfolgsmaße zu benutzen, welche speziell für den tiefenpsychologisch fundierten Ansatz der Klinik geeignet sind. Zum Beispiel die „Skalen psychischer Kompetenz“ (Wallerstein, 1991), welche die Operationalisierung des Konstrukts ´strukturelle Veränderung` erlauben, ein Konstrukt, welches die spezifischen Effekte der psychoanalytischen Psychotherapie zu erfassen versucht und welches unter Psychoanalytikern verschiedener Schulrichtungen auf breite Akzeptanz stößt (Huber und Klug, 2006). Dadurch ließen sich eventuell zusätzliche Effekte beobachten, bzw. das Gesamtergebnis würde womöglich positiver ausfallen. Das angewandte statistische Verfahren ist für die Frage nach dem Zusammenspiel verschiedener Einflüsse gut geeignet. Wie in Kapitel 1.2.3. genau beschrieben ist der Vorteil einer Regressionsanalyse, dass der Einfluss einzelner Variablen unabhängig von anderen einflussnehmenden Faktoren bestimmt werden kann. Wie in meinem Theorieteil ausführlich erläutert spielen viele Faktoren zusammen, die gemeinsam den Therapieerfolg bestimmen. Es ist vermutlich unmöglich alle zu identifizieren, da jede Therapie ihrem ganz individuellen Verlauf folgt. Allein das Vorhaben alle bereits bekannten Einflussfaktoren in einer Studie unterzubringen wird nicht sinnvoll durchzuführen sein. Es wären zu viele Faktoren und die nötige Stichprobe, zur Untersuchung all dieser Variablen, müsste nahezu endlos groß sein. Dennoch gäbe es einige wichtige Einflussfaktoren, welche ich für eine weitere Studie gerne zusätzlich mit einbeziehen würde. Während in meiner Studie hauptsächlich soziodemografische und krankheitsbezogene Variablen zum Einsatz kamen, wäre es interessant auch Faktoren zu beobachten, welche den Therapieprozess bestimmen. Dazu könnten der Einzeltherapeut, medikamentöse Behandlung, unspezifische Wirkfaktoren, wie z.B. die therapeutische Beziehung, oder auch Patientencharakteristiken, wie z.B. Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder Lebensereignisse im Laufe der Therapie oder der Katamnesezeit zählen. Für die Langzeitergebnisse wäre es ebenfalls sehr wichtig den Effekt einer weiterführenden, ambulanten Psychotherapie miteinzurechnen. 98 3.5.3. Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse Für den BDI wurde im Durchschnitt eine Effektstärke von 0,84, für den GSI des SCL-90-R im Durchschnitt eine Effektstärke von 0,71 erreicht. Eine Einteilung von Cohen (1992) besagt, dass sich Effektstärken ab 0,20 als klein, ab 0,50 als mittel und ab 0,80 als groß klassifizieren lassen. Diese Einteilung dient jedoch eher als Richtlinie. Im Einzelfall sollten Effektstärken immer im Kontext zu berichteten Effektstärken aus vergleichbaren Untersuchungen gesehen werden (Steffanowski, 2008). Sack et al. (2003) berichten eine durchschnittliche Effektstärke von 1.22 im GSI (SCL-90-R) von der Aufnahme zur Entlassung. Untersucht wurden die Effekte einer konflikt- und lösungsorientierten, stationären, psychoanalytischen Therapie. Franz et al. (2000) untersuchten in einer multizentrischen Studie die Effektstärken an drei vorwiegend tiefenpsychologisch-dynamisch orientierten Kliniken, welche auch verhaltenstherapeutische Angebote in ihr Behandlungsprogramm integriert hatten. Es wurden mit dem GSI (SCL-90-R) durchschnittliche Effektstärken von 0.84 (0.52; 0.72; 1.11) erreicht. Die Autoren führten die Unterschiede in den Effektstärken auf unterschiedliche Behandlungsdauern und unterschiedliche GSI-Prä-Werte bei den Patienten zurück. Von Paar und Kriebel (1998) liegt ebenfalls eine multizentrische Studie an fünf psychosomatischen Fachkliniken vor. Es wurden Effektstärken zwischen 0.36 und 0.93 mit dem SCL-90-R auf der „Somatisierungsskala“erreicht. Die Kliniken unterschieden sich hinsichtlich Behandlungssetting, Behandlungsdauer und der Zusammensetzung der Patienten und deren Diagnosen. Es ist schwierig Studien zu finden, welche tatsächlich unter gleichen Bedingungen durchgeführt werden. Unter diesem Gesichtspunkt ist es generell fragwürdig, Effektstärken verschiedener Studien miteinander zu vergleichen, wie weiter oben postuliert. Teilweise ist es jedoch notwendig um Ergebnisse in ihrer Größenordnung zumindest grob einschätzen zu können. 3.5.3.1. Zusammenhänge zwischen Verweildauer und Patientenvariablen Fragestellung 1 und Fragestellung 4 Die Frage welche Zusammenhänge zwischen Verweildauer und Patienten-Variablen bestehen, wurde bereits im Literaturteil der Arbeit diskutiert. Einen Teil der bisher bekannten Zusammenhänge konnten die Ergebnisse meiner Arbeit bestätigen. Es wurde zuerst ein 99 Kohortenvergleich mit Hypothesentestung durchgeführt, um einfache Zusammenhänge aufzuzeigen. Anschließend wurden in einer Regressionsanalyse mehrere Variablen in verschiedenen Modellen auf die Größe ihres Einflusses hin überprüft. Die meisten im Kohortenvergleich gefundenen Zusammenhänge bestätigten sich in der Regressionsanalyse. Ein fester (Ehe-)Partner verkürzt den Aufenthalt in der Klinik signifikant, was sich durch die Verantwortung des Patienten gegenüber der Familie erklären lässt, oder auch durch die stabile Beziehung, die ein Partner bieten kann, welche dem Patienten die Rückkehr aus der Klinik erleichtert. Dieses Phänomen wurde bereits von anderen Autoren (Zielke et al., 1997; Allen et al., 1987) beschrieben. Den gleichen Effekt würde man für Kinder erwarten. Jedoch zeigte sich der Zusammenhang zwischen Patienten, welche zu Hause Kinder haben und kürzeren Therapiedauern, in der Kohortenanalyse lediglich als Tendenz und wurde in der Regressionsanalyse nicht bestätigt. Ein höheres Alter hat in meiner Stichprobe ebenfalls einen hochsignifikanten Vorhersagewert für eine kürzere Therapiedauer. Dies entspricht dem Ergebnis von Zielkes et al. (1997) Untersuchung, in welcher jüngere Patienten ebenfalls die längsten Behandlungsdauern aufwiesen. Auch Stevens et al. (2001) zeigte für die jüngste Altersgruppe eine durchschnittlich längere Aufenthaltsdauer. Eine Reihe von Autoren berichten hier jedoch Gegensätzliches (Richter, 2001; Weyerer & Dilling; 1980; Barnow et al., 1997). Sie postulieren, dass ein höheres Lebensalter mit vermehrter Komorbidität und Chronifizierung der Erkrankung einherginge und sich somit die Therapiedauer verlängern würde. Eine mögliche Erklärung für die Ergebnisse meiner Untersuchung könnte sein, dass die älteren Patienten meiner Stichprobe eine geringere Therapiemotivation aufbringen. Jedoch konnte sich keine Korrelation zwischen Alter und geringer Therapiemotivation feststellen lassen. Ein tendenziell positiver Prädiktor für eine längere Therapiedauer war eine private Krankenversicherung. Einen ähnlichen Einfluss der Krankenkasse auf die Verweildauer wurde bereits von Stevens et al. (2001) an der Universitätsklinik Tübingen beschrieben. Auch hier waren die Effekte klein, bis auf signifikant kürzere Behandlungsdauer für Patienten ohne Versicherung, deren Behandlung von der Wohlfahrt übernommen wurde. Im Gegensatz zu Ergebnissen verschiedener Autoren (siehe Kap. 1.2.4.) konnte innerhalb meiner Stichprobe kein Zusammenhang zwischen Verweildauer und folgenden soziodemografischen Variablen festgestellt werden: Geschlecht, berufliche Situation und Bildungsniveau. Unter den krankheitsbezogenen Variablen zeigte sich das Auftreten von psychischer Komorbidität tendenziell häufiger in der Kohorte der längeren Verweildauer. In der Regressionsanalyse ließ sich 100 hier kein Effekt zeigen. Dieser Zusammenhang wurde von mehreren Autoren beschrieben (Zielke et al., 1997; Stevens et al. 2001). Auch wurde in früheren Studien gezeigt, dass Patienten mit schwerer Erkrankung weniger rasch und weniger stark auf Therapie ansprechen (Hermann et al., 2007; Barnow et al., 1997; Richter, 1999). Ein Hinweis darauf konnte auch in der von mir verwendeten Stichprobe gefunden werden. Ein hoher BDI-Prä-Wert, also eine schwere depressive Symptomatik zu Beginn der Behandlung war ein signifikanter Prädiktor für längere Verweildauern. Dazu passt allerdings nicht, dass Patienten mit einem früheren Suizidversuch in der Vorgeschichte deutlich kürzere Verweildauern hatten. Man würde eher vermuten, dass diese Patienten mit einer stärkeren psychischen Belastung kämen und daher längere Therapiedauern benötigen würden. Die Diagnose einer Essstörung hat einen signifikanten positiven Einfluss auf die Verweildauer. Auch dies stimmt mit Ergebnissen älterer Studien überein, welche zeigten, dass die Diagnosegruppen sich in durchschnittlichen Verweildauern unterschieden (Barnow et al., 1997; von Heymann et al., 2003) und Patienten mit Essstörung besonders lange Therapiedauern haben (Zielke et al., 1997). Offenbar sind Krankheitsbilder unterschiedlich schwierig zu behandeln und benötigen demnach einen verschieden großen Zeitaufwand. Eine große Behandlungsmotivation war ein hochsignifikanter Prädiktor für eine längere Verweildauer. Ein Ergebnis, das nicht erstaunt und bereits von anderen Autoren so beschrieben wurde (Zielke et al., 1997; von Heymann et al., 2003). Eine signifikant längere Therapiedauer hatten Setting-Wechsler gegenüber Patienten, welche sich nur in stationärer oder nur in tagesklinischer Behandlung befanden. Setting-Wechsler hatten durchschnittlich keinen höheren BDI-Prä-Wert oder SCL-Prä-Wert. Es besteht also kein Zusammenhang zwischen der anfänglichen Schwere der Symptomatik und dem Behandlungssetting. Eventuell spielen hier organisatorische Gründe eine Rolle. Vielleicht waren aber auch Patienten, welche ihr Setting nie wechselten von Anfang an zufriedener mit ihrer Therapie (und dem Setting) und konnten schnellere Fortschritte machen. Das Problem der fehlenden Werte darf nicht vergessen werden. In Modell A (Tab.10) liegt die Fallbeobachtungszahl bei 403, was für sich genommen, eine gute Zahl ist. Doch in Modell B und C reduzierten sich die Beobachtungen auf 198 und 228. Womöglich ist daher die Repräsentativität der Ergebnisse eingeschränkt. 101 3.5.3.2. Zusammenhänge zwischen Therapieerfolg und Patientenvariablen Fragestellung 2 und Fragestellung 5: Auch zwischen Therapieerfolg und Patienteneigenschaften lassen sich Beziehungen herstellen. Es wurden zwei Kohorten gebildet, für „großen“ Therapieerfolg und „kleinen“ Therapieerfolg. Diese wurden unter der Testung von Hypothesen miteinander verglichen. Anschließend wurden zur Beantwortung der Frage, welche Einflüsse auf das Behandlungsergebnis einwirken, verschiedene Modelle für Regressionsanalysen gebildet. Es wurden mehrere Erfolgsmaße verwendet. Die wichtigsten Erfolgsmaße, die BDI-Effektstärke und die SCL-90-Effektstärke wurden zum Zeitpunkt der Entlassung, der 3-Monats- und der 1-Jahreskatamnesen betrachtet. Zeitpunkt der Entlassung: Es wurden verschiedene Modelle gebildet. Modell A beschreibt den bivariaten Zusammenhang zwischen Verweildauer und Therapieerfolg. In Modell B wird für soziodemografische Variablen kontrolliert. In Modell C werden krankheitsbezogene Faktoren mit eingeschlossen, Modell D gibt das von SPSS gebildete Modell wieder, welches den größten Anteil der Varianz des Erfolgs erklären kann. BDI-Effektstärke Während im Kohortenvergleich kein Zusammenhang zwischen soziodemografischen Variablen und Therapieerfolg deutlich wurde, zeigten sich in der Regressionsanalyse (siehe Tabelle 11) das Alter und das Vorhandensein eines Ehe-Partners als negative Prädiktoren. Da gleichzeitig auf Behandlungsdauer kontrolliert wurde, kann das nicht als Ausdruck dessen gelten, dass dies die Gruppe an Patienten ist, welche auch zu kürzeren Verweildauern neigt. In der Literatur wurde ein negativer Zusammenhang zwischen höherem Lebensalter und Therapieerfolg beschrieben (Deter, 1986; Deter, 1990; Nosper, 1999). Es scheint, als wären ältere Menschen weniger veränderungsfähig als junge Menschen. In einer Untersuchung von Fliege et al. (2002) stellte sich das Alter, welches schlechtere Therapieerfolge vorhersagte lediglich als Deckvariable für somatische Komorbidität heraus. In meiner Stichprobe stellt sich ebenfalls ein Zusammenhang zwischen Alter und zunehmender körperlicher Beeinträchtigung dar und der Einfluss des Alters verliert von Modell B nach C, unter Hinzunahme der krankheitsbezogenen Variablen an Signifikanz. Allerdings zeigt eine starke körperliche Beeinträchtigung ebenfalls keinen signifikanten Einfluss auf die 102 BDI-Effektstärke. Keller et al. (1994) identifizierten die Ehe als Risikofaktor für ein längeres Anhalten einer Depression, wobei sie zu bedenken gaben, dass die Beziehungsqualität möglicherweise ausschlaggebend sei. Löhr et al. (2003) zeigten einen positiven Zusammenhang zwischen Merkmalen positiver Partnerschaftsqualität und Therapieerfolg bei Patienten mit Agoraphobie. Insofern wäre es vermutlich sinnvoller in einer weiteren Untersuchung auf die Qualität der Beziehungen zu kontrollieren, anstatt nur auf den Ehe-Status. In der Regressionsanalyse konnten Kinder als ein hochsignifikanter Prädiktor für ein besseres Therapieergebnis identifiziert werden, womöglich spielen hier ähnliche Gründe eine Rolle. In der Literatur findet man zu diesem Thema widersprüchliche Ergebnisse. Eine Studie von Paykel et al. (1996) zur Untersuchung der Effekte psychosozialer Variablen auf den Verlauf einer Depression, konnte keine Beziehung zwischen sozialer Unterstützung und der Genesung der Patienten finden. Auch Fliege et al. (2002) und Rode (1987) fanden keinen Einfluss von Partnerschaft auf das Therapieergebnis. Im Kohortenvergleich wurden zwischen verschiedenen krankheitsbezogenen Faktoren und Therapieerfolg Zusammenhänge gefunden, von denen die meisten in der Regressionsanalyse als signifikante Prädiktoren bestätigt werden konnten. Die Patientengruppe mit dem größeren BDIErfolg, hatte vor der Behandlung häufiger bereits einen Suizidversuch begangen und kam mit einer stärkeren depressiven Symptomatik (einem höheren BDI-Cut-Off-Wert) in die Klinik. Die Literatur liefert hierzu kontroverse Ergebnisse. So wurde von manchen Autoren ein negativer Zusammenhang zwischen Stärke der Symptomatik und Therapieergebnis gezeigt (Garfield, 1994; Mohr, 1995). In anderen Untersuchungen spielte die Symptomschwere keine Rolle (Joyce & Piper, 1998; Shapiro et al., 1994). Andere wiederum kamen zu dem Schluss, dass ein vom Patienten wahrgenommener hoher Beschwerdedruck sich sogar positiv auf die Behandlung auswirken kann (Deter et al., 1986; Mohr et al. 1990). Eventuell fördert ein hoher Leidensdruck die Bereitschaft sich intensiv auf die Therapie einzulassen. Es ist auch ersichtlich, dass bei einem sehr kranken Menschen mehr Verbesserungspotential vorhanden ist als bei einem nur leicht Depressiven. Dies gilt, solange die Erfolgsbeurteilung nach der Methode der indirekten Veränderungsmessung vorgenommen wird. Dieser Effekt wurde bereits durch Junge & Ahrens (1996) und Nosper (1999) beschrieben (siehe Kap. 1.3.4.2.). Diesem Ergebnis scheint zu widersprechen, dass stationäre Vorbehandlungen und deutliche körperliche Beeinträchtigung häufiger in der Gruppe der kleineren Therapieerfolge auftraten, bzw. in der Regressionsanalyse einen negativen Einfluss zeigten. Jedoch lässt stationäre 103 Vorbehandlung auf eine bisher eventuell nicht geglückte Therapie oder eine gewisse Chronifizierung der Erkrankung schließen, was wiederum die Therapie erschweren und damit den Erfolg mindern kann. Es wurde schon in früheren Untersuchungen gezeigt, dass eine Vorgeschichte mit depressiven Episoden (Sargeant et al., 1990) oder stationären Behandlungen (Keitner et al., 1992) Risikofaktoren für einen chronischen Verlauf der Depression sind. Dementsprechend zeigten einige Autoren günstigere Therapieverläufe bei Patienten, welche vor Beginn der Therapie noch keine psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen mussten (Deter, 1990; Borgart & Meermann, 1999; Sack et al., 2003) Eine deutliche körperliche Beeinträchtigung bedeutet eine psychische oder somatische Komorbidität zur Depression. So sind die Patienten stärker belastet und sprechen daher eventuell nicht so gut auf Psychotherapie an. Auch hierzu sind die Ergebnisse der Literatur inkonsistent. Einige Autoren berichten über schlechtere Therapieergebnisse bei zusätzlicher somatischer Diagnose (Fliege et al. 2002; Keitner et al., 1992). Andere Autoren konnten einen solchen Zusammenhang nicht finden (Joyce & Piper 1998). Obwohl sich die Variable psychische Komorbidität an sich in der Regressionsanalyse nicht als signifikanter Einflussfaktor auf die BDI-Effektstärke herausstellt, zeigen sich die Diagnose einer Somatoformen Störung, und ein hoher State-Prä-Wert als negative Prädiktoren. Dies weist darauf hin, dass ein vielseitigeres und komplexeres Krankheitsbild, im Gegensatz zu einer reinen Depression womöglich schwieriger zu behandeln ist. Nach Coryell et al. (1994) vermindert die Komorbidität mit einer Angststörung die Wahrscheinlichkeit, dass Depression geheilt wird. Auch Zielke (1995) und Borgart & Meermann (1999) weisen auf ein schlechteres Ansprechen auf Therapie bei vorhandener Komorbidität hin. Interessant ist, dass die Variable Behandlungsmotivation einen hochsignifikanten Einfluss auf die Verweildauer hat, nicht aber auf die BDI-Effektstärke. In einer durchgeführten Regressionsanalyse, mit BDI- Effektstärke als abhängige Variable, in welcher nicht auf Dauer kontrolliert wird, bleibt die Behandlungsmotivation nicht signifikant. Ein Robustheits-Test (siehe Kap. 2.4.6.) konnte an einem konstanten Datensatz mit ähnlichen Werten die Ergebnisse bestätigen. 104 SCL-Effektstärke Die SCL-Effektstärke beschreibt, durch die Verwendung des GSI - Global Severity Index, nicht nur die Abnahme der Depressivität, sondern eine Abnahme aller vorhandenen psychischen und körperlichen Symptome. Für die SCL-Effektstärke konnten sich keine soziodemografischen Variablen finden lassen, die einen Einfluss auf das Therapieergebnis gehabt hätten. Es zeigte sich lediglich, wie schon für die BDI-Effektstärke beobachtet, eine negative Tendenz für ein höheres Lebensalter. Die Einflüsse der krankheitsbezogenen Variablen waren ebenfalls ähnlich. Es zeigte sich zusätzlich ein negativer Einfluss einer Persönlichkeitsstörung. Für depressive Patienten und Patienten mit Angststörung wurde in früheren Studien bereits ein schlechteres Outcome bei komorbider Persönlichkeitsstörung beschrieben (Hardy et al., 1995; Shea et al. 1990; Chambless et al., 1997). Andere Autoren gehen davon aus, dass die Bedeutung einer zusätzlichen Persönlichkeitsstörung zu einer Achse-I-Diagnose für den Therapieverlauf überschätzt wird (Leibbrand et al., 1998; Bottlender et al., 2003). Eine große körperliche Beeinträchtigung innerhalb der letzten 12 Monate zeigte sich hier noch deutlicher, sogar als hochsignifikanter negativer Prädiktor für das Therapieergebnis. Interessanterweise spielte für die SCL-Effektstärke auch das Behandlungssetting eine Rolle. So hatten Patienten in stationärer Behandlung ein hochsignifikant schlechteres Ergebnis, als Patienten der Tagesklinik oder im wechselnden Setting. Bei diesem schwer zu erklärendem Phänomen muss man jedoch zu bedenken geben, dass in Modell D (Tabelle 12), in welchem dies auftritt, nur 154 von 604 Patienten mit einbezogen wurden. Es ist nicht klar, ob dieses Ergebnis somit repräsentativ für den Rest der Stichprobe ist. Wie in Kapitel 1.3.4.1. beschrieben, existiert nur wenig befriedigende Literatur zu diesem Thema. In einem Review von Horvitz-Lennon et al. (2001) zeigte sich bei den meisten eingeschlossenen Studien eine gleiche Wirksamkeit für beide Settings. Eine Studie von Geiselmann & Linden (2001) führt einen Vergleich von tagesklinisch und stationär behandelten Patienten so wie Patienten, die das Setting wechselten, durch. Sie fanden Unterschiede für die Belastungsschwere zwischen den Gruppen, wobei sich Tagesklinik- Patienten als tendenziell leichter beeinträchtigt zeigten. Durch eine Regressionsanalyse ließ sich ebenfalls kein signifikanter Einfluss des Settings auf das Therapieergebnis nachweisen. Im Gegensatz zur BDI-Effektstärke, für die ein hoher BDI-Prä-Wert ein positiver Prädiktor ist, stellt sich hier heraus, dass Patienten mit schwerer depressiver Symptomatik eher schlechte 105 Voraussetzungen für einen großen SCL-Erfolg haben. Allerdings ist der Regressionskoeffizient für den BDI-Prä-Wert mit -0,026 eher als klein einzuschätzen. Ein hoher SCL-Prä-Wert dagegen kann einen guten SCL-Erfolg voraussagen, wobei auch hier mit 0,041 ein nur kleiner Regressionskoeffizient besteht. Es zeigt sich für die SCL-Effektstärke noch ein weiterer hochsignifikanter positiver Einflussfaktor: die Behandlungsmotivation. Dies überrascht nicht, im Gegenteil hätte man diesen Effekt auch schon für den BDI-Erfolg erwartet. In der Literatur findet man viele Hinweise auf die wichtige Rolle der Motivation und der Einstellung des Patienten gegenüber der Therapie. Fliege et al. (2002) deckten Optimismus und Selbstwirksamkeitsüberzeugung als Einflussvariable auf. Einen deutlichen Zusammenhang zwischen initialer Behandlungsmotivation und Therapieeffekten fanden Schneider & Klauer (1999). für beide Effektstärken gilt: Passend zu den Ergebnissen anderer Autoren (Zlotnick et al., 1996; Simpson et al., 1997; Geiser et al., 2002; Rode, 1987; Garfield, 1994) hatte auch in meiner Stichprobe das Geschlecht keinen Einfluss auf das Therapieergebnis. Nosper (1999) fand bei Frauen lediglich eine höhere Zufriedenheit mit der stationären Psychotherapie und mit dem Therapeuten.Ebenfalls zeigte sich kein Zusammenhang für den Ausbildungsstatus oder die Erwerbstätigkeit und dem Therapieerfolg. In der Literatur wurde dem Bildungsstand bisher keine große Bedeutung für den Therapieerfolg zugeschrieben (Geiser et al., 2003; Schmidt, 1991; Nosper, 1999). Zusammenhänge zwischen niedrigem Einkommen bzw. einem niedrigen Bildungsniveau und Chronifizierung einer Depression wurden jedoch bereits beschrieben (Keller et al. 1994; Sargeant et al., 1990). Die Rolle des Erwerbsstatus für den Therapieerfolg wurde bisher wenig untersucht. Fliege et al., (2002) konnten für die Patienten einer psychosomatischen Klinik keinen Zusammenhang zwischen Erwerbslosigkeit und Therapieergebnis finden. BDI zu den Katamnese-Zeitpunkten In den Modellen C (Tabelle 14), in denen auf alle soziodemografischen und krankheitsbezogenen Einflussfaktoren kontrolliert wird, zeigen sich generell weniger signifikante Einflüsse, da die einzelnen Effekte in einem zu großen Modell und bei zu kleiner Beobachtungszahl undeutlich werden. Erst in den Modellen D, jenen Modellen, welche von SPSS als die „meist-erklärenden Modelle“ gebildet wurden, werden Einflussfaktoren deutlich. 106 Soziodemografische Einflüsse sind zu den Katamnesezeitpunkten nicht mehr sichtbar, bis auf die Erwerbstätigkeit. Sie ist ein positiver Prädiktor für den BDI-Erfolg zur 3-Monatskatamnese. Für den Zeitraum des Klinikaufenthaltes spielte sie für den Erfolg noch keine Rolle. Eine mögliche Interpretation wäre, dass der Beruf die Patienten davor schützt nach der Entlassung „in ein Loch zu fallen“. Das ist eine Gefahr, von der viele Patienten zur 3-Monatskatamnese in einem Katamnesegespräch berichten. Zum Zeitpunkt der 1-Jahreskatamnese verschwindet dieser Effekt. In einer Untersuchung von Broda et al. (1996) schätzten beruflich integrierte Patienten zum Katamnesezeitpunkt den Behandlungserfolg als positiver ein als nicht-berufstätige Patienten. Der subjektive Behandlungserfolg ein Jahr nach der Behandlung wiederum hing hoch signifikant von der Zufriedenheit mit der Arbeitssituation ab. Zur 3-Monatskatamnese ist außerdem die Diagnose einer Essstörung ein signifikant positiver Prädiktor. Zur 1-Jahreskatamnese dagegen wird er hochsignifikant negativ. Dies würde bedeuten, dass Patienten mit Essstörung ihre Fortschritte für eine kurze Zeit gut halten können aber langfristig eher mit schlechteren Ergebnissen zu rechnen haben. Einen negativen Einfluss auf den längerfristigen Erfolg haben außerdem die Diagnosen Somatoforme Störung und Depression. Deren Regressionskoeffizienten sind in der 1-Jahreskatamnese-Regressionsanalyse signifikant und negativ. Ebenso zeigte sich ein langfristiger negativer Effekt für eine teil-/stationäre Behandlung in der Vorgeschichte. Interessanterweise zeigt sich trotzdem noch der, wenn auch mit B = 0,04, sehr kleine signifikante positive Effekt eines hohen BDI-Prä-Wertes. Ein hoher State-Prä-Wert hat einen negativen Effekt mit ebenfalls kleinem Regressionskoeffizient von B = 0,051. Zusammenfassend kann man also sagen, eine schwere Symptomatik ermöglicht einen großen Erfolg. Dagegen verschlechtert jedoch eine starke Chronizität und Komorbidität das kurz– und langfristige Ergebnis. Auch hier bestätigte die Überprüfung der Robustheit (siehe Kap. 2.3.4.), durch Wiederholung der Regressionsanalysen an einem gleich bleibenden Datensatz die beschriebenen Effekte. SCL zu den Katamnese-Zeitpunkten Für die SCL-Effektstärke zeigt sich das Alter zu beiden Katamnesezeitpunkten als negativer Prädiktor. Eine Tendenz hatte sich bereits zum Zeitpunkt der Entlassung gezeigt, auf den längerfristigen Erfolg scheint sich das Alter noch deutlicher auszuwirken, vor allem wenn man bedenkt, dass der eher kleine Regressionskoeffizient von B = 0,039 sich auf einzelne Jahre bezieht. Der Einfluss von 10 Jahren Altersunterschied läge somit bei B = 0,39. 107 Zwar zum Zeitpunkt der Entlassung nicht sichtbar, jedoch zu beiden Katamnesen als signifikanter negativer Einfluss deutlich, ist eine stattgefundene teil-/stationäre Vorbehandlung. Genauso zeigt sich auch der negative Effekt einer Komorbidität, sowie der positive Effekt eines hohen SCL-PräWertes. Dies entspricht den Ergebnissen, wie sie auch für die BDI-Effektstärke sichtbar sind. In der 1-Jahreskatamnesen-Regressionsanalyse zeigen sich für unterschiedliche Diagnosen negative (für Essstörung und Somatoforme Störung) oder positive Effekte (Angststörung). Auch dies entspricht in etwa den Ergebnissen, welche sich für den BDI-Erfolg herausstellen. Wie auch schon zur Entlassung war auch zum Zeitpunkt der 1-Jahreskatamnese eine große Behandlungsmotivation ein hoch signifikanter positiver Einflussfaktor für den SCL-Erfolg. Auch für die Bewertung dieser Ergebnisse muss bedacht werden, dass eine Beobachtungszahl von N = 39 – 98 sehr klein, im Verhältnis zur Gesamtstichprobe ist und es ist nicht klar, inwiefern sich eine Selektion der Patienten auf die Ergebnisse auswirkt (Tabelle 15). Andere Erfolgsmaße Auch für die anderen Effektstärken, die berechnet wurden, zeichnen sich einzelne der bereits beschriebenen Einflüsse ab. Für die GAF-Effektstärke, welche den Zugewinn an Funktionalität des Patienten beschreibt, waren Komorbidität und ein früherer Suizidversuch hoch signifikante negative Prädiktoren, auch der GAF-Prä-Wert, der sich auf die vergangenen 12 Monate bezieht, also auf eine längere Krankengeschichte hinweist und nicht nur auf die akute Situation kurz vor der Einweisung. Eine große Behandlungsmotivation hatte auch auf dieses Erfolgsmaß einen großen, signifikant positiven Einfluss. Für die Angstsymptomatik wurden State- und Trait-Effektstärken gebildet. Einen großen negativen Einfluss zeigte auch hier eine teil-/stationäre Vorbehandlung in der Vergangenheit. Die Behandlungsmotivation zeigte einen großen positiven Einfluss. Erstaunlicherweise stellte jeweils ein hoher Prä-Wert auf der einen Skala einen kleinen aber signifikanten negativen Einfluss für die andere Skala dar. Der für die eigene Skala bestimmte Prä-Wert stellte jeweils einen positiven Einfluss dar. Die FSI-Effektstärke beschreibt die Verbesserung der sozialen Eingliederung drei Monate nach Entlassung. Die Diagnose einer Depression und eine teil-/stationäre Vorbehandlung hatten einen 108 negativen Einfluss auf das Ergebnis. Wie sich bereits für die anderen Effektstärken zeigte, hatte auch hier ein hoher FSI-Prä-Wert eine große, hoch signifikante Vorhersagekraft für ein gutes Ergebnis. 3.5.3.3. Zusammenhang zwischen Verweildauer und Therapieerfolg Fragestellung 3: Es wurden die Kohorten „großer“ Therapieerfolg und „kleiner“ Therapieerfolg in Bezug auf die Verweildauer verglichen und getestet, ob ein signifikanter Unterschied besteht. Für die BDIEffektstärke konnte die Tendenz eines Zusammenhangs zwischen längerer Verweildauer und großem Therapieerfolg festgestellt werden. Nicht jedoch für die SCL-Effektstärke. Es wurde ebenfalls untersucht ob die Verweildauer mit den unterschiedlichen Erfolgsmaßen korreliert ist. Dabei zeigte sich eine hoch signifikante Korrelation zwischen Verweildauer und BDI-Effektstärke und GAF-Effektstärke. Letzteres ist ein Maß für den Zugewinn an Funktionalität im alltäglichen Leben. Diese statistischen Methoden geben zunächst einen groben Überblick und zeigen, dass es tendenziell einen Zusammenhang gibt. Es gibt allerdings viele Faktoren, die die Verweildauer und den Therapieerfolg beeinflussen, daher muss der Zusammenhang unter Miteinbeziehung anderer potentieller Einflussfaktoren betrachtet werden. Dazu dient die Durchführung verschiedener Regressionsanalysen. Fragestellung 5: In meiner Studie kommen verschiedene Erfolgsmaße zum Einsatz, da sich die Verweildauer eventuell auf jedes einzelne unterschiedlich auswirken kann. Für die BDI-Effektstärke, zum Zeitpunkt der Entlassung, ist die Verweildauer in allen Modellen, (d.h. mit und ohne Kontrolle für weitere Variablen) ein signifikant bis hoch signifikant positiver Prädiktor (Tabelle 11). Die Regressionskoeffizienten der Verweildauer liegen gerundet in allen vier Modellen bei B = 0,2 (0,155 – 0,225). Dies bedeutet, für je einen Monat zusätzliche Therapie, steigt die BDI-Effektstärke um 0,2. Je länger also die Verweildauer, desto besser wäre das Behandlungsergebnis, könnte man alle anderen Einflußfaktoren der Gleichung konstant halten. Mit Modell C lässt sich 38 %, mit Modell E 40 % der Varianz der BDI-Effektstärke aufklären. Nach drei Monaten, zum Zeitpunkt der ersten Katamnese, verschwindet der positive Effekt der Verweildauer (B = 0,047), taucht dann aber 109 nach einem Jahr mit signifikantem, großen Regressionskoeffizient (B = 0,449) wieder auf (Tabelle 13). Die Fallzahl in Modell B der Regressionsanalyse für die 1-Jahreskatamnese liegt bei 62. Dies ist im Vergleich zu Fallzahlen anderer Studien noch eine akzeptable Größe, bedenkt man jedoch die ursprüngliche Größe der Stichprobe (604 Patienten), ist es nur noch eine kleine Auslese. Man kann das Ergebnis auf Grund der kleinen Fallzahl nicht als repräsentativ für die Gesamtstichprobe betrachten. Da die daraus folgende Aussage aber im Einklang zum bisherigen Stand der Forschung steht, lässt sich berechtigterweise folgender Zusammenhang annehmen: Längere Therapiedauer führt nicht nur tendenziell zu besseren kurzfristigen Therapieerfolgen, sondern sorgt außerdem auch für einen lange anhaltenden, positiven Therapie-Effekt. Es wurden auf Grund der wechselnden Stichprobengrößen unter den Regresssionsanalysen zwei Robustheits-Tests vorgenommen, welche ähnliche Ergebnisse an einem gleichbleibenden Datensatz hervorbrachten. In den Regressionsanalysen für die SCL-Effektstärke zeigte sich weder zum Zeitpunkt der Entlassung noch zu den Katamnesen ein signifikanter Einfluss der Verweildauer auf den Erfolg. (Tabelle 13 und 15) Es wurden daraufhin Regressionsanalysen für weitere Erfolgsmaße durchgeführt (s.Tabellen im Anahang). Ein signifikant positiver Effekt der Verweildauer mit B = 0,236 stellte sich für die GAFEffektstärke heraus. Diese Ergebnisse spiegeln das Phasenmodell von Howard et al. (1993) wieder, welches im Literaturteil genauer beschrieben wurde. Demnach beschreibt die SCL-Effektstärke die zweite Phase, die Remediation, welche die Verminderung der Symptomatik bedeutet. Die GAFEffektstärke beschreibt die Rehabilitation, die Verbesserung des Funktionsniveaus des Patienten, welche als dritte Phase spät einsetzt und einen gewissen Aufwand an Therapie mit sich bringt. Da die Patienten der beiden Kliniken im Durchschnitt zwei Monate in Behandlung sind, ist es wahrscheinlich, dass die meisten von ihnen Phase zwei erreichen und sich dann in der Symptomreduktion ab einem gewissen Punkt nur noch gering pro Zeiteinheit verbessern. Dies würde den geringen Einfluss der Verweildauer auf die SCL-Effektstärke begründen. Da Phase drei erst später einsetzt, ist es denkbar, dass sie nicht von allen Patienten vor Entlassung erreicht wurde. Oder dass sie kurz nach Eintritt in die Phase des Zugewinns an Funktionalität noch größere Verbesserungssprünge machen können und sich dies in der GAF-Effektstärke bemerkbar macht. Das wäre eine Erklärung für den signifikant positiven Effekt der Verweildauer auf die GAFEffektstärke. 110 Die Tendenz für einen positiven Einfluss einer längeren Dauer ergab sich für die StateEffektstärke, nicht jedoch für die Trait-Effektstärke. Auch für die FSI-Effektstärke ließ sich kein Einfluss nachweisen. Als letzte Untersuchung wurden Regressionsanalysen für den BDI-Erfolg innerhalb der einzelnen Diagnosegruppen gerechnet, um zu sehen, ob sich hier die Verweildauer unterschiedlich positiv auswirkt (Tabelle 16). Tatsächlich ließen sich für Depressive Störungen, Anpassungsstörungen und Somatoforme Störungen ein hoch-/signifikanter positiver Effekt einer längeren Verweildauer zeigen. Kein signifikanter Effekt zeigte sich in den Diagnosegruppen Angststörung und Essstörung. Dies ist ein interessantes Ergebnis, jedoch muss auch hier wieder auf die sehr kleinen Beobachtungszahlen hingewiesen werden, welche die Unterschiede zwischen den Diagnosegruppen relativieren. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass es bei der BDI-Effektstärke nur um den Rückgang der depressiven Symptomatik geht. Es wurden keine krankheitsspezifischen Effektstärken angewendet. 111 3.5.3.4. Fazit und Ausblick Insgesamt hat sich der in der Literatur beschriebene Zusammenhang zwischen Behandlungsdauer und Therapieerfolg in den Ergebnissen meiner Arbeit bestätigt. Eine längere Therapiedauer führt im Allgemeinen zu größeren Therapieeffekten und zudem zu einem längeren Anhalten der positiven Wirkung. Es ist schwierig, Aussagen über die genaue Funktion des Zusammenhangs zu machen. Zum einen kann der Therapieerfolg sehr unterschiedlich definiert werden und nicht für alle Ebenen des Erfolgs scheint die Therapiedauer gleich wichtig zu sein. So ließ sich für den BDI und den GAF ein eindeutig positiver Einfluss der Verweildauer zeigen, während im Gegensatz dazu, der SCLErfolg verweildauerunabhängig war. Ähnliches wurde bereits von Howard et al. (1993) durch das Phasenmodell beschrieben. Zum anderen wird der Therapieverlauf von sehr vielen zusätzlichen Einflüssen bestimmt, die bei jedem Patienten ganz individuell wirken können. Insofern ist es selbstverständlich nicht möglich aus den Ergebnissen meiner Arbeit generell eine optimale Verweildauer für die stationäre Psychotherapie abzuleiten. Man kann jedoch mit großer Sicherheit schlussfolgern, dass die pauschale Verkürzung der Verweildauer, wie sie in den letzten Jahren stattgefunden hat, sich negativ auf die Behandlungsergebnisse auswirken wird. Um diese Aussage weiter zu unterstützen, wären umfangreichere Untersuchungen mit Langzeitergebnissen notwendig. Ideal wäre dafür ein Datensatz mit großen Patientenzahlen, möglichst aus verschiedenen Kliniken und ein breites Spektrum an Patientenvariablen. Es wäre außerdem sinnvoll Variablen mit einzubeziehen, welche den Therapieprozess beschreiben, da dieser offenbar ebenfalls entscheidend für das Therapieergebnis ist. So ist eine gute Beziehung zwischen Patient und Therapeut die Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie und nur wenn diese gegeben ist, kann sich eine längere Therapiedauer überhaupt positiv auswirken. Zusätzlich wäre eine Auswahl an Erfolgsmaßen, welche in meiner Arbeit leider nur unvollständig eingesetzt wurden vorteilhaft, damit Effekte auf verschiedenen Erfolgsebenen beobachtet werden können. 112 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Verweildauer nach Fachabteilungen im Jahre 2007..........................................................12 Tabelle 2: Datenerhebungsschema.....................................................................................................57 Tabelle 3: Fragebogeneinführung.......................................................................................................58 Tabelle 4: Übersicht über Patientenvariablen und Verweildauer........................................................73 Tabelle 5: Übersicht über Effektstärken zum Zeitpunkt der Entlassung............................................79 Tabelle 6: Übersicht über Effektstärken zum Zeitpunkt der 3-Monatskatamnese.............................79 Tabelle7: Übersicht über Effektstärken zum Zeitpunkt der 1-Jahreskatamnese................................79 Tabelle 8: Zusammenhänge zwischen Therapieerfolg und Verweildauer..........................................82 Tabelle 9: Korrelationen zwischen den Effektstärken und der Verweildauer.....................................83 Tabelle 10: Lineare Regression für die Effekte der Patientenvariablen auf die Verweildauer...........84 Tabelle 11: Lineare Regression für den Effekt der Verweildauer auf die BDI-Effektstärke..............86 Tabelle 12: Lineare Regression für den Effekt der Verweildauer auf die SCL-Effektstärke.............88 Tabelle 13: Lineare Regression für den Effekt der Verweildauer auf die BDI-Effektstärke zu Katamnesezeitpunkten.....................................................................................................91 Tabelle 14: Lineare Regression für den Effekt der Verweildauer auf die SCL-Effektstärken zu Katamnesezeitpunkten.....................................................................................................93 Tabelle 15: Lineare Regression für den Effekt der Verweildauer auf die BDI-Effektstärke in verschiedenen Diagnosegruppen.....................................................................................94 113 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: „Generic Model of Psychotherapy“ von Orlinsky, Grawe und Parks (1994)..............23 Abbildung 2: Ebenen der Erfolgsmessung nach Schulte (1993)........................................................26 Abbildung 3: „Dosis-Effekt-Modell“ nach Howard et al. (1986)......................................................50 Abbildung 4: „Phasenmodell“ nach Howard et al. (1993).................................................................52 Abbildung 5: BDI-Cut-Off-Werte zu Beginn der Behandlung...........................................................75 Abbildung 6: BDI-Cut-Off-Werte zum Ende der Behandlung...........................................................75 Abbildung 7: BDI-Effektstärken zum Ende der Behandlung.............................................................75 Abbildung 8: SCL-Cut-Off-Werte zu Beginn der Behandlung..........................................................76 Abbildung 9: SCL-Cut-Off-Werte zum Ende der Behandlung..........................................................76 Abbildung 10: SCL-Effektstärken zum Ende der Behandlung..........................................................76 Abbildung 11: BDI-Werte zu den vier Messzeitpunkten....................................................................77 Abbildung 12: SCL-Werte zu den vier Messzeitpunken....................................................................78 114 Literaturverzeichnis Allen, J.G. (1987), 'A Conceptual Model for Research on Required Length of Psychiatric Hospital Stay', Comprehensive Psychiatry 28(2), 131 - 140. Allen, J.G. (1985), 'Actual versus optimal length of psychiatric hospital stay', Bulletin of the Menninger Clinic 49(5), 500 - 506. Allen, J.G.; Tarnoff, G.; Coyne, L.; Spohn, H.E.; Buskirk, J.R. & Keller, M.W. (1986), 'An innovative approach to assessing outcome of long-term psychiatric hospitalization', Psychiatric Services 37(4), 376 - 380. ÄZQ (Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin). (2009), S3-Leitlinie/ Nationale Versorgungs Leitlinie Unipolare Depression, DGPPN, BÄK, KBV, AWMF. Barnow, S.; Linden, M. & Schaub R.T. (1997), 'The impact of psychosocial and clinical variables on duration of inpatient treatment for depression', Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology,32(6), 312 – 316. Bassler, M.; Krauthauser, H. & Hoffmann, S. (1995), 'Welche Faktoren beeinflussen die Dauer von stationarer Psychotherapie?', PPmP. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie 45(5), 167 - 175. Bastine, R.; Fiedler P. & Kommer, D. (1989), 'Psychotherapeutische Prozessforschung.', Zeitschrift für Klinische Psychologie 18(1), 3 - 33. Baumann, U.; Sodemann, U. & Tobien, H. (1980), 'Direkte versus indirekte Veränderungsdiagnostik', Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie 1, 201--216. 'Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland' Deutscher Bundestag Drucksache 7/4200 und 4201,(1975), Bonn. Beutel, M.; Ademmer, K. & Rasting, M. (2005), 'Affektive Interaktion zwischen Patienten und Therapeuten', Psychotherapeut 50(2), 100--106. Beutel, M.; Höflich, A.; Kurth, R.; Brosig, B.; Gieler, U.; Leweke, F.; Milch, W. & Reimer, C. (2005), 'Stationäre Kurz-und Langzeitpsychotherapie--Indikationen, Ergebnisse, Prädiktoren', Z Psychosom Med Psychother 51, 145--162. 115 Beutler, L.E.; Machado, P.P.P. & Neufeldt, S.A.(1994), 'Therapist variables', Handbook of psychotherapy and behavior change 4th edn Wiley, New York, 229-269. Beutler, L.; Crago, M. & Arizmendi, T. (1986), 'Therapist variables in psychotherapy process and outcome', Handbook of psychotherapy and behavior change 3th edn Wiley, New York, 257--310. Beutler, L.; Malik, M.; Alimohamed, S.; Harwood, T.; Talebi, H. & Noble, S. (2004), 'Therapist variables', Bergin and Garfield’s Handbook of psychotherapy and behavior change 5th ednWiley, New York, 227--306. Blazer, D.; Kessler, R.; McGonagle, K. & Swartz, M. (1994), 'The prevalence and distribution of major depression in a national community sample: the National Comorbidity Survey', American Journal of Psychiatry 151(7), 979 – 984 Borgart, E. & Meermann, R. (1999), 'Bedingungsfaktoren unterschiedlicher Behandlungsdauer bei Angststörungen im Rahmen stationärer Verhaltenstherapie', PPmP. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie 49, 109—113. Bottlender, M.; Bottlender, R.; Scharfenberg, C. & Soyka, M. (2003), 'Die Bedeutung von Persönlichkeitsstörungen für den Therapieverlauf einer ambulanten Alkoholentwöhnungstherapie', PPmP. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie 53, 384--389 Broda, M.; Bürger, W.; Dinger-Broda, A. & Massing, H. (1996), 'Die Berus-Studie. Zur Ergebnisevaluation der Therapie psychosomatischer Störungen bei gewerblichen Arbeitnehmern', Eine Katamnesestudie stationärer Verhaltenstherapie bei einer Population von LVA-Versicherten, Berlin/Bonn: Westkreuz Verlag Bryk, A. & Raudenbush, S. (1992), 'Hierarchical linear models: Applications and data analysis methods', Sage Publications Newbury Park, CA. Bänninger-Huber, E. (2001), 'Von der Erfolgsforschung zur Prozessforschung - und wieder zurück?', Psychotherapeut 46(5), 348--352. Carroll, L.; 'Alice`s adventures in wonderland.' Harmondsworth Penguin, Middlesex, ed. (1962 (1865 Erstveröffentlichung)) Caspar, F. & Jacobi, F. (2004), 'Psychotherapieforschung', Lehrbuch der Psychotherapie 1, 395--410. 116 Caton, C. & Gralnick, A. (1987), 'A review of issues surrounding length of psychiatric hospitalization', Hospital & Community Psychiatry 38(8), 858--863. Chambless, D.; Tran, G. & Glass, C. (1997), 'Predictors of response to cognitive-behavioral group therapy for social phobia', Journal of Anxiety Disorders 11(3), 221--240. Clarkin, J. & Levy, K. (2004), 'The influence of client variables on psychotherapy', Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change, 194--226. Cohen, J. (1992), 'A power primer.', Psychological Bulletin of the Menninger Clinic 112, 155 - 159. Coryell, W.; Akiskal, H.; Leon, A.; Winokur, G.; Maser, J.; Mueller, T. & Keller, M. (1994), 'The time course of nonchronic major depressive disorder. Uniformity across episodes and samples. National Institute of Mental Health Collaborative Program on the Psychobiology of Depression Clinical Studies.', Archives of General Psychiatry 51(5), 405 -- 410 Creed, F.; Tomenson, B.; Anthony, P. & Tramner, M. (1997), 'BRIEF COMMUNICATION Predicting length of stay in psychiatry', Psychological Medicine 27(4), 961--966. Critelli, J. & Neumann, K. (1984), 'The placebo: Conceptual analysis of a construct in transition', American Psychologist 39(1), 32--39. Crowther, J. (1985), 'The Relationship between Depression and Marital Maladjustment A Descriptive Study.', The Journal of Nervous and Mental Disease 173(4), 227. Cyr, J. & Haley, G. (1983), 'Use of demographic and clinical characteristics in predicting length of psychiatric hospital stay: a final evaluation', Journal of Consulting and Clinical Psychology 51(4), 637--40. Delsignore, A. & Schnyder, U. (2007), 'Control expectancies as predictors of psychotherapy outcome: a systematic review.', The British journal of clinical psychology/the British Psychological Society 46(4), 467. Deter, H. (1990), 'Der Langzeiterfolg einer stationären psychosomatischen Therapie, aus der Sicht von Patienten und Therapeuten.', Psychotherapie und Rehabilitation in der Klinik (177-187), A. Hellwig & M. Schoof (Hrsg.),. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.. Deter, H.; Sameith,W.; Marosta, U.; Ferner, H. & Reindell, A. (1986), 'Katamneseergebnisse von 64 Patienten, 5 Jahre nach der stationären psychosomatischen Behandlung', Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 32(3), 231--248. 117 DeWitt, K.; Milbrath, C. & Wallerstein, R. (1999), 'Scales of Psychological Capacities: Support for a measure of structural change', Psychoanalysis and Contemporary Thought 22(3), 453 -- 480. Diguer, L.; Barber, J. & Luborsky, L. (1993), 'Three concomitants: personality disorders, psychiatric severity, and outcome of dynamic psychotherapy of major depression', American Journal of Psychiatry 150(8), 1246 – 1248. Eisler, R. & Williams, W. (1972), 'A comparison of preadmission characteristics of patients selected for long- or short-term psychiatric treatment.', Journal of clinical psychology 28(2), 209 – 213. Elkin, I.; Shea, M.; Watkins, J.; Imber, S.; Sotsky, S.; Collins, J.; Glass, D.; Pilkonis, P.; Leber, W.; Docherty, J. & others (1989), 'NIMH treatment of depression collaborative research program: general effectiveness of treatments', Archives of General Psychiatry 46, 971 – 982. Fiedler, F. (1950), 'A comparison of therapeutic relationships in psychoanalytic, nondirective and Adlerian therapy.', Journal of Consulting Psychology 14(6), 436 – 445. Figueroa, R.; Harman, J. & Engberg, J. (2004), 'Use of claims data to examine the impact of length of inpatient psychiatric stay on readmission rate', Psychiatric Services 55(5), 560 – 565. Fliege, H.; Rose, M.; Bronner, E. & Klapp, B. (2002), 'Prädiktoren des Behandlungsergebnisses stationärer psychosomatischer Therapie. Predicting Long-Term Outcome of In-Patient Psychosomatic Treatment', Psychother Psychosom Med Psychol 52, 47 -- 55. Frank, J. & Frank, J. (1993), Persuasion and healing: A comparative study of psychotherapy, Johns Hopkins University Press. Franke, G. (2002), 'SCL-90-R: Symptom-Checkliste von LR Derogatis', Manual der deutschen Version. Göttingen: Beltz Test GmbH. Franz, M.; Janssen, P.; Lensche, H.; Schmidtke, V.; Tetzlaff, M.; Martin, K.; Wöller, W.; Hartkamp, N.; Schneider, G. & Heuft, G. (2000), 'Effekte stationärer psychoanalytisch orientierter Psychotherapie-eine Multizenterstudie', Z Psychosom Med Psychother 46(3), 242 -- 258. Frick, U.; Rehm, J. & Cording, C. (2001), 'Brauchen wir eine psychiatrische Gesundheitsökonomie?-Wozu wir eine psychiatrische Gesundheitsökonomie brauchen! Do We Really Need Health Economics in Psychiatry? Why Do We Need Health Economics in Psychiatry?!!', Psychiatr Prax 28, 1 -- 6. Frick, U.; Rehm, J.; Krischker, S. & Cording, C. (1999), 'Length of stay in a German psychiatric hospital as a function of patient and organizational characteristics-a multilevel analysis', 118 International Journal of Methods in Psychiatric Research 8(3), 146 – 161. Garfield, S. (1994), 'Research on client variable in psychotherapy.', Handbook of psychotherapy and behavior change. A. E. Bergin and S. L. Garfield. New York, John Wiley & Sons 4, 190 -- 228. Gassmann, D. (2002), Korrektive Erfahrungen im Psychotherapieprozess. Entwicklung und Anwendung der Konsistenztheoretischen Mikro-Prozessanalyse KMP, Inauguraldissertation, Philosophisch-historische Fakultät der Universität Bern. Geiselmann, B. & Linden, M. (2001), 'Vollstationäre, tagesklinische und kombiniert stationärteilstationäre psychosomatische Rehabilitation im Vergleich', Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin 22(4), 432 -- 450. Geiser, F.; Bassler, M.; Bents, H.; Carls, W.; Joraschky, P.; Michelitsch, B.; Paar, G.; Ullrich, J. & Liedtke, R. (2002), 'Bewertung des Therapieerfolgs durch Patienten mit Angststörungen nach stationärer Psychotherapie', Der Nervenarzt 73(1), 59 -- 64. Generaldirektion Gesundheit & Verbraucherschutz, (2005), 'Grünbuch: Die psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern - Entwicklung einer Strategie für die Förderung der psychischen Gesundheit in der Europäischen Union'. Gove, W. (1972), 'Sex, marital status and suicide', Journal of Health and Social Behavior, 204 - 213. Grawe, K. (1998), Psychologische Therapie, Hogrefe Gottingen. Grawe, K. (1997), 'Research-informed psychotherapy', Psychotherapy Research 7(1), 1 – 19. Grawe, K. (1995), 'Grundriss einer allgemeinen Psychotherapie', Psychotherapeut(Berlin) 40(3), 130 -- 145. Grawe, K. (1992), 'Psychotherapieforschung zu Beginn der neunziger Jahre', Psychologische Rundschau 43(3), 132 – 162. Greenley, J. (1972), 'The psychiatric patient's family and length of hospitalization', Journal of Health and Social Behavior, 25 -- 37. Hardy, G.; Barkham, M.; Shapiro, D.; Stiles, W.; Rees, A. & Reynolds, S. (1995), 'Impact of cluster C personality disorders on outcomes of contrasting brief psychotherapies for depression', Journal of Consulting and Clinical Psychology 63(6), 997 -- 1004. 119 Hartmann, A. & Herzog, T. (1995), 'Varianten der Effektstärkenberechnung in Metaanalysen: Kommt es zu variablen Ergebnissen?', Zeitschrift für klinische Psychologie 24(4), 337 -- 343. Harty, M.; Cerney, M.; Colson, D.; Coyne, L.; Frieswyk, S.; Johnson, S. & Mortimer, R. (1981), 'Correlates of change and long-term outcome. An exploratory study of intensively treated hospital patients.', Bulletin of the Menninger Clinic 45(3), 209 – 228. Hautzinger, M. (2000), Kognitive Verhaltenstherapie bei psychischen Störungen, Beltz (Weinheim). Hautzinger, M. & Bailer, M. (1993), Allgemeine Depressions-Skala, Beltz.(Weinheim) Hautzinger, M.; Bailer, M.; Worall, H. & Keller, F. (1994), 'Beck-Depressions-Inventar (BDI)', Bern, Huber. Heeren, O.; Dixon, L.; Gavirneni, S. & Regenold, W. (2002), 'The association between decreasing length of stay and readmission rate on a psychogeriatric unit', Psychiatric Services 53(1), 76 – 79. Henry, W. & Strupp, H. (1994), 'The therapeutic alliance as interpersonal process', The working alliance: Theory, research, and practice, 51 -- 84. Hermann E.K.; Häusler R.; Hürlimann, E.; Lang, W. & Vauth, R (2007), 'Benchmarkbildung in der stationären Depressionsbehandlung Teil 1: Ist schneller auch besser?', Psychiatrie 4, 1 -- 4. Hermann E.K.; Häusler R.; Hürlimann, E.; Lang, W. & Vauth, R. (2008), 'Benchmarkbildung in der stationären Depressionsbehandlung Teil 2: Doppelt so krank heisst viermal so lang?', Psychiatrie 1, 21 — 24. Heuft, G. & Senf, W. (H.Thieme, S., ed. (1998), Praxis der Qualitätssicherung in der Psychotherapie: Das Manual zur Psy-BaDo.. Heuft, G. & Senf, W. (1998), 'Psy-BaDo-Basisdokumentation in der Psychotherapie', Deutsches Ärzteblatt-Köln 95, 1910 --1912. von Heymann, F.; Zaudig M. & Tritt, K. (2003), 'Die diagnosebezogene Behandlungsdauer in der Psychosomatischen und Psychotherapeutischen Medizin: eine homogene Größe? Erste Ergebnisse der Multicenter-Basisdokumentation (Psy-BaDo-PTM) als Grundlage qualitätssichernder Maßnahmen in der stationären Psychosomatik', Praxis klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation 62, 209 - 221. 120 Hiller,W.; Kroymann, R.; Leibbrand, R.; Cebulla, M.; Korn, H.; Rief, W. & Fichter, M. (2004), 'Wirksamkeit und Kosten-Nutzen-Effekte der stationären Therapie somatoformer Störungen', Fortschritte der Neurologie Psychiatrie 72(3), 136 -- 146. Horvath, A. & Symonds, B. (1991), 'Relation between working alliance and outcome in psychotherapy: A meta-analysis', Journal of Counseling Psychology 38(2), 139 --149. Horvitz-Lennon, M.; Normand, S.; Gaccione, P. & Frank, R. (2001), 'Partial versus full hospitalization for adults in psychiatric distress: a systematic review of the published literature (1957 - 1997)', American Journal of Psychiatry 158(5), Am Psychiatric Assoc, 676 -- 685. House, J.; Robbins, C. & Metzner, H. (1982), 'The association of social relationships and activities with mortality: prospective evidence from the Tecumseh Community Health Study', American Journal of Epidemiology 116(1), 123 – 140. Howard, K.; Brill, P.; Lueger, R.; O'Mahoney, M. & Grissom, G. (1993), 'Integra outpatient tracking assessment. Philadelphia: Compass Information Services', Inc. Howard, K.; Kopta, S.; Krause, M. & Orlinsky, D. (1986), 'The dose-effect relationship in psychotherapy', American Psychologist 41(2), 159 – 164. Howard, K.; Krause, M.; Saunders, S. & Kopta, S. (1997), 'Trials and tribulations in the metaanalysis of treatment differences: Comment on Wampold et al.(1997)', Psychological Bulletin 122, 221 -- 225. Howard, K.; Lueger, R.; Maling, M. & Martinovich, Z. (1993), 'A phase model of psychotherapy outcome: Causal mediation of change', Journal of Consulting and Clinical Psychology 61, 678 -678. Hrobjartsson, A. & Gotzsche, P. (2001), 'Is the placebo powerless? An analysis of clinical trials comparing placebo with no treatment', New England Journal of Medicine 344(21), 1594 -- 1602. Huber, D.; Albrecht, C.; Hautum, A.; Henrich, G. & Klug, G. (2009), 'Langzeit-Katamnese zur Effektivität einer stationären psychodynamischen Psychotherapie', Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 55, 189 — 199. Huber, D.; Henrich, G. & Klug, G. (2005), 'The scales of psychological capacities: Measuring Change in psychic structure', Psychotherapy Research 15(4), 445 -- 456. Huber, D. & Klug, G. (2006), 'Die psychische Struktur in den „Skalen psychischer Kompetenze “', Forum der Psychoanalyse 22(4), Springer, 394 -- 402. 121 Jakobsen, T.; Brockmann, J.; Grande, T.; Huber, D.; Klug, G.; Keller, W.; Rudolf, G.; Schlüter, T.; Staats, H. & Leichsenring, F. (2007), 'Ergebnisse analytischer Langzeitpsychotherapien: Verbesserungen in Symptomatik und interpersonellen Beziehungen bei spezifischen Storungen', Z Psychosom Med Psychother 53, 87-- 110. Joyce, A. & Piper, W. (1998), 'Expectancy, the therapeutic alliance, and treatment outcome in shortterm individual psychotherapy', Journal of Psychotherapy Practice and Research 7(3), 236 – 248. Junge, A. & Ahrens, S. (1996), 'In-Patient Psychotherapy - Patient's Characteristics and Treatment Effects', PPmP. Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie 46(12), 430 -- 437. Kastner, S. & Basler, H. (1997), 'Messen Veränderungsfragebögen wirklich Veränderungen?', Der Schmerz 11(4), 254 -- 262. Kazdin, A. (2005), 'Treatment Outcomes, Common Factors, and Continued Neglect of Mechanisms of Change.', Clinical Psychology: Science & Practice 12(2), 184 – 188. Keitner, G.; Ryan, C.; Miller, I. & Norman, W. (1992), 'Recovery and major depression: factors associated with twelve-month outcome', American Journal of Psychiatry 149(1), 93 – 99. Keller, W.; Westhoff, G.; Dilg, R.; Rohner, H. & Studt, H.H. (2001), 'Wirksamkeit und Inanspruchnahme von Krankenkassenleistungen bei Langzeitanalysen: Ergebnisse einer empirischen Follow-up-Studie zur Effektivität der (Jungianischen) Psychoanalyse und Psychotherapie', Analytische Psychologie 32(3), 202 — 229. Keller, M. (1994), 'Depression: a long-term illness', British Journal of Psychiatry 165(26), 9 --15. Klages, U. (2002), 'Irrationale Einstellungen und soziale Belastung bei Patienten in ambulanter Verhaltenstherapie: Verlauf, prognostische und mediierende Einflüsse auf den Behandlungserfolg', PPmP- Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie 52(12), 500 – 510. Klauer, T.; Maibaum, F. & Schneider, W. (2007), 'Selbst- und Fremdeinschätzungen der Therapiemotivation als Prädiktoren von Behandlungsabbrüchen in der stationären Psychotherapie.', Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie 254 (Suppl.2), 107-111. Klein, D. (1996), 'Preventing hung juries about therapy studies', Journal of Consulting and Clinical Psychology 64(1), 81--86. Klose, C.; Matteucci-Gothe, R. & Linden, M. (2006), 'Die Vor-und Nachbehandlung in der stationären psychosomatischen Rehabilitation Pre-and Post-Treatment in Inpatient Psychosomatic Rehabilitation', Rehabilitation 45, 359--368. 122 Klug, G.; Henrich, G.; Kachele, H.; Sandell, R. & Huber, D. (2008), 'Die Therapeutenvariable: Immer noch ein dunkler Kontinent?', Psychotherapeut 53(2), 83 – 91. R, K. (2000), Psychotherapie, Springer - Verlag Berlin Heidelberg New York. Koch-Institut, R. (2008), 'Psychotherapeutische Versorgung', Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Statistisches Bundesamt 41. Kulick, B. (1998), 'Erwartungen der Rentenversicherung an ambulante/teilstationäre Angebote zur Rehabilitation aus Sicht eines Leistungsträgers', Praxis der Klinischen Verhaltensmedizin und Rehabilitation 44, 7 --12. Kächele, H. (1990), 'Wie lange dauert Psychotherapie', Psychother Psychosom med Psychol 40, 148 --151. Kächele, H.; Kordy, H. & Richard, M. (2001), ' Research Group TR-EAT. Therapy amount and outcome of inpatient psychodynamic treatment of eating disorders in Germany: data from a multicenter study', Psychotherapy Research 11(3), 239—257. Lambert, M.J., Shapiro D.A. & Bergin, A.E. (1986), 'The effectiveness of psychotherapy.', In S.L. Garfield & A.E. Bergin (Eds.) Handbook of psychotherapy and behavior change. New York: Wiley 3, 157 – 212. Lambert, M. & Barley, D. (2001), 'Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy outcome', Psychotherapy 38(4), 357--361. Lambert, M. & Bergin, A.E. (1994), 'The effectiveness of psychotherapy', Handbook of psychotherapy and behavior change 4, 143--189. Lambert, M.J. & Anderson, E. (1996), 'Assessment for the time-limited psychotherapies' Review of psychiatry. American Psychiatric Press. (15), 23 – 42. Lamprecht, F. & Schmidt, J. (1990), 'Das Zauberberg-Projekt: Zwischen Verzauberung und Ernüchterung', Ahrens, S (Hrsg): Entwicklung und Perspektiven der Psychosomatik in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin etc, Springer, 97 -- 115. Laux, L.; Glanzmann, P.; Schaffner, P. & Spielberger, C. (1981), 'STAI Das State-TraitAngstinventar, Theoretische Grundlagen und Handanweisung, Original: State-Trait-Auxiety Inventory by Charles D. Spielberger (1970)', Das State-Trait-Angstinventar. Weinheim, Beltz-Test. 123 Leibbrand, R. & Hiller, W. (1998), 'Komorbidität somatoformer Störungen', Somatoforme Störungen. Ätiologie, Diagnose und Therapie, 53 -- 67. Leichsenring, F. & Rabung, S. (2008), 'Effectiveness of long-term psychodynamic psychotherapy: a meta-analysis', JAMA Journal of the American Medical Association 300(13), 1551 —1565. Leichsenring, F.; Rabung, S. & Leibing, E. (2004), 'The Efficacy of Short-term Psychodynamic Psychotherapy in Specific Psychiatric Disorders A Meta-analysis', Archives of General Psychiatry 61(12), Am Med Assoc, 1208 --1216. Lieberman, P.; Wiitala, S.; Elliott, B.; McCormick, S. & Goyette, S. (1998), 'Decreasing length of stay: are there effects on outcomes of psychiatric hospitalization?', American Journal of Psychiatry 155(7), Am Psychiatric Assoc, 905 -- 909. Luborsky, L.; Crits-Christoph, P.; Mintz, J. & Auerbach, A. (1988), Who will benefit from psychotherapy?: Predicting therapeutic outcomes, Basic Books New York. Luborsky, L.; McLellan, A.; Woody, G.; O' Brien, C. & Auerbach, A. (1985), 'Therapist success and its determinants', Archives of General Psychiatry 42(6), 602 -- 611. Luborsky, L. & Singer, B. (1975), 'Comparative studies of psychotherapies. Is it true that" everywon has one and all must have prizes"?', Archives of General Psychiatry 32(8), 995 – 1008. Lueger, R. (1995), 'Ein Phasenmodell der Veränderung in der Psychotherapie', Psychotherapeut(Berlin) 40(5), 267 -- 278. Lutz, W.; Lowry, J.; Kopta, S.; Einstein, D. & Howard, K. (2001), 'Prediction of Dose-Response Relations based on Patient Characteristics', Journal of clinical psychology 57(7), 889 — 900. Löhr, C.; Schewe, K.; Baudach, M. & Hahlweg, K. (2003), 'Zum Zusammenhang von Partnerschaftsqualität und Therapieerfolg bei agoraphobischen Patienen', Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie 32(1), 10 -- 13. Löschmann, C. (2000), 'Multizentristische Studie zur Evaluation von Entwöhnungsbehandlungen. Ein Beitrag zur Qualitätssicherung in der Rehabilitation Abhängigkeitskranker.', Frankfurt a.M.: Peter Lang.. MacDonald, A. (1994), 'Brief therapy in adult psychiatry', Journal of Family Therapy 16, 415 -- 426. 124 Martin, D.; Garske, J. & Davis, M. (2000), 'Relation of the therapeutic alliance with outcome and other variables: A meta-analytic review', Journal of Consulting and Clinical Psychology 68(3), 438 -- 450. McCrone, P. & Phelan, M. (1994), 'Diagnosis and length of psychiatric in-patient stay.', Psychological Medicine 24(4), 1025 – 1030. McDermut, W.; Mattia, J. & Zimmerman, M. (2001), 'Comorbidity burden and its impact on psychosocial morbidity in depressed outpatients', Journal of Affective Disorders 65(3), 289 -- 295. McLellan, A.; Alterman, A.; Metzger, D.; Grissom, G.; Woody, G.; Luborsky, L. & O'Brien, C. (1994), 'Similarity of outcome predictors across opiate, cocaine, and alcohol treatments: Role of treatment services', Journal of Consulting and Clinical Psychology 62(6), 1141 -- 1157. Mestel, R.; Vogler, J. & Klingelhöfer, J. (2001), 'Katamnesen mit AngstpatientInnen nach psychodynamischer verglichen mit kombiniert psychodynamisch-verhaltenstherapeutischer stationärer Psychotherapie', Stationäre Gruppenpsychotherapie. Mainzer Werkstatt über empirische Forschung von stationärer Psychotherapie. Mestel, R., Erdmann, A., Schmid, M., Klingelhöfer, J., Stauss, K., & Hautzinger, M.(2000). 1-3Jahres-Katamnesen bei 800 depressiven Patienten nach stationärer PsychosomatischerRehabilitation. In M. Bassler (Hrsg.), Leitlinien zur stationären PsychotherapiePro und Contra. Mainzer Werkstatt über empirische Forschung von stationärerPsychotherapie 1999 (S. 243-273). Giessen: Psychosozial-Verlag.. Michalak, J.; Kosfelder, J.; Meyer, F. & Schulte, D. (2003), 'Messung des Therapieerfolgs. Veränderungsmaße oder retrospektive Erfolgsbeurteilung', Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie 32(2), 94 --103. Mohr, G. (1990), 'Arbeit und Gesundheit', In R. Schwarzer (Hrsg.). Gesundheitspsychologie. Ein Lehrbuch. Göttingen: Hogrefe, 229 – 246. Moore, B. & Fine, B. (1990), Psychoanalytic terms and concepts, American Psychoanalytic Association. Neeb, K.; Winkler, K.; Schröder, A. & Mestel, R. (2001), 'Welchen Einfluss hat eine Therapiezeitverkürzung auf den Behandlungserfolg stationärer Psychotherapie?', Prax Klin Verhaltensmed Rehabil 56, 333 - 340. Nelson, T. & Steele, R. (2006), 'Beyond efficacy and effectiveness: A multifaceted approach to treatment evaluation', Professional Psychology Research and Practice 37(4), 389 – 394. 125 Nosper, M. (2008), 'The duration of psychosomatic rehabilitation: provisions, influencing factors, recommendations', Die Rehabilitation 47(1), 8 – 13. Nosper, M. (1999), Psychosomatische Rehabilitation: Untersuchungen zur Ergebnis- und Prozessqualität stationärer Einzel- und Gruppenpsychotherapien., Berlin: Logos-Verlag. Nosper, M. (1999), 'Der Erfolg psychosomatischer Rehabilitation in Abhängigkeit von der Behandlungsdauer', Psychother Psychosom Med Psychol 49(9-10), 354 -- 360. Oliver, J. & Simmons, M. (1984), 'Depression as measured by the DSM-III and the Beck Depression Inventory in an unselected adult population', Journal of Consulting and Clinical Psychology 52(5), 892 -- 898. Leibbrand, R.; Schröder, A.; Hiller, W. & Fichter, M.M. (1998), 'Komorbide Persönlichkeitsstörungen: Ein negativer Prädiktor für den Therapieerfolg bei somatoformen Störungen?', Zeitschrift für klinische Psychologie, 4. 319 – 324. Orlinsky, D.; Grawe, K. & Parks, B. (1994), 'Process and outcome in psychotherapy: Noch einmal', Handbook of psychotherapy and behavior change 4, 270--376. Orlinsky, D. & Howard, K. (1980), 'Gender and psychotherapeutic outcome', Women and psychotherapy, 3 -- 34. Paykel, E.; Cooper, Z.; Ramana, R. & Hayhurst, H. (1996), 'Life events, social support and marital relationships in the outcome of severe depression.', Psychological medicine 26(1), 121 — 133. Pfeiffer, S.; O Malley, D. & Shott, S. (1998), 'Factors associated with the outcome of adults treated in psychiatric hospitals: a synthesis of findings', Outcomes Assessment in Mental Health Treatment: A Compendium of Articles from Psychiatric Services, 43 – 48. Phillips, E. (1988), 'Length of psychotherapy and outcome: Observations stimulated by Howard, Kopta, Krause and Orlinsky', American Psychologist 43(8), 669 — 670. Pilkonis, P. & Frank, E. (1988), 'Personality pathology in recurrent depression: nature, prevalence, and relationship to treatment response', American Journal of Psychiatry 145(4), 435 – 441. Puschner, B.; Haug, S.; Häfner, S. & Kordy, H. (2004), 'Einfluss des Behandlungssettings auf den Gesundungsverlauf', Psychotherapeut 49(3), 182 – 192. Rachman, S. & Wilson, G. (1980), The effects of psychological therapy, Pergamon Press Oxford. 126 Reich, J. & Green, A. (1991), 'Effect of personality disorders on outcome of treatment', The Journal of nervous and mental disease 179(2), 74 – 82. Richter, D. (2001), 'Die Dauer der stationären psychiatrischen Behandlung', Fortschr Neurol Psychiatr 69, 19 – 31. Richter, D. (1999), 'Krankenhausbetriebsvergleich für psychiatrische Kliniken: Wie sinnvoll ist ein Vergleich der Behandlungsdauern nach Diagnose und Alter?', Das Gesundheitswesen, Stuttgart: Thieme, 61(5), 227 -- 233. Richter, P.; Werner, J.; Heerlein, A.; Kraus, A. & Sauer, H. (1998), 'On the validity of the Beck Depression Inventory', Psychopathology 31(3), 160 -- 168. Riedel, W. (1991), 'Einige Patientenmerkmale als Determinanten des Therapieerfolgs in der stationären Psychotherapie.', Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse. Vol 37(1), 14 -- 30. Rief, W.; Hiller, W. & Heuser, J. (1997), 'SOMS--Screening für Somatoforme Störungen', Manual zum Fragebogen. Huber Publishers: Bern. Rosenthal, D. & Frank, J. (1956), 'Psychotherapy and the placebo effect.', Psychological Bulletin 53(4), 294 – 302. Rosnow, R. & Rosenthal, R. (1988), 'Focused tests of significance and effect size estimation in counseling psychology', Journal of Counseling Psychology 35(2), 203 – 208. Rueddel, H. (1996), 'Gibt es eine optimale Therapiedauer in der stationären psychosomatischen Rehabilitation', Prax Klin Verhaltensmed Rehabil 9, 262 -- 264. Sack, M.; Lempa, W.; Lamprecht, F. & Schmid-Ott, G. (2003), 'Therapieziele und Behandlungserfolg: Ergebnisse einer Katamnese ein Jahr nach stationärer psychosomatischer Therapie', Z Psychosom Med Psychother 49, 63 – 73. Safran, J.D., & Muran J.C. (1995), 'The therapeutic alliance', In Session: Psychotherapy in Practice (Special Issue) 1(1), 59 – 71. Sandell, R. (2007), 'Die Menschen sind verschieden - auch als Patienten und Therapeuten', Psychoanalyse heute?!, Psychosozial-Verlag, Gießen, 461 – 469. Sandell, R.; Blomberg, J.; Lazar, A.; Carlsson, J.; Broberg, J. & Schubert, J. (2001), 127 'Unterschiedliche Langzeitergebnisse von Psychoanalysen und Psychotherapien. Aus der Forschung der Stockholmer Psychoanalyse-und Psychotherapieprojekts', Psyche 55, 270 -- 310. Sargeant, J.; Bruce, M.; Florio, L. & Weissman, M. (1990), 'Factors associated with 1-year outcome of major depression in the community.', Archives of general psychiatry 47(6), 519 – 526. Saunders, S.; Howard, K. & Orlinsky, D. (1989), 'The therapeutic bond scales: Psychometric characteristics and relationship to treatment effectiveness', Psychological Assessment 1(4), 323 – 330. Saß, H.; Wittchen, H. & Zaudig, M. (1996), 'Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen DSM IV' Hogrefe Verlag, Göttingen, Bern, Toronto, Seattle. Saß, H. (1989), 'GAF-Skala: Global Assessment of Functioning Scale in: Diagnostische Kriterien und Differenzialdiagnosen des diagnostischen und statistischen Manuals psychischer Störungen DSM-III'. R.-Weinheim; Beltz-Verlag: Basel Schauenburg, H.; Dinger, U. & Strack, M. (2005), 'Zur Bedeutung der Einzeltherapeuten für das Therapieergebniss in der stationären Psychotherapie-eine Pilotstudie', Psychother Psych Med, 55, 339 -- 346. Schmitz-Buhl, M.; Kriebel, R. & Paar, G. (1999), 'Zeitsensitive Therapie: Zusammenhänge zwischen Therapiedauer, Therapiemotivation, Beschwerdestärke und Behandlungserfolg in der stationären psychosomatischen Rehabilitation', Praxis der Klinischen Verhaltensmedizin und Rehabilitation 45, 21 – 27. Schneider, W.; Klauer, T.; Janssen, P. & Tetzlaff, M. (1999), 'Zum Einfluss der Psychotherapiemotivation auf den Psychotherapieverlauf', Der Nervenarzt 70(3), 240 – 249. Schubert, D.; Yokley, J.; Sloan, D. & Gottesman, H. (1995), 'Impact of the interaction of depression and physical illness on a psychiatric unit's length of stay', General hospital psychiatry 17(5), 326 -- 334. Schulte, D. (1993), 'Wie soll Therapieerfolg gemessen werden? Überblicksarbeit', Zeitschrift für klinische Psychologie 22(4), 374 — 393. Seligman, M.E.P. (1995), 'The effectiveness of psychotherapy', American Psychologist 50(12), 965 – 974. 128 Seligman, M.E.P. (1996), 'Science as an ally of practice.', The American psychologist 51(10), 1072 – 1079. Seligman, M.E.P. (1996), 'Long-term psychotherapy is highly effective: The Consumer Reports study.', Harvard Mental Health Letter 13 (1), 5 – 7. Shapiro, D. & Shapiro, D. (1982), 'Meta-analysis of comparative therapy outcome studies: a replication and refinement.', Psychological Bulletin 92(3), 581 – 604. Shapiro, D. & Shapiro, D. (1983), 'Comparative therapy outcome research: Methodological implications of meta-analysis', Journal of Consulting and Clinical Psychology 51(1), 42 -- 53. Shea, M.; Pilkonis, P.; Beckham, E.; Collins, J.; Elkin, I.; Sotsky, S. & Docherty, J. (1990), 'Personality disorders and treatment outcome in the NIMH Treatment of Depression Collaborative Research Program', American Journal of Psychiatry 147(6), 711 – 718. Sitta, P.; Brand, S.; Schneider, F.; Gaebel, W.; Berger, M.; Farin, E. & Härter, M. (2006), 'Faires Benchmarking der Behandlungsdauer depressiver Patienten in psychiatrisch-psychotherapeutischen Kliniken Duration of Inpatient Depression Treatment-Fair Benchmarking Between Hospitals', Psychother Psych Med 56, 128 – 137. Smith, M. & Glass, G. (1977), 'Meta-analysis of psychotherapy outcome studies', American Psychologist 32(9), 752 – 760. Smith, M.; Glass, G. & Miller, T. (1980), The benefits of psychotherapy, Johns Hopkins University Press, Baltimore. Spießl, H.; Binder, H.; Cording, C.; Klein, H. & Hajak, G. (2006), 'Klinikpsychiatrie unter ökonomischem Druck', Deutsches Ärzteblatt 103 (39), 2549 – 2552. Steenbarger, B. (1994), 'Duration and outcome in psychotherapy: An integrative review', Professional Psychology Research and Practice, 25, 111 --111. Steffanowski (2008), 'Evidenz psychosomatischer Rehabilitation im Spiegel multipler Ergebniskriterien', Master's thesis, Universität Mannheim. Steffanowski, A.; Löschmann, C.; Schmidt, J.; Wittmann, W. & Nübling, R. (2007), Meta-analyse der Effekte stationärer psychosomatischer Rehabilitation: Meta-studie, Huber- Verlag. 129 Stevens, A.; Hammer, K. & Buchkremer, G. (2001), 'A statistical model for length of psychiatric inpatient treatment and an analysis of contributing factors', Acta Psychiatrica Scandinavica 103(3), 203 – 211. Stevens, S.; Hynan, M. & Allen, M. (2000), 'A meta-analysis of common factor and specific treatment effects across the outcome domains of the phase model of psychotherapy', Clinical psychology: Science and practice, 7(3), 273 -- 290. Stieglitz, R. (1986), Erfassung von Veränderungen: Theoretische und empirische Beiträge, Oberhofer. Tritt, K.; von Heymann, F.; Loew, T.; Benker, B.; Bleichner, F.; Buchmüller, R.; Findeisen, P.; Galuska, J.; Kalleder, W.; Lettner, F. & others (2003), 'Patienten in stationärer psychosomatischer Krankenhausbehandlung: Patientencharakterisierung und Behandlungsergebnisse anhand der PsyBaDo-PTM', Psychotherapie 8, 244 – 251. Trojan, A. & Doerner, K. (1978), Psychisch krank durch Etikettierung?: Die Bedeutung des Labeling-Ansatzes für die Sozialpsychiatrie, Urban & Schwarzenberg. Wallerstein, R. (1991), 'Assessment of structural change in psychoanalytic therapy and research.', In: Shapiro T (ed) The concept of structure in psychoanalysis. International Universities Press, Madison. Wallerstein, R. (1994), 'Psychotherapy research and its implications for a theory of therapeutic change: A forty-year overview', Psychoanalytic Study of the Child 49, 120 – 141. Wampold, B. (2001), The great psychotherapy debate: Models, methods, and findings, Lawrence Erlbaum Associates. Wampold, B.; Minami, T.; Tierney, S.; Baskin, T. & Bhati, K. (2005), 'The placebo is powerful: estimating placebo effects in medicine and psychotherapy from randomized clinical trials', Journal of clinical psychology 61(7), 835 – 854. Wampold, B.; Mondin, G.; Moody, M.; Stich, F.; Benson, K.; Ahn, H. & others (1997), 'A MetaAnalysis of Outcome Studies Comparing Bona Fide Psychotherapies: Empirically," All Must Have Prizes"', Psychological Bulletin 122, 203 – 215. Watt, D. & Buglass, D. (1966), 'The effect of clinical and social factors on the discharge of chronic psychiatric patients', Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 1(2), 57 – 63. 130 Weissman, M. & Bothwell, S. (1990), 'Social Adjustment Scale-Self Report (SAS-SR)', Measurement of nursing outcomes 1, 230 -- 283. Weyerer, S. & Dilling, H. (1980), 'Der Einfluß der sozialen Schicht auf Aufenthaltsdauer und Entlassung', Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 15(2), 95 – 101. von Wietersheim, J.; Ennulat, A.; Probst, B.; Wilke, E. & Feiereis, H. (1989), 'Konstruktion und erste Evaluation eines Fragebogens zur sozialen Integration', Diagnostica 35, 359 – 363. Wilson, G. & Rachman, S. (1983), 'Meta-analysis and the evaluation of psychotherapy outcome: Limitations and liabilities', Journal of Consulting and Clinical Psychology 51(1), 54 – 64. de Witt K.N.; Hartley, D. & Rosenberg, S.E. (1991), 'Scales of psychological capacities: development of an assessment approach.', Psychoanal Contemp Thought 14, 334 – 343. Wittchen, H. & Jacobi, F. (2001), 'Die Versorgungssituation psychischer Störungen in Deutschland', Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 44(10), 993 – 1000. Wolfe, B. & Goldfried, M. (1988), 'Research on psychotherapy integration: Recommendations and conclusions from an NIMH workshop', Journal of Consulting and Clinical Psychology 56(3), 448 – 451. Zeeck, A.; Scheidt, C.; Hartmann, A. & Wirsching, M. (2003), 'Stationäre oder teilstationäre Psychotherapie?', Psychotherapeut 48(6), 420 – 425. Zielke, M. & Kopf-Mehnert, C. (1978), Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens, Beltz-Test. Zielke, M. (1979), 'Kieler Änderungssensitive Symptomliste (KASSL) ' Weinheim: Beltz Zielke, M. & Sturm, J. (1994), 'Chronisches Krankheitsverhalten: Entwicklung eines neuen Krankheitsparadigmas', Handbuch Stationäre Verhaltenstherapie, 42 – 60. Zielke, M. (1995), 'Arbeitsbelastungen und Krankheitsverläufe bei Patienten mit psychischen und psychosomatischen Erkrankungen', Praxis der Klinischen Verhaltensmedizin und Rehabilitation 8, 271 – 281. 131 Zielke, M.; Dehmlow, A.; Wülbeck, B. & Limbacher, K. (1997), 'Einflußfaktoren auf die Behandlungsdauer bei psychosomatischen Erkrankungen in der stationären Verhaltenstherapie', Praxis Klinische Verhaltenstherapie und Rehabilitation 37, 22 – 56. Zielke, M. (1999), 'Kosten-Nutzen-Aspekte in der Psychosomatischen Rehabilitation', Psychother Psychosom Med Psychol 49, 361 – 367. 132 Anhang 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142