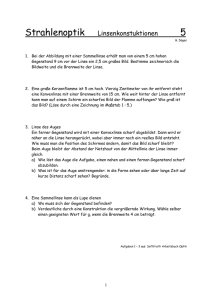DE102005013222B420151231
Werbung

(19) *DE102005013222B420151231* (10) (12) DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 Patentschrift (21) Aktenzeichen: 10 2005 013 222.7 (22) Anmeldetag: 17.03.2005 (43) Offenlegungstag: 21.09.2006 (45) Veröffentlichungstag der Patenterteilung: 31.12.2015 (51) Int Cl.: G01B 11/00 (2006.01) G01B 11/26 (2006.01) G01D 5/36 (2006.01) Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 1 Patentkostengesetz). (73) Patentinhaber: Dr. Johannes Heidenhain GmbH, 83301 Traunreut, DE (74) Vertreter: Maikowski & Ninnemann Patentanwälte, 10707 Berlin, DE (56) Ermittelter Stand der Technik: DE DE US US EP JP 26 53 545 103 17 736 4 079 252 5 539 519 1 420 229 57 013 307 B1 A1 A A A1 A (72) Erfinder: Benner, Ulrich, 83308 Trostberg, DE (54) Bezeichnung: Positionsmesseinrichtung (57) Hauptanspruch: Positionsmesseinrichtung mit – einer Maßverkörperung (15), – einer Abtasteinheit zum Abtasten der Maßverkörperung (15) mittels elektromagnetischer Strahlung zur Ermittlung von Positionsinformationen, – einer Linsenanordnung (2; 2, 2‘) der Abtasteinheit, die im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung zwischen der Maßverkörperung (15) und einer strahlungsempfindlichen Fläche (35) eines Detektors (3) der Abtasteinheit liegt, und – einer von der Maßverkörperung (15) beabstandeten Oberfläche (12) einer Komponente (1) der Positionsmesseinrichtung, die im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung zwischen der Maßverkörperung (15) und der strahlungsempfindlichen Oberfläche (35) des Detektors (3) liegt, wobei die besagte Komponente (1) der Positionsmesseinrichtung als ein Träger (1) der Maßverkörperung (15) ausgebildet ist, und – einer von der Maßverkörperung (15) beabstandeten Oberfläche (41) einer weiteren Komponente (4) der Positionsmesseinrichtung, die im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung zwischen der Maßverkörperung (15) und der strahlungsempfindlichen Oberfläche (35) des Detektors (3) liegt, wobei die weitere Komponente (4) der Positionsmesseinrichtung durch eine Abdeckung oder eine Abtastplatte der Abtasteinheit gebildet wird, wobei ferner die von der Maßverkörperung (15) beabstandeten Oberflächen (12, 41) der beiden Komponenten (1, 4) der Positionsmesseinrichtung jeweils derart in einer Umgebung (F) der Brennebene (B) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) liegen, dass das bei Abtastung der Maßverkörperung (15) mittels der Abtasteinheit erzeugte Abbild eventueller auf jenen Oberflächen (12, 41) befindlicher Störstellen oder Störpartikel über die gesamte strahlungsempfindliche Fläche (35) des Detektors (3) delokalisiert ist, indem die am Träger (1) der Maßverkörperung (15) ausgebildete, von der Maßverkörperung (15) beabstandete Oberfläche (12) und die an der Abdeckung oder Abtastplatte der Abtasteinheit ausgebildete, von der Maßverkörperung (15) beabstandete und dem Träger (1) zugewandte Oberfläche (41) derart durch einen Spalt voneinander getrennt sind, dass beide Oberflächen (12, 41) in der besagten Umgebung der Brennebene (B) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) angeordnet sind. DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 Beschreibung [0001] Die Erfindung betrifft eine Positionsmesseinrichtung zur Bestimmung der Lage zweier zueinander beweglicher Objekte. [0002] Eine derartige Positionsmesseinrichtung umfasst eine Maßverkörperung sowie eine Abtasteinheit zum Abtasten der Maßverkörperung mittels elektromagnetischer Strahlung zur Ermittlung von Positionsinformationen, wobei die Maßverkörperung einerseits und die Abtasteinheit andererseits an jeweils einem der beiden zueinander beweglichen Objekte, zum Beispiel an je einem von zwei zueinander beweglichen Maschinenteilen, angeordnet werden. Die Abtasteinheit weist ferner eine Linsenanordnung auf, die im Strahlengang der zum Abtasten der Maßverkörperung verwendeten elektromagnetischen Strahlung zwischen jener Maßverkörperung und der strahlungsempfindlichen Fläche eines Detektors der Abtasteinheit liegt. Weiterhin liegt im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung zwischen der Maßverkörperung und der Linsenanordnung bzw. der strahlungsempfindlichen Fläche eines Detektors mindestens eine von der Maßverkörperung beabstandete Oberfläche einer Komponente der Positionsmesseinrichtung, beispielsweise in Form einer Oberfläche eines als Abdeckung oder Abtastplatte dienenden transparenten Teiles. [0003] Eine derartige Positionsmesseinrichtung ist beispielsweise in der EP 1 420 229 A1 beschrieben. Danach ist die Maßverkörperung auf einer ersten, der Linsenanordnung abgewandten Oberfläche eines Trägers vorgesehen, mit der der Träger auf einem geeigneten Substrat aufliegt. Die der Maßverkörperung gegenüberliegende, zweite Oberfläche des Trägers ist der Linsenanordnung zugewandt und bildet eine von der Maßverkörperung beabstandete Oberfläche, die im Strahlengang des zum Abtasten der Maßverkörperung verwendeten Lichtes zwischen der Maßverkörperung und der Linsenanordnung liegt. Mit einer solchen Anordnung des Trägers der Maßverkörperung auf einem zugeordneten Substrat, bei der der Träger mit seiner mit der Maßverkörperung versehenen Oberfläche auf dem zugeordneten Substrat liegt, soll eine Verschmutzung der Maßverkörperung verhindert werden. Denn die mit der Maßverkörperung versehene Oberfläche des Trägers ist ja einerseits durch den Kontakt mit dem zugeordneten Substrat vor Verschmutzung geschützt und andererseits durch die von der Maßverkörperung beabstandete, zweite Oberfläche des Trägers, welche im Strahlengang des zur Abtastung verwendeten Lichtes zwischen Maßverkörperung und Linsenanordnung liegt. [0004] Aus der US 4,079,252 A ist eine Maßverkörperung in Form einer Teilungsstruktur bekannt, die auf einem Träger aufgebracht ist und die von einer Abtasteinheit abgetastet wird, wobei eine der Abtas- teinheit zugeordnete und relativ zu der Maßverkörperung bewegliche Komponente eine der Maßverkörperung zugewandte und hiervon beabstandete Oberfläche aufweist. [0005] Ferner ist in der JP 57 013307 A eine Positionsmesseinrichtung beschrieben, bei der ein mit Schlitzen versehener Träger auf beiden Seiten jeweils von einer transparenten Platte bedeckt ist, um eine Verschmutzung des Trägers zu vermeiden. Die dem Träger abgewandten Oberflächen der beiden Platten liegen dabei jeweils außerhalb des Fokus derjenigen Linsen, welche die zur Abtastung des geschlitzten Trägers vorgesehene Strahlung auf jenen Träger projizieren. [0006] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Positionsmesseinrichtung der eingangs genannten Art im Hinblick auf die Vermeidung einer Beeinträchtigung der Messergebnisse durch Störstellen bzw. Störpartikel weiter zu verbessern. [0007] Dieses Problem wird nach einem Aspekt der Erfindung durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. [0008] Danach ist vorgesehen, dass die von der Maßverkörperung beabstandeten (und im Strahlengang zwischen Maßverkörperung und Linsenanordnung bzw. strahlungsempfindlicher Detektorfläche liegenden) Oberflächen zweier Komponenten der Positionsmesseinrichtung derart in der Umgebung der Brennebene der Linsenanordnung liegen, dass das bei Abtastung der Maßverkörperung mittels der Abtasteinheit erzeugte Abbild eventuell auf jenen Oberflächen befindlicher Störpartikel oder sonstige Störstellen, wie z.B. Kratzer, über die gesamte strahlungsempfindliche Fläche des Detektors der Positionsmesseinrichtung delokalisiert wird. [0009] Bei den Komponenten, an denen die im Strahlengang der Positionsmesseinrichtung liegenden Oberflächen vorgesehen sind, handelt es einerseits um eine Komponente der Abtasteinrichtung und andererseits um eine Komponente, die eine Baueinheit mit der Maßverkörperung bildet, insbesondere um einen Träger der Maßverkörperung. Dabei dient eine Oberfläche jenes Trägers zur Aufnahme der Maßverkörperung und eine andere, gegenüberliegende Oberfläche des Trägers bildet diejenige Oberfläche, die in definierter Weise bezüglich der Brennebene der Linsenanordnung bzw. der ersten Linse der Linsenanordnung in den Strahlengang der zum Abtasten verwendeten elektromagnetischen Strahlung zu legen ist. Der Träger wird dabei bevorzugt derart im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung angeordnet, dass die von der Maßverkörperung beabstandete Oberfläche des Trägers der Linsenanordnung zugewandt ist und die mit der Maßverkörperung versehene Oberfläche des Trägers der Lin- 2/15 DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 senanordnung abgewandt ist. Mit der zweitgenannten, mit der Maßverkörperung versehenen Oberfläche liegt der Träger dann bevorzugt auf einem Substrat auf, so dass die mit der Maßverkörperung versehene Oberfläche hinreichend gegen Verschmutzung geschützt ist. [0010] Die von der Maßverkörperung beabstandete Oberfläche der vorstehend zuerst genannten Komponente der Positionsmesseinrichtung, die in definierter Weise bezüglich der Brennebene der Linsenanordnung bzw. einer Linse der Linsenanordnung im Strahlengang der Positionsmesseinrichtung anzuordnen ist, ist als eine von der Maßverkörperung separate Komponente, nämlich als eine Abtast- oder Abdeckplatte, ausgebildet. Gemäß der Erfindung ist jene Abtastplatte bzw. Abdeckung derart bezüglich des Trägers der Maßverkörperung angeordnet, dass zwischen der der Maßverkörperung abgewandten Oberfläche des Trägers der Maßverkörperung und der gegenüberliegenden Oberfläche jener Abtastplatte bzw. Abdeckung nur ein Spalt gebildet ist, der sehr klein verglichen mit der relevanten Brennweite der Linsenanordnung bzw. der ersten Linse der Linsenanordnung ist. Dadurch kann sowohl die der Maßverkörperung abgewandte Oberfläche des Trägers der Maßverkörperung als auch die benachbarte Oberfläche einer hiervon separaten Abtastplatte/Abdeckung derart bezüglich der relevanten Brenn- bzw. Fourier-Ebene angeordnet werden, dass sowohl die Effekte auf der besagten Oberfläche des Trägers befindlicher Störstellen als auch die Effekte auf der besagten Oberfläche der separaten Abtastpallte/Abdeckung befindlicher Störstellen bei Abbildung auf die strahlungsempfindliche Fläche des Detektors verschmiert werden. [0011] Unter der Brennebene der Linsenanordnung wird in dem Fall, dass die Linsenanordnung aus einer einzelnen Linse oder einem ebenen Linsenarray besteht, schlicht die Brennebene jener einzelnen Linse bzw. jenes Linsenarrays verstanden. In dem Fall, dass die Linsenanordnung aus einer Mehrzahl im Strahlengang der zur Abtastung verwendeten elektromagnetischen Strahlung hintereinander angeordneter Linsen oder ebener Linsenarrays besteht, welche eine Objektiv bilden, wird unter der Brennebene der Linsenanordnung die Brennebene jenes Objektivs verstanden. In einer alternativen Betrachtung kann die Linsenanordnung durch eine Ersatzlinse repräsentiert werden, welche dieselbe Brennweite und dieselbe Gegenstandsweite wie jene Linsenanordnung aufweist. [0012] Die Brennebene der Linsenanordnung wird auch als Fourier-Ebene bezeichnet. Die Anordnung eines Objektes unmittelbar in der Brennebene bzw. Fourier-Ebene der Linsenanordnung hat zur Folge, dass das Abbild in der Brennebene bzw. Fourier-Ebene befindlicher Störstellen oder Störpartikel in der De- tektionsebene – in einer idealisierten Betrachtung – vollständig und strukturlos delokalisiert wäre. [0013] Vorliegend kommt es darauf an, dass die Effekte eventueller Störstellen bzw. Störpartikel, wie z.B. Schmutzpartikel oder Kratzer, die sich auf der im Strahlengang zwischen Maßverkörperung und Linsenanordnung liegenden Oberfläche befinden können, bei Abbildung auf die strahlungsempfindliche Fläche des Detektors derart verschmiert werden, dass sie sich auf der gesamten strahlungsempfindlichen Fläche gleichmäßig auswirken. Es soll also verhindert werden, dass sich bei Abbildung von auf jener Oberfläche befindlicher Schmutzpartikel oder Kratzer auf die strahlungsempfindliche Fläche der Detektors eine ortsabhängige Beeinflussung der an der strahlungsempfindlichen Fläche erfassten elektromagnetischen Strahlung ergibt. Hierfür ist es nicht zwingend erforderlich, dass diejenige Oberfläche einer Komponente der Positionsmesseinrichtung, die im Strahlengang der zum Abtasten verwendeten elektromagnetischen Strahlung zwischen der Maßverkörperung und des Detektors liegt und auf der sich z.B. Schmutzpartikel befinden können, unmittelbar in der Brennebene bzw. Fourier-Ebene der Linsenanordnung angeordnet ist. Vielmehr ist es ausreichend, wenn jene Oberfläche in einem die Brenn- bzw. Fourier-Ebene umfassenden Fourier-Bereich liegt, so dass eine hinreichende Verschmierung der Effekte auf jener Oberfläche befindlicher Störstellen bzw. -partikel bei Abbildung auf die strahlungsempfindliche Fläche des Detektors gewährleistet ist. Hierzu kann etwa vorgesehen sein, dass die Breite des Fourier-Bereiches das 0,4-fache der Brennweite der Linsenanordnung beträgt, so dass die Grenzen des Fourier-Bereiches durch zwei parallel zur Brenn- bzw. Fourier-Ebene erstreckte Ebenen gebildet werden, deren Abstand von der Brenn- bzw. Fourier-Ebene jeweils das 0,2-fache der Brennweite beträgt. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform sind die Grenzen des Fourier-Bereiches jeweils nur um eine Länge von der Brennebene beabstandet, die dem 0,1-fachen der Brennweite entspricht. [0014] Nach einem anderen Aspekt der Erfindung wird gemäß Anspruch 5 die Lage der Oberfläche einer im Strahlengang angeordneten Komponente der Positionsmesseinrichtung, auf der sich Störstellen bzw. -partikel befinden können, nicht auf die Brennweite der gesamten Linsenanordnung bezogen, sondern vielmehr auf die Brennweite derjenigen Linse der Linsenanordnung, die jener Oberfläche zugewandt ist, also der besagten Oberfläche am nächsten liegt. Hierbei handelt es sich – bezogen auf die abzutastende Maßverkörperung – insbesondere um die erste Linse der Linsenanordnung, also um diejenige Linse der Linsenanordnung, die die zum Abtasten verwendete elektromagnetische Strahlung nach Wechselwirkung mit der Maßverkörperung zuerst erreicht. 3/15 DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 [0015] Bei der der Maßverkörperung zugewandten (ersten) Linse der Linsenanordnung muss es sich dabei nicht zwingend um eine Einzellinse handeln; vielmehr kann sie einen Bestandteil eines ebenen Linsenarrays bilden, also einer Mehrzahl in einer Ebene angeordneter Linsen. Die Linsenanordnung insgesamt kann in diesem Fall beispielsweise durch ein einzelnes Linsenarray oder durch eine Mehrzahl im Strahlengang der zur Abtastung verwendeten elektromagnetischen Strahlung hintereinander angeordneter Linsenarrays bestehen. abtastbaren Maßverkörperung sowie einen Detektor zur Erfassung des Lichtes nach Reflektion an der Maßverkörperung und eine im Strahlengang zwischen Maßverkörperung und Detektor angeordnete Linsenanordnung; [0016] Aus den gleichen Gründen wie beim erstgenannten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist es auch hier nicht erforderlich, dass die von der Maßverkörperung beabstandete Oberfläche jener Komponente der Positionsmesseinrichtung, auf der sich Störpartikel oder dergl. befinden können, unmittelbar in der Brenn- bzw. Fourier-Ebene liegt, sondern sie kann in einem eine Brennebene einschließenden Fourier-Bereich angeordnet sein, dessen Grenzen etwa jeweils um das 0,2-fache der Brennweite jener ersten Linse, besonders bevorzugt um das 0, 1-fache der Brennweite, von der Brennebene beabstandet sind. [0023] Fig. 2c eine dritte Abwandlung der Positionsmesseinrichtung aus Fig. 1; [0017] In dem Fall, in dem die Linsenanordnung lediglich eine einzelne Linse bzw. eine in einer Ebene angeordnete Linsengruppe umfasst, führen die beiden Aspekte der Erfindung zu einer identischen Anordnung der mit der relevanten Oberfläche versehenen Komponente der Positionsmesseinrichtung im Strahlengang, da jeweils auf die Brennweite einer Linse der Linsenanordnung Bezug zu nehmen ist. [0018] Die erfindungsgemäße Lösung ist besonders bevorzugt anwendbar bei nach dem so genannten „Auflichtverfahren“ arbeitenden Positionsmesseinrichtungen, bei denen an dem Detektor der Positionsmesseinrichtung Anteile einer von einer Strahlungsquelle erzeugten, zum Abtasten der Maßverkörperung verwendeten elektromagnetischen Strahlung empfangen werden, die zuvor von der Maßverkörperung reflektiert worden sind. Grundsätzlich ist die erfindungsgemäße Lösung aber auch bei so genannten „Durchlichtsystemen“ verwendbar, bei denen die von einer Strahlungsquelle zum Abtasten der Maßverkörperung erzeugte elektromagnetische Strahlung bei der Wechselwirkung mit der Maßverkörperung durch diese hindurchtritt und daran anschließend auf den Detektor auftrifft. [0019] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden bei der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Figuren deutlich werden. [0020] Es zeigen: Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Teiles einer Positionsmesseinrichtung umfassend einen Teilungsträger mit einer durch Licht [0021] Fig. 2a eine erste Abwandlung der Positionsmesseinrichtung aus Fig. 1; [0022] Fig. 2b eine zweite Abwandlung der Positionsmesseinrichtung aus Fig. 1; [0024] Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Positionsmesseinrichtung mit einer Maßverkörperung und einem der Maßverkörperung zugeordneten Detektor sowie einer zwischen der Maßverkörperung und dem Detektor angeordneten, zwei Linsen umfassenden Linsenanordnung; [0025] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer Positionsmesseinrichtung. [0026] Fig. 4 zeigt dabei schematisch den grundsätzlichen Aufbau einer Positionsmesseinrichtung, und Fig. 1 illustriert die Überlegungen, auf denen die erfindungsgemäße Ausgestaltung einer Positionsmesseinrichtung beruht. Fig. 2a stellt ein konkretes Ausführungsbeispiel der patentgemäßen Lösung dar; und die Fig. 2b und Fig. 2c zeigen Abwandlungen hiervon. Fig. 3 schließlich betrifft konkret eine Linsenanordnung mit mehreren Einzellinsen. [0027] In Fig. 4 ist schematisch der Aufbau einer Positionsmesseinrichtung zur Bestimmung der relativen Lage zweier zueinander beweglicher Objekte dargestellt. Dieser Aufbau ist von seinem Prinzip her sowohl bei Längenmesseinrichtungen anwendbar, mit der die relative Lage zweier Objekte entlang einer Achse bestimmt wird, als auch bei einer Winkelmesseinrichtung, mit der die relative Winkellage zweier zueinander verdrehbarer Objekte ermittelt wird. [0028] Die Positionsmesseinrichtung umfasst auf einem Teilungsträger T eine Maßverkörperung in Form einer periodischen Inkrementalteilung oder in Form einer absolute Positionsinformation enthaltenden Codespur, die mittels einer zugeordneten Abtasteinheit unter Verwendung elektromagnetischer Strahlung in Form von Licht abgetastet wird. Indem der Teilungsträger T zusammen mit der hierauf vorgesehenen Maßverkörperung an einem der beiden zueinander beweglichen Objekte und die zugeordnete Abtasteinheit am anderen der beiden zueinander beweglichen Objekte angeordnet wird, kann durch Abtastung der Maßverkörperung mit der zugeordneten Abtasteinheit in bekannter Weise die Lage der beiden Objekte zueinander erfasst werden, und zwar 4/15 DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 bei Verwendung einer Maßverkörperung in Form einer Codespur jeweils durch Gewinnung absoluter Positionsinformationen hinsichtlich der Lage des einen Objektes bezüglich des anderen Objektes und im Fall einer Maßverkörperung in Form einer Inkrementalspur durch Informationen hinsichtlich der Änderung der Lage des einen Objektes bezüglich des anderen Objektes. [0029] Hierzu umfasst die dem Teilungsträger T zugeordnete Abtasteinheit eine Strahlungsquelle in Form einer Lichtquelle L (lichtemittierenden Diode) mit einer nachgeordneten Kondensorlinse K zur Parallelisierung des von der Lichtquelle L ausgestrahlten Lichtes, das zu dem Teilungsträger T geführt und von diesem unter Wechselwirkung mit der dort vorgesehenen Maßverkörperung transmittiert wird. Das transmittierte Licht passiert eine im Strahlengang S zwischen dem Teilungsträger T und einem nachgeordneten Detektor D liegende Linsenanordnung O und gelangt dann zur strahlungsempfindlichen Fläche F des Detektors D, an der die Strahlung durch geeignete Detektionselemente, insbesondere in Form von Fotoelementen detektiert wird. Im Strahlengang S der von der Lichtquelle L erzeugten und am Detektor T detektierten elektromagnetischen Strahlung in Form von Licht können noch weitere Komponenten der Positionsmesseinrichtung, wie z. B. eine Abtastplatte oder eine Abdeckplatte angeordnet sein. Dies ist in Fig. 4 durch die mit dem Bezugszeichen A versehene Komponente angedeutet. Bei den für die Linsenanordnung O verwendeten Linsen kann es sich sowohl um refraktive als auch um diffraktive Linsen handeln. [0030] Opto-elektronische Positionsmesseinrichtungen der in Fig. 4 dargestellten Art sind allgemein bekannt. Für weitere Einzelheiten hierzu wird beispielhaft auf das Fachbuch Ditigale Längenund Winkelmesstechnik von Alfons Ernst, 3. Auflage (Landsberg/Lech, 1998) verwiesen. Weiterhin sei für die möglichen Gestaltungen einer derartigen Positionsmesseinrichtung beispielhaft auf die DE 103 17 736 A1 und den dort erwähnten Stand der Technik Bezug genommen. [0031] Bei der in Fig. 4 dargestellten Positionsmesseinrichtung handelt es sich speziell um ein im Durchlichtverfahren arbeitendes Messsystem. D. h., die von der Lichtquelle L erzeugte und ausgesandte elektromagnetische Strahlung in Form von Licht passiert den Teilungsträger T unter Wechselwirkung mit einer am Teilungsträger T vorgesehenen Maßverkörperung und gelangt nach Wechselwirkung mit der Maßverkörperung zu einem Detektor D, der auf der anderen Seite des Teilungsträgers T angeordnet ist wie die Lichtquelle L. Messsysteme nach dem so genannten Auflichtverfahren, bei denen das Licht der Lichtquelle L am Teilungsträger T reflektiert wird, sind ebenso möglich. Dort ist der Detektor D auf derselben Seite des Teilungsträgers angeordnet wie die Lichtquelle L. D. h., die von der Lichtquelle L erzeugte und ausgesandte elektromagnetische Strahlung in Form von Licht würde in diesem Fall an dem Teilungsträger T reflektiert und gelangte nach Wechselwirkung mit einer am Teilungsträger T vorgesehenen Maßverkörperung zu einem Detektor D, der auf derselben Seite des Teilungsträgers T angeordnet ist wie die Lichtquelle L. [0032] Nachfolgend werden anhand der Fig. 1 bis Fig. 3 Ausschnitte einer Positionsmesseinrichtung der in Fig. 4 dargestellten Art beschrieben werden, die eine spezielle Anordnung der zwischen Teilungsträger T und Detektor D befindlichen Linsenanordnung O bezüglich mindestens einer im Strahlengang S zwischen Teilungsträger T und Detektor D befindlichen Oberfläche betreffen. [0033] Die zunächst anhand der Fig. 1 und Fig. 2a bis Fig. 2c erläuterten technischen Merkmale und Eigenschaften einer Positionsmesseinrichtung hinsichtlich der Anordnung einer Linse 2 mit Bezug auf eine von der Maßverkörperung 15 beabstandete Oberfläche einer weiteren Komponente der Positionsmesseinrichtung gelten in gleicher Weise für den Fall, dass die Linsenanordnung aus einer Mehrzahl Linsen besteht. Dabei ist sowohl der Fall erfasst, dass die einzelnen Linsen ein in einer Ebene erstrecktes Linsenarray bilden als auch der Fall, dass eine Mehrzahl Linsen oder Linsenarrays im Strahlengang S der zur Abtastung verwendeten elektromagnetischen Strahlung hintereinander angeordnet ist. Im erstgenannten Fall gelten die nachfolgend anhand einer einzelnen Linse 2 angestellten Betrachtungen schlicht und einfach für jede Linse des in einer Ebene angeordneten Linsenarrays. Im zweitgenannten Fall kann die in den Fig. 1 und Fig. 2a bis Fig. 2c jeweils dargestellte Linse 2 als eine Ersatzlinse gedacht werden, die jeweils die gesamte, ein Objektiv bildende Linsenanordnung repräsentiert. [0034] Gemäß dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel ist ein mit einer Maßverkörperung 15 versehener Teilungsträger 1, der durch eine für die zum Abtasten verwendete elektromagnetische Strahlung transparente Platte 10 (insbesondere bestehend aus Glas) gebildet wird, derart auf einer Unterlage U angeordnet, dass die mit der Maßverkörperung 15 versehene Oberfläche 11 des Teilungsträgers 1 auf der Unterlage U liegt. D. h., die mit der Maßverkörperung 15 versehene Oberfläche 11 des Teilungsträgers 1 ist durch die Unterlage U überdeckt. [0035] Der in Fig. 1 schematisch dargestellte Teilungsträger 1 und die auf einer Oberfläche 11 des Teilungsträgers 1 vorgesehene Maßverkörperung 15 können insbesondere einen Maßstab mit linearer Messteilung bilden, der sich in Fig. 1 senkrecht zur Bildebene erstreckt und Positionsmessungen entlang 5/15 DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 einer in dieser Richtung verlaufenden Achse ermöglicht. [0036] Hierzu ist der Maßverkörperung 15 eine Abtasteinheit der in Fig. 4 dargestellten Art zugeordnet, mit der die Maßverkörperung 15 beispielsweise fotoelektrisch abtastbar ist und von der in Fig. 1 lediglich ein der Maßverkörperung 15 zugeordneter Detektor 3 mit einer strahlungsempfindlichen Fläche 35 sowie eine zwischen dem Teilungsträger 1 und dem Detektor 3 vorgesehene Linsenanordnung 2 dargestellt sind. [0037] Die Linsenanordnung 2 wird hier der Einfachheit halber durch eine einzelne Linse repräsentiert. Hierbei kann es sich einerseits tatsächlich um eine Einzellinse handeln oder andererseits auch um eine so genannte „Ersatzlinse“, die hinsichtlich der maßgeblichen optischen Eigenschaften, wie z. B. der Brennweite f und der Gegenstandsweite g, mit einer aus mehreren im Strahlengang S der zur Abtastung verwendeten Strahlung hintereinander angeordneten Linsen bestehenden Linsenanordnung übereinstimmt, die durch die Ersatzlinse repräsentiert wird. [0038] Die Linse 2 ist vorliegend derart im Strahlengang S der zur Abtastung der Maßverkörperung 15 verwendeten elektromagnetischen Strahlung zwischen dem Teilungsträger 1 und dem Detektor 3 angeordnet, dass die Maßverkörperung 15 in der Gegenstandsebene der Linse 2 liegt, also der Abstand der Linse 2 und Maßverkörperung 15 der Objektweite bzw. Gegenstandsweite g der Linse 2 entspricht. [0039] Weiterhin entspricht der Abstand zwischen der Linse 2 und der der Linse 2 zugewandten – und somit der Maßverkörperung 15 gegenüberliegenden – Oberfläche 12 des Teilungsträgers 1 der Brennweite f der Linse, d. h., die von der Maßverkörperung 15 beabstandete und der Linse 2 zugewandte Oberfläche 12 der Maßverkörperung 1 liegt in der Brennebene B der Linse. Hierbei wird die Tatsache ausgenutzt, dass für reelle Abbildungen die Gegenstandsbzw. Objektweite g einer Linse bzw. Linsenanordnung stets größer ist als deren Brennweite f. Durch diese Anordnung wird erreicht, dass eventuell auf jener zweiten Oberfläche 12 des Teilungsträgers 1 befindliche Störpartikel, wie z. B. Schmutz, oder sonstige Störstellen, wie z. B. Kratzer, das in der Ebene der strahlungsempfindlichen Fläche 35 entstehende Bild der Maßverkörperung 15 nicht lokal beeinflussen, sondern eine in der gesamten Ebene gleichmäßige Beeinflussung der Helligkeit und des Kontrastes des bei der optischen Abtastung der Maßverkörperung 15 entstehenden Bildes bewirken. Mit anderen Worten ausgedrückt, sind die Effekte möglicher auf der zweiten Oberfläche 12 des Teilungsträgers 1 befindlicher Störpartikel oder Störstellen in der Ebene der strahlungsempfindlichen Fläche 35 des Detektors 3 über die gesamte Ebene gleichmäßig verschmiert. Hierdurch werden die Positionsmesswerte, die durch Auswertung der an der strahlungsempfindlichen Fläche 35 des Detektors 3 auftreffenden und im Detektor 3 in elektrische Signale umgewandelten elektromagnetischen Strahlung erzeugt werden, nicht beeinflusst. [0040] Vorliegend ist es allerdings nicht erforderlich, dass die Effekte möglicher auf der zweiten, der Linse 2 zugewandten Oberfläche 12 des Teilungsträgers 1 vorhandener Störungen in der gesamten Ebene delokalisiert sind, in der auch die strahlungsempfindliche Fläche 35 des Detektors 3 liegt. Vielmehr ist es ausreichend, wenn die Effekte von Störpartikeln bzw. Störstellen auf jener Oberfläche 12 auf der strahlungsempfindlichen Fläche 35 des Detektors 3 derart lokalisiert sind, dass sie dort nicht ortsaufgelöst erfasst werden können. Es kommt also darauf an, dass auf der zweiten Oberfläche 12 des Teilungsträgers 1 eventuell vorhandene Störpartikel bzw. Störstellen nicht zu einer ortsabhängigen Veränderung der an der strahlungsempfindlichen Fläche 35 des Detektors 3 erfassten elektromagnetischen Strahlung in Form von Licht führen, sondern allenfalls zu einer auf jener Fläche 35 konstanten, ortsunabhängigen Änderung der Lichtstrahlung. Mit anderen Worten ausgedrückt, muss die Abbildung eventuell auf der zweiten Oberfläche 12 des Teilungsträgers 1 vorhandener Störpartikel oder Störstellen nicht in einer unendlich ausgedehnten Ebene derart delokalisiert sein, dass sie im Wesentlichen ortsunabhängig ist, sondern es genügt, wenn eine entsprechende Verschmierung auf der begrenzten strahlungsempfindlichen Fläche 35 des Detektors 3 erfolgt, so dass dort keine lokal unterschiedliche Änderung der erfassten Lichtstrahlung bewirkt wird. [0041] Daher ist es auch nicht erforderlich, dass die der Linse 2 zugewandte zweite Oberfläche 12 des Teilungsträgers 1 exakt in der Brennebene B der Linse 2 liegt, also exakt um deren Brennweite f von der Linse 2 beabstandet ist. Vielmehr genügt es, wenn jene zweite Oberfläche 12 des Teilungsträgers 1 in einem die Brenn- bzw. Fourier-Ebene B der Linse 2 umfassenden Fourier-Bereich F jener Linse 2 liegt. Dieser Fourier-Bereich F ist so zu wählen, dass bei Anordnung der zweiten Oberfläche 12 des Teilungsträgers 1 in jenem Fourier-Bereich F gewährleistet ist, dass auf jener Oberfläche vorhandene Störpartikel bzw. Störstellen bei Abbildung auf die strahlungsempfindliche Fläche 35 des Detektors 3 dort vollständig delokalisiert sind, also keine ortsabhängige Änderung der erfassten Lichtstrahlung bewirken. Hierzu können die beidseits der Brenn- bzw. Fourier-Ebene vorgesehenen und parallel zu dieser verlaufenden Grenzen F1, F2 des Fourier-Bereiches F beispielsweise jeweils um das 0,2-fache der Brennweite f der Linse 2, insbesondere um das 0,1-fache der Brennweite f der Linse 2, von der Brennebene B entfernt sein. Die gesamte Breite des Fourier-Bereiches F, al- 6/15 DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 so dessen Ausdehnung senkrecht zur Brenn- bzw. Fourier-Ebene B betrüge dann das 0,4-fache bzw. 0, 2-fache der Brennweite f der Linse 2. [0042] Die in Fig. 1 dargestellte Positionsmesseinrichtung zeichnet sich also dadurch aus, dass die mit der Maßverkörperung 15 versehene erste Oberfläche 11 des Teilungsträgers 1, die der Linse 2 abgewandt ist und von dieser um die Gegenstands- bzw. Objektweite g entfernt ist, durch das Aufliegen auf einer zugeordneten Unterlage U gegen Verschmutzung geschützt ist. Die zweite, der Linse 2 zugewandte Oberfläche 12 des Trägers 1 liegt demgegenüber derart in der Brenn- bzw. Fourier-Ebene B der Linse 2 oder innerhalb von deren näherer Umgebung im so genannten Fourier-Bereich F, dass an der zweiten Oberfläche 12 auftretende Störpartikel oder Störstellen eine Positionsmessung nicht beeinträchtigen. Die Anordnung insgesamt zeichnet sich somit durch eine besondere Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzung aus. [0043] Weiterhin ist vorteilhaft, dass aufgrund der Anordnung der Maßverkörperung 15 auf der der Linse 2 abgewandten Oberfläche 11 des Teilungsträgers 1 ein besonders flacher Aufbau der Positionsmesseinrichtung erreicht werden kann, da hiermit eine Minimierung des Abstandes zwischen Linse 2 und Teilungsträger 1 und somit auch zwischen Detektor 3 und Teilungsträger 1 erreichbar ist. Denn die Gegenstandsweite g der Linse 2 liegt zu einem Teil innerhalb des Teilungsträgers 1. Bei einer Anordnung der Maßverkörperung 15 auf der der Linse 2 zugewandten zweiten Oberfläche 12 des Teilungsträgers 1 müsste demgegenüber die Linse 2 um die Gegenstandsweite g von dem Teilungsträger 1 bzw. dessen zweiter Oberfläche 12 beabstandet sein, so dass das System eine entsprechend (um die Dicke des Teilungsträgers 1) größere Ausdehnung in dieser Richtung aufwiese. Die vorliegende Anordnung eignet sich daher insbesondere auch zur Kombination mit dem aus der DE 103 17 736 A1 bekannten Aufbau einer Linsenanordnung für eine Positionsmesseinrichtung, wodurch sich die Reduzierung der Bauhöhe der Positionsmesseinrichtung optimieren lässt. [0044] Ein weiterer Vorteil der in Fig. 1 dargestellten Anordnung ergibt sich bei linearen Messgeräten, bei denen die die Linsenanordnung 2 und den Detektor 3 umfassende Abtasteinheit über Kugellager an einem durch den Teilungsträger 1 und die Maßverkörperung 15 gebildeten Maßstab geführt wird. Dadurch, dass vorliegend die Maßverkörperung 15 auf der der Abtasteinheit abgewandten Seite des Teilungsträgers 1 angeordnet ist, entfällt hier die Notwendigkeit, die die Maßverkörperung 15 bildende Beschichtung im Laufflächenbereich der Kugellager zu entfernen, so dass die Herstellbarkeit des Maßstabs deutlich vereinfacht wird. [0045] Fig. 2a zeigt eine Weiterbildung des in Fig. 1 schematisch dargestellten Ausführungsbeispiels eines Teiles einer Positionsmesseinrichtung, bei dem zwischen dem Teilungsträger 1 und der (ggf. eine größere Linsenanordnung repräsentierenden) Linse 2 eine weitere Komponente 4 der Positionsmesseinrichtung, z. B. in Form einer Abtast- oder Abdeckplatte, angeordnet ist, die aus einem für die zur Abtastung verwendete Strahlung transparentem Material besteht. Diese weist eine erste, dem Teilungsträger 1 zugewandte Oberfläche 41 und eine zweite der Linse 2 zugewandte Oberfläche 42 auf. Die zusammen mit der Linse 2 und dem Detektor 3 der Abtasteinheit zugehörige und gemeinsam mit dieser bewegbare Abdeck- oder Abtastplatte ist vorliegend mit ihrer ersten Oberfläche 41 so dicht bei dem Teilungsträger 1 angeordnet, dass zwischen der ersten Oberfläche 41 jener Platte 4 und der dieser zugewandten zweiten Oberfläche 12 des Teilungsträgers 1 lediglich ein extrem feiner Spalt, von z. B. 30 µm, besteht. Hiermit sollen eventuelle Feuchtigkeitströpfchen zwischen jenen beiden Oberflächen 12, 41 zu einem Flüssigkeitsfilm ausgebildet werden, um zu verhindern, dass dort einzelne Flüssigkeitströpfchen mit störender Linsenwirkung verbleiben. Der besagte Spalt ist viel kleiner als der Fourier-Bereich F der Linse 2, so dass beide Oberflächen 12, 41 unmittelbar benachbart zu der Brenn- bzw. Fourier-Ebene B der Linse 2 angeordnet sein können. (Da die Brennweiten in Positionsmesseinrichtungen verwendeter Linsen typischerweise mehr als 300 µm betragen, ist es bei einem Abstand der beiden besagten Oberflächen 12, 41 von 30 µm nämlich problemlos möglich, beide Oberflächen in den Fourier-Bereich der Linse 2 zu legen, dessen Dicke beispielsweise beim 0,2-fachen der Brennweite f der Linse 2 liegt.) Hiermit lässt sich erreichen, dass sowohl auf der zweiten Oberfläche 12 des Teilungsträgers 1 als auch auf der ersten Oberfläche 41 der daneben angeordneten Platte 4 eventuell vorhandene Störpartikel oder Störstellen nicht zu einer ortsabhängigen Beeinflussung der an der strahlungsempfindlichen Fläche 35 des Detektors 3 auftreffenden, zur Abtastung verwendeten elektromagnetischen Strahlung führen, die eine Beeinträchtigung der Positionsmessung zur Folge haben könnte. [0046] In solchen Fällen, in denen, wie in den Fig. 2b und Fig. 2c dargestellt, der Abstand zwischen der Abtast- oder Abdeckplatte 4 und dem Teilungsträger 1 größer ist als der Fourier-Bereich F der Linse 2, also beispielsweise, wenn jener Abstand in der Größenordnung von 1 mm liegt, dann kann nur entweder eine Oberfläche der Abtast- bzw. Abdeckplatte 4 oder eine Oberfläche des Teilungsträgers 1 in die unmittelbare Umgebung der Brennebenen B der Linse 2, nämlich in deren Fourier-Bereich F, gelegt werden. [0047] In dem in Fig. 2b gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Anordnung derart, dass, wie im Fall der 7/15 DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 Fig. 1, die der Linse 2 zugeordnete zweite Oberfläche 12 des Teilungsträgers 1 im Fourier-Bereich F der Linse 2 und speziell in deren Brennebene B liegt. [0048] In dem in Fig. 2c gezeigten Ausführungsbeispiel liegt demgegenüber ausschließlich die der Linse abgewandte erste Oberfläche 41 der Abtast- oder Abdeckplatte 4 im Fourier-Bereich F der Linse 2 bzw. auf deren Brennebene B. Die Anordnung der der Linse 2 abgewandten ersten Oberfläche 41 im FourierBereich F ist deshalb vorteilhaft, weil hierdurch eine Reduzierung der Bauhöhe der Positionsmesseinrichtung erreicht wird, verglichen mit dem Fall, in dem die der Linsenanordnung zugewandte zweite Oberfläche 42 jener Platte 4 in die Brennebene B gelegt wird. [0049] Das in Fig. 2c dargestellte Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von den übrigen, bisher beschriebenen Ausführungsbeispielen weiterhin dadurch, dass hier kein aus einem transparenten Material bestehender Teilungsträger T zur Aufnahme der Maßverkörperung 15 vorgesehen ist, sondern dass die Maßverkörperung 15 vielmehr auf einem flachen Metallband 1’ ausgebildet ist. [0050] In Fig. 3 ist schließlich noch ausdrücklich schematisch der Fall dargestellt, dass die zwischen der abzutastenden Maßverkörperung 15 und der strahlungsempfindlichen Fläche 35 des Detektors liegende Linsenanordnung 2, 2’ durch zwei entlang des Strahlenganges S der zur Abtastung verwendeten elektromagnetischen Strahlung hintereinander angeordnete Linsen 2 und 2’ gebildet wird. Die beiden Linsen 2, 2’ können dabei, wie in Fig. 4 mit gestrichelten Linien angedeutet, Bestandteil jeweils einer Linsengruppe 200 bzw. 200’ in Form eines ebenen Linsenarrays sein, die in jeweils einer von zwei entlang des Strahlenganges S der zur Abtastung verwendeten elektromagnetischen Strahlung bzw. entlang der optischen Achse der Linsenanordnung 2, 2’ hintereinander angeordneten Ebenen liegen. Für weitere Einzelheiten hierzu wird auf die DE 103 17 736 A1 verwiesen, in der eine solche Anordnung beschrieben ist. [0051] Nachfolgend wird die in Fig. 3 dargestellte Linsenanordnung beispielhaft anhand zweier im Strahlengang S hintereinander angeordneter Linsen 2, 2’ beschrieben. Diese beiden Linsen bilden im Fall zweier hintereinander angeordneter Linsenarrays eine Zelle der Linsenanordnung. Das nachfolgend anhand dieser beiden Linsen 2, 2’ Beschriebene gilt dann in entsprechender Weise für alle anderen Zellen der Linsenanordnung, die aus jeweils zwei entlang des Strahlenganges S bzw. der optischen Achse der Linsenanordnung hintereinander angeordneten Linsen bestehen. [0052] Jede der Zellen der Linsenanordnung umfasst eine erste, der Maßverkörperung 15 zugewand- te Linse 2 zur Erzeugung einer Teilabbildung mit einem Abbildungsmaßstab m1 < 1, der im Ausführungsbeispiel etwa 0.25 beträgt. Diese erste Linse 2 ist dabei in einem Abstand von der Maßverkörperung 15 angeordnet, der der Gegenstandsweite g1 = (1 + 1/m1)·f1 der ersten Linse 2 entspricht, wobei f1 die Brennweite der ersten Linse 2 angibt. Hierdurch wird auf der der Maßverkörperung 15 abgewandten Seite der ersten Linse 2 ein Zwischenbild Z erzeugt, das um das 1/m1-fache kleiner ist als der abgebildete Teil der Maßverkörperung 15. Das Zwischenbild Z ist von der der Maßverkörperung 15 gegenüberliegenden Linse 2 um deren Bildweite b1 = (1 + m1)·f1 entfernt. [0053] Die zweite Linse 2’ einer jeweiligen Zelle der Linsenanordnung ist wiederum derart bezüglich der ersten Linse 2 angeordnet, dass das von der ersten Linse 2 erzeugte Zwischenbild Z in der Gegenstandsebene der zweiten Linse 2’ liegt, also um deren Gegenstandsweite g2 = (1 + 1/m2)·f2 entfernt ist, wobei m2 den Abbildungsmaßstab der zweiten Linse 2’ bezeichnet und f2 deren Brennweite. [0054] Der Abbildungsmaßstab m2 der zweiten Linse 2’ ist größer als 1 und beträgt im Ausführungsbeispiel in etwa 4. So ergibt sich ein Gesamtabbildungsmaßstab m = m1·m2 der von den beiden Linsen 2, 2’ erzeugten Abbildung in der Größenordnung von 1. Das heißt, das von den beiden Linsen 2, 2’ erzeugte Abbild eines Ausschnittes der Maßverkörperung 15 weist auf der strahlungsempfindlichen Fläche 35 des Detektors 3 die gleiche Größe auf wie auf der Maßverkörperung 15 selbst. [0055] Da der Abbildungsmaßstab m1 der ersten Linse 2 kleiner als 1 ist, ergibt sich, dass die Gegenstandsweite g1 = (1 + 1/m2)·f1 der ersten Linse 2 in jedem Fall mehr als doppelt so groß ist als deren Brennweite f1. Hierdurch ist deren Gegenstandsweite g1 hinreichend groß verglichen mit der Brennweite f1, so dass genügend Raum zur Verfügung steht, um einerseits die Maßverkörperung 15 in der Gegenstandsebene der ersten Linse 2 anzuordnen und andererseits eine weitere Oberfläche einer Komponente der Positionsmesseinrichtung in der Brennebene B’ der ersten Linse 2 bzw. in deren die Brennebene B’ umgebenden Fourier-Bereich F’ anzuordnen. Befinden sich auf einer in der Brennebene B’ der ersten Linse 2 bzw. in deren Fourier-Bereich F’ liegender Oberfläche Störpartikel oder Störstellen, so werden diese nicht über die zweite Linse 2’ in lokalisierter Form auf die strahlungsempfindliche Fläche 35 des Detektors 3 abgebildet, sondern sind auf dieser Fläche 35 strukturlos delokalisiert. [0056] Alternativ zu einer Anordnung einer Oberfläche in der Brennebene B’ der ersten Linse 2 bzw. deren Fourier-Bereich F’ kann auch eine Betrachtung bezogen auf die gesamte Linsenanordnung 2, 2’ durchgeführt werden, wobei hier wiederum spe- 8/15 DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 ziell auf einer Zelle der Linsenanordnung mit zwei im Strahlengang S hintereinander angeordneten Linsen 2 und 2’ Bezug genommen wird. Die Linsenanordnung bzw. deren zu betrachtende Zelle wird also nachfolgend repräsentiert durch ein einheitliches Objektiv bzw. eine Ersatzlinse. Für die maßverkörperungsseitige Brennweite f eines solchen Objektivs bzw. einer solchen Ersatzlinse gilt f = f1 + m2·f12/ (m1·m2·f1 + f2), und zwar von der ersten Linse 2 her [0057] gemessen. In dem Fall, dass f1 ungefähr gleich f2 ist, gilt näherungsweise f = (1 + m2/2)·f1 = 3·f1. Dies ist deutlich weniger als die Gegenstandsweite g1 der ersten Linse, welche vorliegend 5·f1 beträgt. So ist es also auch möglich, zusätzlich zu der Anordnung der Maßverkörperung 15 in der Gegenstandsebene der ersten Linse 2 eine weitere Oberfläche einer Komponente der Positionsmesseinrichtung in der Brennebene B des durch die gesamte Linsenanordnung 2, 2’ repräsentierten Objektivs (Ersatzlinse) anzuordnen. Auch hier muss die Anordnung nicht zwingend in der Brennebene B des Objektives bzw. der Ersatzlinse selbst erfolgen, sondern die entsprechende Oberfläche kann auch innerhalb des die Brennebene B umgebenden Fourier-Bereiches F vorgesehen sein. Lässt man etwa einen Fourier-Bereich F zu, dessen Grenzen F1, F2 beidseits der Brennebene jeweils um 10% der relevanten Brennweite f von der Brennebene B beabstandet sind, so beträgt dies bezogen auf die Brennweite f1 der ersten Linse 2 0.3·f1. [0058] Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird diesbezüglich auf die Fig. 1 und Fig. 2a bis Fig. 2c verwiesen, in denen die jeweils dargestellte Linse 2 wahlweise auch als eine Ersatzlinse bzw. ein Objektiv angesehen werden kann, das eine Mehrzahl im Strahlengang S hintereinander angeordneter Linsen repräsentiert. [0059] Besteht die Linsenanordnung aus einer Mehrzahl im Strahlengang hintereinander angeordneter Linsen 2, 2’, wie in Fig. 3 dargestellt, so kann also eine Oberfläche, deren Störstellen bzw. Störpartikel nicht ortsaufgelöst auf die strahlungsempfindliche Fläche 35 des zugehörigen Detektors der Positionsmesseinrichtung abgebildet werden sollen, einerseits in der Brennebene B’ der ersten, der Maßverkörperung 15 zugewandten Linse 2 der Linsenanordnung 2, 2’ angeordnet werden oder alternativ in der Brennebene B einer die gesamte Linsenanordnung repräsentierenden Ersatzlinse – bzw. in dem jeweils zugehörigen Fourier-Bereich F oder F’. [0060] Somit eröffnet sich schließlich auch die Möglichkeit, sowohl in der einen Brennebene B als auch in der anderen Brennebene B’ oder dem jeweils zugehörigen Fourier-Bereich gleichzeitig jeweils eine Oberfläche einer Komponente der Positionsmesseinrichtung anzuordnen, beispielsweise in der Brennebene B der Ersatzlinse die der Maßverkörperung 15 abgewandte Oberfläche eines Trägers der Maßverkörperung und in der Brennebene B’ der ersten Linse 2 der Linsenanordnung eine Oberfläche einer weiteren Komponente der Positionsmesseinrichtung, wie z. B. einer Abdeck- oder Abtastplatte. Patentansprüche 1. Positionsmesseinrichtung mit – einer Maßverkörperung (15), – einer Abtasteinheit zum Abtasten der Maßverkörperung (15) mittels elektromagnetischer Strahlung zur Ermittlung von Positionsinformationen, – einer Linsenanordnung (2; 2, 2‘) der Abtasteinheit, die im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung zwischen der Maßverkörperung (15) und einer strahlungsempfindlichen Fläche (35) eines Detektors (3) der Abtasteinheit liegt, und – einer von der Maßverkörperung (15) beabstandeten Oberfläche (12) einer Komponente (1) der Positionsmesseinrichtung, die im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung zwischen der Maßverkörperung (15) und der strahlungsempfindlichen Oberfläche (35) des Detektors (3) liegt, wobei die besagte Komponente (1) der Positionsmesseinrichtung als ein Träger (1) der Maßverkörperung (15) ausgebildet ist, und – einer von der Maßverkörperung (15) beabstandeten Oberfläche (41) einer weiteren Komponente (4) der Positionsmesseinrichtung, die im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung zwischen der Maßverkörperung (15) und der strahlungsempfindlichen Oberfläche (35) des Detektors (3) liegt, wobei die weitere Komponente (4) der Positionsmesseinrichtung durch eine Abdeckung oder eine Abtastplatte der Abtasteinheit gebildet wird, wobei ferner die von der Maßverkörperung (15) beabstandeten Oberflächen (12, 41) der beiden Komponenten (1, 4) der Positionsmesseinrichtung jeweils derart in einer Umgebung (F) der Brennebene (B) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) liegen, dass das bei Abtastung der Maßverkörperung (15) mittels der Abtasteinheit erzeugte Abbild eventueller auf jenen Oberflächen (12, 41) befindlicher Störstellen oder Störpartikel über die gesamte strahlungsempfindliche Fläche (35) des Detektors (3) delokalisiert ist, indem die am Träger (1) der Maßverkörperung (15) ausgebildete, von der Maßverkörperung (15) beabstandete Oberfläche (12) und die an der Abdeckung oder Abtastplatte der Abtasteinheit ausgebildete, von der Maßverkörperung (15) beabstandete und dem Träger (1) zugewandte Oberfläche (41) derart durch einen Spalt voneinander getrennt sind, dass beide Oberflächen (12, 41) in der besagten Umgebung der Brennebene (B) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) angeordnet sind. 2. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die von der Maßverkörperung (15) beabstandete Oberfläche (12, 41) der jeweiligen Komponente (1, 4) der Positionsmessein- 9/15 DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 richtung höchstens um das 0,2-fache der Brennweite (f) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) von der Brennebene (B) der Linsenanordnung beabstandet ist. 3. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die von der Maßverkörperung (15) beabstandete Oberfläche (12, 41) der jeweiligen Komponente (1, 4) der Positionsmesseinrichtung höchstens um das 0,1-fache der Brennweite (f) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) von der Brennebene (B) der Linsenanordnung beabstandet ist. 4. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die von der Maßverkörperung (15) beabstandete Oberfläche (12, 41) der jeweiligen Komponente (1, 4) der Positionsmesseinrichtung in der Brennebene (B) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) liegt. Positionsmesseinrichtung mit – einer Maßverkörperung (15), – einer Abtasteinheit (zum Abtasten der Maßverkörperung (15) mittels elektromagnetischer Strahlung zur Ermittlung von Positionsinformationen, – einer Linsenanordnung (2; 2, 2‘) der Abtasteinheit, die im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung zwischen der Maßverkörperung (15) und einer strahlungsempfindlichen Fläche (35) eines Detektors (3) der Abtasteinheit liegt und die eine der Maßverkörperung (15) zugewandte erste Linse (2) umfasst, – einer von der Maßverkörperung (15) beabstandeten Oberfläche (12) einer Komponente (1) der Positionsmesseinrichtung, die im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung zwischen der Maßverkörperung (15) und der strahlungsempfindlichen Oberfläche (35) des Detektors (3) liegt, wobei die besagte Komponente (1) der Positionsmesseinrichtung als ein Träger (1) der Maßverkörperung (15) ausgebildet ist, und – einer von der Maßverkörperung (15) beabstandeten Oberfläche (41) einer weiteren Komponente (4) der Positionsmesseinrichtung, die im Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung zwischen der Maßverkörperung (15) und der strahlungsempfindlichen Oberfläche (35) des Detektors (3) liegt, wobei die weitere Komponente (4) der Positionsmesseinrichtung durch eine Abdeckung oder eine Abtastplatte der Abtasteinheit gebildet wird, wobei ferner die von der Maßverkörperung (15) beabstandeten Oberflächen (12, 41) der beiden Komponenten (1, 4) der Positionsmesseinrichtung jeweils derart in einer Umgebung (F’) der Brennebene (B’) der ersten Linse (2) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) liegen, dass das bei Abtastung der Maßverkörperung (15) mittels der Abtasteinheit (2, 3) erzeugte Abbild eventueller auf jenen Oberflächen (12, 41) befindlicher Störstellen oder Störpartikel über die gesamte strahlungsempfindliche Fläche (35) des Detektors (3) delokalisiert ist, indem die am Träger (1) der Maßverkörperung (15) ausgebildete, von der Maßverkörperung (15) beabstandete Oberfläche (12) und die an der Abdeckung oder Abtastplatte der Abtasteinheit ausgebildete, von der Maßverkörperung (15) beabstandete und dem Träger (1) zugewandte Oberfläche (41) derart durch einen Spalt voneinander getrennt sind, dass beide Oberflächen (12, 41) in der besagten Umgebung der Brennebene (B’) der ersten Linse (2) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) angeordnet sind. 5. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die von der Maßverkörperung (15) beabstandete Oberfläche (12, 41) der jeweiligen Komponente (1, 4) der Positionsmesseinrichtung höchstens um das 0,2-fache der Brennweite (f’) der ersten Linse (2) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) von der Brennebene (B’) der ersten Linse (2) der Linsenanordnung beabstandet ist. 6. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die von der Maßverkörperung (15) beabstandete Oberfläche (12, 41) der jeweiligen Komponente (1, 4) der Positionsmesseinrichtung höchstens um das 0,1-fache der Brennweite (f’) der ersten Linse (2) Linsenanordnung (2; 2, 2’) von der Brennebene (B’) der ersten Linse (2) der Linsenanordnung beabstandet ist. 7. Positionsmesseinrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die von der Maßverkörperung (15) beabstandete Oberfläche (12, 41) der jeweiligen Komponente (1, 4) der Positionsmesseinrichtung in der Brennebene (B’) der ersten Linse (2) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) liegt. 8. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige eine von der Maßverkörperung (15) beabstandete Oberfläche (12, 41) bildende Komponente (1, 4) für die zur Abtastung der Maßverkörperung (15) verwendete elektromagnetische Strahlung transparent ist. 9. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die von der Maßverkörperung (15) beabstandete Oberfläche (12) des Trägers (1) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) zugewandt ist. 10. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine mit der Maßverkörperung (15) versehene Oberfläche (11) eines Trägers (1) der Maßverkörperung (15) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) abgewandt ist. 11. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger (1) mit seiner mit der Maßverkörperung (15) versehenen Oberfläche (11) auf einer Unterlage (U) liegt. 10/15 DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 12. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die von der Maßverkörperung (15) beabstandete Oberfläche (41) einer Komponente (4) der Positionsmesseinrichtung durch eine der Linsenanordnung (2; 2, 2’) abgewandte Oberfläche (41) der Abdeckung oder Abtastplatte der Abtasteinheit gebildet wird. 13. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Maßverkörperung (15) derart ausgebildet ist, dass sie die zur Abtastung verwendete elektromagnetische Strahlung reflektiert und dass der Detektor (3) angeordnet ist zur Erfassung der von der Maßverkörperung (15) reflektierten elektromagnetischen Strahlung. 14. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Linsenanordnung (2) genau eine Linse oder eine Mehrzahl in einer Ebene nebeneinander angeordnete Linsen umfasst. 15. Positionsmesseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Linsenanordnung (2; 2, 2’) eine Mehrzahl entlang des Strahlenganges (S) der zur Abtastung verwendeten elektromagnetischen Strahlung hintereinander angeordneter Linsen umfasst. 16. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Linsenanordnung (2, 2’) eine erste, der Maßverkörperung (15) zugewandte Linse (2) umfasst, die einen Abbildungsmaßstab (m1) kleiner als eins aufweist, und dass die Linsenanordnung (2, 2’) eine zweite, im Strahlengang (S) der zur Abtastung verwendeten elektromagnetischen Strahlung hinter der ersten Linse (2) angeordnete Linse (2’) umfasst, die einen Abbildungsmaßstab (m2) größer als eins aufweist. 17. Positionsmesseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Maßverkörperung (15) in der Gegenstandsebene der ersten, der Maßverkörperung (15) zugewandten Linse (2) der Linsenanordnung (2; 2, 2’) liegt. Es folgen 4 Seiten Zeichnungen 11/15 DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 Anhängende Zeichnungen 12/15 DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 13/15 DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 14/15 DE 10 2005 013 222 B4 2015.12.31 15/15