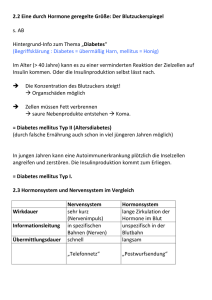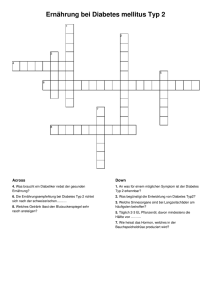Diabetes.Lebens.Wert - Lebens.Resort Ottenschlag
Werbung

Diabetes.Lebens.Wert: Diabetes und Psyche Freitag, 22. September 2017 Tagungsort Lebens.Resort Ottenschlag Xundheitsstraße 1, 3631 Ottenschlag www.lebensresort.at Vorsitz DGKP Jürgen Friedl, MSc Vorträge/Workshops a.o. Prof. Dr. Barbara Mangweth-Matzek Prim. Doz. Dr. Harald Stingl Prim. Dr. Heidemarie Abrahamian Mag. Caroline Culen Dr. Christian-Armin Rosenberg DGKP Gabriele Schrammel www.facebook.com/lebensresort Diabetes und Essstörungen a. o. Prof. Dr. Barbara Mangweth-Matzek Psychologin, Psychotherapeutin, Wissenschafterin Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin, Psychiatrie II, Medizinische Universität Innsbruck Im Vortrag werden erstens die wesentlichsten diagnostischen und epidemiologischen Fakten zu Essstörungen (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Binge Eating Störung und Essstörung nicht näher bezeichnet) dargestellt. Da von einem Basiswissen über Diabetes 1 und 2 ausgegangen wird, handelt der zweite Schwerpunkt von der Komorbidität von Essstörungen und Diabetes auf unterschiedlichsten Ebenen (physiologisch-somatische, physiologisch-verhaltensorientierte, und psychosoziale). Ziel ist es, die Zuhörer zu schulen, wie sie Patienten mit Diabetes und einer Essstörung erkennen können (da die Essstörung ja meist geheim gehalten wird), wie der kommunikative Umgang sich gestalten soll und wie Hilfe möglich sein kann. 1 Diabetes und Demenz – mehr als doppelte Belastung Prim. Doz. Dr. Harald Stingl Vorstand der Abteilung Innere Medizin im Landesklinikum Melk Durch die gestiegene Lebenserwartung findet sich heute unabhängig von Co-Morbiditäten eine deutliche Zunahme dementieller Syndrome. Im Jahr 2000 litten in Österreich etwa 100.000 Personen an einer Demenz, in Hochrechnungen wird für 2050 mit ca. 260.000 Demenzkranken gerechnet. Dabei stellt die Alzheimer-Erkrankung die häufigste Demenzform dar (60–70 %), gefolgt von der vaskulären Demenz (15–25 %). Aufgrund von Überernährung und Bewegungsmangel ist gleichzeitig die Zahl der Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 stark im Steigen begriffen. Neben Diabetes finden sich auch andere Risikofaktoren für die Entwicklung einer (vaskulären) Demenz, wie Hypertonie, Adipositas, Hypercholesterinämie und Nikotinabusus. In Beobachtungsstudien haben Diabetiker innerhalb von (2-)8 Jahren ein ca. doppelt so hohes Risiko für eine Abnahme kognitiver Fähigkeiten, und auch das Ausmaß der jährlichen Verschlechterung ist bei Diabetikern deutlich höher (Lancet Neurol 2006). Als Ursache dafür gelten neben der verminderten Durchblutung (Mikroangiopathie) auch die Hyperinsulinämie, die unter anderem die Amyloid-Ablagerungen im Gehirn beeinflusst. Dies ist eine mögliche Erklärung dafür, dass bei Diabetes mellitus nicht nur die vaskuläre Demenz, sondern auch die Alzheimer-Demenz – bei der Amyloidablagerungen eine wesentliche Rolle spielen – deutlich häufiger ist. Auch häufige und vor allem protrahierte Hypoglykämien können zum geistigen Abbau beitragen. Lang andauernde Hypoglykämien können zudem zu irreversiblen Hirnschäden führen, wobei vor allem die Regionen des Sprachzentrums und des Gedächtnisses betroffen sind. Eine konsequente Optimierung aller Risikofaktoren und eine möglichst hypoglykämiefreie Diabetestherapie können helfen, die Entwicklung einer Demenz zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. Gleichzeitig stellen Diabetiker, bei denen bereits eine Demenz vorliegt, eine enorme Herausforderung für das Gesundheitswesen dar, da die kognitiven Fähigkeiten, eine teils komplexe Therapie (z.B. Insulintherapie, Kombinationstherapien) einzuhalten, teils nicht mehr gegeben sind. So führen häufig Fehleinnahmen von Medikamenten oder versehentlich zu hohe Insulindosierungen zu Spitalsaufenthalten wegen protrahierten Hypoglykämien. Andererseits treten immer wieder hyperglykämische Entgleisungen auf, wenn die Einnahme der Therapie vergessen wird. Die Betreuung demenzkranker Diabetiker erfordert daher eine enge Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen unter Einbindung der Angehörigen, um einen möglichst komplikationsfreien Verlauf der Erkrankungen zu erreichen. 2 Psychosozialer Stress und Diabetes mellitus Stressresilienz als protektiver Faktor Prim. Dr. Heidemarie Abrahamian Leitung des Internistischen Zentrums im Otto Wagner Spital, Gastprofessorin der Medizinischen Universität Wien Übergewicht und Adipositas sind seit langem bekannte Risikofaktoren für das Entstehen von Insulinresistenz und Diabetes mellitus Typ 2. Die Einwirkung von psychosozialem Stress begünstigt in vielen Fällen, insbesondere bei reduzierter Stressresilienz die Entwicklung von Übergewicht, Adipositas und Insulinresistenz und könnte somit die Inzidenz und den Verlauf von Diabetes mellitus ungünstig beeinflussen. Die Erforschung der kausalen Zusammenhänge der komplexen Interaktionen zwischen Stress und Adipositas bzw Stress und Diabetes mellitus Typ 2 steht im Fokus vieler Studien. Mehrere biologische Mechanismen sind für diese Zusammenhänge essentiell. In einem Maus-Modell wurde die Wirkung von chronischem psychosozialen Stress, verursacht durch Unterdrückung einer Maus durch eine andere dominante Maus, sehr genau untersucht. Die daraus resultierenden bekannten Auswirkungen auf den Stoffwechsel umfassten neben der Aktivierung des sympathischen Nervensystems und Veränderungen im Immunsystem auch die Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse mit der Folge erhöhter Cortisolspiegel. Die Auswirkungen eines Hypercortizolismus auf den Stoffwechsel wie verringerte Insulinsensitivität mit erforderlicher Steigerung der Insulinsekretion und somit einer diabetogenen Wirkung sind hinreichend bekannt. Darüber hinaus kommt es durch Stresswirkung zu einer vermehrten Freisetzung von Ghrelin mit Steigerung des Appetits vor allem auf Kohlenhydrate und konsekutiv zu einer Vermehrung der Fettspeicher. Dadurch wird eine Insulinresistenz mit erhöhten Insulinspiegeln induziert. Emotionale Spannungszustände wie sie bei Einwirkungen von psychosozialen Stress bestehen, führen in vielen Fällen zu Nahrungszufuhr insbesondere von zuckerhältigen Nahrungsmitteln. Dieses „emotional eating“ ist bei vielen Menschen ein bewährtes Mittel zur Spannungsabfuhr. Der Mechanismus: emotionale Anspannung - Nahrungszufuhr - Spannungsabfuhr kann mit der Zeit zu einem fixen Verhaltensmuster werden, welches sich der bewussten Kontrolle entzieht. Damit ist eine stetige Gewichtszunahme mit entsprechenden Risiken vorprogrammiert. Mehrere rezente und auch bereits ältere Studien beschäftigen sich mit den Auswirkungen von psychosozialen Stress auf die Inzidenz von Diabetes mellitus Typ 2 beim Menschen. Sehr eindrucksvoll zeigt eine schwedische Studie an 1.5 Millionen jungen Männern über einen Zeitraum von 25.7 Jahren den Zusammenhang zwischen Stressresilienz, also Verfügbarkeit von wirksamen Stressabwehrmechanismen und Diabetesmanifestation über die Jahre. Männer mit schlechteren Stressabwehrmechanismen bekamen signifikant häufiger Diabetes mellitus als stressresilientere Männer. 3 Aber nicht nur für das neue Auftreten von Diabetes mellitus Typ 2, sondern auch für den Verlauf einer bereits bestehenden Diabeteserkrankung spielt psychosozialer Stress eine wichtige Rolle. Biofeedback unterstützte Entspannungsübungen und Maßnahmen zur Stärkung der Stressresilienz können die Diabeteskontrolle verbessern. 4 Sexualfunktionsstörungen – (k)ein Thema für Patienten mit Diabetes mellitus? Prim. Dr. Heidemarie Abrahamian Leitung des Internistischen Zentrums im Otto Wagner Spital, Gastprofessorin der Medizinischen Universität Wien Neben anderen vielfältigen Gesundheitsstörungen sind auch sexuelle Funktionsstörungen mit Diabetes mellitus assoziiert, wobei sowohl ein allgemein unbefriedigendes Sexualleben als auch direkte sexuelle Probleme mit Störungen in bestimmten Bereichen der Sexualität von den Betroffenen berichtet werden. Die dahinterliegenden pathophysiologischen Mechanismen und Zusammenhänge sind durch den jahrelangen Fokus auf männliche Sexualfunktionsstörungen bei Männern in Studien gut dokumentiert, jedoch bei Frauen als „understudied area of research“ nur partiell untersucht. Deskriptive epidemiologische Daten zeigen, dass 40-45% der erwachsenen Frauen und 2030% der erwachsenen Männer an Störungen zumindest eines Bereiches des Sexualzyklus leiden. Neurobiologische, hormonelle und vaskuläre Störungen sowie psychische „Befindlichkeiten“ und Erkrankungen gelten bei beiden Geschlechtern als Hauptursachen. Adipositas, metabolisches Syndrom und Diabetes mellitus Typ 2 per se scheinen durch die Assoziation mit niedrigen Testosteronspiegeln einen Risikofaktor für Sexualfunktionsstörungen beim männlichen Geschlecht darzustellen. Neben hormonellen Störungen spielen beim diabetischen Patienten endotheliale Dysfunktion und Atherosklerose eine wichtige Rolle, wobei aufgrund des kleineren Gefässdurchmessers die Arterien im pelvinen Bereich früher betroffen sein dürften als zB Koronararterien. Somit könnten Sexualfunktionsstörungen ein früher Marker für Atherosklerose sein. Bei diabetischen Frauen mit Sexualfunktionsstörungen ist häufig die psychische Komponente im Vordergrund, wobei das Körpererleben und Selbstbild eine wichtige Rolle spielen. Auch manche Medikamente können Einfluss auf die Sexualfunktion nehmen, die Auswirkungen von bestimmten Antihypertensiva werden in der Regel überschätzt. Im klinischen Bild manifestieren sich Sexualfunktionsstörungen als vermindertes oder fehlendes sexuelles Interesse und Verlangen, ungenügende sexuelle Erregung, Orgasmusstörungen, schmerzhafter Geschlechtsverkehr und frühzeitige Ejakulation. Für das Screening von Sexualfunktionsstörungen stehen validierte Scores zur Verfügung. Der International Index of Erectile Function-5 (IIEF5), der 15 Fragen enthält und der Female Sexual Function Index (FSFI), der 19 Fragen enthält sind multidimensionale und validierte diagnostische Methoden für das jeweilige Geschlecht. Die Behandlung von Sexualfunktionsstörungen umfasst Lebensstilveränderungen mit vermehrter körperlicher Aktivität, Gewichtskontrolle, gesunder Ernährung und Beendigung von Tabakkonsum. Testosteron Substitution in Fällen eines nachgewiesenen Hypogonadismus und Therapie mit PDE-5 Inhibitoren sind gut dokumentierte Behandlungsoptionen bei Männern. Therapieoptionen für Frauen sind nicht so gut evaluiert, wobei Flibanserin, Testosteron und Bupropion wirksam sein dürften. 5 Für Oxytocin konnte keine signifikante Wirkung nachgewiesen werden. Eine in Mitteleuropa noch weniger bekannte pflanzliche Substanz (DamianaR) wurde in Österreich im Mai dieses Jahres eingeführt und ist derzeit auf dem Prüfstand. In jedem Fall sind Sexualfunktionsstörungen ein Thema für Patienten mit Diabetes mellitus und deren Erfassung und Abklärung sollten genügend Raum in der therapeutischen Beziehung bekommen. 6 Psychosoziale Unterstützung bei Diabetes mellitus Typ 1 – psychologisch und systemisch gedacht von Anfang an Mag. Caroline Culen Gründerin Verein cuko, Klinische und Gesundheitspsychologin, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Wien Abteilung Pulmologie, Allergologie und Endokrinologie Die Diagnose von Diabetes Mellitus Typ 1 wird von betroffenen Kindern bzw. Jugendlichen und deren Familien als einschneidendes Lebensereignis und nicht selten als Schock erlebt: eine chronische Erkrankung, die – wenn auch gut therapierbar – lebenslang tägliche Aufmerksamkeit erfordert. Der Vortrag geht auf die speziellen Herausforderungen bei T1DM ein, beschreibt die Ziele psychologischer Interventionen bei Erstmanifestation und im Krankheitsverlauf, widmet sich den individuellen Tücken und Herausforderungen im Aufwachsen mit T1DM sowie im Hinblick auf das System Familie. In unterschiedlichen Lebensphasen beeinflussen unterschiedliche Themen Diabetestherapie und Lebensbereiche der Patientinnen und Patienten. Erkenntnisse zu Risikofaktoren für ungünstige Stoffwechseleinstellung sowie zu positiven Einflussfaktoren auf Diabetesakzeptanz und Krankheitsmanagement geben Hinweise für professionelle Unterstützungsangebote. Die Empfehlungen der internationalen (ISPAD) und nationalen (APEDÖ) Gesellschaften in Bezug auf die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit T1DM werden vorgestellt und konkrete Beispiele wie psychologische Unterstützungsangebote außerhalb des medizinischen Settings aussehen können werden anhand des Vereins cuko (www.cuko.care) gezeigt. 7 Diabetes und Depression – eine unglückliche Allianz Dr. Christian-Armin Rosenberg Stv. Leiter Stoffwechsel-Rehabilitation, Lebens.Resort Ottenschlag Wir beobachten schon seit längerem in der Klinik eine auffällige Koinzidenz von Diabetes und Depressionen. Dies kann zum einen am psychosozialen Verhalten, zum anderen an der bestehenden Begleitmedikation mit Psychopharmaka festgemacht werden. Von einer Depression nach ICD-10 sprechen wir, wenn mindestens 2 der Hauptsymptome, nämlich depressive Verstimmung, Interessensverlust und Antriebsverlust mit mindestens 2 Zusatzsymptomen wie Verlust des Selbstwertgefühls, Auftreten von Schuldgefühlen bzw. Selbstvorwürfen, Denk- und Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Appetitverlust oder gesteigerter Appetit, psychomotorische Unruhe oder Hemmung, pessimistische Zukunftsperspektive und Suizidgedanken vorliegen. Die Zahl der Symptome bestimmt drei Schweregrade: leicht (2 Haupt- + 2 Zusatzsymptome), mittel (2 H.+ 3-4 Z.) und schwer (3 H. + ≥4 Z.). Weiters wird je nach Verlauf eine monophasische, unipolare einer biphasischen, bipolaren depressiven Störung gegenübergestellt. Beide können einmalig als Episode auftreten oder rezidivierend verlaufen. Diabetes ist mit einigen psychischen Erkrankungen assoziiert, darunter Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie und kognitive Störungen. Die Depressionen nehmen dabei eine zentrale Rolle ein. In einer Untersuchung zeigte sich, dass 18-35% der Typ 1 und 2 Diabetiker unter sogenanntem „diabetes distress“ litten, was einer subklinischen Depression entspricht. In den DAWN-Studien konnten die Belastungsfaktoren für Diabetiker bezüglich Lebensqualität, Selbstmanagement, Krankheitsakzeptanz und im sozialen Umfeld evaluiert werden. Diabetiker erkranken etwa doppelt so häufig an Depressionen wie Nichtdiabetiker. Eine Metaanalyse zeigte die Prävalenz von Depressionen bei Diabetes mellitus bei 17,6 % gegenüber 9,8 % bei Nichtdiabetikern. Das Geschlechterverhältnis Frauen zu Männer ist 23,8 % zu 12,8 %, das heißt es sind fast doppelt so viele Frauen betroffen wie Männer. In der ACCORD-Studie konnte gezeigt werden, dass die Mortalität in Abhängigkeit vom Schweregrad 1,8 bis 2,2-mal höher ist als bei Nichtdepressiven. Umgekehrt konnte in einer weiteren Metaanalyse gezeigt werden, dass bei einer manifesten Depression das Risiko Diabetes mellitus zu entwickeln um 37 % erhöht ist. Arbeitshypothese für die enge Verknüpfung von Diabetes mellitus mit Depressionen ist eine Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse mit Erhöhung der Katecholamin- und Cortisol-Spiegel und Alteration des Immunsystems mit vermehrter Freisetzung der Cytokine Interleukin-6 und TNFα durch den intra- und interpersonellen psychischen Stress mit der Konsequenz einer zunehmenden Insulinresistenz und einer subklinischen Inflammation. Diese wirken auf das Gehirn depressionsfördernd, indem sie die Neurotransmitter-Balance stören. Ein weiterer Faktor dürfte die antidepressive Medikation selbst sein, die, abhängig von der verwendeten Substanz, durch eine größere Gewichtszunahme diabetogen wirken dürfte. 8 Für das Screening auf Depressivität hat sich der Zwei-Fragen-Test bewährt: 1. Gab es in den letzten 4 Wochen eine Zeitspanne, während der Sie sich nahezu täglich niedergeschlagen, traurig und hoffnungslos fühlten? 2. Gab es in den letzten 4 Wochen eine Zeitspanne, während der Sie das Interesse an Tätigkeiten verloren haben, die Ihnen sonst Freude machten? Dieser Test weist eine hohe Sensitivität, jedoch nur eine begrenzte Spezifität auf, sodass bei Zutreffen beider Fragen über mindestens zwei Wochen weitere diagnostische Maßnahmen durch einen Psychologen oder Psychiater ergriffen werden sollten. Die Therapie der Depression sollte auf einem wertschätzenden und empathischen Umgang mit dem Patienten beruhen, um ein stabiles Vertrauensverhältnis zu begründen. Die Initiierung einer Psychotherapie ist immer hilfreich, in leichten Fällen auch alleine ausreichend. Bei mittelgradigen und schweren Formen kann die Therapie medikamentös unterstützt werden. Dabei sollten gewisse Antidepressiva mit stark gewichtsfördernder Wirkung (z. B. Mirtazapin, Mirtel®) und ebensolche Neuroleptika (v. a. Olanzapin, Zyprexa®, Clozapin, Leponex®, Risperidon, Risperdal® und Quetiapin, Seroquel®) nach Möglichkeit vermieden werden. Auch die als „mood stabilizer“ eingesetzten Substanzen Lithium (Quilonorm®), Carbamazepin (Tegretol®, Neurotop®) und Valproinsäure (Depakine®, Convulex®) können das Gewicht steigern und dadurch Diabetes begünstigen oder bei bereits bestehender Erkrankung diese negativ beeinflussen. Sehr wertvolle Ergänzungen zur Psycho- und Pharmakotherapie sind Aromatherapie, Psychoedukation, Bewegungstherapie, Lichttherapie, Vermitteln von Entspannungstechniken, Ermunterung zur Alkohol- und Nikotinkarenz, psychosoziale Beratung und Beratung in sozialversicherungsrechtlichen Belangen, wie sie vor allem in einer Rehabilitationseinrichtung wie dem Lebens.Resort durchgeführt werden können. Dabei ist die gegenseitige positive Verstärkung durch die peer groups und Selbsthilfegruppen und nicht zuletzt durch den Humor wertvoll. Schlussfolgerung: Aufgrund des Näheverhältnisses sollten Diabetiker auf das Vorliegen psychischer Erkrankungen inklusive „diabetic distress“ bei der Erstuntersuchung und dann in jährlichen Abständen untersucht werden. Bei Patienten > 65 Jahren sollte auch ein Screening auf kognitive Störungen wie Demenz jährlich erfolgen. Psychisch Kranke mit antidepressiver und/oder antipsychotischer Medikation sollten 1 – 2 x jährlich auf kardiovaskuläre Risikofaktoren untersucht und dabei folgende Parameter erhoben werden: Gewicht, Bauchumfang, RR, NBZ, Lipide und Prolaktinspiegel (bei entsprechendem NW-Profil). Literatur beim Verfasser Satz- und Druckfehler vorbehalten. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit bezieht sich jede personenbezogene Formulierung ausdrücklich auf Frauen und Männer. 9 Notizen 10