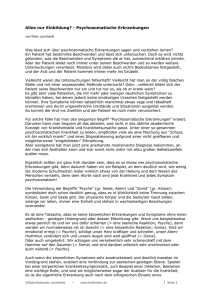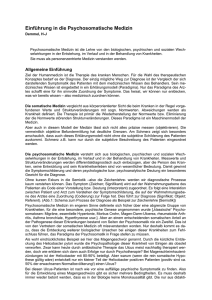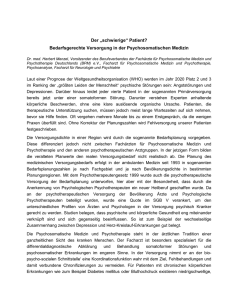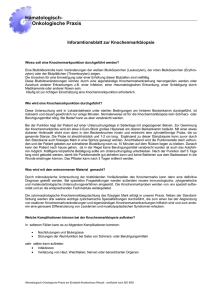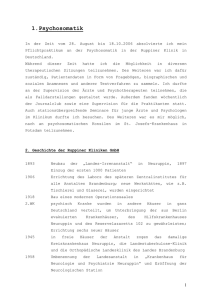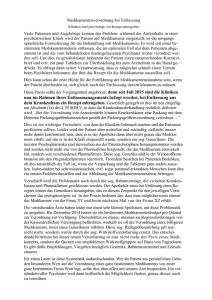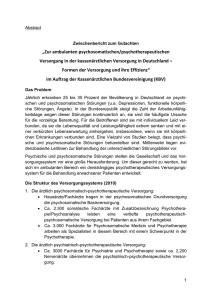Der unmotivierte psychosomatische Patient und der Zeitdruck
Werbung

Aus: Karin Schreiber-Willnow, Guido Hertel (Hrsg.): Rhein-Klinik: Aufsätze aus dem Innenleben. VAS-Verlag Frankfurt 2006. S.38-53 Der unmotivierte psychosomatische Patient und der Zeitdruck1 Eduard Häckl "Ich werde über den Zugang zu dem sogenannten "unmotivierten" psychosomatischen Patienten im engeren Sinne sprechen - und zwar speziell in dem Kontext einer psychosomatisch- psychotherapeutischen Klinik, noch spezieller - im Kontext der RHEINKLINIK! Es geht um die erste Behandlungsphase - der Herstellung einer für diese Patienten hilfreichen therapeutischen Beziehung oder - in einer anderen Theoriesprache - der "Ankoppelung des therapeutischen Systems an das Patientensystem". Den Zeitfaktor werde ich dann am Ende meiner Ausführungen berücksichtigen. Ich definiere hier den psychosomatischen Patienten im engeren Sinne als einen Menschen der auf konflikthaftes Erleben primär somatisch reagiert, der einen Symptom-Leidensdruck und noch keinerlei Zugang zu den psychischen Anteilen seiner Erkrankung hat. ENGEL hat bei diesen Patienten von den "Somato-Psychosomatosen" gesprochen. Sie finden eher selten den Weg in unsere Klinik. Für die Colitis ulcerosa z.B. lässt sich anhand der Praevalenz und Inzidenz errechnen, dass in einer Großstadt wie Köln rein statistisch etwa 400 erkrankte Menschen leben. Das Einzugsgebiet der Rheinklinik ist ja nun bedeutend größer - unsere Statistik zeigt jedoch, dass wir in den letzten Jahren nur ein bis drei dieser Patienten pro Jahr behandelt haben! Eine katamnestische Untersuchung der Essener Psychosomatischen Klinik weist im übrigen ähnliche Verhältnisse auf. Nun könnten diese Zahlen dahingehend interpretiert werden, dass diese Patienten eben im Sinne einer feststehenden Eigenschaft "unmotiviert" und "unergiebig" sind. Ein Blick in die Literatur scheint das zu bestätigen. Es wimmelt da nur so von zum Teil entwertenden Negativ-Katalogen der angeblichen "Eigenschaften" dieser Patienten: Sie seien "emotional starr", "unergiebig", "farblos", "spröde", "ausdrucksgehemmt", "stereotyp", "monoton", "anspruchslos" "vorgeschickt", "vorgeschoben", "ohne echte Ansprüche auf die Verwirklichung persönlicher Bedürfnisse und in ihren unbewussten psychischen Gesprächsmanifestationen uninteressant und langweilig". Die französische Schule der Psychosomatik bescheinigt ihnen unter dem Schlagwort der "pensée operatoire" mangelnde Symbolisierungsfähigkeit, gefühl- und sinnentleertes computerhaftes Denken und Phantasiearmut. Amerikanische Autoren beschreiben ihre "Alexithymie", eine angebliche Unfähigkeit, Gefühle wahrzunehmen und zu zeigen. Dies Negativbild ist allerdings nicht einheitlich: OVERBECK z.B. hat überzeugend dargelegt, dass psychosomatische Störungen auch differenzierte Schöpfungen des Ichs mit einer hochorganisierten Körpersprache sein können. Er weist darauf hin, "dass es aus der Geschichte der psychosomatischen Medizin selbst, mit FREUD angefangen, genügend bekannte Persönlichkeiten gibt, die an zum Teil schweren chronischen psychosomatischen Krankheiten litten und deren besondere Persönlichkeitsmerkmale sicherlich nicht die pensée operatoire oder die Alexithymie waren". 1 Vortrag zur Tagung der Rhein-Klinik 1992 - Psychotherapie unter Zeitdruck - Unter dem Einfluss der Objektbeziehungstheorie und der Systemtheorie verlagerte sich in den letzten Jahren der Blickwinkel von der Beschreibung angeblicher Eigenschaften zu der Erfassung und Beschreibung des Kontextes und der Wechselwirkungen zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten. CREMERIUS z.B. hat geschildert, wie "das Setting, die Interviewtechnik, die Einstellung des Interviewers zum Interviewten und die soziale Stellung des Befragten die von den französischen Autoren beobachteten Phänomene der "pensée operatoire" determinieren". Er hat dazu ein Gespräch zwischen einer Kopfschmerzpatientin und einem Analytiker analysiert, welches in einem Hörsaal vor versammelter Assistenten- und Studentenschar geführt wurde und hat verdeutlicht, dass die Schlussfolgerungen der Autoren diesen Kontext in keiner Weise berücksichtigen. Seine These ist : "Der alexithyme Patient ist ein Artefakt des Umgangs mit ihm: "Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus!" In Anlehnung an diese These möchte ich nun behaupten, dass der Ruf der RHEIN-KLINIK ein vorwiegend psychotherapeutischer ist, ein Ruf, der bei diesen Patienten mit SomatoPsychosomatosen aus guten Gründen ein Echo von mangelnder Motivation und Bereitschaft, sich aus dem Wald hervorzuwagen, erzeugt. Halten wir uns vor Augen: - Die Symptomatik hat auch einen Abwehrcharakter, d.h., die Körpersymptome treten anstelle von unerträglichen Affekten oder bedrohlichen Konflikten auf. - Diese Patienten sind aus intrapsychischen Gründen gezwungen, nach innen und außen ein Bild psychischer Normalität aufrechtzuerhalten. - Psychische Belastungen können schwere, z. T lebensbedrohliche Schübe auslösen. Unser "heimliches Rufen", mit fordernden Selbsterfahrungsangeboten, mit Klein- und Großgruppen, Gestaltungs-, Musik- und Körpertherapien, verbunden mit der impliziten Forderung, die eigene psychische Normalität in Frage zu stellen, ist für diese Patienten ein unheimliches Rufen, das sie eher verschreckt. Der psychosomatische Patient im engeren Sinne zeigt sich diesem Therapieangebot gegenüber zu Recht "unmotiviert", seine behandelnden Ärzte zögern zu Recht, ihn zu überweisen und es ist in diesem Kontext auch oft folgerichtig, diese Patienten nicht dem Risiko einer solchen Therapie auszusetzen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Psychotherapie-Kliniken, die schwere Psychoneurosen und Ich-strukturelle Persönlichkeitsstörungen mit oder ohne körperliche Begleiterscheinungen behandeln, sind selbstverständlich notwendig. Es geht mir aber darum zu zeigen, dass Modifikationen notwendig sind - in unserer Einstellung, unseren Zielsetzungen und unseren Behandlungsangeboten, wenn wir auch Patienten mit Somato-Psychosomatosen zu einer klinischen psychosomatischen Behandlung motivieren wollen. Wir wollen das und haben uns deshalb gefragt : Wie können wir aus der RHEIN-KLINIK genauer aus einer Abteilung der RHEIN-KLINIK - in den Wald hineinrufen, damit unmotivierte psychosomatische Patienten sich motiviert heraustrauen ? Oder - wie ROHLPHS es genannt hat - wie können wir die Patienten dazu bringen, "Appetit auf uns zu bekommen"? Glücklicherweise haben uns wissenschaftliche Erkenntnisse und Interessenschwerpunkte der letzten Jahre - sowie wahrscheinlich auch gesellschaftliche Entwicklungen - bei der Beantwortung dieser Frage unterstützt: Zum Einen hat sich ein wachsendes Interesse an schwierigen Patienten und geeigneten Umgangsformen mit ihnen entwickelt. FÜRSTENAU z.B. hat immer wieder hervorgehoben, dass wir uns um solche Patienten aktiv und engagiert bemühen müssen: "Es ist die erste Aufgabe des Psychotherapeuten, auch mit schwierigen Patienten therapeutischen Kontakt herzustellen, die nicht von sich aus wie ein strukturierter Neurotiker um Hilfe nachsuchen oder die nicht wie er ein Problem klar artikulieren können. (...)In diesen Fällen ist ein 2 beträchtlicher persönlicher Einsatz erforderlich, um den Kontakt herzustellen und aufrechtzuerhalten, ohne vom Patienten als zu eindringend, bedrängend oder fordernd erlebt zu werden." Zum Zweiten scheint die Zeit der beinharten Ideologien und dogmatischen Lehrmeinungen, der verbissenen Argumentationsschlachten um die "wahre" Methode passé. Das "EntwederOder" und "Alles oder Nichts", die "Destruktivität der Ideale", weichen langsam einem gelasseneren "Sowohl-als-auch". MATURANA´s Aussage, "eine wissenschaftliche Diskussion, bei der es um die Wahrheit gehe, sei unseriös”, findet immer mehr Anklang. Psychoanalytiker, Systemiker, Verhaltensund Körpertherapeuten - um nur einige zu nennen - suchen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden und prüfen, ob Kooperation oder gar Integration möglich ist. Das Klima in der "Szene" ist entspannter und spielerischer geworden. Viele suchen lieber einen nützlichen Weg als den richtigen Weg. Nützlich für das Verständnis unserer unmotiviert erscheinenden Patienten, die leicht den Anschein erwecken, gar keine Veränderung zu wollen, ist z.B. die Meisterungshypothese eine psychoanalytische Behandlungstheorie von SAMPSON und WEISS. Diese Forschergruppe hat nachgewiesen, dass der Patient in der Behandlung den bewussten und unbewussten Wunsch hat, seine Konflikte und traumatischen Erfahrungen zu meistern und hemmende pathologische Überzeugungen durch positive Beziehungserfahrungen zu verlieren. Er muss zunächst den Therapeuten testen, um Sicherheit und Gefahr abzuschätzen. Aus dieser Theorie ergibt sich für scheinbar unmotivierte Patienten ein fruchtbares neues Verständnis des Arbeitsbündnisses: Ein abweisendes, indifferentes oder aggressives Verhalten kann als unbewusster Versuch, den Therapeuten zu testen, verstanden werden, der zeigt, dass der Patient an der Überwindung einer pathologischen Überzeugung arbeitet, mit der Hoffnung, der Therapeut möge anders reagieren als seine primären Objekte. Sehr viel Nützliches für unsere klinische Praxis haben uns die Erkenntnisse und Interventionsstrategien der Systemiker gebracht: - Nützlich für den Umgang mit diesen Kranken und auf ihre Krankheit fixierten Patienten ist die stärkere Wahrnehmung und Herausarbeitung der gesunden Persönlichkeitsanteile, der "Stärken und Ressourcen", die Beschäftigung mit den "Lösungsstrategien", mit den "Ausnahmen" von den Beschwerden, mit positiven "Zukunftsentwürfen", mit dem, "was funktioniert". Nützlich, um diese Menschen zu erreichen, die durch eine Art negativen Wahrnehmungsfilter sich selbst, ihre Erkrankung und ihre Mitmenschen oft nur negativ, schlecht und böse erleben, ist eine konsequente "positive Konnotation" ihres Verhaltens und eventuell der Symptomatik, die "sanfte Kunst des Umdeutens", die dem Patienten ihm unbewusste, jedoch wertvolle, seine Selbstachtung stärkende Aspekte seines Verhaltens vor Augen führen. - Nützlich bei Patienten, die oft in "unsichtbaren" familiären "Bindungen" gefangen sind, ist die direkte oder indirekte Einbeziehung der Familie unter Betonung der positiven, beziehungsregulierenden Funktion der Symptomatik und Berücksichtigung der Loyalität zur Familie und der Familienwerte. Nützlich, um diese Menschen mit einem oft sehr statischen Weltbild zu neuen bekömmlicheren Einstellungen und Verhaltensweisen anzuregen, ist die Technik des "hypothetischen Fragens", das Durchspielen und Ausphantasieren neuer "Wirklichkeitskonstruktionen". Sehr nützlich für ängstlich am Status quo festhaltende Menschen ist die gegenüber Veränderung neutrale Position des Therapeuten, der als "Anwalt der Ambivalenz" Vorund Nachteile der Veränderung und der Nicht-Veränderung beleuchtet, vielleicht sogar vor einer noch zu gefährlichen Veränderung warnt. 3 - Ganz besonders nützlich ist der Umgang der Systemiker mit dem Widerstand, den sie durch oft humorvoll-spielerische Interventionen in "Kooperation" zu verwandeln wissen. Ich zitiere noch einmal FÜRSTENAU als Vertreter eines "progressionsorientierten psychoanalytisch-systemischen" Ansatzes: "Die zweite Aufgabe ist eine konsequente neue Umgangsweise mit den Beschwerden, Problemen und Charaktereigenschaften des Patienten. Sehr wichtig scheint in diesem Zusammenhang, die Klagen, Beschwerden oder anstößigen Verhaltensweisen wenn irgendmöglich zu akzeptieren und zu respektieren, keinen Versuch zu machen, die Patienten davon abzubringen, und Machtkämpfe und Widerstandsreaktionen, z.B. durch Unterstellung ichfremder Motive, möglichst zu vermeiden". Ganz praktisch bedeutet dies für unsere unmotivierten psycho-somatischen Patienten zunächst, dass es sinnvoll ist, keinen Versuch zu machen, sie von ihrer mangelnden Motivation abzubringen und stillschweigend davon auszugehen, dass ein Patient, der sich trotz aller Zweifel in die Klinik wagt, nicht so unmotiviert sein kann - so unmotiviert er sich auch zeigen mag. Im übrigen hat JANSSEN in einer katamnestischen Studie herausgefunden, dass die Therapiemotivation für stationäre Behandlungen keinen Einfluss auf das Therapieresultat hat: Sie besteht in erster Linie darin, dass der Patient der stationären Aufnahme zustimmt. Es ist unsere Aufgabe, ihm ein nicht ängstigendes Angebot zu machen, das er annehmen und als hilfreich erleben kann. DE SHAZER, ein amerikanischer lösungsorientierter Kurzzeittherapeut, stellt hierfür eine einfache und nützliche Überlegung an: Er unterscheidet zwischen - Besuchern, die von Angehörigen oder Ärzten geschickt wurden, aber im Grunde kein eigenes Anliegen haben, - Klagenden, die eine Beschwerde haben und eine Lösung ihres Problems von außen erwarten und - Kunden, die tatsächlich etwas gegen das Problem unternehmen wollen. Zu Besuchern ist er so freundlich wie möglich, stellt sich konsequent auf ihre Seite und macht ihnen Komplimente für das, was funktioniert. Ein Besucher kann durch dieses therapeutische Verhalten durchaus zu einem Klagenden oder gar Kunden werden. Klagenden gibt er Beobachtungs- und Denkaufgaben, also nicht veränderungs-orientierte Aufgaben, und Kunden erhalten Verhaltensaufgaben, zum Experimentieren mit neuen Lösungen. DE SHAZER macht deutlich, dass der Versuch Besuchern irgendwelche Aufgaben zu geben und mit Klagenden veränderungsorientiert, z.B. mit Verhaltensaufgaben zu arbeiten, todsicher zu einer widerständigen Beziehung führt. Diese schlichte Unterteilung macht deutlich, dass viele unserer psychosomatischen Patienten noch Besucher oder Klagende sind, die im Grunde durch den hartnäckigen Veränderungsdruck unserer Behandlungsangebote in einen hartnäckigen Widerstand getrieben werden. Um diese für alle Beteiligten unerfreuliche und unfruchtbare Konstellation zu vermeiden, ist es nützlich, diesen Patienten ein gestuftes Angebot zu machen, das weder sie noch uns unter Druck setzt. Wir, ich meine jetzt die Abteilung I, haben daraus folgende idealtypische Behandlungsstrategie entwickelt: Besuchern, also den vorgeschickten oder sehr skeptischen Patienten, bieten wir einen“ Besuch“, einen Kurzaufenthalt von eine Woche an. Sie haben die Möglichkeit, uns kennenzulernen, wir untersuchen sie gründlich, sichten die bisherigen Befunde, führen evtl. 4 ein Gespräch mit der Familie und erörtern Zielvorstellungen für einen möglichen späteren Aufenthalt. Klagenden schlagen wir vor, gemeinsam ihre Erkrankung zu beobachten, zu erforschen und zu prüfen, was man machen könnte, damit es ihnen besser geht. Wir definieren also - für die Patienten - den Aufenthalt ausdrücklich nicht als psychotherapeutische Behandlung! Wir bieten ihnen einen Aufenthalt von 4-6 Wochen an mit medizinischer Behandlung, Einzelgesprächen, bei Bedarf Paar- und Familiengesprächen und einem physikalischen Entspannungsprogramm. Für Kunden - zu einer stationären Psychotherapie motivierte Patienten - gibt es zwei Möglichkeiten: Eine klar begrenzte Kurzzeittherapie von 4-6 Wochen oder eine individuell unterschiedlich lange, oft mehrmonatigen Therapie. Wir gehen davon aus, dass es für einen psychosomatischen Patienten schon ein erster und bedeutsamer Schritt ist, sich überhaupt in eine psychosomatische Klinik zu wagen. Selbst wenn er an keiner einzigen therapeutischen Veranstaltung im engeren Sinne teilgenommen hat, kann ein solcher Aufenthalt durchaus ein Anstoß für weitere Entwicklung sein und somit eine effektive Behandlung darstellen: FÜRSTENAU spricht von dem "kurativen Faktor des Behandlungssettings": "Die sozialwissenschaftliche Perspektive sieht ein wesentliches Moment der Therapie als Veränderung schon darin, dass der Patient in diese für ihn neue Situation überhaupt eintritt, sich auf sie einlässt, sie akzeptiert und für längere oder kürzere Zeit als ein einzuhaltendes Ritual in sein Leben integriert(...) Die Erweiterung des Patientensystems durch die Behandlungsbeziehung ist ein mehr oder weniger folgenreicher Eingriff in das Patientensystem". Für einen Patienten aus einer psychosomatischen Familie mit starren Außengrenzen, rigiden Weltbildern und Werten kann der Schritt aus der Familienfestung in eine andere Welt mit anderen Umgangsformen und Einstellungen eine harte Realität erstmalig in Frage stellen. Der Klinikaufenthalt als solcher kann eine Botschaft an die Familie oder eine Probetrennung darstellen, die, erfolgreich überstanden, neue Entwicklungsschritte ermöglicht. Auch dem Austausch mit den Mitpatienten kommt eine hohe therapeutische Wirksamkeit zu. SENF berichtet aus einer katamnestischen Studie, dass die Patienten auf die Frage, welche Erfahrungen ihnen am wichtigsten waren, am häufigsten die Gespräche untereinander nannten. Dies ist im übrigen auch einer der Gründe, warum die Behandlung von Patienten mit unterschiedlichen Krankheitsbildern, Strukturniveaus und Motivationen in einem Krankenhaus und auf einer Station eine besondere Chance darstellt. Ein stationärer Aufenthalt kann demnach nützlich und sinnvoll sein, auch ohne dass wir uns aktiv therapeutisch betätigen, vielleicht manchmal gerade deswegen! Der - allerdings von uns gestaltete und wohldurchdachte - Kontext wirkt durchaus auch ohne explizite Therapie! Wir haben dabei auch die Worte von RANGELL im Hinterkopf: "Der Patient erfährt eine korrigierende emotionale Erfahrung, aber mehr durch das, was der Therapeut nicht tut, als durch das, was er tut!" Stellen Sie sich nun bitte vor, es ist uns gelungen, einen unmotivierten psychosomatischen Patienten zu ermuntern, seine Skepsis, seine Angst, sein Misstrauen zu überwinden und zu uns zu kommen. Der Beschreibung der Initialphase der Behandlung möchte ich ein Zitat von WINNICOTT voranstellen: "Am Anfang von Behandlungen passe ich mich ganz stark den Erwartungen des Einzelnen an. Es ist unmenschlich, das nicht zu tun.(...) Es ist nicht eine Frage von Bedürfnisbefriedigung, im Sinne von einer Verführung erliegen, sondern schlicht eine Frage der Bereitstellung von notwendigen Rahmenbedingungen." 5 Psychosomatische Patienten erwarten Interesse für ihre Symptome und Krankheitstheorien, sie erwarten Schonung, körperliche Untersuchung und Behandlung. Und genau das müssen sie auch bekommen! Das oberste Prinzip ist zunächst: Es darf und soll dem Patienten gut gehen! Die Erfahrung einer Besserung der Beschwerden durch Versorgung und Entspannung ist zunächst zweckmäßiger und für ihn überzeugender, um psychophysische Zusammenhänge zu erleben, als die einer Verschlimmerung bei Ärger, Enttäuschung und Unzufriedenheit. In diesem Sinne betont WILKE, die erste Sitzung im katathymen Bilderleben bei psychosomatischen Patienten solle eine möglichst nur gute Erfahrung sein und verwendet die Formel: "Stellen Sie sich eine Situation vor, in der Sie sich so richtig wohl fühlen können." GRODDECK, der Altvater der Psychosomatik, hat seine Patienten mit Bädern und Massagen "verwöhnt", die er im Übrigen selbst durchgeführt hat(!). CURTIUS behandelte die Colitis ulcerosa zunächst mit hypnotischer Entspannung, FEIEREIS in Lübeck leitet die kombiniertinternistisch-psycho-therapeutische Behandlung der entzündlichen Darmerkrankungen mit vegetativer Entspannung durch Hypnose, autogenem Training und katathymem Bilderleben ein. KÜTEMEYER aus dem St. Agatha-Krankenhaus in Köln steckt ihre Patienten mit chronischen Schmerzsyndromen in duftende Heublumenpackungen, REDDEMANN aus Bielefeld lässt ihre PatientInnen mit wohlriechenden Ölen massieren. Solche Behandlungsformen stoßen in analytischen Kreisen oft auf eine gewisse Zurückhaltung! In der stationären Behandlung von strukturell gestörten Patienten gilt die strikte Wahrung der Prinzipien Neutralität, Anonymität, Spiegelhaltung, Abstinenz zwar schon lange als überholt, aber die Befriedigung von "regressiven" Wünschen, die so genannte Verwöhnung, ist nach wie vor ein umstrittenes Thema. Ängste vor einem Dammbruch - die Geister, die wir riefen, werden wir nicht mehr los eigene projizierte Regressionswünsche und -ängste, die dann prophylaktisch in Schach gehalten werden müssen, Neid und vielleicht auch Über-Ich-Ängste mögen da eine Rolle spielen: Ist das überhaupt noch analytisch? Manch einer hat vielleicht auch noch die mahnenden Worte von FREUD im Ohr: "Wer als Analytiker, etwa aus der Fülle eines hilfsbereiten Herzens ,dem Kranken alles spendet, was ein Mensch vom anderen erhoffen kann, der begeht denselben ökonomischen Fehler, dessen sich unsere nichtanalytischen Nervenheilanstalten schuldig machen. Diese streben nichts anderes an als es dem Patienten möglichst angenehm zu machen, damit er sich dort wohl fühle und gern wieder vor den Schwierigkeiten des Lebens Zuflucht dorthin nehme. Dabei verzichten sie darauf, ihn für das Leben stärker, für seine eigentlichen Aufgaben leistungsfähiger zu machen. In der analytischen Kur muss jede solche Verwöhnung vermieden werden." In der ”psychosomatischen Kur” ist Entspannung, Schonung und Regression (im Sinne Befriedigung primärer präödipaler Bedürfnisse) erlaubt und indiziert! (Eine therapeutische Regression im Sinne eines sich Öffnens für kindliches Erleben, schmerzliche und beschämende Erfahrungen und bedrohliche Affekte ist sicherlich erst in späteren Behandlungsphasen möglich und sinnvoll - wenn der Patient dazu bereit ist.) Ein weiterer Grund für die Skepsis gegenüber solchen Behandlungsformen ist die Sorge, eine sogenannte Verwöhnung könne zu malignen Regressionen führen. Häufig wird befürchtet, die hinter der Symptomatik lauernde "süchtige", gierige Oralität des Patienten werde durch den "regressiven Sog" der Klinik sozusagen automatisch entfesselt. Gerade diese Sorge kann dann zu einem Teufelskreis beitragen von prophylaktischer Beschränkung und dadurch erzeugter Unzufriedenheit und "Gier", die wiederum die Begrenzung notwendig erscheinen lässt usw. Das so genannte "fordernde", "anspruchsvolle", "gierige", "maßlose" Verhalten dieser Patienten wird im übrigen noch oft auf eine andere Weise von uns miterzeugt: Je fordernder und überfordernder unsere therapeutischen Ambitionen sind, je anspruchsvoller und maßloser wir also sind, umso dramatischer werden die sich bedroht fühlenden 6 psychosomatischen Patienten ihre Symptome in den Vordergrund stellen! Je mehr wir auf der Lauer liegen, um einen Konflikt oder ein Gefühl zu deuten, umso mehr sind sie auf der Hut und umso "fordernder", "anspruchsvoller" und "gieriger" erinnern sie uns an ihre körperlichen Beschwerden. Und umgekehrt, je mehr wir uns zum Anwalt des Widerstandes machen, ihr Misstrauen, ihre Angst und ihre ängstliche Entwertung der Psychotherapie verständnisvoll für sie verbalisieren und zunächst ihre regressiven Bedürfnisse im Rahmen unserer Möglichkeiten befriedigen, umso mehr werden sie sich angenommen und in Sicherheit fühlen - mit positiver Auswirkung auf die Symptomatik. Um bei regredierten psychosomatischen Patienten maligne Regressionen zu verhindern, ist es demnach sinnvoll, sie nicht zu überfordern. (Andererseits aber auch nicht zu unterfordern! Das "richtige" oder besser "passende" Maß (de Shazer) kann nur individuell durch trial and error gefunden werden). Weiterhin ist nützlich eine unbedingte Bejahung und positive Konnotation aller Wünsche des Patienten bei gleichzeitiger, deutlicher Darstellung unserer Möglichkeiten, Grenzen und natürlich auch Behandlungsbedingungen. Es geht also nicht darum, den Patienten zu begrenzen, weil das angeblich gut für ihn ist, sondern ihm ruhig und selbstverständlich sowohl unsere Möglichkeiten als auch unsere Grenzen und Bedingungen aufzuzeigen , weil das gut für uns ist - und das zu erleben, ist dann wiederum hilfreich für ihn! Besonders Stationsarzt und Schwestern, die wesentlichen Bezugspartner in dieser Behandlungsphase, müssen darauf achten, sich nicht zu überfordern und ihre Grenzen, die im übrigen ja individuell ganz unterschiedlich sein dürfen, gelassen und ohne Schuldgefühle aufzeigen. Es ist übrigens immer wieder eindrucksvoll, zu sehen, dass eine konsequente Verordnung der Regression schon bald den Widerspruch, die Regressionsängste und Autonomiewünsche des Patienten mobilisiert. Oft ist es gerade eine zögerliche, halbherzige Bereitstellung von Regression, verbunden mit einer diffusen Darstellung therapeutischer Möglichkeiten und Grenzen, die scheinbar uferlose Wünsche erzeugt. Die maligne Regression ist somit auch ein iatrogener Artefakt! Der Versuch der Lösung eines vermeintlichen Problems wird zum Problem. Anders ausgedrückt, die therapeutische Vorstellung des Patienten als zu begrenzendes nur oder im Grunde "polymorph-perverses gieriges Kind" trägt als "self-fullfilling prophecy" zu der Entwicklung maligner Verstrickungen, "maligner Regressionen" bei. Ich möchte diese theoretischen Überlegungen zum Umgang mit der "Regression" mit einer Fallgeschichte illustrieren. Die Geschichte ist von JANOSCH. Sie heißt: "Ich mach dich gesund, sagte der Bär“ und beschreibt einen hilfreichen Umgang mit einem "gierigen", regredierten psychosomatischen Patienten. Der kleine Tiger ist krank. Ihm ist ein Streifen verrutscht. Der kleine Bär hat ihn auf seinen Wunsch von Kopf bis Fuß verbunden - und da ging es ihm schon ein wenig besser. "Aber dann ging es ihm wieder ein bisschen schlechter, denn er hatte Hunger. "Ich koch dir etwas Dolles" sagte der kleine Bär, "Sag mir doch mal deine Leibspeise!" "Springforelle mit Mandelkernsoße, Kartöffelchen und Semmelbröseln." "Haben wir nicht", sagte der kleine Bär, "Sag etwas anderes." "Eiernudeln mit Mandelkernsoße und Semmelbröseln", sagte der kleine Tiger. "Haben wir auch nicht ", sagte der kleine Bär. "Sag noch etwas anderes." "Semmelbrösel", sagte der kleine Tiger, aber die hatten sie auch nicht. "Sag doch mal Bouillon!", sagte der kleine Bär. "Ja, Bouillon", rief der kleine Tiger, "das wollte ich haargenau sagen." 7 "Und kleine Himbeeren aus dem Garten als Nachspeise", sagte der kleine Bär. Und dann kochte er für den kleinen Tiger eine fabelhafte Bouillon mit Kartoffeln und Mohrrüben aus dem Garten. Etwas Petersilie dazu, und oben schwammen ein paar Fettäuglein, und als der kleine Tiger gespeist hatte, ging es ihm schon wieder ein wenig besser." Dass Widerstandsreaktionen vermieden werden sollten, leuchtet bei psychosomatischen Patienten besonders ein, da sie auf verfrühte psycho-therapeutische Interventionen mit zum Teil gefährlichen Verschlimmerungen ihrer Symptomatik reagieren. CURTIUS sprach vom Primat des somatischen Geschehens: "Jede psychotherapeutische Maßnahme, die eine Verschlechterung des somatischen Befundes bewirken könnte, muss vermieden werden." Die psychotherapeutischen Maßnahmen können jedoch in einem stationären Setting, in dem jeder Patient auch in gruppendynamische Prozesse eingebunden ist, nicht einfach isoliert und dosiert verordnet werden. Die therapeutische Haltung des Teams, die dadurch bestimmte Atmosphäre des Stationslebens wirkt auf jeden Patienten, unabhängig von den einzelnen therapeutischen Maßnahmen, ein. Deshalb muss die Haltung und Einstellung des Teams, die gesamte medizinisch-therapeutische Kultur, in die die einzelnen Maßnahmen eingebettet sind, dieses "primum nihil nocere" gewährleisten! Paradoxerweise vermag bei diesen schweren, ernsten Erkrankungen, denen häufig sehr leidvolle Lebensschicksale vorausgehen, eine spielerischere Haltung dies am ehesten! Vielleicht ist es kein Zufall, dass GRODDECK, der erste Psychoanalytiker, der sich mit psychosomatischen Erkrankungen befasst hat, dies mit soviel Phantasie und spielerischer Kreativität getan hat. Er hat sich nicht gescheut, in dem "Theaterspiel des Es", wie er Krankheit bezeichnete, die verschiedenen Rollen des Arztes, Masseurs, Bademeisters und Psychoanalytikers zu spielen: "Es kam nun nicht mehr darauf an, dem Kranken Vorschriften zu geben, ihm das zu verordnen, was ich für richtig hielt, sondern so zu werden, wie er mich brauchte." Für die Nützlichkeit einer spielerischen Haltung lassen sich sowohl systemische als auch analytische Argumente finden: Idealtypische psychosomatische Familien können als Systeme mit einer harten Beziehungsrealität, mit geschlossenen Außengrenzen, mit mangelhafter Fähigkeit zur Anpassung und Entwicklung beschrieben werden. Jedem Versuch der Veränderung von außen wird meist rasch entgegengearbeitet. Gezielte, veränderungsorientierte therapeutische Bemühungen wirken daher in der Regel eher systemstabilisierend. Ein spielerischer, nicht fordernder Umgang, der sich vom Feedback des Systems leiten lässt, wird die Aufnahme neuer Informationen und Denkanstösse eher ermöglichen. WINNICOTT hat für frühgestörte Patienten das Spielen als essentielle therapeutische Beziehungsform beschrieben: "Psychotherapie hat mit zwei Menschen zu tun, die miteinander spielen. Wenn der Patient nicht spielen kann, muss etwas unternommen werden, um ihm diese Fähigkeit zu geben; erst danach kann die Psychotherapie beginnen. Erst spielen, dann deuten!" Das Kind braucht etwa ab Ende des ersten Lebensjahres einen Übergangsraum oder Möglichkeitsraum, in dem es spielerisch seine Welt erfinden kann. In einer Arbeitsgruppe der Arbeitstagung der RHEIN-KLINIK von 1986 hat SCHMIDT die "Not und Unfähigkeit zu spielen vieler psychosomatisch erkrankter Menschen" hervorgehoben und dies auf eine zu frühe und zu drastische Konfrontation mit einer rigiden, eindeutigen und alleingültigen Realität durch die Eltern zurückgeführt. Ihnen fehlte ein angemessener Übergangsraum. Gerade das vielgestaltige Behandlungsarrangement einer stationären Therapie biete die 8 Möglichkeit der allmählichen Entwicklung eines Übergangsraumes, in dem psychosomatische Patienten "spielerisch erfinderische Erfahrungen" machen können. In einer neueren Arbeit hat Schmidt aufgezeigt,“ dass der Beitrag des Analytikers zu der Erschaffung des Möglichkeitsraumes und zum Spielen im Bereich der Arbeit mit der Grundstörung seine Fähigkeit ist, nicht zu wissen und zu deuten, sondern sich der Situation zu überlassen, darauf zu vertrauen, dass, was immer sich ergeben wird, kein Fehler oder Mangel ist und sich von den "Erfindungen" des Analysanden überraschen zu lassen." Für unsere psychosomatischen Patienten ist diese Haltung auch sehr nützlich! Eine spielerische Einstellung, eine bescheidene, fragende, interessierte Bereitschaft, mit ihnen verschiedene Möglichkeiten durchzuspielen, das ausdrückliche Angebot, gemeinsam mit ihnen ihre Erkrankung zu erforschen, der Verzicht darauf, zu wissen, was richtig und gut für sie ist, können zumindest bei einigen von ihnen ganz langsam einen Möglichkeitsraum und eine Motivation für eine weiterführende therapeutische Arbeit entstehen lassen. Wir - die Abteilung I - versuchen, unsere Behandlungsangebote so zu gestalten, dass die Patienten sie als wohlwollende Einladungen erleben. Eine Metapher für diese Haltung finden wir wiederum bei WINNICOTT: Er stellt dem Training und der Erziehung eine "reifungsfördernde" Einstellung gegenüber, die "Gelegenheiten bereitstellt," die nicht nur Teddybären, Puppen und Spielzeugautos "herumliegen lässt", sondern auch moralische Werte u.ä., die das Kind dann ergreifen kann, wenn es sich damit beschäftigen will. Wir lassen eine bunte Vielfalt von Möglichkeiten für unsere Patienten „herumliegen“: Medizinische Behandlung, Information und Beratung, Physikalische Therapie, Einzel- und Gruppengespräche, konzentrative Bewegungstherapie, katathymes Bildererleben, Sozialberatung, Angst- oder besser Muttraining - also Verhaltens-therapie(!) - Betreuung durch die Schwestern und Pflegern, seelsorgerische Betreuung, Paar - und Familiengespräche, eine auf medizinische Themen zentrierte "Symptomgruppe", Visitengespräche, autogenes Training und Freizeitangebote. Natürlich machen wir uns unsere Gedanken, was wir herumliegen lassen; wir achten z.B. darauf, dass keine noch zu gefährlichen Gegenstände darunter sind wie zu scharf geschliffene Deutungen. Wir zeigen dem Patienten sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen des "Möglichkeitsraumes" auf. Aber wir achten auch darauf, dass das Spielerische, die Eigeninitiative und der Wunsch, eigene Erfahrungen zu machen, nicht durch unsere berufliche Neigung, alles verstehen und unter Kontrolle haben zu wollen und unseren Hang zur Überfürsorglichkeit erstickt wird. Es muss auch genügend Spielecken geben, in denen der Patient sich alleine oder mit seinen Mitpatienten vor uns sicher fühlen kann! Wir ermuntern den Patienten, zu spielen, aber wir hüten uns davor, ihn zu drängen, zu spielen oder mit Dingen zu spielen, die ihm noch Angst machen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass er es dann erst recht nicht tut, ängstlich oder "trotzig" wird, auf einmal keine Lust mehr hat oder sich nur brav anpasst. Zum Schluss noch einige Gedanken zum Zeitdruck bei der stationären Behandlung von Somato-Psychosomatosen: Ich habe dargestellt, dass jede Form von Druck starre Systeme oder ängstliche Menschen bei einer ihnen gemäßen Entwicklung eher behindert als fördert. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass diese Patienten sehr viel Zeit und therapeutische Geduld benötigen. Auch Spielen unter Zeitdruck ist ein Widerspruch. Tatsache ist aber, dass uns nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht! Zeitbegrenzung muss aber nicht gleichbedeutend mit Zeitdruck sein. 9 Der Zeitdruck ist wohl ein gemeinsames Produkt von Patient, Therapeut, Angehörigen, Krankenkassen, Gesellschaft und - Kollegen. Auf Seiten des Therapeuten entsteht Zeitdruck durch viele Faktoren in individuell variabler Mischung: Der Wunsch zu helfen, Mitleid, Ehrgeiz, Größenphantasien, Rivalität, Ungeduld, Schuldgefühle, Wiedergutmachungs- und Reifungsphantasien mit Verantwortungs-übernahme für den Patienten. Die Liste ist sicher nicht vollständig. Auch Patient, Familie und Gesellschaft haben berechtigte Wünsche nach Besserung und Heilung, in die sich ebenfalls mehr oder weniger illusionäre, bewusste und unbewusste Erwartungen mischen. Ohne mathematisch-wissenschaftlichen Anspruch könnte man sagen: Wenn die Erwartungen im Zähler sehr groß sind, wird ein kleinerer Nenner, auch wenn das Ergebnis an sich beachtlich oder die Zeit sehr lang ist, immer einen großen Zeitdruck zur Folge haben! Um den Zeitdruck zu verringern oder ganz abzubauen, ist demnach eine Möglichkeit, unsere hochgespannten therapeutischen Ansprüche und Erwartungen herunterzuschrauben bzw. sie zu differenzieren, uns mehr an den unterschiedlichen Bedürfnissen einzelner Patientengruppen zu orientieren und individuelle begrenzte Ziele in unseren therapeutischen Angeboten zu berücksichtigen. Bei den psychosomatischen Patienten im engeren Sinne ist Weniger oft Mehr. Die therapeutische Bereitschaft, sich zunächst auf ganz bescheidene Ziele einzulassen, ermöglicht meist erst spätere Entwicklungen. SCHÖTTLER, eine Analytikerin, die psychosomatisch schwer gestörte Patienten über viele Jahre psychotherapeutisch behandelt hat, berichtet, dass sie sich - in der ersten etwa zwei bis dreijährigen Behandlungsphase - vorwiegend mit den Klagen der Patienten über körperliche Beschwerden - sowie über Medikamente und das Wetter beschäftigt hat! Sie beschreibt insgesamt vier solcher Behandlungsphasen, die zuletzt sogar in eine klassische Analyse einmündeten! "Ein wichtiges Moment ist das Abwarten können(...) und die Fähigkeit, sich zu früher Deutungen zu enthalten.(...) Der Patient findet die ihm adäquate Deutung aller Erfahrung nach selbst und zu seiner Zeit; nämlich dann, wenn er auch ichstark genug ist, sie ertragen zu können." Erst wenn der Zustand des Patienten sich soweit gebessert hat, dass er auf psychische Belastungen nicht sofort somatisch dekompensiert, meist erst in weiterführenden ambulanten oder stationären Behandlungen, kann bei manchen Patienten zu einer vorsichtigen Konfliktbearbeitung und Aufarbeitung der negativen Objektbeziehungs-erfahrungen übergegangen werden. Eine andere Möglichkeit, den lästigen Zeitdruck loszuwerden, ist es, die Zeitbegrenzung als Entlastung und Stimulans für den therapeutischen Prozess positiv zu konnotieren. Dies gelingt nach unserer Erfahrung vor allem dann, wenn eine Zeitbegrenzung im beiderseitigen Einverständnis zu Beginn der Behandlung zwischen Patient und Therapeut vereinbart wurde. Unter dieser Vorausetzung erleben wir mit 4-6 Wochen Kurzeitbehandlungen, die wir seit etwa einem Jahr durchführen, dass Zeitbegrenzung einen gleichzeitig intensivierenden und entlastenden Effekt für Patient und Therapeut haben kann. Skeptische und ängstliche Patienten haben ja gerade unsere bis vor kurzem noch geltende Mindestzeit von 3 Monaten als abschreckenden Zeitdruck erlebt! 10 Wir - und ich spreche jetzt von der gesamten RHEIN-KLINIK - haben das 3-Monatskonzept zugunsten flexibler Behandlungszeiten und -ziele aufgegeben! Ein Zitat von KERNBERG mag verdeutlichen, dass wir damit ganz im internationalen Trend liegen! "Die vielleicht bedeutendste Tendenz der letzten Jahre ist die Anerkennung der Notwendigkeit, spezielle Dienstleistungen für spezielle Patientengruppen zu entwickeln und nicht, wie bisher, alle psychiatrische Patienten als homogene Gruppe zu behandeln." Wir denken darüber nach, dass die Klinik sowohl in bewährter Weise ein Ort für längere Entwicklungs- und Reifungsprozesse sein kann, als auch ein Erfahrungsfeld, auf dem begrenzte Probleme mit bescheidenen Zielen gemeistert werden können. So könnte die psychosomatisch-psychotherapeutische Klinik ein Übergangs- oder Möglichkeitsraum, eine Gebärmutter, ein Erlebnis-Spielplatz, eine Tankstelle, ein Trainingsplatz für Kommunikation und soziale Kompetenz, eine Parkbank zum Ausruhen und Nachdenken in einer hektischen Zeit und für unsere psychosomatischen Patienten zunächst einfach nur ein Krankenhaus sein. Für diese Patientengruppe ergeben sich aus dieser Sichtweise ganz neue Möglichkeiten. Nicht immer, aber immer öfter! Zusammenfassend, wollte ich Ihnen heute Abend eigentlich nur drei Erkenntnisse, die für psychosomatische Patienten nützlich sind, näher bringen: 1. Gut Ding will Weile haben. 2. Müßiggang ist nicht aller Laster Anfang 3. Manchmal ist weniger mehr!“ Literaturangaben beim Verfasser 11