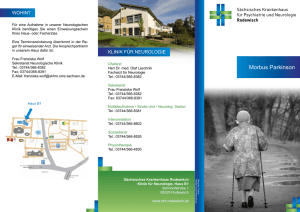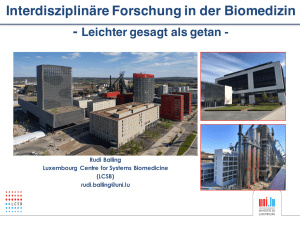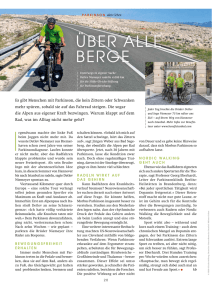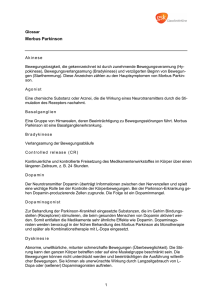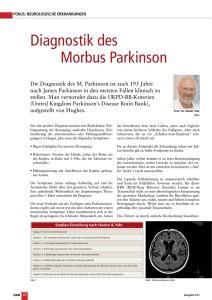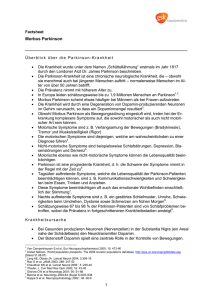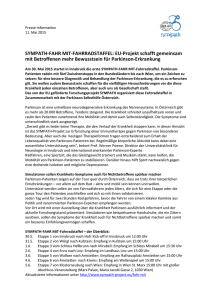Parkinson
Werbung
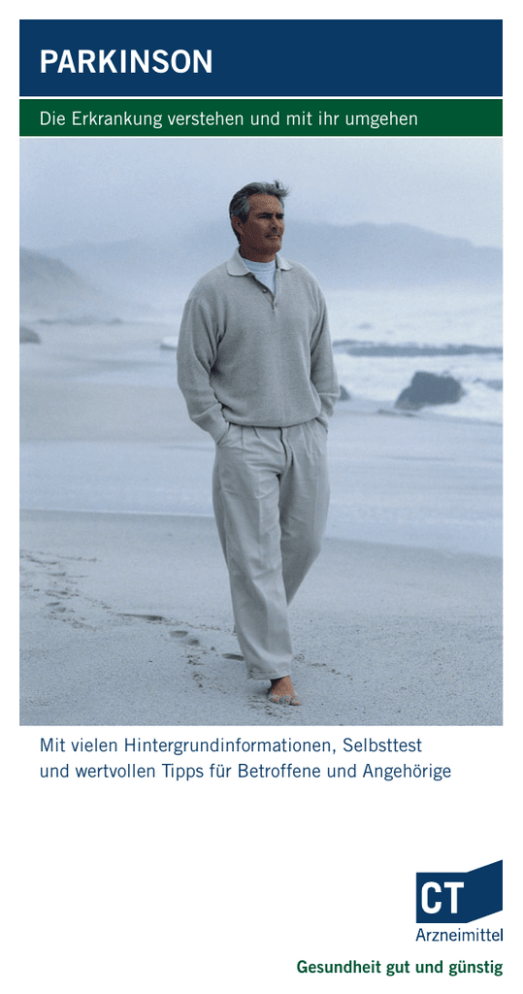
Parkinson Die Erkrankung verstehen und mit ihr umgehen Mit vielen Hintergrundinformationen, Selbsttest und wertvollen Tipps für Betroffene und Angehörige Gesundheit gut und günstig Impressum Inhaltsverzeichnis Inhalt Krankheitsbeschreibung Parkinson kommt auf leisen Sohlen 4 – 5 Parkinson – was steckt dahinter? 6 – 8 Ursachen der Erkrankung Morbus Parkinson – die Ursachen 9 Krankheitssymptome 10 – 11 Den Alltag meistern 12 – 17 Impressum Diagnostik Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung und Vervielfältigung, vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung der CT Arzneimittel GmbH darf kein Teil der Broschüre durch Mikroverfilmung, Fotokopie oder ein anderes Verfahren reproduziert werden. Selbsttest Parkinson20 – 21 © 2009 CT Arzneimittel GmbH Lengeder Straße 42a, 13407 Berlin Compliance-CT: gemeinsam für eine erfolgreiche Parkinsontherapie25 Konzept & Text: Jutta Heinze, Allermöher Deich 95, 21037 Hamburg, [email protected] Tipps für den Alltag Mitarbeit: Dipl.-Biol. Daniela Schmidt, Wissenschaftsjournalistin Wissenschaftliche Beratung: Dr. med. Matthias Bokeloh, Facharzt für Psychiatrie, Hamburg Layout: Stefan Behrendt, Löwenstraße 54, 20251 Hamburg, [email protected] Schlussredaktion: TEXT+PLAN Dr. Ira Lorf, Fischers Allee 59 e, 22763 Hamburg, [email protected] Fotos: CT Arzneimittel (Seite 22), Digital Vision/Getty Images (Seiten 1, 2, 4, 6, 9, 10, 16, 18, 28, 30, 32), © plainpicture/Maskot (Seite 34), © 2009 Jupiter­Images Corporation (Seiten 12, 15), Project Photos (Seite 26) Typische Parkinsonsymptome Diagnose Parkinson 18 – 19 Behandlung Parkinsonbehandlung: auf mehreren Ebenen zum Erfolg22 – 24 Ernährungstipps bei Parkinson26 – 27 Unterstützung per Gesetz28 – 29 Hinweise für Angehörige 30 – 31 Selbsthilfegruppen 32 Hilfreiche Adressen und Buchtipps 33 CT Arzneimittel CT Arzneimittel: Gesundheit gut und günstig34 Compliance-CT® – ein Name, viel Service35 Krankheitsbeschreibung Krankheitsbeschreibung Die Augen offen halten Lindern allerdings lässt sich die Erkrankung schon jetzt, und zwar umso besser, je früher sie erkannt wird. Genau hier aber liegt das Problem, denn die Erkrankung beginnt heimlich, still und leise. Parkinson kommt auf leisen Sohlen Der Country-Star Johnny Cash, die Boxlegende ­Muhammad Ali, Prinz Claus der Niederlande, der amerikanische Schauspieler Michael J. Fox und Papst ­Johannes Paul II. – sie alle leiden oder litten an der Parkinson­krankheit (in der Fachsprache: Morbus Parkinson). Diese auch als „Schüttellähmung“ bezeichnete Erkrankung ist nach dem englischen Arzt und Apotheker James Parkinson benannt, der Anfang des 19. Jahrhunderts die erste umfassende Beschreibung dieses neurologischen Krankheitsbildes lieferte. Seinerzeit empfahl er den Betroffenen Aderlass und Quecksilber. Die moderne Medizin bietet in­ zwischen weit wirksamere Therapien an, auch wenn sie nach wie vor nach den Ursachen und einem Heilmittel gegen die Parkinsonkrankheit forscht. Ein leichtes Zittern der Hände, verzögerte Bewegungen beim Gehen oder eine leisere Sprache: Zu Erkrankungsbeginn fällt Morbus Parkinson den ­Betroffenen, Ange­hörigen und Freunden nicht sofort auf. Von daher erfolgt die ärztliche Diagnose oftmals spät. Denn die Erkrankung wird meist erst erkannt, wenn schon eine Vielzahl von Gehirnzellen in Mit­ leidenschaft gezogen wurde. Doch auch dann ­helfen Medikamente, die Symptome zu mildern. Zahlen & Fakten zu Morbus Parkinson Morbus Parkinson ist nach der Alzheimerkrankheit die zweit­ häufigste degenerative neurologische Erkrankung. • Wie viele Menschen leiden an Parkinson? In Deutschland leiden zwischen 100.000 und 250.000 Menschen an Parkinson. Jährlich kommen 10.000 bis 15.000 Neuerkrankungen hinzu. • Wie hoch ist das Risiko? Die Wahrscheinlichkeit, an Morbus Parkinson zu erkranken, liegt bei über 65-Jährigen bei zirka einem Prozent. • Wen betrifft es? Die Krankheit tritt meist zwischen dem 55. und 65. Lebensjahr auf. Allerdings gibt es auch deutlich jüngere Patienten wie beispielsweise den amerikanischen Filmschauspieler Michael J. Fox, der bereits im Alter von 30 Jahren daran erkrankte. Quelle: Kompetenznetz Parkinson Krankheitsbeschreibung Krankheitsbeschreibung Bei Parkinsonpatienten fehlt es am Botenstoff Dopa­min, andere „Nervenkuriere“ bekommen dadurch ein Übergewicht. Die Folge: Störungen bei der Informationsübertragung in den Bereichen, die die Motorik regulieren. Streik in bestimmten Gehirnregionen Parkinson – was steckt dahinter? Das Parkinsonsyndrom zählt zu den neurologischen Erkrankungen, den Krankheiten des Nerven­systems. Es schreitet langsam fort und betrifft bestimmte Gehirnregionen, die beeinflussbare (will­kürliche) und unbeeinflussbare (unwillkürliche) Bewegungen steuern. Nach der Alzheimererkrankung ist Parkinson hierzulande die zweithäufigste degenerative neurologische Erkrankung. Wenn der Kurierdienst versagt Dahinter steckt letztlich ein Mangel an Botenstoffen im Gehirn. Diese Botenstoffe – Neurotransmitter ­genannt – sorgen dafür, dass die Millionen Nervenzellen im Kopf Informationen untereinander weitergeben können. Schuld an diesem Botenstoff-Ungleichgewicht trägt der allmähliche Ausfall eines bestimmten Hirnareals, der sogenannten „schwarzen Sub­stanz“ (Substantia nigra). Diese durch ihren hohen Eisen- und Melanin­ gehalt dunkle Gehirnregion bildet normalerweise einen Großteil des Botenstoffs Dopamin. Bei Parkinson stellen die Zellen der schwarzen Substanz jedoch nach und nach ihren Dienst ein, sodass sie immer weniger Dopamin produzieren und damit das Krankheitsbild auslösen. Parkinson – rechtzeitige Behandlung bietet beste Erfolge Noch ist es der Forschung zwar nicht gelungen, das Fortschreiten der Erkrankung zu stoppen – aber es stehen hochwirksame Medikamente zur Verfügung, die die Beschwerden wirkungsvoll ausbremsen können. Vor allem zu Beginn der Krankheit bringt die moderne medikamentöse Therapie beachtliche Erfolge. Aufgrund dieser ständigen Weiterentwicklung haben Parkinsonpatienten mittlerweile eine mit Gesunden vergleichbare Lebenserwartung und Lebens­ qualität. Voraussetzung: eine individuell auf die Beschwerden zugeschnittene Therapie. Krankheitsbeschreibung Ursachen der Erkrankung Ein Begriff – verschiedene ­Krankheitsausprägungen Hinter dem Begriff Parkinson verbergen sich verschiedene Krankheitsbilder mit den Symptomen Bewegungshemmung, erhöhte Muskelspannung und Ruhezittern. Die meisten Patienten (um 80 Prozent) leiden am idiopathischen Parkinson­syndrom – auch Morbus Parkinson genannt. Bei dem selteneren symptomatischen Parkinson­ syndrom liegen konkrete Auslöser vor, beispiels­weise Tumore, Gehirnerkrankungen und -verletzungen. Auch Reaktionen auf bestimmte Medikamente kommen als Verursacher infrage. Manchmal lösen auch andere Krankheiten des Nerven­systems ­typische Parkinsonbeschwerden aus. Parkinson und Psyche Morbus Parkinson ist eine neurologische Erkrankung, die in erster Linie das Bewegungssystem betrifft. Der fehlgesteuerte Hirnstoffwechsel und die damit verbundenen Einschränkungen haben aber auch Einfluss auf das psychische Befinden der Betroffenen. Mit einer medikamentösen Parkinsonbehandlung bessern sich derartige Symptome jedoch oft parallel zu den motorischen ­Beschwerden. Die meisten Parkinsonpatienten sind absolut „klar im Kopf“, der Intellekt ist nicht betroffen. Gedächtnisstörungen können bei einem Teil der Erkrankten im späteren Krankheitsverlauf auftreten. Und: Parkinson ist nicht ansteckend! Morbus Parkinson – die Ursachen Nach den Ursachen von Morbus Parkinson forschen Wissenschaftler noch immer. In der Diskussion als Krankheitsauslöser stehen (seltene) Erbgutverände­ rungen, aber auch Umweltfaktoren. Dazu zählen womöglich Schadstoffbelastungen durch Pestizide oder Schwermetalle. Auch zellschädigende Sub­ stanzen, die im normalen Zellstoffwechsel ent­ stehen („freie Radikale“) können die Entstehung der Erkrankung ­möglicherweise begünstigen. Gesund leben – ein guter Schutz Seinen Genen kann niemand etwas entgegensetzen, wohl aber einer ungesunden Lebensweise. Achten Sie daher auf eine vitaminreiche Ernährung ­(Vitamine A, C, E) und eine möglichst chemikalienarme Umgebung! Krankheitssymptome Krankheitssymptome Wie sich die Beschwerden äußern Das typische Zittern (Tremor) betrifft häufig nur eine Körperseite und dann vor allem die Arme. In Ruhe ist das Zittern stärker als in Bewegung. Eine erhöhte Muskelspannung / -steifigkeit (Rigor) zeigt sich in einer eingeschränkten Bewegungsfähigkeit der Muskulatur (z. B. starre Armhaltung beim Gehen). Typische Parkinsonsymptome Morbus Parkinson beginnt nicht plötzlich, sondern ganz allmählich. Das macht die Diagnose so schwierig – gerade zu Beginn der Erkrankung. Denn Krankheiten wie Rheuma oder Depressionen verursachen manchmal ähnliche Beschwerden wie Parkinson im Anfangsstadium und führen daher gelegent­lich auf die falsche Fährte. Vier Indizien für eine Krankheit Das Kompetenznetz Parkinson (Kontaktdaten siehe Seite 33) nennt vier typische Hinweise auf Morbus Parkinson: 1. Muskelzittern in Ruhe oder beim Halten (Tremor) 2. erhöhte Muskelspannung/-steifigkeit (Rigor) 3. Verlangsamung der Bewegungsabläufe (Hypo- oder Akinese) 4. Probleme mit der Körperbalance (Haltungs­instabilität) 10 Bewegungsverlangsamungen (Hypo- / Akinese) äußern sich in einem besonders langsamen Gang und Problemen beim Aufstehen oder Hin­setzen und betreffen auch Gesichtsmimik, Sprechweise und feinmotorische Bewegungsabläufe wie beispielsweise das Schreiben. Ruckartiges Erstarren während eines Bewegungsflusses (Stehenbleiben/Innehalten) kann ebenfalls auftreten. Auch die Körperbalance (Halte- und Stellreflexe) gerät bei Parkinsonpatienten aus dem Gleich­ gewicht. Als Folge treten Gangunsicherheiten und Koordi­nationsprobleme auf. Dadurch stolpern die Betroffenen häufiger und sind auch anfälliger für Stürze. Ebenfalls typisch: Die Betroffenen leiden oft auch an vegetativen Störun­gen. Dazu gehören beispielsweise vermehrtes Schwitzen, eine erhöhte Talgproduktion, vermehrter Speichelfluss oder ­Verdauungsstörungen. 11 Krankheitssymptome Krankheitssymptome inne („Freezing“-Phänomen / engl.: to freeze = einfrieren), bevor der nächste Schritt folgt oder die Bewegung fortgeführt wird. Hilfreich: visuelle oder akustische Reize durch spezielle Hilfsmittel. Generell nehmen spontane Begleitbewegungen (z. B. das Armschlenkern beim Gehen) immer mehr ab und die Betroffenen ermüden zusehends bei bestimmten Bewegungsabläufen. Alles kostet mehr Zeit und erfordert viel Geduld. Aktiv bleiben Den Alltag meistern Im Verlauf einer Parkinsonerkrankung treten verschiedene Beschwerden und typische Merkmale auf, die das Alltagsleben der Betroffenen deutlich ­beeinflussen. Spezielle Alltagshilfen (siehe ­Seite 17), liebevolles Verständnis von Angehörigen und Freunden und eine entspannte Zeitplanung helfen den Patienten, besser mit ihrer Situation zurecht­zukommen. Gang, Haltung und Bewegungen Eine Starthemmung beim Gehen und eine un­ sichere, schlurfende Gangweise mit besonders kleinen Schritten gehören zu den typischen Pakinson­symptomen. Oftmals halten die Patienten beim Gehen oder bei anderen Bewegungen kurz 12 Es hat sich gezeigt, dass Physiotherapie und körperliche Aktivitäten helfen, die durch Muskelverspannungen und -steifigkeit hervorgerufene gebeugte Haltung zu verbessern und die Beweglichkeit zu erhalten. Denn zunehmende Bewegungseinschränkungen und die damit verbun­dene motorische Un­ sicherheit erhöhen das ­Sturzrisiko (siehe Kasten). So senken Sie das Sturzrisiko Ein paar einfache Maßnahmen helfen, das Sturzrisiko zu senken und eventuelle Folgen eines Sturzes zu reduzieren: • Wohnung und Umfeld Nichts auf dem Fußboden herumliegen lassen (Stolpergefahr!), nicht über rutschige und nasse Untergründe gehen, Teppiche gut befestigen, für gute Lichtverhältnisse sorgen • Verhalten Nicht im Dunkeln gehen, die Füße beim Gehen abheben und nicht über den Boden schleifen, ruckartige Bewegungen und Drehungen vermeiden • Schutzmaßnahmen Gehhilfen benutzen, Schutzpolster verwenden (Sanitätshaus) 13 Krankheitssymptome Krankheitssymptome Sprache Die verminderte Muskelbeweglichkeit greift auch auf die Sprechmuskulatur über. Parkinsonpatienten sprechen oft undeutlicher und leiser. Derartige Veränderungen entwickeln sich langsam. Empfehlenswert: ein Sprachtraining bei speziellen Therapeuten (Logopäden). Mimik Aufgrund einer Starre der Gesichtsmuskeln reduziert Parkinson auch die Gesichtsmimik. Das hat zur Folge, dass sich Gefühle nicht mehr so gut vom Gesicht ablesen lassen. Parkinsonpatienten sollten ihren Gefühlen daher mit Worten Ausdruck verleihen und regelmäßig Grimassenschneiden vor dem Spiegel üben, um die Gesichtsmuskulatur zu trainieren. Schmerzen Viele Parkinsonpatienten leiden unter Schmerzen – häufig infolge anderer Krankheitssymptome (z. B. Rückenschmerzen durch Haltungsprobleme oder Muskelschmerzen durch Verkrampfungen). Tipp: ein Schmerztagebuch führen (z. B. bei CT Arzneimittel erhältlich) und den Arzt ansprechen. Frei verkäufliche Schmerzmittel sollten keinesfalls über einen längeren Zeitraum auf eigene Faust eingenommen werden. Mehr zum Thema ­enthält die kostenlose Schmerzbroschüre von CT. 14 Depressionen Rund 40 Prozent aller Parkinsonpatienten klagen über Depressionen, die über ein gelegentliches, kleines Stimmungstief hinausgehen, das wohl jeder manchmal erlebt. Eine echte Depression gehört unbedingt in ärztliche Behandlung – Psychotherapie und wirksame Medikamente bringen gute Erfolge. Weitere Informationen dazu liefert die Depressionsbroschüre von CT (Bestelladresse siehe Seite 35). Geistige Veränderungen Morbus Parkinson beeinflusst manchmal auch die geistige Leistungsfähigkeit. Denkprozesse verlaufen dann langsamer und das Gedächtnis funktioniert gelegentlich nicht mehr wie gewohnt. Denksport­ aufgaben und eine generelle Alltagsaktivität mit Hobbys helfen, geistig fit zu bleiben. 15 Krankheitssymptome Krankheitssymptome Besonders günstig für eine geregelte Verdauung: Backobst, Leinsamen, Weizenkleie, frisches Obst und Gemüse ­sowie Vollkornprodukte (Brot, Naturreis, Vollkornnudeln). Sexualität Schlaf Viele Parkinsonpatienten schlafen schlecht. Der Grund: Die eingeschränkte Beweglichkeit verhindert eine erholsame Schlafposition. Manchmal ist auch die Tiefschlafphase durch unwillkürliche Beinbewegungen gestört oder (medikamentenbedingte) Albträume stören die nächtliche Ruhe. All dies ist ein Fall für den behandelnden Arzt, der mit einer Umstellung der Therapie oder Tipps für einen guten Schlaf und notfalls leichten Schlaf­ mitteln Abhilfe schaffen kann. Verdauungsprobleme Verstopfung ist bei Parkinson ein großes Problem, denn die allgemeine Bewegungsverlangsamung ­betrifft auch die Verdauung. Tipp: mindestens zwei Liter täglich trinken (ideal: Mineralwasser oder ­Kräuter- und Früchtetee) und ballaststoffreich essen. 16 Die Parkinsonerkrankung kann auch das sexuelle Empfinden beeinflussen – in die eine oder andere Richtung. Sowohl ein vermindertes sexuelles Inte­ resse als auch eine Verstärkung (als Nebenwirkung der Parkinsonmedikamente) kann auftreten. Nützliche Hilfen für den Alltag Sanitätshäuser bieten viele nützliche Alltagshilfen an, die ­Parkinsonpatienten das Leben leichter machen. • An- und Ausziehen Z. B. verschiedene An- und Auskleidehilfen, wie Knöpfhilfen, Geräte zum Anziehen von Hosen, Socken, Strümpfen und Schuhen • Körperpflege Z. B. Sicherheits- und Haltegriffe/Stützgestelle für alle sanitären Anlagen, Nagelscheren, -feilen und -bürsten mit verdicktem Griff und/oder rutschfester Befestigungsmöglichkeit, gekrümmte Waschhilfe • Haushalt Z. B. Universalhalter, Greifzangen, Schraubverschlussöffner, spezielle Schneidbretter, gewinkelte Messer, speziell geformtes Besteck, unzerbrechliches Spezialgeschirr, Antirutschunter­ lagen, Stifthalter, Blattwender zum Lesen • Liegen, Sitzen, Gehen Z. B. Aufstehhilfen, orthopädisch geformte Sitzschalen, Bettgalgen zum Aufrichten im Bett, rollende Gehhilfe (Rollator), spezielle Sicherheitsfahrräder, „Anti-Freezing-Stock“ als Start­ hilfe nach plötzlichen Bewegungsstopps 17 Diagnostik Diagnostik Über die Symptome zur Diagnose Diagnose Parkinson Im fortgeschrittenen Stadium erkennt der Arzt die Krankheit oft „auf den ersten Blick“. Eine früh­ zeitige Diagnose aber ist schwierig. Denn vor Beginn der typischen Beschwerden lässt sich Morbus Parkinson nicht feststellen. Späte Gewissheit Bis zur definitiven Bestätigung der Diagnose ­gehen daher oft drei bis vier Jahre ins Land. Weil der Zelluntergang im Gehirn über Jahre dahinschleicht und die Symptome unterschiedlich schnell und in verschiedener Reihen­folge auftreten können, kann Morbus Parkinson mit Erkrankungen wie Rheuma oder Depressionen verwechselt werden. Jeder vierte Parkinsonerkrankte erhält zunächst eine falsche Diagnose – aber auch jede vierte Parkinsondiagnose ist falsch. 18 Das A und O ist eine gezielte Befragung des Patienten und seiner Angehörigen durch einen Nervenspezialisten (Neurologen). Mit Bewegungs­ untersuchungen oder Untersuchungen der Muskelspannung kann er eine vorläufige Diagnose stellen. Wahrscheinlich ist die Diagnose bei Vorliegen einer Akinese („Unbeweglichkeit“) und mindestens einer der folgenden Beschwerden: Erhöhung der Muskel­spannung (Rigor), Muskelzittern (Tremor) oder Stand- und Gangunsicherheiten. Ziemlich ­sicher ist die Diagnose, wenn noch mindestens drei ­weitere parkinsontypische Symptome vorliegen. Ein Medikament als Testmittel Bei weniger typischen Beschwerden kann ein so­ genannter L-Dopa-Test weiterhelfen. Dabei erhält der Patient eine Kapsel oder Tablette mit dem Wirkstoff Levo­dopa, abgekürzt L-Dopa. Bessern sich die Symptome danach innerhalb von 30 bis 60 Minuten, spricht dies für eine Parkinsonerkrankung. Bilder bringen Klarheit Zusätzliche Hinweise liefern bildgebende Verfahren, wie die Computertomografie (CT) oder die Magnet­ resonanztomografie (MRT) – auch Kernspintomografie genannt –, mit denen andere Gehirnerkrankungen ausgeschlossen werden können, die gegebenenfalls eine spezielle Therapie erfordern. 19 Diagnostik Selbsttest Parkinson Dieser vom ärztlichen Beirat der Deutschen ­Parkinson Vereinigung e. V. entwickelte Test gibt ­Ihnen eine Hilfestellung zur Parkinsonfrüherkennung. Einen Arztbesuch ersetzt der Test jedoch in keinem Fall! Testen Sie Ihr Risiko 1.Kommt es vor, dass Ihre Hand zittert, obwohl sie entspannt aufliegt? Ja Nein 2.Ist ein Arm angewinkelt und schlenkert beim Gehen nicht mit? Ja Nein Diagnostik Testen Sie Ihr Risiko 7. Haben Sie häufig Schmerzen im Nacken-Schultergürtel-Bereich? Ja Nein 8. Haben Sie bemerkt, dass Sie sich von Ihren Freunden oder Angehörigen zurückziehen, dass Sie Kontakte meiden und zu nichts Lust haben? Ja Nein 9. Haben Sie Veränderungen in Ihrer Stimme bemerkt? Ist sie monotoner und / oder leiser als früher oder hört sie sich heiser an? Ja Nein 10.Haben Sie eine Verkleinerung Ihrer Schrift bemerkt? Ja Nein 3. Haben Sie eine vornübergeneigte Körperhaltung? Ja Nein 11.Haben Sie Ihren Geruchssinn verloren? Ja Nein 4. Haben Sie einen leicht schlurfenden Gang oder ziehen Sie ein Bein nach? Ja Nein 5. Haben Sie einen kleinschrittigen Gang oder kommt es häufiger vor, dass Sie stolpern oder stürzen? Ja Nein 6. Leiden Sie an Antriebs- oder Initiativmangel? 20 Ja Nein Auswertung Bei ein bis zwei Ja-Antworten sollten Sie sich weiter beobachten und bei der nächsten sich ergebenden ­Gelegenheit einmal mit Ihrem Arzt über Ihre gesund­ heitlichen Wahrnehmungen sprechen. Bei mehr als zwei Ja-Antworten suchen Sie bitte ­bald­möglichst einen Arzt auf, um Ihre Probleme abklären zu ­lassen. Quelle: Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. www.parkinson-vereinigung.de 21 Therapie Therapie Präparate mit L-Dopa, einer Vorstufe des Botenstoffs Dopamin, erhöhen die Dopaminmenge im Gehirn und bieten eine wirkungsvolle Therapie. Nachteil: Nach langjähriger Einnahme kann die Wirkung nachlassen. Zu Beginn der Erkrankung kommt L-Dopa daher vor allem bei älteren Patienten zum Einsatz. Dopamin-Agonisten gleichen ebenfalls den Dopaminmangel im Gehirn aus. Dadurch bessern sie ­unter anderem die verlangsamten ­Bewegungen, die Muskelsteifigkeit und das Zittern. Parkinsonbehandung: auf mehreren Ebenen zum Erfolg Der wichtigste Pfeiler der Parkinsonbehandlung ist die medikamentöse Therapie, um die Beschwerden erfolgreich zu mildern. Die Arzneimittel können aber nur bei regelmäßiger Einnahme optimal wirken – ein vom Arzt zusammen­ gestellter Medikamentenplan hilft dabei. Zusätzliche Maßnahmen unterstützen eine wirksame Behand­lung sinnvoll. Arzneimittel als Helfer Mittlerweile stehen Arzneimittel mit verschiedenen Wirkmechanismen zur Verfügung, die das Botenstoff-Durcheinander im Gehirn regulieren und so den Dopaminspiegel erhöhen – also an der Ursache der Beschwerden anpacken. 22 Enzymhemmer blockieren die Wirkung von bestimmten Eiweißstoffen (Enzymen), die den ­Dopaminabbau beschleunigen. Anticholinergika verringern die Wirkung des Botenstoffs Acetylcholin im Gehirn. Parkinsonpatienten haben zu viel davon und leiden dadurch an Bewegungsstörungen. Glutamat-Rezeptor-Antagonisten reduzieren den Einfluss des Botenstoffs Glutamat, der durch den Dopaminmangel im Überfluss vorhanden ist. Nicht immer vermeidbar: Nebenwirkungen Kein Licht ohne Schatten Auch Parkinsonmedikamente können Nebenwirkungen hervor­ rufen. Wenn Sie unerwünschte Begleiterscheinungen durch die Medikamenteneinnahme bei sich vermuten, suchen Sie bitte unverzüglich Ihren behandelnden Arzt auf, um das weitere ­Vorgehen mit ihm zu besprechen. 23 Therapie Neurochirurgie: wenn Medikamente allein nicht reichen Parkinson: gemeinsam für eine erfolgreiche Therapie Die sogenannte Tiefenhirnstimulation steht heute an erster Stelle der neurochirurgischen Eingriffe bei der idiopathischen Parkinsonerkrankung im fortgeschrittenen Erkrankungsstadium mit schweren Symptomen. Auch wenn Medikamente keine ausreichende Besserung bringen, kann solch ein Eingriff sinnvoll sein. Dabei platziert der Neurochirurg Elektroden in bestimmten überaktiven Gehirnarealen. Wie gut eine Behandlung anschlägt, hängt auch davon ab, ob der Patient mitmacht – also ­seine Medi­kamente regelmäßig nimmt und seinen ­Lebenstil auf die Erkrankung abstimmt. Dieses eigen­verantwortliche Engagement heißt in der ­Fachsprache „Compliance“. Eine Vollnarkose ist dabei nicht erforderlich, da der Patient das Vorschieben der Elektroden nicht spürt. Sie geben über eine Art Hirnschritt­macher einen elektrischen Impuls ab und kontrol­lieren so die entsprechende Region im Gehirn, die aus dem Lot geraten ist. Der Impulsgeber wird meist unter dem Schlüsselbein eingepflanzt. Nützliche Begleittherapien Verschiedene nichtmedikamentöse Maßnahmen können die Behand­lung bei Morbus Parkinson wirkungsvoll unterstützen. Sport und Krankengymnastik halten die Beweglichkeit aufrecht und korrigieren sich einschleichende falsche Bewegungsabläufe. In einer Ergotherapie trainieren die Patienten den Umgang mit Gegenständen aus dem Alltag, wie die Handhabung von Besteck oder das Benutzen eines Schlüssels. Außerdem korrigieren die Ergotherapeuten gezielt falsche Bewegungsabläufe, beispiels­ weise beim Basteln oder Spielen. Eine Sprachtherapie beim Logopäden soll Sprache und Artikulationsfähigkeit der Betroffe­ nen verbessern. Sie wirkt vor allem der leiser und undeutlicher werdenden Sprechweise der Patienten entgegen. 24 Compliance-CT® Compliance-Tipps bei der Parkinsonkrankheit • Medikamentenplan vom Arzt mitgeben lassen und in der ­Apotheke nach einer Medikamentenbox fragen, um die regelmäßige Arzneimitteleinnahme zu unterstützen • Lästige, aber leider manchmal unumgängliche Begleit­ erscheinungen der Parkinsonbehandlung, die oftmals die regelmäßige Medikamenten­einnahme beeinträchtigen, ­lassen sich oft auf sanfte Weise lösen: Verstopfung: Viel trinken (2 bis 3 Liter täglich), ballaststoffreich essen (Vollkornprodukte, Obst, Gemüse) Übelkeit: Mehrere kleine, leicht verdauliche Mahlzeiten über den Tag verteilt verzehren Schlafprobleme: Keinen Mittagsschlaf halten, abends noch einmal an die ­frische Luft gehen, schlaffördernde Tees trinken (z. B. mit Baldrian, Hopfen und Melisse) Probleme mit der Sexualität: Das Thema offen mit dem Arzt besprechen und sich ­gegebenenfalls in einer Sexualberatungsstelle oder Selbst­ hilfegruppe Rat holen Wichtig: Niemals ohne Rücksprache mit dem Arzt die v­ erordneten Präparate absetzen oder die Dosis reduzieren! 25 Tipps für den Alltag Tipps für den Alltag ten­nebenwirkungen oder begleitenden Depressionen. Hilfreich: immer einen lecker angerichteten Snack parat halten, der zum Zugreifen animiert. Damit nichts in den „falschen Hals“ gerät Ernährungstipps bei Parkinson Das Thema Ernährung spielt bei ­Parkinsonpatienten eine wichtige Rolle. Viele nehmen ab – oft mehr, als ihnen gut tut. Dahinter stecken häufig ein schlechter Appetit und Probleme beim Schlucken. Wiegen Sie sich daher regelmäßig und gleichen Sie unerwünschte Gewichtsverluste durch einen reichhaltigen, aber dennoch abwechslungsreichen Speise­zettel mit vielen Zwischenmahlzeiten aus. Den Appetit ankurbeln Viele kleine Mahlzeiten wirken auch einem anderen typischen Ernährungsproblem bei Parkinson ent­ gegen: dem Appetitmangel infolge von Medikamen­ 26 Manche Parkinsonpatienten kämpfen mit Schluck­ störungen und neigen dazu, sich dadurch beim Essen und Trinken zu verschlucken. Hier gilt: gut kauen, langsam und konzentriert schlucken, aufrecht ­sitzen und feste Nahrung mit ­Sauce oder Dips vermengen. Richtiges Schlucken lässt sich auch in einer Sprachtherapie einüben. Der richtige Rhythmus: Essen und Medikamente Manche kulinarischen Genüsse beeinflussen die Wirkung von Parkinsonmedikamenten. Lesen Sie daher genau den Beipackzettel durch und fragen Sie Ihren Arzt, worauf Sie beim Essen und Trinken achten müssen und wann Sie Ihre Arzneimittel am besten einnehmen sollten. Eiweißreiche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Meeres­früchte, Eier sowie Milch­produkte und Käse reduzieren beispielsweise die Wirkung von L-DopaPräparaten. Hier gilt: Nehmen Sie diese Medikamente entweder mindestens eine halbe Stunde vor oder aber anderthalb Stunden nach dem Essen ein. 27 Tipps für den Alltag Tipps für den Alltag Haushaltshilfe), Vergünstigungen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie Wohnungshilfen. Wenn Alltagstätigkeiten wie Körperpflege, selbst­ständiges Essen, An- und Auskleiden oder Einkaufen nicht mehr möglich sind, besteht Anspruch auf Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung. Den täglichen Pflege­bedarf prüft in der Regel der Medizinische Dienst der Krankenkassen. Wichtig: Patien­ ten sollten ihren Tagesablauf so schildern, wie er sich tatsächlich gestaltet. Die Betonung der eigenen Selbstständigkeit und Mobilität kann zu einer Fehleinschätzung des Pflegebedarfs führen. Unterstützung per Gesetz Hinters Steuer oder nicht? Führt die Parkinsonerkrankung zu einer ­Behinderung von mindestens 50 Prozent, gilt sie als Schwer­ behinderung. Dann greifen bestimmte Gesetzes­ regelungen, die den Patienten das Leben erleichtern und sie in besonderer Weise schützen sollen. Aufgrund der eingeschränkten Motorik und auch der medikamentösen Behandlung ist im Einzelfall bei Parkinsonpatienten die Fahrtauglichkeit durchaus infrage zu stellen. Ein Gespräch mit dem behandeln­ den Arzt bringt hier Klarheit. Hilfe bei Schwerbehinderung Schwerbehinderung bei Parkinson ist definiert als deutliche Störung der Bewegungsabläufe, Gleich­ gewichtsstörungen, Unsicherheit beim Umdrehen und stärkere Verlangsamung. Den Grad der Behin­ derung stellt das Versorgungsamt fest (Adressen unter www.versorgungsaemter.de). Mit einem Schwer­behindertenausweis haben Sie Anspruch auf verschiedene Leistungen, wie Steuervorteile (z. B. gegebenenfalls Aufwendungen für eine 28 Unterstützung im Job durch das Schwerbehindertengesetz Für das Berufsleben von Schwerbehinderten sieht der Gesetz­ geber einen besonderen Schutz vor: • Keine Mehrarbeit Schwerbehinderte Beschäftigte müssen auf ihren Antrag hin von Mehrarbeit freigestellt werden. • Mehr Urlaub Nach Vorlage des Schwerbehindertenausweises gibt es eine Woche Zusatzurlaub pro Jahr. • Erschwerte Kündigung Der Arbeitgeber darf einem schwerbehinderten Mitarbeiter nur mit ­Zustimmung der Hauptfürsorgestelle kündigen. 29 Tipps für den Alltag Tipps für den Alltag Vorbereitungen für einen Ausflug oder andere ­Aktivitäten sollten daher rechtzeitig beginnen. Wichtig: gelassen bleiben, wenn mal etwas länger dauert, und den Betroffenen ermutigen, Aufgaben selbst zu bewältigen. Darüber reden Hinweise für Angehörige von Parkinsonpatienten Parkinson macht auch Angehörige zu Leidtragen­den, denn die Erkrankung verlangt ihnen ebenfalls viel ab: psychische Unterstützung wie Trösten, Mut­machen und Hilfe beim Überwinden von emotio­nalen oder körperlichen „Einbrüchen“ der Befind­lichkeit sowie die tägliche Pflege. Das ist nicht immer leicht, zumal Parkinsonkranke ihr ­Leiden oft verleugnen und sich in ihr „Schneckenhaus“ zurückziehen. Gespräche mit dem behandelnden Arzt, Psychologen, Psychotherapeuten oder mit Leidensgefährten in einer Selbsthilfegruppe für Angehörige ­(Adressen Seite 33) erleichtern den Umgang mit Sorgen, Ängsten und Gefühlen. Einige Grundregeln für den Umgang mit Parkinsonpatienten können ebenfalls helfen: • Sich immer in die Lage des anderen versetzen • Versuchen, sein Denken, Handeln und Fühlen zu verstehen • Miteinander reden, um beiderseitige Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und gemeinsame Entscheidungen treffen zu können Wichtige Strategien für Angehörige Eine Frage der Geduld Viele Angehörige fühlen sich hilflos und reagieren mit Ungeduld und Unverständnis auf das Verhalten und die Bedürfnisse des Erkrankten. Vieles geht langsamer als vorher. Dennoch sollten sie dem Betroffenen nicht alles abnehmen und ihm Zeit lassen. Denn Stress kann die Symptome verstärken. 30 • Suchen Sie sich Unterstützung bei anderen Angehörigen oder Freunden und nehmen Sie angebotene Hilfe an. • Bestimmen Sie Ihr Leben – die Krankheit eines geliebten ­Menschen darf nicht ständiger Mittelpunkt sein. • Nehmen Sie sich Auszeiten und tun Sie sich etwas Gutes. • Informieren Sie sich über den Zustand des Erkrankten – Wissen ermöglicht effektive Hilfe. 31 Tipps für den Alltag Tipps für den Alltag Hilfreiche Adressen und Buchtipps Deutsche Parkinson Vereinigung e. V. – Bundesverband Moselstraße 31 41464 Neuss Telefon: 02131 - 74 02 70 (Mo – Fr von 8 – 14 Uhr) E-Mail: [email protected] Internet: www.parkinson-vereinigung.de Ein Service der Deutschen Parkinson Vereinigung e. V.: PIT – Das Parkinson-Info-Telefon: 01805 - 19 19 09 Selbsthilfegruppen: alle im gleichen Boot Viele Parkinsonpatienten schämen sich ihrer Erkrankung und reden am liebsten gar nicht darüber. Ein Austausch mit Leidensgefährten, zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe, kann sehr nützlich sein, um mit der Erkrankung leben zu lernen. Auf viele Fragen, die den Betroffenen auf der Seele liegen, gibt es dort eine Antwort. Mit neuem Mut durch den Alltag Die Arbeit in der Gruppe hilft auch dabei, Strategien für den Alltag zu entwickeln. Zugleich kommen Parkinsonkranke aus ihrer Isolation heraus, in die sie sich häufig zurückziehen. Für viele ist so eine Gruppe auch ein Ventil – dort weiß jeder, was es heißt, an Parkinson erkrankt zu sein. Das macht es sehr viel leichter, offen mit der Krankheit umzugehen. 32 Kompetenznetz Parkinson Netzwerksekretariat / Klinik für Neurologie Rudolf-Bultmann-Straße 8 35039 Marburg Telefon: 06421 -5 86 52 72 E-Mail: [email protected] Internet: www.kompetenznetz-parkinson.de Bundesbeauftragte für Angehörigenarbeit Anne-Kathrin Scharfe Sarrazinstraße 18 12159 Berlin Telefon: 030 - 8 52 02 85, ab ca. 14 Uhr E-Mail: [email protected] Buchtipps: Sabine George et al.: Was tun bei Parkinson ? Ein Ratgeber für Betroffene und Angehörige Schutz-Kirchner 2007 (8,40 Euro) Evelyn Ludwig und Renate Annecke: Der große TRIAS-Ratgeber Parkinson-Krankheit. Alles über Ursachen und Behandlung. Aktiv bleiben im Alltag Mit vielen Sprech- und Bewegungsübungen für zu Hause Trias 2007 (24,95 Euro) Reiner Thümler: Die Parkinson-Krankheit. Diagnose, Verläufe und neue Therapien Hilfreiche Antworten auf die 172 häufigsten Fragen Trias 2006 (19,95 Euro) 33 CT Arzneimittel CT Arzneimittel Compliance-CT® – ein Name, viel Service Neben der Herstellung und dem Vertrieb qualitativ hochwertiger und gleichzeitig günstiger Medikamente hat es sich CT Arzneimittel zur Aufgabe gemacht, Patien­ten, Ärzte und Apotheker mit kompetenten und wertvollen Informationen zu den verschiedensten Krankheitsbildern und deren Behandlungsmöglichkeiten zu unterstützen. CT Arzneimittel: Gesundheit gut und günstig Ein Spezialist unter den Generikaherstellern ist das Berliner Traditionsunternehmen CT Arzneimittel. 1917 gründeten ein Apotheker und ein Kaufmann eine Arzneimittelgroßhandlung mit dem Ziel, die Bevölkerung schnell, effizient und umfassend mit Medikamenten zu versorgen. Rasch folgte die eigene Arzneimittelproduktion. Von Anfang an mit dabei: der beliebte Tussamag® Hustensaft. Seit 25 Jahren hat sich CT Arzneimittel auf die Her­ stellung von ­Generika spezialisiert. Die Philosophie: erstklassige Qualität zu günstigen Preisen. So will CT Arzneimittel dazu beitragen, die Sicherheit bei der Anwendung von Medikamenten zu erhöhen und den Therapieerfolg zu verbessern. Im Rahmen des Serviceangebotes Compliance-CT® können Sie verschiedene Informationsbroschüren ­sowie praktische Therapiehilfen kostenlos bestellen. CT Arzneimittel GmbH Lengeder Straße 42 a, 13407 Berlin Fax: 0800 - 409 00 80-1010 E-Mail: [email protected] Einen Überblick über das Serviceangebot erhalten Sie auf www.compliance-ct.de Dass CT in puncto Qualität und Sicherheit ganz weit vorn liegt, beweist auch die freiwillige Zertifizierung nach der internationalen Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001:2000 – im Sinne einer optimalen Kundenorientierung. 34 35 www.ct-arzneimittel.de Soziales Engagement der CT Arzneimittel GmbH Wer sich für traumatisierte Opfer einsetzt, steht vor besonderen Herausforderungen – ganz gleich, ob häusliche Gewalt, eine andere Gewalttat oder eine Katastrophe das Trauma ausgelöst hat. Viele Ärzte und auch Apotheker in Deutschland stoßen bei ihren Bemühungen zu helfen an ihre Grenzen. CT Arzneimittel engagiert sich daher seit 2004 für die Catania gemeinnützige GmbH, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Versorgung und Betreuung traumatisierter Opfer zu verbessern. Jeder Kauf eines Präparates von CT Arzneimittel unterstützt dieses Engagement. SAP 134962 | Stand 09/09 CT Arzneimittel GmbH Lengeder Straße 42 a 13407 Berlin [email protected] www.ct-arzneimittel.de Gesundheit gut und günstig