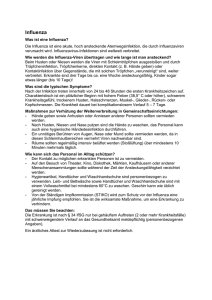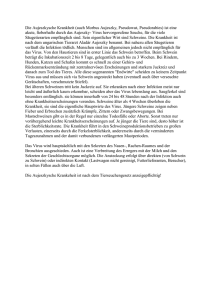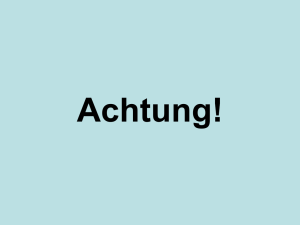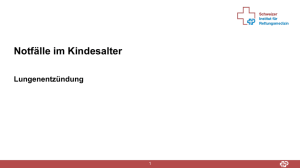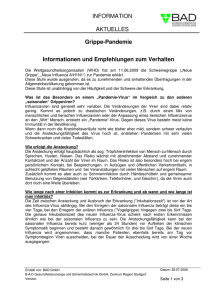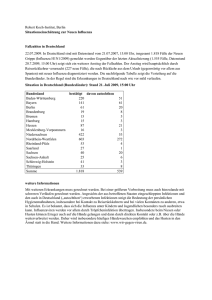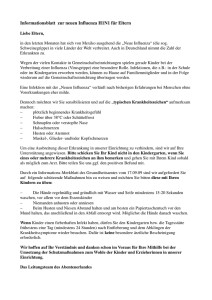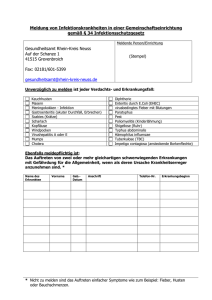Das neue Gesicht der Influenza
Werbung

Tiergesundheit Husten Das neue Gesicht der Influenza Aborte Akute Influenza-Schübe mit hohem Fieber treten immer seltener auf. Die Infektion verläuft heute eher schleichend. Wie man sie erkennt und behandelt, erläutert Diplom-Veterinär Jürgen Grohme aus Marne. D Lungenschäden ie Probleme begannen damit, dass einzelne Sauen verferkelten, quer durch alle Trächtigkeitsstadien. Die Tiere hatten zwar erhöhte Temperatur, aber kein starkes Fieber. Hin und wieder hörte Ferkelerzeuger Kai Petersen* auch mal die eine oder andere Sau husten. Und im Abferkelstall wurden vermehrt lebensschwache Ferkel geboren. Für das Verferkeln könnten Leptospiren oder Chlamydien verantwortlich sein. Darin waren sich Petersen und sein Hoftierarzt einig. PRRS hingegen schlossen sie als Ursache aus, da die Herde seit Jahren regelmäßig geimpft wird. Außerdem lösen PRRS-Viren vermehrt Spätaborte aus. Bei Petersen traten die Aborte aber in allen Trächtigkeitsstadien auf. Um die Ursache der Fruchtbarkeitsprobleme abzuklären, zog der Tierarzt Blutproben und ließ sie im Labor untersuchen, zweimal bei jeweils den gleichen Tieren im Abstand von drei Wochen. Ergebnis: Weder Chlamydien noch Leptospiren bereiteten im Bestand Probleme, sondern eine Infektion mit Influenzaviren vom Typ H1 N2. Sie waren Auslöser der für eine Influenza-Infektion nicht gerade typischen Symptome. Tatsache ist, dass sich das früher für Influenza-Infektionen typische Krankheitsbild heute immer seltener in Schweinebeständen beobachten *) Name geändert S 10 top agrar 2/2011 lässt. Plötzlich auftretende akute Hustenschübe, verbunden mit hohem Fieber von 41 bis 42 °C, ­schmerzhaftem Husten und Atemnot sind heute eher die Ausnahme als die Regel. Typisch untypischer Krankheitsverlauf In den meisten Fällen erkranken die betroffenen Bestände nicht mehr schlagartig. Es sind vielmehr einzelne Tier- und Altersgruppen betroffen. Und der Krankheitsverlauf ist insgesamt milder. Husten und Fieber kann man oft nur bei bestimmten Gruppen oder bei Einzeltieren feststellen, die über den gesamten Bestand verteilt sind. Die Erkrankung breitet sich später dann schleppend von Tiergruppe zu Tiergruppe aus. In der Mast kommt es infolge der Infektion zu erhöhten Verlusten durch Erkrankungen, die bislang im Bestand keine größere Rolle spielten z. B. Colienterotoxämie, APP, Gelenkerkrankungen und Streptokokken. Die beschriebenen Symptome können dabei einzeln aber auch in Kombination auftreten. In Sauenherden gibt es als Folge der Influenza-Infektion vermehrt MMA-Probleme, verbunden mit anschließenden Saugferkeldurchfällen. Häufig klagen die Sauenhalter über erhöhte Umrauschquoten bei den Sauen. Es werden kleine Würfe bzw. mehr lebensschwache Ferkel geboren, und die lebend geborenen Saugferkel kümmern oftmals. Der Antikörper-Nachweis über gepaarte Serumproben liefert die sichersten Ergebnisse. Bestände durchseuchen unvollständig Auslöser für das neue Erscheinungsbild der Influenza ist ein nahezu chronischer Krankheitsverlauf. Die Bestände durchseuchen oftmals nur noch verzögert. Und deshalb kann sich auch die Immunität nur lückenhaft ausbilden. Im Gegensatz zum klassischen Krankheitsverlauf kommt es nicht mehr zu einer „Selbstheilung“ des Bestandes. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt dabei die Remontierung des Sauenbestandes. Denn durch das laufende Nachstallen bisher nicht infizierter Jungsauen trifft das Virus immer wieder auf empfängliche Tiergruppen, wenn keine ausreichend lange (sechs Wochen) Quarantäne vorgeschaltet wird. So wird der Infektionsdruck im Bestand mal mehr und mal weniger stark, aber stetig aufrechterhalten. Eine ähnliche Rolle im Infektionsgeschehen kann auch das Flatdeck spielen. Denn nach dem Absetzen und dem Umstallen in den Aufzuchtstall bauen sich bei den Ferkeln die maternalen Antikörper im Blut allmählich ab. Dadurch werden sie für eine Influenza-Infektion wieder voll empfänglich. Unter ungünstigen Voraussetzungen besteht so ständig die Gefahr einer Viruseinschleppung in die Sauenherde. Deshalb ist es wichtig, den Abferkelbereich und die Ferkelaufzucht räumlich zu tren- nen und beim Stallwechsel zumindest die Kleidung zu wechseln! Serum-Paarproben untersuchen lassen! Die genaue Ursache der Produktionsstörung lässt sich meist erst durch eine gezielte Diagnostik klären. In manchen Fällen gelingt es, das Virus mithilfe der PCR (Polymerase-Ketten-Reaktion) in Nasentupfer- oder Lungenspülproben nachzuweisen. Bei diesem Verfahren werden bestimmte Genabschnitte des Influenza A-Virus molekularbiologisch nach- So sieht der klassische Verlauf aus Die Schweineinfluenza ist eine hoch ansteckende Erkrankung der Atmungsorgane. Das Virus wird durch Husten, Niesen und Nasenausfluss von den erkrankten Tiere ausgeschieden und über Tierkontakt, die Luft oder über Zwischenträger wie Personal und Geräte von Tier zu Tier bzw. von Bestand zu Bestand übertragen. Die seuchenhafte Ausbreitung wird durch starke Temperaturschwankungen, saisonbedingte Erkältungen sowie eine hohe Tierdichte zusätzlich begünstigt. Das Virus befällt, nachdem es die schützende Schleimschicht überwunden hat, im Atmungstrakt das Epithel der Luftröhre und der Bronchien. Hier kommt es zu einer massiven Virusvermehrung, verbunden mit einer Zerstörung der obersten Zellschicht und einer Schädigung des lokalen Abwehrsystems der Lunge. Die sich dabei bildenden Zelltrümmer bilden einen hervorragenden Nährboden für bakterielle Begleitkeime, der sehr zähflüssig ist und die kleinen Bronchien verstopft. Aus der anfänglichen Infektion der Bronchien entwickelt sich innerhalb weniger Stunden mit der Ausbreitung des Virus im Lungenstützgewebe eine schwere Bronchitis mit einer so genanten interstitiellen Pneumonie. gewiesen. Oder aber das Virus wird aus Zellproben angezüchtet, die aus der Lunge toter Schweine gewonnen wurden. Eine höhere diagnostische Trefferquote hat man allerdings beim Antikörpernachweis im Blut. Die zuverlässigsten Ergebnisse bekommt man dabei, wenn man Serumpaare untersuchen lässt. Dazu ist es erforderlich, die gleichen akut erkrankten Sauen zweimal im Abstand von drei Wochen zu beproben. Ein Anstieg des Serumtiters um das Vierfache oder mehr gilt dabei als sicherer Nachweis einer Influenza-Infektion. Bei beiden Untersuchungsmethoden lässt sich genau differenzieren, welche Subtypen des Influenza A-Virus an der Infektion beteiligt sind. Das ist notwendig, um sich im Fall einer Impfung für den passenden Impfstoff entscheiden zu können, der auch die jeweiligen Subtypen abdeckt. Unsere Erfahrung dazu: In Betrieben mit atypischem Influenza-Verlauf lässt sich fast immer auch der Subtyp H1 N2 nachweisen. Mal ist der neue Subtyp H1 N2 allein der Auslöser, oftmals lässt er sich aber auch in Kombination mit H1 N1 und/oder H3 N2 nachweisen. Schnelle Behandlung notwendig Als Sofortmaßnahme sollte bei einer Influenza-Infektion die Stalltemperatur angehoben, ausreichend Wasser angeboten und die Frischluftzufuhr erhöht werden, ohne dass dadurch Zugluft entsteht. Zudem empfiehlt es sich, den Tieren un- top agrar 2/2011 S 11 Tiergesundheit nötigen Stress zu ersparen, z. B. durch Umtreiben oder Umgruppieren. Hochgradig erkrankte Tiere sollten darüber hinaus per Injektion mit Fieber senkenden Entzündungshemmern behandelt werden. Dafür eignen sich z. B. Metamizol-Natrium oder Flunixin-Meglumin. Wenn es möglich ist, können die Fieber senkenden Wirkstoffe (z. B. Acetylsalicylsäure oder Ketoprofen) auch über die Tränke verabreicht werden. Eine antibiotische Behandlung macht wie bei allen Viruserkrankungen nur Sinn, wenn sich bakterielle Begleitinfektionen nachweisen lassen. Das ist in der Praxis sehr häufig der Fall. Allein aus Tierschutzgründen und zur Schadensminimierung wird daher bei den meisten Influenza-Infektionen begleitend antibiotisch behandelt. Vor Behandlungsbeginn sollte jedoch unbedingt ein Resistenztest durchgeführt werden. Die wichtigste und effektivste Maßnahme, um den Bestand vor der Einschleppung bzw. Verbreitung des Virus zu schützen, ist die Influenza-Impfung. In Herden mit atypischem Verlauf gelingt die Unterbrechung der Infektionskette in der Regel aber nur, wenn man das Impfprogramm erstens ganz gezielt auf die Gegebenheiten des Bestandes abstimmt und dieses Programm zweitens dann auch ganz konsequent durchzieht. Den besten Schutz vor InfluenzaInfektionen bietet die Impfung. Fotos: Einhoff, Gass-Cofré (1), Heil (1), IDT (1), Nienhoff (2) Wochen. Die Wiederholungsimpfungen werden dann alle 4 bis 6 Monate empfohlen. Entscheidend für den Erfolg der Impfung ist, dass die Impfdecke im Bestand immer geschlossen bleibt! Auch die Eber dürfen nicht vergessen werden. Wir fassen zusammen Die in Deutschland bereits seit Jahren für Schweine zugelassenen Impfstoffe enthalten die Subtypen H1 N1 und H3 N2. Darüber hinaus bietet IDT mit seinem neuen Impfstoff „Respiporc Flu 3“ als einziger Impfstoffhersteller zusätzlichen Schutz gegen den neuen Subtyp H1 N2. Die Grundimmunisierung erfolgt durch zwei aufeinanderfolgende Impfungen der Sauen im Abstand von 3 bis 4 Das Erscheinungsbild der Influenza hat sich gewandelt. Akute Ausbrüche mit einer nahezu 100 %-igen Erkrankungsrate, hohem Fieber, schmerzhaftem Husten, Atemnot und Fressunlust beobachtet man immer seltener. Stattdessen erkranken meistens nur noch einzelne Tier- bzw. Altersgruppen mit geringfügigem Husten und mäßigem Fieber. In Sauenherden erhöht sich die Zahl der Aborte, es gibt vermehrt MMA-Probleme und kümmernde Ferkel. In der Ferkelaufzucht und in der Mast kann die Influenza-Infektion zu Husten und vermindertem Wachstum führen. Als Sofortmaßnahme können Fiebersenker und Antibiotika gegen bakterielle Begleiterkrankungen verabreicht werden. Die wichtigste vorbeugende Maßnahme ist die Schutzimpfung. Schwein als Bio-Reagenzglas Vorsicht in der nasskalten Jahreszeit: Das Virus kann auch vom Menschen auf das Schwein und umgekehrt übertragen werden! S 12 top agrar 2/2011 Infektionen mit dem Influenza A-Virus kommen bei Mensch, Pferd, Schwein und Geflügel vor. Sie erfolgen zumeist innerhalb einer Art, d. h. von Mensch zu Mensch mit humanen, von Schwein zu Schwein mit porcinen und von Vogel zu Vogel mit aviären Influenzaviren. Schweine können sich zudem mit menschlichen und aviären Influenzaviren infizieren, da das Schwein als einziges Tier Rezeptoren für alle Influenza-Typen in sich trägt. Und es können Infektionen vom Schwein auf den Menschen übertragen werden. Das Influenzavirus wird je nach Proteinzusammensetzung in die Typen A, B und C eingeteilt. Die Erreger der Schweine-Influenza gehören zum Serotyp A. Auf der Virushülle befinden sich die ProteinAntigene Neuramidase (N) und Hämagglutinin (H). Derzeit sind 15 H- und 9 N- Antigene bekannt. Aus der Kombination von H- und N-Antigenen resultieren die verschiedenen Subtypen wie z. B. H1 N1, H3 N2 und H1 N2. Durch punktuelle Mutationen beim Hämagglutinin entstehen immer wieder neue Subtypen. Durch diesen Vorgang, den man als Antigendrift bezeichnet, schützt sich das Virus vor dem Immunsystem des Wirtes. Darüber hinaus gibt es plötzlich auftretende Veränderungen des Virus mit meist erheblichen antigenen Veränderungen, die man als Antigenshift bezeichnet. Infiziert sich ein Schwein gleichzeitig mit zwei unterschiedlichen Virustypen, z. B. mit einem humanen und einem porcinen Influenzavirus, kann es zum Austausch von Gensegmenten und zum Entstehen ganz neuer Subtypen kommen.