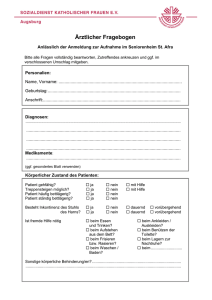Maximilian Gottschlich IM ANFANG IST DAS WORT. ÜBER DIE
Werbung

Maximilian Gottschlich IM ANFANG IST DAS WORT. ÜBER DIE HEILSAME KRAFT ÄRZTLICHER KOMMUNIKATION Vortrag gehalten am Kongress für Komplementärmedizin und Krebserkrankungen Meran 11.Sept.2008 Vor wenigen Tagen erregte eine Patientenanwaltschaft die Öffentlichkeit: Mitteilung der österreichischen Immer mehr Patienten sind in Österreich mit der medizinischen Behandlung in Spitälern und Ordinationen unzufrieden. 9.400 Beschwerden gab es im Jahr 2007 – um 10% mehr als noch im Jahr davor. „Und“, so kommentiert der Sprecher der österr. Patientanwälte, „die Dunkelziffer dürfte noch zehnmal höher sein.“ Zwei Drittel der Beschwerden erfolgte zu Recht. Dabei geht es nicht nur um eklatante Behandlungsfehler: „Die meisten Patienten beschweren sich, weil sie sich von Ärzten oder Spitälern schlecht informiert und nicht ernst genommen fühlen.“ Österreichs Patienten machen da im europäischen Vergleich keine Ausnahme: Eine groß angelegte repräsentative Studie aus dem Jahr 2003, bei der Patienten in acht europäischen Ländern über ihre Einstellungen und Erwartungen befragt wurden – darunter auch Patienten aus Italien, Deutschland und der Schweiz macht deutlich: Europas Patienten fühlen sich nicht gut genug über Diagnosemöglichkeiten und Therapieverfahren informiert, wünschen sich bessere Kommunikation mit dem Arzt und erwarten in allen untersuchten Ländern ein hohes Maß an Mitwirkung bei den Entscheidungen über ihre Behandlung. Aber diese Erwartungen werden vielfach enttäuscht. Solche und ähnliche Ergebnisse bestätigen einen Trend, der sich schon Ende der 1990er Jahre aus österreichischen Daten ablesen ließ: Mehr als ein Drittel der damals repräsentativ befragten Österreicher glaubten, dass sich Ärzte nicht genügend Zeit für Patienten nehmen. 1 Schwerer noch als der beklagte ärztliche Zeitmangel wog der Mangel an Interesse an den Problemen der Patienten. Dieses Gefühl, dass Ärzte nicht wirklich an den Problemen ihrer Patienten interessiert sind, hatte damals schon jeder fünfte Österreicher (21 %). Fast ein Viertel war sich nicht sicher, ob man Ärzten trauen soll oder nicht. 44 % der Befragten waren der Meinung, dass der kranke Mensch etwa im Spital dem System gegenüber ausgeliefert sei und auf die Behandlung keinen Einfluss nehmen könne. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang noch gut an eine Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung 1999 über eine alarmierende Studie, die am Klinikum Nürnberg durchgeführt wurde: „Vier Minuten und 36 Sekunden für die Diagnose: Kebs – Wenn man damit nicht auskommt ist man ineffizient.“ In der onkologischen Abreilung haben – so ergab diese Studie Ärzte knapp mehr als vier Minuten Gesprächszeit für einen Patienten und eine zusätzliche Minute für die Angehörigen. Einer der betroffenen Ärzte wird so zitiert: „Die Medizin wird reduziert auf ökonomisch gut handhabbare Maßnahmen. Damit geht die Berücksichtigung der Dimension des Leidens verloren. Sorge, Zuwendung – das alles bleibt völlig draußen…“ Und der mittlerweile verstorbene Klinikchef der Nürnberger Onkologie, Walter Gallmeier, der die Studie in Auftrag gab, ergänzte: „Die Qualitätssicherung ist eine Farce, sie ist allenfalls eine Dokumentation und führt zu schlechteren als besseren Ergebnissen.“ Vor allem aber gelte die Qualitätssicherung nur der naturwissenschaftlichen Medizin. „Die Medizin aber hat“, so rief Gallmeier damals schon in Erinnerung, „zwei (!) wichtige Säulen, die naturwissenschaftliche und die Beziehungsmedizin.“ 2 Die „Beziehungsmedizin“ gibt es nicht mehr – sie ist längst der Herrschaft ökonomischer Rationalität, dem Prinzip der Effizienzmaximierung im Medizinsystem zum Opfer gefallen. Zum Schaden der Patienten, weil auf ihre emotionalen und seelischen Bedürfnisse keine Rücksicht genommen wird und sie im Zustand sozialer und kommunikativer Isolation um die Chance positiver Sinnerfahrung ihres Leidens gebracht werden; zum Schaden aber auch der Ärzte, die in der wachsenden Distanz zu ihren Patienten, ihrersiets um die Chance positiver Sinnerfahrung ihres ärztlichen Tuns gebracht werden. Sämtliche internationalen Untersuchungen zur Kommunikationspraxis in Ordinationen und Spitälern machen deutlich: 1. Der Wunsch der Patienten nach einem Maximum an Information ist wesentlich größer als die Informationsbereitschaft der Ärzt; 2. Patienten erwarten aber nicht nur ein Höchstmaß an Informationen über Krankheitszustand, Diagnose und Therapieverfahren, sondern sie verlangen auch und vor allem nach emotionaler Zuwendung; 3. diese emotionale Zuwendung wird ihnen aber häufig verwehrt und dies wirkt sich nachweisbar negativ auf den Krankheitsverlauf und den Heilungserfolg aus. Eine jüngere Studie über Quantität und Qalität der Informationsversorgung holländischer Patienten im Krankenhaus – es handeltes sich dabei um Lungenkrebspatienten – zeigt: Die Menschen bewegen midestens genausoviele Fragen nicht-medizinischer Art, wie unmittelbar medizinische Fragen etwa im Zusammenhang mit dem Therapieverlauf. Darüber hinaus wird in dieser Studie deutlich: 3 Die Fragen und Probleme, die Patienten im Spital bewegen, hängen zum überwiegenden Teil mit ihrer Gefühlsverfassung zusammen – mit den Gefühlen, die mit Diagnose und Therapie verbunden sind. Zugleich aber zeigt sich auch: Ärzte sind zwar bereit auf medizinische Fragen zu reagieren – wenn diese Fragen seitens der Patienten auch gestellt werden; Ärzte sind aber nicht gewohnt, erstens von sich selbst aus, also ungefragt, ausreichend verstehbare Antworten zu geben, und zweitens mit den gesamten psychsichen und sozial – psychischen Begleiterscheinungen eines Krankheitsverlaufs zurecht zu kommen. Die Befunde signalisieren: Das empathische, mitfühlende Kommunikationsvermögen von Ärzten ist äußerst limitiert – um es vornehm auszudrücken… Solche und ähnliche Ergebnisse sind ein unüberhörbares Alarmsignal: Unser modernes, technisch hochgerüstetes, arbeitsteilig organisieretes und weithin anonym agierendes Gesundheitssystem ist krank – nicht weil es unfinanzierbar geworden ist – dieses Gesundheistssystem ist krank, weil es eine krankmachende unpersönliche Kommunikationsstruktur aufweist. Wir haben es mit einem „malignem“, weithin kommunikationsgestörten Medizinsystem zu tun, in dem der stumme Schrei der Patienten nach Zuwendung ungehört verhallt und sich hinter der Fassade von „Sachlichkeit“ und „Objektivität“ sich nichts anderes verbirgt als berufsbedingte Gefühllosigkeit. Mitten in der Welt des Lärmes breitet sich um die Kranken ein unheimliches Schweigen aus. Die Krankheit kam und ihr folgte das Schweigen – kein gesundes Schweigen des Innehaltens und Erneuerns, sondern ein lähmendes Schweigen, in dem die Gedanken und Gefühsregungen des Patienten mit jedem Tag mehr erstarren. So macht eine stumme Medizin den leidenden Menschen zum Objekt, zum austauschbaren medizinischen Fall über den man verfügen 4 kann – sie nimmt ihm mit jedem Wort, das nicht gesprochen wird, ein Stück seiner Individualität und Identität als leidendes Subjekt. Die große Philosophin und Menschenfreundin Simone Weil hat einmal geschrieben: „Wer leidet, sucht sein Leid anderen mitzuteilen ... um es so zu vermindern und derart vermindert er es in der Tat… wer es nicht mitteilen kann, bei dem bleibt das Leid in ihm und vergiftet ihn.“ Darin steckt der gesamte therapeutische Anspruch an Kommunikation. Kommunikation schafft das Leid nicht aus der Welt – aber Kommunikation – empathische, also mitfühlende Kommunikation vermag Leid zu verwandeln, zu transformieren…. Kommunikation ist wesentlich mehr als bloß ein Medium der Information und interessensgesteuerten Verständigung – Kommunikation ist auf existenzieller Ebene Begegnung, in der sich der eine dem anderen öffnen kann und isoferne dies gelingt hat Kommunikation, hat das Wort heilstiftendes Potenzial… Sowohl die Psychoanalyse als auch die verschiedenen Psychotherapien schöpfen seit jeher aus diesem heilstiftenden Potenzial des Gesprächs, des Wortes. So schreibt Sigmund Freud in seiner Schrift „Zur Laienanalyse“ von 1926 über das analytische Gespräch: „Es geht nichts anderes zwischen ihnen vor, als dass sie miteinander reden…Worte können unsagbar wohl tun und fürchterliche Verletzungen zufügen“. Das gilt nicht nur für den besonderen Anwendungsfall des analytischen Gesprächs, das gilt für jede Begegnung zwischen Arzt und Patient – genaugenommen gilt das für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen insgesamt. Noch deutlicher formuliert es die amerikanische Onkologin Rachel 5 Naomi Remen mit Blick auf ihre Erfahrungen bei der Betreuung von Krebspatienten. „Jeder von uns“ sagt sie, „ ist verwundet, und jeder von uns verfügt über Heilkräfte. Ich heile dich und du heilst mich…mehrmals täglich vertauschen wir vielleicht diese Positionen. Es geht dabei nicht um Fachkenntnis, sondern um etwas viel Natürlicheres. Wir alle sind verwundete Heiler.“ Jede kommunikative Begegnung, in der die Partner einander von Existenz zu Existenz begegnen, ist unverzichtbarer Teil des Heilprozesses. Heilen ist, genauso wie Kommunikation, ein auf Gegenseitigkeit, auf gegenseitigem Engagement am Anderen beruhender Prozess. „Deshalb“ so beschreibt Rachel Remen diesen Vorgang wechselseitiger heilsamer Beeinflussung in der kommunikativen Beziehung, „deshalb werden wir beide bei diesem Prozess geheilt. Ich wurde durch jede Therapiewoche geheilt, und so erging es auch den übrigen Therapeuten.“ Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Medizin der Zukunft wird eine kommunikative Medizin sein oder sie wird die Menschen verlieren, für die sie eigentlich da ist. Worin besteht eine solche „kommunikative Medizin“? Grundlage einer kommunikativen Medizin ist das Mitgefühl. Ohne Mitgefühl kann es zwar eine effizienzorientierte Gesundheitsindustrie und medizinische Spitzenforschung, nicht jedoch eine Kultur des Heilens geben. Kommunikative Medizin ist mitfühlende Medizin – also eine Medizin, die besondere Sensibilität für die seelischen und emotionalen Bedürfnisse der Menschen entwickelt. 6 Was das bedeutet möchte ich mit wenigen Überlegungen skizzieren: Eine kommunikative Medizin begnügt sich nicht damit, Informationsströme in Richtung des Patienten freizusetzen, ihn das medizinisch Relevante in komprimierter Form und unterschriftsreif wissen zu lassen, um damit der rechtlichen Verpflichtung zur Aufklärung Genüge zu tun. Medizinische Aufklärung sollte heute eine Selbstverständlichkeit sein, die keiner weiteren Begründung bedarf, obwohl sie in der Praxis schlecht genug funktioniert. Die Verantwortung und Chance einer kommunikativen Medizin liegt vielmehr darin, den psychosozialen Begleiterscheinungen eines Krankheitsverlaufs zum Ausdruck zu verhelfen, also Leid beredt werden zu lassen, wie dies Adorno einmal ausgedrückt hat. Adorno sagte nämlich: „Das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit“ Leid muss sich also mitteilen können um der Wahrheit des Krankseins begegnen zu können… Das ist nicht nur ein philosophischer Anspruch – das ist ein durchaus greifbarer medizinisch therapeutischer Anspruch: Weil sich nur darin, im Mitteilen des Leidens und im empathischen Anteilnehemen am Leiden des Anderen imunrelevantes Stressgeschehen minimieren läßt… Der Mensch ist ein hochdifferenziertes und ungemein empfindlich reagierendes kommunikatives Netzwerk, in dem Körper und Geist in permanetem wechselseitigen Austauschprozess stehen. Heute wissen wir, dass Körper und Geist – Soma und Psyche – eng zusammengehören, ja eine untrennbare Ganzheit darstellen, und dass die alte cartesianische Trennung zwischen subjektivem Bewußtsein und objektiver Wirklichkeit, zwischen Geist und Materie längst obsolet geworden ist. 7 Folgt man den Ergebnissen der noch recht jungen Fachdisziplin der PsychoNeuro-Immunologie wird deutlich, dass der Anspruch ganzheitlichen Denkens und Handelns in der Medizin nicht mehr länger als verzichtbare Illusion medizinischer Scharlatane abgetan werden kann. Vielmehr machen die Einsichten der Psycho-Neuro-Immunologie ganz deutlich: psychische Zustände, wie Stress, Trauer, Einsamkeit, Enttäuschungen, seelische Spannungen und Depressionen schwächen die körpereigenen Abwehrkräfte, während Freude, Zufriedenheit, Entspannung, das Gefühl der Sinnerfüllung eigenen Tuns, das Gefühl aber auch geliebt und geachtet zu werden, diese Abwehrkräfte stärken. Man könnte sagen: Kommunikation ist gleichsam der emotionale und seelische „Treibsatz“ für die Aktivierung der T-Lymphozyten und der Antigene… Darin liegt die physiologische Bedeutung empathischer Kommunikation und darin entfaltet sie auch ihre sanative Wirkkraft. Die vielfach bemühte „Patientenzufriedenheit“ hängt nicht vom Ausmaß und der Präzision gegebener Information ab, sondern gerade auch von der „hinter“ der Information erkennbaren emotionalen Zuwendung des Arztes, sei es, dass sie sich durch positive oder auch durch negative Gefühle ausdrückt. Darum geht es. Die Menschen verlangen nicht primär Information aus Wissbegier, sondern weil sie der emotionalen Zuwendung bedürfen, die wiederum positive, heilswirksame Aktivität im Patienten bewirkt. Vielfach ist der Akt des Informierens selbst schon der Moment der ersehnten Zuwendung. Noch besser freilich ist es, wenn der Arzt sich gleichsam zum Patienten hin öffnet und selbst Emotion, ja Mitgefühl zeigt… Damit sich der Patient im mitfühlenden Blick des Arztes, im mitfühlenden Wort des Arztes förmlich widergespiegelt sehen kann. 8 Wir wissen aus den neueren Einsichten der Gehirnforschung, dass es neuronale System gibt, sogenannte Spiegelnervenzellen, die es uns ermöglichen spontan und unwillkürlich in uns jene Gefühle zu rekonstruieren, die wir beim Mitmenschen wahrnehmen. Solche Spiegelneurone sind die neurophysiologische Basis dafür, dass wir den Gefühlszustand eines anderen intuitiv verstehen können. Umgekehrt ist der Empfang verstehender Resonanz , also die Erfahrung: ich erkenne mich in meiner emotionalen Befindlichkeit im anderen widergespiegelt ich erkenne mich vom anderen verstanden, nicht nur ein fundamentales soziales Bedürfnis, sondern auch – wie die Gehirnforschung anhand der bei diesem Vorgang ausgeschütteten Botenstoffe zeigen konnte -, ein elementares biologisches Bedürfnis, ohne dass wir letztlich gar nicht leben könnten. Wenn ein Mensch auf Dauer keinerlei Resonanz der Mitwelt auf die eigenen Gefühle erhält, dann wird er krank. Wir alle brauchen – wie der Neorobiologe und Psychotherapeut Joachim Bauer klar macht – diese Resonanz der Mitwelt auf unsere eigenen Gefühle. Der Mensch bedarf der spiegelnden Wahrrnehmung durch die Umwelt um seine Handlungsentwürfe vornehmen und sich orientieren zu können. Fehlt dieses Orientierungssystem führt dies zu krankmachendem Stress. „Systematischer sozialer Ausschluß“ mahnt Joachim Bauer, „ist somit chronischer biologischer Stress, und chronischer Stress ist ein Krankheits-und Selbstzerstörungsprogramm“. Deswegen brauchen wir eine kommunikative, mitfühlende Medizin – eine Medizin, die auch auf die Kraft des anteilnehmenden, mitfühlenden Wortes setzt. Deswegen muss alles dazu getan werden, die Patienten aus dem Zustand krankmachenden Schweigens in den Krankenhäusern zu „erlösen“. Denn Worte sind eben nicht nur flüchtige Lautbildungen ohne weitere Folgen beim Hörenden, sondern Worte aktivieren im Hörer Handlungsideen und aktivieren Körpergefühle. 9 Auch das hat mit den Spiegelnervenzellen zu tun: Worte können über den Spiegelmechanismus im Hörenden Handlungs- und Empfindungsvorstellungen erzeugen, so dass das, was wir einem Menschen sagen, eine massive suggestive Wirkung entfalten und sein Befinden – positiv oder negativ – beeinflussen kann. Was man also im Lichte der neurobiologischen Forschung sagen kann ist dies: Mitfühlende, empathische Kommunikation ist nicht nur eine moralisch wünschenswerte Form der Arzt-Patienten-Beziehung oder ein psychologischer Faktor, der sich positiv auf die Patientenzufriedenheit, das Wissen über den eigenen Gesundheitszustand und die Compliance auswirkt, sondern mitfühlende Kommunikation hat unmittelbaren Einfluss auf physiologische Prozesse. Kommunikation ist das einzige Gegenmittel gegen jenen zerstörerischen chronischen biologischen Stress, der ja meistens mit Krankheit, Diagnose und Therapie verbunden ist. Bereits in den 1960er Jahren konnte der positive Einfluss qualitativ verbesserter Kommunikation nachweisen. Diejenigen bei Patienten, postoperativen die in den Schmerzbehandlungen Genuss besonderer kommunikativer Betreuung kamen, bedurften nur halb so vieler Schmerzmittel wie ihre Leidensgenossen aus den Kontrollgruppen und konnten auch früher als die anderen, kommunikativ nicht betreuten Patienten das Spital verlassen. Zwei Drittel aller einschlägigen Studien, die sich in den vergangenen 40 Jahren mit der Frage eines heilsamen Effekts positiver Kommunikation auseinandersetzten, konnten einen signifikanten Zusammenhang zwischen Kommunikationsqualität und Gesundheitszustand nachweisen. Sowohl besonders intensive Kommunikation über das Krankheitsbild als auch über den Behandlungsplan beeinflussen deutlich und nachhaltig die jeweiligen Symptome, wie Blutdruck, Blutzucker und Schmerzen. 10 Kommunikation wirkt sich dann positiv auf den Gesundheitszustand aus, wenn dem Patienten etwa ausreichend Gelegenheit gegeben wird, seine Krankengeschichte aus seiner Sicht zu erzählen, und der Arzt offen ist für alle Probleme des Patienten. Im Vergleich verschiedener Betreuungsmethoden bei Brustkrebspatientinnen zeigte sich: Jene Gruppen mit einer guten kommunikativen Betreuung wiesen über einen Beobachtungszeitraum von 12 Monaten einen wesentlich besseren psychischen und physischen Gesundheitszustand auf als die anderen Gruppen. Jene Patientinnen, die kommunikativ nicht gut betreut wurden, litten unter Depressionen, Angstzuständen und hatten noch ein Jahr nach der Operation diesen Eingriff nicht verkraftet. Solche und ähnliche Untersuchungen über den Einfluss psychosozialer Maßnahmen auf den Krankheitsverlauf machen deutlich: Patienten, die psychosoziale Unterstützung erhalten, gewinnen nicht nur ein höheres Maß an Lebensqualität nach einem Klinikaufenthalt, sondern haben auch – etwa bei Krebs oder koronaren Herzkrankheiten – wesentlich verbesserte Überlebenschancen. Fasst man die Resultate zusammen, dann könnte man sagen: Empathische Beziehungen, also Mitgefühl und mitfühlende Kommunikation sind die effektivsten psychosozialen Maßnahmen, um nicht nur krankheitsbedingte Angst, Depressionen und Schmerzen zu verringern, sondern um sogar den Verlauf selbst schwerer Erkrankungen positiv zu beeinflussen. Dabei genügt es schon, wie Studien ebenfalls zeigen, dass Patienten bzw. Patientinnen im Rahmen von Gruppentherapien die Möglichkeit haben, über ihre Krankheit mit anderen Betroffenen zu reden und damit der schädlichen sozialen Isolation zu entgehen. 11 David Spiegel von der medizinischen Fakultät der Universität Stanford konnte Ende der 1980er Jahre zeigen, dass Patientinnen mit metastierendem Brustkrebs, die sich ein Jahr lang einmal pro Woche für neunzig Minuten zum Gedankenaustausch trafen und füreinander Fürsorge und gegenseitiges Verständnis entwickeln konnten, im Durchschnitt doppelt so lange überlebten wie Frauen in der Kontrollgruppe, die nicht auf diese Erfahrungen einer Selbsthilfegruppe zurückgreifen konnten. Keine der Frauen der Vergleichsgruppe lebte noch nach fünf Jahren, hingegen alle Frauen, die an den Gruppentreffen teilgenommen hatten. Ähnlich beeindruckende Ergebnisse legten F. I. Fawzy und Kollegen von der medizinischen Fakultät der Universität von Los Angeles Anfang der 1990er Jahre vor. Melanompatientinnen, die an einer nur sechswöchigen psychologischen Gruppentherapie teilnahmen, wiesen sowohl eine verbesserte emotionale Befindlichkeit auf als auch eine im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne psychotherapeutische Begleitung erhöhte Zahl und Aktivität der natürlichen Killerzellen. Diejenigen Melanompatientinnen, die an der Gruppentherapie teilgenommen hatten, erlitten – so konnten die Autoren in einer Nachfolgestudie 5–6 Jahre nach der Intervention zeigen – mit höherer Wahrscheinlichkeit kein Rezidiv und überlebten ihre Krebskrankheit länger. Der kalifornische Kardiologe Dean Ornish entwickelte ein Therapieprogramm für Patienten mit koronaren Herzkrankheiten, das ganz auf die positiven Wirkungen von Liebe, Mitgefühl, menschlicher Nähe und Fürsorge setzt. Zu der von Ornish praktizierten Therapie der „Öffnung des Herzens“ gehören nicht nur eine radikale Veränderung des Lebensstils und der Ernährungsgewohnheiten, sondern vor allem auch Techniken zum effektiveren Stressmanagement einschließlich Körper- und Atemübungen, Meditation sowie Visualisierungsübungen zur Heilung bzw. Stärkung des Herzens. Ornish’s 12 Therapie bietet sich nicht nur als Alternative zur medikamentösen Behandlung von Herzkrankheiten, sondern verspricht bei konsequenter Befolgung seiner Therapiemaßnahmen sogar eine Öffnung bereits verschlossener Herzkranzgefäße ohne chirurgischen Eingriff. Zahlreiche Studien konnten nachweisen, dass sich nicht nur der Klinikaufenthalt durch besondere psychosoziale Interventionen verkürzt, sondern sich auch die mit dem Krankheitsgeschehen verbundenen Folgen wie Angst, Depression und Schmerzen deutlich verbessern. Ein bewusstes Eingehen auf die extreme Stresssituation von Krebspatienten reduziert deren psychologisch mitbedingte Morbidität. Das Gleiche gilt auch für Herzpatienten: Die Reduktion von Stress bei Patienten mit koronaren Herzkrankheiten durch gezieltes Stressmanagement trägt zur Erhöhung der Langzeitprognose bei. Umgekehrt deutet alles darauf hin, dass psychische Stressfaktoren wie Depression, Angst, Verzweiflung und soziale Isolation zu einem schnelleren Auftreten eines Tumorrezidivs beitragen. „Vermehrte Verdrängung neagtiver Emotionen und ausgeprägte Hilf-und Hoffnungslosigkeit angesichts einer Krebserkrankung erweisen sich in den meisten der hierzu durchgeführten Studien in signifikantem Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko, an Krebs zu sterben“ stellen die beiden Innsbrucker Psychoneuroimmunologen Schubert und Schüssler fest. Neuere Forschungsarbeiten stützen die Vermutung, dass es bei Menschen mit hohem Leidensdruck – etwa bei Brustkrebsüberlebenden – zu einer immunrelevanten Funktionsstörung des Stresssystems kommen kann und damit auch zu einer erhöhten Rückfallswahrscheinlichkeit. Diese Menschen brauchen Mitgefühl und mitfühlende Beziehungen – sie brauchen Mitgefühl zum Leben und zum Überleben … 13 Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die positive Wirkung anteilnehmender Kommunikation, sozialer Nähe und dem Gefühl der Geborgenheit ist ausreichend empirisch bewiesen. Noch dazu handelt es sich dabei um Studien, die einwandfrei dem kausalanalytischen Erkenntnismodell folgen und den methodologischen Prinzipien natur- bzw. sozialwissenschaftlicher Forschung entsprechen. Es gäbe also keinen Grund, an der Relevanz der Ergebnisse zu zweifeln und zu zögern, aus diesen Ergebnissen auch die adäquaten Schlussfolgerungen für die Theorie und Praxis der Arzt-Patienten-Interaktion zu ziehen. Dennoch sind diese wichtigen Ergebnisse noch nicht in das Bewusstsein der Schulmedizin vorgedrungen. Offenkundig handelt es sich hier um eine Art Wirklichkeitsverleugnung, um eine Form „déformation professionelle“: Naturwissenschaftlich ausgebildete Mediziner können nicht glauben, dass positive empathische Kommunikation entscheidend und messbar zum Behandlungserfolg und damit zum Heilungsprozess beiträgt. Vielleicht wollen sie es auch nicht wahrhaben, weil die empirische Evidenz dieser Einsicht ihr medizinisches Selbstverständnis in Frage stellt … Umso wichtiger ist es unermüdlich klar zu machen: Positive, also empathische Kommunikation ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern eine medizinische Notwendigkeit! Man muss das naturwissenschaftliche Paradigma der Medizin nicht aufgeben, um an die Wirkung der positven Kraft des Wortes, das mit ganzem Herzen gesprochen wird, zu glauben. Die moderne Neurobiologie liefert ausreichend Hinweise für das heilsame Potenzial positiver emotionaler Beziehungen. Zusammen mit den empirischen Ergebnissen internationaler Studien der 14 vergangenen zehn, zwanzig Jahre über den Faktor „Kommunikation“ in der Arzt-Patienten-Beziehung sollte dies eigentlich ausreichen, das Problem bewusst zu machen und in qualitativ verbesserte Kommunikationsbeziehungen zu investieren. Es geht darum, alles zu tun um den immunrelevanten psychischen Leidensdruck der Patienten und Patientiennen zu vermindern. Um dies vielleicht nochmals deutlich am Beispiel des Stressfaktors „Angst“ zu verdeutlichen: Es gibt einen empirisch nachgewiesenen engen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Informiertheit von Patienten über vorgeschlagene Therapieverfahren und der Intensität des Gefühls der Angst, das den jeweiligen Therapieverlauf begleitet. Je besser die mentale Vorbereitung des Patienten auch durch ausreichende Information über das medizinische Geschehen, desto geringer die Angst. Entscheidend für die Angstminderung dürften dabei aber weniger die unmittelbaren Sachinhalte der gegebenen Informationen sein, sondern vor allem die mit Hilfe vorgenommenen der gegebenen Informationen Bedeutungszuweisungen und vom Patienten Schlussfolgerungen. selbst Die Information dient dabei nur der vertieften Auseinandersetzung des Patienten mit sich selbst und seiner Situation des Krankseins. Die medizinische Information gibt für diesen so wichtigen und Angst mindernden Aktivierungsprozess also die Initialzündung. Dazu kommt: Ein Arzt, der sich bemüht seine Patienten bestmöglich über diagnostische und therapeutische Verfahren zu informieren, signalisiert auf der Beziehungsebene seine Bereitschaft, sich für Patienten zu engagieren und sich um ihr größtmögliches Wohlergehen zu sorgen. 15 Was aber vor allem noch gezeigt werden konnte, ist dies: Schon geringe Formen gezeigten Mitgefühls im Rahmen ärztlicher Konsultation reduzieren deutlich Angst. Eine amerikanische Forschergruppe um Linda A. Fogarty von der Johns Hopkins Universität in Baltimore konnte in einem Video-Experiment, bei dem unterschiedliche ärztliche Kommunikationsstile von Brustkrebspatientinnen bewertet werden mussten, zeigen, dass ein Arzt dann als mitfühlend wahrgenommen wird, wenn er deutlich merkbar auf den emotionalen Zustand der Patientin verbal eingeht. Dazu reichen, wie in diesem Experiment gezeigt werden konnte, nicht mehr als 40 Sekunden. Ein mitfühlender Kommunikationsstil des Arztes senkt also deutlich das Angstniveau der Patientinnen. „Angst“ ist daher auch eine Funktion des empathischen Kommunikationsvermögens des Arztes: Mitgefühl reduziert Angst. Der Grundsatz müsste lauten: Emotion geht vor Information, Aufklärung ersetzt nicht Zuwendung. Und damit tun sich Ärzte schwer. Sie entwickeln allerlei Schutzmechanismen, um von den Emotionen des Patienten gerade nicht affiziert zu werden: Der Patient „klagt am Arzt vorbei“… Damit tritt aber ein verhängnisvoller Mechanismus in Gang: Je weniger der Patient von der Medizin in seinen primär emotionalen Bedürfnissen wahrgenommen wird, desto geringer ist sein ursprünglich intaktes Vertrauen als Hilfsbedürftiger dem Hilfe gewährenden Arzt gegenüber. Je geringer aber das Vertrauen, desto größer die Angst vor der Medizin und der durch sie bewirkten systemimmanenten, technokratischen Fremdbestimmung. Je geringer das Vertrauen, desto geringer auch die Voraussetzung für positives Heilungsgeschehen. Denn Heilen hängt grundlegend mit Vertrauen und der Kraft positiver Überzeugungen zusammen. 16 Der Patient erlebt sich selbst nicht nur als hilfsbedürftig, sondern auch als ohnmächtig und er erlebt die Medizin als System der Macht und der Herrschaft, dergegenüber er sich unterworfen und ausgeliefert sieht. Je größer aber die Angst des Patienten vor einem entfremdenden und entfremdeten Medizinsystem, desto intensiver und auch berechtigter der Eindruck der Patienten, dass diese Medizin nicht für den Patienten da ist, sondern der Patient für das Funktionieren und die Aufrechterhaltung des Systems. Das ist ein verhängnisvoller Vorgang, den man als Enteignung der Krankheit, bezeichnen könnte, währenddessen genau das Gegenteil passieren sollte: dass nämlich der Patient in die Lage versetzt wird, sich intensiv geistig, emotional und seelisch mit seinem Kranksein auseinanderzusetzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gute Krebstherapie ist immer zugleich auch gute Kommunikationstherapie. Darin liegt auch das besondere Potenzial komplementärmedizinischer Behandlung. Koplementärmedizin – gerade im onkologischen Bereich – kann sich, ja muss sich durch eine alternative Kommunikationsqualität der ArztPatienten-Beziehung auszeichnen. Bloß funktionale Aufmerksamkeit ist hier zuwenig – das ist Domäne der positivistischen, kausalanalytischen Schulmedizin. Eine an der Ganzheit des Patienten orientierte naturwissenschaftliche und zugleich erfahrungsheilkundliche Behandlung braucht hingegen auch eine an der Ganzheit des leidenden Menschen orientierte Kommunikation. Eine Kommunikation also, die im Patienten weder einen medizinischen „Fall“, noch einen anspruchsberechtigten Kunden sieht, sondern das leidende Subjekt mit seinen existenziellen Sorgen und Ängsten. Darauf kann man nicht mit bloß 17 angelernten rhetorischen Fertigkeiten reagieren. Das erfordert Ärzte, die bereit sind, das Wort, das sie an die Patienten richten, mit ihrem ganzen Wesen zu sprechen – also mit dem Patienten in eine Beziehung der persönlichen Nähe einzutreten. Wenn das gelingt, dann entsteht eine Form von Beziehung, die ich als „existenziell“ bezeichnen möchte. Eine solche existenzielle Kommunikationsbeziehung ist genau das Gegenteil dessen, was heute in Ordinationen und Kliniken geschieht. Was verstehe ich unter existenzieller Kommunikation? In der existenziellen Kommunikation geht es primär um das Selbst des Patienten. Das sanative Potential ärztlicher Kommunikation bemisst sich an der Fähigkeit des Arztes das Selbst des Patienten zu verstehen. Das Selbst ist die Quelle und Grundlage der psychischen Individualität eines Menschen, sein So-Sein, in dem seine Erfahrungen, Erwartungen, Wünsche, Sehnsüchte und Ängste aufgehoben sind. Das Selbstkonzept ist gleichsam ein verborgener Plan, der zu Rate gezogen wird, um sich in der Situation der Krise und existenziellen Entscheidung selbst zu verstehen. Es bestimmt das Verhalten des Menschen, organisiert seine Wahrnehmung und sein Erleben. Deswegen ist es so wichtig, das Selbst des anderen, das Selbst des Patienten zu verstehen. Carl R.Rogers, der Begründer der klientenezentrierten Gesprächstherapie, hat klar gemacht, dass es nicht darum geht dass w i r den anderen verstehen, sondern, dass es zunächst darauf ankommt, den anderen von s e i n e m Standpunkt aus zu verstehe, also zu verstehen, was dem anderen die Aussage bedeutet. Das setzt zweierlei voraus: erstens den Verzicht auf sofortige Klassifizikation und Bewertung des anderen; und zweitens die Bereitschaft, sich durch die Aussage des anderen verändern zu lassen. Das ist der entscheidende 18 Schlüssel zur mitfühlenden Kommunikation. Wer einen anderen wirklich zu verstehen sucht, geht bewusst das Risiko ein, vom anderen verändert zu werden. Deswegen scheuen wir uns vor dieser Herausforderung in das Bezugssystem des anderen vollständig und mitfühlend einzutreten… nicht nur die Ärzte, sondern wir alle in der Begegnung miteinander. In der Regel bedienen wir uns unserer Masken und imageerhaltender Rituale. In der Situation existenzieller Kommunikation aber fallen die Masken und werden alle imageerhaltenden Rituale obsolet. Den anderen wirklich zu verstehen, heißt also, ihn nicht von unserem eigenen distanzierten Standpunkt gemäß unseres eigenen sachlichen Urteils verstehen zu wollen – sondern den anderen von seinem Standpunkt aus zu verstehen, hinter seinen Worten, öfter noch hinter seinem Schweigen, den seelischen Zustand, der sich hinter dem Schweigen, der sich hinter den Worten verbirgt zu erschließen. Den Patienten verstehen zu wollen, heißt primär, zu versuchen, sich in seine Gefühlswelt einzufühlen… Das ist die Leistung der „emotionalen Vernunft“ sie verhilft uns zur ganzheitlichen, intuitiven Anschauung. Im Unterschied zur Logik des Verstandes, die sich der Dinge bemächtigen will und dem eigenen forschenden Willen unterwerfen will – vermögen wir mithilfe der emotionalen Vernunft, mithilfe der „Logik des Herzens“ - ein Begriff des Mathematikers und Philosophen Blaise Pascale - Teilhabe am Anderen zu gewinnen, sich in die Dinge und Menschen einzufühlen. Deswegen beginnt wahrhaft empathische Kommunikation nicht mit dem Sprechen, sondern mit dem Zuhören, und zwar einem aktiven Zuhören. Empathisches Zuhören ist Anwesenheit im Zuhören, ohne zu klassifizieren. Es ist sehr schwer, nicht zu klassifizieren. Die Sache muss klassifiziert werden, nicht die Person – das macht den Unterschied. Erst ein solches aktives Zuhören 19 eröffnet nämlich dem anderen den psychischen Raum, in dem er selbst sein kann. Lassen Sie mich zusammenfassend sagen: Ein empathischer Arzt steht zum Patienten in einer Beziehung der Diakonie – man könnte auch sagen in einer Beziehung der Solidarität. Diese Solidarität zwischen Arzt und Patient speist sich aus der unausgesprochenen Einsicht in die existenzielle Bedürftigkeit und Verwundbarkeit des Menschen. Sie speist sich aus der Einsicht, dass auch der Arzt Krankheit und Leiden in sich trägt und darin dem äußeren Patienten ähnlich ist. Ich als Arzt bin genauso verwundbar, wie du als Patient. Wir beide, du und ich, sind Leidende im Leben wie im Sterben. Aus dieser Einsicht existenzieller Ähnlichkeit zwischen Arzt und Patient entsteht jene besondere Solidarität – eine Solidaridät der Verletzten und der Verletzbaren. Der Arzt erkennt sich wieder im Patienten und der Patient sieht sich im mitfühlenden Antlitz des Arztes erkannt und verstanden. Aus diesem tiefen Gefühl der Solidarität schöpft der Arzt – schöpfen wir alle die Kraft zum Mitgefühl, die Ktaft zur empathischen Kommunikation. Und dann, wenn dies gelingt, vermag auch das Wort des Arztes für den Patienten eine neue Wirklichkeit hervorzubringen: eine Wirklichkeit, in der die lähmende Sprachlosigkeit, in der das lähmende Gefühl der Sinnlosigkeit und der Hoffnungslosigkeit überwunden ist – und Heil und Heilung möglich werden können … 20 Ich danke für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen interessante Kongresstage voller Inspiration und Kommunikation…. 21 22