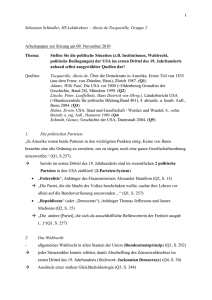Amerikas Kriege
Werbung
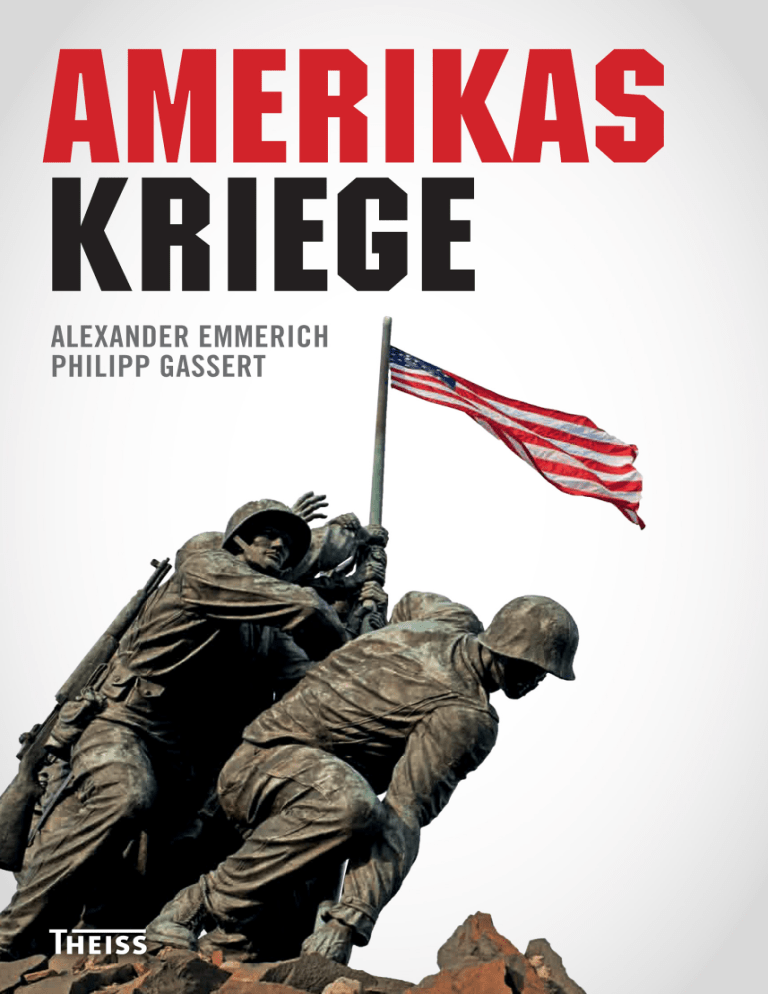
B is zum Eintritt in den Ersten Weltkrieg kümmerten sich die Amerikaner kaum um die Verwicklungen der europäi- schen Kriege. Zwar hatten sie zahlreiche Kontakte in die Alte Welt. Auch waren sie meist gut über die Kriege Europas informiert, ja fieberten etwa als Deutsch-Amerikaner bei der Reichseinigung 1870/71 mit. Oder sie legten Sympathie für den Freiheitskampf der Polen und Griechen an den Tag. Doch militärisch betrachtet hatten sie den Rest der Welt nur bedingt im Blick. Ihr außenpolitisches Interesse richtete sich auf die westliche Hemisphäre, auf die beiden Amerikas. Die Amerikaner waren ein Jahrhundert lang damit beschäftigt, die Vorherrschaft auf dem nordamerikanischen Teilkontinent zu erringen und die eigene Nation gegen Übergriffe aus Europa, Mexiko oder vor den Indianern zu sichern. Dafür steht das Schlagwort „Amerika den Amerikanern“. Es fasst knapp und deutlich die am 2. Dezember 1823 von Präsident James Monroe vorgelegte Monroe Doctrine zusammen. Monroe steckte als Teil seiner jährlichen Botschaft an den Kongress den langfristigen Rahmen der amerikanischen Außenpolitik ab. Er unterstrich einmal mehr die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten wie auch aller anderen amerikanischen Nationen von Europa, der rückständigen „Alten Welt“. Dabei knüpfte er an die prophetischen Warnungen seines Außenministers John Quincy Adams an, der in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag 1821 davor warnte, „im Ausland auf die Suche Amerika den Amerikanern 17 John Quincy Adams – Politiker mit Weitsicht und Warner vor weltpolitischen Abenteuern John Quincy Adams (1767–1848) war der Sohn des zweiten Präsidenten John Adams. In Leiden (Niederlande) und Cambridge studierte er Rechtswissenschaften, war Professor an der Harvard University und arbeitete als Rechtsanwalt in Boston, bevor er als Gesandter der jungen amerikanischen Republik in die Niederlande, nach Preußen, Russland und ins Vereinigte Königreich geschickt wurde. Unter Präsident Monroe wurde er 1817 zum Außenminister ernannt. In dieser Zeit konnte er einen Vertrag mit Spanien aushandeln, der den Vereinigten Staaten langfristig den Zugang zum Pazifik und damit zu den asiatischen Märkten ermöglichen sollte. Schließlich folgte er Monroe 1825 ins Amt des Präsidenten. Er warnte vor kriegerischem Ehrgeiz. Nach seiner Niederlage gegen Andrew Jackson in den Präsidentschaftswahlen 1828 vertrat er bis zu seinem Tod Massachusetts im Kongress. Dort tat er sich als Gegner der Sklaverei hervor. nach Monstern zu gehen, die es zu zerstören gelte“. Aus diesen Worten spricht das wenig getrübte Selbstbewusstsein einer jungen Nation. Schon die damalige Generation amerikanischer Politiker ging davon aus, Amerika werde einst eine dominante Macht werden. Sollte aber Adams Recht behalten, wenn er befürchtete, dass ein Amerika, das in Übersee Kriege führte, die fundamentale Maxime seiner Politik verrate, von „Freiheit“ zu „Gewalt“ überginge, ja die „Diktatorin der Welt“ werden könnte? Von den Versuchungen der Hegemonie waren die USA trotz des von Monroe und Adams an den Tag gelegten Selbstbewusstseins noch weit entfernt. Vorerst hatte das militärisch schwache Amerika mit 18 Amerika den Amerikanern seinen langen, ungesicherten Küsten gar keine andere Wahl, als um seiner eigenen Sicherheit willen auf Isolation zu drängen. Monroe stellte sich daher ganz bewusst in die rhetorische Tradition seiner Vorgänger und definierte zwei politische Hemisphären: eine amerikanische und eine europäische, die politisch voneinander getrennt bleiben sollten. Indem er versicherte, dass Amerika sich aus Europa und dem Ränkespiel der Monarchien heraushalten werde, machte er gleichzeitig klar, dass es eingreifen würde, sollten die Europäer versuchen, die gerade unabhängig gewordenen Staaten in Lateinamerika zu rekolonialisieren. Damit verlieh er jener Denkweise Ausdruck, die etwas missverständlich als Isolationismus bezeichnet wird. Diese Leitlinie der bündnispolitischen Abstinenz entstand bereits in der Revolutions- und Gründungsphase der USA. Sie sollte die USAußenpolitik aus allen internationalen Verträgen heraushalten („Isolation“). Denn das ungefestigte junge Land, das über keine nennenswerte Armee und Marine verfügte, sah sich bald nach seiner Gründung vor der Gefahr, in die durch die Französische Revolution ausgelösten Kriege hineingezogen zu werden. Schon der erste US-Präsident George Washington wies in seiner Abschiedsbotschaft, seiner Farewell Address, darauf hin, dass die Amerikaner sich nicht in das europäische Spiel der Mächte einmischen sollten. Diese Linie führte der dritte Präsident, Thomas Jefferson, in seiner ersten Inaugural Address fort, nachdem sich das 1778 „auf ewig“ geschlossene Bündnis mit Frankreich auch innenpolitisch zunehmend als Spaltpilz zwischen den Anhängern und Gegnern der Französischen Revolution erwies. Nur unter größten Schwierigkeiten und gegen Zahlung einer enormen Summe konnte der Bund mit Frankreich aufgelöst werden. Vor dem Hintergrund dieser Gefahr einer Verwicklung in europäische Kriege beschwor auch Jefferson die strategische Isolation der USA in der westlichen Hemisphäre. Als Prinzipien seiner Regierung in Bezug auf die Außenpolitik definierte er: „Peace, commerce and honest Amerika den Amerikanern friendship with all nations, entangling alliances with none.“ Von Jefferson und nicht von Washington stammt demnach die berühmte Warnung, die Amerikaner dürften sich nicht auf eine „verstrickende Allianz“ einlassen, die sie schon in Friedenszeiten binde. Genau diese Gefahr eines „verstrickenden Bündnisses“ hätte der von Wilson betriebene Völkerbund in sich getragen, den der US-Senat 1919 prompt nicht ratifizierte. Von der Linie der Bündnislosigkeit in Friedenszeiten wichen die USA erst mit der Gründung der NATO nach 1945 ab. Es fiel den USA anfangs nicht leicht, sich von den europäischen Konfliktherden fernzuhalten. Doch nach dem Desaster des britischamerikanischen Krieges von 1812 und beginnend mit Monroe konzentrierten sie sich über das nächste halbe Jahrhundert auf die kontinentale Expansion über den nordamerikanischen Kontinent. Dies führte zu mehrfachen Kriegen mit Mexiko und zu wiederholten Spannungen mit den europäischen Großmächten England, Spanien und Russland, die alle nach wie vor koloniale Besitzungen in Amerika hatten. Im Laufe des 19. Jahrhunderts breitete sich das Siedlungsgebiet der USA sukzessive nach Westen aus, bis schließlich das heutige Territorium der USA mit seiner Ausdehnung von Küste zu Küste entstanden war. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie dann selbst zur überseeischen Imperialmacht. Dabei gab es immer äußere Feinde, die es zu bezwingen galt. Die ersten waren die einzelnen Stämme der nordamerikanischen Indianer wie auch die europäischen Kolonisten: Franzosen, Spanier und britische Kanadier. Zunächst sicherten sich die englischen Kolonisten das Siedlungsgebiet bis zu den Appalachen und verdrängten die meisten Indianer des Ostens. Dann siegten sie über die Franzosen, drängten die Spanier bzw. Mexikaner an den Rand und letztlich auch die Indianer des Westens. Was entstand, war ein fast vollständig besiedelter Kontinent, der neben zwei Küsten nur zwei Grenzen zu anderen Ländern hatte: zu Kanada im Norden und zu Mexiko im Süden. Während die 19 20 Amerika den Amerikanern USA zweimal an der Eroberung Kanadas scheiterten (im Unabhängigkeitskrieg wie im Krieg von 1812), verlor Mexiko im Krieg mit den USA (1848) etwa ein Drittel seines Gebiets. Zwar war der mexikanische Norden nur spärlich besiedelt, aber es bedeutete psychologisch einen herben Verlust, der im kulturellen Gedächtnis der Mexikaner bis heute nachwirkt. Diese Landgewinne bescherten den USA eine schier uneinnehmbare geostrategische Situierung. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der größte Krieg der USA im 19. Jahrhundert durch einen inneren Konflikt herbeigeführt wurde. Ganz bewusst stellte Präsident Abraham Lincoln den Bürgerkrieg als interne Angelegenheit der Vereinigten Staaten dar, indem er die abtrünnigen Staaten als rebellierend brandmarkte. So wollte er verhindern, dass europäische Mächte wie das Britische Weltreich, das zeitweilig mit den Südstaaten sympathisierte, oder gar Mexiko in diesen Konflikt hineingezogen würden. Waren die USA vor dem Bürgerkrieg eher eine Republik aus mehreren, vergleichsweise autonom agierenden Staaten, formte Lincoln daraus einen Bundesstaat mit starker Zentralgewalt. Im 18. und 19. Jahrhundert deuteten die Amerikaner ihre Expansion und Landnahme nicht nur ökonomisch, sondern vor allem religiös. Mit Konzepten wie Manifest Destiny, d. h. eines vorherbestimmten Auftrages sich den Kontinent untertan zu machen, begründeten sie z. B. die Annexion von Texas und den Krieg gegen Mexiko. Viele Amerikaner versuchten sich selbst eine besondere Mission zuzuschreiben und sie taten das gerne in Begriffen und Bildern, die aus der Bibel stammten. Lange bevor der Kontinent erobert war, sprachen bereits die Gründerväter von der kommenden Landnahme, für die die US-Amerikaner einen göttlichen Auftrag hätten – vergleichbar dem Volk Israel im Alten Testament. Die eigentlich in erster Linie von der Aufklärung geprägten Gründerväter verbanden diese Sichtweise mit dem puritanischen Sendungsbewusstsein eines auserwählten Volkes.