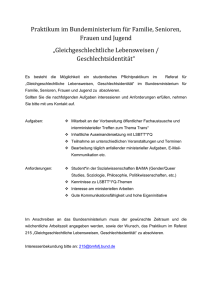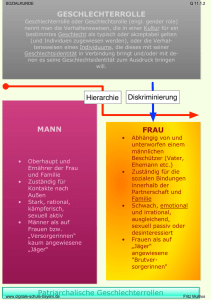Weibliche und männliche Sexualität (S. 63-65)
Werbung

SOPHINETTE BECKER Weibliche und männliche Sexualität (S. 63-65) In den medizinisch-biologischen Wissenschaften gilt die weibliche Sexualität – nicht nur zum Ärger der Pharmaindustrie – immer noch als »sträflich untererforscht« (Dick 2005: 28). Trotz massiver Anstrengungen in den letzten Jahren unter Einsatz von Fragebögen, Messungen der Lubrikation, des vaginalen Säuremilieus, der Klitoris-Durchblutung oder der Reizschwelle für vaginale Vibrationen »mussten die Forscher zu ihrem Bedauern feststellen, dass der sinnliche Aufruhr bei Frauen ungleich schwieriger festzumachen ist als jener des Mannes. Während sich beim Mann – funktionierende Hardware vorausgesetzt – die subjektive Erregung ziemlich genau im körperlichen Ertragswinkel widerspiegelt […], findet sich bei der Frau kein vergleichbares Maß« (ebd.). Die Zusammenhänge zwischen psychischer und physischer sexueller Erregung bei der Frau seien »sehr komplex« und erwiesen sich als statistisch nicht signifikant. Eine der hartnäckigsten Behauptungen über die biologische Ursache der männlichen Homosexualität, diese sei auf einem bestimmten Gen-Komplex zu finden (z. B. auf der Xq28-Region), konnte in einer groß angelegten, bei homosexuellen Männern mit mindestens einem homosexuellen Bruder (und möglichst auch noch einer homosexuellen Mutter) durchgeführten »genomweiten Suche nach der sexuellen Orientierung des Mannes« (Müller-Jung 2005: 34) nicht bestätigt werden: »Unsere Vermutung ist, dass zahlreiche Gene, vermutlich im Zusammenspiel mit vielen Umwelteinflüssen, die Andersartigkeit der sexuellen Orientierung begründen« (ebd.). Das Fazit der Forscher ist so vage, dass es sich gleichermaßen über die heterosexuelle Orientierung formulieren ließe. Diese beiden Befunde zum Stand der Sexualforschung zeigen, dass die von Freud in den Drei Abhandlungen behandelten Fragen keineswegs in der Zwischenzeit von den »Hardcore-Wissenschaften « beantwortet worden sind. So sind etwa die Zusammenhänge zwischen Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung nach wie vor (innerhalb und außerhalb der Psychoanalyse) wenig aufgeklärt und werden kontrovers diskutiert; das beginnt schon mit der Frage, ob Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung sich nacheinander oder parallel entwickeln. Weitgehend Konsens besteht darüber, dass eine stabil-flexible Geschlechtsidentität (das heißt eine sichere Geschlechtsidentität, verbunden mit der Fähigkeit zur Identifikation mit dem anderen Geschlecht) ebenso wie eine stabil-flexible sexuelle Orientierung (beispielsweise Heterosexualität ohne Homophobie) nichts Naturhaftes, sondern das Ergebnis gewaltiger Integrations- und Abwehrleistungen ist, die sich für Männer und Frauen unterschiedlich gestalten. Für beide Geschlechter stellt sich ein komplexer und konflikthafter Prozess der Integration: Dieser umfasst körperliche Lust- und Unlust-Empfindungen, aktive und passive Bedürfnisse, libidinöse und aggressive Triebimpulse, gute und böse Selbst- und Objektrepräsentanzen ebenso wie den Widerspruch zwischen dem auftauchenden Selbstbewusstsein und den »rätselhaften Botschaften « (Laplanche 1988) der Erwachsenen. Jungen und Mädchen haben aktive und passive Wünsche, beide identifizieren sich mit Mutter und Vater, beide begehren beide als Objekt und beide reagieren auf die Beziehung zwischen den Eltern. Geschlechtsspezifische Brechungen gibt es hingegen durch die Wahrnehmung des Geschlechtsunterschiedes und der Beziehung zwischen den Eltern sowie durch die geschlechtsspezifisch aufgeladenen unbewussten Botschaften und Zuschreibungen seitens der Eltern (wie etwa die spezifische Reaktion der Mutter auf die orale Gier des weiblichen bzw. männlichen Säuglings oder die spezifische Reaktion des Vaters auf die abhängige Bedürftigkeit des männlichen bzw. weiblichen Säuglings) und durch das unterschiedliche Erle ben des eigenen Körpers aufgrund verschiedener körperlicher Gegebenheiten, wozu auch der verbale und averbale Umgang der Eltern mit diesem Körper gehört. Die Bisexualität ist ein Schlüsselkonstrukt in den Drei Abhandlungen und meines Erachtens ein heute noch spannendes Konzept – auch wenn man wohl nicht mehr von »konstitutioneller«, sondern eher von »basaler« oder »psychischer« Bisexualität sprechen würde. Freud ringt um ein Verständnis von »männlich« und »weiblich«, wobei ihm die Geschlechtsidentität und sexuelles Begehren oft ebenso durcheinander geraten wie Triebschicksale und Frauenschicksale. Freud sucht zwar Tendenzen zur Ontologisierung von Begriffen zu vermeiden (wie die Zuordnung von aktiv/ passiv zu männlich/ weiblich oder »Geschlechtscharakter« zur sexuellen Orientierung usw.), kann das aber nicht durchhalten und erliegt ihnen auch immer wieder – und argumentiert gerade dann dezidiert biologisch.