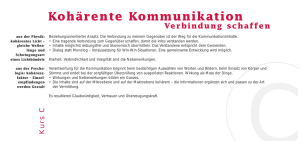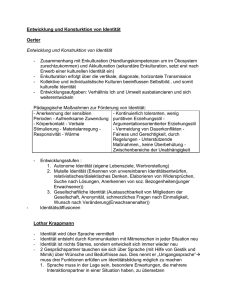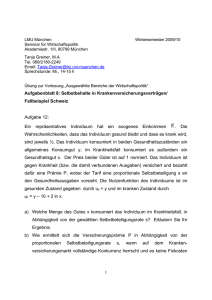Identitätskrisen, Devianz und soziale Kontrolle
Werbung

Zentrum für psychosoziale Medizin Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. F. Resch Identitätskrisen, Devianz und soziale Kontrolle – Die sozialisationstheoretische Dimension sozialen Handelns und die Forschungsmethode der Psychoanalyse Zur Erlangung des Doctor scientiarum humanarum (Dr.sc.hum.) der Medizinischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg vorgelegt von Maria-Christina Karnavou Heidelberg, 10. März 2006 »Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber Liebe ist die größte unter ihnen.« Aus der Heiligen Schrift. Der erste Brief des Paulus an die Korinther. I. Korinther, Kapitel 13, Psalm13 Für meine Eltern 2 Inhaltsverzeichnis I. EINLEITUNG....................................................................................................... 5 1. Gegenstand und Problemstellung – Präsentation der Kernfrage aller psychiatrierelevanten Sozialisationstheorien ............................................................................................................5 2. Bemerkungen zum Forschungsstand ....................................................................................11 3. Relevanz: Was die vorliegende Arbeit leisten will und zu leisten vermag und was sie nicht zu leisten vermag .................................................................................................................25 4. Zum Stellenwert der sog. „Psychoanalyse“..........................................................................35 II. HAUPTTEIL ..................................................................................................... 41 1. Max Webers „Begriffslehre des sozialen Handelns“ I – Der sozialstrukturelle Gesichtspunkt.......................................................................................................................41 2. Die sozialanthropologische Grundlage der Humanwissenschaften: Verstehende Soziologie und symbolischer Interaktionismus .....................................................................................66 3. Methodische Probleme und Probleme der Methodologie: Texthermeneutik, Begriffsanalyse und ein wissenschaftstheoretischer Thesenkatalog..............................................................76 3.1. Allgemeines .......................................................................................................................76 3.2. Ein wissenschaftstheoretischer Thesenkatalog..................................................................84 4. Die Psychiatrie als Gegenstand der kultursoziologischen Analyse und als kultursoziologische Disziplin ..............................................................................................99 4.1. Die kultursoziologische Grundlage der Psychiatrie und ein Grunddilemma derselben ....99 4.2. Das Verhältnis zwischen Grundlagenforschung und „Anwendung“ ..............................124 4.3. Ein kurzer (kulturwissenschaftlicher) Blick auf die Krankheitsformen(lehre) ...............127 4.4. Interpretation: Ätiologie und symptomatologische Genauigkeit.....................................132 3 5. Max Webers „Begriffslehre des sozialen Handelns“ II: Der Wissenschaftscharakter der Soziologie ..........................................................................................................................134 5.1. Die Zielsetzung der Erfahrungswissenschaften und der Weg der Forschung – ein Tafelbild ..........................................................................................................................134 5.2. Die „Objektivität“ der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis: Max Webers Postulate, der wissenschaftstheoretische Thesenkatalog von II. 3 .2. und einige Überlegungen zu Diagnostik, Prognostik und Therapie..............................................................................141 5.3. Grundlagenforschung und „angewandte Wissenschaft“ – Einige Bemerkungen zum Problem der „Sozialverantwortlichkeit“ .........................................................................150 5.4. Das Gadamersche „Gespräch“ als Idealtypus rationalen Argumentierens – Der Begriff der „Identitätsmetamorphose“..................................................................................................162 5.5. Das DN-Modell einer wissenschaftlicher Erklärung.......................................................178 5.6. Der systemische Gesichtspunkt und die Zerlegung der Erklärungen in Funktional- und in Kausalerklärungen: Organismische und personale Systeme ..........................................212 6. Die Psychoanalyse und ihre Grundannahmen ....................................................................222 6.1. Rückblick und Fragen......................................................................................................222 6.2. Die Fundamentalannahmen .............................................................................................227 7. Devianzformen – Eine fundamentale Differenzierung.......................................................234 7.1. Das Kriterium der (gegenwärtigen) Moral- und Rechtsordnung und die Formen der Devianz ...........................................................................................................................234 7.2. Zum Problem der Irrationalität – Das „Normal-Ich“ und die psychopathologischen Erscheinungsformen von „Konformität“ und „Devianz“: Selbstverantwortliches Handeln und zwanghaftes Verhalten.............................................................................................245 8. Zum Problem der Rationalität ............................................................................................265 8.1. Einige überleitende Bemerkungen – Der genuin soziologische Gesichtspunkt und die zentrale Bedeutung des Handlungsbegriffs.....................................................................265 8.2. Personale Rationalität .....................................................................................................270 III. BILANZ UND AUSBLICK ............................................................................. 313 LITERATURVERZEICHNIS ............................................................................... 320 4 I. Einleitung 1. Gegenstand und Problemstellung – Präsentation der Kernfrage aller psychiatrierelevanten Sozialisationstheorien Gegenstand dieser Untersuchung ist das Identitätsproblem, genauer: das Problem der Identitätskrisen. Gefragt wird nach der Rolle und der Funktion von Identitätskrisen zum einen für gelungene, zum anderen für gründlich „schief“ gelaufene Sozialisationsvorgänge. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass die vorliegende Arbeit im Bezugsrahmen der Kinder- und Jugendpsychiatrie angesiedelt ist, denn dadurch können Stellenwert wie Erkenntniswert der hier aufgeworfenen Fragestellung recht genau bestimmt werden: Von einem rigoros soziologischen Standpunkt aus werden diejenigen (pädo-) psychiatrischen Problembereiche angesprochen, die aus deren Sicht mittels des Oberbegriffs „Identitätskrise“ umschrieben und in einen systematischen Zusammenhang mit bestimmten als „gestört“ zu bezeichnenden Verhaltensmustern gebracht zu werden pflegen. In der vorliegenden Arbeit wird deswegen konsequent das gesamte Spektrum klinisch auffälligen Verhaltens als differenzierte Erscheinungsform der „Identitätskrise“ behandelt. Diese Aussage hat den Status einer Grundannahme: Wann immer wir von genuin pathologischen Erscheinungsformen humanspezifischen Verhaltens sprechen, gilt, dass diesen „im Mentalbereich“ identitätskritische Tatbestände zugrunde- und vorausliegen.1 1 Man beachte, dass diese „Grundaussage“ keine spezifisch soziologische sondern vielmehr eine psychologische Aussage ist, denn sie bezieht sich auf die Relation zwischen bestimmten „an einem Individuum“ beobachtbaren Verhaltensmustern und bestimmten diesen Verhaltensmustern zugrunde liegenden Mentalzuständen. Der genuin „soziologische“ Aspekt ist freilich insofern „mitenthalten“, als es ja wohl kein individuelles Verhalten gibt, welches nicht auf irgendeine Art und Weise in irgendeinem sozialen Kontext „auftritt“. Zur begrifflichen Unterscheidung zwischen „Grundannahmen“ und „Hypothesen“ vgl. den Abschnitt II. 3. Grundannahmen, Hypothesen und Theorien gestatten, weil sie alle drei die (linguistische bzw. logische) Struktur streng allgemeiner Allsätze haben, gleichermaßen Rückschlüsse von „Beobachtbarem“ auf „Theoretisches“, von „Theoretischem“ auf anderes „Theoretisches“ und von „Beobachtbarem“ auf anderes „Beobachtbares“. Während jedoch Hypothesen und Theorien – zu deren Bedeutungen vgl. vor allem den „Thesenkatalog“ in Abschnitt II.3.2 – empirisch falsifizierbar sind bzw. es sein müssen, eignet den Grundannahmen eine wesentlich begriffliche Struktur: Sie sind prinzipiell nicht falsifizierbar, beinhalten gleichwohl immer ganz bestimmte empirisch falsifizierbare Hypothesen. Es ist eine der großen Leistungen der Freudschen Konzeption („Metapsychologie“), auf ganz bestimmte beobachtbare Verhaltenstatbestände hingewiesen zu haben, die sich nur mit der Grundannahme erklären lassen, dass es so etwas wie „Unbewusstes“ gibt. Prekär ist daran freilich, dass Freud, 5 Psychopathologische Erscheinungsformen des Alltagslebens, wie sie beispielsweise Sigmund Freud als „Fehlleistungen“ bzw. „Symptomhandlungen“ so meisterhaft beschrieben hat, lassen ebenso auf mentale Zustände schließen, welche der dieser Arbeit zugrundeliegenden Auffassung zufolge als Identitätskrisen zu diagnostizieren sind, wie etwaige identitätskritische Dauerzustände des psychosomatischen, des zwangsneurotischen oder gar des psychotischen Formenkreises. Die umgekehrte Beziehung gilt jedoch nicht: Identitätskrisen führen nicht immer zu genuin pathologischen Erscheinungsformen humanspezifischen Verhaltens. Ganz im Gegenteil: Es gibt Identitätskrisen, die keineswegs pathologische Verhaltensformen zur Folge haben, die vielmehr die Voraussetzungen dafür bilden, dass u. U. künstlerische und wissenschaftliche Höchstleistungen die Folge sind, so dass zunächst einmal die prima facie verblüffende, da wissenschaftstheoretisch prekäre, allgemeine Aussage gilt: Identitätskrisen sind – nicht direkt beobachtbare – mentale Zustände, welche auf ganz bestimmten – nämlich: die Identitätsfrage betreffenden – Erfahrungen eines Individuums beruhen und sich zum einen in pathologische Erscheinungsformen humanspezifischen Verhaltens, zum anderen in nichtpathologische Erscheinungsformen des humanspezifischen Verhaltens ausmünzen.2 weil er sich sehr stark auch eines handlungskonzeptionellen Vokabulars bedient hat, wobei „Verhalten“ und „Handeln“ semantisch verschwimmen, sich gezwungen gesehen hat, bestimmte Fehlleistungen als Handlungen zu deuten, weil dadurch der Eindruck entsteht, es gäbe so etwas wie ein nichtbewusstes Bewusstes. Ich sage ganz bewusst „prekär“, nicht jedoch „falsch“, denn in der Tat besteht ja ein Unterschied zwischen dem eindeutig „unbewussten“ Reagieren beim gereizten Patellarsehnenreflex und einer Fehlleistung. Bei dem hier angesprochenen Problem der Unterscheidbarkeit zwischen (nicht falsifizierbaren) „Grundannahmen“ und (empirisch falsifizierbaren) „Hypothesen“ handelt es sich um ein methodologisches bzw. wissenschaftsund erkenntnistheoretisches Grundproblem keineswegs nur der sog. „Gesellschaftswissenschaften“, dessen Lösung nach wie vor aussteht. Die vorliegende Arbeit favorisiert eine Lösung, wie sie sich im [Forschungsantrag] bereits abgezeichnet hat: Wie insbesondere die Geschichte der strengen Naturwissenschaften zeigt, verwandeln sich sehr oft bestimmte, zuvor nur und ausschließlich hypothetisch unterstellte Grundannahmen, die, wie z. B. die Dalton-Vermutung, in der Regel auf ganz bestimmten „(Neu-) Definitionen“ beruhen, in empirisch sodann sehr gut bestätigte empirisch falsifizierbare Hypothesen. 2 Gehen Identitätskrisen in identitätskritische Dauerzustände über, so ergeben sich die im eigentlichen Sinne psycho-pathologischen Verhaltensmuster, welche wir zum einen als Neurosen, zum anderen als Psychosen diagnostizieren. Es funktionieren dann ganz einfach nicht mehr die identitätskonstituierenden Konstruktprinzipien und die in diesem Zusammenhang auftretenden Syndrome designieren dann vermutlich auch über kurz oder lang Erscheinungsformen der personalen Desintegration. Trotz der erkenntnistheoretisch extrem schwierigen Problematik, ein Kriterium zu erarbeiten, welches zwischen der sog. „Beobachtungssprache“ und der sog. „theoretischen Sprache“ triftig zu unterscheiden gestattet, muss dennoch an der heuristischen Leitregel der prinzipiellen Unterscheidbarkeit zwischen den beobachtbaren Verhaltensmustern von Individuen und den diesen zugrunde liegenden mentalen Zuständen, welche erschlossen werden müssen, festgehalten werden. Ich folge hier konsequent der von Redlich und Freedman in [Psychiatrie] entwickelten methodologischen Leitregel der psychiatrischen Symptomatologie. 6 Man sieht unschwer das damit sich andeutende gravierende methodologische Problem: Soll diese Aussage nicht leer werden, so muss scharf unterschieden werden (können) zwischen derjenigen Klasse von Identitätskrisen, die pathologische Erscheinungsformen des menschlichen Verhaltens zur Folge haben – wir sprechen dann von malignen Identitätskrisen –, und derjenigen Klasse von Verhaltensmustern, bei denen dies nicht der Fall ist. Die Rede ist dann von den benignen Identitätskrisen, die entweder völlig „normale“ Lernzuwächse designieren oder gar genuin innovative Leistungen im Gefolge haben. Um jedoch eine solche scharfe Unterscheidung leisten zu können, bedarf es, wie wir sehen werden, der idealtypologischen Konstruktion des Identitätsbegriffs, welcher konstitutives Element einer allgemeinen empirisch gehaltvollen Sozialisationstheorie ist: Identitätskrisen sowie Identitätsrekonstitutionen sind, da sie dem „subjektiv sinnhaften Sichverhalten der Einzelindividuen“ (Max Weber) konstitutiv zugehören, wesentliche Bestandteile jedweden Sozialisationsgeschehens, und folglich hängt von der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur eines Menschen, von seinem „Charakter“, ab, ob und in welcher Weise welche Formen von Identitätskrisen zu welchen genuin pathologischen Erscheinungsformen humanspezifischen Verhaltens führen und welche nicht. Denn dieser Charakter ist nun einmal immer eine Resultante des den Lebensverlauf eines Menschen bestimmenden Sozialisationsgeschehens – eine These, aus der sich nunmehr bereits an dieser Stelle die folgende zentrale Aussage herleiten lässt: Die Modalitäten des je individuellen Sozialisationsgeschehens bestimmen, da dadurch die jeweilige „Persönlichkeitsstruktur“ geprägt wird, sowohl die jeweilige Struktur der Identitätskrisen, welche jedes Individuum im Laufe seines Lebens durchzumachen gezwungen ist, als auch die Dynamik der je individuellen Verhaltensmodifikation, des Lerngeschehens also, welches im Humanbereich in der Regel als eine fortlaufende Ereigniskette von kognitiven Umorientierungsprozessen aufgefasst werden kann und muss, die, in der Sprache Max Webers formuliert, wesentlich die „Dynamik des (sozialen) Handelns“ (menschlicher) Individuen ausmachen. In genau diesem Sinne sind dann benigne und maligne Identitätskrisen die jeweiligen Resultanten unterschiedlich verlaufener Sozialisationsvorgänge, woraus logisch folgt: Jedwede Ätiologie entwicklungspsychopathologischer Syndrome gründet in einer allgemeinen, empirisch Die intime Verflochtenheit von „Identitätskrisen“ mit sozialen Konstellationen, welche einem „Individuum“ (soziale) Lernprozesse zumuten bzw. abverlangen, ist praktisch gegeben durch die extrem enge Verknüpfung von Sozialisationsprozessen mit Lernvorgängen und deren „natürlichen“ wie „sozialen“ Bedingungen: Lernleistungen und deren „Produkte“ sind die intersubjektive Beobachtung zugänglicher Resultanten von „Identitätskrisen“. 7 falsifizierbaren, Sozialisationstheorie, welche – sozusagen „differenzialdiagnostisch“ – benigne gegenüber malignen Identitätskrisen so zu diskriminieren vermag, dass sie die Wurzeln der kognitiven Dynamik subjektiv sinnhaften (sozialen) Handelns aufzudecken gestattet. Wäre diese Überlegung tragfähig, so würde das bedeuten, dass vor allem die PädoPsychiatrie, die sich als „Entwicklungspsychopathologie des Kindes- und Jugendalters“ (Resch et al.) versteht, ihre Erkenntnisgrundlage in einer solchen allgemeinen empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie hätte – eine Sichtweise, die, wie wir sehen werden, erhebliche Konsequenzen vor allem für die Anamnese und sodann auch naturgemäß für die Diagnostik klinisch auffälliger Verhaltensmuster haben dürfte. Was aber ist eigentlich „Sozialisation“ und was genau müsste eine „Sozialisationstheorie“ beinhalten, welche erstens die kognitive Dynamik humanspezifischen Verhaltens zu beschreiben gestattete, zweitens deren Wurzeln in der frühen Kindheit freizulegen imstande wäre und drittens den funktionalen Stellenwert der Identitätskrisen für die jeweilige Charakterbildung eines Menschen bestimmen könnte, um so zum einen „erfolgreiche“, zum anderen „gründlich schiefgelaufene“ Sozialisationsvorgänge erklären zu können?3 Halten wir hier zur Vorbereitung einer einigermaßen befriedigenden Beantwortung dieser Fragen die (methodologische) Grundthese der vorliegenden Arbeit fest, die sich um der Ausarbeitung einer allgemeinen Sozialisationstheorie willen auf eine mögliche Integration des genuin psychologischen Ansatzes, der den Begriff des „individuellen Verhaltens“ als „seinen“ Basalterm ansieht, mit dem genuin soziologischen Ansatz, der vom „Handlungsbegriff“ ausgeht, konzentriert: 3 Zur Vorbeugung gegenüber Missverständnissen und eventuellen überzogenen Erwartungen sollte vielleicht bereits an dieser Stelle explizit auf folgendes hingewiesen werden: Wie in den methodologischen Teilen der vorliegenden Arbeit hervorgehoben wird, ist es die vornehmliche Aufgabe erfahrungswissenschaftlicher Theorien, einigermaßen klar beschriebene Tatbestände unsere Wirklichkeit zu erklären. Dafür jedoch müssen die entsprechenden Theoriegebilde in einer einigermaßen logischen transparenten Weise vorliegen, müssen mithin vorher konstruiert und zumindest halbwegs empirisch validiert worden sein, sich also zumindest in einigen Bereichen bewährt haben. Es wird durchweg übersehen, dass auch in den sog. Gesellschaftswissenschaften die Konstruktion einer solchen empirisch falsifizierbaren Theorie ein äußerst mühseliges Geschäft ist, welches niemals von einem Forscher bzw. einer Forscherin alleine geleistet werden kann. Die hier vorgelegte Arbeit erstrebt deshalb auch nicht den Anspruch, bereits eine solche erklärungskräftige Sozialisationstheorie vorlegen zu können, einen Anspruch nämlich, der schlichtweg vermessen wäre. Vorgestellt wird hier vielmehr das methodologische Grundarsenal für eine solche (mögliche) Theorie, des Sozialisationsgeschehens indem die Bedingungen genannt werden die erfüllt sein müssen, damit wir irgendwann einmal über eine solche Theorie des Sozialisationsgeschehens verfügen, welche einer allgemeinen Ätiologie der Mentalerkrankungen als (kognitive) Hintergrundsfolie dienen könnte. Die gesamte Argumentationsstruktur meiner Arbeit stellt darauf ab, plausibel zu machen, dass bei systematischer Vernachlässigung des genuin soziologischen „piont of view“, wie derzeit noch allenthalben zu beobachten ist, nie und nimmer eine solche psychiatrie-relevante Sozialisationstheorie erarbeitet werden kann. 8 Psychologisch ist die Sozialisation zweifelsohne ein notorisch stattfindender Lernprozess, der gekennzeichnet ist durch Verhaltensmodifikationsstrukturen, die sich im Zuge ihrer primordialen Stadien zunächst einmal ausschließlich als „reine“, d. h. unmittelbar am sog. „organismischen Geschehen“ ansetzende, Verhaltensmodifikationen abspielen und sodann mehr und mehr auf kognitiven Umorientierungen, für die der Handlungsbegriff sozusagen „verantwortlich zeichnet“, beruhen. Schlagwortartig formuliert: Das zunächst einmal noch wesentlich bzw. ausschließlich triebgesteuerte „bloße“ Verhalten eines menschlichen Individuums, wie wir es in der (unmittelbaren) Postnatalperiode beobachten können, transformiert sich im Verlaufe von dessen Entwicklung zunehmend in ein kognitiv bzw. evaluativ gesteuertes soziales Handeln, welches hinfort mehr und mehr seine gesamte Verhaltensdynamik bestimmt. Und das Faszinosum der Freudschen Theorie in diesem Zusammenhang besteht darin, dass hierbei behauptet wird, es fände gleichzeitig ein in sich äußerst komplexes unbewusstes „Beiprogramm“ statt, welches die Modalitäten der kognitiven Umorientierungen tiefgreifend beeinflusst und welches seine Wurzeln im Ursprung des „IchWerdungsprozesses“ eines jeden menschlichen Individuums hat. Damit aber stoßen wir, wie unschwer zu sehen, auf einige in methodischer wie in methodologischer Hinsicht äußerst prekäre Probleme, müssen wir doch nicht nur den genauen Status einer Theorie des Sozialisationsgeschehens sowie den genauen Status des – wie zu vermuten ist – theoretischen Begriffs der „Identitätskrise“ innerhalb derselben zum einen in der „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ (Redlich und Freedman), zum anderen im Kanon der Humanwissenschaften insgesamt, sondern darüber hinaus auch noch den genauen Stellenwert unbewusst gewordener Lernvorgänge in diesem Sozialisationsgeschehen bestimmen.4 Nur so nämlich, so will mir scheinen, lässt sich sodann auch der Begriff der „Identität“ idealtypologisch konstruieren, der offensichtlich zu den tragenden Begrifflichkeiten einer allgemeinen, empirisch falsifizierbaren und aus genau diesem Grunde sodann eben auch erklärungskräftigen Sozialisationstheorie gehört.5 Und in diesem Zusammenhang ergibt sich bereits ein erster kritischer Blick in die 4 Man beachte die Thetik: Unbewusst gewordene Lernvorgänge sind es, welche auf eine wie auch immer genauer zu bestimmende Art und Weise das jeweilige subjektiv sinnhafte Handeln nebst dessen kognitiver Dynamik beeinträchtigen! Die Zerlegung des begrifflichen Arsenals eines Aussagensystems in theoretische und in Beobachtungsbegriffe ist, wie bereits weiter oben betont, eines der kompliziertesten Probleme der strengen Wissenschaftslehre, worauf in Abschnitt II. 3 zu sprechen zu kommen sein wird. 5 Identitätskonstruktionen und Identitätsrekonstitutionen gehören der kognitiven Dynamik jedweden „subjektiv sinnhaften Sichverhaltens zu Objekten“ (Max Weber) wesentlich zu, sind sie doch ganz bestimmte, im Zuge des Lerngeschehens fortlaufend notwendig werdende gedankliche Operationen, die allerdings nur dann bewusst vollzogen zu werden pflegen, wenn ein komplexes Lerngeschehen problematisch zu werden droht, sich 9 derzeitig verfügbare sozialisationstheoretische Literatur: Dass der Begriff der „Identität“ – nebst der mit ihm assoziierten Begriffe wie „Identitätskrise“, „Ich“, „Selbst“ etc. – zu den tragenden Begrifflichkeiten einer allgemeinen Sozialisationstheorie, mithin also auch zur sog. „Entwicklungspsychologie“ bzw. zur „Entwicklungspsychopathologie“, gehört, ist in der Regel unstrittig, dass hingegen eine solche „Sozialisationstheorie“ eine streng empirisch falsifizierbare Theorie sein muss, die konsequent mit idealtypischen Konstruktionen zu arbeiten gezwungen ist, ist alles andere als selbstverständlich. Denn: Was genau ist eigentlich eine „empirisch falsifizierbare Theorie“ und was ist eine „idealtypische Konstruktion“? Wie auch immer die Antwort auf dies methodologische Doppelfrage ausfallen wird, sicher ist jedenfalls, dass eine empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie, welche zu Recht den Anspruch erheben kann, mittels einer plausiblen Explikation des Begriffs der malignen Identitätskrise eine sowohl anamnestisch als auch diagnostisch als auch therapeutisch verwertbare Ätiologie der Mentalerkrankungen zu ermöglichen, imstande sein muss, präzise die Kernfrage allen (humanspezifischen) Sozialisationsgeschehens zu formulieren: Wann und wie transformiert sich humanspezifisches Verhalten in (subjektiv sinnhaftes) soziales Handeln? Entwicklungspsychopathologisch aber bedeutet dies: Je präziser sich die au fond ätiologische Frage nach den primordialen Konstitutionsbedingungen subjektiv sinnhaften sozialen Handelns beantworten lässt, desto genauer lässt sich auch Auskunft erlangen bezüglich der Frage, wann und wie sich bei diesem einzelnen Individuum zunehmend maligne werdende Identitätskrisen haben herausbilden können, in deren Verlauf das (subjektiv sinnhafte) rationale Handeln eines Individuums sich mehr und mehr mit „gestörten Verhaltensmustern“ (Redlich und Freedman) durchsetzte und dadurch zunehmend eben auch „zersetzt“ wurde. Denn es gilt die streng allgemeine Aussage, die wir nunmehr problemlos „herleiten“ können: Nehmen wegen ausgesprochen schlechter „Startbedingungen“ in der primordialen also sicht mehr „so ganz glatt“ vollzieht. „Identität“ bedeutet aus diesem Blickwinkel – und wenn man hierbei die weiter unten entwickelte These vom Primat der Konstitution des „sozialen Universums“ in den ersten Lebensjahren hinzuzieht, dass eine ganz bestimmte soziale Position in einem (gedanklichen) sozialen Universum gleichgesetzt wird mit einer anderen sozialen Position in genau diesem (gedanklichen) Universum. Denn – und dies ist der entscheidende Punkt – die als Symptome sich geltend machenden „Signale aus dem Unbewussten“ müssen ja, vor allem auch und gerade dann, wenn sie massiv in die Handlungsdynamik eingreifende Verhaltensstörungen sind, interpretiert werden, soll Handlungsfähigkeit nicht grundsätzlich in Gefahr geraten. Verleugnung, Verdrängung, Sublimierung etc. fungieren offenkundig nur dann personalstabilisierend, wenn wegen „glatten Aufgehens der Rechnung“ keine allzu massiven Dissonanzen bei der positionalen Gleichsetzungsprozedur auftreten. Aber auch hierbei operiert ja das Individuum mit einem Idealtypus von sich selbst, der, weil er mit der (erfolgreichen) Ausprägung der Kompetenz zur „Rollendistanz“ engstes zusammenhängt, als unabhängig von allen nur möglichen positionalen Situierungen gedacht werden muss. 10 Sozialisationsphase eines menschlichen Wesens die seine kognitive Dynamik bestimmenden Identitätskrisen mehr und mehr maligne werdende Gestalt an, ja gehen diese gar in identitätskritische Dauerzustände über, so erodiert über kurz oder lang die ursprünglich durchaus auf Rationalität hin angelegt gewesene kognitive Dynamik des Handelns dieses Menschen. Wie sich bereits terminologisch andeutet, lässt sich freilich genau diese Problematik nur im Bezugsrahmen einer genuin kultursoziologischen Paradigmatik, wie sie die Webersche „Begriffslehre des sozialen Handelns“ repräsentiert, überhaupt sinnvoll formulieren: Personalsystemische Verhaltensstörungen, wie sie z.B. in dem – wie ich finde, nach wie vor ausgezeichneten – Lehrbuch von Redlich und Freedman („Theorie und Praxis der Psychiatrie“) seinerzeit zu beschreiben versucht worden sind, so die zentrale methodologische These der hier vorgelegten Arbeit, lassen sich dann und nur dann auch in einer begrifflich präzisen Sprache diagnostizieren, wenn sich eine Idealtypologie rationalen (sozialen) Handelns konstruieren lässt, die Wesensbestandteil einer jeden empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie ist. Um die Ausarbeitung und Plausibilisierung genau dieser Grundfragestellung geht es in der hier vorgelegten Arbeit.6 2. Bemerkungen zum Forschungsstand Dass es einer sozialisationstheoretischen Fundierung sowohl der „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ (Redlich und Freedman) als auch der „Entwicklungspsychopathologie des Kindes- und Jugendalters“ (Resch et al.) bedarf, ist seit dem Erscheinen der Jasperschen „Psychopathologie“ allgemeiner Konsens.7 Darüber jedoch wie diese aussehen sollte, herrscht 6 Zur methodologischen Doppelfrage vgl. die Abschnitte II. 3. 2. und II. 5. 5., zur sozialisationstheoretischen Grundfrage vgl. den Abschnitt. II. 8., wo es im Rahmen einer relativ ausführlichen Erörterung der Rationalitätsproblematik um die Kernfrage aller psychiatrierelevanten Sozialisationstheorien gehen wird: Wie sieht die strukturelle Dynamik dieses Überganges von den noch stark organismisch gebundenen Verhaltensmodifikationen zu den ersten Ansätzen derjenigen Formen von kognitiven Umorientierungen aus, die im weiteren Verlauf der Sozialisation eines Individuums dessen subjektiv sinnvolles soziales Handeln bestimmen? Die sozialstrukturelle Präzisierung dieser „Kernfrage“ aller sozialisationstheoretischen Ansätze, die sich auf das familiale Umfeld eines Sozialisanden in der primordialen Sozialisationsphase bezieht, bildet dann den nächsten Schritt. 7 Die Jaspersche „Psychopathologie“ mit ihren zahlreichen Auflagen, an denen sich, wie Schmitt [Karl Jaspers] sehr schön herausgearbeitet hat, ablesen lässt, dass und warum sich dieses Grundlagenwerk zunehmend „ins Philosophische“ verlagert hat, ist Beleg für die Notwendigkeit des permanenten Rückbezuges der Psychiatrie auf methodische und methodologische Überlegungen. Zugleich aber zeigt sich hieran, dass eine 11 seit gut einhundert Jahren Uneinigkeit, was nicht zuletzt wohl auch daran liegt, dass die „Psychiatrie der Gegenwart ..... methodologisch betrachtet ein Irrgarten“8,der Psychiater, wie Tellenbach es in den 70er Jahren ausgedrückt hat, ein „Methodenchamäleon“ ist.9 Vielleicht muss das auch so sein. Vielleicht gibt es ja tatsächlich keine Möglichkeit, der Facettenmannigfaltigkeit des Verhaltens- und Handlungsrepertoires und deren Irritationen, wodurch das menschliche Wesen sich nun einmal auszeichnet, anders als mittels methodischer Vielfalt Rechung zu tragen. Das mag hier offen bleiben. Zu kritisieren jedoch ist – und dies betrifft die gesamte moderne Literatur hierzu – dass in den einschlägigen Handbuchartikeln und Sammelreferaten wie auch in den Monographien diese von Tellenbach diagnostizierte chamäleoneske Methodik einfach „abgespiegelt“ zu werden pflegt, was dazu geführt hat, dass überhaupt keine dezidierten methodischen wie auch methodologischen Positionen mehr so richtig bezogen werden.10 Davon versucht sich die vorliegende Arbeit zu unterscheiden und nimmt deshalb ganz bewusst den möglichen Vorwurf der Einseitigkeit in Kauf, die jedoch, wie ich meine, zumindest den einen wirklichen Vorzug hat, kritisiert, angegriffen und argumentativ diskutiert werden zu können.11 In genau diesem Sinne wird hier Stellung bezogen aus dem Blickwinkel einer dezidiert soziologischen Position, die sich, wie ich meine, zu Recht,konsequent zum einen in der Weberschen „Verstehenden Soziologie“, zum anderen in der sog. „Analytischen wirkliche „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ bei genauerem Zusehen notorisch Gefahr läuft, sich vom lebendigen Zusammenhang der Klinik abzulösen. Die „Entwicklungspsychopathologie“ ist natürlich ein Versuch, die Psychiatrie sozialisationstheoretisch zu fundieren. Nur besteht eben die Gefahr, dass eine solche sozialisationstheoretische Fundierung sich mehr und mehr von einer möglichen wissenschaftlichen Verpflichtung zu emanzipieren versucht. Zum Beleg dafür, dass bezüglich einer sozialisationstheoretischen Fundierung der Psychiatrie unter den Fachleuten Konsens herrscht, genügt ein oberflächlicher Blick in die entsprechenden Sammelwerke, von denen ich hier nur die folgenden nenne: Die beiden Teilbände der „Psychologie des 20. Jahrhunderts“, die sich als Band X mit den Ergebnissen für die Medizin befassen, die seinerzeitige Monographie von Heinz Remplein [Seelische Entwicklung], Resch’s Lehrbuch [Entwicklungspsychopathologie], Redlich und Freedman’s [Psychiatrie], sowie das Heft 4 der Zeitschrift für „Verhaltenstherapie und Psychosoziale Praxis“ mit dem Schwerpunkt „Therapie der Schizophrenie“ aus dem Jahre 2002. 8 so Wolfram Schmitt in [Karl Jaspers] S.46 9 Tellenbach [Wesen des Menschen] S.138ff 10 Vgl. hierzu vor allem meine in Abschnitt II. 4. dargelegte Analyse des seinerzeitigen Lehrbuchs von Redlich und Freedman [Psychiatrie], deren Ergebnisse, wie ich glaube, durchaus übertragbar sind. Es ist natürlich ein Manko der hier vorgelegten Arbeit, dass diese Überlegung nicht intensiver hat überprüft werden können. 11 Zum Postulat der „Einseitigkeit“ vgl. die Erörterung der Weberschen „Objektivitätspostulate“ in Abschnitt II. 5. 2. 12 Wissenschaftslehre“ verankert.12 Blickt man von einer solchen Position her sowohl in die ältere als auch die jüngere Literatur der psychiatrisch-medizinischen Forschung, so macht man eine verblüffende Feststellung: Generell fehlt eine Würdigung des genuin soziologischen Standpunktes und selbst bestimmte in der Fachsoziologie kaum strittige Grundorientierungen werden in der Regel noch nicht einmal erwähnt. Hierzu einige Beispiele: Obwohl in der Psychiatrie wie auch in der Pädo-Psychiatrie ganz allgemein die Bedeutung des frühkindlichfamilialen Umfeldes für die Ätiologie der Mentalerkrankungen betont zu werden pflegt, bleibt zumeist völlig unklar, was denn nun die „Familie“ soziologisch eigentlich ist. Ich bin auf keine einzige Untersuchung gestoßen, die im Rahmen ihrer psychiatrischen Forschungsorientierung die begriffliche Unterscheidung zwischen einer makrosoziologischen und einer mikrosoziologischen Bestimmung des Begriffs der „Familie“ konsequent beachtet. Makrosoziologisch ist nämlich die „Familie“ eine Sozialisationsagentur, eine Institution und ein System der sozialen Kontrolle. Dies ist von Bedeutung deshalb, weil makrosoziologisch die medizinisch-klinischen Institutionen ja genau dasselbe sind. Die erwähnte psychiatrische Literatur sieht dies zwar sehr wohl, schließt jedoch daran niemals irgendwelche Überlegungen an, die sich auf die Analogisierbarkeit der diesen beiden Systemen der sozialen Kontrolle gesamtgesellschaftlich obliegenden Sozialisationsverpflichtungen beziehen. Dasselbe gilt hinsichtlich der mikrosoziologischen Interpretation des sozialen Tatbestandes „Familie“. Dies ist umso unverständlicher, als ja ganz sicher die Ergebnisse der bisherigen Kleingruppenforschung für die Ausarbeitung einer Ätiologie der Mentalerkrankungen hochbedeutsam sein dürften. Selbst ein so ausgezeichnetes Grundlagenwerk wie der „Redlich/Freedman“, welches große Mühe darauf verwendet, um die Ergebnisse der seinerzeitigen „Double-Bind-Forschung“ zu verarbeiten, rekurriert selbst nicht auf die damals ja bereits sehr stark entwickelte sozialpsychologische Literatur. Das fällt bereits auf, wenn man nur die Bibliographie durchschaut: Die Namen Homans, Festinger, Newcomb, Sherif, etc., die ja für eine blühende Kleingruppenforschung, ja sogar für eine experimentelle Kleingruppenforschung stehen, sucht man vergeblich. 12 Nach gängiger Auffassung (sog. „herrschender Lehre“) erzeugt genau diese Verknüpfung der Weberschen „Wissenschaftslehre“ mit den Grundpostulaten der sog. „strengen Wissenschaftslogik“ einen Selbstwiderspruch, der in der sog. „methodischen Dichotomie“ von „Verstehen und Erklären“ liege. Anlässlich der Demonstration des sog. „DN-Schemas einer wissenschaftlichen Erklärung“ (HO-Modell) in Abschnitt II. 5. 5. soll gezeigt werden, dass ein solcher Widerspruch nicht besteht, dass sich vielmehr das hierbei involvierte methodologische Grundproblem der Kulturwissenschaften sehr gut auflösen lässt. Ich stütze mich in meiner Argumentation vor allem auf die Forschungen der „Dossenheimer Arbeitsgruppe“, wie sie in kompakter Form im [Forschungsantrag] zusammengefasst worden sind. 13 Selbstverständlich kann man verstehen, dass vor allem die klinische Medizin davor zurückschreckt, sich auf das Gebiet der sozialwissenschaftlichen Grundlagenforschung zu begeben, hat doch bereits Max Weber bezüglich der „Soziologie“ auf den problematischen „Sinn dieses sehr vieldeutig gebrauchten Wortes“ explizit hingewiesen. Denn was ist eigentlich diese „Soziologie“?, fragt sich auch gegenwärtig ja keineswegs nur jeder Laie. An der Weberschen „Diagnose“ und dem Grundlagenstreit zwischen Durkheim und den sog. „Massenpsychologen“ in der französischen Sozialforschung zu Beginn des 20. Jahrhunderts scheint sich ja nun tatsächlich in der Zwischenzeit nicht allzu viel geändert zu haben. Dies lehrt bereits ein auch nur oberflächlicher Blick in die großen Grundlagenkontroversen der 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wie sie sich im sog. „Positivismusstreit in der deutschen Soziologie“ und in der sog. „Konstruktivismuskontroverse“ in der Methodologie ebenso abgespielt haben wie in der empirischen Forschungspraxis der Sozialforschung. Selbst der methodologisch einigermaßen sensibilisierte Psychiater dürfte wirkliche Schwierigkeiten haben, sich in diesem Tellenbach’schen „methodologischen Irrgarten“ einigermaßen zu Recht zu finden: Die Psychologen haben behauptet, die „Soziologie“ sei überhaupt überflüssig, die Historiker sprachen gar von einem „Wortmaskenverleihinstitut“ und definieren diese „Soziologie“ ironisch als „Historie ohne harte Arbeit“. Die Verwirrung dürfte komplett sein, wenn man versucht den Fachsoziologen selbst in diesem Zusammenhang Gehör zu verschaffen. Selbst namhafte Fachsoziologen nämlich vertreten nach wie vor die Auffassung, „wahre“ Soziologie sei bei genauerem Hinsehen, insofern sie tatsächlich wissenschaftlich sein wolle, nichts anderes als „Psychologie“. Selbst der fachsoziologisch durch seine „Theorie der sozialen Gruppe“ hervorragend ausgewiesene Parsonsschüler G.C. Homans vertritt bzw. vertrat die These, die „Soziologie“ sei vollständig reduzierbar auf „Psychologie“ und sprach folgerichtig auch nicht mehr von „sozialem Handeln“ als dem eigentlichen Gegenstandsbereich der Sozialforschung, sondern von den „Elementarformen des sozialen Verhaltens“ und plädiert nach wie vor in seiner Polemik gegen den „Durkheimianismus“ für eine systematische forschungsstrategische Bagatellisierung der institutionellen Zusammenhänge des sozialen Lebens. Namhafte Soziologen und Wissenschaftstheoretiker wie der Popperianer Hans Albert, Stendenbach, Hummell, Opp, Lindenberg und Esser sind ihm in ihren Lehrbüchern ebenso gefolgt wie es die renommierte „Mannheimer Schule der modernen deutschen Sozialpsychologie“ getan hat. Man denke nur an die nach wie vor vorzüglich gestalteten Lehrbücher der Sozialpsychologie von Martin Irle und seinen Schülern. 14 Wie auch immer: Verständlich ist zweifelsohne angesichts dieser Problemlage die vorsichtige Zurückhaltung der meisten Psychiater, vornehmlich dann, wenn sie klinisch praktisch arbeitende Ärzte sind. Die entscheidende Frage jedoch ist meiner Meinung nach, ob sie letzten Endes es sich leisten können, bezüglich genau dieser Problemlage Zurückhaltung zu üben. Meiner Auffassung nach ist das nämlich nicht möglich, und aus diesem Grunde wird die vorliegende Arbeit auf die hier angeschnittene Problematik zumindest bezugnehmen, um das hierbei involvierte Problem als Problem immerhin kenntlich machen zu können. Zu hoffen ist, dass zumindest die Bedeutsamkeit dieser „Grundlagenprobleme“ plausibel gemacht werden kann. In den Mittelpunkt gestellt habe ich deshalb auch eine in dieser Arbeit erstmalig mit Blick auf die sozialisationstheoretische Grundlage der Psychiatrie entwickelte Stellungnahme zu dem prekären Problem des Verhältnisses zwischen „Psychologie“ und „Soziologie“. Diese Problematik sowie die mit dieser engstes verbundene erkenntnistheoretische Problemlage ist notorischer Gegenstand eigentlich aller Arbeiten der „Dossenheimer Forschungsgruppe“. Naturgemäß sind die Auffassungen hierzu kontrovers, jedoch ist es meine Meinung, dass eine dezidierte Stellungnahme, wie ich sie hier vorstelle, in jedem Fall besser ist als gar keine. Nimmt man sich von dieser Position her zum einen das in den 60er Jahren erschienene – wie ich finde: nach wie vor ausgezeichnete – Lehrbuch von Redlich und Freedman und sodann das erst in den letzten Jahren erschienene Lehrbuch von Resch et al. mit dem anspruchvollen Titel „Entwicklungspsychopathologie des Kindes- und Jugendalters“, welches „in seiner Art“ gleichfalls vorzüglich ist, zur Hand, so zeigt sich die bereits oben skizzierte Problemlage. Beide Lehrbücher erwähnen noch nicht einmal die Arbeiten von Max Weber, eine Auseinandersetzung mit der sozialwissenschaftlichen Grundlagenforschung sucht man vergeblich, ja selbst ein auch nur halbwegs ernsthafter Versuch zu einer wirklich integrativen Behandlung der verfügbaren psychologischen Theorien wird nicht gemacht. Genau dasselbe gilt für die eigentliche methodologische Dimension der ja wesentlich kulturwissenschaftlich zu diskutierenden sog. „Kooperations- und Integrationsproblematik“: Obwohl sehr stark die Notwendigkeit der „Integration“ der mittlerweile in einer unüberschaubaren Fülle vorliegenden Theorien, Modelle, Ansätze, Konzepte, Methoden etc. beklagend hervorgehoben wird, ist beispielsweise die Grundlagenkontroverse zum sog. „methodologischen Individualismus“, die ja ausschließlich um das „Integrationsproblem in den Kultur- und Sozialwissenschaften“ zentriert gewesen ist, völlig unbekannt. Dasselbe gilt für die in diesem Zusammenhang ja gleichfalls wichtige Kontroverse um den sog. „labeling-approach“ zwischen Fritz Sack und den sog. „methodologischen Individualisten“. 15 Ich meine, dass die Vermeidung von Problemen, welche vor allem die methodologische Fragestellung betreffen, unerwünschte Konsequenzen haben muss insbesondere für das Verhältnis von Ätiologie und Diagnostik, ist doch hier das genuin wissenschaftstheoretische Problem des Verhältnisses von klassifikatorischen Systemen und komparativem Hintergrund, welches ich im „Rationalitätsabschnitt“ ausführlich zur Sprache bringen werde, mit Händen zu greifen. Einige methodologisch orientierte Arbeiten wie z.B. die Übersichtsartikel von Schmitt und Kraus, sprechen zwar das Problem einer Abklärung des Verhältnisses von „Verstehen“ und „Erklären“ an, erwähnen auch das sog. „DN-Schema einer wissenschaftlichen Erklärung“, vermeiden jedoch eine entsprechend klare auf den Ergebnissen der strengen Wissenschaftslehre fußenden Begriffssprache: Die Begriffe „Theorie“, „Hypothese“, „Gesetzmäßigkeit“, „empirischer Gehalt“, „Erklärung“, „Prognose“, „Idealtypus“, etc., denen ja mittlerweile ganz bestimmte fachterminologisch abgeklärte Bedeutungen in der strengen Wissenschaftslehre zukommen, werden kunterbunt durcheinandergeworfen und je nach unmittelbarem Bedarf umdefiniert. Ich habe es deshalb als meine Pflicht angesehen, in einem „Thesenkatalog“ zumindest postulatorisch aufzulisten, was ein dezidiert soziologischer Standpunkt hierzu sagen muss. Die dort vorgeführten Begriffe sind sozusagen mein begriffsanalytisches Inventar. Solcherart methodologische Sorglosigkeit erzeugt bisweilen z. T. absurde „Zusammenstellungen“: Resch’s Lehrbuch beispielweise, welches, wie gesagt, zweifelsohne ein wirklich gutes Lehrbuch ist, verwendet zum einen zwecks Charakterisierung kognitiver Sozialisationsvorgänge die Piaget’sche „Theorie“, bezieht sich sodann jedoch auf die Russische Schule (Luria und Wygotski), deren Theoriegebilde, wie Luckmann in seiner Einleitung zu Wygotski’s [Denken und Sprechen] zu Recht hervorgehoben hat, im Widerspruch mit dem Piaget’schen Forschungsansatz steht. Dies geschieht hier ganz selbstverständlich als praktisch geübter Eklektizismus: Offenkundig findet niemand etwas dabei, ohne explizite Erörterung der sog. Integrationsproblematik sich widersprechende Theoriegebilde zu einem einheitlichen „Ansatz“ zu verknüpfen, wenn „praktische Urteilskraft“ dies als geboten erscheinen lässt. Jeder auch nur oberflächliche Blick in ein beliebiges Lehrbuch der strengen Wissenschaftslehre hätte Auskunft darüber geben können, dass und inwiefern Eklektizismen und Synkretismen zu logischen Katastrophen führen: Die auf solch eine Art und Weise zusammengestellte „Theorie“ ist prinzipiell ohne Informationsgehalt, kann mithin auch nichts 16 erklären, ist also auch bar jeglichen Wertes auch und gerade für die Ausarbeitung einer halbwegs präzisen Diagnostik und Ätiologie.13 Doch nicht allein hier liegt der Fehler. Ebenso gravierend scheint mir der Tatbestand zu sein, dass die meisten psychiatrischen Grundlagenforschungen ein ganz offenkundig gestörtes Verhältnis zu dem methodologisch hochsensiblen Problem der Beziehungen zwischen klassifikatorischen Systemen und komparativen begrifflichen Strukturen haben: Die Diagnostik muss natürlich wegen der eventuellen therapeutischen Konsequenzen, die eine bestimmte Diagnose haben könnte, konsequent mit klassifikatorischen Begriffen verfahren. In dieser Hinsicht besteht eine sehr weitreichende Analogie zwischen klinischer Diagnostik und praktischer Jurisprudenz: Scharfe Begrifflichkeiten mit eindeutigen semantischen Kernen bilden nun einmal das wichtigste methodische Arsenal „angewandter“ Wissenschaften. Jedoch muss auch gesehen werden, wie weit diese Analogie reicht und wo sie endet. Die Psychiatrie wendet Theoriegebilde an, deren Validität unabhängig von der anwendenden Praxis feststehen muss.14 Die medizinische Diagnostik beruht also gerade nicht auf Theoriegebilden mit wesentlich klassifikatorischer Grundstruktur, sondern steht stets auf dem Boden von empirisch falsifizierbaren Hypothesenkonstruktionen, die wegen des (notwendigen) Gebrauchs von operativen Begrifflichkeiten in ihnen eine wesentlich komparative Struktur besitzen müssen, die ja selbst wiederum nur solange ein Notbehelf ist, solange sich die fraglichen Begriffe nicht quantifizieren lassen. Soweit ich das zu überschauen vermag, wird die damit angeschnittene Begriffsproblematik in der Regel in der psychiatrischen Fachliteratur nicht gesehen. In Abschnitt II. 8. 2. wird deswegen ad nauseam diese Problematik so kleinschrittig vorgeführt, dass deutlich werden kann, worin der methodologische „Knackpunkt“ meiner hier vorgelegten Arbeit liegt. Die vorliegende Arbeit wird in Anlehnung an die Forschungen von Ernst Topitsch und Rainer M. Lepsius scharf unterscheiden zwischen den aus lebenspraktischen Zusammenhängen heraus entstehenden bzw. entstandenen Sozialtheorien und den sozialwissenschaftlichen Theorien. Nur dann nämlich, wenn diese Unterscheidung konsequent durchgehalten wird, lässt sich das Identitätskonstrukt so fassen, dass es als ein Grundbegriff einer 13 In seiner Kritik an der Wirtschaft- und Sozialgeschichtsforschung hat Porath in [Narratives Paradigma] den Nachweis geführt, dass der methodisch gepflegte Eklektizismus in der „Modernen deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte“ (Wehler, Conze, Groh, Kocka) notwendigerweise zu zirkulären Erklärungen führt. 14 Vgl. hierzu meine Analyse des Lehrbuchs Redlich und Freedman [Psychiatrie], in Abschnitt II. 4. 17 Sozialisationstheorie fungieren kann.15 Hier liegt ein weiteres Manko in der psychiatrischen Literatur, die diesen Unterschied normalerweise genauso wenig beachtet, wie es nicht nur die Psychoanalytiker, sondern eben auch die kognitivistischen Lerntheoretiker tun. Selbst dann, wenn sozialpsychologisch vorgegangen wird, ja sogar auf die Wichtigkeit des sog. „symbolischen Interaktionismus“ hingewiesen wird, wird zwischen diesen Sozialtheorien, die in ihrem Insgesamt die jeweiligen kognitiven Universen der Individuen bevölkern, und den sozialwissenschaftlichen Theorien, welche ja bezugzunehmen haben auf diese wohl wichtigste Klasse von „sozialen Kognitionen“, nicht unterschieden. Folgerichtig wird auch die „Doppelsemantik“ des „Identitätskonstruktes“ in expliziter Weise jedenfalls nirgendwo beachtet.16 Hier halte ich lediglich die zentrale These fest: Die scharfe Differenzierung zwischen den sozusagen naturwüchsig entstehenden wie entstandenen „Sozialtheorien“, in deren Rahmen subjektiv sinnhaft sich verhaltende menschliche Wesen ihre je spezifischen Identitätskonstruktionen vornehmen, und den „sozialwissenschaftlichen Theorien“, welche sich wahrheitsfähig auf genau diese je subjektiven Identitätskonstruktionsprinzipien beziehen, um so deren Funktionen für die jeweiligen personalen Stabilisierungen beschreiben zu können, ist wohl die wichtigste Unterscheidung der gesamten empirischen Sozialforschung, deren wissenschaftstheoretischer Problemkern die – bislang nichtgelöste – Ideologiefrage ausmacht. Wie auch immer letztendlich dieses Problem gelöst werden mag, – sicher ist jedenfalls, dass sich ohne die Unterscheidung zwischen Sozialtheorie und sozialwissenschaftlichen Theorien die Begriffe „Identität“ bzw. „Identitätskrise“ gar nicht idealtypisch konstruieren lassen und sich folglich auch der Mechanismus der (subjektiven) „Identitätskonstruktionsprinzipien“ nicht richtig erläutern lässt. Vom soziologischen Standpunkt her lässt sich noch ein weiteres Manko in der psychiatrischen Literatur feststellen. Gemeint ist die Umgehensweise mit der sog. „Rollentheorie“. Diese ist, wie sehr oft zu Recht festgestellt worden ist, im strengen Sinne eigentlich keine Theorie, sondern eher ein klassifikatorisch angelegtes Inventar von 15 Die in der primordialen Sozialisationsphase eines Menschen sich abspielende „Enkulturation“ ist der Erwerb genau dieser Sozialisationstheorie, mittels derer ein „subjektiv sinnhaft sich verhaltendes Einzelindividuum“ (so die Webersche „Definition“ des eigentlichen „Trägers“ allen gesellschaftlichen Geschehens, dessen „Atom“ sozusagen) nicht nur „sein“ soziales Universum sondern eben auch „seine“ Identität konstruiert. 16 Später werden wir sehen: Identität wird den personalen Systemen, welche die „Agenten“ sozialer Systeme sind bzw. es werden sollen, gesellschaftlich zugeschrieben, und die Art und Weise, wie dies in welchen (familialen) Rollenkontexten geschieht, konstituiert, da so die jeweiligen Identitätskonstruktionsprinzipien vermittelt werden, zugleich auch die jeweiligen Bedingungen des Identitätserlebens, die jeweiligen Strukturen der Identitätskrisen und die jeweiligen Kompetenzen zur Identitätsrekonstitution. 18 Beschreibungsmöglichkeiten. Mit anderen Worten: Die Rollentheorie erklärt nichts und kann dies trivialerweise auch nicht, ganz einfach deshalb, weil sie ausschließlich zu dem Zweck entworfen worden ist, ein halbwegs wertneutrales Begriffsschema zur Verfügung zu haben für die Beschreibung von Sozialstrukturen, die der neuzeitlich-okzidentalen Kulturwelt fremd (gewesen) sind. In diesem Sinne hat 1936 Linton den Rollenbegriff als Mittel der sozialstrukturellen Analyse eingeführt. Als ein Beschreibungsinstrument, mittels dessen sich relativ neutral institutionelle Tatbestände sowohl des eigenen als auch des fremden Kulturkreises analysieren lassen, ist diese „Rollentheorie“ allerdings vor allem deswegen von außerordentlich hohem Wert, weil sie Beschreibungen von Sozialstrukturen ermöglicht, ohne dass man Gefahr läuft, psychologische Selbstverständlichkeiten in die betreffenden sozialen Agenten hineinzuprojizieren. Anders formuliert: Es lassen sich Verhaltensregelmäßigkeiten auch dann „strukturell“ beschreiben, die man einfach nur beobachtet, ohne dass man über ein entsprechendes psychologisches Hintergrundswissen verfügt. Rollenverhalten jedenfalls – und darauf kommt es hier an – kann beobachtet und beschrieben werden, ohne irgendwelche Personalastrologien betreiben zu müssen. In diesem Sinne ist die „Rollentheorie“ auch in der Psychiatrie sehr oft verwendet worden. Übersehen worden ist dabei jedoch zumeist, dass dieses analytische Instrument erst dann seine eigentliche Fruchtbarkeit erweist, wenn man es mit empirisch falsifizierbaren Theorien in einen Zusammenhang bringt. So steht in der Tat die „Rollentheorie“ als fruchtbares „Brückenvokabular“ in der Mitte zwischen Psychologie und Soziologie. Es ist genau dieser Punkt, der in der Literatur viel zu wenig gesehen wird. Überschärft formuliert: Mit den analytischen „Angeboten“ der Rollentheorie kann nur dann fruchtbringend verfahren werden, wenn man sie mit dem dezidierten Interesse an einer theoretischen Integration von soziologischen und psychologischen Hypothesen konsequent texthermeneutisch behandelt. So ist insbesondere der ansonsten recht gute, da durchaus informative, Übersichtsartikel von Kraus [Rollentheorie] fast wertlos: Die theoretische Hintergrundsfolie leidet an eklektizistischer und synkretistischer Mixtur, so dass einige von Kraus eingeführte Begriffe, wie z. B. der der „Rollenüberidentifikation“, überhaupt nicht mehr klar zuzuordnen sind: Völlig willkürlich wird dieser Begriff eingeführt und in einen definitorischen Zusammenhang z.B. mit dem hochtheoretischen Begriff der „manischen Depression“ gebracht. Da Kraus jedoch nicht klar macht, ob er hierbei eine Definition, eine Operationalisierung oder aber eine empirische Hypothese im Sinne hat, ist seine gesamte argumentative Aussagenkombination fast wertlos. Überhaupt lässt sich Kritik formulieren an der Art und Weise, wie sehr oft mit 19 der verfügbaren Literatur umgegangen zu werden pflegt. Ganz allgemein lässt sich die „Sünde“ feststellen, dass bei der vornehmlichen Verwendung von Fachzeitschriftenmaterial konsequent texthermeneutisch gar nicht vorgegangen werden kann. So haben selbst Handbuchartikel kaum einen größeren Wert als den einer kommentierten Literaturliste. In diesem Zusammenhang ist wiederum das von Bedeutung, was bereits weiter oben kritisch angemerkt wurde: Theoretische und methodische Positionen werden nur sporadisch referiert, nicht jedoch im Hinblick auf eine präzise ausformulierte Fragestellung hin analysiert, was notwendigerweise zu genau derjenigen „handwerkelnden Ad-hoc-Strategie“ führen muss, die weiter oben als eklektizistisch und synkretistisch kritisiert wurde. Dass „der Kranke“, der „mental Kranke“ und vor allen Dingen das „mental kranke Kind“ Gegenstand des ärztlichen Verständnisses sein muss, dürfte unbestritten sein. Das gilt selbstverständlich auch dann, wenn ein solches Verständnis sich des ganzen mittlerweile verfügbaren Inventars streng naturwissenschaftlich gesicherten Wissens zu versichern und zu bedienen versucht. „Ganz versteht den Menschen nur der Mensch“, lautet bekanntlich eine mittlerweile bereits zur Phrase gewordene Formel psychologischen wie hermeneutischen „Verstehens“. Und überhaupt: Die sog. „Verstehenslehre“ steht mit Recht auf der Grenzlinie zwischen den Naturwissenschaften und den sog. Humanwissenschaften, bildet also auch – oder sollte es zumindest tun – den eigentlichen Gegenstand einer Methodologie der Heilkunde. Die „Psychopathologie“ Jaspers ist bekanntlich sehr stark an die Rickert’sche Fundierung der sog. Kulturwissenschaften angelehnt, wie eine akribische Max-WeberForschung mittlerweile hat herausarbeiten können. Es ergibt sich von daher bereits eine Grundlagenproblematik der Medizin, welche diesen „Riss in der Methodik“ sozusagen als ein Grundstigma in sich birgt. Selbstverständlich wird die hier vorgelegte Arbeit versuchen, diesen „methodischen Irrgarten“ so weitgehend wie möglich zu vermeiden. Jedoch gilt auch in diesem Zusammenhang die weiter oben formulierte Grundmaxime meiner Arbeit: Man muss Stellung beziehen. Aus diesem Blickwinkel ergibt sich ein weiterer gravierender Kritikpunkt an der psychiatrisch orientierten Erkenntnispraxis: Obwohl jeder auch nur oberflächliche Blick in die sog. „Philosophische Hermeneutik“ (Gadamer) darüber belehren kann, dass methodisch scharf unterschieden werden muss zwischen der sog. „psychologischen Konzeption des Verstehens“ und der sog. „hermeneutischen Konzeption des Verstehens“, wird genau dieser Unterschied in der Regel nicht beachtet. Für eine dezidiert sozialisationstheoretisch ausgerichtete Interessensorientierung ist gleichwohl diese Unterscheidung hoch bedeutsam. Dies gilt gerade nicht lediglich nur dann ausschließlich, wenn man, wie ich es tue, die „Verstehende 20 Soziologie“ Max Webers favorisiert. Um die spezifische Abhängigkeit ganz bestimmter personeller Einstellungssysteme von ganz bestimmten Weltbildern und Ideen in Hypothesen präzise fassen zu können – und das muss eine konsequente Sozialisationsforschung natürlich –, muss zwischen den „objektiven Sinngebilden“, die es zu „verstehen“ gilt und den „motivierenden Weltbildern“, die Bestandteil subjektiver Sinnkonstruktion sind, terminologisch scharf unterschieden werden. Wir benötigen doch eine Rekonstruktion z.B. der Ethik wie der Weltbilder einer medizinischen Institution, um sodann das Ausmaß abschätzen zu können, in welchem diese institutionelle Ethik bei den Personen, die als Ärzte fungieren, in deren Einstellungen präsent sind. Und dasselbe gilt natürlich für die Patienten. Würde man die Unterscheidung nicht beachten, um die es hier geht, so könnte man niemals die Beziehungen analysieren zwischen einer durch eine ganz bestimmte Idee sowie durch ein ganz bestimmtes Wertsystem dominierten Sozialstruktur und dem subjektiv sinnhaften Handeln derjenigen Individuen, die im Rahmen dieser Sozialstruktur sozialisiert worden sind. Aus diesem Grunde muss ganz einfach eine wirkliche auch und gerade ethisch engagierte „Entwicklungspsychopathologie des Kindes- und Jugendalters“, welche das „Verstehen des Kindes“ in den Mittelpunkt aller ihrer Bemühungen stellt, wesentlich unzulänglich bleiben, wenn sie diese fundamentale methodische Unterscheidung der Philosophischen Hermeneutik zu sehr vernachlässigt. Hier schließt sich zwanglos meine diesbezügliche Kritik mit meiner bereits oben geäußerten Kritik an der gänzlichen Außerachtlassung insbesondere der Weberschen Verstehenslehre zusammen. Bislang nämlich gibt es nur einen einzigen wirklich diskutablen Versuch, genau diese methodische Maxime der Philosophischen Hermeneutik in ein genuin wissenschaftliches Erkenntnisprogramm zu überführen: die Webersche „Begriffslehre des sozialen Handelns“. Damit in engem Zusammenhang steht auch die allenthalben zu beobachtende völlige Ausblendung der „Kulturwerte-Diskussion“, was, wie ich meine, massive Konsequenzen vor allen Dingen für die Formulierung der Therapieziele hat, deren Realisation ja den „Funktionären“ der medizinisch-klinischen Systeme der sozialen Kontrolle als verbindliche Pflicht obliegt: durchorganisiertes Makrosoziologisch System der ist die sozialen Psychiatrie Kontrolle, ein mittlerweile welchem ganz perfekt bestimmte Sozialisationsaufgaben und Re-Sozialisationsaufgaben auferlegt sind, die sie zu bewältigen hat, wenn sie nicht mit der Werte- und Normstruktur unseres derzeitig geltenden Moral- und Rechtssystems in Konflikt geraten will. Auf die Frage: „Was ist, will und kann die Psychiatrie?“, muss die erste und wichtigste Antwort lauten: Sie ist ein System der sozialen Kontrolle, dem die Realisation ganz bestimmter Sozialisationszielvorgaben und Re21 Sozialisationszielvorgaben seitens unserer derzeitig geltenden Moral- und Rechtsordnung auferlegt ist, die samt und sonders mit den Werten der „Mündigkeit“, „Selbstverantwortung“ etc. etc. assoziiert ist. Dass unsere Rechtsordnung dabei genau diesem System der sozialen Kontrolle – und dies unterscheidet es z.B. von unserem Strafrechtssystem – zuweilen erstaunlich weitgefasste Handlungsspielräume bei der Erfüllung ihrer „gesellschaftlichen Aufgaben“ einräumt, ändert nichts an dem grundsätzlichen Tatbestand, dass es nun einmal „Grenzen der Wirksamkeitsmöglichkeiten“ gibt, deren Überschreitung unabdingbar die „Aufmerksamkeit“ anderer – nämlich justiziärer Systeme der sozialen Kontrolle auf sich ziehen würde. Ich komme nunmehr zu dem gravierensten aber auch präkersten Vorwurf, der den meisten Arbeiten in der Psychiatrie gemacht werden muss: Es fehlt der forschungsheuristische Ausgriff auf die mögliche Ausarbeitung erklärungsrelevanter Theorien, die allein, wie es seitens der Naturwissenschaften der Fall ist, die Möglichkeit in sich bergen würde, wirklich ätiologisch vorgehen zu können. Die Verschiebung der Schwerpunkte zur Naturwissenschaft, wie sie in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat und zumeist relativ hilflos bisweilen auch beklagt wird, ist allein deshalb verständlich, weil diese naturwissenschaftlichen Theorien ja tatsächlich so etwas wie eine halbwegs gesicherte Hintergrundsfolie für die Ätiologie der Mentalerkrankungen abgeben. Dass damit gleichwohl eine Einengung der Blickrichtung erfolgt, ist nur natürlich. In der strengen Wissenschaftslehre ist angeblich vor allem seitens der sog. „Positivisten“, so wird behauptet, immer wieder darauf aufmerksam gemacht worden, dass die sog. „Geisteswissenschaften“ wesentlich daran kranken, sie würden sich nicht nach dem Vorbild der Naturwissenschaften ausbilden. Die Forschungen des „Dossenheimer Arbeitskreises“ haben zeigen können, dass das Bild, was hier von den Positivisten gezeichnet wird, „so“ gar nicht stimmt. Insbesondere die „Wiener Schule des Neopositivismus“ hat diesen Vorwurf nämlich völlig anders formuliert. Es geht nicht darum, den Humanwissenschaften vorzuwerfen, sie richteten sich zu wenig naturwissenschaftlich aus. Der Vorwurf lautet vielmehr: Die Humanwissenschaften bemühen sich zu wenig um die Konstruktion empirisch falsifizierbarer Hypothesen, und es ist dieser Mangel an Bemühung, der kritisiert wird. Ob tatsächlich irgendwann einmal Theorien konstruiert werden können in den Humanwissenschaften, die das Ausmaß an Exaktheit und Allgemeinheit aufweisen, wie es die zumeist in mathematischer Sprache formulierten naturwissenschaftlichen Theorien tun, steht durchaus in den Sternen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Worum es vielmehr geht, ist folgendes: Die geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung dramatisiert viel zu sehr den vermeintlich grundsätzlichen Widerspruch zwischen 22 Hypothesen, die sich einer quantitativen Begriffssprache bedienen, und Hypothesen die mit qualitativen Begriffen arbeiten. Durch die Maschen dieser vermeintlich erschöpfenden Alternative fällt nämlich die real gegebene Möglichkeit hindurch, dezidierte empirische Hypothesen konstruieren zu können, die sich einer komparativen Begrifflichkeit bedienen. Diese Hypothesen haben jedoch dieselbe logische Struktur wie die bewunderten quantitativ verfassten Hypothesen der strengen Naturwissenschaften. Der Hauptteil und das Hauptgewicht der hier vorgelegten Arbeit wird auf genau diesem – wie ich meine: entscheidenden – Punkt liegen. Dafür allerdings muss scharf unterschieden werden zwischen „Definitionen“, „Arbeitsbegriffen“, „Grundannahmen“ und „Hypothesen“. In sehr engem Zusammenhang damit steht meine Kritik an der Art und Weise, wie „Fallbeschreibungen“ sich präsentieren. Hier ist ein, wie ich finde, unerträgliches Mischverhältnis von hochtheoretischem Fachvokabular und zuweilen bis ans Primitive grenzender Umgangssprachlichkeit gegeben, welche dem Postulat der intersubjektiven Überprüfbarkeit widerspricht. Doch dies nur nebenbei. Ich komme zum Abschluss: Der therapeutischen Heuristik der Forschungsgruppe Resch zufolge steht zu Recht im Zentrum die Frage: Wie können wir als klinisch ausgerichtete Pädo-Psychiater die Welt des Kindes verstehen? „Forschung“ heißt in diesem Fall ja tatsächlich: Entdeckungsreise in eine uns unbekannte geistige Welt. Diese „Grundfragestellung der Pädo-Pyschiatrie“ hat sehr weitreichende Implikationen. Vor allem lässt sie sich problemlos in die Fragestellung „einbinden“, die in der vorliegenden Arbeit im Abschnitt „Wissenschaft und Forschung“ explizit aufgeworfen werden wird: Eine uns eigentlich wohlvertraute Welt ist „uns Erwachsenen“, die wir ja einen relativ langen Sozialisationsweg hinter uns haben, mittlerweile so völlig unvertraut geworden, dass wir sie ganz neu zu entdecken haben. In der Tat müssen wir, wie Resch es formuliert hat, lernen zu verstehen. Ein wirklich interessanter Gedanke – wenn man ihn konsequent zu Ende denkt. Selbstverständlich nämlich beinhaltet er ja auch eine ganz bestimmte Moral, die sich problemlos auf die Kant’sche Ethik beziehen lässt: Verobjekte Dein Gegenüber nicht, nimm es ernst – nämlich als „Zweck an sich“ –, sei Dir jedoch bewusst, dass es noch kein Erwachsener ist, mit dem Du es zu tun hast und mit dem Du sprichst. Notwendige Bedingung dafür jedoch, dass sich solche Maximen überhaupt beherzigen lassen, ist die forschende Bemühung um die Erschließung der „Welt des Kindes“, conditio sine qua non auch für mögliche Therapien. 23 Wie aber sollte wohl eine solche Erschließung aussehen, wenn bereits auf Grund des theoretischen Ansatzes nicht hinreichend unterschieden werden kann zwischen den jeweiligen subjektiven Sinnkonstruktionen des Kindes und dessen objektiv bestehender sozialer Welt? Nur auf Grundlage dieser genuin psychologischen und zugleich soziologischen Problemstellung lassen sich, wie ich meine, auch solche Fragen sinnvoll stellen: Wie sieht das soziale Universum eines Kindes aus? Wie konstruiert es seine „innere“, wie seine „äußere Realität“? Und vor allem: Wann, wie und unter welchen sozialstrukturellen Rahmenbedingungen in der primordialen Sozialisationsphase hat eigentlich ein Kind gelernt, zwischen seiner „inneren Realität“ und der „äußeren Realität“ entscheidungsrelevant zu differenzieren? Selbstverständlich ist der methodische Grundansatz der Forschungsgruppe Resch, welcher besagt, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrie lernen müsse, das Kind zu verstehen, völlig korrekt und stimmt mit demjenigen, der in der vorliegenden Arbeit entwickelt wird, völlig überein. Nur überschärfe ich ihn noch dahingehend: Nicht nur die Forschungsethik der PädoPsychiatrie, sondern die Forschungsethik der Humanwissenschaften überhaupt sollte „lernen“ vor allem und an erster Stelle „das Kind zu verstehen“. Dafür aber bedarf es einer Beantwortung genau derjenigen Kernfrage der Sozialisationstheorie wie ich sie gegen Ende des ersten Abschnitts dieser Einleitung aufgeworfen habe und in Abschnitt II. 8. 4. im direkten Anschluss an die Erörterung der Rationalitätsproblematik explizit als Kern- und Kardinalfrage der sozialisationstheoretischen Forschung formulieren werde. Nur so scheint es mir möglich, in die Struktur und Dynamik eines uns allen einst völlig vertraut gewesenen und mittlerweile fremd gewordenen sozialen Universums irgendwelche therapierelevante Einblicke nehmen zu können. Denn dann und nur dann, wenn es gelingt, genau diese Kernfrage aller psychiatrierelevanten sozialisationstheoretischen Entwürfe zu beantworten, haben wir auch eine Chance, die inhaltliche Vielfalt der infantilen, juvenalen und adoleszenten Sozialtheorien („Weltbilder“) zu verstehen, von denen wir annehmen, dass sie als „Weichensteller“ die „Bahnen“ bestimmen, in denen die Dynamik des Handelns von Kindern und Jugendlichen sich bewegt. Auch und gerade in diesem Zusammenhang gilt, wie ich meine, eine der methodologischen Grundregeln der sog. „Verstehenden Soziologie“ Max Webers, wie dieser sie in seiner 1916 verfassten „Einleitung in die Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ so prägnant formuliert hat: „Interessen (materielle und ideelle), nicht: Ideen, bestimmen unmittelbar das Handeln der Menschen. Aber: die »Weltbilder«, welche durch »Ideen« geschaffen wurden, haben sehr oft als Weichensteller die Bahnen bestimmt, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln fortbewegte.“ 24 3. Relevanz: Was die vorliegende Arbeit leisten will und zu leisten vermag und was sie nicht zu leisten vermag Aus den aufgeführten Kritikpunkten leitet sich die Frage ab, was die hier verfolgte Arbeit, die ja bezüglich der klinisch psychiatrischen Praxis als fachfremd angesehen werden muss, zu leisten sich vornehmen kann, was zu leisten sie imstande ist und was zu leisten sie nicht imstande ist. Es geht also um die Erörterung des Problems der Relevanz der hier vorgelegten Arbeit. Als erstes muss klar gesehen werden, dass und inwiefern die vorliegende Arbeit durch ein gewisses Dilemma gekennzeichnet ist, was sich bereits deutlich abzeichnet, wenn man die im letzten Abschnitt (Forschungsstand) der gegenwärtigen Psychiatrie gegenüber erhobenen Vorwürfe konstruktiv zu wenden versucht: Der Aufbau einer psychiatrierelevanten Sozialisationstheorie, wie er einleitend gefordert worden ist, krankt ja genau daran, dass die im letzten Abschnitt angesprochenen Probleme der kultur- und sozialwissenschaftlichen Grundlagenforschung nicht gelöst sind, was ein auch nur oberflächlicher Blick z.B. in den [Forschungsantrag] zeigt. Dennoch bleibt kein anderer Weg als der in der vorliegenden Arbeit beschrittene, was deutlich werden wird, wenn man sich die Mühe macht, die Argumentation vor allem des Abschnitt II. 8 über die „Rationalität“ mit seinen „Definitions- und Hypothesenkatalogen“ minutiös nachzuvollziehen. Und trotzdem: Die Arbeit beansprucht Relevanz im Hinblick auf eine mögliche Differenzierung klinisch auffälligen Verhaltens und muss dies tun. Denn der mit Bedacht gewählte Untertitel der hier vorgelegten Arbeit, der sich auf die „Werdestruktur“ jeglicher Formen des Humanverhaltens bezieht, beschreibt ja nun tatsächlich ein objektiv bestehendes Desiderat: Bisher wurde nicht nur noch keine Theorie entwickelt, die sich auf den Zusammenhang bezieht zwischen der sozialisationstheoretischen Dimension sozialen Handelns und denjenigen Tatbeständen, die mittels der Begriffe „Identitätskrise“, „Devianz“ und „soziale Kontrolle“ bezeichnet werden. Ganz im Gegenteil: Es wurde darüber hinaus noch nicht einmal ein methodologisch zumindest halbwegs sensibilisierter Versuch dazu gemacht. Und um einen solchen Versuch geht es hier: Wenn es gelingt – und das genau versucht der Titel und der Untertitel der hier vorgelegten Arbeit anzudeuten – die sozialisationstheoretische Dimension sozialen Handelns für die Etablierung sowohl 25 kompetenten sozialen Handelns als auch wesentlich defizienten „Handelns“ sichtbar zu machen,17 dann müsste sich ein sozialisationstheoretisches Modell ergeben, in welchem die Begriffe „Identitätskrise“, „Devianz“ und „soziale Kontrolle“ nicht nur eine klar umschreibbare Bedeutung haben. Diese Begriffe müssten überdies so aufeinander bezogen sein, dass sich aus einem solchen „Erklärungsmodell“ eine Reihe von empirisch falsifizierbaren Hypothesen herleiten ließe, die einen Kausalzusammenhang zwischen den mittels dieser Konstrukte umschreibbaren Tatbeständen postulieren.18 Vor allem geht es mir darum zu zeigen, was es tatsächlich bedeutet, wenn man einen Kausalzusammenhang zu postulieren versucht zwischen den sozialstrukturellen Bedingungen der frühen Kindheit und im Krankheitsfall auftretender entwicklungspsychopathologischer Syndromlage: Die diese erfassende Symptomatologie muss auf der Grundlage einer empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie ätiologisch zurückführbar – d. h. kausal beziehbar – sein nicht nur auf die psychosomatische Befindlichkeit „des Kindes“ in der primordialen Sozialisationsphase, sondern auch und gerade – und genau hier liegt der systematische Stellenwert der „Soziologie“ – auf die Bedingungskonstellationen des seinerzeitigen sozialen Umfeldes dieses Kindes. Aus dieser Überlegung folgt trivialerweise, dass ein Modell des sozialen Handelns, welches sich mit all denjenigen Formen abweichenden Verhaltens befasst, die nicht eindeutig dem „Delinquenzmodell“ oder aber dem „Widerstandsmodell“19 zuzuordnen sind, wesentlich ergänzungsbedürftig ist im Hinblick auf eine Theorie des Sozialisationsgeschehens.20 Wenden 17 D.h. eine Lerntheorie auszuarbeiten, welche angeben kann, unter welchen sozialstrukturellen Bedingungen sich genetisch bzw. konstitutionell relativ „normal“ ausgestattete menschliche Wesen zu sozial kompetenten Handlungsträgern entwickeln können. Aus diesem Blickwinkel ergibt sich ja dann ganz automatisch die „Ableitung“ einer Theorie, welche aufzeigt, unter welchen Bedingungen wesentlich defizientes Verhalten das wahrscheinliche Resultat sein wird. 18 Damit ist bereits hinreichend deutlich die Aufgabenstellung einer sowohl für die Pädiatrie als auch für die Neuropädiatrie als auch für die Pädo-Psychiatrie bedeutsamen Sozialisationstheorie umschrieben: In Form von empirisch falsifizierbaren Hypothesen, muss ein Kausalzusammenhang behauptet werden zwischen denjenigen Wechselwirkungsverhältnissen, welche die primordiale Sozialisations- und Enkulturationsphase ausmachen, der (Patho-)Genese ganz bestimmter, nämlich maligne strukturierter Identitätskrisen und dem Auftreten ganz bestimmter, nämlich pathologischer, devianter Verhaltensmuster. Zur Klassifikation devianter bzw. pathologischer Verhaltensmuster vgl. das Tafelbild in Abschnitt II. 7. 1. und dessen Variation nach Maßgabe bestimmter Rationalitäts- und Irrationalitätskriterien das Tafelbild II. 7. 2. 19 Vgl. hierzu die Ausführungen in II. 7. 20 Der Unterschied ist, wie wir sehen werden, sehr wichtig: Ein Modell sozialen Handelns, welches ein (logisch konsistentes) Gefüge von Grundannahmen repräsentiert, ist eine idealtypische Konstruktion, ein begriffliches Gebilde, welches folglich nicht selbst wahr oder falsch sein kann. Weber definiert das Begriffsgefüge des „sozialen Handelns“ und legt so den genuinen Gegenstandsbereich der „Soziologie“ kategorisch fest. Eine Theorie des Sozialisationsgeschehens hingegen ist ein System von wahrheitsfähigen Sätzen. Nur eine Theorie nämlich hat eine erklärende Funktion. Vgl. hierzu vor allem den „Thesenkatalog“ in 26 wir diese Überlegung nun konsequent makrosoziologisch, so lässt sich derselbe Tatbestand auch folgendermaßen formulieren: Es gibt Sozialisationsverläufe, welche zu Formen der Devianz führen auf welche nicht die „sanktionierenden“ Systeme der sozialen Kontrolle einer Gesellschaft, sondern vielmehr die „fürsorgenden“ Systeme derselben zu reagieren ermächtigt, d.h. legitimiert und verpflichtet sind. Wie in der Skizzierung des Forschungsstandes bereits angedeutet, ist genau dieser Gesichtspunkt in den einschlägigen psychiatrieorientierten Analysen viel zu sehr vernachlässigt worden. Man hat nicht gesehen, dass und inwiefern wie auch in welchem Umfang den „fürsorgenden“ Systemen der sozialen Kontrolle die Pflicht auferlegt ist, ganz bestimmte „Kulturwerte“ in ihrer Praxis zu realisieren. Es ist eine soziale Tatsache unserer Gesellschaftsform, dass diese von sich aus recht klar die Kriterien vorgibt dafür, was als „gesund“ und „krank“, was als „normal“ und was als „anomal“ zu gelten hat, und vom streng soziologischen – oder genauer noch: vom streng kultursoziologischen – Gesichtspunkt aus ist dieser Tatbestand alles andere als unwichtig. Psychiatrie, Medizin und Psychologie tun sich bekanntlich schwer damit, Kriterien für die Unterscheidbarkeit von „gesund“ und „krank“ von „normal“ und „anomal“ von „rational“ und „irrational“ zu entwickeln. Soziologisch aber ist völlig klar, warum dies im Rahmen dieser Institutionen gar nicht bewerkstelligt werden kann: Es handelt sich dabei um Kulturwerte, denen ganz bestimmte normative Prinzipien zugeordnet werden. „Werte“ werden, wie vor allem Max Weber mustergültig herausgearbeitet hat, den Wissenschaften nun einmal vorgegeben, sie können sich gar nicht aus ihnen selbst ergeben. Es ist eines der wichtigsten Resultate der Weberschen Forschungen zum sog. „Objektivitäts- und Wertfreiheitsproblem“, gezeigt zu haben, dass Erfahrungswissenschaften „Werte“ zwar analysieren, sie jedoch niemals selbst begründen können. Auf das methodologisch sehr schwierige Problem, wie sich kulturell vorgegebene Werte mit den Mitteln der Wissenschaft kritisieren lassen, ohne dass dadurch die Wissenschaftlichkeit fragwürdig wird, wird später noch genauer einzugehen sein. Hier halte ich dazu lediglich schlagwortartig fest: Angewandte Wissenschaften realisieren sozialstrukturell vorgegebene Kulturwerte, ihre jeweiligen Grundlagenforschungen jedoch müssen so „gebaut“ sein, dass sie zeigen können, was im gegebenem Fall an „Wertrealisation“ möglich ist und was nicht.21 Wenn es also gelingt, mittels einer präzisen Aufklärung des Bedeutungsgehaltes der Begriffe „Identitätskrise“, „Devianz“ und „soziale Abschnitt II. 3. 2. sowie die Ausführungen zum sog. „DN-Schema einer wissenschaftliche Erklärung“ in Abschnitt II. 5. 5. 21 Vgl. hierzu die Abschnitte II. 4. und II. 5 .1. bzw. II. 5. 2. 27 Kontrolle“, Rolle und Funktion von „Identitätskrisen“ für das Sozialisationsgeschehen menschlicher Wesen dergestalt genau zu bestimmen, dass sich ein Erklärungsmodell für klinisch auffälliges abweichendes Verhalten ergibt, dann müsste sich im Hinblick auf die Ätiologie der sog. „Geistes- und Gemütskrankheiten“ auch eine verbesserte Diagnostik ergeben. Eine Analyse der sozialisationstheoretischen Dimension (rationalen) sozialen Handelns wäre dann die eigentliche Grundlage für sorgfältig erstellbare Anamnesen, und bekanntlich gilt ja nun einmal die alte medizinische Faustregel, 90% einer guten Diagnostik sei sorgfältige Anamnese.22 In genau dieser Hinsicht erstrebt die vorliegende Arbeit Relevanz: Sie möchte theoretische bzw. methodologische „Hilfsdienste“ im Hinblick auf die klinisch psychiatrische Diagnostik leisten. Damit nimmt sie ernst, was mit dem Titel eines Dr. sc. hum (Doctor scientiarum humanarum) eigentlich angestrebt sein sollte: Geleistet werden soll ein konstruktiver Beitrag zur Verbesserung der medizinischen Forschung und Diagnostik, wobei in genuinem Sinne die Medizin als eine „Humanwissenschaft in praktischer Absicht“ aufgefasst wird.23 Bereits so gefasst ist die Arbeit, wie bereits im Abschnitt über den „Forschungsstand“ angedeutet, in methodischer Hinsicht mit einer ausgesprochen schwierigen erkenntnistheoretischen Problemlage konfrontiert: Es ist das Problem des Verhältnisses der sog. „Methode des Verstehens“ zu der angeblich ausschließlich in den strengen 22 Zu berücksichtigen ist allerdings in diesem Zusammenhang – und dies kompliziert die ganze Angelegenheit natürlich –, dass es ja durchaus klinisch auffälliges Verhalten bzw. klinisch auffällige Verhaltensmuster gibt, die nicht deviant sind, sondern sich vielmehr durch exzessive Konformität auszeichnen. Ich werde hierfür den Begriff der „realitätsfugativen Roffelfixation“ einführen und diesen abzugrenzen versuchen gegenüber dem von Kraus [Rollentheorie] eingeführten Begriff der „Rollenüberidentifikation“. Selbstverständlich stehen auch diese beiden Begriffe, unserer allgemeinen Aussage gemäß, in einem ganz bestimmten Zusammenhang mit ganz bestimmten Formen von Identitätskrisen: Jedweder Verhaltensmodifikation, die in den Bereich der kognitiven Umorientierungen fällt, gehen irgendwelche identitätskritische Zustände voraus, sind diese doch immer der Preis, der zu zahlen ist für mögliche Lernzuwächse. Psychiatrisch interessant sind natürlich dann diejenigen Fälle, in denen sich Lernblockaden nachweisen lassen, haben doch auch diese, wie wir sehen werden, identitätsstabilisierende Funktionen. Nebenbei gesagt: Auch und gerade der Begriff der „Identitätskrise“ bedarf, um als operativer Begriff fungieren zu können, der Komparativierung. Nur so lassen sich empirisch falsifizierbare Hypothesen konstruieren. 23 Vgl. Max Weber über die Einordnung der klinischen Medizin in [Objektivität]. Weber spricht dort von den „klinischen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften“, die er als Paradigma aller Versuche auffasst, grundlagenorientierte Forschung welche vor allem dem Wertfreiheitspostulat verpflichtet ist, Technologie zu transformieren. Wir werden weiter unten explizit auf diese Problemlage eingehen. 28 Naturwissenschaften geübte Methode des „Erklärens“, mithin also die bekannte Frage nach der methodischen Dichotomie von Kultur- und Naturwissenschaften. Dies ist, wie sich nunmehr klar feststellen lässt, wegen der „Grenzlage“ der medizinischen Forschung und Praxis alles andere als eine bloß akademisches Problem, stellt sich doch die Frage, ob vornehmlich derjenige Teil der medizinischen Forschung und Diagnostik, der mit dem Bereich der „Geistes- und Gemütskrankheiten“ befasst ist, streng naturwissenschaftlich oder streng kulturwissenschaftlich ausgerichtet sein soll. „Beides natürlich“, wird in der Regel ganz spontan der klinisch arbeitende Psychiater antworten.24 Was jedoch bedeutet das ganz konkret? Die gegenwärtige Medizin ist bekanntlich sehr stark naturwissenschaftlich ausgerichtet, orientiert sich also in ihrer Praxis vor allem an demjenigen „Wissen“, welches seitens der Physik, Chemie und Biologie hat ausgearbeitet werden können und nunmehr in Gestalt ganz bestimmter Theoriegebilde „verfügbar“ ist. Meine Arbeit setzt sich das bescheidene Ziel, in genau diesem Zusammenhang auf einen Aspekt aufmerksam zu machen, der – und dies nicht zuletzt wegen der gegenwärtigen naturwissenschaftlichen Dominanz – in der Psychiatrie derzeitig Gefahr läuft, verloren zu gehen. Es ist nicht die Absicht dieser Arbeit, gegen die naturwissenschaftliche Präsenz in der Humanmedizin zu polemisieren – ganz im Gegenteil! – oder gar den Grundlagenstreit der methodischen Dichotomie zu entscheiden. Allerdings scheint mir die derzeitige Konjunktur der sich neuentfaltenden interdisziplinären Aktivitäten darauf hinzudeuten, dass dieses traditionelle zentrale Problem sich erneut aktualisiert. Ich möchte das damit aufgeworfene Problem ein wenig anders akzentuieren und stelle mit der Frage, ob nicht vielleicht doch eine „gute Portion“ kulturwissenschaftlichen Denkens der derzeitig naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin ganz allgemein gut täte, die, wie ich mit Porath finde, sehr viel spannendere Frage, ob nicht unter Umständen um einer verbesserten Diagnostik willen auch die sog. Geisteswissenschaften (=Kulturwissenschaften) nach dem Vorbild der Naturwissenschaften streng erfahrungswissenschaftlich organisiert werden sollten oder gar müssen.25 24 Vgl. Resch’s Ausführungen in der Besprechung am 13. Juni 2005 25 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in den Abschnitten II. 3. 2. sowie II. 5., wo es um den Zusammenhang zwischen dem Wissenschaftscharakter der Kulturwissenschaften und dem Problem der kulturwissenschaftlichen Integration gehen wird. 29 Hierbei ist scharf zu unterscheiden zwischen der Frage ob dies möglich ist oder ob dies wünschenswert ist. Die bisherige hierzu entwickelte Diskurskultur hat nämlich genau diese beiden Fragen notorisch konfundiert, was zu einer wirklichen „Schieflage“ aller hierbei relevanten Argumentationsstrukturen geführt hat. Ich zitiere zur Verdeutlichung meiner grundsätzlichen Position in dieser Frage eine Passage aus dem bereits des öfteren erwähnten [Forschungsantrag] der „Dossenheimer Arbeitsgruppe“ aus dem Jahre 2001, der sich um des möglichen Aufbaus einer streng wissenschaftstheoretisch Sozialwissenschaften disziplinierten willen wesentlich Methodologie mit der der Geschichts- Möglichkeit einer Kultur- und konsequenten kulturwissenschaftlichen Analyse der Struktur und Dynamik der Entwicklungsgeschichte der Naturwissenschaften befasst. Es heißt dort: „Prekär ist hierbei vor allem der folgende Gesichtspunkt: Sollen die (methodologische) Struktur, die Genese, die (endogene) Dynamik und die (gesellschaftliche) Funktion der Naturwissenschaften einerseits sowie die Struktur, Genese, Dynamik und (gesellschaftliche) Funktion der Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaften andererseits Gegenstandsbereich derjenigen Abteilung der Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaften sein, die den Namen Analytische Wissenschaftslehre trägt und die ich [Porath] als historische Forschungslogik zu konzeptualisieren versuchen werde, so bedarf es hierfür vorab einer Entscheidung darüber, ob man überhaupt eine streng erfahrungswissenschaftlich organisierte Durchdringung des Gegenstandsbereiches der Gesellschaftswissenschaften ganz allgemein will. Und bezüglich dieses Problems sollten sodann zwei, wie mir scheint: wesentliche, Unterscheidungen getroffen werden: Erstens ist die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion erfahrungswissenschaftlich organisierter Weltbewältigung – dies schließt gleichermaßen die Natur- wie die Sozialforschung ein –, da selbst eine historisch-empirische Frage, legitimer Gegenstand der Geschichts-, Kulturund Sozialwissenschaften, wohingegen die Frage nach der Aufgabe bzw. der Zielsetzung der Natur- wie der Sozialforschung ein "Willensverzweigungsproblem" im Reichenbachschen Sinne ist und folgerichtig nicht selbst wiederum "wissenschaftlich" entschieden werden kann. In diesem Sinne ist der "Wille zur Wissenschaft" (Holzkamp) in der Tat entweder konstitutives Element des Versuches einer (konsequenten) "Erneuerung der Historik" (Rüsen) oder er ist es eben nicht: Willensverzweigungsprobleme designieren, bringt man hierbei die Carl-Schmittsche Terminologie in Anschlag, Erfahrungswissenschaften. Und gewissermaßen auftreten 30 tun die selbige politische zu Hauf Dimension in der denjenigen Ausnahmesituationen des "normalen" Forschungsprozedere, die wir Paradigmakrisen nennen. Da ich der Auffassung bin, daß wir uns nach wie vor in einer auf der Symptomebene von Forschungstechnik und Methodik nicht mehr therapierbaren Grundlagenkrise befinden, die als Paradigmakrise im Sinne der Kuhnschen Wissenschaftslehre zu deuten ist, folgt trivialerweise, daß wir uns entscheiden müssen, ob es uns in unseren Grundlagenkontroversen um eine wahrhaft wissenschaftliche Konzeptualisierung des Erfahrungsraumes „menschlich- gesellschaftliche Wirklichkeit“ (Dilthey) gehen soll oder nicht. Nach meinem Dafürhalten jedenfalls ist es an der Zeit, die Verwissenschaftlichungsmöglichkeiten der Gesellschaftswissenschaften (erneut) zu überprüfen. Dies die eine Unterscheidung, und die zweite, eng damit zusammenhängende, läßt sich folgendermaßen formulieren: Die Frage, ob es wünschenswert ist, die "Geschichts-, Kultur- und Sozialforschung als strenge Wissenschaft" (Viktor Kraft) zu konzeptualisieren, muß strikt getrennt werden von der Frage, ob es überhaupt möglich ist, die Geschichts-, Kultur- und Sozialforschung als Erfahrungswissenschaft stricto sensu zu konzeptualisieren. Dies nämlich eine Unterscheidung, welche ob der hoffnungslos mehrdeutigen Metaphorik des Wissenschaftsbegriffs in der Regel nicht hinreichend präzise getroffen zu werden pflegt: Während die erste Frage ebenfalls ein "Willensverzweigungsproblem" ist, umschreibt die zweite Frage ein eindeutiges wissenschaftstheoretisches Problem und ist im Prinzip auch mit Blick auf das paradigmatische Belegstück der strengen Naturwissenschaften durchaus beantwortbar, wie ich meine: Gelingt mit der Aufklärung der methodologischen Problemlage der Naturwissenschaften die Beantwortung der Frage, wie in deren institutionellem Rahmen z. B. das Wertfreiheitsproblem faktisch hat gelöst werden können, so gelingt auch die Erstellung eines Bezugssystems, welches das Ausmaß an "Wissenschaftlichkeit" bestimmbar macht, welches den Humanwissenschaften möglich ist. Zu zeigen wird also sein, daß und inwiefern der Wissenschaftsbegriff als ein au fond komparatives Prädikativgebilde gefaßt werden kann und muß, wobei das Lehrbeispiel der strengen Naturwissenschaften als Extremtypus fungiert. Dies wird vornehmlich Gegenstand der Argumentation in dem dritten größeren Denkschritt der hier vorgelegten insgesamt auf vier Bände angelegten Historischen Forschungslogik sein.“26 Das hier ja nur ganz grob „angerissene“ Problem ist eigentlich das zentrale Dauerthema des „Forschungskreises Dossenheim“ mit Gelehrten, die unsere Symposien besucht haben, gewesen. Der Moralphilosoph Rolf Zimmermann, der zum engeren Umkreis unserer Forschungsgruppe gerechnet werden kann, vertritt ebenso wie der Rechtsphilosoph Bernhard Schlink den Standpunkt einer prinzipiellen methodischen Dichotomie von Geistes- und 26 Vgl. [Forschungsantrag] 31 Naturwissenschaften. Ich selbst vertrete in enger Anlehnung an die Forschungen von Porath die Auffassung von der methodischen Einheit der Erfahrungswissenschaften (Einheitskonzeption). Aus diesem Grunde deute ich ja auch die Forschungsmethode der Psychoanalyse in durchaus klassischem, nämlich Freud’schen Sinne, indem ich sie als ein naturwissenschaftliches Forschungsprogramm stricto sensu auffasse. Dass ich damit der in der gängigen Sozialphilosophie dominierenden Freudinterpretation (Lorenzer, Habermas, Zimmermann) widerspreche bzw. widersprechen muss, ist mir natürlich bewusst.27 Stellen wir abschließend die Frage, was die vorliegende Arbeit zu leisten vermag und was sie nicht zu leisten vermag. Die sog. „Rollentheorie“ wird ebenso wie die Homans’sche Kleingruppenforschung genuin „soziologisch“, d.h. auf dem Boden der Weberschen Handlungssoziologie, zur Sprache gebracht. Dies, wie bereits mehrfach angedeutet, zum einen im Hinblick auf die mögliche Konstruktion einer Sozialisationstheorie, zum anderen im Hinblick auf das Problem der sozial- und kulturwissenschaftlichen Integration. Aus diesem Blickwinkel wird dann auch die Möglichkeit gegeben sein, die gesellschaftliche Institution „Psychiatrie“ sowohl kultursoziologisch zu deuten als auch die Frage zu stellen, ob und inwiefern diese „Psychiatrie“ selbst als eine Kulturwissenschaft aufzufassen ist.28 Dennoch muss vieles, was kritisch weiter oben anlässlich der Skizzierung des „Forschungsstandes“ angemerkt wurde, auch gegen die hier vorgelegte Arbeit eingewendet werden. Diese ist erstens selbst zu wenig „institutionentheoretisch“, was bedeutet, dass der makrosoziologische Gesichtspunkt nur in Ansätzen zur Geltung kommen kann, zweitens ist sie insofern viel zu wenig „sozialpsychologisch“, als sie die in den sog. „Konsistenztheorien“ wurzelnden 27 Am 17. März 2004 hat der Moralphilosoph Rolf Zimmermann im Rahmen der Veranstaltung unserer Forschungsgruppe sein Projekt „Gattungsbruch und Transformationsmoral“ vorgestellt. Hierbei ist dann auch intensiv das Problem der „methodischen Dichotomie“ zur Sprache gekommen. Mittlerweile hat Herr Zimmermann seinen Ansatz erst in einer philosophischen Fachzeitschrift unter dem Titel [Gattungsbruch] und sodann als Buch [Auschwitz] publiziert und auf die Ergebnisse unserer Auseinandersetzungen explizit Bezug genommen. Um einer diskursiv möglichst fruchtbaren Bezugnahme meiner Arbeitsergebnisse willen, habe ich meinen Kontrahenten, Herrn Prof. Zimmermann, neben Herrn Resch, Herrn Schwinn und Herrn Tsiakalos ebenfalls um seine begutachtende Stellungnahme gebeten. Herr Prof. Resch, für dessen Fairness ich mehr als nur einmal Gelegenheit hatte, mich zu bedanken, hatte mir die Suche nach dem Zweitgutachter bzw. nach den Zweitgutachtern überlassen und lediglich die Auflage gemacht, es müsse auch ein institutionell ausgewiesener Fachsoziologe dabei sein, was Herr Prof. Zimmermann als Habermasschüler, als der er sich versteht, zweifelsohne ist, hat er doch selbst in seiner Habilitation ein geradezu klassisches sozialphilosophisches Thema [Utopie-Rationalität-Politik] gewählt. Mir ist völlig unerfindlich, warum Herr Prof. Zimmermann sich meiner Bitte verweigert hat, vor allem leuchtet mir seine Begründung ganz und gar nicht ein. 28 Siehe hierzu den Abschnitt II. 4. 32 sozialpsychologischen Ansätze viel zu wenig berücksichtigt, und drittens wird ihre methodologische Hintergrundsfolie nur in groben Zügen deutlich werden können: Ein konsequent kulturwissenschaftlich ausgerichteter Ansatz, der „auszugreifen“ versucht auf die mögliche Konstruktion einer psychiatrierelevanten Sozialisationstheorie, hätte, wie Porath es in seinem „Warschauvortrag“ [Endlösung] postuliert hat, ein Integrationsprogramm entwickeln müssen, welches Kulturpsychologie mit Kultursoziologie auf der Grundlage der weiter unten noch zu behandelnden „kulturwissenschaftlichen Faustregel“ integrativ vernetzt.29 Eine weitere wesentliche Unzulänglichkeit der vorliegenden Arbeit, die ganz besonders bedauerlich ist, muss auf jeden Fall benannt werden. Sie betrifft den Umgang mit der psychiatrischen Fachliteratur im engeren Sinne. Es liegt in der Natur der Sache, dass texthermeneutische Analyse immer nur exemplarisch verfahren kann. Ihr methodischer Vorzug der analytischen Akribie hat den großen Nachteil, im Hinblick auf die zu verarbeitenden Menge der Literatur zu schwerfällig zu sein. Selbst das Werk von Redlich und Freedman oder auch das Resch’sche Lehrbuch wurde nicht wirklich texthermeneutisch so analysiert, wie es eigentlich erforderlich gewesen wäre. Die Arbeit musste sich aus diesem Grunde vornehmlich auf zwei Ziele konzentrieren und dabei entsprechende Schwächen in Kauf nehmen: Es ist ihr Anliegen, die jedweder Psychiatrie uneingestanden innewohnende Implizitsoziologie herauszustellen und sich überdies der Deutlichmachung all derjenigen Probleme zu widmen, die mit der Konstruktion einer psychiatrierelevanten Sozialisationstheorie in irgendeinem Zusammenhang stehen könnten.30 Kernstück meines Anliegens ist jedoch die Herausschälung des Unterschiedes zwischen „Grundannahmen“, „komparativen Begrifflichkeiten“ und „empirisch falsifizierbaren Hypothesen“. Die im Abschnitt über die „Personale Rationalität“ vorgelegte „Katalogarbeit“ dient vor allem diesem Ziel. Wie bereits einleitend angedeutet, sind es zwei Kernfragen, die in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle spielen, auf deren präzise Formulierung hingearbeitet werden muss 29 Vgl. hierzu II. 2., wo es um die „sozialbehavioristische“ Komplementarisierung der Weberschen Sozialanthropologie gehen wird. 30 Deswegen ist mir zum einen der Argumentgang von Abschnitt II. 4. zum anderen der Argumentgang von Abschnitt II. 5. 5 ganz besonders wichtig. Insbesondere der Argumentgang von Abschnitt II. 5. 5. schlägt den Bogen zur Rationalitäts- und Irrationalitätsproblematik, wie ich sie in Abschnitt II. 7. 2. und sodann in Abschnitt II. 8. behandeln werde. 33 und zu deren mögliche Beantwortung in der vorliegenden Arbeit zumindest ein Weg aufgezeigt werden muss: 1. Wie transformiert sich die primordiale Verhaltensdynamik des Kindes, die ja in der Tat, wie es insbesondere die Gelehrten der Lorenzschule31 betont haben, auf weite Strecken hin nicht nur ethologisch, sondern sogar streng behavioristisch „gedeutet“ werden muss, in subjektiv sinnvolles soziales Handeln? Lässt sich diese Frage beantworten, so wären wir dem Resch’schen Postulat, die Welt des Kindes wirklich verstehen zu wollen, wie ich meine, ein gutes Stück näher. Eng damit verbunden ist nämlich die Frage, die allerdings von Resch und seinen Mitarbeitern nicht richtig aufgeworfen wird: 2. Welches sind die unabdingbaren – in der Regel „familialen“ – sozialstrukturellen Voraussetzungen dafür, dass sich die unmittelbar am Organismusgeschehen ansetzenden Verhaltensmodifikationen in absichtsgeleitetes, d.h. subjektiv sinnvolles soziales Handeln, transformieren bzw. transformieren können? Eine Beantwortung dieser Frage beantwortet zugleich auch die Frage nach den sozialstrukturellen Voraussetzungen für die Herausbildung von „Individualität“ und „Identität“. Letztendlich lässt sich freilich diese Frage nur anhand einer texthermeneutischen Feinanalyse der seinerzeit begonnenen Forschungsarbeiten und in der Zwischenzeit nur sporadisch weitergeführten Untersuchungen zu dem Zusammenhang von „familialem Sozialisationsgeschehen“ und „Ätiologie der Schizophrenien“ durchführen, eine Arbeit die sich anschließend anbietet. Sind diese beiden Fragenkomplexe beantwortbar so lässt sich auch erklären, wie sich die primordialen Identitätskonstruktionsprinzipien bilden können, welche die kognitive Dynamik eines menschlichen Lebens in der Gesellschaft, in der es lebt, sein ganzes Leben lang ausmachen. Von der mehr oder weniger erfolgreichen Bewältigung dieser Problematik ist nämlich wiederum das Schicksal der Versuche eines „Individuums“ abhängig, Identitätskrisen erfolgreich bewältigen zu können. Trivialerweise ergibt sich: Die Kette der malignen Identitätskrisen, welche zunehmend identitätskritische Dauerzustände mit entsprechend gravierenden psychopathologischen Verhaltensmustern „einschleifen“ und 31 Vgl. hierzu den Sammelband [Lorenz und die Folgen]. 34 sodann eben auch entsprechenden personalen Zerrüttungserscheinungen den Weg bereiten, ist letztendlich zurückführbar auf ganz bestimmte in der Primordialphase von Sozialisation und Enkulturation dominierende sozialstrukturelle Bedingungen, unter denen sich die methodischen Prinzipien der je individuellen Identitätskonstruktionskompetenzen etabliert haben. Denn es ist die Art und Weise, wie Identitätskonstruktion habitualisiert zu werden pflegt – eben die „Methode“ –, nicht jedoch die jeweilige Persönlichkeitsstruktur der primordial ausschlaggebenden Bezugspersonen als solche („schizophrenogene Mutter“ bzw. „ich-schwacher Vater“), die darüber entscheidet, ob jemand eine eher maligne oder eher eine benigne „Identitätskarriere“ durchläuft. Und bezogen auf die Ausarbeitung einer empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie, welche diese Problematik zu klären hat, fällt der „Soziologie“ die Aufgabe zu die sozialstrukturellen Bedingungen zu beschreiben und zu erklären, die jeweils gegeben sein müssen, damit sich überhaupt eine ganz bestimmte Identitätskonstruktionsmethode herausbilden kann. Im Abschnitt III., wo es um Bilanz, Schlussbemerkung und Ausblick gehen wird, sollen die weiteren Schritte skizziert werden: Letztendlich bewährt sich nämlich der nachstehend von mir entwickelte Ansatz nur und ausschließlich mittels einer texthermeneutisch akribischen Analyse der psychiatrischen Fachliteratur selbst. 4. Zum Stellenwert der sog. „Psychoanalyse“ Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Arbeit, der mittels des Untertitels zu umschreiben versucht worden ist, ist bereits hier in der Einleitung zur Sprache zu bringen. Er betrifft den Stellenwert der Psychoanalyse für den Aufbau einer ansonsten streng soziologisch zu fassenden Sozialisationstheorie, welche im Kern, wie mehrfach hervorgehoben, eine Lerntheorie sein muss. Sie und nur sie, nicht jedoch die sog. „kognitivistischen Lerntheorien als solche“, so meine These, beinhaltet eine wirklich tragfähige Möglichkeit, den genuin lerntheoretisch erfaßbarenen Aspekt des Sozialisations- und Enkulturationsgeschehens „abzudecken“. Denn wie eine empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie, welche ihre ersten Kinderkrankheiten bereits hinter sich gebracht hat, wird zeigen müssen, sind die – interdependenzfunktional aufeinander bezogenen – Prozesse der „Sozialisation“ und „Enkulturation“ aus dem Blickwinkel der Soziologie Prozesse der Einbindung (potentiell handlungsfähiger) menschlicher Organismen in – vorab bestehende und sich fortlaufend 35 ändernde – Sozialgebilde (Institutionen bzw. Gruppen), die rollenbegrifflich als sozialstrukturell verobjektivierte Verhaltensschemata beschreibbar sind, und aus dem Blickwinkel der Entwicklungspsychologie sind diese Prozesse Lernprozesse.32 Dieser Punkt ist wohl auch nicht strittig, das Problem allerdings besteht darin, die Frage zu beantworten, welche Klasse von Lerntheorien zur Beschreibung und zur Erklärung genau dieser Art von Lernprozessen in Frage kommt, müsste sie doch, wie eingangs hervorgehoben, dreierlei leisten: Sie müsste erstens die kognitive Dynamik humanspezifischen Verhaltens zu beschreiben gestatten, zweitens deren Wurzeln in der frühen Kindheit freizulegen imstande sein und drittens den funktionalen Stellenwert der Identitätskrisen für die jeweilige Charakterbildung eines Menschen bestimmen können, um so zum einen „erfolgreiche“, zum anderen „gründlich schiefgelaufene“ Sozialisationsvorgänge erklären zu können. Überdies müsste sie natürlich in Einklang zu bringen sein mit der Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“, denn um diese geht es ja nun einmal wesentlich, soll der Begriff der Identitätskrise präzise gefasst werden wollen. Denn wie gesagt: Eine Sozialisationstheorie, welche „Identitätskrisen“ nicht zu zerlegen vermag in maligne und in benigne, bildet mit Sicherheit keine hinreichende kognitive Grundlage für eine erfolgreiche „Theorie und Praxis der Psychiatrie“. Warum aber, so lautet dann ja wohl die Frage, ist es ausgerechnet die Psychoanalyse, die uns die für eine auch psychiatrisch relevante Sozialisationstheorie benötigte Hintergrundsfolie 32 Zur Verdeutlichung der Richtung, in welcher sich meine Überlegungen bewegen, hierzu ein Beispiel: Ein bisher im Rahmen des Rollengefüges „Familie“, einer sozialen Institution also, aufgewachsenes dreijähriges Kleinkind, welches sprechen gelernt und die ersten Hürden seiner Individualitätsbildung mehr oder weniger erfolgreich „hinter sich gebracht“ hat, indem es ganz bestimmte familialspezifische Verhaltensmuster gelernt hat, geht von Ostern ab in das ihm bis dahin noch unbekannte Rollengefüge „Kindergarten“, wird mithin in selbiges „eingefügt“ oder auch „eingebunden“ – sprich: sozialisiert – und in das dort herrschende kulturelle System (Wertesystem, Sozialtheorien, „Ideen“) enkulturiert. Zwar überschneiden sich die kulturellen Systeme der beiden sozialen Einrichtungen (Institutionen) in einigen Segmenten – z. B. in der gemeinsamen deutschen „Sprache“ –, weisen jedoch zugleich auch Unmengen von „Werten“ und „Ideen“ (Ideologien, Sozialtheorien) auf, die sich völlig voneinander unterscheiden (können). Hierbei ist das Erste und Wichtigste, was ein Kind gelernt haben muss: Es bleibt mit sich selbst gleich, obwohl es beim Übergang vom familialen Sozialgefüge zu demjenigen des Kinderhortes nunmehr z. T. gänzlich anderen Rollenanforderungen genügen muss. Dieser Aspekt des sozialen Lernens ist es, der als das Identitätsproblem das in dieser Arbeit ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückte eigentliche Problem darstellt, dem wir in Gestalt der weiter unten zu behandelnden „Kernfrage aller Sozialisationstheorien“ Rechnung zu tragen versuchen werden: Wie erwirbt das Kind die Fähigkeit zu subjektiv sinnvollem sozialen Verhalten? Der für die Identitätsproblematik entscheidende Punkt nämlich besteht darin: Hat es seine „Ich-Rolle“ bis dahin nur unvollkommen gelernt, so kommt es ganz sicher zu Identitätsirritationen. Dieser, wie ich meine, entscheidende Punkt lässt sich nunmehr in die eigentliche Generalfrage der vorliegenden Arbeit überhaupt kleiden: Wie muss wohl – idealtypisch gesehen – die Sozialisationsagentur beschaffen sein, die es einem Kind in unserer Gesellschaft ermöglicht, die „Ich-Rolle“ zu lernen? Auf diese Generalfrage, die als genuin soziologische Frage allen pädagogischen wie therapeutischen Aufgabenstellungen zugrunde liegt, läuft letztendlich alles hinaus. 36 liefern soll? Was an ihr macht sie für das in dieser Arbeit avisierte Vorhaben besonders geeignet und in was für einem Verhältnis steht sie zu der Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“? Wären denn nicht die im engeren Sinne kognitiven Lerntheorien wesentlich besser geeignet, da diese doch expressis verbis streng behavioral beschreibbare Verhaltensmodifikationen nach Maßgabe der sog. „Hypothesentheorie der Wahrnehmung“ als kognitive Umorientierungen interpretieren? Steht denn vor allem die Freudsche Theorie des Lernens nicht insofern der analytischen Heuristik des „dogmatischen Behaviorismus“ sehr viel näher, als sie gerade, wie es z. B. die kognitivistische Psychologie Piaget’s tut, nicht die Divergenz von humanspezifischen und infrahumanen Lernprozessen über Gebühr strapaziert? Betont nicht gerade sie expressis verbis die unbewusste Dimension von Lernprozessen, die sie doch als sehr viel wichtiger erachtet als die dem Rationalitätsprinzip sehr viel näher stehenden kognitiven Umorientierungen? Die Beantwortung dieser Fragen macht, wie sich noch des öfteren zeigen wird, das hier avisierte Unternehmen schwierig, führt eine solche Beantwortung uns doch ganz automatisch auf genuin methodologisches Gebiet. Darauf soll bereits an dieser Stelle zumindest hingewiesen werden. Im Abschnitt II. 6 wird auf diese Fragen näher eingegangen werden. Was aber ist denn nun eigentlich diese bekanntlich mehr als umstrittene Psychoanalyse? Bei der Psychoanalyse handelt es sich ja nicht nur um eine empirisch gehaltvolle Theorie, mittels derer wir „fehlgelaufene“ Sozialisationsverläufe beschreiben und erklären können, und es handelt sich dabei auch nicht nur um eine neue Forschungsmethode bzw. eine neue therapeutische Methode. Ihrem Erkenntnisanspruch nach ist die Psychoanalyse der Auffassung ihres Gründungsvaters zufolge eine Metapsychologie, „umgreift“ mithin integrativ als „Tiefenpsychologie“ sowohl die spezifisch neurologische Sichtweise als auch den sog. „strengen Behaviorismus“ als auch die kognitiven Lerntheorien und ist überdies eine wesentlich kulturwissenschaftlich ausgerichtete Sozialpsychologie.33 Die Wissenschaftsverpflichtung meiner Arbeit muss scharf analytisch trennen zwischen diesen Aspekten der Freudschen „Metapsychologie“. Hier geht es mir zunächst einmal um die „Forschungsmethodik der Psychoanalyse“, genauer: um die Relevanz der psychoanalytischen Forschungsmethode im Hinblick auf das eingangs skizzierte Unternehmen einer Explikation 33 Wichtig in diesem Zusammenhang sind vor allem die folgenden Schriften, welche im Lichte des in dieser Arbeit entwickelten sozialisationstheoretischen Ansatzes einer akribischen texthermeneutischen Analyse zu unterziehen wären: Freud [Enttäuschung], ders. [Massenpsychologie], ders. [Illusion]. Insbesondere die „Massenpsychologie“ ist in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung, da Freud hierin zu zeigen versucht, dass streng genommen jede „Individualpsychologie“ Sozialpsychologie sei. 37 des Begriffes der „Identitätskrise“.34 Und wir können nunmehr auch bereits präzisieren, was eingangs nur als These formuliert wurde: Mittels einer Analyse genau derjenigen sozialisationstheoretischen Dimension sozialen Handelns, welche den Erwerb der kommunikativen Kompetenzen eines sozial kompetenten Individuums betrifft, soll der Zusammenhang zwischen „Identitätskrisen“, „Devianz“ und „sozialer Kontrolle“ dergestalt aufgeklärt werden, dass sich damit die – im weiteren Sinne – irrationalen Formen menschlichen Verhaltens – das sind, wie wir sehen werden, sowohl „zu gut“ angepasste wie überhaupt nicht (mehr) angepasste – genauer charakterisieren und erklären lassen.35 Wie sich 34 Im Unterschied zu den meisten anderen sozialisationstheoretischen Ansätzen ist die Forschungsmethode der Psychoanalyse wesentlich historisch-genetisch, das heißt: Sie konstruiert einen Kausalzusammenhang zwischen den primordialen Anfängen eines individuellen Sozialisationsgeschehens und seinem gegenwärtigen „Resultat“. Weil sie strikt auf die wissenschaftslogische Leitregel des methodologischen Determinismus verpflichtet ist, gibt es streng genommen aus psychoanalytischer Sicht so etwas wie ein für sich selbst verantwortliches Individuum, wie es die Webersche „Begriffslehre des sozialen Handelns“ ja voraussetzt, gar nicht. Zwischen der in der Weberschen Konzeption vercodeten Grundannahme unseres Rechts- und Moralsystems und der Psychoanalyse besteht mithin ein Grundwiderspruch, den es „irgendwie“ aufzulösen gilt. Vgl. hierzu demnächst Porath [Psychiatrische Historik]. 35 Das subjektiv sinnhafte Sichverhalten können des Einzelindividuums zu (imaginierten wie „wirklichen“) Objekten – dies ja das idealtypologische Konstrukt, welches Max Weber als (soziales) „Atom“ postuliert – ist wesentlich gebunden an die Fähigkeit dieses Individuums, mit sich und anderen zu kommunizieren. Aus genau diesem Grunde ist ja die Webersche „Begriffslehre des sozialen Handelns“ wesentlich ergänzungsbedürftig durch bestimmte „Grundannahmen“ des sog. „symbolischen Interaktionismus“, wie wir in Abschnitt II. 2. Sehen werden. Der vornehmlich im familialen Sozialisationsverband erfolgende Erwerb der kommunikativen Kompetenz(en) – dies ein Grundbegriff aller Sozialisationstheorien – scheint der wichtigste Bestandteil für „erfolgreich“ verlaufende Sozialisationsprozesse zu sein. Die entscheidende Frage ist nur, was genau dieser Begriff alles beinhaltet. Der Begriff der „kommunikativen Kompetenz“ stammt von Jürgen Habermas, der es jedoch verabsäumt hat, die genuin psychologische Literatur hierbei systematisch einzuarbeiten. So ist ihm auch das reichhaltige Material aus der sozialpsychologischen Kleingruppenforschung unerschlossen geblieben. Auch sind die Habermas’schen Anleihen bei der Chicagoer Schule des „symbolischen Interaktionismus“ ganz unzulänglich. Selbst das lexikalische Material, wie Graumann es in seinem Handbuchartikel „Interaktion und Kommunikation“ bereits in den 60er Jahren monographisch zusammengestellt hat, ist von Habermas nicht einbezogen worden. Hier liegt der Grund dafür, dass die sehr stark psychoanalytisch ausgerichtete „Frankfurter Schule“ auch nicht die Ergebnisse des seinerzeitigen Sammelbandes „Schizophrenie und Familie“ erkenntnisfruchtbar hat nutzen können. Zum Nachfolgenden vgl. Abschnitt II. 8., wo es um ein gewisses „Fazit“ aus den Rationalitätskatalogen geht. An dieser Stelle ist nur darauf aufmerksam zu machen, dass zu dem Annahmegefüge der „kommunikativen Kompetenz“ wesentlich die Kompetenz hinzugehört, metakommunikative Dimensionen von Interaktions- und Kommunikationszusammenhängen wahrzunehmen und handelnd einzubeziehen bzw. handlungsintentional zu berücksichtigen: Subjektiv sinnhaftes Sichverhalten zu Objekten beruht auf der Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können, was voraussetzt, dass ein menschliches Wesen die Fähigkeit erworben hat, sich als ein Einzelindividuum zu begreifen, welches zu subjektiv sinnhaftem Sichverhalten zu (imaginierten wie wirklichen) Objekten fähig ist. Hat ein bestimmtes Individuum genau diese Dimensionen kompetenten sozialen Handelns nicht erworben, so entbehrt es des Basalcharakteristikums für Rationalität überhaupt. Vgl. dazu den Abschnitt II. 7. 2. und II. 8. 2. Wie ein Blick in die Homans’schen Kleingruppenanalysen zeigt, scheinen insbesondere Fehlhandlungen die Resultanten spezifischer Erwartungskonflikte in Kleingruppen zu sein, die als rollendilemmatisch zu 38 nämlich herausstellen wird, sind dafür die überkommenen lerntheoretischen Ansätze nur unzulänglich imstande. Damit wird folgendes behauptet: Nicht nur aus dem Blickwinkel der „strengen Soziologie“, sondern auch und gerade aus dem Blickwinkel der lerntheoretischen Ergänzungsversuche derselben, wie sie z. B. G.C. Homans vorgeschlagen hat, ist die Genese sowohl des kompetent sozialen Handelns als auch des „entschuldbar“ inkompetenten sozialen Handelns nur unzulänglich aufklärbar, weil der Sozialisationsprozess als solcher auch und gerade seitens der überkommenen entwicklungspsychologischen Lern- und Lehrmodelle nicht präzise genug beschreibbar ist. Es bedarf also einer empirisch gehaltvollen Sozialisationstheorie, die es, wie es nur die Psychoanalyse tut, gestattet, zum einen die in der primordialen Sozialisationsphase „wurzelnde“ Genese kompetenten sozialen Handelns, zum anderen aber auch die gleichfalls in der primordialen Sozialisationsphase wurzelnde Genese massiver Beeinträchtigungen kompetenten sozialen Handelns aufzuklären.36 Unabdingbares Erfordernis auch hierfür ist allerdings, wie eingangs expressis verbis betont, die Konstruktion eines Idealtypus „kompetentes soziales Handeln“, welcher mithin auch für die Psychoanalyse diagnostizieren sind. Hierbei geht es um Konflikte, die daraus resultieren, dass jemand den Gruppenwerten und normen gemäß durchaus zweckrational bzw. richtigkeitsrational zu handeln in der Lage ist und dies auch tut, dass er sodann jedoch mit voller Wucht die Gruppensanktionen zu spüren bekommt, weil sein Verhalten nicht in Einklang mit den Erwartungen zu bringen ist, die sich an die ihm zugeschriebene soziale Position knüpfen. Hierbei geht es also nicht um Fehlleistungen, die ihren Ursprung in der Welt der „unbewussten Triebregungen und Wunschvorstellungen“ haben, wie die klassische Psychoanalyse sie postuliert, sondern um sozialstrukturell bedingte Fehlleistungen, und diese Fehlleistungen sind interessanterweise relativ milde Formen von „personalsystemischen Verhaltensstörungen“, die jeder „Normale“ problemlos nachvollziehen kann, weil er Ähnliches irgendwann einmal „am eigenen Leib verspürt“ haben dürfte. Hochkohäsive Kleingruppen – juvenale Gangs bzw. sektiöse Formen der Vergemeinschaftung aber eben auch Familien – verfügen über erstaunlich sensible Mechanismen der sozialen Kontrolle, die sofort „in Kraft treten“, wenn positional fest zugeordnete Habituale „aus der Rolle fallen“ und das Gruppengleichgewicht in Gefahr zu bringen drohen. Hierbei sind „Selbstidentifikation“ und „positionale Zuschreibung“ von Habitualen so eng miteinander „verlötet“, dass eindeutig pathologische Formen des Verhaltens auffällig werden. Genau diese nenne ich die personalsystemischen Verhaltensstörungen, die als Fehlleistungen z. B. symptomatisch werden. In diesem Sinne ist vornehmlich die fünfte Hauptthese der Homans’schen „Elementarformen“, die sich sehr eng an die bekannte „Frustrations-Aggressionsthese“ von Dollard und Miller anlehnt, zu interpretieren. Hier würde sich paradigmatisch belegen lassen, wie eng der Zusammenhang zwischen der psychoanalytischen Forschungsmethode und der Weberschen Begriffslehre des sozialen Handelns ist: Der jugendliche Kegelvirtuose, der sich „verwirft“, reagiert auf zielblockierende Maßnahmen der Gruppenmitglieder, was sozusagen in den Kompetenzbereich der „Frustrationshypothese“ fällt. Aggressives Verhalten gegenüber den störend eingreifenden Gruppenmitgliedern wäre sinngetragenes Verhalten und als solches ein rational-normales Verhalten. Dieser Weg jedoch ist ihm versperrt und folgerichtig gerät er in eine maligne Identitätskrise, die sich in massiven Fehlleistungen manifestiert. Aus diesem Blickwinkel ergäbe sich dann die folgende Hypothese: Ist einem Individuum aufgrund der vorgegebenen Gruppenstruktur das eigentlich angebrachte aggressive Reagieren auf eine bestimmte Verhaltenszumutung unmöglich gemacht, so gerät es in eine „Identitätskrise“, die sich wegen der vorhandenen sozialstrukturellen Bedingungen nicht in aggressiven Verhaltensmustern äußern kann und deshalb die Kompromissverhaltensweisen der sog. „Fehlleistungen“ hervorrufen. 36 Siehe hierzu den Abschnitt II. 6., wie auch den Abschnitt II. 7. 2. 39 Geltung hat.37 Mit anderen Worten: Um Formen abweichenden sozialen Handelns erklären zu können, die wegen ihrer „Irrationalität“ nicht in den Kompetenzbereich der juristischen Formen der sozialen Kontrolle fallen, bedarf es einer empirisch gehaltvollen Sozialisationstheorie, die weder von der „formalen Soziologie“ noch von deren Komplementärformen in Gestalt der entwicklungspsychologischen Modelle geliefert werden kann, die wir vielmehr der Psychoanalyse verdanken, wie die vorliegende Arbeit behauptet. Die methodologischen Probleme, die sich damit herauskristallisieren, interessieren mich an dieser Stelle zunächst einmal noch nicht. Hier geht es vorerst lediglich um die These, dass nur mittels der psychoanalytischen Methodik die sozialisationstheoretische Dimension sozialen Handelns adäquat erfasst werden kann, dass jedoch diese psychoanalytische Methodik wiederum nicht nur rollentheoretisch sondern eben auch streng handlungssoziologisch im „klassischen“ Weberschen Sinne ergänzt werden muss.38 37 Woraus logisch folgt, dass eine differenzialdiagnostisch handhabbare Verwendung des Begriffs „Identitätskrise“, die es gestatten würde, zwischen malignen und benignen Verlaufsformen des (möglichen) Krankheitsgeschehens zu unterscheiden, wesentlich auf dem Konstrukt des rationalen sozialen Handelns Weberscher Observanz beruht. Siehe hierzu den siebten Abschnitt des Hauptteils, wo es um das Kriterium der derzeitig geltenden rechtlichen Praxis für die Unterscheidung zwischen rationalen und irrationalen Formen der Devianz gehen wird: Die gängige rechtliche Praxis befindet nämlich (derzeitig) darüber, ob wir es mit einem Patienten zu tun haben, der ja per definitionem in dem Sinne nicht sozial kompetent genannt werden kann, weil er vor Gericht nicht für sein Handeln verantwortlich gemacht wird. Bei der Zerlegung des „abweichenden sozialen Handelns“ in „delinquentes Verhalten“ und anderen Formen der Devianz verfügen wir also über ein Belegstück dessen, was Weber einen „scharfen Begriff“ nennt: Delinquenz ist eindeutig durch ihren Bezug zum rationalen Sozialverhalten gekennzeichnet. 38 Zu der damit aufgeworfenen wissenschaftslogischen Problemlage vgl. demnächst Porath [Psychiatrische Historik], wo die Webersche „Methode der Begriffsdefinition“ systematisch verknüpft wird mit der in [Narratives Paradigma] formulierten „Kernproblematik der historischen Forschungslogik“. Diese Arbeit, welche die Ergebnisse der hier vorgelegten Arbeit systematisch auswertet, versucht vor allem einen Zugang aufzuzeigen für eine mögliche Lösung des sog. „Integrationsproblems“. Den eigentlichen prekären Kern dieses Problems bildet, wie Porath zeigen kann, die methodologisch präzise Umsetzung der in der nächsten Anmerkung genannten „Faustregel kulturwissenschaftlichen Denkens und Fragens“ auch und gerade im Zusammenhang mit dem Bemühen, den „Werdegang“ (personaler) Habitualprofile zu rekonstruieren, was ja, wie wiederum ich meine, die eigentliche Aufgabe jedweder Ätiologie von Mentalerkrankungen überhaupt ist. In genau diesem Sinne lässt sich, wie Porath meint, anhand des paradigmatischen Belegstückes vor allem der psychiatrischen Diagnostik ganz besonders sinnenfällig demonstrieren, wie eine „Vergangenheitserforschung“ funktionieren kann, die es sich zum Ziel setzt, dem Objektivitätsprinzip als solchem zu genügen. 40 II. Hauptteil 1. Max Webers „Begriffslehre des sozialen Handelns“ I – Der sozialstrukturelle Gesichtspunkt Wie erinnerlich, wurde in der Einleitungsthetik auf die integrative Vernetzung von „Psychologie“ und „Soziologie“ abgehoben, denn nur so könne, so wurde behauptet, eine für die Anamnese wie auch für die Diagnostik psychiatrierelevante Sozialisationstheorie konstruiert werden. Um diese gehe es, denn diese bilde, so wurde gesagt, die kognitive Grundlage dafür, dass „Identitätskrisen“, sich zerlegend in „maligne“ und „benigne“, in ihrem funktionalen Stellenwert für den Sozialisationsverlauf menschlicher Individuen eingeschätzt werden können. Bereits in diesem Zusammenhang wurde auf die „Begriffslehre des sozialen Handelns“ verwiesen, die den allgemeinen Hintergrund dafür bilde, um Lerntheorien mit dem soziologischen „point of view“ integrativ so zu vernetzen, dass sich Erklärungen gewinnen ließen für „gründlich schief gelaufene“ Sozialisationsvorgänge. Gleichfalls wurde bereits darauf hingewiesen, dass auch der Psychoanalyse hierbei ein zentraler Stellenwert beigemessen werden müsste, denn nur diese gestatte es, jenes äußerst komplexe unbewusste „Beiprogramm“ zu analysieren, welches die Modalitäten der kognitiven Umorientierungen in der Verhaltensdynamik menschlicher Individuen tiefgreifend beeinflusse. Schlagwortartig lässt sich der damit angedeutete Zusammenhang folgendermaßen formulieren: Während die Webersche „Begriffslehre des sozialen Handelns“ den Hintergrund dafür liefert, dass die dem Rationalitätsprinzip verpflichteten kognitiven Umorientierungen des Sozialisationsprozesses lerntheoretisch erfasst werden könnten, liefert die Psychoanalyse das methodische bzw. begriffliche Arsenal, um auch den sog. „irrationalen“ Dimensionen in den „Elementarformen sozialen Verhaltens“ (Homans) genügend Aufmerksamkeit widmen zu können.39 Generell geht es dabei dann um die These, dass nur und ausschließlich die Freud’sche „Metapsychologie“ eine wirklich umfassende Analyse von Lernvorgängen im Humanbereich 39 Insbesondere die in der „Psychopathologie des Alltagslebens“ beschriebenen Fehlleistungen liefern eine umfangreiche Kasuistik für genau diese „Störungen“, wie sie massenhaft in nahezu allen „Elementarformen des 41 überhaupt ermögliche, denn diese beinhaltet mit ihrem Basalkonstrukt des „Unbewussten“ die Möglichkeit, die Modifikationsvariablen genauer zu bestimmen, welche Prozesse der kognitiven Umorientierung maßgeblich beeinflussen. Dies der eigentliche Kern des „Dossenheimer Forschungsprogramms“, auf den allerdings in der vorliegenden Arbeit nur aufmerksam gemacht werden kann.40 Lassen wir diesen zuletzt genannten Problempunkt – er betrifft die sehr viel weitergehende These, dass nur und ausschließlich die Psychoanalyse für die genuin sozialisationstheoretische Dimension des sog. „sozialen Handelns“ zuständig sei, die wir in Abschnitt II. 6. behandeln werden – hier vorläufig außer Betracht, so sind wir, insofern es uns wirklich um die Ausarbeitung einer allgemeinen und empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie gehen soll, die eine funktionale Verortung der sog. „Identitätskrisen“ zum einen für „erfolgreiche“, zum anderen für „schiefgelaufene“ Sozialisationsvorgänge gestattet, zunächst einmal mit dem Problem einer genaueren Abklärung des Verhältnisses sozialen Verhaltens“ aufzutreten pflegen. Sie können daher ganz besonders gut auch und gerade in experimentell angeordneten Kleingruppenkonstellationen studiert werden. 40 Ich zitiere hier der Deutlichkeit halber aus dem bereits mehrfach erwähnten „Warschau-Vortrag“ Poraths, den dieser anlässlich des sechzigsten Jahrestages der Niederschlagung des Ghetto-Aufstandes auf Einladung des Jüdischen Historischen Instituts und der Friedrich-Ebert-Stiftung am 16. Mai 2003 gehalten hat, die folgende Passage, die die „Faustregel kulturwissenschaftlichen Denkens und Forschens“ beinhaltet. Es heißt dort: „Der Punkt, um den es mir in diesem Vortrag vor allem geht, ist der folgende: Die befriedigende kulturwissenschaftliche Erklärung eines kulturhistorisch bedeutsamen Tatbestandes besteht letzten Endes in der integrativen Vernetzung der beiden hier herausgestellten Gesichtspunkte: des kulturpsychologischen und des kultursoziologischen. Selbstverständlich gehört zur vollen kulturwissenschaftlichen Erkenntnis beides, jedoch – und dies in seinem berühmten „Objektivitätsaufsatz“ von 1904 nachgewiesen zu haben, ist das bleibende Verdienst Max Webers – nicht beides gleichzeitig. Wir haben eine „Prioritätsentscheidung“ zu fällen, die uns die kulturwissenschaftliche Fragestellung als solche aufnötigt, wenn wir uns entschließen, in diesem Zusammenhang dem Weberschen kulturhistorischen Paradigma zu folgen, dessen Kernthese besagt: Man kann die psychologische Dimension des Gesellschaftsgeschehens, die Art und Weise also, wie Menschen denken, fühlen und handeln, dann und nur dann im Hinblick auf bestimmte Ereigniskonstellationen, um deren Erklärung es uns geht, kausalrelevant gewichten, wenn zuvor in „relativer Reingestalt“ die institutionelle Dynamik des Geschehens, welche die Bedingungen der Möglichkeit des Denkens, Fühlens und Handelns der Menschen beinhalten, hinreichend aufgehellt worden ist. Ich bezeichne dieses „Prioritätspostulat“ als die methodische Faustregel kulturwissenschaftlichen Denkens und Fragens und leite aus ihr die folgende Konsequenz ab: Wenn wir uns entschließen, die „Endlösung der europäischen Judenfrage“ als ein kulturhistorisch bedeutsames Phänomen aufzufassen, dann haben wir es zunächst einmal nicht mit der Psychologie der „Täter“ und auch nicht mit der Psychologie der „Opfer“ zu tun, sondern mit den strukturellen Mechanismen der institutionellen Dynamik, in die die Täter wie die Opfer „eingesponnen“ gewesen sind. Und die alles entscheidende Frage in diesem Zusammenhang lautet: Wie sollen wir diese „strukturellen Mechanismen der institutionellen Dynamik“ im 20. Jahrhundert eigentlich beschreiben?“ Dass, inwiefern und warum nur und ausschließlich die – entsprechend umformulierungsbedürftige – Freud’sche „Metapsychologie“ es ist, welche mithin auch als die eigentliche metatheoretische Grundlage für die lerntheoretische Forschung insgesamt in Frage komme, kann in der vorliegenden Arbeit natürlich nur unzulänglich zum Ausdruck kommen. Hier wird, wie bereits einleitend hervorgehoben, lediglich Plausibilität 42 zwischen „Soziologie“ und „Psychologie“ konfrontiert. Im Zentrum steht dabei die Frage nach dem methodologischen Stellenwert der Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“, welche dem vorliegenden Ansatz zufolge die eigentliche analytisch-heuristische Grundlage bildet für eine systematische Erforschung zum einen der sozialstrukturellen Aspekte des Gesellschaftsgeschehens, zum anderen für die Erforschung von deren Verhaltensdimension.41 Dies bedarf der Erläuterung: Psychologisch, d. h. aus dem Blickwinkel einer wesentlich das sich verhaltende Individuum ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückenden Betrachtungsweise, ist der „Charakter“ eines menschlichen Wesens zum einen durch seine „Anlagen“, zum anderen durch seine „Lebenserfahrungen“ geprägt, was wesentlich lerntheoretisch interpretiert werden kann und muss. Der Begriff des „Lernens“ macht nämlich nur Sinn im Bezugsrahmen einer Theorie, die sich mit bestimmten (organismischen) Lebensformen befasst, hinsichtlich der institutionellen bzw. rollenstrukturellen Aspekte des Sozialgeschehens hingegen, die ja „irgendwie“ auch in die Sozialisationsvorgänge „eingreifen“, ist er vollständig sinnlos: In einem genuinen Sinne sich dergestalt verhalten, dass ihr Verhalten als „subjektiv sinnhaftes“ gedeutet oder gar verstanden werden könnte bzw. müsste, können nur menschliche Individuen.42 Ist jedoch das der Fall, dann haben wir es eben nicht mehr mit „bloßem angestrebt, wofür allerdings die Offenlegung der argumentativen Hintergründe unabdingbar ist. Nur darum geht es mir an dieser Stelle zunächst einmal. 41 Vgl. die im nächsten Abschnitt zu behandelnden Heuristik des sog. „symbolischen Interaktionismus“, den ich in dem von Stryker vorgestellten „Gefüge von Grundannahmen“ präsentieren werde. 42 „Menschliches (»äußeres« oder »inneres«) Verhalten zeigt sowohl Zusammenhänge wie Regelmäßigkeiten des Verlaufs wie alles Geschehen. Was aber, wenigstens im vollen Sinne, nur menschlichem Verhalten eignet, sind Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten, deren Ablauf verständlich deutbar ist“, heißt es schon in dem „Kategorienaufsatz“ Max Webers aus dem Jahre 1913. Dass, inwiefern und warum es dabei immer um „subjektiv sinnhaftes“, auf irgendeiner Art und Weise also auch „rationales“ Verhalten geht, wird uns später in extenso interessieren. Das mit dem Problem der kultur- und sozialwissenschaftlichen Integration befasste Forschungsprogramm der „Dossenheimer Arbeitsgruppe“ zerlegt, dem „Forschungsantrag“ vom Sommer 2001 folgend, die – derzeitig verfügbaren – Lern- und Entwicklungstheorien in drei große Teilmengen und unterscheidet folglich arbeitsbegrifflich zwischen drei Lernbegriffen, wobei der Begriff der „Verhaltensmodifikation“ als Oberbegriff fungiert: Streng behavioristisch ist „Lernen“ die „Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Verhaltensänderungen“, kognitivistisch ist „Lernen“ in Anlehnung an die berühmte Bruner-Postman-Vermutung gleichbedeutend mit „Umorientierung des kognitiven Feldes“ und psychoanalytisch ist das (primordiale) Lernen definiert als „Transformation des Lustprinzips in das Realitätsprinzip“. Wie bereits angedeutet, geht das Forschungsprogramm der „Dossenheimer Arbeitsgruppe“ davon aus, dass es vornehmlich die Freud’sche „Metapsychologie“ ist, deren „paradigmatische Grundorientierung“ (Porath) als hinreichend kompetent aufgefasst werden kann, um sowohl die streng behavioristischen als auch die „kognitivistischen“ Lerntheorien zu einer umfassenden und in sich kohärenten Allgemeinen Verhaltenstheorie zu integrieren. Die dabei auftretenden 43 Verhalten“, sondern mit sozialem Handeln zu tun, betreten also das Gebiet der Soziologie.43 Denn: „Soziologie (im hier verstandenen Sinn dieses sehr vieldeutig gebrauchten Wortes)“, schreibt Max Weber in seiner berühmt gewordenen, viel zitierten und dennoch analytisch in der Regel kaum wirklich durchdrungenen (Arbeits-) Definition, auf die wir aus genau diesem Grunde wieder und wieder zurückkommen werden, „soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will.“44 methodischen wie auch methodologischen Detailprobleme sind ausgesprochen kompliziert und ihre auch nur halbwegs befriedigende Lösung liegt noch in weiter Ferne. 43 Wie Porath in [Psychiatrische Historik] beziehungsweise in [Historische Forschungslogik] zu zeigen versucht, ist bislang der Webersche Forschungsansatz gründlich mißverstanden worden, was vor allem daran liege, dass wir alle noch viel zu sehr in genuin „aristotelischen Kategorien“ (Lewin), d.h. vor allem klassifikatorisch, zu denken gewohnt und folglich unfähig seien, den von Kurt Lewin postulierten „Galileisierungsschritt“ auch und gerade in gesellschaftswissenschaftlichen Denken nachzuvollziehen. Webers nicht zufällig Fragment gebliebenes Gesamtwerk – das betrifft vor allem den „in Spiritus gesetzten theorieembryonalen Torso“ [Wirtschaft und Gesellschaft], welcher bekanntlich posthum erschienen ist – müsse als ein „sisyphosionaler“ Versuch gelesen werden, genau diesen galileischen Übergang auch in der Erforschung der „menschlich-gesellschaftlich-geschichtlichen Wirklichkeit (Dilthey) zu vollziehen. Dieser Deutung zufolge habe Max Weber in seiner „Begriffslehre des sozialen Handelns“ keineswegs den Versuch gemacht, eine neue Fachdisziplin mit dem Namen „Soziologie“ bzw. die „Verstehende Soziologie“ zu begründen, es sei ihm vielmehr wesentlich darum gegangen, um einer auf Objektivität ausgreifenden Erforschung der „menschlichgesellschaftlich-geschichtlichen Wirklichkeit“ willen, die notwendige Komplementarstruktur von Psychologie und (Kultur-)Soziologie methodologisch mittels notorischer Kasuistik plausibel zu machen. Meine wissenschaftstheoretischen wie auch wissenschaftsgeschichtlichen Kenntnisse erlauben es mir nicht, mich voll und ganz mit dieser Deutung zu identifizieren, mir leuchtet jedoch der (texthermeneutische) Grundgedanke Poraths ein, vor allem die Webersche „Definitionsmethode“, wie er sie in „Wirtschaft und Gesellschaft“ zur Perfektion entwickelt hat, wie ein Vexierbild zu lesen, was bedeutet: Dem institutionentheoretisch orientierten Soziologen wird deutlich gemacht, wie er mit den genuin psychologischen Verhaltenstheorien verfahren müsse, und dem Verhaltenstheoretiker wird deutlich gemacht, dass er genau dann, wenn er sich humanspezifischen Formen des Verhaltens annähert, um diese zu erforschen, mit „linguistiko-kognitiven Strukturen“ (Porath) konfrontiert werde, die sich nur sozialstrukturell – auf der Grundlage einer allgemeinen Institutionentheorie – analysieren ließen. Der jedoch in der Tat bei Weber nachweisbare Primat genuin „soziologischen“ Denkens und Forschens ergebe sich ganz einfach, so Porath, aus dem genuin historischen Basalinteresse Max Webers, wie vor allem dessen „Rationalitätsforschungen“ im Rahmen seiner Religionssoziologie belegten. Genau hier hat dann natürlich die idealtypologische Methodik, wie ich sie in den „Rationalitätskatalogen“ zu demonstrieren versuchen werde, ihren systematischen Stellenwert. 44 Weber [Wirtschaft und Gesellschaft] S. 1. Später werden wir das Implikat dieser „definitorischen“ Festlegung des eigentlichen Gegenstandsbereiches der Soziologie genauer unter die Lupe nehmen: In der Weberschen Verstehenslehre wird die von Gadamer erarbeitete scharfe Unterscheidung zwischen der sog. „hermeneutischen“ und der „psychologischen Konzeption des Verstehens“ zwar begrifflich noch nicht befriedigend durchgeführt, ist jedoch „im Prinzip“ vorhanden, wie Porath behauptet. Wie auch immer: Die Unterscheidung ist jedenfalls in den methodologischen Schriften selbst „so“ nicht vorhanden, so dass die folgende Faustregel gilt: Das Verständnis eines subjektiv sinnvollen Verhaltensmusters benötigt in demselben Umfang genuin psychologisches Wissen, in welchem es sich als irrational im klinischen Sinne erweist. In diesem Sinne sind die „Affekte“, die das rationale Handeln verzerren und beeinflussen auf gar keinen Fall irrational, können wir doch, insofern uns „nichts Menschliches fremd ist“, in der Regel sehr wohl „verstehen“, warum sich jemand in einer ganz bestimmten Situation, in der er sich eigentlich streng situationsadäquat und zweck- bzw. wertrational hätte verhalten müssen, mehr von seinen Leidenschaften leiten lässt. Es ist ein 44 Was aber bedeutet in diesem Zusammenhang, d. h. bei dem Versuch, den nur und ausschließlich der „Soziologie“ genuin zueigenen Gegenstandsbereich bestimmen zu wollen, der Begriff des „Handelns“, den Weber offensichtlich ganz bewusst von dem Begriff des „Verhaltens“ unterscheidet, um so den Begriff des „sozialen Handelns“ gewinnen zu können? Nun „»Handeln« soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden.45 »Soziales« Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist.“46 Hinsichtlich des nach wie vor bestehenden Desiderats einer auch und gerade für die „Entwicklungspsychopathologie des Kindes- und Jugendalters“ bedeutsamen Sozialisationstheorie ergibt sich nämlich soziologisch – dies gilt zumindest für die Soziologie Max Webers, der wir hier folgen wollen – eine etwas andere Blickrichtung als wie sie uns die Lern- und Verhaltenstheorien aufherrschen: Die Persönlichkeitsstruktur eines menschlichen Wesens ist wesentlich geprägt von denjenigen Sozialstrukturen, die dieses menschliche Wesen in seinem Leben „durchlaufen“ hat und die es streng soziologisch, d. h. gerade nicht mittels eines genuin lern- und verhaltenstheoretischen Jargons zu bestimmen gilt, soll das Handeln eines Menschen oder gar sein soziales Handeln als situationsadäquat, d. h. „rational“, oder aber als situationsinadäquat, d. h. „irrational“, wirklich verstanden werden. Merkwürdigerweise – und dies zeigt sich erst bei wirklich genauem Hinsehen – lässt sich nämlich das „Begriffspaar „rational – irrational“, dem zweifelsohne psychiatrisch ein konstitutiver Stellenwert zukommt, lerntheoretisch gar nicht recht bestimmen: Gerade weil es zentrales Prinzip der Weberschen Methodik, dass psychologisches bzw. naturwissenschaftliches Wissen die Aufgabe des „Verstehens“ zwar erleichtern, nicht jedoch ersetzen kann. Zu dem Problem einer genaueren Bestimmung des „Grenzbereiches“ zwischen den noch verstehbaren affektgeladenen – und in diesem Sinne „irrationalen“ – Formen des „Sichverhaltens“ und den nur noch psychologisch „Irrationalismen“ vgl. den Abschnitt II. 7. 2. 45 Wie stark hierbei die „Bewusstseinskomponente“ ist, lässt sich daran ablesen, dass ja die Frage Antwort erheischt, warum ein bestimmtes Individuum sich auf eine bestimmte Art und Weise hat bzw. sich zu verhalten gewohnt ist (Habitualprofil). Es ist so von vorneherein in einen pragmatischen Kontext gestellt. Weber selbst verwendet hierfür den Begriff des „Sinnzusammenhangs“. 46 Ist also subjektiv sinnhaftes Verhalten zweier Individuen komplementär zueinander, d.h. wechselseitig aufeinander bezogen, so bildet dieses „Gemeinschaftshandeln“ einen Sinnzusammenhang. Vgl. hierzu das „Radfahrerbeispiel“ in Abschnitt II. 8. 1. Zu einer ersten systematischen Verknüpfung der Weberschen Soziologiedefinition mit den Grundannahmen des sog. „symbolischen Interaktionismus“ vgl. den nächsten Abschnitt II. 2. 45 wesentlich mit dem Begriff der „Situationsadäquatheit“ und damit letztendlich mit dem Realitätsbegriff konnotiert ist, macht das Begriffspaar „rational – irrational“ nur aus dem sozialstrukturellen Blickwinkel, d. h. soziologisch, überhaupt Sinn. Das jeweilige institutionelle Arrangement der Sozialstrukturen nämlich, bestehend aus Familie, Kindergärten, Schulen, Lehrstelle etc., wirkt als ein Gefüge von Sozialisationsagenturen, welche rollensystematisch beschrieben und in ihrem jeweiligen Einfluss auf den Sozialisationsprozess einer „Persönlichkeit“ bestimmt werden können bzw. müssen: Gelingt es nicht, die sozialstrukturellen Hintergründe eines Individuums, die seinen Erfahrungsraum und damit auch seine dominierenden Verhaltens- und Handlungsmuster wesentlich geprägt haben, aufzuklären, so dürfte es wohl kaum möglich sein, zu erklären, warum sich jemand genau so verhält wie er sich verhält. Darum aber geht es naturgemäß letztendlich bei einer empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie, welche nun einmal die allgemeine kognitive Grundlage einer jeden „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ (Redlich und Freedman) ist und bleiben muss. Unter dem Blickwinkel einer genau in diesem Sinne als streng soziologisch zu verstehenden Sichtweise, die von dem Grundbegriff des sozialen Handelns, nicht jedoch von dem des individuellen Verhaltens ausgeht, ausgehen muss, soll in der vorliegenden Arbeit diskutiert werden, was eigentlich eine „Identitätskrise“ ist, und in welchem Zusammenhang sie mit den Verhaltensstörungen des neurotischen bzw. psychosomatischen oder auch des psychotischen Formenkreises stehen könnte. Betreten wir nämlich dieses Gebiet, so betreten wir das „Reich der Irrationalität“ und damit, wie in Abschnitt II. 7. 2. auszuführen sein wird, das „Reich der (Freud’schen) Psychoanalyse“.47 47 Damit haben wir immerhin bereits so etwas wie eine erste Arbeitsdefinition dessen, was bei Redlich und Freedmann mit dem Begriff des „gestörten“ bzw. des „abnormen Verhaltens“ zu umschreiben versucht worden ist: Gemeint sein können damit nur Verhaltensmuster, welche darauf schließen lassen, dass entweder das „subjektiv sinnvolle Verhalten“ eines Individuums als solches oder/und das „subjektiv sinnhafte Verhalten“ eines Individuums, welches sich „auf das Verhalten anderer“ bezieht, beeinträchtigt ist. Der eigentliche Clou des Weberschen Ansatzes besteht, wie wir sehen werden, darin, dass damit nicht die jeweilige „Affektbesetzung“ eines Handlungsaktes gemeint ist: Verstehbar ist Weber zufolge sehr wohl, dass „ein Kulturmensch, begabt mit der Fähigkeit und dem Willen, bewusst zur Welt Stellung zu nehmen und ihr einen Sinn zu verleihen“, aus Stolz, Eifersucht, Liebe oder Hass keineswegs „zweckrational“ bzw. „richtigkeitsrational“ oder auch „wertrational“ handelt. Das Webersche Kriterium ist das Ausmaß der Beeinträchtigung „subjektiv sinnhaften Verhaltens, welches wir an Hand des idealtypologischen Rationalitätsschemas bemessen können. Die Webersche Motivlehre ist ja gerade keine Psychologie! Dieser Aspekt der Weberschen Kategorienlehre ist offensichtlich ungemein schwer zu begreifen, macht doch nahezu die gesamte Weber-Interpretation den Grundfehler, „Normalvorstellungen“ von Rationalität und Irrationalität in die Webersche Fachbegrifflichkeit hineinzuprojezieren. Nebenbei gesagt liegt hier einer der Hauptgründe dafür, dass ich mich um eine Begutachtung meiner Arbeit durch so ausgewiesene Weber-Kenner, wie es sowohl der Sozialphilosoph Prof. Rolf Zimmermann als auch der Schluchter-Schüler Prof. Thomas Schwinn sind, so intensiv bemüht habe. Ich 46 Wie aber geht das zusammen? Was bedeutet es, dass ein offenkundig genuin psychologischer Begriff wie der der „Identitätskrise“, der doch wesentlich dem Grundvokabular einer Lerntheorie und damit der „Psychologie“ angehört, nur und ausschließlich, wie es die hier vorgelegte Arbeit behauptet, aus dem Blickwinkel einer streng soziologisch „vorausdefinierten“ Sozialisationstheorie, welche einen offenkundig nicht psychologisch gemeinten Begriff – den des „subjektiv sinnvollen sozialen Handelns“ nämlich – zum Ausgangspunkt nimmt, so bestimmt werden kann, dass zum einen der Begriff der malignen, zum anderen der Begriff der benignen Identitätskrise gewonnen werden kann? Schauen wir näher zu, denn natürlich wird zwar das hier Angedeutete noch wesentlich präziser zu fassen sein, jedoch sollte der Deutlichkeit halber bereits an dieser Stelle zumindest so etwas wie die Richtung angegeben werden, in welcher sich meine Überlegungen bewegen. Die nachfolgenden Denkschritte werden sodann mehr und mehr zu präzisieren versuchen, worum es geht, wenn von einem genuin soziologischen „point of view“ in den Kultur- und Sozialwissenschaften die Rede ist, der ganz bewusst die „Verstehende Soziologie“ Max Webers und damit den Begriff des sozialen Handelns, zum Ausgangspunkt nimmt. Die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen – geprägt durch eine sequenzielle Kette mehr oder weniger erfolgreich bewältigter Identitätskrisen – ist Resultante eines (individuellen) Lerngeschehens, welches sich, wie nachstehend zu zeigen versucht wird, in zwei soziologische Stränge, den Sozialisations- sowie den Enkulturationsprozess, und in einen psychologischen Strang, den Affektstrukturierungssprozess, zerlegt. Der Sozialisationsprozess besorgt dabei die Fähigkeit, soziale Positionen einzunehmen und die mit diesen verbundenen sozialen Rollen zu spielen, der Enkulturationsprozess führt zur Internalisierung der mit den „stattgehabten“ Rollenübernahmen verbundenen Kognitiv- und Wertestrukturen und je nachdem, wie diese beiden Strukturen des personalen Aufbaus – des Sozialisationsprozesses und des Enkulturationsprozesses – aufeinander bezogen sind, erfolgen die Modalitäten der je individuellen Affektstrukturierung (Sublimierung bzw. Verdrängung), die sich, wie die weiter unten zu behandelnden „psychoanalytischen Grundannahmen“ glaube nämlich, dass auch diese beiden vorzüglichen Weber-Kenner genau diesen Aspekt der Weberschen Kategorienlehre nicht gesehen haben. Aus diesem Blickwinkel lassen sich sodann auch, wie mir scheint, Kompetenzbereich und Stellenwert der Psychoanalyse sehr viel genauer bestimmen, als es der bloße Verweis auf „Irrationalität“ vermag. Aus diesem Blickwinkel lassen sich sodann auch, wie mir scheint, Kompetenzbereich und Stellenwert der Psychoanalyse sehr viel genauer bestimmen, als es der bloße Verweis auf „Irrationalität“ vermag. 47 postulieren, nur mittels des Begriffs des „Unbewussten“ erforschen und aufklären lassen. Hierzu erst im Abschnitt II. 6. bzw. im Abschnitt II. 7. 2. Genaueres.48 Ich behaupte nämlich, dass ein Zusammenhang zwischen diesen drei Determinanten der Persönlichkeitsentstehung, der jeweiligen Struktur der Identitätskrisen derselben, den klinisch auffälligen Verhaltensmustern wie auch den delinquenten Verhaltensmustern besteht, welche aus der hier angedeuteten genuin soziologischen Perspektive wesentlich genauer gefasst werden kann als aus einer bloß entwicklungspsychologischen Perspektive, die gegenwärtig noch eigentlich alle Formen der „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ dominiert. Denn die im engeren Sinne soziologische Perspektive – und nur diese – gestattet, wie ich bereits in meiner Magisterarbeit habe zeigen können49, die eindeutige Differenzierung zwischen delinquenten, 48 Wie in der Schlussbemerkung (III.) explizit hervorzuheben sein wird, bildet die Analyse des Enkulturationsvorganges, dem als Komplementarvorgang das Internalisierungsgeschehen korrespondiert, den eigentlich neuralgischen Punkt des hier vorgelegten Ansatzes zu einer möglichen empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie. Aus dem Blickwinkel der Psychologie, welche die strukturelle Dynamik von Verhaltensmodifikationen organismischer Systeme erforscht und empirisch gehaltvolle streng allgemein formulierbare Sätze bezüglich dieser Verhaltensdynamik zu finden versucht, ist die „Soziologie“ derjenige „point of view“, von dem aus diese strukturelle Dynamik des Verhaltens von (menschlichen Individuen) nach Maßgabe des Begriffsgefüges „soziales Handeln“ gedeutet und verstanden zu werden versucht wird. Dabei werden einige trivialpsychologische Gesetzmäßigkeiten zugrunde gelegt, um das Konstrukt des rationalen Handelns zu gewinnen, denn nur mittels dieses Konstruktes lassen sich dann auch die psychologisch nicht trivialen Gesetzmäßigkeiten der Verhaltensmodifikation erforschen. Deshalb benötigt jedwede „Psychologie“ eben diesen genuin soziologischen „point of view“ aus genau zwei Gründen: Erstens um die sozialkonfigurativen Rahmenbedingungen beschreiben zu können, „unter“ denen sich das Verhalten menschlicher Individuen abspielt und zweitens, um gedankenexperimentell den jeweiligen reinen Fall des Verhaltens konstruieren zu können, bei dem die die psychologischen Trivialgesetze konstituierenden Bedingungen erfüllt sind. 49 In meiner Magisterarbeit [Delinquenzdisposition] die sich wesentlich auf die Sacksche [Kriminalsoziologie] Analyse des Zusammenhangs von sozialer Kontrolle und Delinquenzdisposition stützt, habe ich erstens zeigen können, in welchem Umfang „Delinquenzkarrieren“ abhängig sein können von dem Modus des Umgehens der Kontrollorgane und Institutionen mit Delinquenzverdächtigen. Sack spricht in diesem Zusammenhang von „delinquenter Karriere“. Und zweitens habe ich zeigen können, dass unter bestimmten Umständen, der Einstieg eines Jugendlichen in eine Delinquenzkarriere diesem die genuin psychiatrische Karriere erspart: Dann nämlich, wenn bei bestehender rollenkonfliktiös verursachter drohender Identitätsdiffusion einem Jugendlichen seitens der rechtlichen Systeme der sozialen Kontrolle die Rolle des „Diebes“ – z. B. in Gestalt eines Gerichtsurteils – zugeschrieben wird, mit der sich dieser Jugendliche sodann identifizieren kann, festigt sich sein sozialer Standort und genau dieser Tatbestand wirkt pathologiehemmend. Zu überlegen wäre also, ob diesem Sackschen Terminus nicht der Begriff der „psychiatrischen Karriere“ zugeordnet werden kann. Wie unschwer zu erkennen, liegt hier ein schwieriges Problem. Sack hat nachgewiesen, dass erst durch das Wirken der sozialen Kontrollen „Delinquenz“ in schwerem Sinne erzeugt werden kann: Offenkundig benötigen ganz bestimmte Erscheinungsformen von Schwerstkriminalität, wenn sich diese als persönlichkeitsspezifische Handlungsmuster mit entsprechenden Qualifikationsprofilen ausbilden sollen, ganz bestimmte Sozialisationsmodi, die sich nur und ausschließlich in entsprechenden Strafvollzugseinrichtungen antreffen lassen. Das Erregende dieser These besteht, wenn man sie streng allgemein fasst, darin, dass damit die Möglichkeit eingeräumt wird, die Systeme der sozialen Kontrolle könnten, obwohl sie doch als Reaktion auf delinquentes Verhalten gedacht werden müssen, delinquentes Verhalten erst 48 d. h. rationalen, und psychiatrisch auffälligen, d. h. irrationalen, Formen der Devianz insbesondere bei Kindern- und Jugendlichen, eine Differenzierung, die sich folgendermaßen formulieren lässt: Schwere Identitätskrisen bzw. identitätskritische Dauerzustände, die sich wegen ihrer irritierenden irrationalen Erscheinungsformen mittels der psychiatrischen Symptomatologie umschreiben lassen, wirken sich dahingehend aus, dass Individuen nicht mehr in einer halbwegs adäquaten Form sozial – bzw. rational – zu handeln imstande sind und sich deshalb auf eine bestimmte Art und Weise dergestalt abweichend verhalten (müssen), dass ihre soziale Umwelt gezwungen ist, sie in die Obhut der medizinischen Betreuung zu geben.50 Dasselbe gilt nämlich – und hier liegt bereits ein bestimmter Aspekt genuin soziologischen Vorgehens – nicht für diejenige Klasse von Identitätskrisen, die mit delinquenten Verhaltensmustern verknüpft sind: Personale Desintegrationen vor allem des sog. „psychotischen Formenkreises“ sind die Resultanten gänzlich anders gearteter massiver Identitätskrisen, die selbst wiederum auf gänzlich anders gearteten Sozialisationsverläufen beruhen, als derjenigen, die zu delinquenten Formen abweichenden Verhaltens führen, denn hervorbringen. Analog dazu wäre es doch immerhin denkbar, dass die medizinischen Institutionen, deren Aufgabe es doch eigentlich sein muss, innerhalb der Grenzen ihrer Möglichkeiten aus einem „Patienten“ einen normal funktionierenden „Gesunden“ zu machen, eben diesen Patienten erst richtig „krank“ machen. Im Zusammenhang mit der Analyse der „Wirkfaktoren“ pathologisierender Gesprächsformen sollte man sich, wie ich meine, mit diesen Problemen genauer befassen. Die in der vorliegenden Arbeit sehr stark betonte Analogie zwischen dem genuin juristischen Umgehen mit Formen der Devianz und dem psychiatrischen Umgehen mit diesen hat vor allem einen, wie ich meine, ungemein großen analytisch-heuristischen Vorteil: Man kann mit Blick auf das entsprechende Prozedere der Organe unserer Rechtsordnung die seitens der Psychiatrie in den Blick genommenen Verhaltensstörungen, insofern sie sozial auffällig geworden sind rollenstrukturell beschreiben und somit dem methodologischen Postulat der intersubjektiven Überprüfbarkeit in durchaus „behavioristischen Sinne“ Rechnung tragen, wie es ja auch von Redlich und Freedman gefordert wird. Die von Sigmund Freud beispielsweise so eindrucksvoll beschriebenen „Fehlleistungen“ sind ausnahmslos in ganz bestimmten sozialen Kontexten angesiedelt. Ich verweise hier nur auf den von Freud beschriebenen Vorsitzenden einer Journalistenvereinigung der sich mit seiner völlig unpassenden Eröffnungsformel „Die Sitzung ist geschlossen, pardon, ich meine natürlich eröffnet“, ja nicht nur auffällig benimmt, sondern ganz einfach „aus seiner Rolle fällt“. Zu dem Problem des Zusammenhanges zwischen den in der „Theorie“ der Psychoanalyse avisierten Fehl- und Symptomhandlungen und den diesen zuordbaren beobachtbaren Verhaltensmustern vgl. die Interpretation des Tafelbildes in Abschnitt II. 7. 2. 50 Dies ja wohl der eigentlich wichtige Punkt bezüglich einer Analyse auftretender Devianz, der z.B. gegenüber den sehr viel wageren Kriterien für die definitorische Festlegung des Begriffs für die „Verhaltensstörung“ in dem Lehrbuch von Redlich und Freedman [Psychiatrie] geltend gemacht werden muss, wie wir in Abschnitt II. 4. sehen werden: Personale Systeme, die sich in notorisch anhaltendem identitätskritischem Zustand befinden, müssen sich auf eine bestimmte Art und Weise deviant verhalten, wohingegen „Widerständler“ und „Delinquente“ die Wahl haben, sich deviant oder konform zu verhalten. Der weitere Punkt, die Reaktion der sozialen Mitwelt, die darüber befindet, ob oder ob nicht „abnormes Verhalten“ im klinischen Sinne vorliegt, ist strengstens zu beachten: Die Kriterien für die „Irrationalitätsevaluation“ ergeben sich immer aus einem Wertesystem, welches kulturspezifisch ist. 49 bei diesen bleiben die sozialen Kompetenzen und die diesen genuin zugehörigen Rationalitätsprinzipien erhalten.51 Wenn dergestalt ein Zusammenhang postuliert werden muss zwischen schweren („malignen“) Formen von Identitätskrisen und massiv „gestörten Verhaltensmustern“ (Redlich und Freedman), was ist dann eigentlich überhaupt eine „Identitätskrise“ und in welchem Zusammenhang steht diese wiederum mit denjenigen Verhaltensmustern, die ganz allgemein in der soziologischen Fachsprache als „Devianz“ bezeichnet zu werden pflegen? Gibt es hierbei vielleicht einen Zusammenhang mit den genuin soziologisch definierten „Systemen der sozialen Kontrolle“, der bislang vom „rein medizinischen“ Standpunkt aus nicht zuletzt auch deshalb übersehen wurde, weil es sich bei den Einrichtungen, die für die mentale und körperliche Gesundheit in unserer Gesellschaft zuständig sind, selbst um komplexe und nahezu perfekt durchorganisierte Systeme der sozialen Kontrolle handelt? Erklärt sich die vielzitierte Hilflosigkeit der Psychiatrie, das Begriffspaar „normal-anomal“ in einem wirklich therapierelevanten präzisen Sinne zu definieren, vielleicht doch vor allem dadurch, dass man trotz einer Unmenge von rollentheoretischen Ansätzen in der Psychiatrie den genuin soziologischen Aspekt der Problematik viel zu sehr vernachlässigt hat? Was aber ist dann dieser „soziologische Aspekt“? Worin genau besteht er? Wie sich zeigen wird, liegt in der Beantwortung dieser Fragen einer der sowohl diagnostisch als auch therapeutisch relevanten Vorzüge einer konsequent soziologischen Verfeinerung der 51 Bei aller wohlwollenden Bereitschaft meinerseits, die mehr als genug Grund hat, von den Ergebnissen ihrer (bisherigen) Arbeit bescheiden zu denken, sehe ich nicht, wo in der gängigen Literatur genau dieser Gedanke bereits aufgetreten ist. Ganz im Gegenteil: Gerade den Eriksonschen Bemühungen verdanken wir das Konstrukt der „Sozio-Pathie“. Dies ein Konstrukt, welches bereits begriffsnotwendig, d. h. bereits vom (methodischen) Grundansatz her, nahelegt, die Divergenz von besonders schwerwiegender Delinquenz und „Krankheit“ aufzuheben. Meisterhaft beschrieben ist das komplizierte Netzwerk von kriminellen und psychopathologischen Strukturen in dem Döblin’schen Großstadtroman „Berlin Alexanderplatz“. Hier in diesem Roman wird virtuos dargestellt, dass und inwiefern eine „Schizophrenie“ ein Lebensverlaufsgeschehen designiert, welches notorisch von sich einander ablösenden und immer gravierender sich maligne auswirkenden Identitätskrisen des Protagonisten „durchsetzt“ ist. Weil Döblin, wie das Arbeitspapier meiner Kollegin Janna Rinderknecht minutiös nachgewiesen hat, den zunehmend desaströsen Lebensprozess seines Protagonisten Franz Biberkopf als Funktion der in der Großstadt „Berlin“ in der Nachkriegsaera der 20er Jahre bestehenden Sozialmilieus und gerade nicht als „endogen“ beschreibt, wird in musterhafter Weise eine wirkliche „Sozialpathologie“ entworfen, die sozialstrukturelle Konstellationen ätiologisch zu gewichten gestattet. Diesen Gedanken gilt es nunmehr, wie ich meine, auch streng wissenschaftlich zu sichern. Eines der interessantesten Problembereiche der psychosozialen medizinischen Forschung erschließt sich, wenn man im Bezugsrahmen einer streng soziologischen Sichtweise, wie sie z.B. die Sacksche Heuristik darstellt, kriminogene und psycho-pathogene Karrieren differenzialdiagnostisch zu klären versucht wie ich meine. 50 psychiatrischen Forschung und Praxis, wie sie vor allem – und wie ich meine: letzten Endes nur – die Webersche „Begriffslehre des sozialen Handelns“ zu bieten vermag.52 Dies deshalb, weil diese – und letztendlich eben nur diese – in Gestalt eines idealtypologischen Schemas ein logisch kohärentes Gefüge von Kriterien offeriert, die es gestatten, dass rationale Handeln menschlicher Individuen als situationsadäquates Verhalten gegenüber irrationalen Verhaltensmustern wertfrei zu diskriminieren.53 Halten wir bereits an dieser Stelle eine der zentralen Thesen der vorliegenden Abhandlung – die andere betrifft, wie gesagt, den Stellen- und Erkenntniswert der Psychoanalyse – in expliziter Form fest: Ausschließlich der Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“ verdanken wir den bislang einzigen gelungenen Versuch, normales (individuelles) menschliches Verhalten als objektbezogenes sowie „(subjektiv) sinngetragenes soziales Handeln“ so zu bestimmen, dass es arbeitsdefinitorisch als Richtschnur zur Analyse aller genuin humanen Formen des Verhaltens dienen kann. Und nur aus dem Blickwinkel eines so verstandenen kultursoziologischen Ansatzes macht letztendlich auch eine Theorie der kognitiven Sozialisation, wie sie z. B. von Piaget entwickelt worden ist, überhaupt Sinn. Dies deshalb, weil eine solche Theorie die idealtypologische Konstruktion des Rationalitätsbegriffs benötigt, der in „reiner“ Form bisher nur von Max Weber in seiner Theorie des zweckrationalen Handelns elaboriert worden ist: Pathologische Erscheinungsformen humanspezifischen individuellen Verhaltens sind sodann solche, bei denen das „(subjektiv) sinngetragene“ und normalerweise objektbezogene „soziale Handeln“ auf irgendeine mehr oder weniger starke Weise beeinträchtigt ist. Trivialerweise folgt hieraus im Zusammenhang mit den obigen Ausführungen: Ist das „(subjektiv) sinngetragene soziale Handeln“ 52 Wie sich zeigen wird, gestattet allerdings erst die rollenbegriffliche Komplementarisierung der Weberschen Handlungssoziologie, wie wir sie vor allem Linton verdanken, die Differenzierung in institutionelle Tatbestände („Dieb“ bzw. „Diebstahl“) und individuelle Verhaltensmuster („Stehlen“). Und bei genauem Hinsehen ist auch völlig klar, warum das so ist: Mittels des Begriffs „Diebstahl“ wird seitens der Systeme der sozialen Kontrolle ein ganz bestimmtes Habitualprofil erstellt, ob allerdings eine ganz bestimmte Handlung bzw. ein ganz bestimmtes Verhalten diesem sozialstrukturell vorauserstellten Habitualprofil entspricht, kann u. U. ein durchaus kniffliges Problem sein, welches erst in einem geregelten Verfahren sich klären lässt: Auch und gerade die Systeme der sozialen Kontrolle schreiben Rollen zu, was auf dem Boden einer ganz bestimmten Sozialtheorie geschieht: Dass jemand einen Lippenstift im Kaufhaus an sich nimmt, dass er dann ohne zu bezahlen das Kaufhaus verlässt, ist zweifelsohne beobachtbar, dass er jedoch einen Diebstahl begangen hat, wird erst z. B. vom Kaufhausdetektiv dadurch erschlossen, dass er beide Verhaltensvorgänge auf der Grundlage einer ganz bestimmten Sozialtheorie, die sich auf das Eigentumsinstitut bezieht, in einen Kausalzusammenhang bringt. 53 Wie in Abschnitt II. 4. zu zeigen sein wird, verwendet ganz automatisch die Psychiatrie zur Charakterisierung ihres Gegenstandsbereiches eine krypto-(kultur)soziologische Sprache, was alles andere als zufällig ist. Sie tut es jedoch nicht explizit und zahlt deshalb, wie ich meine einen sehr hohen Preis. 51 menschlicher Individuen beeinträchtigt, so liegt dieser Beeinträchtigung eine Identitätskrise zugrunde – d. h. der Betreffende weiß weder genau noch was er will, noch wie er sich verhalten soll, weil er „nicht mehr er selbst“ ist –, welche insofern nicht konstruktiv hat bewältigt werden können, als das weitere Lernverhalten negativ beeinträchtigt wird: Identitätskrisen und Lernverhalten in ganz bestimmten rollenstrukturell interpretierbaren Handlungskontexten sind komplementär aufeinander bezogen.54 Die Webersche Konstruktion des „sozialen Handelns“ repräsentiert nämlich in diesem Sinne – und dies wohl nicht zuletzt auch deshalb, weil sie sich methodologisch in der sozialphilosophischen Tradition der Kantschen Vernunftphilosophie stehend begreift – eine (anthropologische) Ausgangspunkt Grundkategorie sowohl für die aller Sozialwissenschaften, Soziologie als auch für bildet die mithin den Psychologie und Sozialpsychologie. Wie der Sozialbehaviorist Stryker, auf den ich im nächsten Abschnitt genauer zu sprechen kommen werde, treffend sagt, kann mittels der Weberschen Formel die Analyse der Formen des menschlichen Gemeinschaftslebens wie auch jeden individuellen Verhaltens ihren Ausgangspunkt nehmen. Man könne nämlich, so Stryker, „daraus sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft [ableiten]. Auf diese Weise“ sei „für eine klare Soziologie und Sozialpsychologie“ gesorgt: „Die erstere beginnt mit dem sozialen Handeln 54 Man muss freilich sehen, warum das Lernverhalten bisweilen so massiv gestört ist bzw. sein kann. Die Konfrontation mit einer komplexen Reizmannigfaltigkeit, welche es irgendwie zu „begreifen“ gilt, um sich mit ihr zurechtzufinden, macht wegen des Ineinanderspiels von Leibreizmannigfaltigkeiten und (sozialer) „Umwelt“ zuweilen äußerst schwierige Umbauten des sozialen Universums erforderlich, für die das betreffende Individuum insofern nicht „beschaffen“ ist, als es nicht über entsprechende Kapazitäten verfügt, zugleich auch noch seine jeweiligen Identitätskonstruktionen besorgen zu können. Wohlgemerkt, das ist der genuin soziologische Standpunkt. Eine etwas andere Blickrichtung ergibt sich, wenn man konsequent den „dogmatisch“ festgelegten Standpunkt der Psychoanalyse hierzu einnimmt: Ist das Sozialverhalten eines Menschen bzw. das sein Sozialverhalten bestimmende „Gefühlsleben“ gravierend beeinträchtigt, wohingegen seine kognitiven Fähigkeiten keine Auffälligkeiten aufweisen, so muss irgendetwas in der „Objektphase“, in der die – das Sozialverhalten eines Menschen steuernde – „Erotik“ aufgebaut wird, schief gelaufen sein. Eine texthermeneutische Feinanalyse insbesondere des Freudschen Artikels „Enttäuschung des Krieges“ müsste über diesen Punkt genauere Auskunft geben können. Überaus sensibel und subtil hat Freud in seinen Arbeiten, die sich auf die „Psychopathologie des Alltagslebens“ beziehen, die Fähigkeiten derjenigen beschrieben, die nach einer ganz offenkundig „hochverräterischen“ Fehlleistung mit selbiger umzugehen versuchen und daran entsprechende charakterologische Überlegungen geknüpft: Immer geht es dabei darum, die soziale Maskerade „irgendwie“ wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn der Betreffende nur an dem Prinzip des „sozialen Handelns“ festzuhalten bestrebt ist. Später werden wir eine – wie ich meine: hochinteressante – mögliche Implikation dieses Satzes diskutieren: Bei einer bereits personalsystemisch verfestigten Disposition zu genuin malignen Formen von Identitätskrisen hängt es u. U. vom sozialen Kontext ab, ob sich eine solche Disposition weiter verstärkt oder nicht. 52 und baut darauf auf bis zur Gesellschaft; die letztere beginnt ebenfalls mit dem sozialen Handeln und arbeitet in die andere Richtung, nämlich in Richtung auf das Individuum“. Zweifellos – aber wie? Die nachfolgenden Denkschritte werden eine Antwort auf diese Frage zu geben versuchen. Der entscheidende Punkt, um den es jedoch hier – zunächst einmal – geht, ist der folgende: Webers Idealtypologie des sozialen Handelns beinhaltet die hypothetische Konstruktion eines „Normal-Ich“, d. h. eines menschlichen Individuums, welches in dem Sinne rational zu handeln im Stande ist, dass es seine Interessen und Bedürfnisse sinnadäquat zu interpretieren und zu deren Durchsetzung bzw. Befriedigung entsprechend zu handeln vermag, welches „aus Schaden klug zu werden“ und Fehlverhalten zu korrigieren vermag. Der in allen Normalsprachen dieser Welt anzutreffende Sprichwörterbestand belegt diese „Normalkonstruktion“ sinnfällig: „Jede denkende Besinnung auf die letzten Elemente sinnvollen menschlichen Handelns“, sagt Max Weber bereits in seinem „Objektivitätsaufsatz“ aus dem Jahre 1904, „ist zunächst gebunden an die Kategorien „Zweck“ und „Mittel“. Wir wollen etwas in concreto entweder „um seines eigenen Wertes willen“ oder als Mittel im Dienste des in letzter Linie Gewollten.“ Und hätte die Menschheit im Laufe ihrer natürlichen wie sozialen Evolution nicht die Fähigkeit entwickelt, bei dem, was gewollt wird, rational zu unterscheiden, was bei gegebenem Stand der verfügbaren Mittel möglich ist, und was nicht, so hätte sie wohl kaum überlebt.55 Die beiden entscheidenden Punkte jedoch in diesem Zusammenhang sind die folgenden, welche explizit festzuhalten mir bereits an dieser Stelle wichtig zu sein scheint: Erstens präjudiziert diese Webersche Idealtypologie des sozialen Handelns nicht bereits als solche eine ganz bestimmte „Sozialisationshypothese“, welche vor allem die Wurzeln 55 In genau derselben Richtung bewegt sich ja auch die Freudsche Kulturdefinition, was ganz sicher kein Zufall ist, berücksichtigt man hierbei die allen Sozialwissenschaftlern des 19. und 20. Jahrhunderts gemeinsame Tradition der Kant’schen Vernunft- und Aufklärungsphilosophie: Wenn wir von „sozialem Handeln“, dem Handeln von „Kulturmenschen“ sprechen, d. h. von menschlichen Wesen, die „begabt mit der Fähigkeit und dem Willen [sind], bewusst zur Welt Stellung zu nehmen und ihr einen Sinn zu verleihen“ (Max Weber), gilt: „Die menschliche Kultur – ich meine all das, worin sich das menschliche Leben über seine animalischen Bedingungen erhoben hat und worin es sich vom Leben der Tiere unterscheidet – und ich verschmähe es, Kultur und Zivilisation zu trennen – zeigt uns bekanntlich zwei Seiten. Sie umfasst einerseits all das Wissen und Können, das die Menschen erworben haben, um die Kräfte der Natur zu beherrschen und ihr Güter zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse abzugewinnen, andererseits alle die Einrichtungen, die notwendig sind, um die Beziehungen der Menschen zueinander, und besonders die Verteilung der erreichbaren Güter zu regeln. Diese beiden Richtungen der Kultur sind nicht unabhängig voneinander ...“ Freud [Illusion], S. 139f 53 subjektiv sinnhaften (sozialen) Handelns zu beschreiben und zu erklären imstande wäre und zweitens ist Webers „zweckrational handelndes Individuum“ eine sozialwissenschaftliche Konstruktion, die es „real“ so nicht gibt, ja gar nicht geben kann. Nur und ausschließlich in dieser Weise und nur und ausschließlich aus diesem Grunde kommt ihr nämlich für die verhaltenstheoretische Zerlegung der „Identitätskrisen“ in maligne und benigne, die sich auf das Lernverhalten der betreffenden Individuen kapriziert, ein methodisch schlechterdings ausschlaggebender Erkenntniswert zu, worauf später noch genauer einzugehen sein wird. Die mittels der Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“ gegebene Möglichkeit – und, wie ich betonen möchte, nur mittels dieser –, so etwas wie ein rational sich verhaltendes „Normal-Ich“ konstruieren zu können, scheint mir sowohl im Hinblick auf eine (allgemeine) „Theorie und Praxis der Psychiatrie“, wie Redlich und Freedman sie seinerzeit entworfen haben, als auch im Hinblick auf die „Entwicklungspsychopathologie des Kindes- und Jugendalters“, wie Resch et al. sie in jüngerer Zeit erarbeitet haben, ungemein wichtig. Einer genuin soziologischen und zugleich dem Prinzip der Wissenschaftlichkeit verpflichteten „Allgemeine[n] Psychopathologie“ (Jaspers), die ganz bewusst Abstand zu halten versucht von einer metaphorisch durchseuchten „Phänomenologie der Intersubjektivität“ (Kisker), muss es ganz einfach darum gehen, die Begriffe „Identitätskrise“, „Devianz“ und „soziale Kontrolle“ in ihrem Bedeutungsgehalt so zu explizieren, dass sich dabei ein Erklärungsmodell ergibt, aus dem sich empirisch überprüfbare Hypothesen ableiten lassen, die sich auf die strukturellen Prinzipien humanspezifischer Sozialisationsprozesse beziehen. Denn ein solches Modell hat ja nicht nur eine Differenzierung abweichenden sozialen Verhaltens zu leisten. Es hat darüber hinaus ja auch die Funktion, Vorstellungen über mögliche Therapieziele zu entwickeln. Und in genau dieser Beziehung scheint mir die hypothetische Konstruktion eines „Normal-Ich“, wie sie Max Weber erarbeitet hat, unabdingbar, ist sie doch zugleich auch, wie ich meine die Voraussetzung dafür, dass sich das Identitätskonzept selbst idealtypologisch konstruieren lässt. Um die hinreichende Plausibilisierung genau dieses Grundgedankens geht es mit bei der hier vorgelegten Arbeit. Gelingt es nämlich, in diesem Sinne den Terminus „Identitätskrise“ so zu differenzieren, dass sich daraus differenzialdiagnostische Möglichkeiten ergeben, so fungiert dieses Konstrukt als Basalbegriff einer Ätiologie abnormen Verhaltens, die den bislang – nach der hier vertretenen Meinung – viel zu sehr vernachlässigten Aspekt streng soziologischen Denkens nachdrücklich hervorhebt und dies auch kann, weil die idealtypische Konstruktion des 54 Identitätsbegriffs selbst wiederum in einem streng begriffssoziologischen Sinne verankerbar ist in einem genuin soziologisch präformierten Sozialisationsmodell.56 Es ist mithin, wie bereits angedeutet, ein erklärtes Ziel dieser Untersuchung, aus genau diesem – dem genuin soziologischen – Blickwinkel, der das von Max Weber idealtypologisch erarbeitete Konstrukt des „sozialen Handelns“ ins Zentrum seiner Überlegungen stellt, die sozialisationstheoretische Dimension sozialen Handelns wie auch seiner Devianzvariationen sichtbar zu machen. Dies ist meiner Meinung nach bislang vor allem deshalb nicht geschehen, weil viel zu oft auf die sozialisationstheoretische Dimension sozialen Handelns aufmerksam gemacht worden ist, ohne dass man sich zum einen des Weberschen Idealtypus „soziales Handeln“, zum anderen der dabei involvierten Lerntheorien explizit zu versichern versucht hat.57 Denn es geht mir nicht nur um diese sozialisationstheoretische Dimension als solche, die zumeist in einer eklektizistisch wie synkretistisch zusammengestellten Mixtur von „soziologischen“ und „psychologischen“ Begrifflichkeiten thematisiert zu werden pflegt, sondern vielmehr darum, zu zeigen, dass dann und nur dann, wenn es gelingt, die sozialisationstheoretische Dimension sozialen Handelns im strengen Weberschen Sinne 56 Jedoch in einer ganz bestimmten Hinsicht nachdrücklich hervorhebt. Es wird sich nämlich, wie wir sehen werden, herausstellen, dass abnorme Formen der Devianz auf Identitätskrisen beruhen, die mit genuin pathologischen Formen des Lernens einhergehen. Auch aus diesem Grunde bedarf es einer Ätiologie, welche Identitätskrisen differenzialdiagnostisch zu behandeln gestattet. Der weiter oben angedeutete Vorzug einer konsequent soziologischen Verfeinerung der psychiatrischen Forschung und Praxis wird hierdurch nicht nur nicht beeinträchtigt. Wir werden vielmehr sehen, wie beide Aspekte sich widerspruchsfrei zusammenschließen lassen. 57 Denn selbstverständlich hängt die Fähigkeit eines Individuums zu rationalem Sozialhandeln mit seiner Fähigkeit zur (subjektiven) Identitätskonstruktion engstens zusammen, und Webers Idealtypologie des sozialen Handelns designiert ein Konstrukt, welches mit der weitestgehenden Absage an „irrationale Verhaltensmuster“ operiert: Das subjektiv sinnhafte objektbezogene Sichverhalten eines Individuums beruht auf der je individuell gegebenen Fähigkeit – und diese ist natürlich immer eine Resultante des bis dahin abgelaufenen Sozialisationsgeschehens – im Zweifelsfalle „seiner“ Identität integrativ und kohärent konstruieren zu können. Der im Weberschen Sinne „sozial Handelnde“ ist dasjenige „ich-starke“ Individuum, welches in optimaler Weise um Realitätsprüfung bemüht und dessen „Handeln“ darauf ausgerichtet ist, „die Realität“ zu bearbeiten, was gleichwohl nur dann funktioniert, wenn im Zweifelsfalle erfolgreich Identitätskonstruktion bewerkstelligt werden kann. „Ich-Schwäche“ ist von daher gerade nicht mit mangelnder „Willensstärke“ assoziiert, sondern vielmehr zum einen mit der Unfähigkeit zur Realitätsprüfung, zum anderen mit der Unfähigkeit zur subjektiven Identitätskonstruktion. Der „Wille“ nämlich ist dieser Konzeption zufolge wesentlich an die Vollausbildung der Kognitivstrukturen und damit naturgemäß an die Statthabe bestimmter Enkulturations- und Sozialisationsprozesse gebunden. „Triebstärke“ und (echte) „Willensstärke“ sind Gegenbegriffe. Und das Kernproblem der vorliegenden Arbeit besteht natürlich darin, die Identitätskonstruktion hierbei systematisch so zu „verorten“, dass damit die personalstabilisierenden Funktionen der je subjektiven Identitätskonstruktionsprinzipien deutlich werden können. Es ist immer wieder übersehen worden, dass der Begriff der „Ich-Stärke“, wenn man ihn in die Nomenklatur der Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“ einfügt, gleichbedeutend sein muss mit dem idealtypologisch konstruierten Begriff des rationalen Sozialhandelns. „Ich-Stärke“ beschreibt den gelungenen „Endpunkt“ eines erfolgreich verlaufenen Adaptionsprozesses an die sozialstrukturellen Erfordernisse einer bestimmten Sozialordnung. 55 sichtbar zu machen, um so einigermaßen triftig zwischen der Dynamik der kognitiven Umorientierungen und „bloßen“ Verhaltensmodifikationen unterscheiden zu können, auch eine Chance besteht, zwischen den Konstrukten „Identitätskrise“, „Devianz“ und „soziale Kontrolle“ einen Zusammenhang herzustellen, welcher streng institutionentheoretisch und damit eben konsequent rollenstrukturell gefasst werden kann. Genau diese nämlich benötigt eine jede Lerntheorie, welche sich an eine mögliche Beschreibung und Erklärung humanspezifischer Sozialisationsvorgänge heranwagt: Der Jargon des rollentheoretischen Beschreibungsarsenals bildet so das „Mittelstück“ zwischen den lerntheoretisch zu interpretierenden Sozialisationsverläufen der „Agenten“ des Sozialgeschehens, die sich auf eine je spezifische Art und Weise – „rational“ oder eben auch „irrational“ – verhalten, und der institutionellen Dynamik des Sozialgeschehens, welches sich notorisch strukturell wandelt, woraus sich trivialerweise die Doppelstruktur jedweder Theorie des Sozialisationsgeschehens ergibt: Um das real aufweisbare Verhalten menschlicher Individuen sowie die strukturelle Dynamik desselben beschreiben und erklären zu können, ist zum einen eine Theorie der institutionellen Dynamik der Gesellschaftsformation, in welche dieses Individuum hineingeboren ist und in welchem es lebt, erheischt, zum anderen bedarf es einer Lerntheorie, welche sich auf die „Werdestruktur“ des „Charakters“ eben dieses Individuums bezieht. Denn es ist genau dieser Punkt, der mir in den meisten hier einschlägigen Untersuchungen viel zu kurz gekommen zu sein scheint und dem ich mittels des genuin soziologischen „point of view“ Geltung zu schaffen versuche: Gesellschaften sind wesentlich institutionell geordnete dynamische Gebilde, die im Rahmen einer Idealtypologie rationalen sozialen Handelns als komplexe, arbeitsteilig organisierte Rollensysteme beschreibbar sind, ohne dass man dabei in direkter Weise auf die Verhaltensdynamik der sozialen Agenten bezugzunehmen braucht, ja es nicht einmal darf. Sie differenzieren sich sozial in einem notorisch stattfindenden Prozess, den Popitz sehr einleuchtend als „Normenfächerung“ charakterisiert hat, und bilden gemäß diesen sozialen Differenzierungen Systeme der sozialen Kontrolle aus, deren Funktion es ist, auf ein stets sich neu bildendes Universum von Formen der – rationalen wie irrationalen – Devianz um einer Austarierung „neuer“ Gleichgewichtslagen willen konfliktregulativ zu reagieren.58 Und eines dieser Systeme der sozialen Kontrolle ist eben die Pädo-Psychiatrie, 58 Wie bereits Durkheim zu Recht explizit hervorgehoben hat, tritt Devianz nicht nur notorisch auf, ihr Auftreten gehört vielmehr konstitutiv der Regulierungsfunktion der sozialen Institutionen zu: Gäbe es kein „Verbrechen“, so gäbe es keinen sozialen Wandel. Überschärft formuliert: Die institutionelle Dynamik einer historisch realisierten Gesellschaftsformation erzeugt von sich aus permanent zum einen genuin delinquente, zum anderen psychopathologisch auffällige Formen der Devianz, was zugestandenermaßen aus der Perspektive des jeweiligen sozialen Umfeldes sehr oft „zusammengeblendet“ zu werden pflegt. Zur genaueren 56 die sich unter ganz bestimmten, „allgemeingesellschaftlichen“ und mit einem ganz bestimmten – gleichfalls „allgemeingesellschaftlichen“ – Auftrag mit genau denjenigen Formen der Devianz befasst, die wegen ihrer „Irrationalität“ als psycho-pathologisch auffällig angesehen zu werden pflegen.59 Denn bezeichnenderweise sind das genau diejenigen Formen der Devianz, mit denen die justiziären Systeme der sozialen Kontrolle nichts anfangen können, weil ihre Funktionäre sie eben gerade nicht „verstehen“ können60: Dass und in Unterscheidung zwischen den „rationalen“ und den „irrationalen“ Formen der Konformität wie der Devianz vgl. die weiter unten gegebenen Tafelbilder (II. 7. 1., II. 7. 2.) 59 Auf die vorzügliche und nach wie vor nicht übertroffene Analyse des „Begriffs der sozialen Rolle“ durch Popitz verweise ich an dieser Stelle ausdrücklich, denn auf diese beziehe ich mich bei meinen Ausführungen wesentlich. Folgt man ihr, so ergibt sich das folgende Bild: Im strengen Weberschen Sinne lassen sich die Institutionen einer Gesellschaft durchwegs als Systeme der sozialen Kontrolle deuten, jedoch geraten diese keineswegs nur „reaktiv“ in Bewegung. Ihnen eignet erstens eine ziemliche Eigendynamik, wie insbesondere Fritz Sack [Kriminalsoziologie] zu Recht betont hat, und außerdem eignen ihnen, da die meisten von ihnen ja auch eine Sozialisationsfunktion haben, wesentlich immer zugleich auch pädagogische Funktionen. Aus diesem Blickwinkel böte es sich an, die „Familie“ als die primäre, Kindergärten, Schulen hingegen – und eben auch Strafanstalten wie „Landeskrankenanstalten“ – als sekundäre bzw. als wesentlich „reaktive“ Sozialisationsagenturen und somit als pädagogisch wirkende Systeme der sozialen Kontrolle zu interpretieren. Ich komme noch des öfteren, vor allem, wo es wesentlich um die – in der Regel evaluativ gefassten – institutionell definierten Tatbestände unserer Gesellschaftsformation und die diesen jeweils zugeordneten Verhaltensmuster gehen wird, hierauf zurück. Derjenigen Institution, die wir als „Familie“ auffassen werden, kommt allerdings insofern eine Sonderstellung zu, als sie ja sozusagen die „Bedingungen der Möglichkeit“ aller anderen Sozialisations- und Enkulturationsprozesse „setzt“. Hier nämlich, im familialen Rollenfeld, wird die Methode des Lernens, mithin also auch und gerade die Methode der Identitätskonstruktion als solche erworben. Zu einer konsequent handlungssoziologischen Deutung sog. „pädagogischer Grundsituation“ vgl. die Doktorarbeit meiner Kollegin Dietlinde Michael [Ästhetische Sensibilisierung], wo explizit gezeigt wird, was pädagogisch angerichtet wird, wenn adoleszentes bzw. juvenales schulisches Lernen nicht nach Maßgabe der Rationalitätskriterien der Weberschen Handlungskonzeption organisiert wird: Adoleszentes Lernen ist wesentlich aktives Handeln im Weberschen Sinne. Vgl. hierzu bereits das von Frau Michael erstellte Arbeitspapier, welches die Vorlage für einen Vortrag im Doktorandenkolleg Karlsruhe (Lehrstuhl Schweitzer) bildete: „Die Funktion des Gadamerschen »Gesprächs« für den pädagogischen Prozess“, wo dankenswerterweise explizit auf den von mir eingeführten Begriff der „Identitätsmetamorphose“ bezuggenommen wird. Die Idealtypologie des Gadamerschen „Gesprächs“ erzeugt – oder besser noch: bewirkt – nämlich „Identitätsmetamorphosen“, die wesentlich auf benignen Identitätskrisen beruhen. Auch hierbei lässt sich eine in komparativer Sprache abgefasste Hypothese ableiten. Auf die Rolle, Funktion und Aufgabenstellung insbesondere der Pädo-Psychiatrie müsste eigentlich sehr viel eingehender, als es hier geschehen kann, eingegangen werden: Wie alle unsere Institutionen, die sich mit den Adoleszenzformen des sozialen Handelns befassen, ist auch und gerade die Pädo-Psychiatrie ein System der sozialen Kontrolle, dem wesentlich Sozialisations- und Enkulturationsfunktionen obliegen. Da sie in laufende Formen des sozialen Lernens aktiv einzugreifen befugt und genötigt ist, eignet der Pädo-Psychiatrie nicht nur ganz allgemein – wie z. B. unseren schulischen Institutionen – die Aufgabe einer Sozialisationsagentur par exellence, sie übernimmt vielmehr ganz automatisch familial-komplementäre pädagogische Funktionen und repräsentiert folgerichtig eine familial-analoge pädagogische Struktur. 60 Dass jemand aus Eifersucht mordet, kann jeder halbwegs normal denkende Jurist, dem, wie man so schön sagt, „nichts Menschliches fremd ist“, problemlos nachvollziehen, mithin also auch „verstehen“. Wirkliche Schwierigkeiten dürfte er allerdings mit jemandem haben, dem ein Fachpsychologe Eifersuchtswahn bescheinigt. An dieser Stelle kommt es mir lediglich darauf an, dem (möglichen) Missverständnis vorzubeugen, „Irrationalität“ sei so etwas wie ein „automatischer“ Gegenbegriff zum Rationalitätskonstrukt. Vgl. hierzu die minutiöse Vorgehensweise bei den „Rationalitätskatalogen“ in Abschnitt II. 8. 2. 57 welchem Umfang sie überhaupt auftreten, bedarf natürlich der soziologischen Erklärung, zu beschreiben und zu erklären jedoch, wie sie auftreten, fällt in den Kompetenzbereich der „Psychologie“, und eine den genuin „soziologischen“ mit dem genuin „psychologischen“ Ansatz vereinigenden Ansatz bietet eben eine Sozialisationstheorie, um die es uns hier geht. Ich halte auch diesen Punkt bereits an dieser Stelle explizit in thetischer Form fest: Die zumeist als Systeme der sozialen Kontrolle fungierenden sozialen Institutionen wandeln sich nach Maßgabe von bislang noch weitgehend undurchschauten Selbstgesetzlichkeiten, deren Mechanik, wie Porath vermutet, tiefenstrukturell organisiert ist61, und dieser „Strukturwandel“ arbeitsteilig organisierter Rollensysteme kovariiert mit dem je spezifischen Verhalten der Agenten des gesellschaftlichen Geschehens – den Individuen –, welche sich diesem Wandlungsprozess adaptieren müssen, wenn sie psychisch oder auch somatisch einigermaßen normal überleben wollen. Und es ist die zentrale These der vorliegenden Untersuchung, dass sich diese Kovariation – „porathianisch“ ausgedrückt – dann und nur dann in einer wissenschaftsanalytisch korrekten Weise als ein interdependenzfunktionaler Zusammenhang beschreiben und erklären lässt, wenn man dabei explizit auf die in der Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“ erarbeitete Idealtypologie rekurriert, was bedeutet: Sowohl den Lerntheorien, mittels derer die Verhaltensdynamik der Sozialisationsund Enkulturationsverläufe der sozialen Agenten beschrieben und erklärt werden soll, als auch denjenigen Theorien, mittels derer der strukturelle Wandel der das Gesellschaftsgeschehen tragenden Systeme der sozialen Kontrolle beschrieben und erklärt werden kann, ist das von Max Weber erarbeitete idealtypische Konstrukt des „sozialen Handelns“, mithin also eine ganz bestimmte Sozialanthropologie, die, wie ich glaube, letzten Endes auf Kant zurückgeht, als Selbstverständlichkeit implantiert. Dies zu sehen ist, wie gesagt nötig, denn nur dann, wenn ein solcher Zusammenhang streng idealtypologisch konstruierbar ist, lässt sich auch ein Erklärungsmodell ableiten, welches eine Differenzierung devianten sozialen Handelns ermöglicht. 61 Ich erwähne diesen (prekären) Punkt nicht nur deshalb, weil ich mich einer intellektuellen Dankesschuld verpflichtet fühle. Vielmehr bin ich keineswegs der Porath’schen Überzeugung, man könne – und müsse – die „Tiefengrammatik“ der modernen kapitalistischen Produktionsweise mittels derselben methodischen Prinzipen erforschen, wie es die modernen Naturwissenschaften „vorgemacht“ haben. Ich stütze mich (vorläufig?) jedenfalls mehr auf Max Weber als auf Karl Marx. Porath ist nämlich der Überzeugung, dass der Schritt zur Marxschen Kapitaltheorie der über Max Weber hinausgehende weitere Wissenschaftsschritt sein muss. Zur – wie Porath meint: grundsätzlichen – Divergenz von „Sozialwissenschaft und Kulturwissenschaft“ vgl. die hierzu einschlägigen Passagen des [Forschungsantrages]. Zum Problem der Übereinstimmungen und Divergenzen in den methodischen bzw. methodologischen Basalüberzeugungen in unserer Forschungsgruppe vgl. jetzt das von Porath und mir gemeinsam verfasste Arbeitspapier [Identitätskrisen in der Entwicklungspsychopathologie], welches wir in den nächsten Monaten zur Publikation in der Reihe „Schriften der Gesellschaft für Wissenschaft als Beruf“ vorbereiten werden. 58 In thetischer Weise halten wir an dieser Stelle zunächst einmal fest, was wir hierzu bislang haben zusammenstellen können: 1. Wird die Allgemeine Psychiatrie und insbesondere die Pädopsychiatrie als Entwicklungspsychopathologie aufgefasst, der es darauf ankommt, psychopathologische Verhaltensmuster ätiologisch in einer (allgemeinen) Theorie der Identitätskrisen zu verorten, dann muss eine solche Theorie symptomatologisch scharf zu unterscheiden gestatten zwischen benignen und malignen Identitätskrisen, und dies ist nur möglich, wenn eine streng allgemein konzipierte empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie verfügbar ist, welche die Grundlage bildet für eine solche „Entwicklungspsychopathologie“, so dass logisch (trivialerweise) folgt: 2. Dann und nur dann, wenn es gelingt eine empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie auszuarbeiten, in deren Kontext sich das idealtypische Konstrukt der „Identität“ erarbeiten lässt, lässt sich auch eine Ätiologie psychopathologisch auffälliger Verhaltensmuster ausarbeiten, welche eine entsprechende Anamnese sowie eine entsprechende Diagnostik und Prognostik derselben ermöglicht. 3. Eine solche Theorie des Sozialisationsgeschehens ist eine Lerntheorie, so dass gilt: Der Begriff der „Identitätskrise“, der sich auf bestimmte mentale Zustände eines menschlichen Organismus bezieht, gehört dem (theoretischen) begrifflichen Arsenal einer Lerntheorie62 und damit wesentlich dem Grundvokabular der Verhaltenswissenschaften zu, was bedeutet: Nur organismische Entitäten können lernen und nur diejenigen Organismen, welche im streng biologischen Sinne Menschen sind, machen, da sie der einzigen Spezies angehören, deren Angehörige sich zweckrational und situationsadäquat verhalten können, Identitätskrisen durch, die auf jener Klasse von Lernvorgängen beruhen, welche „kognitive Umorientierungen“ genannt zu werden pflegen, woraus sich ergibt: Der Begriff der „Identitätskrise“ ist wesentlich „eingenetzt“ in ein System von Hypothesen, die sich mit denjenigen Verhaltensmodifikationen von menschlichen Individuen befassen, die wesentlich die 62 Es ist, wie wir später immer deutlicher sehen werden, sehr wichtig, sich permanent vor Augen zu halten, dass die Grundbegrifflichkeit, mit der wir in den Humanwissenschaften arbeiten, Theoriecharakter hat und nur indirekt mit „Beobachtbarem“ verknüpft ist. Wäre dem nicht so, so bräuchten wir uns ja auch nicht um entsprechende idealtypologische Konstruktionen bemühen. Es gilt hierbei, wie Porath es formuliert hat, die behavioralheuristische Grundregel, welche besagt, dass das Verhalten sowie die Verhaltensänderungen von Individuen zwar beobachtbar sind, dass jedoch deren Deutung sich immer im Bezugsrahmen von Theorien vollzieht. Wie sich zeigen lässt, geht diese Aussage viel weiter als die allgemein akzeptierte Erkenntnis, „Wahrnehmung“ und „Beobachtung“ seien wesentlich theorienimprägniert. 59 kognitiven Dimensionen von Sozialisationsprozessen betreffen: Verhalten ist beobachtbar, wohingegen das „Lernen“ nur und ausschließlich als Verhaltensmodifikation – auf der Grundlage von Informationszufuhr –, nicht jedoch als kognitive Umorientierung beobachtbar ist. Macht jedoch deshalb auch jedes menschliche Wesen im Verlaufe seiner Sozialisation Identitätskrisen durch und nehmen selbige nicht vielleicht lediglich in „unserer“ Kultur so dramatische Formen an? Sozialisation als beobachtbares – oder zumindest „im Prinzip“ beobachtbares – Rollenerwerbsverhalten ist Verhaltensmodifikation menschlicher Individuen, die auf prinzipiell der Beobachtung nicht zugänglichen Internalisierungsprozessen bestimmter objektiver Sinngebilde beruht. 4. Da wir mittels lerntheoretischer Begriffe und Hypothesen die im Lebensverlauf von humanen Organismen auftretenden Verhaltensmodifikation(en) beschreiben und erklären, repräsentieren „Identitätskrisen“ ganz bestimmte „Knotenpunkte“ bzw. „Haltestationen“ im Lebensverlauf eines menschlichen Wesens, die mittels bestimmter „Daten“ aus dem jeweils stattgehabten Sozialisationsverlauf erschlossen werden müssen. Identitätskrisen als solche „Lebenshaltestationen“ – das sind sozusagen „Anhaltestationen“ im Leben eines Menschen, in denen sich mehr oder weniger bewusst die Identitätsfrage stellt63 – designieren, insofern sie sich „symptomatisch“, z.B. als „Fehlleistungen“ irgendwie bemerkbar machen, in der Regel Identitätsmetamorphosen, weisen sie doch immer zugleich auf (mögliche) „Umbauten“ in der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen hin.64 Wie auch immer. Identitätskrisen – mögen sie sich nun symptomatisch bemerkbar machen oder nicht – sind jedenfalls konstitutive Momente des genuin kognitivsystemisch statthabenden 63 Die Floskel „mehr oder weniger bewusst“ ist absolut ernst zu nehmen. Genauso wenig, wie irgend Jemand bewusst in eine Identitätskrise geraten will wie nicht will, genauso wenig erlebt dieser Jemand bewusst eine Identitätskrise. Vielmehr macht sich eine solche an Symptomen geltend, die sodann – mehr oder weniger „bewusst“ – interpretiert werden, und erst dieser Interpretationsvorgang enthält in der Regel „Bewusstseinsanteile“. 64 Der Begriff der „Identitätsmetamorphose“ ist mir, obwohl ich ihn bislang noch nicht in wünschenswerter Klarheit explizieren kann, dennoch aus verschiedenen Gründen sehr wichtig, wie wir weiter unten sehen werden. Fasst man gemäß der klassischen strukturell-funktionalen Nomenklatur das (menschliche) „Einzelindividuum“ als personales System auf, wie es in gewisser Weise ja auch Redlich und Freedman tun (vgl. hierzu den Abschnitt II. 5. 6.), dann designiert das idealtypische Konstrukt der Identitätsmetamorphose nämlich denjengen Aspekt des Gestaltwandels einer „Persönlichkeit“, der sich wesentlich auf die kognitive Dimension derselben bezieht, ohne dass das betreffende Individuum diesen Gestaltwandel seiner selbst überhaupt zu bemerken braucht. In Abschnitt II. 5. 4. wird dieses prima facie ja etwas paradox anmutende Ergebnis meiner Überlegungen hierzu, welches sich letztendlich, wie ich annehme, nur psychoanalytisch präzise beschreiben lässt, noch etwas genauer zu erläutern sein. 60 Sozialisationsprozesses, die immer dann mehr oder weniger dramatische Formen annehmen, wenn ausgesprochen komplexe Lernzumutungen anstehen, welche vor allem ein mittlerweile drastisch gewandeltes Rollenfeld eines Menschen betreffen. Ob und inwiefern sie gar in identitätskritische Dauerzustände mit entsprechend gravierenden psychopathologischen Verhaltensmustern übergehen und so eventuell sogar bestimmten personalen Zerrüttungserscheinungen den Weg bereiten, hängt letztendlich ab von jenen einst dominierend gewesenen sozialstrukturellen Bedingungskonstellationen, in deren Rahmen sich ursprünglich die methodischen Prinzipien der je individuellen Identitätskonstruktionskompetenzen ausgebildet haben. Denn es ist, wie bereits gesagt, die Art und Weise, wie sich eine bestimmte Identitätskonstruktionsmethode in der Primordialphase des Sozialisationsprozesses „eingeschliffen hat“, von welcher abhängig ist, ob jemand mit einer gravierenden Identitätskrise zurechtkommt oder nicht: Identität wird konstruiert, wofür es ganz bestimmter Kompetenzen bedarf, und die dabei jeweils angewandte „Methode“ variiert nach Maßgabe der je individuell „erfahrenen“ sozialstrukturellen („familialen“) Bedingungen in derjenigen Übergangsperiode von den postnatal dominierenden Verhaltensmodifikationen zu den ersten Ansätzen subjektiv sinnhaften sozialen Handelns, in der sich das Lernverhalten grundlegend ändert, woraus sich nunmehr eine erste im Prinzip empirisch validierbare sozialisationstheoretische Hypothese ergibt: Vor der Transformation der noch wesentlich „organismisch“ gesteuerten Verhaltensmodifikationen eines menschlichen Wesens in subjektiv sinnhaftes (soziales) Handeln, kann es keine Identitätskrisen oder irgendwelche identitätskritischen Zustände geben, denn diese sind wesentliche Momente derjenigen humanspezifischen Formen des jeweiligen „Lernens“, die kognitive Umorientierungen genannt zu werden pflegen. Aus diesem Blickwinkel wird sodann auch das ausgesprochen turbulente Geschehen in der Pubertätsphase fast jedes Adoleszenten verständlich: Leibreizmannigfaltigkeiten und (soziale) Umweltkomplexität überschneiden sich in einem Ausmaß und Umfang, dass sich – „systemisch“ gesprochen – die für rationales Handeln unabdingbare Komplexitätsreduktion, die ja die Voraussetzung für ein einigermaßen gut funktionierendes „Identitätskrisenmanagement“ ist, exorbitant schwierig gestaltet, so dass dadurch schon beinahe „naturnotwendig“ hebephrene bzw. hebephrenoide Verhaltensmuster mit notorisch auftretender Rollendiffusivität erzeugt werden: Zwischen den bis dahin erworbenen Identitätskonstruktionskapazitäten eines „personalen Systems“ und dem 61 (internen wie externen) Katalog von Bewältigungsnotwendigkeiten nach Maßgabe des Realitätsprinzips, die integrativ „bedient“ werden müssen, besteht eine zunächst auf Dauer gestellt zu sein scheinende Diskrepanz und gibt entsprechende Impulse für die bis dahin eingeübten Formenmannigfaltigkeiten der Realitätsfugativität. Entsprechend hoch ist in einer solchen Phase sodann natürlich auch die Affektaufgeladenheit der „normalen“ Verhaltensdynamik.65 5. Es ist eine Weiterentwicklung der bereits in der Einleitung genannten (methodologischen) Grundthese der hier vorgelegten Arbeit, dass sich völlig unabhängig davon, was für eine Lerntheorie zur Erkenntnisbasis einer psychiatrierelevanten Sozialisationstheorie gemacht wird, diese methodisch auf jeden Fall von jenem genuin soziologischen „point of view“ her konstruiert werden muss, welche die Webersche Idealtypologie der sog. „Verstehenden Soziologie“ zu bieten vermag. Diese zerlegt sich in eine „Makro-Soziologie“, welche die institutionelle Dynamik der Formen des menschlichen Gemeinschaftslebens zu beschreiben und zu erklären versucht, und in eine „Mikro-Soziologie“, welche die „Elementarformen des sozialen Verhaltens“ zu beschreiben und zu erklären versucht. 6. Diese Webersche „Verstehenslehre“ ist wesentlich eine Kulturwissenschaft. Dies bedeutet, dass sie in ihrer „Grundbegrifflichkeit“ nicht nur die Konstrukte „Institutionen“, „Organisationen“, „Herrschaftsverbände“ sowie die Begriffe „soziale Differenzierung“, „Norm“, „soziale Kontrolle“, „Rolle“ etc., sondern auch – und dies vor allen Dingen – den Begriff des „Wertes“ zu ihrem kategorialen Arsenal zählt: Kulturwertanalyse, die auf solche (Evaluativ-) Konstrukte wie „Mündigkeit“, „Selbstverantwortlichkeit“, „Bildung“, „(geistige wie körperliche) Gesundheit“, „Wahrheitsstreben“, „Rationalität“ etc. ihre Aufmerksamkeit richtet, ist konstitutiver methodischer Bestandteil ihres von Grunde auf hermeneutischen Ansatzes. In vorbildlicher Weise hat vor allem der Weberianer Rainer M. Lepsius diese genuin kulturwissenschaftliche Heuristik auf den Begriff gebracht, weswegen ich sie nachstehend zitiere: 65 Aus diesem Blickwinkel hochinteressant sind sodann natürlich vor allem diejenigen Identitätsmetamorphosen, die sich in solchen Diskursmilieus „abspielen“, welche dem Gadamerschen Gesprächstyp sehr nahekommen: Soziale Positionierung der Diskurskontrahenten ist hierbei relativ festgeschrieben und folglich ist auch das jeweilige auf „Dialektik“ eingestimmte bzw. ausgerichtete Rollenverhalten als solches relativ starr „konditioniert“. Entsprechend groß ist hierbei die auf die jeweilige „Sache“ bezogene Vigilanzabsorption, die dazu zwingt, dem mitlaufenden Affektgeschehen so wenig Aufmerksamkeit, wie nur möglich, zu schenken. Gesprächsdominierte Interaktionsstrukturen sind aus diesem Grunde toto coelo verschieden von den entspannenden „Gesellschaftsspielen“. 62 7. Die das soziale Handeln menschlicher Individuen unmittelbar beherrschenden „Interessen, sind ideenbezogen, sie bedürfen eines Wertbezuges für die Formulierung ihrer Ziele und für die Rechtfertigung der Mittel, mit denen diese Ziele verfolgt werden. Ideen sind interessenbezogen, sie konkretisieren sich an Interessenlagen und erhalten durch diese Deutungsmacht. Institutionen formen Interessen und bieten Verfahrensweisen für ihre Durchsetzung, Institutionen geben Ideen Geltung in bestimmten Handlungskontexten. Der Kampf der Interessen, der Streit über Ideen, der Konflikt zwischen Institutionen lassen stets neue soziale Konstellationen entstehen, die die historische Entwicklung offen halten. Aus Interessen, Ideen und Institutionen entstehen soziale Ordnungen, die die Lebensverhältnisse, die Personalität und die Wertorientierung der Menschen bestimmen“.66 Festzuhalten: Soziale Ordnungen bestimmen die (Formen der) Personalität, weil sie die „Lebensverhältnisse“ sowie die Wertorientierung(en) der Menschen bestimmen, was heißt: Die sozialstrukturellen Bedingungen, welche die – z. B. familialen – Lebensverhältnisse eines Menschen „bestimmen“, bestimmen eben auch dessen „Wertorientierung(en)“. Daraus aber ergibt sich trivialerweise: 8. Die sozialstrukturellen Milieubedingungen von „Gesellschaften“, mithin auch deren Wandlungen, wirken sich in einer wie auch immer genau zu bestimmenden Art und Weise auf die strukturelle Dynamik der Verhaltensmodifikationen von (humanen) Organismen aus, verursachen mithin auch bestimmte Verhaltensmodifikationen strukturell. Dass sie dabei in der Regel „subjektiv umgerechnet“ zu werden pflegen, berührt nicht den Tatbestand, dass sie ja „irgendwie“ zunächst einmal – als soziale Ordnungen – objektiv vorhanden (gewesen) sein müssen, um überhaupt „subjektiv umgerechnet“ werden zu können. Streng lerntheoretisch repräsentieren also die Rollensysteme der Sozialisationsagenturen, welche die Verhaltensdynamik ihrer Sozialisanden „bestimmen“ – was immer das auch heißen mag – Stimuli bzw. Stimuluskonfigurationen, die in der Regel, da sie ja auf eine jeweils ganz bestimmte Art und Weise „irgendwie“ wahrgenommen werden müssen, Cue-Charakter haben, denn sonst würden sie ja wohl kaum bestimmte Verhaltensmodifikationen „bewirken“. Erfassen tun wir diesen „Einfluss“ freilich nur dann, wenn zuvor in relativer Reinform die Lerngesetzmäßigkeiten ausgearbeitet worden sind. Der hier angesprochene Aspekt fällt unter den Oberbegriff bzw. in den Bereich der sozialen Kognition. 66 Lepsius, M. R. [Vorwort] zu ders. [Institutionen], S. 7 63 9. Während die strukturelle Dynamik der Verhaltensmodifikationen menschlicher Individuen mittels bestimmter lerntheoretischer Hypothesen zu beschreiben und zu erklären ist, ist die Metamorphose sozialer Institutionen, auch und gerade dann, wenn diese als Sozialisationsagenturen fungieren, nicht mittels lerntheoretischer Hypothesen beschreibbar und erklärbar: Institutionen lernen nicht, weil Institutionen sich nicht verhalten (können), folglich auch keine Verhaltensmodifikationen aufweisen (können). Aber das ist auch sowieso klar: Institutionen sind die sozialen Bedingungen der Möglichkeit für Sozialisationsprozesse, können aber natürlich nicht selbst „sozialisiert“ werden. Doch wir müssen hier sogar noch einen Schritt weiter gehen: Institutionen verhalten sich nicht und sie handeln auch nicht, eine Aussage, die natürlich auch für soziale Gruppen gilt, woraus folgt, dass es streng genommen auch nur eine metaphorische Bedeutung für die Ausdrücke „Gruppenerwartungen“, „gesellschaftliche Erwartungen“ etc. geben kann, was, wie wir sehen werden, wichtig für die systematische Verwendung des Rollenbegriffs sein wird. Wird beispielsweise eine Institution als Erwartungskomplex „definiert“, so kann eine solche Definition nur metaphorischen Charakter haben. Damit aber ist zehntens klar: 10. Die Menge derjenigen Theorien, mittels derer wir soziale Tatbestände zu beschreiben und zu erklären versuchen, zerlegt sich erschöpfend in mindestens zwei Teiltheorien (ob und wie diese wiederum sich weiter zerlegen lassen, mag hier zunächst einmal völlig offen bleiben): In Lerntheorien, die sich auf die Verhaltensmodifikationen von (humanen) Individuen beziehen, und in Institutionentheorien, die sich auf soziale Systeme beziehen, deren Struktur (und Dynamik) wesentlich rollenbegrifflich beschreibbar bzw. erklärbar ist. Und damit ist, unter der Voraussetzung, dass ja auch menschliche Wesen – und letztendlich eben nur diese – bestimmte „Rollen spielen“, elftens klar: 11. Das rollenbegriffliche Arsenal fungiert, da rollenadäquates und rollendiskrepantes Verhalten beobachtbar ist, als „Brückenvokabular“ zum einen bei der Beschreibung und Erklärung von sozialen Institutionen und deren Dynamik, zum anderen bei der Beschreibung von individuellen Verhaltensweisen und deren Modifikationen. Allerdings muss dafür sowohl die Webersche „Begriffslehre des sozialen Handelns“ als auch die entsprechende lerntheoretische Idealtypologie rollenbegrifflich „angereichert“ werden, denn wie wir sehen werden, designiert das rollentheoretische begriffliche Arsenal ganz bestimmte Verhaltensmuster: Diebstahl z. B. ist zugleich ein ganz bestimmter institutioneller bzw. institutionell definierter sozialer Tatbestand und 64 ein Verhaltensmuster. Und dasselbe gilt für den „Dieb“ bzw. für die Verhaltensweise des „Stehlens“: Ein Individuum kann das „Stehlen“ lernen, identifiziert sich also, indem es die sozial „vorgestanzte“ Position des Diebes einnimmt, – zumindest zeitweise – mit der Rolle des Diebes, wofür in unserer Gesellschaft mittels ganz bestimmter hypothetisch gefasster Normen ganz bestimmte Sanktionen angedroht werden. Der entscheidende Punkt jedoch hierbei ist der folgende: Damit sich ein Individuum überhaupt mit einer bestimmten sozialstrukturell „vorausgestanzten“ Position identifizieren kann, muss es erstens zuvor ein Individuum geworden sein, was im Rahmen derjenigen Institution geschieht, die wir „Familie“ nennen (werden) und es müssen zweitens natürlich solche „sozialstrukturell vorausgestanzte“ Positionen mit ganz bestimmten, diesen jeweils bereits objektiv zugeordneten Rollen vorhanden sein, mit denen sich ein solches Individuum überhaupt identifizieren kann. Es ergibt sich mithin ein zwölfter Punkt, den die vorliegende Arbeit allerdings nicht behandeln kann und den wir deshalb auch als Frage formulieren wollen: 12. Wie kommt sozialstruktureller Wandel zustande? 13. Das zuletzt angesprochene Problem ist ein Grundlagenproblem der gesamten sozialund kulturwissenschaftlichen Forschung, welches sich vom genuin soziologischen Standpunkt bemerkbar macht als Frage nach dem Verhältnis zwischen Makrosoziologie und Mikrosoziologie. 14. Das jedoch sind streng genommen eigentlich bereits inhaltliche Probleme. Wir sollten uns jedoch, bevor wir auf solcherart Probleme zu sprechen kommen, der eingangs gestellten Frage zuwenden, was denn wohl überhaupt eine empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie ist bzw. sein könnte, von der wir in erster Linie ja erwarten, dass sie uns etwas erklärt. Damit betreten wir das Gebiet der Methodik bzw. der Methodologie, welches im übernächsten Abschnitt zu behandeln sein wird. Wie erinnerlich, wurde anlässlich der Skizzierung des „Forschungsstandes“ in der Einleitung an der Psychiatrie bzw. der Pädo-Psychiatrie ganz allgemein kritisiert, dass selbst beste Lehrbücher praktisch überhaupt nicht – zumindest nicht in systematischer Form – auf die Ergebnisse von Kleingruppenforschung und Sozialpsychologie bezugnehmen. Im nächsten Abschnitt wird deshalb dieser Punkt zur Sprache kommen. Dabei wird auf das faszinierende „Paradigma“ des sog. „symbolischen Interaktionsimus“ einzugehen sein. Zugleich soll damit zumindest angedeutet werden, inwiefern es vor allem wegen des Begriffs der „Kommunikativen Kompetenz“ (Habermas) für eine grundbegriffliche Ergänzung der 65 Weberschen „Sozialanthropologie“ des Blicks insbesondere auf die Strykersche Präsentation des „symbolischen Interaktionismus“ bedarf. Dies ist erforderlich, ansonsten nämlich würden die in den Abschnitten II. 7. 3. und II. 7. 4. zur Sprache kommenden sozialisationstheoretischen Konsequenzen der Weberschen „Rationalitätsargumentation“ gewissermaßen „in der Luft hängen“ bleiben. 2. Die sozialanthropologische Grundlage der Humanwissenschaften: Verstehende Soziologie und symbolischer Interaktionismus In sehr vielen Arbeiten zur Methodologie der systematischen Gesellschaftswissenschaften wird im vorangegangenen Abschnitt aus methodischen Gründen notwendige Unterscheidung zwischen einer „Soziologie“, die sich mit dem sozialen Handeln um des Aufbaus einer allgemeinen Theorie der gesellschaftlichen Institutionen (Theorie von Rollensystemen) willen bemüht, und einer „Psychologie“, die sich mit den elementaren Voraussetzungen, Bedingungen und Strukturen des individuellen Verhaltens befasst zu wenig beachtet, und deshalb der Fehler gemacht, die „Sozialpsychologie“ als eine Wissenschaft anzusehen, die lediglich eine „Mixtur“ von Soziologie und Psychologie darstelle. Gewiss ist das Feld der Sozialpsychologie die Kleingruppenforschung, die, wie ja auch bei Redlich und Freedman nachzulesen, das eigentliche Bezugsfeld für die Erforschung der Mentalerkrankungen ist. Vor allem die experimentelle Kleingruppenforschung, wie sie in der Mannheimer Schule in Deutschland sich etabliert hat, hat in diesem Sinne ganz erstaunliche theoriekonstruierende Arbeit geleistet.67 Jedoch sollte nicht vergessen werden, dass sie auf ein reichhaltiges Forschungsfeld hat zurückgreifen können, welches in den 30er, 40er und 50er Jahren in den USA erfolgreich „beackert“ worden ist.68 67 Vgl. vor allem die Arbeit die Arbeiten von M. Irle und seiner Schule, wie sie in den [Lehrbücher]n zur Sozialpsychologie vorliegen. 68 Wie die beiden schon zu „Klassikern“ gewordenen Aufsätze von Carl F. Graumann [Sozialpsychologie] bzw. [Kommunikation] belegen, ist die Sozialpsychologie dasjenige Forschungsgebiet, auf dem sich Soziologie und Psychologie wohl am intensivsten berühren, wenn nicht gar sich überschneiden. Sie ist als „experimentelle Kleingruppenforschung“ sozusagen das paradigmatische Belegfeld für die Ausarbeitung einer allgemeinen Sozialisationstheorie, in deren Zentrum das Identitätsproblem steht. 66 Eine Variante, auf die es mir an dieser Stelle vor allen Dingen ankommt, ist die sog. „Chicago-Schule“, die unter dem Sammelbegriff „symbolischer Interaktionismus“ bekannt geworden ist. Der Einfachheit halber beziehe ich mich auf die Arbeit von Sheldon Stryker, der den Versuch unternommen hat, die Grundannahmen des „symbolischen Interaktionismus“ in einigen strengen Lehrsätzen zusammenzufassen. Wie Stryker deutlich gemacht hat – und ausschließlich in dieser Hinsicht ist er an dieser Stelle für mich interessant – ist der symbolische Interaktionismus nicht lediglich ein anderer theoretischer Erklärungsansatz sozialisationstheoretische der Neuorientierung Modelle, für er entwicklungspsychologische stellt vielmehr Gesellschaftswissenschaften ein als oder sozialpsychologische durchaus eigenständiges humanwissenschaftliches Paradigma dar, welches, wie ich meine, die Webersche „Begriffslehre des sozialen Handelns“ vorzüglich ergänzt. In der vorliegenden Arbeit geht es darum, genau dieses „Paradigma“ mit der Weberschen Handlungssoziologie zusammenzuschließen, dass sich daraus eine empirisch gehaltvolle Sozialisationstheorie „ableiten“ lässt. Dafür wird es nötig sein, die Strykerschen „Grundannahmen“ genauso idealtypisch zu formulieren, wie wir es in den späteren Abschnitten zum einen mit der Freudschen Psychoanalyse zum anderen mit dem Weberschen Handlungsmodell (Rationalitätskataloge) tun werden. Meine in Anlehnung an die Strykerschen Überlegungen entwickelte These ist, dass es sich bei dem „symbolischen Interaktionismus“ ebenso wie bei der Weberschen Handlungskonzeption um ein anthropologisches Modell handelt, welches die Fachwissenschaften der Soziologie und der Psychologie gleichermaßen „umgreift“. Während jedoch Webers Argumentation sehr viel stärker sozial-strukturell (z.B. rollensystematisch) ausgerichtet ist, ist das Modell des „symbolischen Interaktionismus“ wesentlich stärker sozialpsychologisch und damit im Prinzip, d.h. vom „Grundansatz“ her, auch sozialisationstheoretisch ausgerichtet. Sozialpsychologie erscheint so als diejenige Disziplin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die anthropologische Grundlage der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung verhaltenstheoretisch zu formulieren und zugleich dabei auch auf ganz bestimmte mikrosoziale Aspekte des gesellschaftlichen Geschehens zu achten, die rollenstrukturell beschreibbar sind. Ausgangspunkt der Betrachtung ist, wie bei Weber auch, die Grundeinsicht des „symbolischen Interaktionismus“, dass sich der Mensch als eine Kategorie sui generis qualitativ und prinzipiell von allen Formen der höher entwickelten Organismen unterscheidet 67 und dass folglich eine andere (Fach-)Sprache nötig ist, um diesem Tatbestand auch wissenschaftlich Rechnung tragen zu können. Bei Weber heißt es: „Menschliches (»äußeres« oder »inneres«) Verhalten zeigt sowohl Zusammenhänge wir Regelmäßigkeiten des Verlaufs wie alles Geschehen. Was aber, wenigstens im vollen Sinne, nur menschlichem Verhalten eignet, sind Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten, deren Ablauf verständlich deutbar ist.“69 Bei Stryker wird, genau diesen Gedanken präzisierend, darauf aufmerksam gemacht, dass der Mensch und nur der Mensch – genau dies unterscheidet ihn von allen anderen Lebewesen sowohl in den Interaktions- als auch Kommunikationsformen – über das Instrument der Sprache verfügt, woraus zunächst einmal logisch folgt: Die zugestandenermaßen sehr komplizierten Kommunikationsformen der Bienen z.B. aber auch die sprachähnlichen Kommunikationsformen der Primaten oder der Delphine, sind per definitionem nicht „Sprache“. „Sprache“ ist vielmehr dasjenige „System von Zeichen“70, welches als soziale Institution“ (Saussure) das „Zusammenhandeln“ (Max Weber) menschlicher Individuen von dem Kollektivhandeln aller anderen Lebewesen unterscheidet. Schließen wir diese beiden Ansichten zusammen, so ergibt sich als erster Satz für eine mögliche Integration der Weberschen „Verstehenslehre“ mit dem „symbolischen Interaktionismus“: 1. Menschliches (»äußeres« oder »inneres«) Verhalten zeigt sowohl Zusammenhänge wir Regelmäßigkeiten des Verlaufs wie alles Geschehen, weil aber der Mensch und nur der Mensch über das Instrument der Sprache verfügt, eignen seinem Verhalten Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten, deren Ablauf verständlich deutbar ist. Und ziehen wir nunmehr die obige Webersche „Soziologiedefinition“ hinzu, so ergibt sich als zweiter Satz für eine mögliche Integration der Weberschen „Verstehenslehre“ mit dem „symbolischen Interaktionismus“: 2. Das soziale Handeln menschlicher Individuen welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird, und daran in seinem Ablauf orientiert ist, ist deshalb deutend verstehbar und genau dadurch in seinem 69 Weber [Kategorienaufsatz] S. 427 70 Saussure, vgl. hierzu die beiden Magisterarbeiten von Marina Demetriou [Morgue] und Eleni Liousi [Kompetenzbegriff], die im Rahmen unserer Forschungsgruppe vor vier Jahren angefertigt worden sind. 68 Ablauf wie in seinen Wirkungen ursächlich erklärbar, weil es wesentlich sprachlich organisiert ist, woraus der folgenden dritte Satz für eine mögliche Integration der Weberschen „Verstehenslehre“ mit dem „symbolischen Interaktionsimus“ logisch folgt, nämlich: 3. Soziologie und Linguistik bilden eine Komplementareinheit, denn virtuell sind menschliche Formen des Gemeinschaftslebens Gesprächsvergemeinschaftungen. Oder anders ausgedrückt: Idealtypologisch lässt sich, da aus diesem Blickwinkel die Sprache als (humanspezifische) Basisinstitution aufgefasst werden muss, welche die Kernstruktur sozialen Handelns überhaupt ausmacht, jedwede humanspezifische Interaktions- und Kommunikationsformen als Gespräch im Gadamerschen Sinne deuten. Und hieraus wiederum folgt logisch der vierte Satz für eine mögliche Integration von „Verstehenslehre“ und „symbolischem Interaktionismus“. 4. Die Fähigkeit sprachlich zu kommunizieren ist die unabdingbare Voraussetzung für soziales Handeln im strengen Weberschen Sinne, wodurch, wie ich finde, das Habermassche Konstrukt der „Kommunikativen Kompetenz“ genau diejenige präzise Bedeutung bekommt, die es bislang nicht hatte. In Abschnitt II. 5. 4. wird auf diesen Aspekt aller empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorien zurückzukommen sein. Schauen wir uns unter diesem Blickwinkel die Strykersche Argumentation an, so sind es vier Grundannahmen, die das Paradigma des „Sozialbehaviorismus“ der Chicagoer-Schule ausmachen und die für unser hier verfolgtes Vorhaben interessant sind: Die erste Annahme ist die gegen den (radikalen) Behaviorismus gerichtete These, dass der Mensch mit den Mitteln der Tierpsychologie wie auch mit den Mitteln der naturwissenschaftlichen Medizin nicht komplex genug erfasst werden kann.71 Methodisch ist dies also eine radikal antireduktionistische These, welche besagt, dass das menschliche Verhalten qualitativ etwas anderes ist, als selbst das Verhalten der Primaten. Der Mensch ist also nicht nur ein in quantitativer Hinsicht gesteigertes und komplexeres Primatengeschöpf, er 71 Zu dem Versuch, auch „Bewusstseinsprobleme“ im Bezugsrahmen des „klassischen“ – sprich: des radikalen – Behaviorismus zu erfassen, vgl. die allerdings noch sehr stark philosophisch gehaltene Untersuchung bestimmter ausgewählter Texte von Watson und Skinner, die meine Kollegin Marija Mitrov jetzt vorgelegt hat: Die sog. „Naturalisierung des Bewusstseins“ – Ein philosophisches Problem? Versuch einer philosophischen Analyse des klassischen behavioristischen Paradigmas. Auf die Diskussion und den Ergebnissen dieser Arbeit in den Aprilsitzungen 2005 stütze ich mich hier. 69 ist vielmehr auch qualitativ different, eben weil er ein „Kulturmensch“ im Weberschen Sinne ist, d.h. „begabt mit der Fähigkeit und dem Willen, bewusst zur Welt Stellung zu nehmen und ihr einen Sinn zu verleihen“72: „Die Theorie [des symbolischen Interaktionismus] nimmt [deshalb] ihren Ausgang von der antireduktionistischen Annahme, dass der Mensch auf seiner eigenen Basis erforscht werden muss. Da der Mensch [und nur er, die] Befähigung zu komplexen symbolischen Produkten hat [sich also im Weberschen Sinne „subjektiv sinnhaft verhalten“ kann] und die Speicherung solcher Produkte ihn von anderen Lebensformen unterscheidet, folgt daraus, dass nicht all sein Verhalten durch Prinzipien erklärt werden kann, die man bei der Erforschung der anderen Lebensformen gewonnen hat.“73 Erklärungsbedürftig wäre in dem hier gemeinten Sinne z.B. der Tatbestand, dass es ausschließlich der Menschenart gelungen ist, Kultur hervorzubringen und zu entwickeln, jenes komplexe rollenstrukturell beschreibbare Lebenssystem also, welches der Freudschen „Definition“ zufolge „zwei Seiten [umfasst]“, nämlich: „einerseits all das Wissen und Können, das die Menschen erworben haben, um die Kräfte der Natur zu beherrschen und ihr Güter zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse abzugewinnen, andererseits alle die [rollenstrukturell organisierten] Einrichtungen [die Systeme der sozialen Kontrolle also], die notwendig sind, um die Beziehungen der Menschen zueinander, und besonders die Verteilung der erreichbaren Güter zu regeln.“74 Die zweite Annahme folgt logisch aus der ersten und ist – wir sehen hier ganz deutlich das „Soziologieaxiom“ Emile Durkheims, – gegen die „Psychologie des Individuums“ gerichtet: Um menschliches Verhalten wirklich wissenschaftlich verstehen zu können, muss man von „der Gesellschaft“ als einer „Gegebenheit an sich“ ausgehen, was im Sinne unserer Ausführungen über die Sozialtheorien bzw. das Gesellschaftsbild bedeutet, dass das Prädikat „Individuum“ selbst ein sprachliches, mithin also ein kulturelles 72 Produkt der Weber [Objektivitätsaufsatz] passim. Wir müssen jedoch diesen Satz ein wenig anders formulieren, wollen wir das, was er für eine empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie bedeuten könnte, wirklich zum Ausdruck bringen: Dem Menschen und nur dem Menschen eignet, weil er über das Instrument der „Sprache“ verfügt, die Kompetenz, bewusst zur Welt Stellung zu nehmen und ihr einen Sinn zu verleihen. Nur aus diesem Blickwinkel werden wir dann nämlich die Berechtigung haben, das Konstrukt der „Kommunikativen Kompetenz“ zum Grundbegriff der Sozialisationstheorie zu machen. Vgl. hierzu das Tafelbild im Abschnitt II. 8. 2. 73 74 Stryker [Interaktionismus] S.53. Hervorhebungen mittels Kursive durch mich Ch. K. Freud [Illusion] 70 „gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit“ ist.75 Der Begriff des „Individuums“ bezeichnet eine von der menschlichen Sprachgemeinschaft erzeugte Konstruktion, ein kategoriales Klassifikationsschema also, und diese Kategorie wird so von vorneherein in der Theorie des „symbolischen Interaktionismus“ gefasst: „Die Theorie [des symbolischen Interaktionismus] nimmt ferner an, dass der fruchtbarste Weg zu einem wissenschaftlichen Verständnis des menschlichen Verhaltens über eine Analyse der Gesellschaft führt.“ Und er „hält ..... daran fest, dass jedes denkbare Individuum in eine bestehende ..... Kultur [bzw. in ein vorausdefiniertes Rollensystem] hineingeboren wird. Statt eine metaphysische Priorität der Gesellschaft vor dem Individuum oder umgekehrt zu behaupten, umgeht der „symbolische Interaktionismus“ diese philosophische Frage dadurch, dass er seine Analyse [ebenso wie Max Weber] mit dem sozialen Handeln beginnt und daraus sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft ableitet. Auf diese Weise sorgt er für eine klare Soziologie und Sozialpsychologie: Die erstere beginnt mit dem sozialen Handeln und baut darauf auf bis zur Gesellschaft; die letztere beginnt ebenfalls mit dem sozialen Handeln und arbeitet in die andere Richtung, nämlich in Richtung auf das Individuum.“76 Zu erinnern ist hierbei zunächst einmal an die oben erwähnte „kulturwissenschaftliche Faustregel“, welche besagt, dass man „die psychologische Dimension des Gesellschaftsgeschehens, die Art und Weise also, wie Menschen denken, fühlen und handeln, dann und nur dann im Hinblick auf bestimmte Ereigniskonstellationen, um deren Erklärung es uns geht, kausal relevant gewichten [kann], wenn zuvor in relativer Reingestalt die institutionelle Dynamik des Geschehens, welche die Bedingungen der Möglichkeit des denkens, fühlens und handelns der Menschen beinhalten, hinreichend aufgehellt worden ist.“77 Man sieht, dass die Grunddefinition wie auch das paradigmatische Belegstück des intentionalen Handelns für die Differenzierung dieses Modells in der Weberschen Soziologie auf dasselbe hinauslaufen wie im symbolischen Interaktionismus: Gegenstand der 75 Dies eine, wie ich finde, recht treffende Formel, die Berger und Luckmann geprägt haben und die mittlerweile zur Standardformel der Soziologie geworden ist. 76 Stryker [Interaktionismus] S.53. Hervorhebungen mittels Kursive durch Ch. K. 77 Vgl. hierzu weiter oben die Fußnote 40 71 Menschenwissenschaften sind Wesen, die, weil sie kommunikativ (sprachlich) kompetent, mithin also auch zu subjektiv sinnhaftem Verhalten fähig sind, die etwas wollen können, und die bezüglich dessen, was sie wollen können, eben Mittel anwenden können, von denen sie glauben, dass sie zur Erreichung dessen, was sie wollen, geeignet sind. Sie handeln, insofern sie im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind, als aktiv Handelnde, die gelernt haben (müssen), dass es andere aktiv Handelnde gibt, die ebenfalls ihre Interessen verfolgen bzw. etwas wollen, und die bezüglich dessen, was sie wollen, (gleichfalls) Mittel anwenden, von denen sie glauben, dass sie zur Erreichung dessen, was sie wollen, geeignet sind. Es wird uns später nicht schwer fallen, wie ich glaube, dieses Grundmodell komplementären rationalen Handelns rollensystematisch mit dem Gadamerschen Idealtypus des Gespräches in Beziehung zu bringen.78 Unschwer zu sehen ist bereits an dieser Stelle, dass sowohl im Weberschen Modell als auch hier bei Stryker mit der unausgesprochenen Prämisse operiert wird, dass nur rationale „Individuen“ es sind, über deren komplementäres Normalhandeln hierbei idealtypisch gesprochen wird. Diese zweite Grundannahme Strykers bildet für mich die Legitimation, von einem anthropologischen Paradigma zu sprechen, wobei das Weberschen Konstrukt des „sozialen Handelns“ zu einer wesentlich anthropologisch gefassten Grundkategorie wird: Sowohl die Gesellschaft als auch das Individuum seien, so Stryker, aus dieser Grundkategorie „ableitbar“. Wie wir sehen werden ist diese Unsicherheit in der Terminologie alles andere als zufällig. Wie eine solche „Ableitung“ genau auszusehen hat, lasse ich an dieser Stelle zunächst einmal völlig offen und weise lediglich auf den im nächsten Abschnitt zu behandelnden methodologischen Vorbehalt hin. Natürlich ist weder das „Individuum“ noch „die Gesellschaft“ aus irgendeiner Kategorie „ableitbar“. Nur Sätze über das Verhalten von Individuen und nur soziologisch-wissenschaftliche Sätze können irgendwie „ableitbar“ sein. Und selbst dann, wenn wir diesen Punkt berücksichtigen, haben wir hier eine, wie ich glaube, massive Ungereimtheit: Eine „Kategorie“ ist ein begriffliches Gebilde, nicht jedoch ein möglicherweise wahres oder falsches Satzsystem. Nur Sätze jedoch können aus anderen Sätzen abgeleitet werden. Im Zusammenhang mit unseren Überlegungen zur Methodenlehre 78 Vgl. den Abschnitt II. 5. 4., wo es um das Gadamersche Gesprächsmodell gehen wird. Wie in der Einleitung bereits gesagt müssen „Individuum“ und „Gespräch“ zusammen als ein idealtypologisches Gefüge konstruiert werden, damit man die in der sozialen Realität vorfindlichen Abweichungen nach Maßgabe von „Rationalität“ und „Irrationalität“ in ein Ordnungszusammenhang bringen können. 72 des „Idealtypus“ im nächsten Abschnitt, werden wir hierzu dann allerdings einiges zu sagen haben. Wie auch immer – diese „Ungereimtheit“ scheint mir ausräumbar, so dass die (prinzipielle) Geltung der Strykerschen „Grundannahmen“ wohl nicht in Frage steht. Sozialpsychologie wird jedenfalls so bereits von ihren Grundvoraussetzungen her zur Basiswissenschaft für die Soziologie wie für die Psychologie. Allerdings muss man sich die Frage vorlegen, was das letztenendes bedeutet. Es handelt sich, die Soziologie einerseits die Psychologie andererseits betreffend, um zwei Sichtweisen auf dasselbe Grundphänomen „Mensch“.79 Später werden wir dann sehen, dass es sich bei diesem begrifflichen Gebilde um ein idealtypisches Konstrukt handelt, mit dem wir sowohl in der Soziologie als auch in den Verhaltenswissenschaften operieren müssen.80 Von unschätzbarer Wichtigkeit ist sodann die dritte Annahme Strykers, ermöglicht sie doch eine überraschende Re-Interpretation derjenigen Textabschnitte, die wir anlässlich einer etwas genaueren Interpretation des „Redlich/Freedman“ zu behandeln haben. Denn ich sagte ja, dass man darauf rechnen müsse, begrifflich scharf zwischen „Handeln“ und „Verhalten“ zu unterscheiden. Diese dritte Annahme definiert den Menschen sowohl als einen aktiv Handelnden als auch als einen auf eine bereits bestehende sozialstrukturierte Welt Reagierenden. Mit anderen Worten: Der Mensch reagiert auf eine soziale Umwelt, die sich ihm von Anbeginn seines Lebens an, – nämlich im Bezugsrahmen des familialen Interaktionsund Kommunikationsgefüges – als ein kategorial vermitteltes Symbolsystem darbietet, welches rollenstrukturell „immer schon“ seiner Daseinsform vorausliegt und er handelt subjektiv sinnhaft. Denn eines dieser rollensystemisch strukturierten Symbolsysteme ist eben die „Familie“, die, wie wir einleitend behauptet haben, die primordiale Sozialisationsphase und damit die Identitätsbildung bestimmt. Menschen reagieren jedoch nicht nur „quasireflexologisch“, Menschen sind vielmehr Wesen, die von Anbeginn ihres Lebens an mit Phantasie begabt ihre spezifischen Reaktionen kreativ zu handhaben wissen.81 Wohlgemerkt: 79 Vgl. weiter oben die Fußnote 43 80 Vgl. hierzu die Ausführungen in II. 7. 2., sowie die Argumentation in Abschnitt II. 8. 81 Wie wir alle in der „Dossenheimer Forschungsgruppe es tun, hat auch meine Kollegin Dietlinde Michael versucht, die Pädagogik streng handlungssoziologisch zu konzipieren. Und in diesem Zusammenhang hat sie auch versucht, eine streng sozialstrukturelle Beschreibung der sog. „pädagogischen Grundsituation“ zu geben, was Gegenstand einer Kontroverse geworden ist. Der eigentliche prekäre Punkt ist hierbei der Kreativitätsaspekt, der, wie ich meine, nur handlungssoziologisch deutlich gemacht werden kann. Er folgt nämlich aus der komplementären Interaktion des von Frau Michael entwickelten Lehr-Lernmodells. Die Verknüpfung dieser 73 Nicht die Individuen sind es in dieser strengen Sprechweise, vielmehr sind es die menschlichen Wesen als menschliche Wesen. Um diesen Gedanken jedoch präzisieren zu können bedarf es einer anderen Lerntheorie als der des strengen Behaviorismus oder derjenigen der kognitiven Psychologie. Dass der Mensch in diesem Sinne sowohl Handelnder als auch Reagierender ist, dass er nicht auf die Umwelt als einer bloß physikalischen Gegebenheit, sondern auf eine Umwelt antwortet, wie sie symbolisch vermittelt, normal ist, ist von ausschlaggebender Bedeutung: „Da [nämlich] die Menschen auf symbolische Umwelten reagieren und die Menschen ihre eigenen Symbole produzieren, kann der Mensch sich also selbst stimulieren.“82 Psychoanalytisch gefasst aber heißt das: Der Mensch kann Traumwelten erschaffen, die selbst wiederum sein „Realhandeln“ beeinflussen. Und die Psychoanalyse fragt ja nicht nur danach, ob und wie sich eine realitätsfugative Verhaltensweise in solchen Traumwelten verliert – bei Freud sind das die halluzinatorischen Psychosen – sondern auch und gerade nach dem funktionalen Stellenwert des Phantasie- und Traumverhaltens dafür, dass „normales“ Sozialverhalten sich vollziehen kann. Insofern ist die Psychoanalyse ein Forschungsprogramm, welches seine Aufmerksamkeit ganz allgemein auf diejenigen Bedingungen richtet, die sowohl für sozialkompetentes rationales Verhalten, als auch für eine Ätiologie pathologischer Formen des Verhaltens verantwortlich zu machen sind.83 Von daher richtet sich unser Blick ganz automatisch auf jene familialstrukturellen Bedingungen, welche die primordialen Sozialisations- und Enkulturationsprozesse bestimmen. Überlegung mit der „Zeigehandlung“ des „ästhetischen Sensibilisierens“ – dies die Grundthese von Frau Michael – steht dabei nicht in Frage. Nur ist eben derjenige, welcher „sensibilisiert“ wird dem Handlungsmodell zufolge auf gar keinen Fall passiv. Wie weit sich dieser Aspekt klären lassen wird muss abgewartet werden. Ich meine jedoch, dass dieser zentrale Punkt der handlungssoziologischen Grundsätze auf gar keinen Fall suspendierbar ist, folgt er doch logisch, – ganz gleich ob sich diese These mit unserem umgangssprachlichen Verständnis des „Lernens“ verträgt oder nicht: Wenn man die pädagogische Grundsituation als paradigmatisches Belegstück für die Komplementarstruktur für „Pädagoge und Pädagogant“ (D. Michael) auffasst und dabei auf das Handlungsmodell rekurriert, dann ergibt sich zwingend, dass nicht nur das „Lehren“, sondern auch das „Lernen“ als ein aktives Handeln aufgefasst werden muss. Wie man anhand einer texthermeneutischen Feinanalyse des Freudschen Fragments über die „Zwei Prinzipien“ sehen kann – eine Interpretation genau dieser Stelle war der Streitpunkt –, lässt sich nur so auch die „Kreativitätsstruktur“ derjenigen Lernphase herausarbeiten, die das frühkindliche Lernen bestimmt. Mit Porath bin ich der Überzeugung, dass die von Chompsky in enger Anlehnung an die Sprachphilosophie W.v.Humboldt’s vorgetragene These bezüglich der „Kreativität des Sprachgebrauchs“ nahtlos hier eingefügt werden kann. Ein früherer Schüler von Porath, Rainer Ostermann, hatte in seiner politikwissenschaftlichen Dissertation über W.v.Humboldt [Freiheit des Individuums] genau diese These erstmalig auf das Gebiet der Politologie „angewandt“ und überzeigend zeigen können, dass nur so der prekäre „Freiheitsbegriff“ sich empirifizieren lässt (vgl. hierzu auch die Bemerkungen im Forschungsantrag). 82 Stryker [Interaktionismus] S. 53f Hervorhebungen mittels Kursive durch mich - Ch.K. 83 Vgl. hierzu insgesamt den Abschnitt II. 6. 74 Die vierte Annahme schließlich grenzt die Sozialpsychologie des „symbolischen Interaktionismus“ konsequent gegenüber ganz bestimmten anthropologischen Grundannahmen der Psychoanalyse ab, die auch uns, zumindest in einer Hinsicht, verdächtig sind. Sie betrifft sehr stark den in den Freudschen Schriften begegnenden „Hobbesianismus“. Dieser nämlich scheint mir eine „Denkblockade“ gegenüber einer möglichen soziologischen Verfeinerung der Psychoanalyse zu sein, worauf in der vorliegenden Arbeit einzugehen jedoch nicht der Ort ist. An dieser Stelle halte ich lediglich fest: Weil der Mensch ein mit Sprache bereits biologisch ausgestattetes Wesen ist, wird er geboren weder als ein soziales noch als ein anti-soziales Wesen, wie es einige Textstellen des Freudschen Werkes nahelegen.84 Stryker stellt zu Recht fest: „Letztlich nimmt die Theorie noch an, dass die Menschen weder sozial noch anti-sozial geboren werden, sondern vielmehr a-sozial. Das Kind ist kein geborener „Mensch“, obwohl es die Fähigkeiten besitzt, Mensch zu werden. Es wird dies durch den Erwerb eines Selbst im Kontext der Interaktion mit anderen.“85 Übersetzen wir: Das Kind ist zwar sehr wohl zu möglichem „Mensch sein“ geboren, denn es ist philogenetisch ein Mensch, besitzt mithin die Fähigkeit zu subjektiv sinnhaftem Verhalten, dennoch bedarf es der Sozialisation, um ein „Kulturmensch“ im Weberschen Sinne zu werden, d.h. „begabt mit der Fähigkeit und dem Willen, bewußt zur Welt Stellung zu nehmen und ihr einen Sinn zu verleihen“. 84 Ich denke hier insbesondere an die Ausführungen Freuds in [Unbehagen] zu der grundsätzlich barbarischen Natur, welche jedes Neugeborene sozusagen „von sich aus“ mit auf die Welt bringe. 85 Stryker [Interaktionismus] S. 53f. Hervorhebungen mittels Kursive durch mich Ch. K; mittels Unterstreichung durch den Autor. 75 3. Methodische Probleme und Probleme der Methodologie: Texthermeneutik, Begriffsanalyse und ein wissenschaftstheoretischer Thesenkatalog 3.1. Allgemeines Das der vorliegenden Arbeit zugrundeliegende „Material“ sind nicht die sozialen, psychiatrischen, psychologischen oder biologischen Tatbestände als solche, wie sie dem Sozialforscher, dem Psychiater, dem Psychologen, dem Arzt oder dem Biologen „vorgegeben“ sind, sondern Texte bzw. die in diesen Texten anzutreffenden Begriffe und Aussagen. Die vorliegende Arbeit ist in erster Linie der Begriffsklärung und der (möglichen) Theoriekonstruktion gewidmet. Es geht um die Rekonstruktion der Bedeutungsgehalte ganz bestimmter Begriffe, mit dem Ziel, einer auch für die Praxis relevanten Theoriebildung einen Zugang zu verschaffen, wobei die Frage nach den Konstruktionsprinzipien einer (allgemeinen) Theorie des Sozialisationsgeschehens im Mittelpunkt steht. Insofern und nur insofern handelt es sich bei der hier vorgelegten Arbeit um eine „geisteswissenschaftliche“, genauer: kulturwissenschaftliche, und versteht sich auch nur in diesem Sinne als ein Beitrag zu einem interdisziplinären Diskurs über z.T. brennende Probleme der klinischen Praxis und der Sozialpolitik, wie Max Weber sie verstanden hat. Es bedarf deshalb an dieser Stelle einiger mehr methodisch-erkenntnistheoretischer Bemerkungen, die das Umgehen mit bestimmten Texten betreffen: Bemerkungen zur Texthermeneutik eben. Darüber hinaus werde ich Gelegenheit nehmen, meine wissenschaftstheoretische Grundposition zu dokumentieren, die wie bereits in der Einleitung („Relevanz“) erwähnt, alles andere als eine traditionell geisteswissenschaftliche ist. Mein methodisches Vorgehen zerfällt in zwei Teile: 1. Textanalyse (methodisch ausgewiesen als Hermeneutik, genauer: Texthermeneutik ) 2. Begriffsanalyse Die Reihenfolge ist nicht unwichtig. Die fraglichen Begriffe nämlich finden sich in einem kaum noch überschaubaren Textmaterial, welches sich grob einteilen lässt in psychiatrischmedizinisches, soziologisches, psychologisches und sozialpsychologisches. Methodisch ergibt sich also hier zunächst einmal das Problem der Auswahl der Texte. 76 Auf die schwierigen methodologischen Probleme, die in dieser „Methodik“ angesprochen sind, kann ich in der vorliegenden Arbeit nur in ganz grober Form eingehen, und dies obwohl sie, wie sich später noch sehr viel deutlicher herauskristallisieren wird, derzeitig die eigentlich wichtigen sind. An dieser Stelle mache ich in diesem Zusammenhang – und dies notgedrungen lediglich thesenartig – auf ein zentrales Problem aufmerksam, zu dessen (möglicher) Lösung ich zwar beitragen, welches zur allgemeinen Zufriedenheit zu lösen mir jedoch versagt bleiben muss. Es ist tatsächlich so, wie einleitend betont: Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag für mögliche Lösungen in den Raum stellen und ist von daher, wie derzeitig kaum eine andere auf Widerspruch, Kritik und eine entsprechende wissenschaftliche Diskurskultur86 vital angewiesen. Das zentrale methodologische Problem, um welches es hierbei geht, betrifft, da es die Frage nach der integrativen Vernetzbarkeit divergenter wissenschaftlicher Theoriegebilde betrifft, immer zugleich auch die Frage der integrativen Vernetzbarkeit divergenter Paradigmen: Die Psychoanalyse ist dem Selbstverständnis ihres Begründers zufolge als strenge Naturwissenschaft konzipiert worden, zu deren Fundamentalannahmen das Prinzip des methodologischen Determinismus gehört, wie weiter unten noch explizit hervorzuheben sein wird. Die Theorie des sozialen Handelns hingegen ist bekanntlich ein Produkt der „Verstehenssoziologie“, einer Kulturwissenschaft also. Hier besteht die Gefahr der notorischen Konfundierung von Begriffen, Hypothesen und Theorien die unterschiedlichen Paradigmen angehören.87 Es besteht also die Gefahr eines Selbstwiderspruchs in den theoretischen Grundannahmen. Mein „Erklärungsmodell“ hätte dann in genau dem Sinne keinen empirischen Gehalt, in welchem es einleitend der Resch‘schen „Entwicklungspsychopathologie des Kindes- und Jugendalters“ vorgeworfen wurde: Aus einem in sich widerspruchsvollen Konglomerat von Grundannahmen können keine empirisch falsifizierbare Hypothesen abgeleitet werden.88 Nur mittels dieser jedoch lassen sich echte 86 Vgl. hierzu die Ausführungen zur Gadamerschen Idealtypologie des „Gespräches“ in Abschnitt II. 5. 4. 87 Einer Gefahr, die wie in der einleitenden Skizzierung des „Forschungsstandes“ bereits betont, beispielsweise das Resch’sche Lehrbuch erlegen ist. Diesem ist es nicht gelungen, zwei verschiedene Theoriegebilde desselben (lerntheoretischen) Paradigmas zu einer halbwegs methodisch homogenen Einheit zu „integrieren“: Die Grundannahmen von Wygotski und Piaget im selben Theoriegebäude angesiedelt produzieren einen Selbstwiderspruch, was offenkundig die Autoren noch nicht einmal bemerkt haben. 88 Wie wir in Abschnitt II. 8. sehen werden, lassen sich tatsächlich einige Beziehungen zwischen den „Bedeutungssegmenten“ des Konstrukts der „Kommunikativen Kompetenz“, wie wir es im letzten Abschnitt entwickelt haben, als empirisch falsifizierbare Hypothesen deuten. Man wird jedoch zugleich auch sehen, dass dies nur deshalb überhaupt möglich ist, weil sich, wie in Abschnitt II. 2. dargelegt, die Weberschen 77 Kausalerklärungen formulieren. Wenn also tatsächlich bislang keine wirkliche Ätiologie der Erkrankungen des sog. „schizophrenen Formenkreises“ hat ausgearbeitet werden können, wie seitens der psychiatrischen Fachwelt glaubwürdig versichert wird, dann bedeutet das in einer streng wissenschaftstheoretischen Sprache: Wir verfügen bislang nicht über eine empirisch hinreichend gut validierte Menge von Hypothesen, die uns eine Erklärung für das Auftreten von „Schizophrenie“ zu liefern imstande wären, weil wir diese Hypothesen nicht zu in sich widerspruchsfreien Theoriekonstruktionen ausarbeiten können. Und in einer ebenfalls streng wissenschaftlich konzipierten soziologischen Sprache formuliert heißt das: Es gibt bislang keine hinreichend präzise empirisch validierte Sozialisationstheorie, in deren Rahmen diejenigen Terme, die sich auf die sog. „abnormen“ Formen abweichenden Sozialverhaltens beziehen könnten, eine hinreichend präzise Bedeutung haben. Die Schwäche der hierzu einschlägigen Theorien spiegelt sich wieder in einer z.T. unerträglichen (anthropomorphistischen) Metaphorik der die betreffenden Phänomene designierenden Begrifflichkeit(en), was, wie man nunmehr sieht, alles andere als ein Zufall ist. Zu dem hier angesprochenen grundsätzlichen erkenntnistheoretischem Problem – ich habe sie eingangs als „methodologische Doppelfrage“ umschrieben – möchte ich an dieser Stelle einen Thesenkatalog vorstellen, der die wissenschaftstheoretische Begrifflichkeit, mit der ich arbeiten werde und die ich bislang auch später als selbstverständlich voraussetzen werde, erläutern soll. Eingehender erläutern werde ich das nachstehend vorgestellte methodologische Thesengerüst sodann in dem Abschnitt II. 5. der sich mit dem „Wissenschaftscharakter“ der Soziologie befasst. Dort insbesondere wird sodann auch das vielumstrittene „DN-Schema einer wissenschaftlichen Erklärung“ zu erläutern sein, welches sehr vielen Missverständnissen ausgesetzt zu sein pflegt, deren „Ausräumung“ mir aus einem ganz bestimmten Grunde sehr am Herzen liegt: Die Postulatorik des „DN-Schemas einer wissenschaftlichen Erklärung“ steht nicht wie fast immer behauptet wird, im Widerspruch zu den (hermeneutischen) Prinzipien der Weberschen „Verstehenssoziologie“. Sie beinhaltet vielmehr eine wesentliche Präzisierung der von Max Weber selbst ins Zentrum seiner Forschungen gestellten Grundannahmen zur „Verstehenslehre“ integrativ mit den Strykerschen Grundannahmen zum „symbolischen Interaktionismus“ vernetzen und mit dem Gadamerschen „Gespräch“ in Beziehung bringen lassen. Das soziolinguistische Modell, welches wie in Abschnitt II. 2. erhielten, genügt nämlich dem Widerspruchsfreiheitspostulat, was ja keineswegs selbstverständlich ist: Ein „Modell“ ist wie jedes idealtypologische Konstrukt ein wesentlich begriffliches Gebilde und kann sich dann und nur dann auch als erklärungsrelevant bewähren, wenn empirisch falsifizierbare Hypothesen abgeleitet werden können, die sich dann natürlich auch nicht widersprechen dürfen. Nur aus diesem Grunde können wir es nämlich auch wagen, den in Abschnitt II. 8. gestarteten Versuch als (ersten) Entwurf zu einer möglichen empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie aufzufassen. 78 Wertfreiheits- und Objektivitätsforderung. Ist aber dies einmal akzeptiert, so ergeben sich sehr weitreichende Konsequenzen für das Ineinanderspiel von streng empirischer Grundlagenforschung und Anwendung: Eine empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie, zu deren Ausarbeitung in der hier vorgelegten Arbeit ja lediglich die ersten Schritte vorgeschlagen werden sollen, bildet dann tatsächlich den eigentlichen kognitiven Hintergrund für eine mögliche Ätiologie der Mentalerkrankungen. In genau diesem Sinne ist auch mein nachstehend vorgestellter Thesenkatalog zu verstehen, welcher mithin eine Position umreißt, die die in dieser Arbeit sozusagen „in Permanenz“ zu erörternden methodologischen Probleme zuordbar machen. Die vorliegende Arbeit hat nicht den Ehrgeiz wissenschaftstheoretische Grundlagenforschung zu betreiben. Sie verwendet, in dem sie sich hierbei vor allem auf die im bereits mehrfach erwähnten [Forschungsantrag] vorgetragenen Ergebnisse der historisch-sozialwissenschaftlichen Grundlagenforschung des „Dossenheimer Arbeitskreises“ stützt, vielmehr selektiv ganz bestimmte Forschungsergebnisse der wissenschaftstheoretischen Analyse und listet zunächst einmal ganz unprätentiös einige feststehende wissenschaftslogische Begrifflichkeiten sowie einige mit diesen assoziierte Problemklassen auf, sodass sich die folgende „Wenn-DannAussage“ ergibt: Wenn das in dieser Arbeit entfaltete Plädoyer für eine wesentlich sozialisationstheoretisch fundierte Ätiologie der sog. „Geistes- und Gemütserkrankungen“ auch nur einigermaßen plausibek erscheint, dann muss bei der „Inangriffnahme“ der Ausarbeitung eines solchen Forschungsprogramms erstens mit dem Instrumentarium der nachstehend aufgelisteten Begrifflichkeiten operiert und zweitens mit genau denjenigen (methodologischen) Detailproblemen gerechnet werden, die ich in dem nachstehenden „Thesenkatalog“ anspreche. Vorweg sei es mir gestattet, in diesem Sinne zwei mir sehr wichtig erscheinende Passagen zu zitieren, in denen prinzipiell Stellung genommen wird zur „Grundlagenproblemlage in den Kulturwissenschaften“, wie auch ich selbst sie verstehe. Die erste stammt aus dem Begleitpapier zu einem Hauptseminar, welches seinerzeit als Einführungskurs in das „kulturwissenschaftliche Denken und Forschen“ am „Germanistischen Seminar“ der Universität Heidelberg abgehalten wurde, und die zweite stammt aus einem Vortrag, der direkt im Anschluss an dieses Seminar auf dem „Wind-Kongress“ in Berlin zu 79 genau dem selben Thema gehalten wurde und der sich expressis verbis mit dem Problem der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Integration befasst89: Erste Passage: „Das Seminar mit dem Arbeitstitel "Der kulturtheoretische Ansatz Edgar Winds" ist ein Forschungsseminar und hat als ein solches Forschungsseminar zugleich eine Orientierungsfunktion hinsichtlich dessen, was in den späteren Semestern geplant ist und fortgeführt werden soll. Das bedeutet, daß an Hand eines ganz bestimmten – methodologisch sensibilisierten – kulturwissenschaftlichen Ansatzes, nämlich desjenigen E. Winds, Positionen erarbeitet werden sollen, welche die Kontinuität weiterführender Fragestellungen zu sichern imstande sind. In diesem Sinne ist das hier angebotene Seminar zugleich auch eine Einführung in das kulturwissenschaftliche Reflektieren, welches in systematischerer Form in den kommenden Semestern fortgeführt werden mag. Die weiter unten zu nennenden Begleitlektürevorschläge dienen dieser Zielorientierung und sind ganz bewußt so ausgewählt worden wie sie ausgewählt worden sind (vgl. hierzu beispielsweise die Bemerkungen zur vierten Arbeitssitzung): Es soll sensibilisiert werden für die kulturwissenschaftliche Problemsituation überhaupt und es soll zugleich damit ein gewisses Basisvokabular vermittelt werden, welches sinnvolles und problemorientiertes Diskutieren auf dem Felde der kulturwissenschaftlichen Forschung gestattet. Mit dem Sammelausdruck "sinnvolles und problemorientiertes Diskutieren" ist hier gemeint, daß für eine Diskurskultur plädiert wird, in deren Rahmen Revisionen von Thesen sowie Umorientierungen von Arbeitsbegrifflichkeiten möglich sind, ohne daß bestimmte basale Problemorientierungen dabei permanent in Frage gestellt werden (müssen). Detailprobleme müssen kontrovers diskutabel sein, wobei jedoch die jeweilige Relevanz bestimmter Thesen und Thesenrevisionen für die Ausgangsproblematik kulturwissenschaftlichen Fragens immer hinreichend transparent gemacht werden muß (Vgl. hierzu die Bemerkungen zur zweiten Arbeitssitzung). Und dies ist naturgemäß nur möglich, wenn ein zumindest halbwegs semantisch homogenes Basisvokabular hat erarbeitet werden können: An Hand der im engeren Sinne "wissenschaftstheoretischen Literatur" (sie ist in der Literaturliste jeweils mit dem Kürzel "meth." ausgezeichnet) sollte am Ende des Semesters zumindest in Ansätzen klar geworden sein, worüber man eigentlich genau genommen spricht, 89 Hierzu nur informativ: Das im Wintersemester 1995/96 am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg von Porath und den Privatdozenten Buschendorf/Buschendorf abgehaltene Hauptseminar mit dem Titel „Der kulturwissenschaftliche Ansatz Edgar Winds“ stellte seinerzeit den ersten Versuch dar, Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen sowohl der Naturwissenschaften (Physik) als auch der Kulturwissenschaften (Geschichte, Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte, Soziologie und Psychologie) in einer gemeinsamen Lehrveranstaltung mit der ehrgeizigen Zielsetzung zu vereinigen, zugleich Grundlagenforschung zu betreiben und junge Studierende in das „kulturwissenschaftliche“ wie „naturwissenschaftliche“ Denken und Arbeiten einzuführen. Die von Bernhard Buschendorf und Porath zu einem gemeinsamen Vortrag verarbeiteten Ergebnisse dieses „Forschungsseminars“ sind dann im Februar 1996 von Porath auf einer (viertägigen) „Tagung des Einstein-Forums“ in Berlin zu dem Thema „Edgar Wind. Kunsthistoriker und Philosoph“ Kulturwissenschaftlern aus dem deutschen, dem angelsächsischen und dem romanischen Sprachraum (University of Oxford, TU-Berlin, University of Michigan, Humboldt-Universität, Uni Jena, Université de Neuchâtel, University of Cambridge, University of Chicago, FU-Berlin, Vatican Library, University of Illinois, Universität Düsseldorf, Norwich) vorgestellt worden, was noch Jahre später nachhaltigen Widerhall (Rom, Warschau, Krakau) fand. Das Forschungsseminar war auf mehrere Semester hin angelegt und fand soviel Anklang, dass man es im nachfolgenden Sommersemester in zwei (wöchentliche) Lehrveranstaltungen hätte aufteilen müssen. Aus massiven Druck hin mussten dann jedoch die weiteren Veranstaltungen eingestellt werden. Die jetzige „Forschungsgruppe Dossenheim“ ist aus diesem Seminar des WS 1995/96 hervorgegangen, die beiden „Mitlehrenden“ von Porath sind mittlerweile professoriert. Die erste Passage wurde dem Porathschen Seminarleitfaden, die zweite Passage dem Vortrag beim Einstein-Forum entnommen. 80 wenn von wissenschaftlichen "Erklärungen", von wissenschaftlichen "Theorien", von wissenschaftlichen "Gesetzen", von wissenschaftlichen "Hypothesen" von wissenschaftlichen "Begriffen", von "Strukturen", "Modellen", "empirischen Systemen", "Interdependenzrelationen", "Idealtypus", "rationaler Rekonstruktion" usw. die Rede ist. Denn wir wollen nicht nur herausbekommen, was ein kulturwissenschaftlicher Ansatz ist, sondern auch, was ein kulturwissenschaftlicher Ansatz ist. Und wir wollen scharf unterscheiden lernen zwischen der Klasse derjenigen Begriffe, die sich auf kulturelle Gegenstände oder Tatbestände und Zusammenhänge beziehen, und der Klasse derjenigen Begriffe, die sich auf die Art und Weise – den Modus also – beziehen, in der "in" den Kulturwissenschaften auf diese "kulturellen" Tatbestände, Zusammenhänge oder Gegenstände bezuggenommen zu werden pflegt. Die dazu relevanten Lektürevorschläge haben in erster Linie die Funktion, gedankliche Disziplin einzuüben und eine entsprechende Diskurskultur pflegen zu lernen, bei der die in den nichtnaturwissenschaftlichen Disziplinen mittlerweile endemisch gewordene narzistische Spreizerei ebenso wie die dieser korrespondierende Blufferei ein wenig in den Hintergrund treten kann. Das dergestalt mit den Lektürevorschlägen vermittelte begriffliche Arsenal soll sozusagen den Grundstock auch dafür bilden, daß man lernt, die hier genannten Autoren zu kritisieren.90 Denn der in diesem Zusammenhang entscheidende Punkt ist der folgende: Forschung in den Kulturwissenschaften ist vornehmlich, wenn auch ganz gewiß nicht ausschließlich, Sprachanalyse, und das Material solcherart Analysen umfaßt das gesamte Spektrum sprachlich sedimentierter Imaginativformationen; der Bogen spannt sich von den mimetisch-gestischen Formen des "schweigenden Sprechens" über die "musisch-ästhetischen" bis hin zu den mathematisch-logischen Sprachformen. Dies ja lediglich ein anderer Ausdruck für die im engeren Sinne "kulturelle" Dimension der "menschlich-gesellschaftlich-geschichtlichen Wirklichkeit" (Dilthey). Und in genau diesem Sinne ist es richtig, wenn einmal – so sinngemäß – gesagt wurde: Den Kulturwissenschaften stehen weder das Mikroskop noch chemische Reagenzien zur Verfügung; die Abstraktionskraft muß beide ersetzen. Dem Ungebildeten scheint sich die kulturwissenschaftliche Analyse in bloßen Spitzfindigkeiten herumzutreiben. Es handelt sich dabei in der Tat um Spitzfindigkeiten, aber nur so, wie es sich in der mikrologischen Anatomie darum handelt. Bei näherem Besehen läßt sich die Sachlage hierbei sogar noch wesentlich schärfer formulieren, wie uns scheint: Den Kulturwissenschaften stehen nicht nur chemische Reagenzien und Mikroskop nicht zur Verfügung – die Möglichkeiten der experimentellen Erprobung sind also zumindest gravierend beschränkt –, auch das Paradigma der menschlichen Abstraktionskraft, die Verknüpfung von Logik und Mathematik, hat bisher in einer dem naturwissenschaftlichen Prozedere vergleichbaren Form nicht in das kulturwissenschaftliche Forschen Eingang finden können. Umso bedeutsamer sollte eigentlich, wie uns scheint, die begriffliche Sorgfalt in unseren Wissenschaften sein.“ 90 . Die Literaturvorschläge sind nach den folgenden Schwerpunkten gewichtet: 1. Wind-Warburg-Komplex; 2. Probleme der Emigrationsforschung; 3. Methodologische bzw. wissenschaftstheoretische Einführungsliteratur; 3 a. allgemein bzw. naturwiss. bezogen; 3 b. mehr kunstwiss. bzw. histor. bezogen (die unter 3 a genannte Literatur soll in die moderne wissenschaftstheoretische Terminologie einführen; die Titel sind mit dem Kürzel "meth." – für Methodologie – versehen und tragen eine Nummernfolge, die die empfohlene Reihenfolge der Lektüre betrifft; unter 3 c. haben wir noch ein paar Titel angeführt, die unserer Auffassung nach exemplarisch vorführen, wie handwerklich gute ikonographische Detailuntersuchungen aussehen könnten; bei der Lektüre von Winds Arbeiten, die die Sitzungen 9, 11 und 12 betrifft, wird darauf dann ohnehin genauer einzugehen sein; 4. Kulturwissenschaftliche Ansätze und forschungsprogrammatische Grundkonzeptionen. Gelernt werden sollte jedenfalls – auch – an Hand dieser Titel, daß man denselben Autor unter einer sich verändernden Fragestellung sehr unterschiedlich lesen und bearbeiten kann. Wir werden das Weitere hierzu noch mündlich durchgehen. 81 Und zu dem ja auch in der „Kinder- und Jugendpsychiatrie“ brennenden Problem der „Theorieund Wissenschaftsintegration“ hat Porath dann auf dem „Wind-Kongreß“ in Berlin die im eigentlichen Sinne erkenntnistheoretische Dimensionierung der Frage nach der "Einheit der Kulturwissenschaften" folgendermaßen zu umschreiben versucht: Zweite Passage: „Der Schwerpunkt unserer gemeinsamen Arbeiten, sofern sie sich mit den Problemen der fachübergreifenden Frage nach der Einheit der Kulturwissenschaften befassen, lag und liegt auf den im engeren Sinne begriffstheoretisch-methodologischen Segmenten der Schriften Edgar Winds, eines in Vergessenheit geratenen und auch, wie der eine von uns beiden [gemeint war hiermit Poraths Korreferent Prof. Buschendorf – Chr. Karnavou] vor einigen Jahren nachzuweisen versucht hat, ausgesprochen verkannten Kunsthistorikers, der sich Zeit seines Lebens darum bemüht hat, der Spezialisierung in den Kulturwissenschaften entgegenzuwirken. Und dies aus systematischen Gründen heraus: Hält man an dem Wissenschaftsgedanken auch auf dem Felde der Kunst-, Geschichts- und Sozialwissenschaften fest, so sind interdisziplinärer Diskurs und kooperatives Herangehen an kulturwissenschaftliche Problemstellungen genauso unabdingbar, wie in den strengen Naturwissenschaften. Nur so lassen sich fächerübergreifende Fragestellungen avisieren und verfolgen. Und nur so lassen sich innerhalb der fachspezifischen Detailforschungen relevante Problemstellungen von wissenschaftlichen Sackgassen unterscheiden. [Hervorhebung durch mich – Chr. Karnavou] Was Wind sehr früh gesehen hat, ist, daß eine allgemeine konsensfähige kulturwissenschaftliche Grundorientierung nicht zu leisten ist, wenn sich nicht fächerübergreifende Fragestellungen herausbilden können, die das allen kulturwissenschaftlichen Interessen Gemeinsame in ähnlicher Form dauerhaft thematisieren, wie das in den Naturwissenschaften der Fall ist. Denn diese geben ja ein sinnenfälliges Beispiel dafür, daß bei aller notwendigen Spezialisierung das fachspezifische Prozedere auf gemeinsame theoretische Orientierungen bezogen bleibt, ja bleiben muß und auch bleiben kann: Bei aller Divergenz ist für den Physiker, den Chemiker, den Biologen klar, daß man sich unter unterschiedlichem Blickwinkel und mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung letztlich eben doch mit demselben "Gegenstand" befaßt: der Natur. Deren Struktur gilt es zu erforschen, um sodann die – ja notwendig und immer nur vorläufigen – Ergebnisse dieser Forschungen in möglichst allgemeinen, in sich widerspruchsfreien und wahrheitsfähigen Propositionalgebilden "abzuspiegeln". Die Naturwissenschaftler können dies deshalb, weil bei aller arbeitsteilig gebotenen Divergenz bestimmte Prinzipien der naturwissenschaftlichen Methodik nicht zur Disposition stehen, weil sich deshalb eine im Prinzip immer wieder homogenisierbare Sprache herausgebildet hat und herausbilden konnte und weil sich aus diesem Grunde zumindest im Prinzip immer eine Einigung erzielen läßt hinsichtlich der möglichen Strukturen des allen Naturwissenschaftlern gemeinsamen Gegenstandes "Natur". Man sieht hier bei aller Spezialisierung letztlich immer auch die Relevanz bestimmter Forschungsergebnisse für "die" naturwissenschaftliche Forschung in ihrer Gesamtheit, und so konnten und können sich hinsichtlich der strukturellen Zusammenhänge des "Natürlichen" Hypothesen formulieren lassen, die mittlerweile den Status von "Gesetzen" erlangt haben und im Verlaufe der letzten drei bis vier Jahrhunderte sodann auch zu komplexen Theorien haben verarbeitet werden können, in denen sich die verschiedenen Forschungsansätze und -ergebnisse in einem gemeinsamen Basisvokabular präsentieren lassen. Die Bezugnahme auf den gemeinsamen Gegenstand hält so die forschungsmoralische Grundorientierung lebendig, das in den einzelnen naturwissenschaftlichen Disziplinen 82 Erarbeitete methodisch zu homogenisieren. Es ist diese Bemühung, die letztlich das in den Einzelwissenschaften ausmacht, was man die eigentliche "philosophische" – da fächerübergreifende – Dimension nennen könnte und – wie wir meinen – auch nennen sollte. Es ist eben diese Grundorientierung, die den "Kulturwissenschaftlern" weitgehend fehlt. Sie fehlt nicht zuletzt deshalb, wie wir glauben, weil hier bestimmte wissenschaftliche Positionen ein wesentlich höheres Ausmaß an Permeabilität gegenüber bestimmten weltanschaulichen Positionen ausweisen, als das in den Naturwissenschaften der Fall ist, denen ja im Verlaufe ihrer Geschichte ähnliche schmerzhafte Erfahrungen gleichfalls nicht erspart geblieben sind. Das soll hier allerdings nicht in seinen moralischen Dimensionen diskutiert werden. Denn das Problem liegt auf dem Felde der kulturwissenschaftlichen Forschung anders: Es ist ein geistesgeschichtliches Faktum, daß die Kulturwissenschaften heute mehr denn je in ein breit gefächertes Spektrum von Einzeldisziplinen zerfallen, die nicht durch eine alle diese Einzeldisziplinen übergreifende Fragestellung zusammengehalten werden. Und es ist dieses Faktum, mit dem man sich zunächst einmal auseinanderzusetzen hat: das Faktum der kulturwissenschaftlichen Desintegration. Hierbei ist es aber, wie uns scheint, ziemlich müßig, das zu bedauern oder anzuprangern oder aber aus der Not in trotziger Weise eine Tugend zu machen, wie wir das ganz sinnfällig in den phänomenologischen, existenzialphilosophischen und hermeneutischen Tradititonen unserer Fächer erleben können. Die methodologische Diskussion insbesondere der kulturwissenschaftlichen Grundlagenforschung ist übervoll von Klagen und Verteidigungen, und wir glauben nicht, daß es lohnenswert ist, diesem Klagespektrum eine weitere Variante hinzuzufügen. Nach unserem Dafürhalten muß sich das Problem auf einen zentralen Punkt bringen lassen, der sich mittels der folgenden Fragestellung wiedergeben läßt: Ist es prinzipiell möglich, auch in den sog. "Kulturwissenschaften", in denjenigen Wissenschaften also, die sich mit dem mannigfaltigen Spektrum dessen zu befassen haben, was dem Menschengeschlecht gemeinsam ist, ihre "kulturelle" Dimension nämlich, eine diese "kulturwissenschaftlichen Einzeldisziplinen" übergreifende Fragestellung zu erarbeiten, die in ähnlicher Weise wie in den Naturwissenschaften zu entsprechenden übergreifenden "Theorien" führen könnte, oder ist das prinzipiell unmöglich, weil sich der Gegenstandsbereich der Kulturwissenschaften einer solchen "wissenschaftlichen Problemstellung" im strengen Sinne entzieht? Es ist klar, daß damit ins Zentrum der Aufmerksamkeit die Frage rückt, was in diesem Zusammenhang das Begriffsgefüge "kulturwissenschaftliche Theorie" eigentlich besagt – oder genauer: eigentlich besagen kann. Und weiter: Was kann hier heißen: wissenschaftliche Problemstellung? Was kann hier "Theorie" überhaupt heißen? Welches ist der Gegenstandsbereich "Kultur" und was kann in diesem Zusammenhang "Kulturwissenschaft" heißen? Vor allem aber wird damit ins Zentrum der Aufmerksamkeit das Problem des Verhältnisses zwischen dem Modus der kulturwissenschaftlichen Begriffskonstruktionen und den Formen des empirischen Validierens der mittels dieser Begriffskonstruktionen gebildeten Theorien und Hypothesen gerückt. Es ergibt sich die folgende Alternative: Entweder lassen sich die Kulturwissenschaften in genau demselben Sinne als Erfahrungswissenschaften stricto sensu konzipieren wie die Naturwissenschaften, so daß sie, wie diese auch, zerfallend in konstruktiv-selektive Partialkonzeptualisierungen der "kulturellen Wirklichkeit", in einem konsequent erfahrungswissenschaftlichen Sinne organisiert werden können, oder aber das ist nicht der Fall, weil sich dann z. B. – dies wäre ja denkbar – nur relativ 83 triviale Bereiche der kulturellen Dimension der menschlich-gesellschaftlichen Wirklichkeit dem wissenschaftlichen Zugriff erschließen, woraus folgt: Zwar stellen die Kulturwissenschaften ebenso wie die Naturwissenschaften konstruktivselektive Partialkonzeptualisierungen der Wirklichkeit dar – denn diesem Kriterium genügt trivialerweise eine Vielzahl anderer begrifflich präzisierter Kognitivgebilde –, jedoch präsentieren sich ihre Propositionalgebilde (Hypothesen und Theorien) gerade nicht vornehmlich wie in den strengen Naturwissenschaften im Assertionalmodus und ihre linguistischen Rahmenwerke erfahren keineswegs vornehmlich immer nur dann wesentliche semantische Umorientierungen, wenn gegenstandskonstituierende empirische Hypothesen effektiv falsifiziert worden sind. Denn das genau ist in den Naturwissenschaften der Fall. Wesentliche semantische Umorientierungen erfahren die linguistischen Rahmenwerke der Kulturwissenschaften demgegenüber vielmehr vornehmlich immer dann, wenn sich – aus welchen Gründen auch immer – wesentliche kognitive Umorientierungen in den Weltbildstrukturen sozialfigurativ verdichteter "Lebensformen" ergeben. Wir können diese Fragestellung als die im eigentlichen Sinne erkenntnistheoretische Dimensionierung der Frage nach der "Einheit der Kulturwissenschaften" umschreiben. In dieser Form war das Problem der kulturwissenschaftlichen Integration thematischer Schwerpunkt dessen, was gemeinhin "Neukantianismus" genannt zu werden pflegt. Und in diesem Sinne fragte Rickert auch nach den "Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung" und arbeitete zum Behufe einer erkenntnistheoretischen Antwort auf diese Frage eine ganz bestimmte Begriffstheorie aus, die sodann in Cassirers "Substanzbegriff und Funktionsbegriff" einer massiven Kritik unterzogen wurde.“ In diesem – forschungsprogrammatischen – Sinne nunmehr der nachstehende „wissenschaftstheoretische Thesenkatalog“. 3. 2. Ein wissenschaftstheoretischer Thesenkatalog 1. Wissenschaften, die sich der griffigen Formel des einstigen Münchner Erkenntnistheoretikers Wolfgang Stegmüller zufolge unter dem Oberbegriff der „rationalen Formen der Wahrheitssuche“ zu einer Einheit zusammenfassen lassen, zerlegen sich arbeitsteilig in normative Wissenschaften (Ästhetik, Ethik, Rechtswissenschaft), in formale Wissenschaften (Mathematik, Logik), in Erfahrungsbzw. Wirklichkeitswissenschaften und in sog. „angewandte Wissenschaften“.91 Vor allem die Erfahrungswissenschaften sind es, die uns hier interessieren, liefern uns diese doch in erster Linie diejenigen „Erkenntnisinstrumente“, mittels derer wir die 91 Vgl. hierzu das Tafelbild in dem Abschnitt II. 5. 1. und dessen Erläuterung. 84 natürliche wie soziale Welt, in der wir leben, rational durchzukonstruieren und vernünftig umzugestalten im Stande sind, wobei wir im Zuge dieser vernunftgeleiteten Tätigkeiten permanent Neues „an“ und „in“ unserer Welt entdecken bzw. zu entdecken hoffen. Erkennen, Entdecken, wahrheitsfähig beschreiben, Erklären und sinnvoll bzw. vernünftig verändern designieren gewissermaßen die Systemziele wissenschaftlichen Handelns und dafür eben bedarf es ganz bestimmter Instrumente oder auch Erkenntnisinstrumente. Diese „Erkenntnisinstrumente“ nennen wir erfahrungswissenschaftliche Theorien. 2. Ehrfahrungswissenschaftliche Theorien (wie z.B. die Psychoanalyse), welche aus allgemeinen Hypothesen bestehen, haben also vor allem die Aufgabe empirische Tatbestände zu beschreiben und zu erklären. So diagnostiziert beispielsweise ein Psychoanalytiker das Auftreten einer schweren Lähmung als konversionshysterisches Syndrom und erklärt dieses mittels der Neurosentheorie, indem er die Erscheinungsform genau dieser Konversionshysterie – das ist die Art und Weise, wie sich diese Konversionshysterie in dem beobachtbaren Verhalten des Patienten manifestiert – ganz bestimmten Erlebniszusammenhängen in der frühen Kindheit des Patienten bzw. der Patientin kausal zurechnet.92 Sein streng neurowissenschaftlich kompetenter Kollege diagnostiziert hingegen den gleichen „Befund“ (Lähmung) im Rahmen einer fachsprachlich gänzlich anders gearteten Ätiologie und liefert eine entsprechend anders lautende Erklärung. Wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang zu sein, dass der Neurologe sich bei seiner Diagnose ganz sicher nicht in demselben Umfang auf die historisch-genetische Methode stützt, wie sein mehr psychoanalytisch ausgebildeter Kollege. Interdisziplinäre Forschung hätte zweifelsohne genau hierbei einen ganz anderen Stellenwert für die wirkliche Aufklärung der Lähmungssymptomatik, als z.B. bei den Infektionskrankheiten. Sie wäre, da hierbei notorisch Probleme der Hypothesen- und Theorieintegration auftreten würden, wesentlich mit methodologischen Problemen befasst, denn die beiden in sehr 92 Es macht wie wir sehen werden, den methodologischen Sonderstatus genuin psychiatrischer „Theorie und Praxis“ aus, dass sie anamnestisch immer einen (kausalen) Sinnbogen zu konstruieren genötigt ist zwischen hic et nunc zu diagnostizierender Symptomlage eines Patienten und denjenigen Ereignisklassen, welche in der frühen Kindheit die Erfahrungswelt dieses Patienten geprägt haben (könnten): Psychiatrie ist in genau diesem Sinne strenge Geschichtsforschung. Vgl. hierzu demnächst: Porath, Psychiatrische Historik. Die methodologischen Grundlagen der psychopathologischen Diagnostik, wo eine Interpretation der Ergebnisse der von mir hier vorgelegten Arbeit vorgenommen werden wird. 85 stark voneinander abweichenden Sprachen verfassten Erklärungen dürften sich letztendlich ja nicht widersprechen. 3. Eine wissenschaftliche Erklärung besteht darin, dass verschiedene empirische Tatbestände in einen kausalen Zusammenhang gebracht werden auf der Grundlage streng allgemeiner Gesetzmäßigkeiten (in der Wissenschaftslehre „Hypothesen“ genannt). Das sog. „DN-Schema einer wissenschaftlichen Erklärung“, welches in Gestalt eines „Modells“ diesen Tatbestand abzuspiegeln versucht, wird uns, wie gesagt, weiter unten noch eingehender interessieren. An dieser Stelle halten wir lediglich in apodiktischer Form fest: Tatbestände lassen sich dann und nur dann in dem Sinne erklären, dass sie mit anderen Tatbeständen in ein Kausalzusammenhang gebracht werden, wenn sie in Form einer Satzmenge beschrieben worden sind, die sich aus einer anderen Satzmenge ableiten lässt, die selbst wiederum in zwei Teilmengen zerlegbar ist: in die Teilmenge derjenigen Sätze, welche die „Anfangsbedingungen“ bzw. die „Randbedingungen“ des erklärungsbedürftigen Ereignisses beschreiben, und in die Teilmenge derjenigen Sätze, die aus einer Menge nomologischer, das heißt: gesetzesartiger Hypothesen bzw. einer Theorie besteht. Dieser Punkt ist deswegen von Bedeutung, weil sich natürlich nicht „Tatbestände“ aus anderen Tatbeständen „ableiten“ lassen: Nur Sätze lassen sich aus anderen Sätzen ableiten. Der Begriff der „Erklärung“ bezieht sich also genaugenommen nicht auf „Tatbestände“ sondern auf den Zusammenhang zwischen bestimmten Satzklassen. Näheres hierzu im übernächsten Abschnitt, wo wir uns mit dem sog. „DN-Modell“ bzw. dem „HOModell“ auseinandersetzen werden.93 4. In den Humanwissenschaften ist der Begriff des „(sozialen) empirischen Tatbestandes“ der Oberbegriff für zwei Klassen von Tatbeständen, die, weil sie analytisch auseinander gehalten werden müssen, auch begrifflich geschieden werden müssen: empirisch gesicherte jedoch nicht direkt beobachtbare sozialstrukturelle Tatbestände und der direkten Beobachtung zugängliche Verhaltenstatbestände. Die 93 Wir erhalten damit so etwas wie eine „Funktionsdefinition“ für den Begriff des „Gesetzes“: Eine erfahrungswissenschaftlich gut gestützte Hypothese fungiert als „Quasi-Algorythmus“, mittels dessen sich bestimmte singuläre Satzklassen – das sind Satzklassen, die sich auf singuläre Tatbestände beziehen – aus anderen singulären Satzklassen, die sich sozusagen auf die „Vorgeschichte“ des zu erklärenden Sachverhaltes beziehen, ableiten lassen. Die als „Gesetz“ deklarierte „Hypothese“ erlaubt mithin den Blick in die „Vergangenheit“. Doch das ist nicht alles. Sie erlaubt zugleich den Blick in die „Zukunft“, wie sich leicht einsehen lässt: Mittels ihrer lässt sich ja auch „bei gegebener Sachlage“, die mittels einer Klasse von singulären Sätzen beschreibbar ist, auf die Wahrheit einer – ebenfalls singulären – Satzklasse schließen, die einen bestimmten Tatbestand in der Zukunft beschreibt. 86 Unterscheidung ist aus zwei Gründen bedeutsam: Erstens lassen sich sehr oft sozialstrukturelle Tatbestände in der Sprache ausdrücken, mittels derer Verhaltenstatbestände beschrieben zu werden pflegen, sodass genau dadurch sozialstrukturelle Tatbestände, die sich nicht beobachten lassen, dennoch als empirisch gesichert gelten können, und zweitens werfen manche prima facie „rein“ klinischdiagnostische Fragen in ätiologischer Hinsicht Probleme auf, die sich nur sozialstrukturell und damit eben auch nur makrosoziologisch formulieren lassen. Zur Verdeutlichung zwei Beispiele: a) Die in der berühmten Durkheimschen „Selbstmordstudie“ behauptete sozialstrukturelle Korrelation von „Religionszugehörigkeit“ und „Selbstmordrate“ lässt sich in eine Verhaltenssprache übersetzen, die es gestattet, die in dieser Korrelation auftretenden theoretischen Begriffe so zu operationalisieren, dass die entsprechende Korrelation als empirisch gesichert gelten kann. So ist z.B. der als erklärungsbedürftig angesehene Tatbestand, dass in Ländern mit vorwiegend protestantischer Religionszugehörigkeit die Selbstmordrate erstaunlich hoch, in Ländern mit katholischer Religionszugehörigkeit hingegen die Selbstmordrate erstaunlich niedrig ist, mühelos in die Aussage übersetzbar, dass sich in den Ländern, in denen sehr viele Katholiken leben, erstaunlich wenige Menschen suizidal verhalten. Es ist nicht sehr schwierig, wie mir scheint, sich hierzu entsprechende medizinisch relevante Beispiele auszudenken, und wie man sieht, verbessert sich dadurch ganz automatisch die Präzision der hierbei in Frage kommenden Erklärungen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn man, wie es ja der Regelfall ist, weitere Variablen hierbei einzubeziehen gezwungen ist. Auf diese Weise kann nämlich dass, was von vorneherein als erklärungsbedürftig keineswegs so klar ist, wesentlich genauer formuliert werden. Auch hierfür ein Beispiel: Nehmen wir an, die als empirisch gesichert geltende Korrelation zwischen Religionszugehörigkeit und Suizidaldisposition werde durch die weitere Variable „Tabakgenuss“ verzerrt, sodass die jeweiligen kausalen Abhängigkeiten keineswegs mehr so eindeutig sind, wie es zunächst den Anschein hat, dann wäre die „Übersetzbarkeit“ genau dieser sozialstrukturellen Korrelationsaussage in entsprechende Aussagen, welche die Rauchgewohnheiten von Individuen einbeziehen, von sehr großer Bedeutung. Nur so ließe sich nämlich dann eine zunächst einmal lediglich statistisch 87 gesicherte Korrelation in eine echte Kausalhypothese überführen, welche z.B. wichtig sein könnte Selbstmordgefährdeten. für die Durch therapeutische diese Betreuung „Übersetzbarkeit“ von könnten kausalrelevante Tatbestände herausgearbeitet werden, welche durch die rein sozialstrukturelle Fassung des Problems verborgen geblieben wären. Usw. Usw. Ich brauche dies hier nicht weiter fortzusetzen. b) Hierbei denke ich an die seinerzeit in dem von Kranz und Heinrich herausgegebenen Sammelband „Schizophrenie und Umwelt“ zusammengestellten Befunde von Heinrich, J.H. Kretschmar, Chr. Kretschmar und H. Fassl [Soziale Faktoren und klinische Befunde], Berner u. Naske [Pathoplastische Faktoren], Deppe [Sozialökonomische Strukturen], Abholz, Hippius u. Lange [Arbeitssituation] und Degkwitz u. Schulte [Sozialer Status], in denen eine sehr hohe Korrelation nachzuweisen versucht worden ist zwischen Schichtenzugehörigkeit und ausgeprägter Vulnerabilitätsdispopsition. Wie die anderen Arbeiten in diesem Sammelband sodann nachzuweisen versucht haben, ergaben sich aus der Frage, ob sich diese für eine eventuelle Ätiologie der sog. „Schizophrenien“ relevante „Schichtenabhängigkeitsthese“ empirisch erhärten ließe oder nicht, erhebliche Konsequenzen für die Diagnostik, Anamnese und Therapie: Während klassisch-neurotische Vulnerabilitätsdispositionen mehr in den „bürgerlichen“ Sozialisationsmilieus anzutreffen seien, ließen sich – so wurde behauptet – überproportional psychotische Vulnerabilitätsdispositionen in den „klassischen“ Arbeiterschichten nachweisen. Diese erwiesen sich dann als hartnäckig gesprächstherapieresistent. Insbesondere dieser zuletzt genannte Punkt weist zurück auf die in dieser Arbeit thematisierte Problematik, wie wir anhand des therapeutischen Mediums „Gespräch“ mühelos erkennen können. Mich interessiert natürlich nicht, ob und inwiefern sich die seinerzeitigen Forschungen in der Folgezeit bewährt haben, zumal die Konstruktion von Indikatoren für Schichtendifferenzen methodisch ohnehin ein Kapitel für sich ist. An dieser Stelle kommt es mir vielmehr wesentlich auf die hier ja ins Auge springende methodologische Problemlage an, welche mit dieser „Schichtenabhängigkeitsthese“ konnotiert ist: Ich will den notwendigen Zusammenhang zwischen genuin empirischen, genuin theoretischen, genuin erkenntnistheoretischen und genuin klinisch-therapeutischen Problemfeldern hervorheben, mit denen man unabdingbar 88 konfrontiert ist, soll sich „Grundlagenforschung“ fruchtbringend mit „Klinik“ zum einen interdisziplinär-kooperativ zum anderen theorie-integrativ verbinden. Ich wiederhole deshalb, was ich bereits im „Relevanzabschnitt“ des Einleitungskapitels betont habe: Meine (grundsätzliche) Position in dieser Frage soll zumindest in Ansätzen plausibel werden (können). 5. Zwischen sozialwissenschaftlichen Theorien und den sog. „Sozialtheorien“ muss, wie insbesondere Lepsius und Topitsch nie müde geworden sind, zu betonen, scharf unterschieden werden. Ich erweitere hier das zu diesem Problem im Einleitungsabschnitt („Forschungsstand“) bereits gesagte. Eine solche Unterscheidung ist um so notwendiger, als in erkenntnistheoretischer bzw. erkenntnissoziologischer Hinsicht den Sozialtheorien dieselbe Funktion zukommt wie den sozialwissenschaftlichen Theoriegebilden: Beiden eignen Erklärungs- und damit eben auch Sinnstiftungsfunktionen, beide konstruieren Kausalzusammenhänge. Der Unterschied ist ein erkenntnistheoretisch-methodologischer, kein ontologischer. Sozialtheorien eignet eine direkte alltagspraktische Bedeutung, denn sie fungieren als Systeme der sozialen Orientierung, wohingegen den sozialwissenschaftlichen Theorien in reiner Form eine ausschließlich erkenntnisfunktionale Bedeutung zukommt. Konsequent applikativ gewendet allerdings unterscheiden sie sich nicht voneinander. Die Systeme der sozialen Kontrolle der sozialen Welt, in der wir leben, beinhalten beispielsweise Sozialtheorien, welche personale Identitäten als rollenübergreifende und positionenjenseitige Habitualprofile fingieren, wir jedoch als Sozialwissenschaftler haben zu überprüfen, ob und inwiefern solche „Theorien“ auch haltbar sind, und wir müssen Theorien konstruieren, welche streng wissenschaftlich zu erklären imstande sind, warum sich manche Sozialtheorien im gesellschaftlichen (Real-) Geschehen hartnäckig halten, obwohl sie mittlerweile aus wissenschaftlicher Sicht als obsolet angesehen werden können müssen. Etwas schlagwortartig ausgedrückt: Entschließen wir uns, bestimmte Theoriegebilde, seien diese nun „wissenschaftlich“ oder „sozialpraktisch“, auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen, so müssen wir sie in Gestalt streng allgemeiner logisch kohärenter Systeme von Allsätzen formulieren und behandeln sie so als sozialwissenschaftliche Theorien, völlig unabhängig davon, wie primitiv sie auch gebaut sein mögen: Als sozialtheoretisches Fragment ist die Formel „gleich und gleich gesellt sich gern“ eine lebenspraktische Orientierungs[binsen?]weisheit, welche manchmal zutrifft oder auch 89 nicht, als sozialwissenschaftliches Theoriefragment hingegen ist sie, als streng allgemeiner wahrheitsfähiger Allsatz gefasst, falsch. 6. In der kulturwissenschaftlichen Grundlagenforschung, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts durch die Kontroverse um die Frage nach der methodischen Einheit der Erfahrungswissenschaften geprägt ist, werden von „geisteswissenschaftlicher“ Seite zwei Klassen von Erklärungen unterschieden: Funktionalerklärungen und Kausalerklärungen. Mit Redlich und Freedman und auf der Grundlage des „Dossenheimer Forschungsprogramms“ bestreite ich die Berechtigung einer solchen Unterscheidung.94 Wie zunächst einmal Nagel und sodann vor allem Stegmüller hat zeigen können, lassen sich Funktionalerklärungen mittels bestimmter logischer Operationen in strenge Kausalerklärungen umformen. 7. Gegenüber einer solchen Unterscheidung zwischen Kausalerklärungen und Funktionalerklärungen muss allerdings auf eine andere Form der Unterscheidung aufmerksam gemacht werden. Wir müssen scharf unterscheiden zwischen jener Klasse von Erklärungen, die sich auf singuläre Tatbestände beziehen, und jener Klasse von Erklärungen, die sich auf allgemeine Tatbestände beziehen, denn hier liegt der eigentliche Kern des sog. „Integrationsproblems“. Es macht einen Unterschied aus, ob man die von Durkheim beschriebene Korrelation „Selbstmordrate und Religionszugehörigkeit“ erklären möchte, oder ob man erklären möchte, dass und warum sich ein ganz bestimmtes Individuum zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt an einem ganz bestimmten Ort umgebracht hat oder aber dass und warum sich sehr viele Individuen, die einer ganz bestimmten Religion angehören, umgebracht haben. Trotz der Bedeutungsüberschneidung, die hier auftritt, und trotz der weiter oben genannten „Übersetzbarkeit“ sozialstruktureller Aussagen in „Verhaltensaussagen“ sind diese beiden Aussagenklassen nicht in striktem Sinne „deckungsgleich“. Ob und inwiefern sie es sind, ist – wie bei jeder Übersetzung, die das sog. „hermeneutische Kernproblem der Deutung“ beinhaltet – ein Problem der Interpretation, ein Problem der Texthermeneutik eben.95 94 Vgl. hierzu den Abschnitt II. 5. 6. 95 Wie die demnächst veröffentlichte Arbeit meiner Kollegin Tatjana Schaaf [Macbeth] sehr schön zeigt, ergeben sich die hierbei relevanten Probleme der „Deutung“ und der „Interpretation“ vor allem bei den sog. „Quellentextübersetzungen“, bei denen es ja in ganz besonderem Maße auf „Bedeutungstreue“ ankommt. Diese ist bei Übersetzungen immer nur – und zwar aus prinzipiell methodische Gründen, die nicht durch Übersetzervirtuosität kompensiert werden können – annähernd möglich. Denn es gilt ja die texthermeneutische Grundregel: Jede Übersetzung ist in Wahrheit eine Interpretation. 90 8. Begriffe („Konzepte“, „Konstrukte“, „Termini“) sind, weil sie die wesentlichen Bestandteile von Hypothesen sind, zugleich auch die wesentlichen Bestandteile von Theorien. Bildet man mit diesen Begriffen (Identität, Identitätskrise, Identitätsdiffusion, Familie, Rollenstruktur, Delinquenz, abweichendes Verhalten, soziale Kontrolle etc.) allgemeine Aussagen, dann ergeben sich die wesentlichen Sätze einer Theorie, Hypothesen genannt, mit deren Hilfe sich empirische Tatbestände beschreiben und erklären lassen. Eine erfahrungswissenschaftliche Theorie ist idealiter ein widerspruchsfreies System von logisch zusammenhängenden Aussagen/Sätzen. 9. Der entscheidende Punkt um den es in diesem Zusammenhang hier geht ist der folgende: Begriffe als solche können nicht „wahr“ oder „falsch“ sein, dies können nur die aussageartigen Hypothesen. Ebenso wie der Begriff der Ableitung oder der der Erklärung nur Sinn macht in bezug auf Aussagen bzw. auf Sätze, machen auch die Begriffe „wahr“ und „falsch“ nur Sinn in bezug auf Sätze und Satzklassen. Dies zu betonen ist mir ganz besonders wichtig, weil sehr viele Arbeiten, die sich auf die sog. „emotiven“ Aspekte des primordialen Sozialisationsgeschehens beziehen, mit einer anthropomorphistisch-metaphorischen Begrifflichkeit operieren, ohne dass der Versuch gemacht wird, diese Begrifflichkeit in scharfe Begriffskonstruktionen zu transformieren und mittels dieser sodann explanative Aussagen zu formulieren. Denn Begriffskonstruktionen bzw. die sog. „Idealtypen“ können zwar niemals „wahr“ oder „falsch“ sein, jedoch können sich Begriffe für die Konstruktion von Aussagensystemen („Theorien“) mehr oder weniger gut eignen. Ob dies freilich der Fall ist, ist erst dann entscheidbar, wenn die Bedeutung dieser Begriffe hinreichend klar gemacht worden ist und sodann mittels dieser „scharfen“ Begriffe die Aussagen einer Theorie formuliert worden sind, oder auch: wenn die mit Hilfe bestimmter Begriffe gebildeten Hypothesen zu einer Theorie zusammengestellt worden sind. Dies zu entscheiden ist gleichwohl ein manchmal sehr mühseliges Geschäft, wie wir anhand der jeweiligen Interpretation der in Abschnitt II. 8. 2. vorgestellten „Rationalitätskataloge“ sehen werden. Es ergibt sich mithin: Theorien können unterschiedlich gut empirische Zusammenhänge erfassen, beschreiben und erklären. Und ein Kriterium ist eben in diesem Zusammenhang das weiter unten zu behandelnde Kriterium der scharfen Begrifflichkeit. 10. Das hier ja vorläufig nur sehr grob angesprochene „Begriffsproblem“ beinhaltet sehr viele methodologisch nach wie vor extrem fragwürdige Facetten, wie wir vornehmlich in den weiter unten behandelnden „Rationalitätskatalogen“ sehen werden. Eine dieser 91 Facetten betrifft das Verhältnis zwischen klassifikatorischen begrifflichen Schemata, wie wir sie anhand der „Tafelbilder“ kennenlernen werden, und den Komparativierungen von Begriffen, welche notwendig werden, wenn entschieden werden soll, ob es sich bei einer bestimmten „Aussage“ um eine „Definition“, eine „Arbeitsdefinition“, ein „idealtypisches Konstrukt“, um eine „Grundannahme“ oder aber um eine wahrheitsfähige empirisch falsifizierbare Hypothese handelt bzw. handeln soll: Komparativierungen von klassifikatorischen Begriffen und begrifflichen Schemata sind die notwendigen Voraussetzungen dafür, dass die fraglichen Begriffe in operative Begriffe umgewandelt werden können, und dies wiederum ist umabdingbar für die Gewinnung empirisch falsifizierbarer Hypothesen, welche ja die „tragenden Teile“ von Theorien bilden, mittels derer Kausalzusammenhänge beschrieben und erklärt werden sollen. Und der für uns hier ins Zentrum gestellte entscheidende Aspekt genau dieser Problematik lässt sich nunmehr in einer apodiktischen methodologischen Grundaussage formulieren: Es ist prinzipiell ausgeschlossen, eine Ätiologie irgendeiner Mentalerkrankung entwickeln zu wollen, die nicht auf einer ganz bestimmten empirisch falsifizierbaren Theorie des Sozialisationsgeschehens beruht woraus sich trivialerweise ergibt: Sage mir, wie Deine Sozialisationstheorie aussieht, und ich sage Dir, wie viel Deine Ätiologie, Deine Anamnestik, Deine Diagnostik und Deine Prognostik taugt. Ich lege entschiedenen Wert darauf festzuhalten, dass ich genau diese Aussage, als die eigentliche Grundaussage jedweder Sozio-Psychiatrie verstanden wissen will, die es sich zum Anliegen macht, psychosoziale Medizin als ein Forschungsprogramm etablieren zu wollen. 11. Auf ein sehr schwieriges wissenschaftstheoretisches Problem, welches indirekt mit der idealtypologischen Methodik zusammenhängt und als bislang ungelöst aufgefasst werden muss, muss an dieser Stelle zumindest hingewiesen werden, steht es doch ebenfalls in einem sehr engen Zusammenhang mit dem „Integrationsproblem“. Es betrifft die Relation zwischen der Basalterminologie einer Erfahrungswissenschaft und den mittels dieser Basalterminologie gebildeten Hypothesen- und Theoriensystemen: Obwohl strikt daran festgehalten werden muss, dass nicht die begrifflichen Gebilde einer Wissenschaft als solche, sondern nur die mittels derselben formulierten Hypothesen oder Theorien „wahr“ oder „falsch“ sein können, eignet ganz bestimmten begrifflichen Konstruktionen – den sog. „Idealtypen“ nämlich – eine aussagenartige (linguistische) Struktur: Ihr „Gehalt“ lässt sich in Form von streng allgemeinen 92 Allsätzen wiedergeben, jedoch eignet ihnen gerade nicht irgendein empirischer Gehalt. Die Entscheidung, ob es sich bei einem bestimmten Gefüge von „Annahmen“ um eine wesentlich begriffliche oder aber um eine wesentlich gesetzesartige Systematik handelt, ist eine Interpretationsfrage, die sich, wie wir insbesondere, bei unserer Arbeit an den „Rationalitätskatalogen“ sehen werden, nicht immer leicht entscheiden lässt. Wir werden in der vorliegenden Arbeit deshalb dennoch immer wieder scharf zu unterscheiden haben zwischen den „Grundannahmen“ einer Wissenschaft und ihren „Haupthypothesen“: Erstere sind die explizit gemachten Voraussetzungen einer Argumentationsstruktur und repräsentieren in den jeweiligen Wissenschaftskonzeptionen deren jeweils nichtfalsifizierbares begriffliches Gerüst, welches sich in den Humanwissenschaften in der Regel auf ein bestimmtes Menschenbild bezieht, letztere hingegen repräsentieren bestimmte, zu Theorien „zusammengestellte“ empirisch falsifizierbare Mengen von Hypothesen.96 12. Ein damit zusammenhängendes weiteres sehr schwieriges wissenschaftstheoretisches Problem ergibt sich, wenn man Begriffe und Hypothesen aus verschiedenen F a c h d i s z i p l i n e n (Soziologie, Psychologie, Sozialpsychologie) zu neuen umfassenderen Theoriegebilden zusammenzustellen versucht: Wie ja ganz besonders sinnfällig an der Weberschen „Soziologiedefinition“ abgelesen werden kann, definiert eine Fachwissenschaft ihren Gegenstandsbereich, so dass bei der Verknüpfung von Termini verschiedener Fachdisziplinen nicht kompatible Wirklichkeitsbereiche zu einer Einheit zusammengefasst zu werden drohen. Hier kommt sozusagen das in der Wissenschaftslehre bislang nicht aufgeklärte Problem des Verhältnisses zwischen den 96 Das Problem der präzisen Unterscheidbarkeit zwischen (nicht falsifizierbaren) Grundannahmen und eigentlichen Hypothesen, ist sozusagen ein „methodologischer Dauerbrenner“ aller texthermeneutisch verfahrenden Arbeiten, denen es darum geht, den Erkenntnisgehalt und damit auch die noch gegenwärtig aktuellen theoretischen wie empirischen Prinzipien z.B. einer klassischen philosophischen Abhandlung herauszuarbeiten. Die Dissertation meines Kollegen Rainer Ostermann [Individuum], die sich mit der Frage einer im Prinzip empiriefähigen Rekonstruktion der Freiheitsproblematik in den Staatsschriften W.v.Humboldt’s befasst, belegt dies sinnfällig. Gravierende Bedeutung hat genau dieses Problem erlangt bei der Dissertation [Weltbühne] meines Kollegen Christian Schönleben, der sich mit einer texthermeneutisch „korrekten“ Deutung der berühmten „Vorwortstelle“ zu Marx’schen „Kritik der politischen Ökonomie“ abgeplagt hat. Hierzu sind ja auch die politisch-praktischen Konsequenzen, die sich aus einer solchen „Klassiker-Exegese“ ergeben, ganz besonders brisant. Porath ist der Auffassung, dass sich die hierbei aufgeworfene Problematik letztendlich nur über den Umweg einer Deutungsmethode lösen lässt, die sich an der Feininterpretation sog. „paradigmatischer Umorientierengen“ in der Evolution der modernen Naturwissenschaften „abarbeitet“. Vgl. hierzu die entsprechenden Passagen im [Forschungsantrag]. 93 idealtypologisch konstruierten Basalbegrifflichkeiten einer „Wissenschaft“ und den mittels dieser Begrifflichkeiten erstellten falsifizierbaren Hypothesen „zum Schwur“.97 13. In der vorliegenden Arbeit versuche ich nun, Begriffe und Aussagen verschiedener wissenschaftlicher Theorien so zusammenzustellen, dass sich vielleicht bessere Formen der Erklärung von abweichendem Verhalten ergeben könnten. Dann und nur dann nämlich lässt sich entsprechend Mut aufnehmen, um das hier ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückte Problem einer psychiatrierelevanten empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie endlich auch forschungspraktisch angehen zu können. Aus diesem Grunde bin ich gezwungen meinen Anspruch einzuschränken: Geprüft werden soll lediglich die prinzipielle Anwendbarkeit der mit der Identitätsproblematik assoziierten Konzepte für eine mögliche Erhöhung der Erklärungskraft bestehender Theorien abweichenden Verhaltens. Ich weise jedoch expressis verbis darauf hin, dass dies tatsächlich nichts mehr als eine vorläufige Notlösung sein kann. Damit will ich meine Arbeit nicht gegenüber Kritik immunisieren. Ganz im Gegenteil: Vielleicht ergibt ja der Diskurs zu der in dieser Arbeit entwickelten Thetik Ergebnisse, die uns weiterführen. 14. Ein bestimmter „Ansatz“ zu einer möglichen Lösung des hier ja vorläufig nur ganz grob umschriebenen Problems der Theorieintegration liegt allerdings in jenem faszinierenden Konzept vor, welches „symbolischer Interaktionismus“ genannt wird: Insbesondere der Meadsche „Identitätsansatz“ scheint, obwohl bislang in empirischer Hinsicht nicht gut genug präsentiert, dennoch die Möglichkeit zu enthalten, Mikrosoziologie und Psychologie dergestalt „zusammenzubinden“, dass das in den Punkten 9, 10, 11, 12 und 13 beschriebene wissenschaftstheoretische Problem in dieser Form gar nicht auftritt. Ich habe deshalb weiter oben anlässlich der Strykerschen Ergänzung der Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“, wo tatsächlich Grundannahmen aus verschiedenen Paradigmata widerspruchsfrei haben zusammengestellt werden können, genau diesen Gedanken Rechnung zu tragen versucht. 15. Aus den in den zuletzt aufgelisteten Problempunkten sich ergebenden Gründen ist deshalb der in vielen Untersuchungen gebräuchliche Begriff der „Einbindung“ 97 Zu einer möglichen Lösung dieses Grundproblems der gesamten modernen Wissenschaftslehre vgl. den Antrag zur Bewerbung für den kulturwissenschaftlichen Forschungspreis des Landes Nordrhein-Westfalen [Forschungsantrag]. In Punkt 22 dieses „wissenschaftstheoretischen Thesenkatalogs“ komme ich hierauf noch einmal zurück. 94 methodologisch extrem fragwürdig, da er nur metaphorische Bedeutung haben kann. Und auch die Verwendung der Begriffe „Konzept“, „Theorie“, „Ansatz“, „Modell“ etc., erfolgt nachstehend nicht vollständig nach Maßgabe der Prinzipien der strengen Wissenschaftslehre, die ja eine sich immer mehr spezialisierende und ihre Begrifflichkeiten verfeinernde strenge Wissenschaft geworden ist. Jedoch bin ich, wie bereits mehrfach betont, der Auffassung, dass eine jegliche wissenschaftliche Abhandlung dergestalt durchstrukturiert sein sollte, dass damit gewissermaßen die Karten auf den Tisch gelegt werden. Es kann dann nämlich geprüft werden, welchen Anspruch eine Arbeit hat und ob dieser Anspruch bei der Durchführung der Arbeit sich als gerechtfertigt erweist. In genau diesem Sinne verwende ich als „Erkenntnisinventar“ die hier aufgeführten Begrifflichkeiten („Theorie“, „Hypothese“, „Erklärung“, „Prognose“ etc.) und achte lediglich darauf, dass sich nichts falsches einschleicht. Auf die z.T. exorbitant schwierigen wissenschaftstheoretischen Nachfolgerprobleme, die sich aus meiner hier vorgetragenen „Thetik“ ergeben, kann ich, da mir für deren Detailbearbeitung ganz einfach die entsprechende Kompetenz fehlt, nur immer wieder hinweisen. 16. Es sind mithin – zusammenfassend gesagt – vornehmlich drei prekäre Problembereiche aus der sog. „strengen“ Wissenschaftslehre, auf die hier zumindest hingewiesen werden muss, weil sie die Semantik der bisher entwickelten wissenschaftstheoretischen Begrifflichkeiten je nach „Forschungsposition“ spezifisch einfärbt: Erstens das nach wie vor nicht geklärte Problem des Verhältnisses von „Verstehen“ und „Erklären“, zweitens das sog. „Integrationsproblem“, repräsentiert vor allem durch die Frage, ob das „Reduzierbarkeitsprogramm“ der in der strengen Wissenschaftslehre erarbeiteten „Erklärungsproblematik“ haltbar ist oder nicht, und drittens die Frage nach dem Verhältnis zwischen den sog. „theoretischen Begriffen“ und den „Beobachtungsbegriffen“. 17. Bezüglich des ersten und des zweiten Problems kann die vorliegende Arbeit, wie bereits mehrfach hervorgehoben, nur indirekt Stellung nehmen bzw. zu deren möglicher Lösung etwas beitragen, während bezüglich des dritten Problems sich ein etwas anderer Sachverhalt ergibt, der aus der hier favorisierten Stellung der sog. „Rollentheorie“ resultiert: Devianz ist beobachtbar und sowohl behavioral als auch „rollenverbal“ beschreibbar. Ja noch mehr: Ein sehr großer Teil der z. B. von Freud mitgeteilten Verhaltensauffälligkeiten tritt in ganz bestimmten rollenstrukturell präzise beschreibbaren Handlungskonfigurationen auf. Man denke nur an die dem Publikum 95 auffällig werdenden Fehlleistungen in ganz bestimmten Kommunikativkonfigurationen. Deshalb gilt: 18. Es muss zumindest analytisch scharf unterschieden werden zwischen Begriffen, die sich auf „Beobachtbares“ beziehen, und Begriffen, die sich auf prinzipiell nicht Beobachtbares beziehen, ein Postulat, welches völlig unabhängig von der Schwierigkeit gilt, dass sich im Einzelfall eine solche Unterscheidung auch immer faktisch durchführen und demonstrieren lässt. Also: 19. Zentral: Die in der Freud’schen „Psychopathologie des Alltagslebens“ analysierten „Fehl- und Symptomhandlungen“ sind behavioral beschreibbar, und indem man die jeweiligen Handlungskontexte berücksichtigt, in denen sie auftreten, sind sie rollenstrukturell identifizierbar. Aus genau diesem Grunde liefert die in dieser Arbeit vorgenommene rollenstrukturelle Ergänzung der Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“ ein Beobachtungsbegrifflichkeiten, hinreichend mittels derer umfassendes Arsenal „Brückenhypothesen“ von zwischen Soziologie und Psychologie formuliert werden können. 20. Abschließend noch einmal der eigentliche neuralgische „Syndromherd“ meiner hier vorgeführten Argumentation. Er betrifft zum einen die für das hier vorgestellte Anliegen der Konstruktion einer psychiatrierelevanten Sozialisationstheorie schlechterdings vitale Frage nach der Struktur und Funktion kognitiv-evaluativer Sinnkonstruktionsschemata (dies der Punkt 21), zum anderen die engstens damit zusammenhängende Frage nach dem Verhältnis zwischen den basalterminologischen Grundlagen einer Wissenschaft und den mit deren Hilfe zu erstellenden Theoriekonstruktionen, die ja ganz wesentlich dem Kriterium der „empirischen Prüfbarkeit“ zu genügen haben (dies der Punkt 22): 21. Eines der wichtigsten Probleme in den erkenntnistheoretischen Grundlagen sowohl der beobachtend-experimentellen als auch der historisch-empirischen Sozialforschung betrifft, wie bereits weiter oben angedeutet, die Frage nach dem Verhältnis zwischen den im eigentlichen Sinne erfahrungswissenschaftlichen Theorien, wie sie weiter oben beschrieben wurden, und den sog. (zumeist noch sehr stark in „Umgangssprache“ abgefassten) „Sozialtheorien“, wie wir sie weiter unten in den Blick nehmen werden. Das hiermit angesprochene Problem ist gleichbedeutend mit dem Ideologieproblem, und es muss gesehen werden, dass sich für eine mögliche Lösung genau dieser Problematik erst mit dem Forschungsprogramm zum Intellektuellenproblem, wie es in der Bewerbung für den kulturwissenschaftlichen Forschungspreis entwickelt hat, so 96 etwas wie eine halbwegs tragfähige Diskursgrundlage ergeben hat. Von dieser gehe ich hier aus und werde in diesem Sinne zumindest zum Problem der idealtypologischen Konstruktion eine sehr „engmaschige“ Schrittfolge vorführen, die sich mit dem Rationalitätsproblem befasst. Methodologisch ist dies der Kern meiner Argumentation, der sich, wie mühelos erkennbar sein wird, unmittelbar berührt mit der Frage nach der Geltung des sog. „DN-Schemas einer wissenschaftlichen Erklärung“. 22. Im, wie gesagt, engsten Zusammenhang mit dem zuletzt genannten Problem steht die Frage nach dem Verhältnis zwischen idealtypologisch gefasster Grundbegrifflichkeit und Hypothesenbildung, welches nach Porath‘s Meinung die eigentliche Kernfrage vor allem der sog. Integrationsproblematik ist, und die tatsächlich bis zum heutigen Tage, wie bereits weiter oben betont, ein ungelöstes methodologisches Problems geblieben zu sein scheint. Das hierbei sich ergebende Problem ist wohl nicht zuletzt auch deshalb so schwierig zu fassen, weil es sich wegen des nach wie vor bestehenden sehr niedrigen „Theoretizitätsniveaus“ der bislang erarbeiteten humanwissenschaftlichen Theoriegebilde auf diesem Felde gar nicht sinnvoll diskutieren lässt. Überschärft ausgedrückt: Es bedarf einer methodologischen Feinanalyse der „strukturellen Dynamik“ der strengen Naturwissenschaften, um auf dem Felde der Methodologie der Kultur- und Sozialwissenschaften hierzu überhaupt etwas methodologisch einigermaßen sinnvolles sagen zu können. Vgl. vor allem die hierzu einschlägigen Ausführungen im [Forschungsantrag], die zu zitieren, ich mir hier erlaube, weil sie ja bislang noch nicht in Buchform publiziert sind. Sie scheinen mir jedenfalls die hier avisierte Problemlage zutreffend zu charakterisieren: „Der entscheidende Punkt, um den es hierbei geht“, heißt es dort, „ist, daß die gesamte überkommene Wissenschaftsphilosophie nicht hinreichend scharf zwischen genuin methodologischer und streng wissenschaftstheoretischer Problemstellung hat unterscheiden können, daß dies gleichwohl unabdingbar ist, wenn man sich anheischig macht, eine Heuristik für eine „adäquate“ Logik der Sozialwissenschaften zu erarbeiten, die ich [Porath] mit dem Begriffsgefüge „historische Forschungslogik“ zu umschreiben versucht habe. In thetischer Überschärfung gilt nämlich: Die mit dem „Verwissenschaftlichungsbegehren“ zusammenhängenden methodologischen Probleme der Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaften lassen sich dann und nur dann lösungsfähig formulieren, wenn man zwischen empirisch-assertionaler Wissenschaftsanalyse und normativer Methodologie scharf unterscheidet. Ohne eine solche Unterscheidung kann prinzipiell nicht die Wertfreiheitsfrage gegenüber der Objektivitätsfrage diskriminiert werden. Um einer wissenschaftsanalytisch adäquaten Lösung nicht nur der Integrationsproblematik der Sozialwissenschaften willen sondern ganz allgemein auch um der Objektivitätsproblematik, der Theorieproblematik und der 97 Wertfreiheitsproblematik der Sozialwissenschaften willen schlage ich also vor, den genuin erkenntnistheoretischen Aspekt der derzeitigen Grundlagenproblematik der Geschichts-, Kulturund Sozialwissenschaften zu der folgenden methodologischen (Grund-) Fragestellung zu verdichten: Welcher systematische Zusammenhang besteht zwischen der (idealtypologischen) Konstruktion einer die Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaften übergreifenden Basalterminologie, mittels derer der Gegenstandsbereich der Gesellschaftswissenschaften konstituiert wird, und den Formen des empirischen Validierens der mittels einer solchen Basalterminologie konstruierten Hypothesen und Theorien, die sich in einer wahrheitsfähigen Weise zum einen auf das makrosoziale Gefüge der institutionellen Strukturen der gesellschaftlichen Wirklichkeit und zum anderen auf deren mikrosoziale Strukturen beziehen? Dies, wie ich glaube, die eigentliche, freilich nur sehr mühselig aufzuklärende, (methodologische, nicht materiale) Kernfrage der gegenwärtigen humanwissenschaftlichen Grundlagenforschung, die zunächst einmal das Erklärungsproblem und das mit diesem assoziierte Verstehensproblem ebenso konsequent abschattet wie das materiale Problem der synchronisationalen Dynamik institutioneller Anatomien – das Vergesellschaftsproblem also –, und die vor allem deshalb so mühselig aufklärbar ist, weil sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise die wissenschaftsanalytische Durchdringung der Naturforschung mit der methodologischen Problematik der Geschichts- und Sozialforschung zusammenschließt. Damit jedoch tritt in einer durchaus prinzipiellen Weise das Problem einer systematischen Abklärung des Verhältnisses zwischen genuin normativen und genuin assertionalen Propositionalgebilden auf den Plan, und dies wiederum bedeutet eine Provokation für die bisher erarbeiteten „Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie“ (Stegmüller) selbst: Wenn man Anhaltspunkte dafür gewinnen will, wie die Struktur der gesellschaftswissenschaftlichen Hypothesen und Theorien auszusehen hat, mittels derer historische Tatbestände zu beschreiben und zu erklären sind – dies das Theorieproblem der Geschichtswissenschaft –, wie diese Hypothesen und Theorien empirisch zu validieren sind – dies ein wesentlicher Aspekt des Problems der Historisierung der Soziologie – und wie schließlich die Konstruktion einer die Humanwissenschaften übergreifenden Basalterminologie zu bewerkstelligen ist – dies die Frage nach der den Gegenstandsbereich der Gesellschaftswissenschaften konstituierenden Axiomatik und mithin das (eigentliche) Integrationsproblem –, dann bedarf es dafür vorab der konsequenten analytischen wie empirischen Durchdringung der Naturforschung mit der Zielsetzung, die erkenntnistheoretische Thetik der Prolegomenaperspektive, welche immerhin den nicht zu unterschätzenden Vorzug aufweist, bezüglich der endogenen Dynamik der Naturwissenschaften eine in sich geschlossene Deutung vorgeschlagen zu haben, zu überprüfen. Oder anders formuliert, denn dies ist der eigentliche springende Punkt, um den es erkenntnistheoretisch in der hier vorgelegten Arbeit geht: Um die methodologischen Grundlagen der Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaften erarbeiten zu können, müssen zunächst einmal einige bestätigungsbedürftige, d. h. wahrheitsfähige Hypothesen entwickelt werden, die uns darüber informieren, wie in den strengen Naturwissenschaften Hypothesen und Theorien logisch gebaut sind, wie diese empirisch validiert werden bzw. worden sind und wie dadurch die Konstruktion der die Naturwissenschaften in ihrem Insgesamt übergreifenden Basalterminologie beeinflußt worden ist bzw. nach wie vor wird. Dies der im engeren Sinne wissenschaftsanalytische Kern der hier insgesamt thematisierten Grundlagenproblematik der Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaften, die im traditionellen epistemologischen Sinne als Objektivitätsfrage gestellt worden ist: So und nur so nämlich läßt sich eine Bezugsfolie für eine wesentlich komparative Fassung des Wissenschaftsbegriffs konstruieren, nach Maßgabe derer das Ausmaß an „Wissenschaftlichkeit“ bestimmbar wird, welches den Humaniora möglich ist. Wird jedoch diese Frage genau so gestellt, wie ich sie hier gestellt habe, so impliziert dies, wie unschwer einsehbar ist, eine systematische Revision der in den Prolegomena entwickelten Apriorizitätsargumentation im Lichte einer Analyse des seit der Kantschen Problemstellung in 98 den Naturwissenschaften Geleisteten, die weit über den Ansatz selbst des logischen Empirismus noch hinausgeht: Dann und nur dann, wenn die Frage schlüssig beantwortbar ist, wie es den Naturwissenschaften hat gelingen können, in einer wahrheitsfähigen Weise die Tiefenstrukturen des Wirklichen nicht nur in einer das menschliche Erkenntnisvermögen befriedigenden Form transparent zu machen, sondern überdies dergestalt detailliert aufzuklären, daß tatsächlich in einem bis dahin ungeahnten Ausmaß die natürliche Wirklichkeit technologisch hat verändert werden können, kann erstens der Wissenschaftsbegriff hinreichend präzise expliziert und gegenüber den Prädikativgebilden „Weltbild“, „Theorie“, „Ideologie“ und „Paradigma“ diskriminiert werden , und es kann zweitens sodann auch, so die These, die Lösung des Problems der kultur- und sozialwissenschaftlichen Integration gelingen, welches sich, wie ich in engster Anlehnung an die Kelsensche Postulatorik behaupten werde, in ein analytischempirisches und in ein normatives Problem zerlegt. Erheischt ist nicht weniger als die historisch-empirische Aufklärung der institutionalisierten Bedingungen der Möglichkeit erfolgreicher Emanzipation von der Metaphorik des offenen oder versteckten Anthropomorphisierens, und wenn man aus diesem Blickwinkel die insbesondere von Hans Reichenbach postulierte Verwissenschaftlichung der Philosophie zu realisieren und durchzuhalten versucht, dann bedeutet das auch für die wissenschaftsanalytische wie methodologische Befaßtheit mit den vielfältigen Formen der „rationalen Wahrheitssuche“ die konsequente Verabschiedung von der Metaphorik des anthropozentristischen und anthropomophistischen Denkens.“98 4. Die Psychiatrie als Gegenstand der kultursoziologischen Analyse und als kultursoziologische Disziplin 4.1. Die kultursoziologische Grundlage der Psychiatrie und ein Grunddilemma derselben In ihrem 1966 veröffentlichten und 1970 sodann auch in deutscher Sprache erschienenen Lehrbuch mit dem Titel „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ charakterisieren Redlich und Freedman das „Spezialfach der Psychiatrie“ als eine „angewandte Wissenschaft“ und plädieren dafür, dass diese „Psychiatrie“ zunehmend konsequent „auf das Fundament der biologischen und der Verhaltenswissenschaften gegründet werden“ müsse. Ja, sie geben sogar der Überzeugung Ausdruck, dass in Zukunft eine solche Fundierung der Psychiatrie in den wesentlich biologisch ausgerichteten „Verhaltenswissenschaften“ unabdingbar sei. Der Psychoanalyse komme hierbei der Status einer Basiswissenschaft zu, dies allerdings nur dann, wenn auch sie konsequent biologisch ausgerichtet werde. Damit übernehmen die Autoren 98 Porath [Forschungsantrag], S. 174ff 99 genau dasjenige Freud’sche „Forschungsprogramm“, welches dieser selbst als konsequent naturwissenschaftlich konzipiert hatte: Die Psychoanalyse wird, als „Metapsychologie“ aufgefasst, zur eigentlichen Grundlagendisziplin auch und gerade einer der psychiatrischen Theorie und Praxis verpflichteten Anwendung. Dass die Autoren damit zugleich auch das streng wissenschaftsheoretisch ausgerichtete Erkenntnisprogramm des sog. „methodologischen Individualismus“ übernehmen, eine Position also, die im amerikanischen Kulturraum seinerzeit von Homans vertreten wurde, wird von ihnen nicht gesehen. Zu den Verhaltenswissenschaften im weiteren Sinne werden nämlich von Freedman und Redlich sowohl die Psychologie, als auch die Anthropologie, als auch die Soziologie gezählt. Es ist den Autoren selbstverständlich, die „Soziologie“ als „Verhaltenswissenschaft“ anzusehen und sie machen sich keine Mühe, die dabei involvierten methodologischen Probleme zu diskutieren, die ein solches „antisoziologisches“ Programm nun einmal in sich birgt. Eine solche Erörterung wäre seinerzeit problemlos möglich gewesen, hatte doch insbesondere Homans, ursprünglich als Parson’s-Schüler ein überzeugter Vertreter der sog. „strukturellfunktionalen Schule“, welche, in der Durkheim-Weber-Tradition stehend, ja die scharfe Trennung von „Soziologie“ und „Psychologie“ betonte, mit der Publikation seiner „Elementarformen des sozialen Verhaltens“ seine wissenschaftstheoretische Position vollständig revidiert und damit eine Grundlagendebatte ausgelöst, die praktisch bis zum heutigen Tage andauert. Das für die „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ eigentlich Interessante an dieser Position bestand darin, dass mit ausschließlich wissenschaftsanalytischen Argumenten für eine radikale Reduktion handlungskonzeptionell formulierter soziologischer Hypothesen auf die bis dahin entwickelten „Lern- und Interaktionstheorien“ plädiert wurde, dieses Plädoyer, sich sehr stark auf Befunde der experimentellen Kleingruppenforschung stützend ein Programm für Theorieintegration beinhaltete und eine ziemlich radikale Absage an die überkommene kulturwissenschaftliche Paradigmatik beinhaltete. Von großem Interesse ist genau dieser Punkt vor allem deshalb, weil damit die vormals intensiv geführte Kulturwertdebatte sozusagen „urplötzlich weggeschnitten“ wurde. Dass damit zugleich auch Probleme der pädagogischen wie therapeutischen Zielorientierungen systematisch ausgeblendet wurden, ist praktisch seinerzeit von niemandem bemerkt worden. Vielmehr wurde genaugenommen dadurch ein Forschungsprogramm für die sog. „angewandten“ Wissenschaften entwickelt, welches die traditionelle methodische Zerlegung der „Wirklichkeitswissenschaften“ (Weber) in „wertegebundene Kulturwissenschaften“ und in „nomothetische Naturwissenschaften“ aufzuheben trachtete: Praktisch die gesamte Argumentation der „methodologischen 100 Individualisten“ beruhte auf der seitens der damaligen strengen Wissenschaftslehre entwickelten Postulatorik des sog. „DN-Schemas einer wissenschaftlichen Erklärung“, welche in scharfer Frontstellung gegen die sog. „Methode des Verstehens“ formuliert wurde. Aus diesem Blickwinkel enthielt das bei Redlich und Freedman geltende Erkenntnisprogramm mit ihrer Betonung einer biologisch fundierbaren Psychoanalyse eigentlich eine massive Ungereimtheit, welche methodologisch hätte behoben werden müssen. Den damaligen führenden Köpfen der Analytischen Wissenschaftslehre, auf deren Argumentation sich Homans und seine Anhänger bei ihrem dezidiert vertretenen „Anti-Soziologismus“ stützten, galt nämlich die Psychoanalyse als „unwissenschaftlich“. Es wurde bestritten, dass diese, tatsächlich biologisch „orientiert“ werden könne. Natürlich kann ich die damit aufgeworfene Problematik hier nur sehr grob andeuten. Ich verweise jedoch explizit auf diese Aspekte, weil die Psychiatrie seinerzeit sich durchaus mit den z.B. von Redlich und Freedman gesetzten Schwerpunkten in ihren Grundlagenforschungen in genau diese Debatte hätte einbringen können und müssen, hätten sie sich doch mit genau dieser „Ungereimtheit“ auseinanderszusetzen gehabt: Einerseits hätte sich die von Redlich und Freedman dargelegte „psychiatrische Verhaltensparadigmatik“ auf eine wissenschaftsanalytisch dezidiert exponierte Position durchaus stützen können, andererseits hätten sie dann allerdings den Nachweis führen müssen, dass die Psychoanalyse von ihrer Grundorientierung her sehr wohl so aufgebaut werden könne, dass sie als strenge Naturwissenschaft eine tragfähige Basis für die „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ hätte bilden können. Auf jeden Fall hätte man in ähnlicher Weise, wie ich es in der hier vorgelegten Arbeit versuche, die methodologischen Implikationen durchreflektieren müssen, die sich meiner Meinung nach notwendigerweise aus einer so gearteten Psychiatrie als einer angewandten Wissenschaft ergeben. Es ist klar, dass eine so geartete Konzeption, die Webersche „Begriffslehre des sozialen Handelns“ auf gar keinen Fall hätte „außen vor“ lassen können. Davon jedoch findet sich in dem RedlichFreedman’schen Lehrbuch noch nicht einmal eine Andeutung. Statt dessen lässt sich aus diesem Blickwinkel, bei der Lektüre des „Redlich/Freedman“ eine auf den ersten Blick erstaunliche, sodann jedoch keineswegs mehr überraschende Entdeckung machen, nämlich: Ohne dies eigentlich so Recht zu bemerken entwickeln diese beiden Autoren eine geradezu klassische soziologische Kulturwerteposition. Dies sozusagen in Gestalt einer kryptoweberianischen Faustskizze bei gleichzeitigem Festhalten an der ja streng genommen „antiweberianischen“ Position an einer konsequent verhaltenswissenschaftlichen Fundierung der 101 gesellschaftswissenschaftlichen Forschung insgesamt. Um eine Re-Interpretation genau dieser Faustskizze geht es mir, eine Re-Interpretation, die ganz bewusst in der Weberschen Kultursoziologie fundiert ist und herauszubringen versucht, was sozusagen an „Weberianischer Implizitsoziologie“ in dieser „Psychiatrie“ steckt. Nur und ausschließlich aus diesem Grunde habe ich mir die Freiheit genommen, mein Forschungsprogramm mit dem neuen Begriff der Sozio-Psychiatrie zu beschreiben. Die Arbeit setzt sich – längerfristig – das Ziel, mittels der präzisen soziologischen Kategorienlehre, wie ich sie in den beiden nächsten Denkschritten vorführen werde, „auszuführen“ und zu „differenzieren“ was bei Redlich und Freedman nur grob skizziert worden ist. Denn in der vorliegenden Arbeit versuche ich ja zu zeigen, wie Redlich und Freedman – diese ja lediglich stellvertretend für andere Psychiater – argumentieren müssten, wenn sie tatsächlich um der Konstruktion einer ätiologisch interessanten empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie willen eine Amalgamierung von „Kognitivpsychologie“, „Handlungssoziologie“ und „biologisch-orientierter Psychoanalyse“ auch in methodologisch befriedigenderweise zu bewerkstelligen versuchten, nämlich: Sie müssten erstens sehen, dass das für die klinisch-therapeutische Praxis charakteristische Prozedere als „Wertverwirklichungshandeln“ gar nicht streng wissenschaftlich vorgenommen werden kann, und sie müssten zweitens sehen, dass sich eine streng verhaltenswissenschaftlich ausgerichtete psychiatrische Grundlagenforschung ohne eine Idealtypologie der Rationalitätsbegriffs auf gar keinen Fall bewerkstelligen lässt. Wir gehen also von der Annahme aus, dass ganz allgemein bei der Skizzierung des Gegenstandsbereiches der Psychiatrie diese selbst eine verborgene soziologische Bestimmung in sich trägt, wenn es z.B. um die Formulierung der Therapieziele geht. Dann nämlich wird immer eine wissenschaftsabgewandte Kulturwertediskussion unabdingbar. Dass also notorisch bei den genannten Autoren ein krypto-soziologisches Vokabular verwendet wird, ist alles andere als ein Zufall.99 Nachdem die Autoren die Charakterisierung Harry Stack Sullivan‘s, „die Psychiatrie [sei] ... die Wissenschaft von den zwischenmenschlichen Beziehungen“, mit der richtigen 99 Wir haben hierbei übrigens eine ähnliche Problemlage wie wir sie bei der einleitend angedeuteten Analyse des Resch’schen Lehrbuchs antreffen können: Das kultursoziologische Paradigma Max Webers steht im Widerspruch zu der These von der Reduzierbarkeit der „Soziologie“ auf die biologisch-orientierten Verhaltenswissenschaften. Lässt sich also die These von der Redlich/Freedman‘schen „Implizitsoziologie“ erhärten, so geriete eine dergestalt konzipierte „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ wegen der dabei ja notwendigerweise ungelöst bleibenden Integrationsproblematik in ein Grunddilemma. Hierzu weiter unten Genaueres. 102 Begründung, eine solche definitorische Umschreibung sei viel zu weit gefasst, da sie „auf alle Wissenschaften“ zuträfe, „die sich mit menschlichem Verhalten beschäftigen“, zurückgewiesen haben, schlagen sie statt dessen die folgende Einordnung vor100: Die Psychiatrie habe „ihren festen Platz innerhalb der Medizin, zugleich jedoch“ stehe sie „stark in Abhängigkeit von den Sozialwissenschaften“.101 Natürlich geht es ganz genau um eine Präzisierung eben dieser „Abhängigkeitsformel“, wird dadurch doch das wissenschaftstheoretische Kernproblem einer methodisch befriedigenden Abklärung des Verhältnisses zwischen „Grundlagenforschung und Anwendung“ aufgeworfen, worauf später zurückzukommen sein wird. Die Autoren stellen sodann die folgenden fünf Fragen, die ich hier in einer etwas vereinfachenden Weise schematisch aufliste: 1. Was ist der der Psychiatrie genuin zu eigener Bereich? 2. Welches sind ihre Zuständigkeiten, welches ihre zentralen Probleme, welches ihre Methoden und wohin zielt ihre Entwicklung? 3. Mit welcher Art von Patienten hat sie es zu tun? 4. Mit welchen praktisch-therapeutischen Problemen ist man damit konfrontiert? Dies eine Frage, die sodann in die eigentliche „Grundlagenfrage“ einer „Psychiatrie“ einmündet, welche zwar „ihren festen Platz innerhalb der Medizin“ habe, welche sich zugleich jedoch „stark in Abhängigkeit von den Sozialwissenschaften“ befindet, nämlich: 5. Wie ist Verhalten organisiert, über welche Mittel und Wege wird es desorganisiert und wie wird es – therapeutisch – wiederhergestellt? Diese Fragen sollten uns, wie ich meine, nicht mehr so fremd vorkommen. Im Zentrum steht für die Autoren der Begriff der „Verhaltensstörung“, mittels dessen ganz global der der Psychiatrie genuin zu eigene Bereich zu kennzeichnen ist. Dieser prima facie recht einleuchtende Begriff erweise sich gleichwohl, so die Autoren, bei genauem Hinsehen als sehr schwer definierbar. Wer sich die Schwierigkeiten vor Augen hält, die eine methodologisch genaue Interpretation des Weberschen Handlungsbegriffs aufwirft, findet die 100 Redlich und Freedman [Psychiatrie], S. 13. 101 ibid. Hervorhebung mittels Kursiv durch mich Ch. K. 103 „schwere Definierbarkeit“ eines solchen Grundbegriffes, mittels dessen ein komplexer Gegenstandsbereich etikettiert wird, selbstverständlich alles andere als erstaunlich, liegt hier doch die gesamte Problematik des Verhältnisses von „Grundannahmen“, „Basalbegriffen“ und „empirisch falsifizierbaren Hypothesen“ verborgen. Meine These ist nun, dass die von Redlich und Freedman festgestellte „schwierige Definierbarkeit“ des Begriffs der „Verhaltensstörung“ sich vor allem deshalb ergibt, weil die Autoren – ohne sich dies explizit bewusst zu machen – in Wirklichkeit bei der Bestimmung ihres Gegenstandsbereiches soziologisch – genauer: kultursoziologisch – verfahren (müssen) denn erstens diskutieren sie den Term der „Verhaltensstörung“ im Bezugsrahmen einer au fond soziologischen Devianzargumentation und zweitens im Bezugsrahmen der überkommenen Kulturwerteproblematik, in deren Zentrum sich ja gerade die Frage nach dem Verhältnis des „Handlungsbegriffes“ zum au fond psychologischen „Verhaltensbegriff“ befindet. Und dies, ohne das genau diese Problemlage in expliziter Form zum Austrag kommt. Hören wir zunächst einmal die Autoren wörtlich, reflektieren den Gehalt der entsprechenden Textstelle und schließen erst hieran eine genauere Interpretation an. Die mir wichtig erscheinenden Punkte hebe ich mittels Kursive hervor und arbeite zwecks genauerer Interpretation zusätzlich mit Unterstreichungen: „Was sind nun diese sogenannten Verhaltensstörungen, mit denen es der Psychiater therapeutisch zu tun haben soll? Der Terminus ist nicht leicht zu definieren. Es handelt sich jedenfalls dabei um das Vorliegen bestimmter Verhaltensmuster verschiedentlich beschrieben als abnorme, subnormale, unerwünschte, inadäquate, unangemessene, unangepasste oder fehlangepasste Verhaltensweisen, deren gemeinsames Kennzeichen es ist, dass sie zu den Normen und Erwartungen des sozialen und kulturellen Systems dem der Patient angehört, im Widerspruch stehen. Menschen mit solchen Verhaltensstörungen sind nicht imstande, sich sozial, sexuell oder im Beruf gemäß den Erwartungen ihrer Umwelt zu betätigen; sie leiden und machen andere leiden“.102 102 ibid S. 14. Bei sehr genauem Hinsehen zeigt sich, dass hier nicht eine Klasse von Verhaltensmustern als „Verhaltensstörung“ benannt wird. Es sind vielmehr zwei Klassen: Aus dem Blickwinkel etablierter sozialer Systeme werden „Auffälligkeiten“ aufgelistet, sodann aber ist, ohne dass dies an dieser Stelle allerdings benannt wird, von „Menschen“ als personalen Systemen die Rede, welche zu sozialadäquatem Verhalten unfähig seien. Streng genommen ist an dieser Stelle also von personalsystemischen Verhaltensstörungen die Rede, wenn man an dieser Stelle hinzuzieht, was in Abschnitt II. 5. 6. in Anlehnung an den Redlich/Freedman genauer auszuführen sein wird. Wirklich interessant wird die ganze Angelegenheit, wenn sich zeigen lässt, dass ein Kausalzusammenhang konstruierbar ist, zwischen Sozialsystemen auf der einen Seite und bestimmten Verhaltensirritationen auf der anderen Seite, welche bestimmte personale Systeme aufweisen. Die vorliegende 104 Die Autoren hätten natürlich vor allem die Frage diskutieren müssen, warum Menschen mit den beschriebenen Verhaltensstörungen außerstande sind, sich „gemäß den Erwartungen ihrer Umwelt“, d.h. situationsadäquat zu verhalten, warum sie genau darunter leiden und „andere leiden [machen]“. Genau diese Frage jedoch wird nicht gestellt, worauf weiter unten zurückzukommen sein wird. Wie man sieht, lässt sich ansonsten der ganze Absatz problemlos in eine rollenbegriffliche Sprache übersetzen. Dies würde ungefähr folgendermaßen aussehen: Verhaltensstörungen, auch und gerade diejenigen, die in den Kompetenzbereich der Psychiatrie fallen, sind normendiskrepante Verhaltensmuster, deren gemeinsames Kennzeichen es ist, zum einen zu den Rollenerwartungen des sozialen Systems, in welchem der Patient auf irgendeine Art und Weise positioniert ist, zum anderen zu den Werten der kulturellen Dimension dieses sozialen Systems im Widerspruch zu stehen. Daraus ergibt sich – ebenfalls in soziologischer Sprache formuliert – : Verhaltensstörungen, welche klinisch-psychiatrisch interessant sein könnten, machen sich in erster Linie durch Devianz bemerkbar, wobei die Gründe für genau diese Formen von Devianz dem letzten Satz zufolge im prinzipiellen Unvermögen „der Patienten“ zu suchen sind, den jeweils relevanten Rollenerwartungen genügen zu können. Und hieraus folgt: Mental kranke Menschen „leiden“ bzw. „machen andere leiden“, weil sie unfähig sind, den Normen-, Werten und Rollenerwartungen ihrer jeweiligen sozialen Umwelt zu genügen. Man beachte, dass hierbei – und das gilt für das ganze Buch – nicht der Versuch gemacht wird, eventuell auftretende Formen der Devianz nach Maßgabe der in unserer Gesellschaft bestehenden Systeme der sozialen Kontrolle zu differenzieren.103 Dieser Punkt ist mir aus einem ganz bestimmten Grunde sehr wichtig: Unausgesprochen wird auch von den Autoren die Unterscheidung zwischen „Devianz aus persönlicher Unfähigkeit“ und absichtlicher Devianz gemacht. Da sie jedoch das damit angesprochene soziologische Problem nicht explizit diskutieren, konfundieren sie ganz automatisch rationale und irrationale Formen der Devianz. An genau diesem Punkt ist später anzusetzen. Es wird der Tatbestand in den Vordergrund zu stellen sein, dass um einer auch diagnostisch befriedigenden Art und Weise rationale und irrationale Formen der Devianz begrifflich scharf unterscheiden zu können, Arbeit muss es sich leider versagen, diesen Gedanken in der gebotenen Differenziertheit weiterzuverfolgen, beharrt jedoch darauf, dass die sog. „Verhaltensstörungen“ systemtheoretisch als personalsystemische Funktionsstörungen interpretierbar sind. 103 Vgl. hierzu den Abschnitt II. 7. 1. 105 konsequent unterschieden werden muss, zwischen bewusst vorgenommenen, mithin also „subjektiv sinnhaften“ Formen der Devianz (Delinquenz und Widerstand), bei denen die personellen Rationalitätskompetenzen erhalten geblieben sind, und jenen „hilflosirrationalen“ Formen der Devianz, bei denen das abweichende Verhalten auf ganz bestimmten persönlichkeitsspezifischen Defiziten beruht. Befassen wir uns näher mit dem Grund, der die Autoren dazu veranlasst haben könnte, mittels des Begriffs der „Verhaltensstörung“, welcher ja den allgemeinen Begriff des „Verhaltens“ voraussetzt, den der Psychiatrie genuin zu eigenen Gegenstandsbereich zu charakterisieren. Ganz bewusst rücken nämlich die Autoren den Begriff der Verhaltensstörung ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit, weil die noch in den älteren Lehrbüchern verwendeten Begriffe wie „Geist“, „Seele“ usw. viel zu viele „metaphysische Auffassungen nahelegen“ würden. Die Autoren bevorzugen also aus genau demselben Grund die neutralen Begriffe des „Verhaltens“ bzw. der „Verhaltensstörung“, der auch uns zum Motiv geworden ist, traditionell belastete Begriffe durch neutralere zu ersetzen. Sie liegen also auf derselben Linie, auf der auch wir in unserer bisher entwickelten Argumentation liegen: Die Abweisung von „Metaphysik“ und der konsequente Verzicht auf traditionell stark belastete philosophische Begrifflichkeiten designieren in dezidierter Weise die Verpflichtung zur „Wissenschaftlichkeit“ und „Wissenschaftlichkeit“ ist nun einmal, wie an dem im vorangegangenen Abschnitt vorgestellten wissenschaftstheoretischen Thesenkatalog abgelesen werden kann, wesentlich mit empirischer Überprüfung, d.h. mit Beobachtbarkeit und damit zugleich auch mit intersubjektiver Nachprüfbarkeit verknüpft. Aus genau diesem Grunde also stellen die Autoren den Begriff des Verhaltens ins Zentrum ihrer Überlegungen, nehmen mithin, wenn man so will, durchaus einen klassisch-behavioristischen Standpunkt ein und versuchen, ausgehend von diesem Begriff, dem Begriff des „beobachtbaren Verhaltens“, den Begriff der Verhaltensstörung zum eigentlichen Gegenstand psychiatrischer Aufmerksamkeit zu machen. Konsequenterweise hätten sie dann auch, wie die hier vorgelegte Arbeit es tut, den Begriff des „sozialen Handelns“ in ihre Betrachtungen mit einbeziehen müssen, wie die hier vorgelegte Arbeit behauptet. Es macht nämlich den genuin soziologischen Aspekt deutlich, wenn man sich methodologisch um das Verhältnis zwischen „Verhalten“ bzw. „Verhaltensstörung“ und „Handlung“ bzw. „Devianz“ Gedanken macht. Bevor wir hierauf zu sprechen kommen hören wir zunächst einmal die Begründung von Redlich und Freedman für die Wahl eines quasi106 behavioristischen Vokabulars. Auch hierbei hebe ich wiederum das mir wichtig erscheinende hervor: „Denn der Begriff Verhalten bezieht sich auf objektive Gegebenheiten, die der Beobachtung, der logischen Verknüpfung, der Hypothesenbildung und dem Experiment zugänglich sind. Der Terminus Störung ist zwar etwas ungenau, aber er bezeichnet rein deskriptiv Formen von Fehlverhalten, ohne dabei eine spezielle Ätiologie oder Pathogenese zu präjudizieren. Nur einige, nicht alle Verhaltensstörungen haben Erkrankungen des Gehirns zur Ursache oder gehen mit somatischen Reaktionen einher. Zwar führen viele cerebrale Krankheitsbilder zu Verhaltensstörungen, und es ist auch anzunehmen, dass zwischen den Vorgängen im Gehirn und dem Verhalten fundamentale Beziehungen bestehen müssen; Gehirnerkrankungen im medizinischen Sinne lassen sich jedoch bei der Mehrzahl der Verhaltensstörungen nicht nachweisen. Der eigentliche Gegenstand der Psychiatrie ist also das gestörte oder abweichende Verhalten des Individuums“.104 Wie wir sehen können – vgl. hierzu auch die weiter unten in den Abschnitten II. 7. gezeichneten Tafelbilder –, ist bereits diese Skizzierung soziologisch ergänzungsbedürftig: Streng soziologisch bedarf, wie bereits festgestellt, der Begriff der „Devianz“ der Differenzierung. Beachten wir nämlich die Rationalitätskriterien unserer geltenden Rechtsordnung, so muss zwischen „schuldfähigem“ und „entschuldbarem“ abweichenden Verhalten scharf unterschieden werden. Das Verhalten des strafmündigen Diebes ist deviantes Verhalten, der Dieb handelt jedoch durchaus sozial und rational. Er orientiert nämlich sein Verhalten „subjektiv sinnhaft“ (Max Weber) an einer sozialen Ordnung, der gegenüber er sein Verhalten ganz bewusst „verhehlt“ – ein Fachterminus der Weberschen Rechtssoziologie – und er tut dies auf eine Art und Weise, welche einen ziemlichen Aufwand an „Rationalität“ zu betreiben gezwungen ist. Die subjektiv sinnhafte und wesentlich rationale Handlung des Diebes, fällt deshalb gerade nicht in den Gegenstandsbereich der Psychiatrie, ist doch sein „Verhalten“ zwar deviant, keinesfalls jedoch „gestört“: Klinisch interessant ist das Verhalten dieses Diebes erst dann, wenn seine Form der Regelverletzung von einer solchen Fülle von Fehlleistungen durchsetzt ist, dass bei den Verfolgungsbehörden der Verdacht aufkommt, der z.B. juvenale Dieb habe es geradezu darauf angelegt „erwischt“ zu werden. Ich habe hier keineswegs nur die übliche Kleptomanie im Auge. Ich spreche vielmehr von dem in psychoanalytischer 104 Sprache feststellbaren eventuellen Redlich/Freedman S.14 107 Syndrom des unbewussten Schuldgefühls. Es sind die ja ebenfalls im Prinzip beobachtbare Fehlleistungen, welche hier zu Schlussfolgerungen führen, die in der Theorie der unbewussten Schuldgefühle ihren eigentlichen ätiologischen Hintergrund haben: Die seitens der Verfolgungsbehörden konstatierten „Fehlleistungen“ werden also seitens des psychoanalytisch ausgebildeten Psychiaters auf der Grundlage einer allgemeinen Theorie diagnostiziert, woraus sich trivialerweise ergibt: Diagnosen ganz allgemein verdanken ihre mehr oder weniger präzisen Schärfe derjenigen Theorie, welche das Interpretament des betreffenden Psychiaters darstellt. Im Lichte dieser Überlegungen lassen sich sodann auch diejenigen Textpassagen im „Redlich/Freedman“ einer genaueren Betrachtung unterziehen, die sich mit der eigentlichen „wissenschaftliche[n] Aufgabe der Psychiatrie“ befassen. Hierbei kommen die Autoren nämlich auf das zentrale methodische Problem zu sprechen, wie man vom objektiv beobachtbaren Verhalten eines Individuums auf nicht beobachtbare vielmehr nur noch vermutete, Hintergründe des Verhaltens schließen könnte. „Der eigentliche Gegenstand der Psychiatrie“ sei, so die Autoren, das „gestörte oder abweichende Verhalten des Individuums.“ In konsequent behavioristischer Sprechweise wird damit ganz bewusst auf das „offene, manifeste Verhalten“ abgestellt. Ausdrücklich schließen die Autoren das Verbalverhalten hierbei ein. Und das ist auch durchaus folgerichtig, da sich ja Sprechakte durchaus deskriptiv erfassen lassen. Dieser Punkt ist für uns deshalb wichtig, weil ja die Freudschen „Versprecher“ in diesem Sinne durchaus objektiv festgestellt werden können, bilden sie doch ganz bestimmte Formen der „Abweichung“, derjenigen nämlich, die gegen bestimmte grammatikalische Regeln verstoßen. Diesen – eigentlich hochinteressanten – Punkt lassen wir hier jedoch außer Betracht. Wichtiger erscheint mir an dieser Stelle, dass die Autoren das Problem, vom „offenen“ bzw. „manifesten Verhalten“ auf das diesem jeweils zugrunde liegende Beliefsystem zu schließen durchaus sehen, genau dieses Problem jedoch gerade nicht einer methodologischen Analyse unterziehen. In der fraglichen Textpassage heisst es nämlich: „Daraus [gemeint ist das offene manifeste Verhalten] lässt sich dann weiter das subjektive Leben der Person erschließen, ihre privaten Gedanken, Reaktionen und Gefühle.“ Völlig richtig bekunden dann die Autoren die Auffassung, es müsse sich ein gesetzesartiger Zusammenhang nachweisen lassen, wenn sich ganz bestimmte Verhaltensmuster im gestörten Verhalten herauskristallisierten: „Nach unserer Auffassung stellen sowohl das offene (manifeste) wie das verborgene (latente) Verhalten systematisch verknüpfte und sinnvolle Ereignisreihen dar.“ Es sei die 108 „wissenschaftliche Aufgabe der Psychiatrie“, vor allem diejenigen Fragen zu klären, die sich mit dem Problem befassen, wie denn wohl „die einzelnen Verhaltensereignisse zu sinnvollen Mustern organisiert“ seien. Nur so nämlich – und dies ist auch nach der hier vertretenen Auffassung das einzig Richtige – ließen „sich die für die Diagnose, Ätiologie und Therapie relevanten Beziehungen aufdecken.“105 Schauen wir uns den zuletzt genannten Zusammenhang unter einem noch etwas anderen Blickwinkel an. Er betrifft den Zusammenhang zwischen dem Wissenschaftsprinzip und dem Problem des Kulturwertwandels. Es kann nämlich gezeigt werden, dass die sog. „Wertediskussion“ in die vom Wissenschaftsgedanken getragene Argumentation hineinragt, so dass die Problematik der „gesetzmäßigen Organisation des Verhaltens“ ineinandergeschoben wird mit dem Problem der jeweiligen Wertpräferenzen. Die Autoren interessieren sich, wie gesagt, für die Verhaltensmuster und stellen in diesem Zusammenhang die in der Tat entscheidende (Doppel-)Frage, „wie ..... die einzelnen Verhaltensereignisse zu sinnvollen Mustern organisiert und wie ..... sich die für die Diagnose, Ätiologie und Therapie relevanten Beziehungen aufdecken“ ließen. Es ist eindeutig, dass diese Art der Fragestellung in den Kompetenzbereich einer streng wissenschaftlich organisierten Ätiologie gehört. Dennoch stellen die Autoren in demselben Zusammenhang fest, dass das, „was im einzelnen zu den Verhaltensstörungen“ zähle, „von der jeweiligen Kultur bzw. deren Wertsystem“ abhänge. Diese „Kultur“ bestimmt also auch, wie an Detail die jeweiligen Formen der Devianz zu evaluieren sind, werde doch von solch einer Art Evaluation zugleich auch festgelegt, „welche Maßnahmen jeweils als psychiatrische Behandlung“ angezeigt wären. Die Rollenkonfundierung von psychiatrischem Praktiker und theoriegeleitetem Diagnostiker macht sich dann in der folgenden Feststellung geltend: Die „praktische Aufgabe des Fachmannes“ läge zum einen in der Prophylaxe, zum anderen in einer anamnestisch gut fundierten Ätiologie, nämlich „darin, im Interesse einer Früherkennung und kompetenten Behandlung mittels hochspezialisierter Untersuchungsverfahren Art und Ursache der Störung festzustellen.“106 Die Autoren sehen völlig richtig, dass es für die Prophylaxe, wie auch für die Diagnostik und die eventuelle Therapie einer allgemeinen empirisch falsifizierbaren Theorie bedarf, welche unabhängig von den geltenden kulturellen Wertestrukturen die Art der Störung festzustellen habe. Streng genommen müssten sie dann eigentlich scharf trennen 105 Redlich/Freedman S.13f 106 Redlich/Freedman S.14f 109 zwischen der Arbeit des Diagnostikers, der auf der Grundlage seiner Kenntnis der „gesetzmäßigen Organisation sämtlichen Verhalten“ die jeweilige Art der Verhaltensstörung zu konstatieren hätte und der in der Tat seine Feststellungen zu treffen hätte völlig unabhängig davon, „was immer dessen sozialen Bedeutung sein mag“, und dem an Therapie interessierten Praktiker, der auf der Grundlage einer solchen Diagnose die Wahl über geeignete therapeutische Maßnahmen zu treffen hätte. Denn der Begriff der „Prophylaxe“ beinhaltet ja eine evaluativ imprägnierte Diagnose und Prognose. Wohlgemerkt: Ich diskutiere hier nicht – wenigstens an dieser Stelle noch nicht – das hierbei involvierte in der Tat sehr schwierige Problem des Verhältnisses zwischen theoretischem Hintergrundswissen und therapeutischer Applikation. Und folglich kritisiere ich auch nicht, dass unter Umständen die Kliniker dieses Problem vielleicht nicht lösen können. Ich mache lediglich auf die methodologische Leerstelle aufmerksam, die in diesem Zusammenhang durchweg zu beobachten ist. Die beiden Autoren sprechen sehr wohl das ausgesprochen schwierige Problem des (makrosozialen) Kulturwandels an, verweisen auch zu Recht auf das Wechselwirkungsverhältnis zwischen wissenschaftlich-psychiatrischen Erkenntnisfortschritt und allgemeinem Kulturwertwandel, verzichten dann jedoch – wie ich finde: nicht zu Recht – vollständig auf eine methodologische Erörterung dieses Grundproblems der kulturwissenschaftlichen Forschung. Genau hier liegt die „Ungereimtheit“ die ich zu Beginn dieses Kapitels festgestellt habe. Nur und ausschließlich die radikal-positivistische Position des „methodologischen Individualismus“ betrachtet die hier angeschnittene „Wertediskussion“ als schlicht überflüssig und plädiert für eine konsequent technologisch gewendete Umgehensweise auch und gerade mit dem psychisch Kranken. Genau diese radikale Position jedoch möchten die beiden Autoren nicht einnehmen. Aus genau diesem Grunde hätten sie die damit anhängende Problematik eigentlich diskutieren müssen. Stattdessen genügt ihnen ein bloßer Hinweis: Zugestandenermaßen würden „die Spezialisten vorwiegend von den Wertsystemen der Gesellschaft geleitet, der sie angehören“, nicht selten jedoch hätten „auch umgekehrt ihre Entdeckungen und Theorien die vorherrschenden Auffassungen von der Natur des Menschen umgestaltet und damit das Wertsystem modifiziert.“107 Paradigmatisches Belegstück hierfür ist ihnen naturgemäß die Psychoanalyse. Die „Idee einer unbewussten Motivation“ habe z.B. „die Vorstellung der westlichabendländischen Gesellschaft von der Verantwortlichkeit des Individuums umgeprägt.“ Nicht 107 ibid. 110 auszuschließen sei deshalb, dass „umgekehrt auch das Auftreten neuer Anschauungen innerhalb einer Gesellschaft dazu führen“ könne, „dass Verhaltensstörungen anders – im guten oder schlechten Sinne – beurteilt werden.“108 Zu Verdeutlichung machen wir uns die argumentative Logik dar, wie sie in diesem – ich betone es: wirklich ausgezeichneten – Lehrbuch der „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ vorliegt: Die Psychiatrie als eine medizinische Unternehmung habe zum einen eine praktische, zum anderen eine wissenschaftliche Aufgabenstellung die letztendlich natürlich zu einer für den heilkundlichen Auftrag der Psychiatrie fruchtbaren Einheit zusammengeschlossen werden müssen. Die „Aufgabe“ des Psychiaters bestehe um einer aussichtsreichen therapeutischen Umgehensweise mit bestimmten, als leitvoll erlebten „Verhaltensstörungen“ willen, zunächst einmal – „im Interesse einer Früherkennung und kompetenten Behandlung“ – darin, „mittels hochspezialisierter Untersuchungsverfahren „Art und Ursache der Störung festzustellen“. Hierbei müsse bedacht werden, dass das „Verhalten“ als solches – gewissermaßen als ein kulturunabhängiger Tatbestand – als gesetzmäßig organisiert aufgefasst werden müsse. Soweit so gut. In einem Atemzug wird sodann jedoch zugestanden, dass gerade diese „Definition“ von „Verhaltensstörungen“ wesentlich von den geltenden „Wertsystem“ der Gesellschaft, dem – wie die Soziologen sagen würden – kulturellen System einer Gesellschaft abhängig ist. Wie kann das gehen?, müssen wir uns fragen. Ist denn dann nicht ganz automatisch auch das allgemeine „Verhalten“ der Menschen nicht gleichfalls von den „Kulturwerten“ einer Gesellschaft geprägt, sind sie doch zweifelsohne im Bezugrahmen genau dieser „Kultur“ aufgewachsen, haben deren „Werte“ internalisiert? 108 ibid. Zweifelsohne hat „beispielsweise die Idee einer unbewussten Motivation die Vorstellung der westlich-abendländischen Gesellschaft von der Verantwortlichkeit des Individuums umgeprägt“. Das ist aber nicht der wirklich entscheidende Punkt. Die hier bemühte „Umprägung“ einer „Idee“ und der mit dieser verbundenen „Werte“ hat sich nämlich keineswegs effektiv auf diejenigen Abteilungen der Systeme der sozialen Kontrolle unserer „westlich-abendländischen Gesellschaft“ ausgewirkt, die wir mittels des Oberbegriffs „Strafrecht“ zusammenfassen: Als ein für sein Tun in vollgültigem Sinne Verantwortlicher erhält der gemeine Mörder ja gerade nicht irgendeine psychiatrische Behandlung sondern geht nach wie vor – in unserem Rechtssystem – in eine Vollzugsanstalt, wo er seine Schuld zu sühnen hat. Obwohl also jeder streng freudianisch geschulte Psychiater jederzeit den Nachweis zu erbringen vermag, dass wegen der strukturellen Dominanz der unbewussten Formen des Denkens, Fühlens und Wollens keine „Verantwortlichkeit“ vorliegen kann, wird dennoch nach wie vor im Strafrecht mit dem Konstrukt der „Verantwortlichkeit“ gearbeitet. Wie wir sehen werden: zu Recht. 111 Uns scheint sich hier ein gewisses Dilemma anzudeuten. Jedenfalls werden wir uns aus dem Blickwinkel der wesentlich kultursoziologisch geprägten Handlungsdefinition Max Webers genauer mit diesem Dilemma zwischen „Wissenschaftsinteresse“ der Psychiatrie und kulturwertabhängiger Praxis und Therapie der Psychiatrie befassen müssen und machen an dieser Stelle lediglich darauf aufmerksam, dass wir hier einen ziemlich eindeutigen Beleg für das „Hineinspielen“ genuin soziologischen Denkens haben: Was als psycho-pathologisch auffällige „Verhaltensstörung“ gelten kann, ist ebenso von bestimmten kulturell geprägten Werten, Normen und Ideen einer Gesellschaft abhängig wie die jeweiligen Therapieziele. Der entscheidende Punkt jedoch: Es findet keine wissenschaftstheoretisch vigilante Diskussion genau dieser Problematik statt. Worauf es uns ankommen wird, ist, dass jedenfalls, sämtliche Verhaltensmuster, die als im klinischen Sinne „gestört“ aufzufassen sind und für deren „gesetzmäßige Organisation“ sich der Psychiater interessiert, wenn sie nicht in ihrer Pathogenese eindeutig somatischen Ursachen zuzuschreiben sind109, als die Ergebnisse von Lernprozessen zu interpretieren sind, für die ja sodann auch die allgemeinen Lerngesetze zu gelten haben. Das bedeutet, dass diese Verhaltensmuster irgendwann im Verlaufe der Sozialisation nach Maßgabe bestimmter kultureller Präferenzen belohnt worden sein müssen. Schärfer formuliert: Klinisch auffällige Verhaltensmuster lassen sich hinsichtlich ihrer Pathogenese nach Maßgabe bekannter Lerngesetzmäßigkeiten interpretieren, jedoch hängen die jeweiligen „Verstärkerpläne“ wesentlich davon ab, was in einem bestimmten kulturellen Milieu als verstärkenswert angesehen zu werden pflegt und was nicht. Nachdem wir den Text von Redlich und Freedman zur Skizzierung des „Gebietes der Psychiatrie“ behandelt haben, sollten wir uns nunmehr darauf konzentrieren, was genau dies eigentlich für die hier in den Mittelpunkt gestellte Fragestellung bedeutet? Es sind insbesondere drei Punkte die uns hier interessieren: 1. Die Arbeitsdefinition 2. Die quasi soziologische Festlegung 3. Das Verhältnis zwischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendung 109 Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass in sehr vielen Fällen bezüglich der Symptomatologie keine allzu großen differenzialdiagnostischen Probleme auftreten. 112 „Die Psychiatrie“, so wird gesagt, sei ein „Spezialfach der Medizin“. Folgerichtig gelten dann natürlich auch die allgemeinen Charakterisierungen für die Medizin. Genannt werden die Aktivitäten „Forschung“, „Diagnostik“, „Therapie“ und „Prävention“, was handlungsbegrifflich bedeutet: der Mediziner forscht, er diagnostiziert – er deutet mithin bestimmte „Daten“, die er beobachtet –, er therapiert und er „sorgt vor“. Mit einem Wort: Er handelt, und zwar handelt er subjektiv sinnhaft gemäß seiner sozialen Position und gemäß zweier dieser zugeordneter verschiedener Rollen. Als Wissenschaftler erforscht er die entsprechende Krankheit nach Maßgabe der für die Wissenschaftsinstitution geltenden Wertprinzipien der „rationalen Wahrheitssuche“ als „helfender Arzt“ jedoch handelt er „praktisch“, nämlich nach Maßgabe ganz bestimmter anderer Kulturwerte als denen, die für die Institution „Wissenschaft“ gelten. Dem Praktiker bzw. dem Kliniker ist kulturell vorgegeben, was überhaupt als „krankhaft“ zu gelten hat und was nicht. Es ist prinzipiell ausgeschlossen, dass mit den Mitteln der Wissenschaft die entsprechenden kulturellen Zielvorstellungen festgelegt werden können. Auf den Punkt kommt dieses Problem, wenn es darum geht, den Begriff der „Verhaltensstörung“ zum einen aus dem Blickwinkel der klinischen Praxis, zum anderen aus dem Blickwinkel der strengen Verhaltenswissenschaften präzise zu bestimmen. Und hierzu gleich vorweg: Ich kritisiere die Autoren nicht deswegen, weil sie u.U. dieses Problem nicht zu lösen in der Lage sind, denn so gefasst kann auch ich hier dazu wenig sagen. Sonst wäre es ja auch kein gravierendes Problem. Zu kritisieren ist vielmehr, dass „über dieses Problem hinweggegangen wird“, ohne dass sich irgendwelche methodologische Reflexionen daraus ergeben. Ich hatte weiter oben vorsichtig darauf hingewiesen, dass sich mir hier ein „gewisses Dilemma“ anzudeuten scheint. Wenden wir uns also diesem Problem erneut zu, in der Absicht, dass dabei vielleicht im Spiele befindliche Dilemma genau herauszuarbeiten. Präzise umschrieben wird der Gegenstand der Psychiatrie als ein Komplex von „Verhaltensstörungen“, welche wegen ihrer Devianz auffällig geworden sind. Mein erster Kritikpunkt ist, dass seitens der psychiatrischen Fachwelt wegen ihrer fehlenden „soziologischen Sensibilität“ viel zu wenig zwischen den jeweiligen Formen der Devianz, wie ich sie in Abschnitt II. 7. behandeln werde, differenziert wird. Vor allem wird nicht unterschieden zwischen rationalen Formen der Devianz (Delinquenz bzw. „Widerstand“) und nicht-rationalen Formen der Devianz. Doch wird, wie gesagt, weiter unten noch genauer darauf einzugehen sein. 113 Dass vornehmlich die Psychiatrie unter den medizinischen Disziplinen ein ganz besonders enges Verhältnis zu den „systematischen Sozialwissenschaften“ habe, wird explizit hervorgehoben – und dies zu Recht –, es muss jedoch die Frage gestellt werden, zu welchen Sozialwissenschaften genau ein so enger Zusammenhang besteht, eine Frage, die von den Autoren gerade nicht gestellt wird. Dem gegenüber muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Spektrum der systematischen Sozialwissenschaften doch auch solche Disziplinen umfasst, die sehr weit entfernt von irgendwelchen psychiatrischen Problemen sind. Die Autoren wären vermutlich sehr erstaunt, wenn wir darauf beharren würden, ein Kriterium entwickeln zu müssen, welches die „Psychiatrierelevanz“ der einzelnen sozialwissenschaftlichen Disziplinen zu gewichten gestatten würde. Ich will in diesem Zusammenhang nur auf ein Beispiel hinweisen: Die Ökonomie – genauer: die Nationalökonomie – würde vermutlich von den Autoren als relativ fern vom medizinischen bzw. psychiatrischen Aufgabenkreis angesiedelt werden, gilt diese doch gerade nicht als Verhaltenswissenschaft. Aus diesem Blickwinkel würden die Autoren dann auch vermutlich die Webersche Soziologie unbeachtet lassen, was zumeist ja auch geschieht. Auf den ersten Blick ist diese Vernachlässigung ja auch durchaus plausibel: Ein Blick in den „Objektivitätsaufsatz“ belehrt darüber, dass hierbei „Soziologie“ und Nationalökonomie als ein einheitliches Ganzes aufgefasst wird. Von daher scheint die Soziologie als ziemlich entfernt von allem, was den Psychiater interessieren muss. Ein genaueres Hinsehen zeigt dann jedoch ein völlig anderes Bild: Es ist alles andere als ein Zufall, dass die gesamte Argumentation Max Webers auf dem Lehrstück der Nationalökonomie beruht, ist jedoch vornehmlich die Nationalökonomie das Paradigma schlechthin für die Demonstration der Fruchtbarkeit einer konsequent idealtypischen Konstruktion des Rationalitätsbegriffs. Und dass genau dieser Begriff auch und gerade für eine konsequent verhaltenstheoretisch fundierte „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ uninteressant sein würde, wird wohl niemand ernsthaft behaupten, bildet er doch den eigentlich „Angelpunkt“ sowohl der kognitivistisch gefassten Verhaltenswissenschaften als auch jedweder „Soziologie“, wie auch immer diese dann auch aussehen mag. Webers Auffassung zufolge bildet die Grundlagenforschung der Nationalökonomie den methodologischen Ausgangspunkt für eine mögliche Integration der gesamten Sozialwissenschaften. Aus diesem Grund ließe sich, so Weber, auch nur mit Blick auf die Nationalökonomie der Begriff des sozialen Handelns, oder genauer noch: des rationalen sozialen Handelns, als der eigentliche Grundbegriff der gesamten Sozialwissenschaften 114 gewinnen, der jedoch – und genau hier liegt das entscheidende Problem – auf irgendeine Weise bezogen werden muss auf den Verhaltensbegriff. Dies nämlich ist – und wie wir weiter unten noch deutlicher sehen werden: zu Recht das eigentliche Anliegen Max Webers. Die Nationalökonomie ist nur das ausgezeichnete Lehrbeispiel dafür, wie ein allgemeiner Handlungsbegriff in Relation gesetzt werden kann zum Verhaltensbegriff. Und genau dieser Begriff bildet ja wiederum auch nach Auffassung der Psychiatrie die Grundlage für die Konstruktion des Begriffes der Verhaltensstörung, was allgemein umschrieben werden kann im Rahmen einer Theorie der Devianz. Dazu dann weiter unten wesentlich mehr. An dieser Stelle halte ich lediglich fest: 1. Der Begriff der „Verhaltensstörung“, mittels dessen zu Recht der der Psychiatrie genuin zueigene Gegenstandsbereich sowohl in ihrer Grundlagenforschung als auch in ihrer praktisch-therapeutischen Anwendung umschrieben wird, lässt sich dann und nur dann auch präzise formulieren, wenn man das Verhältnis zwischen dem Handlungsbegriff und dem Verhaltensbegriff in einer methodologisch korrekten Weise abzuklären versucht. Praktisch das gesamt Lebenswerk Max Webers ist mit genau dieser methodologischen Kernfrage der Soziologie als einer Wirklichkeitswissenschaft befasst (gewesen). Dass z.B. Redlich und Freedman nicht präzise zu unterscheiden imstande sind zwischen genuin rationalen Formen der Devianz und „irrationalen“ Formen abweichenden Verhaltens, ist deswegen kein Zufall, weil sie genau diese Diskussion aus ihren Überlegungen ausblenden. 2. Menschliche Wesen verhalten sich, ebenso wie nicht-menschliche Organismen sich verhalten. Und ebenso wie infra-humane Organismen bestimmte Verhaltensstörungen aufweisen, deren „Muster“ sich studieren, beschreiben und erklären lassen, weisen natürlich auch menschliche Wesen bestimmte Verhaltensstörungen auf, die sich als „vom Normalen abweichende“ Verhaltensmuster studieren, beschreiben und erklären lassen. Unmengen von dergestalt organisch bedingten „Krankheiten“, lassen sich so weitgehend kulturunabhängig studieren, beschreiben und erklären. Dieser Punkt ist ganz sicher nicht strittig. Im eigentlichen Sinne „mentalsyndromatisch“ wird die ganze Angelegenheit erst dann, wenn 115 genuin humane Sozialisations- und Enkulturationsvorgänge im Spiel sind, die Devianzformen erzeugen, welche mit den sozialstrukturell dominierenden Kulturwerten diskrepant sind. Und um genau diese geht es: Es geht um die „Besonderheit“ von strukturellen Verhaltensmustern, welche ausschließlich menschlichem Verhalten eignen, wodurch das Problem des sog. „Kulturwertrelativismus“ aufgeworfen wird. Um auch dieser Problematik methodologisch Rechnung tragen zu können, hat nämlich Max Weber den Handlungsbegriff genauso eingeführt, wie wir ihn weiter unten kennenlernen werden, und sodann diesen Handlungsbegriff in Beziehung gesetzt zum Verhaltensbegriff. Ist aber diese analytische Heuristik „im Prinzip“ korrekt, was ja die – auch bei Stryker nachzulesene – These impliziert, dass zwischen humanspezifischen Verhaltensmustern und infra-humanspezifischen Verhaltensmustern eine qualitative Differenz postuliert werden muss, dann ergibt sich zwingend, dass auch die humanspezifischen Verhaltensstörungen im Bezugsrahmen des „Handlungsmodells“ und nicht im Bezugsrahmen eines kulturjenseitigen Verhaltensmodells studiert, beschrieben und erklärt werden müssen.110 Wenden wir uns deswegen noch einmal etwas intensiver dem Begriff der „Verhaltensstörung“ zu, als wie wir es bisher getan haben, und unterziehen wir im Lichte der in den letzten beiden Absätzen behandelten Hinweise auf die genuin soziologische Dimension der „Handlungs- und Rationalitätsproblematik“ die bereits vorgestellten Textvorlagen erneut einer genaueren texthermeneutischen Interpretation: Redlich und Freedman erläutern mittels des Begriffs der „Verhaltensstörung“ zunächst einmal rein arbeitsdefinitorisch, worum es ihnen geht. Dabei wird das gesamt Spektrum dessen, was soziologisch als „Devianz“ der Differenzierung bedürftig ist, abgedeckt. Ganz allgemein ist die Rede von unangemessene[n], „abnorme[n], unangepasste[n] subnormale[n], oder unerwünschte[n], fehlangepasste[n] inadäquate[n], Verhaltensweisen, deren gemeinsames Kennzeichen“ es sei, „dass sie zu den Normen und Erwartungen des sozialen und kulturellen Systems, dem der Patient angehört, im Widerspruch stehen.“111 110 Vgl. hierzu auch die Ergänzungen der Weberschen Grundannahmen, die ich weiter oben in Anlehnung an den Strykerschen „Sozialbehaviorismus“ vorgenommen habe. 111 Redlich/Freedman S.14 Hervorhebungen mittels Kursiv durch mich Ch. K. 116 Bedenken stellen sich erst ein, wenn mit der Gleichsetzung der psychiatrisch auffälligen Verhaltensstörungen mit normendiskrepanten Verhaltensmustern lediglich auf den jeweiligen sozialen und kulturellen Kontext, in dem diese „Störungen“ auftreten, hingewiesen wird. Dass dieser Aspekt „mitzubedenken“ sei, ist aus den im obigen zweiten Absatz genannten Gründen viel zu schwach. Ich lege entschiedenen Wert auf den Hinweis – und genau damit tritt das Problem der Konstruktion einer streng allgemeinen empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie auf den Plan –, dass hierbei eigentlich die Problematik des sog. „Kulturrelativismus“ hätte durchreflektiert werden müssen, liegt hier doch auch der neuralgische Punkt jedweder „transkulturellen Psychiatrie“, wie sie z.B. seitens der „Gießener Schule“ (Wulff) seinerzeit thematisiert wurde. Eine eingehende Diskussion dieses Problems muss ich mir an dieser Stelle natürlich versagen. Sodann wird eine präzisere Kennzeichnung der hier in Frage stehenden Verhaltensstörung vorgenommen: Es gehe um solche „Verhaltensstörung[en]“, die nur solche „Menschen“ beträfen, die „nicht imstande [seien], sich sozial, sexuell oder im Beruf gemäß den Erwartungen ihrer Umwelt zu betätigen.112 Um genau diese Klasse von – wie wir sagen werden – manifester Inkompetenz geht es also. Sie sind genuin psychiatrisch zu charakterisierende Patienten, die „leiden und andere leiden [machen]“.113 Wenn nun der Bereich der „Verhaltensstörungen“ dergestalt ins Zentrum der psychiatrischen Aufmerksamkeit gerückt wird und damit „rein deskriptiv sämtliche Formen von Fehlverhalten“ gemeint sind, dann ergibt sich natürlich automatisch die Frage nach dem Verhältnis zwischen „Verhalten“ und „Verhaltensstörung“. Interessant scheint mir nunmehr die Art und Weise wie von den Autoren der Verhaltensbegriff gefasst wird. Er wird nämlich zunächst einmal streng behavioristisch gefasst, beharren die Autoren doch – und dies zu Recht – auf dem Postulat der Beobachtbarkeit: „Verhalten meint hier zunächst das offene, manifeste Verhalten, einschließlich des Verbalverhaltens“.114 112 ibid. 113 ibid. 114 ibid. 117 Völlig zu Recht weisen dann Redlich und Freedman daraufhin, dass man scharf unterscheiden müsse zwischen den beobachtbaren Verhaltensformen und den nur erschließbaren Gründen für die beobachtbaren Verhaltensstörungen, vermeiden jedoch eine systematische Auseinandersetzung mit diesen methodologisch bekanntermaßen extrem schwierigen Problem. In dem wissenschaftstheoretischen Thesenkatalog hatte ich ja implizit darauf hingewiesen. Anhand einer systematischen Erörterung der von Freud so meisterhaft beschriebenen „Fehlleistungen“ hätte sich, wie ich meine, minuziös demonstrieren lassen, wie beobachtbare Verhaltensdaten und erschließungsbedürftige mentale Zustände zu „sinnvollen Mustern“ hätten konstruiert werden können. Bezogen auf die in dieser Arbeit ins Zentrum gestellte Fragestellung heisst das: Beobachtbar ist z.B. das sprachliche Verhalten eines Menschen, so dass sich die Sprechakte daraufhin untersuchen lassen, dass sie eventuelle Verstöße gegenüber der Syntax aufweisen, die der Analytiker als „Fehlleistungen“ interpretiert und diese sodann in einen kausalen Zusammenhang mit ganz bestimmten „Mentalzuständen“ bringt, welche er z.B. als „neurotisch“ bezeichnet. Zeichnen wir nunmehr ein, was wir weiter oben bereits zum einen über die „Identitätskrisen“, zum anderen – im „wissenschaftstheoretischen Thesenkatalog“ – über das Verhältnis zwischen „Beobachtungssprache und theoretische Sprache“ ausgeführt haben, und beziehen wir das dort Ausgeführte auf diese Textstelle, so ergibt sich: Identitätskrisen müssen, da sie als mentale Zustände zum „subjektiven Leben der Person[en]“ gehören und deren „private Gedanken, Reaktionen und Gefühle“ betreffen, erschlossen werden. Hier wohl dann der entscheidende Punkt: Beziehungen zwischen beobachtbaren Verhaltensmustern und den diesen zugrunde- und vorausliegenden mentalen Zuständen, lassen sich nur und ausschließlich auf dem Hintergrund einer für „wahr“ gehaltenen empirisch falsifizierbaren Theorie herstellen. Wie einleitend wieder und wieder behauptet handelt es sich bei dem Begriff der „Identitätskrise“ also tatsächlich, wenn dieser Begriff als ein Fachterminus eingeführt werden soll, um ein theoretisches Konstrukt, welches seinen Ort in einem idealtypisch konstruierten Identitätsmodell haben muss, so dass sich nunmehr (trivialerweise) ergibt: Im Prinzip beobachtbare Verhaltensmuster, welche als „Verhaltensstörungen“ psychosozial auffällig geworden sind, müssen im Rahmen einer wesentlich theoretisch organisierten Bemühung interpretiert werden, wenn man sie tatsächlich, wie Redlich und Freedman postulieren, in einen systematischen Zusammenhang 118 miteinander zu bringen beabsichtigt. Nur so macht dann die nachstehende Forderung Sinn, dass das „offene (manifeste) wie das verborgene (latente) Verhalten“ als eine Relation „systematisch [miteinander] verknüpfte[r] und sinnvolle[r] Ereignisreihen, konstruiert werden müsse“ .115 Wie wir sehen können, stellt eine solche „Verknüpfung“ einen kausalen Zusammenhang her zwischen den fraglichen Relationen. Auch hier weise ich darauf hin, dass sich genau diese Problematik ohne massive Abstützung an den „Problemen und Resultaten der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie“ (so der Titel des nach wie vor besten Lehrbuchs der modernen Wissenschaftslogik) überhaupt nicht sinnvoll diskutieren lässt. Hierzu hat nämlich Sigmund Freud selbst in seinen grundlagentheoretischen Schriften ein Erkenntnisprogramm ausgearbeitet, welches als ein solches eigentlich nirgendwo zur Kenntnis genommen und wissenschaftstheoretisch gewürdigt worden ist. Gleichwohl müsste eben dieses Erkenntnisprogramm naturgemäß – es handelt sich dabei um die als „Metapsychologie“ umschriebene Dimension der Psychoanalyse – im Lichte der bisher im Rahmen der strengen Wissenschaftslehre erarbeiteten Ergebnisse diskutiert und umgeschrieben werden. Dies kann meine Arbeit natürlich nicht leisten. Hier halte ich lediglich fest: Von einer wirklichen echten methodologischen Auseinandersetzung mit den hier angerissenen methodischen Problemen der „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ findet sich nichts. Methodologie wie Soziologie sind „Fremde“ in der Geisteswelt der Psychiatrie und der „Pädo-Psychiatrie“. Wie aber steht es denn dann überhaupt mit der „Wissenschaftlichkeit“ dieser Sonderdisziplinen der allgemeinen Heilkunde? Redlich und Freedman stellen dazu – wie ich finde: konsequenterweise – die beiden folgenden Fragen, welche sie ihrem Grundprogramm „verhaltenswissenschaftliche“ verstanden wissen wollen: 115 ibid. 119 entsprechend als a) „Wie werden die einzelnen Verhaltensereignisse zu sinnvollen Mustern organisiert?“ b) „Wie lassen sich die für die Diagnose, Ätiologie und Therapie relevanten Beziehungen aufdecken?“116 Selbstverständlich ist die so gefasste Fragestellung keineswegs falsch, jedoch muss betont werden, dass dadurch – nämlich in dieser Kombination – das dahinter verborgene methodologische Problem als solches lediglich aufgeworfen bzw. benannt, keineswegs jedoch bereits analysiert wird. Auch hierbei handelt es sich, wie ein Blick in mein Thesenkatalog lehrt, um ein wissenschaftstheoretisch prekäres Problem, um ein Problem, mit dem sich der Webersche „Objektivitätsaufsatz“ in seinem ganzen ersten Teil fast ausschließlich befasst. Es betrifft das Verhältnis zwischen theoriekonstruierender Grundlagenforschung und klinischtherapeutischer Anwendbarkeit der Ergebnisse derselben. So wie Redlich und Freedman die Frage aufwerfen, um die es hier geht, wird eigentlich nur zugedeckt, dass eine streng allgemein gefasste Verhaltenstheorie, welche die divergenten verhaltenstheoretischen Ansätze zu einem kohärenten Ganzen zu integrieren versuchte, unabhängig konstruiert werden muss, von ihren jeweiligen Funktionalisierungsmöglichkeiten „in therapeutischer Absicht“. Wie einleitend betont sehe ich hier natürlich genau den Stellenwert einer streng allgemeinen gefassten Sozialisationstheorie mit entsprechend großer Erklärungskraft, die zu konstruieren ich ja notorisch postuliert habe. Auch hier ziehe ich nur die Schlussfolgerung aus einigen nicht in Zweifel gestellten Resultaten der modernen wissenschaftstheoretischen Forschung: „Bewährung in der Praxis“ ist etwas völlig anderes als „empirische Bewährung“.117 Die Frage, wie sich „die einzelnen Verhaltensereignisse zu sinnvollen Mustern organisieren“ ist eine verhaltenstheoretische Frage und gehört der Grundlagenforschung an. Erst wenn diese Frage halbwegs konsensfähig unter den Fachleuten beantwortbar ist, lässt sich sodann auch 116 ibid. 117 Vgl. hierzu die entsprechenden Passagen im [Forschungsantrag], wo minuziös nachgewiesen wird, dass die „technologisch-applikative Transformation“ einer empirisch gehaltvollen Theorie, nicht als Bewährung für eben diese Theorie angesehen werden kann. Genau hier lag ja der eigentliche Denkfehler der radikalen Positivisten bei ihrer Verwerfung der Psychoanalyse als „unwissenschaftlich“: Erfolgreiche therapeutische Anwendung ist kein Beleg für die Haltbarkeit einer Theorie, in deren Rahmen die Therapie vorgenommen wird, und erfolglose „Anwendung“ wiederum belegt nicht die „Falschheit“ der Theorie. Überspitzt ausgedrückt: Empirische Validierung – der Fachausdruck hierfür heißt „Corroboration“ – und Bewährung im Anwendungsfalle sind wissenschaftslogisch völlig verschiedene Prozeduren. 120 seitens der klinischen Praxis an die so formulierte Grundlagenforschung die Frage nach denjenigen „relevanten Beziehungen“ stellen, die deshalb für „die Diagnose, Ätiologie und Therapie“ relevant sind, weil sie dafür sozusagen „verantwortlich“ zu machen sind, dass die normalerweise seitens der betreffenden Personen „zu sinnvollen Mustern organisiert[e]“ Verhaltensereignisse bei den Verhaltensstörungen nicht anzutreffen sind. Ich wiederhole noch einmal: Was die Autoren hierbei völlig „außen vor“ lassen, ist das äußerst prekäre Problem des Verhältnisses zwischen theoriekonstruierender Forschung und theorienanwendender (klinischer) Praxis. Nach meinem Dafürhalten liegt hier einer der Gründe dafür, dass wir eben bislang nicht über eine auch nur halbwegs in sich kohärente, empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie verfügen, welche als kognitive Hintergrundsfolie für eine wirkliche Ätiologie der Mentalerkrankungen fungieren könnte. Doch das nur nebenbei. Mit anderen Worten: Die Psychiatrie muss bei ihrem Versuch, Verhaltensstörungen symptomatologisch so zu erfassen, dass entsprechende therapeutische Maßnahmen auch greifen können, über eine Theorie verfügen, die genau angibt, unter welchen Bedingungen sich psychiatrisch auffällige Verhaltensweisen entwickeln und wann dies nicht der Fall ist. Dafür jedoch muss zuallererst eine entsprechende Theorie vorliegen, in deren Rahmen sodann vielleicht auch Kriterien konstruierbar sind die es gestatten, „psychiatrisch auffällige“ Verhaltensweisen als echte Verhaltensstörungen zu diagnostizieren. Was wird in streng methodologischer Hinsicht damit eigentlich gesagt? Dass es hier um eine allgemeine Sozialisationstheorie gehen muss, die ja vielleicht tatsächlich, wie es die Autoren wollen, ausschließlich streng verhaltenswissenschaftlich zu konzipieren ist – diesen Punkt stelle ich als Möglichkeit nicht in Zweifel! – dürfte klar sein. Dies haben wir bereits mehrfach betont und werden es notorisch erneut thematisieren. An dieser Stelle kommt es mir noch auf einen anderen Aspekt an, der mir in methodologischer Hinsicht interessant erscheint, gerade weil er in den psychiatrischen Bestimmungen des Gegenstandsbereiches von Devianzformen notorisch unerwähnt zu bleiben pflegt. Ich werde auch dies an dieser Stelle in einer apodiktischen Aussage formulieren, die sodann im Folgenden weiterentwickelt und erläutert werden soll: 121 Man kann dann und nur dann differenzialdiagnostisch zwischen rationalen Formen der Devianz und irrationalen Formen der Devianz unterscheiden, wenn man über ein idealtypologisch gefasstes Modell „normal“ gedachter Sozialisationsverläufe mit fiktiv gesetzten Sozialisationswerten verfügt. Mit anderen Worten: Benötigt wird eine allgemeine „Theorie“ – in diesem Fall besser: ein Modell – rational sich vollziehender Lernprozesse, um überhaupt die in der Psychiatrie viel zitierten pathologischen Lernprozesse beschreiben und gewichten zu können. Und genau dafür benötigt man ein idealtypisches Konstrukt des „rationalen sozialen Verhaltens“, welches der hier vertretenen Überzeugung nach nur und ausschließlich gegeben werden kann im Rahmen einer „Begriffslehre des (rationalen) sozialen Handelns“. Und wie unschwer zu sehen, muss hierfür begrifflich scharf unterschieden werden zwischen dem (lerntheoretischen) Verhaltensbegriff und dem genuin soziologischen Handlungsbegriff, womit wir ja ganz automatisch bei der oben entwickelten Problemlage einer (möglichen) empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie wären. Hierzu weiter unten dann Genaueres. Aus diesem Blickwinkel sei es mir gestattet auf einen grundsätzlichen Widerspruch hinzuweisen, der jeden Versuch, das „Gebiet der Psychiatrie“ mittels des Verhaltenskonstrukts zu „kartographieren“, kennzeichnet und dadurch ein, wie ich „kulturwissenschaftlich“ argumentierend glaube, methodologisches Grunddilemma erzeugt. Hören wir aus diesem Grunde noch einmal, was die Autoren Redlich und Freedman im Hinblick auf das Verhältnis von Verhaltensstörung und Kulturwerten zu sagen haben: „Was im einzelnen zu den Verhaltensstörungen“, zähle, hänge „von der jeweiligen Kultur bzw. deren Wertsystem ab.“ Diese „Kultur“ bestimme „auch, welche Maßnahmen jeweils als psychiatrische Behandlung gelten“ würden. Hier wird klar gesagt, dass die Psychiatrie mit Vorgaben operiere, die sie nicht autonom selbst festlegen könne oder solle. Dieser Punkt wird uns gleich noch genauer interessieren. Die Autoren fahren dann fort, dass der Psychiater aus genau diesem Grunde an der „gesetzmäßigen[n] Organisation sämtlichen Verhaltens“ interessiert sein müsse, „was immer dessen soziale Bedeutung sein mag.“ 122 Mir erscheint dieser Punkt von sehr großer Wichtigkeit: Eine Theorie des Verhaltens muss streng allgemein, mithin also kultur- und sozialunabhängig ausgearbeitet werden können, um in der klinischen Praxis mit bestimmten in einer bestimmten Kultur als irrational umschriebenen Formen des Verhaltens medizinisch praktisch umgehen zu können. Die paradigmatischen Lehrstücke kulturunabhängiger strenger Allgemeinheit begegnen uns in den Theoriegebilden der Naturwissenschaften. Ist aber dies die einzige Möglichkeit? Müssen wir deshalb vielleicht letztendlich nicht doch auf Physik, Chemie und Biologie zurückgreifen? Die Autoren tun dies indem sie z.B. von den genuin biologisch orientierten Verhalteswissenschaften sprechen, benutzen jedoch dann, wenn es darum geht, den Begriff der „Verhaltensstörung“ hierbei „einzuzeichnen“, ausschließlich eine kultursoziologische – genauer: eine krypto-kultursoziologische Sprache. Ich werde auf diesen Punkt anlässlich der methodologisch behandelten Abschnitte genauer eingehen und halte an dieser Stelle lediglich noch einmal fest was bereits einleitend hervorgehoben wurde: Es ist eine soziale Tatsache unserer Gesellschaftsform, dass diese im Bezugsrahmen ihrer großen Systeme der sozialen Kontrolle von sich aus recht klar die Kriterien „vorgibt“ dafür, was als „gesund“ und „krank“, was als „normal“ und was als „anomal“ zu gelten hat. Und vom streng soziologischen, genauer: vom streng kultursoziologischen Standpunkt aus, ist dieser Tatbestand alles andere als unwichtig. Wie wir zumindest andeutungsweise gesehen haben, tun sich Psychiatrie, Medizin, Psychologie und Sozialpsychologie bekanntlich schwer damit, ihm Rahmen ihres Kompetenzbereiches Kriterien für die Unterscheidbarkeit von „gesund“ und „krank“ von „normal“ und „anomal“, von „rational“ und „irrational“ zu entwickeln. Streng kulturwissenschaftlich, das heißt soziologisch, ist jedoch völlig klar, warum dies im Rahmen dieser Institutionen gar nicht bewerkstelligt werden kann, nämlich: Es handelt sich dabei um historisch-variable Kulturwerte im strengen Weberschen Sinne, und „Werte“ werden den Wissenschaften wie auch ihren angewandten Formen nun einmal vorgegeben, sie können sich gar nicht aus diesen selbst ergeben. Es ist eines der wichtigsten Resultate der im „Objektivitätsaufsatz“ von 1904 von Max Weber vorgetragenen Forschungsarbeit, minutiös herausgearbeitet zu haben, dass Erfahrungswissenschaften „Werte“ zwar analysieren, eventuell auch mit ihnen umzugehen lehren (können), sie jedoch niemals selbst begründen können. Doch dies ist nur der eine Aspekt, der hierbei interessant ist und auf den wir naturgemäß expressis verbis zu sprechen kommen müssen. 123 Der andere, der hier nur angedeutet wurde, ist eigentlich genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger: Die Rollentheorie steht, was die möglichen Kausalzusammenhänge zwischen beobachtbarem Verhalten und deren bloß erschließbare motivationale und kognitive Hintergründe betrifft, gewissermaßen zwischen beiden. Sie liefert ein Vokabular für eine mögliche (kausale) Verknüpfung, die jedoch methodisch spezifisch gehandhabt werden muss. Ein Beispiel soll zumindest andeuten, was damit gemeint ist: In ganz bestimmten Handlungskontexten lassen sich deren Rollenstrukturen relativ leicht ausmachen, weshalb auch relativ problemlos bestimmte Devianzen festgestellt werden können: Fehlleistungen, die sich gut beobachten lassen, sind schließlich Verstöße gegen bestimmte Rollenanforderungen in bestimmten Rollenkontexten. Ist aber diese Überlegung richtig, so würde sich daraus die folgende Schlussfolgerung ableiten lassen: Verfügt man über eine Theorie, die z.B. ganz bestimmte „Symptomhandlungen“ und „Fehlleistungen“ in einen Kausalzusammenhang bringt mit ganz bestimmten nervösen Störungen, und lassen sich wiederum diese „Fehlleistungen“ rollenstrukturell verorten, so ließen sich trivialerweise bestimmte Devianzen in ganz bestimmten rollenstrukturell angeordneten Handlungskonfigurationen in einer systematisch überprüfbaren Art und Weise in einen kausalen Zusammenhang mit entsprechenden nervösen Störungen bringen. Dies der Grundgedanke, auf den zurückzukommen sein wird. 4.2. Das Verhältnis zwischen Grundlagenforschung und „Anwendung“ Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, „war sich bewusst, dass die Beiträge der Psychoanalyse zur Grundlagenforschung sich als bedeutender erweisen würden als ihr Beitrag zur Therapie.“118 In der wissenschaftlichen Literatur wird diese Aussage Freuds viel zu wenig beachtet. Gleichwohl meine ich, dass sie von grundsätzlicher Bedeutung insbesondere für den Tätigkeitsbereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist. Die meisten Arbeiten kranken daran, dass sie die analytisch zu machende Unterscheidung zwischen Grundlagenforschung und Therapie vor allem deswegen zu wenig beachten, weil sie in der klinischen Praxis naturgemäß nicht gemacht wird und in der Regel auch nicht gemacht werden kann. Auch hier erweist sich 124 die konsequent soziologische Betrachtung, wie ich meine, als hilfreich. Explizit werde ich mich dieser Überlegung erst bei der Behandlung des Weberschen Handlungsmodells – insbesondere von dessen Methodologie – zuwenden. Dennoch möchte ich diese Unterscheidung bereits an dieser Stelle nachdrücklich betonen: Es ist aus mehreren Gründen, wie wir sehen werden, von großer Wichtigkeit, dass der Psychiater sich seiner Rolle als Wissenschaftler und seiner Rolle als Therapeut bewusst ist und diese gegebenenfalls auch trennen kann. In Anlehnung an die Webersche Unterscheidung von Erfahrungswissen und Werturteil ist im [Forschungsantrag] ganz scharf begrifflich unterschieden worden zwischen theoriekonstruierendem Forschungsmodus und theorieanwendendem Applikationsmodus.119 Gezeigt werden konnte, dass eine Konfusion dieser beiden Ebenen – sie lassen sich übrigens rollentheoretisch streng fassen120 – zu einer vollständig falschen Auffassung von den Validierungsprozeduren streng allgemein gefasster theoretischer Konstrukte führt. Ich beziehe mich auf dieses Resultat und wende es konsequent auf das hier ins Zentrum gerückte Problem der „Kulturwertegebundenheit“ psychiatrischer Theorie und Praxis an. Unter diesem Gesichtspunkt lässt sich nunmehr recht klar re-interpretieren, was Redlich und Freedman eigentlich im Auge haben: Die Konstruktion wie auch die empirische Validierung streng erfahrungswissenschaftlich gefasster Verhaltenstheorien, die sich, wie ich meine, immer „in psychiatrischer Absicht“ auf den Sozialisationsprozess beziehen lassen müssen, bilden die Voraussetzung dafür, dass bei beliebig vorgeprägtem Therapieziel das in der Grundlagenforschung akkumulierte Wissen auch erfolgreich angewendet werden kann. Tut man das jedoch, so ist man ganz automatisch mit all denjenigen methodologischen Fragen konfrontiert, die das Verhältnis zwischen „Erklärung“, „Prognose“ und (technologischer) „Applikation“ betreffen, ein Problem, welches sich nur im Rahmen einer Erörterung des sog. „DN-Schemas einer wissenschaftlichen Erklärung“ diskutieren lässt: Therapeutische Anwendung von „Grundlagenwissen“ besteht in dem gezielten Eingriff in ein ansonsten ja „natürlich“ ablaufendes Geschehen. Um jedoch einen solchen „gezielten Eingriff“ überhaupt vornehmen zu können, muss zuvor eine Prognose erstellt werden, die besagt, wie der infrage 118 Redlich/Freedman S.24 119 Vgl. [Forschungsantrag] 120 siehe hierzu das „Arbeitspapier Nr. 12“, welches ich im Anschluss an die Sitzung am 17. März 2004 der Arbeitsgruppe Dossenheim vorgelegt und vorgetragen habe. 125 stehende Ablauf z.B. einer Tuberkulose sich gestalten würde, würde man den gezielten Eingriff unterlassen. Näheres wird uns erst in den Abschnitten II. 5. 2, II. 5. 3. und II. 5. 5. interessieren können. Betonen möchte ich an dieser Stelle lediglich, dass die hiermit angeschnittene Problematik des fiktiven „Durchrechnens“ der (möglichen) Konsequenzen einer ganz bestimmten ins Auge gefassten therapeutischen Bemühung eine ganz massive Relevanz sowohl für die Konstruktion eines Klassifikationsschemas für psychiatrisch auffällige Krankheitsformen als auch für die Frage nach der Struktur und der Funktion des sog. „therapeutischen Gesprächs“ hat: Der betreffende Arzt muss, wenn er in medizinischem Sinne zu handeln sich anschickt, entscheiden, was er will, d.h. worauf sein intentionales Handeln (therapeutisch) abzweckt, eine Situation, die sich als solche ganz gewiss nicht selbst wiederum restlos als verhaltensdeterminiert interpretieren lässt. Und genau diese Problematik verschärft sich natürlich zusätzlich, wenn im Medium des Gespräches zwischen dem Arzt und dem Patienten eine therapeutisch relevante Entscheidung zum Gegenstand einer diskursiven Erörterung gemacht wird: Auch in einem solchen entscheidungssuchenden Gespräch verhalten sich ja die beiden Gesprächskontrahenten auf eine mehr oder weniger genau beschreibbare Weise, so dass streng genommen gerade hierbei die dafür relevanten Verhaltensgesetzmäßigkeiten gelten würden und natürlich auch anwendbar sein müssten. Dennoch ist sicherlich – und dies aus prinzipiellen Gründen, wie wir anhand einer genaueren Analyse des Gadamerschen „Gespräches“ sehen werden – gerade ein solches auf eine gemeinsame Entscheidung sich zubewegendes Gesprächsverhalten nicht prognostizierbar, denn „Gespräche“ nach Maßgabe der Gadamerschen Idealtypologie sind grundsätzlich offene Sozialsysteme. Was aber wird aus einer streng wissenschaftlich ausgearbeiteten Verhaltenstheorie, die sich – wie unschwer zu sehen – auf das Verbalverhalten im Arzt-Patienten-Gespräch gar nicht anwenden lässt? Nun, aus dem Blickwinkel der Wissenschaftslogik ist dann der Fall klar: Eine streng allgemeine und als empirisch falsifizierbar konzipierte Theorie, welche von vorneherein zugesteht, dass sie in bestimmten Fällen aus prinzipiellen Gründen nicht empirisch prüfbar ist, weil sie mit Ausnahmeklauseln zu arbeiten gezwungen ist, ist eben keine informationshaltige mithin auch keine erklärungskräftige Theorie im Popper‘schen Sinne121, da ihre prognostische Relevanz ganz einfach auf den Nullpunkt sinken würde. 121 Vgl. Abschnitt II. 5. 5., wo insbesondere die Popper’schen Prinzipien des sog. „methodologischen Falsifikationismus“ zu diskutieren sein werden. 126 An dieser Stelle halte ich lediglich fest: Anwendung und mehr oder weniger gezielter Eingriff in eine wie auch immer geartete Wirklichkeitsdynamik beruhen immer auf zuvor getroffenen Entscheidungen und damit betreten wir unausweichlich das von Max Weber erschlossene Gebiet des subjektiv sinnhaften rationalen Handelns, das Gebiet der Soziologie also: Subjektiv sinnhaftes Handeln beruht immer (explizit oder implizit) auf zuvor getroffenen Entscheidungen bezüglich (subjektiv wahrgenommener) Alternativen. Man verstehe gleichwohl die hier vorgeführte Argumentation nicht falsch: Ich plädiere nicht damit automatisch für die sog. „methodische Dichotomiekonzeption“, wie sie beispielsweise dem Habermas’schen „Umbau“ der Psychoanalyse zugrundeliegt. Ich weise lediglich darauf hin, dass hier ein massives Problem jedweder „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ liegt, welches systematischer methodologischer Behandlung bedürftig ist. Und meine Kritik an dem Ansatz von Redlich und Freedman bezieht sich ausschließlich darauf, dass dieser – wie ich meine: gravierende – Aspekt einer Psychiatrie als „angewandter Verhaltenswissenschaft“ noch nicht einmal erwähnt wird.122 4.3. Ein kurzer (kulturwissenschaftlicher) Blick auf die Krankheitsformen(lehre) Es sind hauptsächlich vier Formenkreise von Verhaltensstörungen, die psychiatrisch von Interesse sind, die wir hier in Anlehnung an Redlich und Freedman auflisten und kurz charakterisieren wollen. Ich nehme mir dabei die Freiheit, die Klassifikation der Autoren ein wenig umzugruppieren und z.B. die von den Autoren ebenfalls aufgeführten Oligophrenien zu vernachlässigen. An erster Stelle werden jene „schweren Störungen“ genannt, die dem sog. „psychotischen Formenkreis“ zugehören. Patienten die unter diesen Krankheitsformen leiden, seinen, so heißt 122 Resch versucht genau dieses Problem zu umgehen, indem er die ethische Dimension des medizinischen Entscheidungsverhaltens bemüht, und ähnlich hat auch Prof. Verres argumentiert, der meine kritische Mitarbeit an seinem erst kürzlich erschienen Buch [Was uns gesund macht] dankenswerterweise so warmherzig gewürdigt hat. Es handelt sich aber nicht um ein „moralisches“ bzw. „ethisches“ Problem, wie auch Herr Prof. Zimmermann in seiner Kontroverse mit mir hervorgehoben hat, sondern vielmehr um ein Problem, der erkenntnistheoretischen Grundlagen eigentlich aller Erfahrungswissenschaften. Den Überschritt in die Moralphilosophie halte ich nicht für notwendig. 127 es, unfähig, „ihre innere und äußere Realität angemessen zu bewältigen und ihre sozialen Beziehungen konstant und adäquat zu organisieren.“123 Die Aussage bedarf der Interpretation, wie mir scheint, so dass sich zunächst einmal die folgende Doppelfrage ergibt: Wird ein Kausalzusammenhang behauptet zwischen der – im Prinzip ja durchaus beobachtbaren – Unfähigkeit eines Patienten, der an einer Psychose leidet, seine „sozialen Beziehungen konstant und adäquat zu organisieren“, und der – prinzipiell nicht beobachtbaren – Unfähigkeit, zwischen „innerer und äußerer Realität angemessen“ zu differenzieren, oder ist es das theoretische Kriterium einer Psychose, dass ein Patient nicht zwischen „innerer und äußerer Realität“ unterscheiden kann? In diesem Fall wäre es dann wiederum u.U. das beobachtbare Kriterium, dass dieser Mensch nicht imstande ist, seine „sozialen Beziehungen konstant und adäquat zu organisieren“. Im ersten Fall müsste – sonst würde die Behauptung leer werden – die Unfähigkeit des Patienten, zwischen „innerer und äußerer Realität“ angemessen differenzieren zu können, unabhängig festgestellt werden können, von der Unfähigkeit, bestimmte „soziale Beziehungen konstant und adäquat zu organisieren“. Nur dann nämlich hätten wie eine empirisch falsifizierbare Kausalhypothese. Hingegen hätten wir im zweiten Fall keine Kausalhypothese, sondern eher eine begriffliche Bestimmung für Erkrankungen des sog. „psychotischen Formenkreises“, wobei dann die Unfähigkeit des Patienten, seine „sozialen Beziehungen konstant und adäquat zu organisieren“, als beobachtbares Kriterium fungieren würde, um die Unfähigkeit eines Psychotikers zu designieren, zwischen „innerer und äußerer Realität“ adäquat differenzieren zu können. Dann hätte man allerdings das Problem zu lösen, die „Realitätsadäquatheit“ noch wesentlich genauer bestimmen zu müssen. Weil die Autoren uns über die hier angedeuteten Interpretationsmöglichkeiten im Unklaren lassen, überträgt sich natürlich ganz automatisch die hier angedeutete Unbestimmtheit auch und gerade auf die klinische Praxis. Die hier dargelegte Pedanterie ist alles andere als eine rein akademische Frage der Wissenschaftslehre wie wir insbesondere in Abschnitt II. 8. sehen werden. Anlässlich der dort „durchgespielten“ Möglichkeiten, Aussagen über „Rationalität“ als Definitionen, Grundannahmen oder als empirisch falsifizierbare Hypothesen zu deuten, werden wir in extenso auf die hier angeschnittene Problematik zurückkommen. Eine Möglichkeit wäre nämlich immerhin, die ganze Aussage konsequent in eine komparative 123 Redlich/Freedman a.a.O. S. 15. Hervorhebungen durch mich Ch. K. 128 Form zu überführen und dann entsprechende Operationalisierungskriterien anzugeben. Sie würde dann ungefähr folgendermaßen aussehen: Je weniger ein Mensch imstande ist, seine „sozialen Beziehungen konstant und adäquat“ zu organisieren, was z.B. an sprunghaft ansteigendem Anteil von „Fehlleistungen“ in bestimmten Konfliktsituationen ablesbar wäre – dies eine Möglichkeit der Operationalisierung –, umso weniger wird ein solcher Mensch imstande sein, zwischen „innerer und äußerer Realität angemessen“ zu differenzieren; genau dies ist ein wichtiges Indiz dafür, dass dieser Mensch „psychotisch“ ist. Eine solche komparativ gefasste Aussage wäre etwas weniger mehrdeutig, wie man sieht, jedoch ist gleichfalls unschwer erkennbar, dass eigentlich immer noch nicht so recht deutlich wird, ob hier Kausalzusammenhänge behauptet werden, oder aber, ob lediglich genauere definitorische Kriterien für das Vorliegen oder nicht Vorliegen einer psychotischen „Verhaltensstörung“ angestrebt werden. Wir legen die hierbei involvierten methodologischen Probleme – sie werden, wie gesagt, Gegenstand des Abschnittes II. 8. sein – hier zunächst einmal zur Seite. Worauf es mir an dieser Stelle ankommt, ist lediglich, auf dieses Problem hinzuweisen: Es handelt sich aus wissenschaftslogischer Sicht um ein prinzipielles Problem, mit dem man eben notorisch konfrontiert ist, will man überhaupt die Fruchtbarkeit des soziologischen „piont of view“ für die psychiatrische „Theorie und Praxis“ plausibilisieren. Nicht bestritten wird natürlich, dass der erfahrene Kliniker mit „praktischer Urteilskraft“ und „Sachverstand“ in der Regel durchaus imstande ist, hierbei auch ohne irgendwelche Anleihen an der Wissenschaftstheorie richtig vorzugehen. Doch darum geht es natürlich nicht. Wie unschwer zu sehen, ließen sich auch bei den nachfolgenden „Krankheitsformenhypothesen“ genau die gleichen Überlegungen anstellen, worauf hier allerdings zunächst einmal verzichtet werden soll. Denn wie gesagt: Anlässlich der Frage nach den „Kriterien für Rationalität und Irrationalität“ werden wir noch in extenso auf die hier angesprochenen Problemzusammenhänge zurückkommen. Deshalb an dieser Stelle nur eine etwas grobe „Auflistung“, bei der es mir lediglich darauf ankommt, zu zeigen, dass und inwiefern Defizienzen in den theoretischen Voraussetzungen sich ganz automatisch auf Diagnostik, Prognostik und Therapie auswirken können. Es ist ganz einfach falsch, notorisch die vielbeschworene theoriekonstruierende „Praxis“ auszuspielen Grundlagenforschung, gegen denn es jedwedes ist nun Plädoyer für einmal eine wissenschaftslogische Binsenweisheit, dass symptomatologische Genauigkeit nie besser sein 129 kann als die hinter ihr steckende theoretische Präzision. Nur um die Demonstration dieses Gedankenganges geht es mir an dieser Stelle, denn ich will auf ein hierbei gleichfalls involviertes kulturwissenschaftliches Problem zusätzlich aufmerksam machen. An zweiter Stelle nennen Redlich und Freedman Neurosen, die, wie ich in enger Anlehnung an die Freud’sche Nomenklatur vorschlage, vornehmlich mit anankistischen Syndromen assoziiert sind. Ich weiche allerdings in diesem Punkt – wenn auch vermutlich nur geringfügig – von der Redlich/Freedman‘schen Kategorisierung ab, weil die Freud’sche Neurosenlehre, wie ich meine: aus guten Gründen, dazu tendiert, Zwangskrankheiten und „halluzinatorische Psychosen“ zu trennen.124 Die Autoren fassen – dies vermutlich in Anlehnung an Erikson – Neurosen und Soziopathien zu einer Einheit zusammen. Es ist klar, dass ich mich meiner bisherigen Argumentationsstruktur zufolge gegen eine solche Konfusion von juristischen und psychiatrischen Begriffen verwahren muss: Zwar gibt es ganz sicher „Schwerstkriminelle“, die zugleich gravierende Verhaltensstörungen aufweisen, unsere Systeme der sozialen Kontrolle jedoch verbieten eine solche Konfundierung mit gutem Grund: Es ist für die Systemintegration einer bestimmten Gesellschaft nicht gleichgültig, in welchen Kompetenzbereich das Umgehen mit ganz bestimmten Formen der Devianz fällt. Zwar mag der letztendliche Zweck von „Strafjustiz“ und „Therapie“ kulturell derselbe sein, nämlich „Gesellschaftsschutz“ (social deffence) bzw. Re-Sozialisation des Delinquenten sowie des Kranken, die Methoden, die hierbei anzuwenden sind, sind es jedoch zweifelsohne auf gar keinen Fall. An dritter Stelle werden die psychosomatischen Krankheiten genannt. Es handele sich dabei, so Redlich und Freedman, um eine „Gruppe von organischen Funktionsstörungen“ mit „unbekannter Ätiologie ..., bei denen psychogene Faktoren eine hervorragende Rolle spielen.“ ( ???) Auch hierbei weisen die Autoren zu Recht daraufhin, dass zumeist eine präzise differenzialdiagnostische Vorgehensweise unmöglich ist: „Einige von ihnen [gemeint sind die 124 Ich stütze mich hierbei vor allem auf das schon beinahe „genialisch“ zu nennende Fragment Freuds über die „Zwei Prinzipien des psychischen Geschehens“, wo das jeweilige Ausmaß an Realitätsfugativität zum Kriterium genommen wird, ob ein Patient „noch“ zwangsneurotisch genannt werden kann, oder ob er als Psychotiker eingeschätzt werden muss. Eine akribische texthermeneutische Analyse dieser Schrift muss ich mir leider versagen. 130 psychosomatischen Krankheiten] stehen den Neurosen näher, andere weisen enge Beziehungen zu Psychosen auf.“125 Man sieht bereits – und um mehr geht es mir an dieser Stelle zunächst einmal nicht – dass selbst so hervorragende Fachleute, wie zweifelsohne Redlich und Freedman es sind, sich durchaus schwer tun mit einer differenzialdiagnostisch präzise handhabbaren Symptomatologie, welche streng theoretisch durchzukonstruieren wäre. Vor allem die beiden Hauptkategorien von Verhaltensstörungen, die Psychosen und Neurosen, seien „keineswegs immer deutlich gegeneinander [abgrenzbar].“Und letztendlich gäbe es „de facto ja ohnehin auch“ keine „scharfe Trennungslinie zwischen normalen und abnormen Verhalten.“126 Mit anderen Worten: Es gibt ganz einfach keine hinreichend scharfen Kriterien, um ein auch symptomatologisch handhabbares Klassifikationsschema zu erarbeiten, welches dem therapeutischen Umgehen mit „gestörtem Verhalten“ eine tatsächliche Hilfe wäre. Ja nicht einmal die wirklich scharfe Abgrenzung zwischen Schwerstkriminalität und Krankheit ist offenkundig möglich. Stellt aber denn dann nicht, so müssen wir fragen, das Verhältnis zwischen der juristischen Nomenklatur und der psychiatrischen Nomenklatur letztendlich doch ein Problem dar? „Ganz sicher“, so muss der Sozialwissenschaftler antworten, „jedoch handelt es sich dabei weder um ein juristisches noch um ein psychiatrisches Problem als solches.“ Es handelt sich nämlich um ein kulturwissenschaftliches Problem: Angesichts einer institutionellen Praxis, die mehr und mehr – und dies ganz sicher aus unbestreitbar humanitären Gründen – dazu tendiert, das Schuld- und Sühneprinzip im Strafrecht zugunsten von „Re-Sozialisation“ und „Therapie“ zu suspendieren, wird ja ganz automatisch den Funktionären der medizinischen Systemen der sozialen Kontrolle die prinzipiell fachfremde soziale Verantwortung aufgebürdet und damit wird, wie nach dem Vorhergegangenen unschwer erkennbar, vornehmlich der Psychiatrie die Kulturwertdebatte gewissermaßen „von außen“ aufgeherrscht. 125 Redlich/Freedman a.a.O. S. 16. 126 Dass ist den beiden Autoren in den späteren Abschnitten ihres Buches dennoch gelingt, steht außer Frage, geht es dort doch um die – wie ich finde: meisterhafte – Präsentation der klinisch-praktischen Kasuistik. Hier geht es aber ausschließlich um das Problem der „theoretischen Verortung“. Ich gestehe freilich zu, dass eine wirklich akribische texthermeneutische Analyse dieses vorzüglichen Lehrbuches sich selbstverständlich in dem hier gemeinten Sinne mit der von Redlich und Freedman vorgeführten klinisch-praktischen Kasuistik befassen müsste. Auf dieses Manko der vorliegenden Untersuchung hatte ich ja bereits anlässlich der „Relevanzbesprechung“ in der Einleitung hingewiesen. Genau dieselbe Einschränkung gilt naturgemäß hinsichtlich der Besprechung der (methodologischen) Schwächen des Resch’schen Lehrbuches. In der Tat ist „so gesehen“ die hier vorgeführte Kritik ein wenig unfair. 131 Interessanterweise ist bereits von Max Weber dieser Aspekt sehr klar gesehen worden, denn er schreibt mit deutlich warnender Stimme, hiermit explizit auf die kulturwissenschaftliche Dimension streng naturwissenschaftlich ausgerichteter Psychiatrie hinweisend: „Der Fachjustiz ... winkt auf kriminellem Gebiet die Entmündigung durch die FachPsychiater, auf welche zunehmend die Verantwortung gerade für die Beurteilung besonders schwerer Straftaten abgewälzt wird und denen damit der Rationalismus eine Aufgabe zuschiebt, welche sie mit den Mitteln echter Naturwissenschaft gar nicht lösen können.“127 Ich meine: Zumindest reden sollte man über genau dieses „Problem der Kulturwerte“ in den „klinischen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften“ (Max Weber). Dafür jedoch erscheint mir als Voraussetzung unabdingbar, die hierbei im Spiele befindlichen „Wertsphären“ – auch dies ein Terminus der Weberschen Kultursoziologie – analytisch scharf gegeneinander abzugrenzen: Während die medizinisch-psychiatrische Grundlagenforschung nur und ausschließlich dem ethischen Prinzip der „rationalen Wahrheitssuche“ ( Stegmüller) verpflichtet ist, ragen eben andere Kulturwerte als die der „Wahrheits- und Erkenntnisgewinnung“ in den humanitär eingefärbten „medizinsich-klinischen Dienst am leidenden Menschen“ hinein. 4.4. Interpretation: Ätiologie und symptomatologische Genauigkeit Soziologisch ist die Psychiatrie ebenso wie die Justiz ein organisatorisch durchgebildetes komplexes System der sozialen Kontrolle, die sich mittels einer eigenen Fachsprache und mit einem ganz bestimmtem kulturellen Auftrag auf das Verhalten der Individuen in unserer Gesellschaft bezieht. Wie Redlich und Freedman richtig gesehen haben, bezieht sich deshalb die psychiatrische Fachsprache als der Jargon einer sozialen Institution auf ganz bestimmte Tatbestände, die sie als Verhaltensmuster und damit als „typisch“ in einer generellen Form umschreibt, wobei in Gestalt eines kulturell vorgegebenen Menschenbildes in der Regel immer zugleich auch ein ganz bestimmtes Ideal desselben eine mehr oder weniger große Rolle spielt. Hierauf gehe ich später noch genauer ein, denn an dieser Stelle kommt es mir noch auf etwas anderes an. Prinzipiell nämlich lässt sich das terminologische Arsenal der Psychiatrie insgesamt als ein komplexes Klassifikationsschema in ähnlicher Weise, wie dies 127 Weber, M. [Wirtschaft und Gesellschaft] S. 511 132 in der Jurisprudenz geschieht, präsentieren, so dass auch in dieser Beziehung eine ziemlich weitreichende Analogie zu unseren als „strafrecht“ bekannten Systemen der sozialen Kontrolle besteht: Der klinische Mediziner ist ebenso wie der praktisch tätige Strafrechtler gezwungen, den in Frage stehenden „Tatbestand“ so präzise wie möglich zu beschreiben, weil davon die Wahl der Maßnahmen abhängt, die vorschreiben, wie man mit einem solchen – erwünschten oder unerwünschten – Tatbestand umzugehen hat. Wir haben es hier wesentlich mit einem Problem der Sprache zu tun: Existiert keine wirklich gut entwickelte Ätiologie, so kann eben auch keine wirklich treffsichere Diagnose formuliert werden. Bedenken wir, was weiter oben in Abschnitt II. 3. 2. in meinem Thesenkatalog zum Problem der „Wissenschaftlichkeit“ ausgeführt worden ist, so können wir nunmehr mit Blick auf das in Abschnitt II. 5. 5. dargestellte DN-Schema einer wissenschaftlichen Erklärung den folgenden streng allgemeinen Satz formulieren, der ja nichts anderes als eine Ableitung aus dem ist, was bisher entwickelt wurde und was, wie wir sehen werden, anhand des DN-Schemas selbst noch sehr viel genauer darstellbar ist: Je allgemeiner und präziser eine das infrage stehende Krankheitsgeschehen betreffende Theorie ist, welche eine entsprechend umfassende Ätiologie beinhaltet, desto präziser ist die Diagnose und desto genauer lässt sich zum einen eine Erklärung, zum anderen eine Prognose formulieren. Wie in II. 5. 2. (Objektivität), II. 5. 3. (Grundlagenforschung und „Anwendung“) und II. 5. 5. (DN-Schema) zu zeigen, gilt dieser Satz als zentrale wissenschaftslogische Einsicht, die für alle Formen des erfahrungswissenschaftlichen Denkens, Forschens und „Anwendens“ ebenso wahr ist wie er es für eine „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ ist, die sich dem Wissenschaftsideal verpflichtet. Es sind drei Fragen, die wir später erneut aufnehmen werden: 1. Was ist eigentlich eine „Diagnose“? 2. Warum ist die Beantwortung genau dieser Frage, die jeder Kliniker ja wohl problemlos beantworten und erläutern könnte, dennoch ein au fond wissenschaftstheoretisches Problem? 3. Könnte es u.U. sein, dass eine streng wissenschaftstheoretische Betrachtungsweise hinsichtlich einer exakten Abklärung des 133 Problems der „Diagnostik“ vielleicht doch selbst dem erfahrenen Kliniker ein wenig Hilfestellung zu leisten vermag? 5. Max Webers „Begriffslehre des Wissenschaftscharakter der Soziologie sozialen Handelns“ II: Der 5.1. Die Zielsetzung der Erfahrungswissenschaften und der Weg der Forschung – ein Tafelbild Welches ist die Zielsetzung der Erfahrungswissenschaften? Wie verfolgt und realisiert sie diese? Welches sind ihre wichtigsten „Instrumente“? In welchem Verhältnis stehen sie zu denjenigen Formen „rationalen Handelns“, die auf „Wirklichkeitsveränderung“ abzielen? Was kann eigentlich „Forschung“ heißen? Worin genau besteht der „Wissenschaftscharakter“ der „Soziologie“ und in welch einem Verhältnis steht diese wiederum zu den sog. „Verhaltenswissenschaften“? Das sind die Fragen, denen ich mich nunmehr, nachdem im obigen „Thesenkatalog“ schlagwortartig diese Probleme angesprochen worden sind, zuwenden werde. 134 Beginnen wir mit einem Tafelbild. Es wurde dem Lehrbuch von Mario Bunge entnommen128 und ist hier für unsere Bedürfnisse etwas abgeändert worden: Angewandte Wissenschaften Normative Wissenschaften Ästhetik Rechtswissenschaft Ethik Mathematik F ormale Wissenschaften Technologie Ingenieurswissenschaften Logik Maschinenbau BWL Physik Chemie Naturwissenschaften Biolog ie Wissenschaften Chirurgie Orthopädie etc. Ökonomie Pädiatrie Soziologie Ethnologie Systematische Sozialwissenschaften Erfahrungswissenschaften Psychologie Medizin Psychiatrie Ling uistik Politische Wissenschaft Pädagogik Humanwissenschaften Pädo-Psychiatrie Wirtschaftsgeschichte Sozialgeschichte Vergleichende Sprachwissenschaft Historische Sozialwissenschaften Politische Ge schichte Ideengeschichte Literaturgeschichte Tafelbild 1 Interpretation: Richten wir zunächst einmal, bevor wir uns auf das dahintersteckende wissenschaftstheoretische Problem einlassen, unsere Aufmerksamkeit auf die vier rechtsbefindlichen Spalten, so wird, wie ich finde, ziemlich eindeutig klar: Der derzeitig klinisch arbeitende Mediziner ist, methodisch in den Erfahrungswissenschaften geschult, in erster Linie ein naturwissenschaftlich ausgebildeter Praktiker, auf dessen Kompetenz man sich als hilfesuchender Patient getrost verlassen kann, wenn man ihn wegen bestimmter 135 somatisch ziemlich eindeutig identifizierbarer Leiden aufsucht. Die Pädiatrie beispielsweise ist, insofern sie wirklich „Kinderheilkunde“ sein will, als eine Abteilung der klinischen Medizin eine angewandte Naturwissenschaft und folgerichtig wurzelt ihre Ätiologie in genau denjenigen gutbestätigten Theorien der vornehmlich biochemisch ausgerichteten Naturwissenschaften, die sich z.B. mit bestimmten Stoffwechselanomalien befasst haben. Die Pfeilstruktur in den Spalten 9, 11 und 12 spiegelt, wenn wir unsere Aufmerksamkeit dabei auf die Kinderheilkunde richten, relativ gut, wie ich finde, diesen Tatbestand wider: Solide Kenntnisse in Biologie, Chemie und Physik gehören zum Ausbildungsfundus eines Pädiaters, der, wenn er überdies ein zumindest halbwegs gutes Verhältnis zu seinen Mitmenschen hat, eben auch ein „guter“ sowie „fachlich kompetenter“ Kinderarzt ist. „Soziologie“ dürfte ihm fremd sein und das u.U. nötige psychologische Wissen gehört seiner Auffassung zufolge ohnehin zur Allgemeinbildung. Die gestrichelten Pfeile sollen dies verdeutlichen, wobei der dünn durchgezogene Pfeil, der von der Psychologie zur Medizin und über die Pädagogik sodann auch zur Pädo-Psychiatrie führt, auf ein Sonderproblem verweisen soll. Wie nämlich, so muss man fragen, lässt sich erklären, dass Psychologie in den letzten Jahren/Jahrzehnten mehr und mehr hat Eingang finden können in das medizinische Grundlagenwissen, ja offenkundig mittlerweile sogar von den meisten Medizinern als Bestandteil des Ausbildungsprozedere geschätzt wird? Die Antwort dürfte nicht schwer fallen: Einerseits ist die Psychologie mittlerweile sehr stark in den Naturwissenschaften verankert, andererseits repräsentiert sie in ihren populärwissenschaftlichen Publikationen Forschungsergebnisse, die sehr stark auf das ohnehin umlaufende psychologische Allgemeinwissen ausgerichtet und folglich auch entsprechend leicht konsumierbar sind. Unbestreitbar reicht das ja auch in den meisten Fällen. Prekär auch und gerade für den traditionell praktizierenden Pädiater hingegen werden die sog. „Grenzdiagnosen“: Asthmaerkrankungen, hartnäckige Formen der Enuresis und natürlich die Anaroxieformen weisen auf psychosomatische Tatbestände, die eine gewisse Hilflosigkeit des Klinikers erzeugen, wie man weiß. Der Punkt, auf den es mir hier ankommt, ist der folgende: Werden „Grenzprobleme“ diagnostisch akut, so ist jeder Problembereich notwendigerweise zugleich auch immer mit dahintersteckenden methodologischen Problemen konfrontiert, und genau diese kommen 128 Vgl. M.Bunge [Scientific Research I], S. 24 136 selbst in den besten Schulungskursen nicht zur Sprache.129 In genau dieser Beziehung soll das obige Schaubild lehrreich sein. Man sieht nämlich bereits an den Zuordnungsstrichen bzw. – Pfeilen, dass man sich bei diesem Schaubild – es ist, wie gesagt, dem Lehrbuch von Bunge entnommen und ein wenig abgeändert worden – durchaus schwer tut: Erstens sind die Abhängigkeiten nicht eindeutig und zweitens kann das Schaubild der Tatsache natürlich nicht Rechnung tragen, dass sich diese Abhängigkeiten fortlaufend ändern und umgruppieren. Fragen wir woran das liegt, dass sich noch nicht einmal ein halbwegs plausibles Klassifikationsschema konstruieren lässt, so liegt das, wie ich meine, vornehmlich an zweierlei: Soziologisch sind Wissenschaften soziale Institutionen, verkörpern mithin komplexe rollenstrukturell beschreibbare Handlungszusammenhänge mit ganz bestimmten Organisationsstrukturen und „Aufgabenbereichen“. Dies das eine. Bereits jedoch, wenn es darum gehen soll, die Aufgabenbereiche genauer zu spezifizieren, ist unschwer zu sehen, dass eine präzise Spezifikation und damit natürlich auch die entsprechende Klassifikation diese Aufgabenbereiche auf Deutungen beruht, die uns die strenge Wissenschaftslehre zur Verfügung stellt. Diese Deutungen jedoch sind eben zum Teil hoch kontrovers. Ich habe deshalb trotz massiver Bedenken ein Schaubild gewählt, welches ungefähr auf derjenigen Deutung beruht, die ich in dem obigen Thesenkatalog vorgestellt habe. Die etwas kräftiger gezogenen Linien sollen dies veranschaulichen. Das bedeutet, dass ich weniger am institutionellen als vielmehr am erkenntnistheoretischen Aspekt des „Wissenschaftsproblems“ interessiert bin, geht es mir doch erklärtermaßen um die „Einbringung“ des genuin soziologischen „point of view“ im Hinblick auf die Psychiatrie, und hierbei wiederum wesentlich um das Verhältnis zwischen „Grundlagenforschung“ und „Anwendung“. Sowie dies klar ist, ergeben sich nämlich doch zumindest einige „feste Linien“, die deutlich werden, 129 Ein noch in den 60er Jahren im Thieme-Verlag erschienenes, von Heinz Mattern, Ursula Porath und Kurt Schreier verfasstes und seinerzeit recht intensiv genutztes Lehrbuch der Kinderheilkunde, hatte den bezeichnenden Titel „Die angeborenen Stoffwechselanomalien in der Prä- und Postnatalperiode“ und dokumentiert sehr schön die Überzeugung der Autoren, „gute“ Kinderheilkunde sei angewandte Naturwissenschaft. Die Autoren haben sich später sehr stark bemüht, in Schulungskursen ihre psychologischen Kenntnisse zu verbessern und zu vertiefen, eine Notwendigkeit, die ihnen durch ihre klinisch-praktische Arbeit aufgeherrscht wurde [persönliche Auskunft]. Nie jedoch haben sich diese Bemühungen sodann auch in den späteren Neuauflagen dieses Lehrbuchs irgendwie niedergeschlagen, was bedeutet: Man war schlichtweg nicht in der Lage, das mittlerweile recht mühselig erworbene psychologische bzw. sozialpsychologische Grundlagenwissen in den ursprünglich radikalen naturwissenschaftlichen Ansatz dieses Lehrbuches integrativ einzuarbeiten. In der Tat ist dies ohne Methodologie auch gar nicht denkbar. 137 wenn ich das in Erinnerung rufe, was in dem obigen „Thesenkatalog“ vorgestellt wurde, nämlich: Wissenschaften, so hieß es dort, seien „rationale Formen der Wahrheitssuche“, die sich arbeitsteilig in normative Wissenschaften ( Ästhetik, Ethik, Rechtswissenschaft), in formale Wissenschaften ( Mathematik, Logik), in Erfahrungs- bzw. Wirklichkeitswissenschaften und in die sog. „angewandten Wissenschaften“ zerlegen lassen. Als Kriterium fungiert hierbei das Merkmal, dass es sich wesentlich um ganz bestimmte Aussagenstrukturen handelt, die hierbei in Frage kommen: Erstens normative Sätze bzw. Werturteile, zweitens Satzsysteme, die nur dem Widerspruchsfreiheitspostulat zu genügen haben (Mathematik und Logik) – hier folge ich dem Bungerschen Lehrbuch – und drittens erfahrungswissenschaftliche Satzsysteme, welche außer, dass sie dem Widerspruchsfreiheitspostulat zu genügen haben, zusätzlich noch so „gebaut“ sein müssen, dass sie empirischen Gehalt besitzen. Nur dann nämlich sind sie überhaupt „anwendbar“, denn nur dann auch können sie Erklärungen liefern und gestatten nur dann auch die Formulierung von Prognosen, welche selbst wiederum von entscheidender Bedeutung für die Wahl eventueller therapeutischer Maßnahmen sind, wie bereits in Abschnitt II. 3. 2. hervorgehoben. Man sieht, wie sehr hier alles zugeschnitten ist auf das von uns ins Zentrum gestellte Problem des Verhältnisses zwischen „Forschung“ und „Anwendung“ woraus sich ergibt: Vor allem die Erfahrungswissenschaften sind es, die uns hier interessieren, liefern uns diese doch in erster Linie diejenigen „Erkenntnisinstrumente“, mittels derer wir die natürliche wie soziale Welt, in der wir leben, rational durchzukonstruieren und vernünftig umzugestalten im Stande sind, wobei wir im Zuge dieser vernunftgeleiteten Tätigkeiten permanent Neues „an“ und „in“ unserer Welt entdecken bzw. zu entdecken hoffen. Das Erkennen von Zusammenhängen, die Entdeckung von Neuem, die (wahrheitsfähige) Beschreibung von Tatbeständen sowie die Erklärung derselben bzw. deren Voraussage und schließlich die sinnvolle bzw. vernünftige Veränderung von „Wirklichkeit“ designieren gewissermaßen die Systemziele wissenschaftlichen Handelns130 und dafür bedarf es eben ganz bestimmter 130 Mein Kollege Julian Rudolph, der sozusagen die „philosophische Position“ in unserer Forschungsgruppe vertritt, hat seine Magisterarbeit über den mittlerweile als „Marxist“ verfemten Wissenschaftstheoretiker und Sozialpsychologen Klaus Holzkamp verfasst. Dessen Hauptwerk hat den Titel „Wissenschaft als Handlung“ und hier findet sich auch die bereits weiter oben gebrauchte Formel des „Willens zur Wissenschaft“. In den mittlerweile fast vergessenen Arbeiten Klaus Holzkamps wird insbesondere das Verhältnis zwischen „Grundlagenforschung“ und „Angewandter Wissenschaft“ ausführlich erörtert. Ich stütze mich hierbei allerdings nicht so sehr auf die Holzkamp’schen Ausführungen selbst als vielmehr auf die Arbeit von Julian Rudolph [Störende Bedingungen]. 138 Instrumente oder auch, wenn man so will ganz bestimmter Erkenntnisinstrumente. Diese „Erkenntnisinstrumente“ nun, nennen wir die erfahrungswissenschaftlichen Theorien. Wie ebenfalls im Thesenkatalog hervorgehoben, müssen wir scharf unterscheiden zwischen den Sozialtheorien welche, zumeist noch in Umgangssprache abgefasst, „normales Wissen“ hinsichtlich der Strukturen unserer sozialen Welt beinhalten und sozusagen den weltanschaulichen Inhalt ausmachen, der unser lebenspraktisches Erkennen verkörpert, und den im engeren Sinne sozialwissenschaftlichen Theorien, die auf „Wahrheitsfähigkeit“ abzielen. Interessieren muss uns nämlich deren Verhältnis zueinander, welches grob folgendermaßen beschrieben werden kann: Erfahrungswissenschaftlich organisierte sozialwissenschaftliche Theoriegebilde, die ja gemäß bestimmter Objektivitätskriterien auf eine ganz bestimmte Art und Weise konstruiert und empirisch überprüft werden müssen, können nur dann die entsprechend gesicherte kognitive Grundlage z.B. für eventuelle therapeutische Maßnahmen bilden, wenn sie zu festen Bestandteilen unseres Wissenschaftswissens geworden und in die bereits bestehenden Theoriegebilde desselben integriert wurden. Bezogen auf unser „normales“ Alltagswissen verkörpern sie immer ganz bestimmte Problematisierungen dieses in Alltagssprache eingelagerten sozialtheoretischen Wissens, woraus sich nunmehr zwanglos die bekannte folgende Formel ergibt: Erfahrungswissenschaften greifen über unser normales und in der Regel in Umgangssprache verfasstes „Wissen von dieser Welt“ hinaus, verfremden und problematisieren es und zwingen uns, die Normalwelt, in der wir leben, mit ganz anderen Augen zu sehen. So wird die uns erscheinende „Wirklichkeit“ sozusagen auf der Grundlage unseres wissenschaftlichen Wissens neu konstruierbar. In klassischer ideologiekritischer Weise ausgedrückt heißt das: Erfahrungswissenschaften problematisieren die Erscheinungsebene und stellen neue Formen „konstruktiv-selektive“ Partialkonzeptualisierungen der Wirklichkeit dar, wobei sie um des Eindringens in tiefere Strukturen des wirklichen willen, die sozialtheoretischen Alltagssicherheiten notorisch in Frage stellen.131 Um dies aber überhaupt zu Stande bringen zu können, bedarf es künstlich geschaffener Fachterminologien und in „weberianischer“ Sprache ausgedrückt heißt das: Die in umgangssprachlicher Begrifflichkeiten verfassten Wirklichkeitsbeschreibungen und- Erklärungen müssen mittels idealtypischer Konstrukte in wissenschaftlicher Absicht umgearbeitet, gegebenenfalls sogar neu geschaffen werden. 131 Vgl. hierzu die einschlägigen Ausführungen im [Forschungsantrag] 139 An Hand des Rollenbegriffs hat seinerzeit Popitz sehr eindrucksvoll das Schicksal eines Begriffes geschildert, der zunächst als idealtypische Konstruktion seiner „Verfremdungsaufgabe“ sehr gut erfüllt hatte, dann jedoch, erneut zum festen Bestand umgangssprachlichen sozialtheoretischen Wissens geworden, diese analytische Kraft nahezu vollständig einbüßte: „Rolle, Rollenspieler, Rollenverhalten: mit diesen Worten verbindet sich häufig die erste allgemein-theoretische Abstraktion der Soziologie, die dem Soziologie-Studenten wirklich einleuchtet. Sie sind offensichtlich besonders geeignet, sowohl Phänomene zu »zeigen«, wie gleichzeitig ein distanzierendes Sehen zu lehren, das Allzunahe der sozialen Alltagserfahrung zu verfremden, das Selbstverständliche unselbstverständlich und merkwürdig zu machen. gesellschaftlicher Zusammenhänge 132 Leider jedoch sei dieser Rollenbegriff sodann wieder in den Alltagsbegriff der Umgangssprache überführt worden und habe eine solche triviale Selbstverständlichkeit erlangt, dass seine ursprüngliche Verfremdungsleistung mittlerweile fast vollständig verlorengegangen sei: „Aber so verhältnismäßig leicht der Rollen-Begriff diesen Dienst leistet so schnell verliert er wieder auch seine Funktion: er geht allzu rasch in den eigenen Sprachgebrauch ein, führt zu uferlosen Assoziationen, läßt sich beliebig in Szene setzen. Man kann eben mühelos alle sozialen Erfahrungen »aufrollen«. Die Beliebtheit des Begriffs deckt sich schließlich mit seiner grenzenlosen Brauchbarkeit als Formulierungsschablone. Der Kreis ist bald geschlossen: Der Begriff der sozialen Rolle dient heute der Geburt der soziologischen Distanz und fast zugleich ihrem Begräbnis“.133 132 Popitz [Soziale Rolle] S. 3, Hervorhebung durch mich Ch. K. 133 ibid. 140 5.2. Die „Objektivität“ der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis: Max Webers Postulate, der wissenschaftstheoretische Thesenkatalog von II. 3 .2. und einige Überlegungen zu Diagnostik, Prognostik und Therapie Der in methodischer wie in methodologischer Hinsicht wohl wichtigste Aufsatz Max Webers zum Problem des Wissenschaftscharakters der Soziologie, den dieser im Jahre 1904 anlässlich der Übergabe der Zeitschrift „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik“ an das neue Redaktionskollegium (Sombart, Weber, Jaffé) wie ein „Manifest der Wissenschaftlichkeit“ gestaltet hat, trägt den Titel „Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis“. Nach unser aller Auffassung hat dieser Aufsatz nach wie vor nichts von seiner Faszination verloren, sind doch die erkenntnistheoretischen Grundlagenprobleme der Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaften, die hier zur Sprache gekommen sind, gerade weil sie sich auf „Sinn und Grenzen rationaler Erkenntnis“ überhaupt beziehen, wie Winckelmann in seiner „Vorbemerkung“ zur Neuherausgabe von 1973 richtig sagt, eigentlich bis auf den heutigen Tag ungelöst geblieben.134 Ausgehend von der Einsicht, dass das „Merkmal wissenschaftlicher Erkenntnis in der objektiven Geltung ihrer Ergebnisse als Wahrheit erblickt werden“ müsse135, untersucht Weber hier die Frage, „ob und in welchem Sinn es objektiv gültige Wahrheit auf dem Boden der empirischen Wissenschaften vom Kulturleben überhaupt geben“ könne136 und fasst die „Antwort auf die Frage nach den Bedingungen, die eine Objektivität in diesem Sinne im Bereich kulturwissenschaftlicher 134 Johannes Winckelmann [Anmerkungen und Erläuterungen] S. 533. Ich kann heute kaum noch sagen, wie oft im Laufe der letzten sechs Jahre gerade dieser Aufsatz Max Webers beziehungsweise bestimmte Textauszüge aus ihm zum Gegenstand intensivster Auseinandersetzungen in unserer Forschungsgruppe geworden sind. Bei der Durchsicht der Interpretationen und Kommentare zu diesem „kulturwissenschaftlichen Objektivitätsmanifest“ musste immer wieder festgestellt werden, wie wenig dessen Erkenntnisgehalt analytisch eigentlich durchdrungen worden ist. Dass hier auf eine ganz besondere Art und Weise beschriebene Verhältnis zwischen idealtypologisch gefasster Grundbegrifflichkeit, Theoriebildung und Werturteilsproblematik, welches nach Porath’s Meinung die eigentliche Kernfrage vor allem der sog. Integrationsproblematik ist, scheint tatsächlich bis zum heutigen Tage, wie ich es ja auch in meinem wissenschaftstheoretischen Thesenkatalog betont habe, ein ungelöstes methodologisches Problem geblieben zu sein. Vgl. vor allem die hierzu einschlägigen Ausführungen im [Forschungsantrag], die zu zitieren ich mir weiter oben vor allem deshalb erlaubt habe, weil sie ja bislang noch nicht in Buchform publiziert sind. 135 Winckelmann, J., a.a.O., S. 533 136 ibid. 141 Erkenntnis, d.h. also als Wahrheitssuche, allererst ermöglichen“137, in drei Grundpostulaten zusammen, die sich erstens auf den „Theoriecharakter des wissenschaftlichen Erkennens“, zweitens auf die „Bildung scharfer Begrifflichkeiten“ und drittens schließlich auf die „strenge Trennung von Erfahrungswissen und Werturteil“ beziehen. In der ersten Anmerkung zu seinen Ausführungen hierzu heißt es: „Daß das Archiv niemals in den Bann einer bestimmten Schulmeinung geraten wird, dafür bürgt der Umstand, daß der Standpunkt nicht nur seiner Mitarbeiter, sondern auch seiner Herausgeber, auch in methodischer Hinsicht, keineswegs schlechthin identisch ist. Andererseits war natürlich eine Übereinstimmung in gewissen Grundanschauungen Voraussetzung der gemeinsamen Übernahme der Redaktion. Diese Übereinstimmung besteht insbesondere bezüglich der Schätzung des Wertes t h e o r e t i s c h e r E r k e n n t n i s unter »einseitigen« Gesichtspunkten, sowie bezüglich der Forderung der B i l d u n g s c h a r f e r B e g r i f f e und der strengen S c h e i d u n g v o n E r f a h r u n g s w i s s e n u n d W e r t u r t e i l, wie sie hier – natürlich ohne den Anspruch, damit etwas »Neues« zu fordern – vertreten wird“.138 Wie mein Kollege Julian Rudolph, der die philosophische Abteilung unserer Arbeitsgruppe vertritt, zu Recht hervorgehoben hat, hat Weber hier nicht nur die Prinzipien sozialwissenschaftlicher Erkenntnis, sondern vielmehr die Prinzipien erfahrungswissenschaftlicher Erkenntnis überhaupt formuliert. Bleibt nur noch hinzuzufügen, dass diese dreigestaltige Postulatorik Webers sich mit Blick auf die moderne wissenschaftstheoretische Forschung noch um drei Postulate ergänzen lässt139, nämlich um das Postulat der prinzipiellen Widerspruchsfreiheit, um das Postulat der prinzipiellen Falsifizierbarkeit und um das Postulat der strengen „Trennung von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang. Der Deutlichkeit halber liste ich an dieser Stelle die ersten fünf Postulate auf, wohingegen ich das sechste Postulat, da es sich explizit auf die Argumentationsstruktur rationaler Diskursformen überhaupt bezieht, im Anschluß behandeln werde: 137 ibid. 138 Max Weber [Objektivität] S. 146 Hervorhebungen durch mich Ch. K. 139 vgl. hierzu meinen Thesenkatalog 142 1. Wann immer wir von erfahrungswissenschaftlicher Erkenntnis sprechen, ist für diese unabdingbar, dass sie ihre Voraussetzungen in expliziten Theoriesystemen formuliert. Es geht also nicht nur um die „Wertschätzung“ theoretischer Erkenntnis als solche. Es geht vielmehr darum, dass theoretische Erkenntnis in explizit ausformulierten Hypothesensystemen dargelegt werden muss, wenn man Forschung betreiben und über bestimmte thetisch vorgetragene Argumentationsstrukturen Konsens erzielen will. Entschließt man sich nämlich tatsächlich, dem Holzkamp’schen Vorschlag Folge leistend „Wissenschaft als Handlung“ aufzufassen, dann ist das selbst dem Objektivitätspostulat noch übergeordnete – mithin in diesem Sinne „oberste“ – Prinzip vernünftigen wissenschaftlichen Argumentierens überhaupt das Postulat der intersubjektiven Überprüfbarkeit: Zum einen muss die Forschergemeinschaft eine begrifflich weitgehend homogenisierte Sprache sprechen, um überhaupt bezüglich bestimmter Thesen und Argumentzusammenhänge verbindlich befinden zu können, zum anderen bedürfen bestimmte Erklärungsvorschläge aus Gründen, welche die Optimierbarkeit der Prüfbarkeitsbedingungen betreffen, der Explizitmachung der die jeweilige „Erklärung“ leistenden theoretischen Prämissen. Die Explizitmachung der Voraussetzungen vernünftigen Argumentierens überhaupt ist zugleich auch die notwendige Bedingung für Objektivität. Vgl. hierzu weiter unten die Ausführungen zum „DN-Modell einer wissenschaftlichen Erklärung“. 2. Wann immer wir von erfahrungswissenschatlicher Erkenntnis sprechen, ist für diese unabdingbar, dass sie ihre Theorien bzw. Hypothesensysteme mit scharfen Begriffen zu konstruieren versucht. Dieser Punkt ist deswegen von hervorragender Bedeutung, weil dieses Postulat, wie bereits mehrfach betont, präzisierungsbedürftig ist. Denn wie im obigen „wissenschaftstheoretischen Thesenkatalog“ expressis verbis gezeigt, ist das Verhältnis zwischen den Begriffen einer Wissenschaft und ihren Hypothesensystemen (Theorien) klärungsbedürftig: Zwar können nur Hypothesen bzw. Theorien wahr oder falsch sein, wohingegen auf Begrifflichkeiten als solche der Maßstab von Wahrheit oder Falschheit nicht anwendbar ist, jedoch können sich die entsprechenden Begrifflichkeiten für die Konstruktion und empirische Validierung dieser Hypothesensysteme (Theorien) mehr oder weniger gut eignen, und aus genau diesem Grunde bedarf es „scharfer Begriffe“, die entweder als „Arbeitsbegriffe“ zu formulieren sind, oder aber, wenn sie in den sog. „Grundannahmen“ bzw. „Fundamentalannahmen“ Verwendung finden sollen, als Idealtypen zu konstruieren sind. 143 3. Wann immer wir von erfahrungswissenschaftlicher Erkenntnis sprechen, gilt, dass Aussagen, welche den Anspruch auf empirische Geltung erheben, scharf unterschieden werden müssen von Aussagen welche Werturteile repräsentieren, was sich zu folgender Formel verdichten lässt: Beinhaltet eine Aussage ein Werturteil, dann ist sie keine erfahrungswissenschaftliche Aussage, und ist sie eine erfahrungswissenschaftliche Aussage, dann beinhaltet sie kein Werturteil. Ebenso wie auf „Begriffe“ ist auch auf „Werturteile“ der Maßstab von Wahrheit und Falschheit nicht anwendbar. 4. In engstem Zusammenhang mit dem obigen Postulat der intersubjektiven Überprüfbarkeit steht das deshalb an gleicher Stelle stehende Prinzip für alle vernünftigen bzw. sinnvollen Systeme von Aussagen: Das Widerspruchsfreiheitsprinzip. Dieses Prinzip gilt also nicht nur für erfahrungswissenscahftliche Aussagensysteme, es geht vielmehr als Fundamentalprinzip in jedes sinnvolle Aussagensystem ein, denn es handelt sich hier um ein Grundprinzip des vernünftigen Argumentierens überhaupt. Selbstverständlich gilt es für erfahrungswissenschaftliche Aussagensysteme in besonderem Maße. Diese Ausweitung des Postulats der Widerspruchsfreiheit muss uns weiter unten noch in besonderem Maße interessieren: Für diejenigen zu Theorien zusammengestellten Hypothesensysteme, die Anspruch auf empirische Geltung erheben, gilt das Widerspruchsfreiheitsprinzip, weil aus einer in sich widersprüchlichen Aussage beliebig viele Aussagen logisch ableitbar sind, was konkret heißt: Widersprüchliche Aussagensysteme haben, da sie keinen Informationsgehalt haben, auch keine Erklärungskraft und folglich lassen sich aus einem in sich widerspruchsvollen Aussagegebilde auch keine Prognosen ableiten: Wenn zugleich gilt, dass es morgen regnen wird und nicht regnen wird, dann lässt sich trivialerweise überhaupt keine Voraussage über das morgige Wetter machen. Dennoch ist Widerspruchsfreiheit lediglich die notwendige Bedingung, nicht jedoch die hinreichende Bedingung für Aussagen mit empirischem Geltungsanspruch, wie ein Blick auf unser obiges Tafelbild lehrt: Zweifellos müssen die Aussagen und Aussagensysteme der „Formalwissenschaften“ Mathematik und Logik widerspruchsfrei sein, die Hypothesen der Erfahrungswissenschaften jedoch müssen darüber hinaus so konstruiert sein, dass sie, wie allgemein gesagt zu werden pflegt, mit der „Wirklichkeit in Konflikt“ geraten können: Sie müssen falsifizierbar sein, wozu weiter unten mehr. Hier ist zunächst einmal lediglich festzuhalten, dass vor allem das Postulat der Widerspruchsfreiheit ein Fundamentalprinzip jedweden „vernünftigen Redens“ ist. Anhand der Gadamerschen Analyse des „Gespräches“ soll deshalb in einer sozusagen „idealtypischen Weise“ die Struktur aller vernunftorientierten Formen des 144 Argumentierens aufgezeigt werden. Indem gezeigt werden kann, in welcher katastrophalen Art und Weise sich kontradiktorische (widerspruchshaltige) Formen des Argumentierens auf jedweden Diskurs auswirken, kann zugleich auch gezeigt werden, das, inwiefern und warum das Postulat der Widerspruchsfreiheit konstitutiver Bestandteil vernünftigen Diskursverhaltens überhaupt ist. 5. Es wurde bereits angesprochen: Damit eine Aussage als eine erfahrungswissenschaftliche Aussage im strengen Sinne angesehen werden kann, muss sie so konstruiert sein, dass sie mit bestimmten Erfahrungen in Konflikt geraten kann. Streng logisch gebaute Aussagen unterliegen lediglich dem Prinzip der Widerspruchsfreiheit. Würde man dieses Postulat alleine geltend machen für erfahrungswissenschaftliche Aussagen, so würde dies nichts nützen. Logisch wahre Aussagen sind unterbestimmt im Hinblick auf ihrem empirischen Geltungsanspruch, weil sie keinen möglichen Fall ausschließen. So ist der bekannte Spruch: „Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann wird das Wetter anders oder es bleibt wie es ist“, zweifellos eine in sich widerspruchsfreie wahre Aussage, da ihre Bedeutung ausschließlich von den in ihr auftretenden logischen Zeichen („wenn-dann“, „und“, „oder“, „nicht“ etc.) bestimmt ist. Auch sie jedoch ermöglicht keine Prognosen, ist mithin niemals im Hinblick auf prognostische Momente „widerlegungsfähig“. Die strenge Wissenschaftslehre drückt den hier gemeinten Tatbestand so aus, dass eine nicht falsifizierbare Aussage, gerade weil sie sozusagen ein bißchen „zu wahr“ ist, eine Aussage ohne empirischen Gehalt und damit auch ohne Erklärungskraft und ohne prognostische Relevanz ist. Versuchen wir nunmehr, zwischen den drei Weberschen Postulaten und den bereits ausgeführten wie auch noch zu nennenden methodischen Ergänzungen zu diesen einen Zusammenhang herzustellen mit unserer Grundfragestellung und beziehen die hier vorgeführte Postulatorik auf die obigen kritischen Ausführungen zur gegenwärtigen „Theorie und Praxis der Psychiatrie“. Vornehmlich das Postulat der „scharfen Begrifflichkeit“ interessiert uns in diesem Zusammenhang, ist es doch augenscheinlich direkt bezogen auf die genuin syptomatologische Problemlage, auf den Zusammenhang zwischen Ätiologie, Anamnese, Diagnostik und Prognostik also, wie ja bereits weiter oben angesprochen worden ist: Die Offenlegung des jeweiligen Ursachengefüges einer „Krankheit“, ist gebunden an eine empirisch falsifizierbare Theorie des Krankheitsgeschehens, und aus dem Blickwinkel einer solchen Theorie ergeben sich die jeweiligen Möglichkeiten der Anamnese, Diagnostik und Prognostik. 145 Erinnern wir uns an die oben abbreviativ vorgestellte Krankheitsformenlehre, wie sie sich in dem „Redlich/Freedman“ findet, so ist auffällig, dass hierbei das Postulat der scharfen Begrifflichkeit ganz offensichtlich notorisch verletzt wird. Fragen wir ganz konsequent, wozu wir eigentlich wirklich scharfe Begriffe benötigen, so lässt sich nunmehr die obige These zuspitzen: Die Begriffe für die diagnostische Symptomatologie müssen wegen der Konsequenzen, die sich im Hinblick auf die therapeutische Zielsetzung ergeben, scharf gefasst werden. Wir haben hier eine völlig analoge Situation zur derjenigen, die wir in einem Strafprozess beobachten können. Da die Konsequenzen an die genaue begriffliche Umschreibung der Tatbestände gebunden sind, ist es gerade nicht gleichgültig, ob dem Angeklagten „Mord“, „Todschlag“, „Körperverletzung mit Todesfolge“ oder „fahrlässige Tötung“ vorgeworfen wird. Ebenso ist es mit der Diagnostik: Das fragliche Syndrom muss symptomatologisch so genau erfasst werden können, dass sich die eventuellen therapeutischen Eingriffe ganz gezielt vornehmen lassen, beruhen diese doch, wie gezeigt, auf einer ganz bestimmten Prognose. Was aber bedeutet dies? Nun, zunächst einmal ist klar, dass eine metaphorische Begriffssprache in Jurisprudenz und Medizin völlig untauglich wäre. Man könnte ganz einfach nicht damit arbeiten. Doch hier liegt nicht der entscheidende Punkt, auf den es mir hier ankommt. Mit kommt es vielmehr auf den systematischen Zusammenhang an, der zwischen der Struktur erfahrungswissenschaftlicher Theoriegebilde – genauer: deren Niveau – und den aus diesen abgeleiteten Beschreibungs- Erklärungs- und Prognosemöglichkeiten besteht. Die Begriffe für die diagnostische Symptomatologie können nämlich umso schärfer gefasst werden, je besser eine empirisch falsifizierbare theoretische Grundlage für eine gute Ätiologie sorgt. Eine gute Ätiologie jedoch ist gleichbedeutend mit einer entsprechenden „guten“, d. h. erklärungskompetenten Theorie, wie oben gezeigt. Die Konstruktion von Theorien, so hatten wir gesagt, fällt jedoch nicht in den Bereich der angewandten Forschung, wie ein Blick auf unser obiges Tafelbild zeigt. Sie ist, wie bereits im [Forschungsantrag] explizit gezeigt, eine Angelegenheit der Grundlagenforschung. Und dennoch: Es besteht schon ein systematischer Zusammenhang zwischen dem Theorieniveau der Grundlagenforschung, dem „Differenziertheitsgrad“ einer ganz bestimmten Ätiologie und der „Treffgenauigkeit“ präziser symptomatologischer Diagnostik. Er sieht jedoch nicht so aus, wie man auf den ersten Blick annehmen könnte, ist doch, wie im vorherigen Abschnitt gezeigt, die Prognose, und damit die Fiktivmöglichkeiten, die sich aus dem Geltungsgrad einer bestimmten Theorie ergeben, zwischengeschaltet. 146 Fassen wir auch diesen Zusammenhang in Form einer expliziten Aussage, welche die in Abschnitt II. 4. 4. gemachte präzisiert und ergänzt: Je besser, umfassender und fachterminologisch ausgefeilter die Grundlagenforschung einer medizinischen Disziplin, desto allgemeinere und präzisere Theoriegebilde mit entsprechend größerem empirischem Gehalt lassen sich konstruieren, und da das terminologische Gerüst der theoretischen Forschung ja zugleich das Vokabular abgibt für Symptomatologie und Diagnostik, gilt nunmehr, dass eine präzise Diagnostik eine direkte „Funktion“ des verfügbaren theoretischen Hintergrundswissens ist. Mit anderen Worten: Sage mir, auf welche allgemeine theoretische Grundlage Du Dich berufst, und ich sage Dir, wie gut Deine Krankheitsformenlehre ist und wie präzise deine Diagnostik gestaltet werden kann. Ich habe hier lediglich wissenschaftstheoretisch in expliziter Form zu fassen versucht, was natürlich jedem Kliniker intuitiv völlig vertraut ist: Je differenzierter die Ätiologie, desto exakter die Diagnose und desto präziser die Prognose. Worauf ich jedoch ausdrücklich hinweise, ist die Bedeutung streng allgemeingefasster empirisch gut bestätigter Theoriegebilde, die unabhängig von ihren jeweiligen „Applikationen“ konstruiert und empirisch überprüft werden müssen. Denn wie gesagt: Man kann einen „natürlich belassenen Krankheitsverlauf“ dann und nur dann therapeutisch beeinflussen, wenn man über eine Prognose darüber verfügt, wie der Krankheitsverlauf sich gestalten würde ohne einen solchen Eingriff. Eine solche Prognose ist aber natürlich nur möglich, wenn eine entsprechend gut bestätigte empirisch falsifizierbare Theorie hierbei sozusagen die „Kognitivfolie“ abgibt. Aber auch hier muss auf ein darüber hinaus gehendes Problem explizit hingewiesen werden: Die Grundbegriffe „gesund“ und „krank“, „normal“ und „anomal“, „rational“ und „irrational“, etc. müssen extern formuliert werden: Der Arzt kann sagen was therapeutisch getan werden kann bzw. muss, um einen theoretisch vorhersehbaren malignen Verlauf zu beeinflussen. Die Therapieziele hingegen werden ihm entweder durch das kulturelle Umfeld vorgegeben oder aber sie sind Sache des Patienten. Ist jedoch dieser Patient unmündig, d.h. gar nicht kompetent, überhaupt sagen zu können was er will – und dies ist bei schweren Verhaltensstörungen notorisch der Fall –, dann müssen wir uns etwas einfallen lassen. Ich halte diesen Punkt an dieser Stelle fest und beziehe hier zunächst einmal ganz sporadisch das Gesagte auf das Postulat der scharfen Trennung von Erfahrungswissen und Werturteil, so dass gilt: 147 Die Kultur-Wertediskussion ragt auf eine spezifische Art und Weise in alle Definitionsbemühungen auch und gerade um eine „richtig“ ausgeführte Krankheitsformenlehre hinein. Weiter unten werden wir sehen, dass sich dieser hier angesprochene Zusammenhang noch sehr viel genauer fassen lässt, wenn wir uns eingehender mit der Struktur des sog. „DN-Modells“ sowie (erneut) mit dem „Objektivitätsaufsatz“ befassen. Weiter oben wurde gesagt, dass das Webersche Postulatenssystem der Trias von scharfen Begriffen, Theoriesensibilität und Trennung von Erfahrungs- und Werturteil noch einiger methodologischer Ergänzungen bedarf. Auf die absolute Geltung des Widerspruchsfreiheitspostulates wurde bereits hingewiesen, zwei andere Problemkomplexe sollten wir uns an dieser Stelle, wie ich meine, noch ansehen. In der strengen Wissenshaftlehre gilt für die wissenschaftlichen Diskursformen, dass scharf unterschieden werden müsse zwischen denjenigen Argumenten, die sich auf die Entdeckung einer Theorie (context of discovery) beziehen und denjenigen Argumenten die sich auf deren Begründung (context of justification) beziehen. Beide Argumentstrukturen müssen radikal voneinander geschieden werden: Wichtig ist ausschließlich, wie eine bestimmte Theorie oder auch ein ganz bestimmter Erklärungsvorschlag argumentativ begründet zu werden pflegt. Dabei ist im Prinzip vollständig gleichgültig, wer den entsprechenden Vorschlag macht und wie er auf seine Entdeckung gekommen sein könnte. Der argumentative Diskurs muss bei strenger wissenschaftslogischer Ausformulierung ausschließlich auf den „context of justification“ bezug nehmen. Zur Verdeutlichung zitiere ich an dieser Stelle die sehr klaren Ausführungen zu diesem „Grundpostulat“ vernünftigen Argumentierens überhaupt, die sich in dem Dissertationsentwurf meines Kollegen Christian Schönleben finden. Es heißt dort: „Durch die scharfe Unterscheidung von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang wird die prinzipielle Grundvoraussetzung für den wissenschaftlichen Diskursmodus festgelegt. Für den wissenschaftlichen Diskurs ist es nicht von belang, wer etwas erklärt oder wer etwas entdeckt hat, sondern vielmehr die Art und Weise – der Modus also – wie ein Zusammenhang argumentativ begründet wird. Die strikte Einhaltung dieser Grundregel führt automatisch zu einer Abkoppelung personal attributiver und meist statusbezogener Zuschreibungen und hin zu einem argumentativmodalen, d.h. rein auf den logischen Aufbau einer Argumentationsstruktur bezogenen Diskurs: Der idealtypische wissenschaftliche Diskurs geschieht in Sätzen (Propositionalgebilden) und ihrer widerspruchfreien Verknüpfung zu 148 einem Aussagengefüge. Ein wissenschaftlicher Diskurs besitzt demnach sein Fundament in der Sachbezogenheit und nicht in der Frage: „Wer streitet sich mit wem“? Aus der Grundvoraussetzung der strikten Trennung von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang folgt als logische Konsequenz, dass ein Diskursmodus, der so strukturiert ist, von vorneherein herrschaftsfrei ist.“140 Die vorliegende Arbeit muss es sich leider versagen, diese Postulatorik streng rollentheoretisch auszuformulieren. Es dürfte jedoch kaum prinzipielle Probleme aufwerfen, eine solche rollentheoretische Beschreibung zu liefern. Wichtiger ist mit an dieser Stelle die von Hans Georg Gadamer idealtypisch dargelegte Gesprächsstruktur für rationales Argumentieren überhaupt. Bevor wir jedoch darauf genauer eingehen, sollten wir uns die Webersche Analyse des funktionalen Stellenwertes sozialwissenschaftlicher Erkenntnis für die praktische Verwirklichung bestimmter „Kulturwerte“ noch etwas genauer ansehen. Der gesamte erste Teil des „Objektivitätsaufsatzes“ beschäftigt sich nämlich mit der Frage der praktischen Verwertbarkeit und Umsetzbarkeit theoretischen Wissens. Hier ist sozusagen das prekäre Verhältnis zwischen „wahrheitsorientierter Grundlagenforschung“ und kulturwertbezogener Handlungsorientierung „auf den Punkt gebracht“. Ausdrücklich wird dabei auf das Lehrstück der „klinischen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften“ bezuggenommen, um das für Weber im Mittelpunkt seiner Forschungen stehende Problem der praktisch-sozialpolitischen Bedeutung der „reinen“ Ökonomie zu erläutern. Ich meine, dass damit auch Licht geworfen wird auf dasjenige „Grunddilemma“, welches weiter oben anläßlich der Analyse des „Redlich/Freedman“ hat konstatiert werden müssen. Werfen wir nämlich einen Blick auf unser obiges Tafelbild, so wird die Webersche Formel von den „klinischen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften“ sofort verständlich, wie ich meine: „Heilkunde“ ist immer zugleich „wahrheitsbezogene Grundlagenforschung“, die natürlich dem Fundamentalprinzip „wissenschaftsanwendende Praxis“, der Wertfreiheit zu eben bestimmte welche ganz genügen hat, und „Werte“ bzw. „Kulturwerte“ („körperliche und geistige Gesundheit“, „Ich-Stärke“, „soziale Kompetenz“ etc. etc.) zu verwirklichen hat. Und wir müssen uns die Frage stellen: Wie geht das zusammen? 140 Vgl. Christian Schönleben [Weltbühne], S. 5/6 149 5.3. Grundlagenforschung und „angewandte Wissenschaft“ – Einige Bemerkungen zum Problem der „Sozialverantwortlichkeit“ Wie erinnerlich haben wir scharf zwischen theoriekonstruierender Grundlagenforschung und möglicher Anwendung differenziert. In diesem Zusammenhang haben wir zugleich auch darauf aufmerksam gemacht, dass die institutionell vorgegebenen Therapieziele Wertimplikationen in sich bergen, welche gerade nicht von der Grundlagenforschung selbst konstruktiv geleistet werden können. Eine Erfahrungswissenschaft kann Werte analysieren, nicht jedoch sie selbst setzen oder gar begründen. Es ist dieser Punkt, der am „Objektivitätsaufsatz“ für unsere Grundfragestellung an dieser Stelle interessiert. Eigentlich alle Wissenschaften, so beginnt Weber den ersten Teil seiner Ausführungen zu dem Problem der „»Objektivität« sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis“, und vornehmlich diejenigen Wissenschaften, „deren Objekt menschliche Kulturinstitutionen und Kulturvorgänge“ seien, seien „geschichtlich zuerst von praktischen Gesichtspunkten“ ausgegangen und damit wesentlich wertgebunden und wertorientiert gewesen. So die Nationalökonomie, die, wie wir ja wissen, von Weber sodann als „Soziologie“ zu konzipieren versucht worden ist, und so ganz sicher eben auch die „Heilkunde“, von der wir ja behauptet haben, sie stehe sozusagen auf der „Grenzlinie“ zwischen den Natur- und Kulturwissenschaften: „Werturteile über bestimmte wirtschaftspolitische Maßnahmen des Staates zu produzieren, war ihr nächster und zunächst einziger Zweck. Sie war »Technik« etwa in dem Sinne, in welchem es auch die klinischen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften sind. Es ist nun bekannt, wie diese Stellung sich allmählich veränderte, ohne daß doch eine prinzipielle Scheidung von Erkenntnis des »Seienden« und des »Seinsollenden« vollzogen wurde“.141 Gemeint ist natürlich, dass sich mit zunehmender arbeitsteiliger Differenzierung sowohl der Heilkunde als auch der Ökonomie zwar objektiv „eine prinzipielle Scheidung von Erkenntnis des »Seienden« und des »Seinsollenden« vollzogen“ habe, dass dies gleichwohl nicht in den betreffenden Wissenschaften explizit methodologisch reflektiert worden sei. Vielmehr sei gewissermaßen „in den Köpfen“ der Vertreter dieser „Wissenschaften“ die Verknüpfung von „theorieorientierter Forschung“ und „anwendender Praxis“ vorherrschend geblieben. Soziologisch ausgedrückt aber bedeutet das: 141 Max Weber [Objektivität], S. 148. Ich erinnere hier noch an die obigen Ausführungen: Als Wissenschaftler stellt der Diagnostiker fest, wie es ist, und als solcher auch prognostiziert er auf der Grundlage einer empirisch falsifizierbaren Theorie, wie es sein wird, als heilkundiger Therapeut jedoch, der sich am Kulturwert der „Gesundheit“ des Patienten orientieren muss, legt es fest, wie es sein soll. Weiter unten werden 150 Während sich institutionell eine Wertedifferenzierung vollzogen habe, habe dies dennoch für das jeweilige Rollenverständnis der Positionsinhaber kein Unterschied gemacht. Weber drückt dies folgendermaßen aus: „Noch heute“ sei die „unklare Ansicht“ insbesondere bei den Praktikern „nicht geschwunden ..... , daß die Nationalökonomie Werturteile aus einer spezifisch »wirtschaftlichen Weltanschauung« heraus produziere und zu produzieren habe“.142 Problemlos lässt sich diese „institutionelle Diagnose“, die Weber hier bezüglich der Nationalökonomie vorlegt, auf die „klinischen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften“ übertragen, wie ich meine, haben wir dies doch sinnfällig an dem oben gezeichneten „Grunddilemma“ in der „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ demonstriert: Auch und gerade in den „klinischen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften“ dürfte bis zum heutigen Tage die Ansicht sehr weit verbreitet sein, theoriekonstruierende Forschung müsse wesentlich ausgerichtet sein und bleiben an den Erfordernissen der klinischen Praxis. Nicht gesehen zu werden pflegt dabei, dass genau dadurch ganz bestimmte Kulturwerte in die wissenschaftliche Bemühung hineinragen, die selbst noch in erster Linie dem Wertfreiheitsprinzip verpflichtet ist: Das Kulturwertideal der körperlichen und seelischen Gesundheit mag als ethisches Normengefüge die klinische Praxis noch so sehr bestimmen und so auch eventuell bestimmte Forschungsrichtungen „bahnen“, das forschungspraktische Prozedere der empirischen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften hingegen, muss sich an den Wertfreiheitsprinzipien der „rationalen Formen der Wahrheitssuche“ orientieren, was gegebenenfalls, wie bekannt, zu massiven Konflikten führen kann. Streng methodologisch ist jedoch die Sachlage klar, wie Max Weber explizit betont: „Unsere Zeitschrift als Vertreterin einer empirischen Fachdisziplin muß, wie wir gleich vorweg feststellen wollen, diese Ansicht [gemeint ist die Werturteilsgebundenheit der Forschung] grundsätzlich ablehnen, denn wir sind der Meinung, daß es niemals Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft sein kann, bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte ableiten zu können.“143 Fragen wir im Lichte unserer bisherigen Ausführungen, was dies bedeuten könnte, so sehen wir zunächst einmal ganz deutlich, dass und warum sich die „klinischen Disziplinen der wir dann die sich daraus ergebenden Möglichkeitsspielräume zu diskutieren haben (Erfolgschancensatz bzw. Kostensatz). 142 ibid. 143 ibid. 151 medizinischen Wissenschaften“ schwer tun, die Begriffe „gesund“ und „krank“ bzw. „normal“ und „anomal“ zu definieren: Weil zwischen den streng erfahrungswissenschaftlichen Grundlagendisziplinen der Medizin auf der einen und deren klinischer Praxis auf der anderen Seite scharf unterschieden werden muss, gibt es ganz einfach „die Medizin“ bzw. „die Psychiatrie“ als solche nicht. Bestenfalls lässt sich definitorische Übereinstimmung unter den medizinischen bzw. psychiatrischen Fachleuten darüber erzielen, was als „gesund“ und „krank“ bzw. was als „normal“ und was als „gestört“ gelten soll: Normen werden durch Übereinkunft festgelegt und können sich durch (erneute) Übereinkunft ändern, wissenschaftlich festlegen lassen sie sich nicht. Streng genommen haben wir hier aber auch ein sehr schönes Beispiel für die „Geltung“ der Forderung nach Trennung zwischen „Entdeckungs- und Begründungszusammenhang“, was an einem etwas platten Beispiel verdeutlicht werden mag: Die einstige schreckliche Volksseuche der Tuberkulose ist wohl ziemlich sicher hochmotivierender Anlass für die Erforschung der mikro-biologischen Struktur(en) dieser Krankheit gewesen, die erfahrungswissenschaftlichen Hypothesen jedoch, die zur Auffindung des Tuberkel-Bazillus führten, behandelten selbstverständlich diesen Tatbestand als etwas völlig „Natürliches“. Wir müssen wohl kaum den damit gemeinten Sachverhalt bis in alle Einzelheiten hinein betrachten, ist doch ziemlich klar, was gemeint ist. Ich will hier nämlich noch auf etwas anderes hinaus, wenn ich mich dieser Problematik aus methodologischer Sicht nähere. Wenden wir uns also dem „Objektivitätsaufsatz“ Max Webers erneut zu: „Ausgesprochener Zweck des »Archivs« war seit seinem bestehen neben der Erweiterung unserer Erkenntnis der »gesellschaftlichen Zustände aller Länder«, also der Tatsachen des sozialen Lebens, auch die Schulung des Urteils über praktische Probleme desselben und damit .... die Kritik an der sozialpolitischen Arbeit der Praxis ..... . Trotzdem hat nun aber das Archiv von Anfang an daran festgehalten, eine ausschließlich wissenschaftliche Zeitschrift sein zu wollen, nur mit den Mitteln wissenschaftlicher Forschung zu arbeiten, – und es entsteht zunächst die Frage: wie sich jener Zweck mit der Beschränkung auf diese Mittel prinzipiell vereinigen läßt. Wenn das Archiv in seinen Spalten Maßregeln der Gesetzgebung und Verwaltung oder praktische Vorschläge zu solchen beurteilen läßt – was bedeutet das? Welches sind die Normen für diese Urteile? Welches ist die Geltung der Werturteile, die der Beurteilende seinerseits etwa äußert, oder welche ein Schriftsteller, der praktische Vorschläge macht, diesen zugrunde legt? In welchem Sinne befindet er sich dabei auf dem Boden 152 wissenschaftlicher Erörterung, da doch das Merkmal wissenschaftlicher Erkenntnis in der »objektiven« Geltung ihrer Ergebnisse als Wahrheit gefunden werden muß?“.144 Übertragen wir das auf unser Problem: Ausgesprochener Zweck jedweder Erörterung von methodologischen bzw. erkenntnistheoretischen Grundlagenproblemen in der „Heilkunde“ – oder wie Weber sie nennt: in den „klinischen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften“ – ist neben der „Erweiterung unserer [Tatsachen]erkenntnis ..... auch die Schulung des Urteils über praktische [klinische] Probleme .... und damit die Kritik an der [klinisch-medizinischen] Praxis.“ Da jedoch auch hierbei, soll der Wissenschaftsauftrag als solcher den Vorrang haben, eine solche „Kritik“ „nur mit den Mitteln wissenschaftlicher Forschung zu arbeiten“ versuchen muss, entsteht zunächst die Frage: wie sich jener Zweck [Schulung des kritischen Urteils bzw. Kritik an der Praxis] mit der Beschränkung auf diese Mittel [wertfreie Forschung] prinzipiell vereinigen läßt“. Wir fragen etwas anders, da wir die von Weber in den Mittelpunkt gestellte „Vorrangfrage“ als solche nicht nur abschwächen, sonder umformulieren müssen: Wie kann in einer sinnvollen Art und Weise klinisch-therapeutische Praxis sich verknüpfen mit Grundlagenforschung, welche eben dieser klinisch-therapeutischen Praxis die eigentlichen Hilfsmittel in die Hand zu geben versucht? Nun, streng soziologisch entsteht hier eigentlich kein Problem: Man muss scharf zwischen der Rolle des medizinischen Forschers und der Rolle des klinischen Praktikers differenzieren, wobei prinzipiell unerheblich ist, dass u.U. diese beiden grundverschiedenen sozialen Positionen in derselben Person sich vereinigen. Bei näherem Zusehen jedoch ergibt sich sehr wohl ein Problem, welches allerdings nichts damit zu tun hat, dass „Forscher“ und „Praktiker“ sehr oft eine „Personalunion“ bilden145: 144 ibid. 145 Dieses Problem ist streng soziologisch überhaupt kein Problem, worauf zu Recht bereits Porath in seinem Warschauvortrag bei der Frage der „Persönlichkeit Hitlers“ hingewiesen hat: Dieselbe Person kann (und muss) selbstverständlich mit der Einnahme verschiedener sozialer Positionen (Arzt, Ehemann Klinikchef, Neurochirurg, Liebhaber, Fahrstuhlbenutzer, Forscher etc. etc.) auch völlig verschiedene soziale Rollen übernehmen, mit denen sie sich unterschiedlich stark identifizieren kann. Probleme ergeben sich immer nur dann, wenn bestimmte Rollenanforderungen, welche unvereinbar miteinander sind (Intrarollenkonflikt bzw. Interrollenkonflikt), sich in bestimmten Situationen überschneiden. Der Punkt um den es mir hier geht, ist, wenn institutionell und damit objektiv bestimmte Rollen noch nicht hinreichend differenziert sind. 153 Der medizinische Forscher, welcher eine bestimmte Hypothese überprüfen möchte in der Absicht, sie empirisch zu validieren, verfolgt ein anderes Ziel als derjenige, der „gesichertes Wissen“ zwecks Realisation des „Gesundheitswertes“ anwendet. Diese beiden Rollen dürften genau dann relativ problemlos differenzierbar sein, wenn die institutionelle Arbeitsteilung bereits relativ fortgeschritten ist, sich also – weberianisch gesprochen – „eine prinzipielle Scheidung von Erkenntnis des »Seienden« und des »Seinsollenden« [bereits] vollzogen“ hat, und das ist trivialerweise immer dann der Fall, wenn bereits ein hinreichend „empirisch gesättigtes“ – z.B. neurophysiologisches bzw. pharmakologisches – Grundlagenwissen der klinischen Praxis „zu Verfügung steht“. Ganz anders sieht die Angelegenheit nämlich aus, wenn wegen noch relativ niedrigen „Niveaus“ der – z.B. sozialwissenschaftlichen – Grundlagenforschung diese sich mit der sog. „Praxis“ noch sehr stark überschneidet. Oder überspitzt gefragt: Was ist mit denjenigen Bereichen, in denen, wie z.B. in dem bisher beschriebenen Verhältnis zwischen „Sozialwissenschaft“ und „Psychiatrie“ die institutionelle Arbeitsteilung noch nicht soweit fortgeschritten ist, wie in denjenigen „klinischen Abteilungen der medizinischen Wissenschaften“, welche die unbestrittene Domäne der Naturwissenschaften sind? Müssen sich hierbei nicht ganz automatisch sozialtheoretisches Wissen, im obig definierten Sinne, und sozialwissenschaftliches Wissen notorisch überschneiden und zu entsprechenden „Rollendiffusionen“ führen? Da das ziemlich sicher der Fall sein dürfte, ergibt sich naturgemäß die Frage, wie damit umzugehen ist, und vielleicht ergeben sich ja einige Anhaltspunkte für eine mögliche Beantwortung dieser Frage, die wir in enger Anlehnung an das im „Objektivitätsaufsatz“ zu diesem Problem Erarbeitet entwickeln wollen. Dort heißt es: „Jede denkende Besinnung auf die letzten Elemente sinnvollen menschlichen Handelns ist zunächst gebunden an die Kategorien »Zweck« und »Mittel«. Wir wollen etwas in concreto entweder „um seines eigenen Wertes willen“ oder als Mittel im Dienste des in letzter Linie Gewollten. Der wissenschaftlichen Betrachtung zugänglich ist nun zunächst unbedingt die Frage der Geeignetheit der Mittel bei gegebenem Zwecke. Da wir (innerhalb der jeweiligen Grenzen unseres Wissens) gültig festzustellen vermögen, w e l c h e Mittel zu einem vorgestellten Zwecke zu führen geeignet oder ungeeignet sind, so können wir auf diesem Wege die Chancen, mit bestimmten zur Verfügung stehenden Mitteln einen bestimmten Zweck überhaupt zu erreichen, abwägen und mithin indirekt die Zwecksetzung selbst, auf 154 Grund der jeweiligen historischen Situation, als praktisch sinnvoll oder aber als nach Lage der gegebenen Verhältnisse sinnlos kritisieren.“146 Zerlegen wir diese Passage in ihre vier Sätze, dann haben wir erstens die für die Kultur- und Sozialwissenschaften in ihrem Insgesamt Geltung beanspruchende apodiktische Behauptung, dass „jede denkende Besinnung auf die letzten Elemente sinnvollen menschlichen Handelns .... an die Kategorien »Zweck« und »Mittel« gebunden“ sei. Auf diese werden wir später in anderem Zusammenhang erneut zurückkommen. Zweitens haben wir eine Erläuterung derselben, auf die wir später gleichfalls zurückkommen werden. Drittens haben wir die – gleichfalls apodiktisch formulierte – forschungsheuristische Konsequenz, die sich für die „wissenschaftliche Betrachtungsweise“ im Hinblick auf den in den ersten beiden Sätzen apodiktisch festgestellten Gegenstandsbereich der „Soziologie“ ergibt, und auf die wir später ebenfalls zurückkommen werden. Und viertens schließlich, haben wir eine auf diese forschungsheuristische Konsequenz sich beziehende Kausalbehauptung mit einer bemerkenswerten „Bedingungsaussage“, die Weber in Klammern setzt. Vor allem diese interessiert uns hier, betrifft sie doch direkt das für den Therapeuten notorisch gegebene Problemverhältnis zwischen seinem „Kenntnisstand“ und seinem „praktischen Tun“. Und hierbei stellen wir (nunmehr) zweierlei fest: 1. Weil die „Zweck-Mittel-Relation“ beim klinischen Praktiker anders aussieht als beim medizinischen Forscher, geht, obwohl beide herauszubekommen versuchen müssen, woran genau ein bestimmter Therapievorschlag gescheitert ist, der eine mit einer fehlgeschlagenen Therapiebemühung anders um als der andere. Wie wir bei der Behandlung des DN-Schemas sehen werden, muss der Forscher daran interessiert sein, den „Fehler“ bei der Theorie, die hierbei – implizit oder explizit – zur Anwendung gelangt ist, selbst zu suchen, um die gegebenenfalls „umbauen“ zu können, während genau diese Frage dem Praktiker scheinbar überhaupt nicht zu interessieren braucht. Ich sage ganz bewusst „scheinbar“, denn, wenn es sich um „medizinisch-klinisches Neuland“ handelt, auf dem beide sich zu bewegen u.U. genötigt sind, wird ja ganz automatisch der Praktiker zum „Grundlagenforscher“. Oder ganz konkret auf das in dieser Arbeit ins Zentrum gerückte Problem gewendet: Wo es um den Zusammenhang (noch) ungesicherter sozialisationstheoretischer Grundlage und psychotherapeutischer Praxis geht, ist genau das der Fall. Hier berühren sich sehr eng die 146 Weber [Objektivitätsaufsatz] S. 149 155 beiden Aktivitäten „Prognose zwecks Überprüfung“ und „Prognose zwecks therapeutischem Eingriff“, worauf zurückzukommen sein wird. An dieser Stelle halte ich zunächst einmal die allgemeine Aussage hierzu fest, auf die es mir in dem hier angesprochenen Zusammenhang ankommt: Je stärker wegen noch unentwickelter Theoriegrundlage therapeutische und wissenschaftliche – das „theoriekonstruierende“ – ist, wie Bemühung weiter sich unten genauer berühren, desto zu sehen, notwendiger immer ist die methodologische „Zwischenschaltung“.147 Worauf es mir hier wesentlich ankommt, ist Folgendes: Wegen der unterschiedlichen institutionellen Differenzierung sieht das vielzitierte „Theorie-Praxis-Verhältnis“ auf dem Felde „gesicherten medizinischen Grundlagenwissens“ vollständig anders aus, als auf dem Felde „ungesicherten medizinischen Grundlagenwissens“. Ich erinnere an dieser Stelle zur Verdeutlichung des hier gemeinten lediglich an die anlässlich der Skizzierung des „Forschungsstandes“ zitierten Bemerkungen über den „methodologischen Irrgarten“ der Psychiatrie. 2. Die Beantwortung der Frage, welche Mittel geeignet sein könnten, um bestimmte Zwecke realisieren zu können (z.B. Aspirin bei Kopfschmerzen) – dies ja eine Fiktivüberlegung –, setzt voraus, dass man über eine einigermaßen gut gesicherte Prognose verfügt, die angibt, was (wahrscheinlich!) passiert, wenn nicht in den in Frage stehenden Ablauf eingegriffen werden würde. Dies doch der entscheidende Punkt: Die gedankliche Überlegung, was sein könnte, geht immer der jeweiligen Therapiemaßnahme als einem „subjektiv sinnhaften Handeln“, welches um eines ganz bestimmten Zweckes willen mit ganz bestimmten hierfür für „geeignet gehaltenen Mitteln“ praktisch sich betätigt, voraus. Und eine solche gedankliche Überlegung bezüglich dessen, was getan werden sollte bzw. müsste angesichts dessen, was „nach menschlichem Ermessen“ zu erwarten ist, steht nun einmal trivialerweise dann und nur dann auf relativ sicherem Boden, wenn der betreffende Mediziner dabei von einer bis dahin empirisch gut bestätigten Theorie ausgeht. Sein „menschliches Ermessen“ hätte dann nämlich eine entsprechend gesicherte Grundlage. Ich will auch dies in einer allgemeinen Aussage/Regel formulieren: Je besser diejenige Theorie, welche dem Hintergrundswissen einer praktisch-klinischen Maßnahme zugrunde liegt, empirisch sich bewährt hat, desto präziser erstens die Ätiologie, zweitens die Anamnese, drittens die Diagnose und viertens schließlich eben auch die Prognose, von deren Genauigkeit bzw. „Treffsicherheit“ wiederum 147 Ich verweise hier auf meine Ausführungen in der Anmerkung 129: Das dort mitgeteilte Beispiel dient hier als Beleg. 156 der Erfolg eventuell möglicher therapeutischer Eingriffe abhängt. Und hieraus ergibt sich nunmehr trivialerweise: Je besser diejenige Theorie, welche dem Hintergrundswissen einer praktisch-klinischen Maßnahme zugrunde liegt, empirisch sich bewährt hat, desto risikoärmer die empfohlene Therapiemaßnahme. Dieser Punkt dürfte als solcher kaum strittig sein, die entscheidende Frage jedoch bezieht sich natürlich auf das Problem, woher unser Therapeut eigentlich diese „empirisch bewährte Theorie“ bezieht, stellt sich doch unseren obigen Überlegungen zufolge die reine „Praxisbewährung“ als solche gerade keine Validierungsgrundlage für die hierbei in Frage kommende Theorie dar. Aber diesen Aspekt lassen wir hier einmal beiseite. Worauf es mir also bei der Betrachtung des obigen vierten Satzes im Weberschen Zitat zunächst einmal ankommt, ist folgendes: Ob unser Kliniker eine solche Theorie nun bewusst handhabt oder hierbei mehr intuitiv – sozusagen von seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz ausgehend – vorgeht, ändert nichts an der grundsätzlichen methodologischen Sachlage: Immer bildet eine jeweils für „wahr“ gehaltene Theorie dabei den kognitiven Hintergrund für seine Prognose. Und diese wiederum den Fiktivhintergrund für die entsprechende „Wahl der Mittel“, um den prognostizierten Ablauf des Krankheitsgeschehens kulturwertbezogen – in diesem Fall, wie zu hoffen, zu Gunsten des Patienten – zu beeinflussen. Vor allem die von Weber in Klammern gesetzte „Bedingung“ erscheint mir von so entscheidender Wichtigkeit, dass ich sie in die folgende Aussage überführen möchte: Wenn unser theoretisch repräsentiertes Grundlagenwissen zu einem bestimmten Problembestand als bereits gut bestätigt angesehen werden kann, so dass wir „gültig festzustellen vermögen, welche Mittel zu einem vorgestellten Zweck zu führen geeignet oder ungeeignet sind“, dann können wir die Erfolgschancen bestimmter anzuwendender Mittel auch relativ gut einschätzen, woraus sich trivialerweise ergibt: Je unsicherer noch die entsprechende „Grundlagentheorie“, desto unsicherer die Anamnestik, Diagnostik, Prognostik und Therapie. Wie unschwer zu sehen, ist genau das im Hinblick auf unser Problem der noch fehlenden Sozialisationstheorie der Fall: Es gibt keine hinreichend gesicherte Sozialisationstheorie und folglich kann es auch noch keine wirklich adäquate Ätiologie der Mentalerkrankungen geben. Dies nunmehr, wie unmittelbar einzusehen, die eigentliche Substanz meiner hier vorgelegten Doktorthese. Oder anders noch: Der Spielraum für relativ erfolgreiche therapeutische Eingriffe in ein bestimmtes Krankheitsgeschehen ist umso größer, je mehr und besser bestätigte Theorien hierbei für eine 157 entsprechende Ätiologie sorgen. Problemlos können wir diesen Satz, wie zu sehen, „umrechnen“ auf unsere obige „Ätiologieaussage“: Die „Grenzen unseres Wissens“ designieren zugleich auch die Grenzen der praktischen – z.B. therapeutischen – Möglichkeiten. Das folgt ja ganz zwanglos bereits aus unseren obigen Ausführungen. Der zweite Aspekt, der hierbei involviert ist, erscheint mir sogar noch wichtiger: Die „Grenzen unseres Wissens“ sind keine Konstanten, sondern sie sind Variablen. Fragen wir ganz naiv, worin sich der jeweilige Forschungsstand, an dem sich unsere praktischen Handlungsmöglichkeiten orientieren müssen, eigentlich präsentiert, dann stoßen wir sofort auf das für jedwede Ätiologie relevante theoretische Hintergrundswissen. Und genau hierfür sollte die minutiöse Behandlung des DN-Schemas, wie wir sie weiter unten vornehmen werden, hilfreich sein. Auch hier bietet sich eine allgemeine Aussage/Regel an: Je allgemeiner und präziser das erreichte Theorieniveau einer Wissenschaft ist, desto mannigfaltiger ist der Handlungsspielraum für den verändernden Eingriff in das, was sich ansonsten „naturwüchsig“ vollzieht. Ein Blick in die Geschichte der Medizin lehrt ja sinnfällig, was das bedeutet. Solange wir keine Antibiotika hatten, konnten Wund- und Kindbettfieber in ihren „natürlichen Abläufen“ mit zumeist für den/die Patienten/in desaströsen Konsequenzen auch nicht beeinflusst werden. In genau dem Moment aber, in welchem „grundlagentheoretisch“ das Penizillin entdeckt wurde, konnte sozusagen eine „fiktivkonstruierte differenzialdiagnostische Bemühung“ Platz greifen. Doch dieser Hinweis hier wirklich nur zur Erläuterung. Die hier vorgeführte zentrale These des „Objektivitätsaufsatzes“ ist in unserer Forschungsgruppe als Erfolgschancensatz gekennzeichnet worden, das gleiche gilt auch für den Kostensatz, den mein Kollege Schönleben mit Blick auf einen bestimmten Zusatz in der Arzneimittelreklame den „Apothekensatz“ genannt hat: „Wir können weiter, w e n n die Möglichkeit der Erreichung eines vorgestellten Zweckes gegeben erscheint, natürlich immer innerhalb der Grenzen unseres jeweiligen Wissens, die F o l g e n feststellen, welche die Anwendung der erforderlichen Mittel n e b e n der eventuellen Erreichung des beabsichtigten Zweckes, infolge des Allzusammenhangs alles Geschehens, haben würde. Wir bieten alsdann dem Handelnden die Möglichkeit der Abwägung dieser ungewollten gegen die gewollten Folgen seines Handelns und damit die Antwort auf die Frage: was „kostet“ die Erreichung des gewollten Zweckes in Gestalt der voraussichtlich eintretenden Verletzung a n d e r e r Werte? Da in der großen Überzahl aller 158 Fälle jeder erstrebte Zweck in diesem Sinne etwas „kostet“ oder doch kosten kann, so kann an der Abwägung von Zweck und Folgen des Handelns gegeneinander keine Selbstbesinnung verantwortlich handelnder Menschen vorbeigehen, und sie zu ermöglichen, ist eine der wesentlichen Funktionen der t e c h n i s c h e n Kritik, welche wir bisher betrachtet haben. Jene Abwägung selbst nun aber zur Entscheidung zu bringen, ist freilich n i c h t mehr eine mögliche Aufgabe der Wissenschaft, sondern des wollenden Menschen: er wägt und wählt nach seinem eigenen Gewissen und seiner persönlichen Weltanschauung zwischen den Werten, um die es sich handelt. Die Wissenschaft kann ihm zu dem B e w u ß t s e i n verhelfen, daß a l l e s Handeln, und natürlich auch, je nach Umständen, das N i c h t – H a n d e l n, in seinen Konsequenzen eine Parteinahme zugunsten bestimmter Werte bedeutet, und damit – was heute so besonders gern verkannt wird – regelmäßig g e g e n a n d e r e. Die Wahl zu treffen, ist seine Sache“.148 Max Weber spricht hier über die Möglichkeiten die einer strengen erfahrungswissenschaftlich ausgerichteten Wissenschaft noch gegeben sind im Hinblick auf praktische Verwertbarkeit dessen, worüber diese Wissenschaft spricht. Konkret lautet die Frage: Was kann eine streng empirische Wissenschaft im Hinblick auf die ihr vorgegebenen fremden Ziele leisten, ohne dass sie ihre wissenschaftliche Kompetenz überschreitet? Es ergibt sich nämlich die Frage, wie sich der Zweck, an bestimmten Zuständen Kritik zu üben mit der Beschränkung vereinbaren lässt, dass eine solche Kritik den Kreis der Wissenschaftlichkeit ja nicht verlassen darf. Wir brauchen das hier Gemeinte nicht bis zum letzten Winkel durchzuspielen, da ja sonnenklar ist um was es dabei geht, nämlich: Immer geht es um die Frage, auf der Grundlage welcher in Anspruch genommener Werte sich Kritik an bestehenden Werten bzw. an wünschbaren oder unerwünschten Zuständen eigentlich bewerkstelligen lässt. Auf unser Problem bezogen heißt das: Die Werte „Gesundheit“, „Mündigkeit“, „Rationalität“, „Ich-Stärke“ etc. sind als therapeutische Ziele denjenigen Systemen der sozialen Kontrolle, die wir unter dem Oberbegriff „klinische Medizin“ zusammenfassen, gesellschaftlich, kulturell oder auch persönlich vorgegeben. In Anlehnung an Max Weber können wir nunmehr die Frage stellen, welchen Beitrag eine streng erfahrungswissenschaftlich aufgebaute Medizin zur Realisation dieser Zielvorgaben (Werte) eigentlich leisten kann, ohne dass sie den Umkreis streng erfahrungswissenschaftlichen Denkens und Forschens verlässt. Die strenge Trennung von 148 Weber [Objektivitätsaufsatz] S. 149f 159 Erfahrungswissen und Werturteil erfordert ja, dass Therapieziele nicht von der reinen wissenschaftlich aufgebauten Psychiatrie gegeben werden können. Wir hatten dieses Problem als das Grunddilemma umschrieben. Es ist aber, wie wir sehen können, das Grunddilemma einer jeden technisch praktischen Wendung einer jeden beliebigen Wissenschaft. Redlich und Freedman haben versucht, mit diesem Dilemma so umzugehen, dass sie eine systemisch gefasste Verhaltenstheorie, die das Geschehen „Mensch“ kulturunabhängig im Rahmen einer streng wissenschaftlich aufgebauten Verhaltenswissenschaft zu thematisieren versucht haben. Wir können nunmehr mit bereits deutlichem Blick auf das weiter unten zu behandelnde DN-Schema sehr viel präziser dieses für jede praktisch technisch gewendete Wissenschaft bestehende Dilemma in Anlehnung an die Weberschen Ausführungen erneut formulieren, um sodann das Sonderproblem der psychiatrischen Praxis präzise fassen zu können. Jeder Arzt steht trivialerweise in dieser Rollendoppelbindung, sich als wissenschaftlich ausgebildeter Arzt auf den vorhandenen Forschungsstand beziehen zu müssen und als „helfender Arzt“ seine Patienten anständig therapeutisch versorgen zu wollen. Und diese Rollendoppelbindung wird zum Problem, wie mir scheint, immer genau dann, wenn wegen noch ungesicherten Grundlagenwissens sich die Rolle des Klinikers mit der Rolle des Forschers überschneidet. Doch schauen wir uns noch einen anderen Aspekt der hier angeschnittenen Problemlage an: Wir alle kennen die in den letzten 2-3 Jahrzehnten zu einer Phrase verkommenen Formel vom sog. „mündigen Patienten“. Im Rahmen der Weberschen Ausführungen können wir nunmehr problemlos dieser Phrase erneut Sinn geben: Die Möglichkeiten die die wissenschaftliche Medizin dem hilfesuchenden Patienten zur Verfügung stellt, lassen sich diesen gegenüber problemlos benennen, ohne dass der Wissenschaftscharakter der modernen Medizin hierbei Schaden nähme. Der „Erfolgschancensatz“ wie auch der „Kostensatz“ sind hierbei problemlos anwendbar. Man beachte jedoch, dass der Arzt in seiner Eigenschaft als Berater des Patienten seine wissenschaftlichen Grundlagen verlässt, um eben als Therapeut eine wichtige Funktion zu übernehmen. Es designiert die vielberufene Verantwortung des Arztes – soziologisch ausgedrückt gehört das zu seiner Berufsrolle –, wenn er sich hierbei auf das beschränkt was machbar ist und Entscheidungsmöglichkeiten sozusagen in den Raum stellt. Ob und wie und in welchem Umfang der Patient nach intensiver Erörterung von Erfolgschancen, Folgen und Nebenfolgen den Rat des Arztes befolgt, ist in der Tat „seine Sache“. Wir sehen sofort, dass und inwiefern sich dieser „normalklinische“ Sachverhalt, bei dem es der Mediziner ja – zumindest „im Prinzip“ – mit einem durchschnittlich rationalen, dass heißt 160 subjektiv sinnhaft sich verhaltenden Patienten zu tun hat, zu einer massiven Problematik zuschärft, wenn wir unseren Blick auf die Pädiatrie, auf die Psychiatrie und sodann auf den äußerst prekären Fall der Pädo-Psychiatrie richten. Dies sollten wir hier zumindest andeuten, da eine eingehendere Erörterung der hierbei mittlerweile aufgehäuften Problemzusammenhänge uns zu weit abführen würde von unserem hier zunächst einmal grundsätzlich beabsichtigten Plädoyer für „Soziologie“ und „Methodologie“. Der Pädiater wird naturgemäß diejenigen mit in seine Verantwortung einbeziehen, die aufgrund ihres „gesellschaftlichen Auftrages“ die Pflicht zur Verantwortung für ihr Kind haben. Hier ist der Fall noch relativ klar: Eltern und Arzt bilden als Funktionäre ihre jeweiligen Sozialisationsagenturen eine im Hinblick auf das Kind „sich und der Gesellschaft“ verantwortliche Therapiegemeinschaft und müssen sich zu diesem Zweck eben auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise rollenstrukturell vergesellschaften. Komplizierter wird die Angelegenheit bereits, wenn der Arzt es erstens mit Patienten zu tun hat, die per derfinitionem unmündig in dem Sinne sind, dass sie sozial inkompetent sind und mithin überhaupt keine Entscheidung treffen können und zweitens die durch Fachkompetenz ausgewiesene gesellschaftliche Verantwortung u.U. auch gegen die elterliche Erziehungsgewalt wahrzunehmen gezwungen sind. Aus diesem Blickwinkel lässt sich nunmehr der dramatische Fall einkreisen, der für den Pädo-Psychiater ja der Normalfall ist: Er muss – das ist gesellschaftlicher Auftrag und gesellschaftliche Pflicht, gehört also zu seiner Berufsqualifikation – sich mit denjenigen in einer ganz anderen Art und Weise auseinandersetzen als gewohnt, denen ja gleichfalls die Verantwortung für ihr Kind rollenstrukturell zugemutet wird. Denn dies gilt auch dann, wenn er sozusagen über die gesellschaftliche Legitimationslizenz zum therapeutischen „Eingreifen“ verfügt. Genau hier liegt der systematische Ort dessen, was wir im nächsten Denkschritt als „Gespräch“ behandeln werden. Der Pädo-Psychiater wird nämlich vornehmlich dann, wenn es sich um den prekären Grenzbereich der psycho-sozialen Probleme der Medizin handelt, ganz automatisch zum Funktionär einer Sozialisationsagentur, die wie Schule und Elternhaus genuin pädagogische Pflichten übernommen haben. Auf diesen Punkt wird leider in der hier vorliegenden Arbeit nicht seiner Bedeutung gemäß genauer eingegangen werden können. An dieser Stelle weise ich lediglich auf diesen Aspekt hin, weil er generell das „Werteproblem“ einer gesellschaftlichen Institution betrifft, welche Wissenschaft sein kann, sein will und wie ich meine, auch sein muss und zugleich die Verantwortung für die Subtilisierung von Wertestrukturen unserer Gesellschaft im therapeutischen Prozedere wahrzunehmen hat. 161 5.4. Das Gadamersche „Gespräch“ als Idealtypus rationalen Argumentierens – Der Begriff der „Identitätsmetamorphose“ Wir wenden uns nunmehr dem Gadamerschen „Gespräch“ zu, dessen Behandlung in der hier entwickelten Argumentationsstruktur eine sozusagen „dreifache Funktion“ zukommt: Es ist erstens der idealtypische Ort des vernünftigen Argumentierens überhaupt, zweitens bietet seine Behandlung die Möglichkeit einer Präzisierung der Ausführungen in Abschnitt II. 2. (Kommunikative Kompetenz) und drittens gewinnen wir dadurch, dass seine Behandlung uns die Chance eröffnet, den Begriff der „Identitätsmetamorphose“ zu entwickeln, die Überleitung zu „unserem“ Identitätsproblem. Wie erinnerlich, hatten wir in Abschnitt II. 2. die Grundannahmen der Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“, wie sie sich zum einen in der „Kategorienlehre“ von 1913, zum anderen sodann in Webers Fragment gebliebenen und posthum erschienenen Hauptwerk „Wirtschaft und Gesellschaft“ finden, mit den Grundannahmen des sog. „symbolischen Interaktionismus“ zu einer in sich widerspruchsfreien „Sozialanthropologie“ verknüpft und dabei mittels vier Sätzen den Habermas’schen Begriff der „Kommunikativen Kompetenz“ zu gewinnen versucht. Ich werde das dort Ausgeführte hier noch einmal in der Absicht zusammenfassen, nunmehr auch den Zugang gewinnen zu können zu demjenigen Aspekt der „Verstehenden Soziologie“ Max Webers, den die Gadamersche Hermeneutik repräsentiert. Vor allem interessiert uns dabei diejenige von Gadamer idealtypologisch konstruierte Handlungsstruktur, die dieser „das eigentliche Gespräch“ genannt hat. Anhand dessen nämlich versucht Gadamer das „Phänomen der Hermeneutik“ in seiner reinen Gestalt zu demonstrieren. Uns interessiert dieser Aspekt weniger. Es kommt uns vielmehr darauf an, dass Gadamer insbesondere an dem paradigmatischen Lehrstück des „Gespräches“ zu thematisieren versucht, was den eigentlichen Gegenstand der „Verstehenden Wissenschaften von Menschen“ ausmacht. Restlos alles wird hier nämlich – wie bei Stryker ja auch –,was in den sog. Humanwissenschaften Thema sein kann, auf das soziale Institut „Sprache“ bezogen, so dass gilt: Diejenige minimale soziale Situation, die in der Soziologie „Interaktion zwischen (mindestens) zwei (menschlichen) Personen“ und in der Sozialpsychologie „Kommunikation“ genannt zu werden pflegt, ist wesentlich durch Sprachlichkeit dominiert, so dass das Paradigma nicht nur vernünftigen Argumentierens, sondern auch vernunftorientierten sozialen Handelns schlechthin eben das „Gespräch“ ist. Man sieht, wie mir scheint, ohne große Schwierigkeiten, dass unter diesem Blickwinkel sich die Webersche „Verstehenssoziologie“ zum einen mit den Grundannahmen des „symbolischen Interaktionismus“, zum anderen mit 162 der Gadamerschen Idealtypologie der „Gesprächshermeneutik“ zu einer gemeinsamen „Grunddefinition“ zusammenschließt: Gegenstand der Menschenwissenschaften sind Wesen, die, weil sie kommunikativ (sprachlich) kompetent, mithin also auch zu subjektiv sinnhaftem Sozialverhalten fähig sind, etwas wollen, und die bezüglich dessen, was sie wollen, eben Mittel anwenden, von denen sie glauben, dass sie zur Erreichung dessen, was sie wollen, geeignet sind. Sie handeln, insofern sie im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind, als aktiv Handelnde, die gelernt haben (müssen), dass es andere aktiv Handelnde gibt, die ebenfalls ihre Interessen verfolgen bzw. etwas wollen, und die bezüglich dessen, was sie wollen, gleichfalls Mittel anwenden, von denen sie glauben, dass sie zur Erreichung dessen, was sie wollen, geeignet sind. Die mir wichtig erscheinenden Textstücke aus dem Weberschen Werk reihe ich hier zunächst einmal der besseren Übersicht halber aneinander, verknüpfe sie dann, wie bereits in Abschnitt II. 2. vorgeführt, mit dem „Sprachanthropologismus“ der Chicago-Schule und wende mich sodann der Feininterpretation des Gadamerschen „Gesprächsmodells“ in der bereits eingangs zu diesem Kapitel genannten Absicht zu, damit erstens den idealtypischen Ort all derjenigen Formen vernunftorientierten Argumentierens zu skizzieren, die ernsthaft mit der Lösung wirklicher Probleme befasst sind, zweitens den Begriff der kommunikativen Kompetenz zu erläutern und drittens den Übergang zur Identität zu gewinnen. Wie sich nämlich herausstellen wird, hängen genau diese drei Problembereiche engstens miteinander zusammen: Zu einem echten „Gespräch“ sind nur Personen imstande, welche sprachlich zu kommunizieren vermögen, und nur dann auch ergeben sich möglicherweise weiterführende Problemlösungen. Der eigentlich Clou jedoch betrifft, wie wir sehen werden, das Identitätsproblem. Bereits im „Objektivitätsaufsatz“ von 1904 heißt es, dass „jede denkende Besinnung auf die letzten Elemente sinnvollen menschlichen Handelns .... zunächst gebunden“ sei „an die Kategorien »Zweck« und »Mittel«.“ Menschliche Wesen wollten „etwas in concreto entweder »um seines eigenen Wertes willen« oder als Mittel im Dienste des in letzter Linie Gewollten.“ Mittels dieser „quasi voluntaristischen“ Kennzeichnung wird gewissermaßen die Intentionalstruktur jedweden humanspezifischen Handlungsvorganges charakterisiert. Ich bitte jedoch darum, bereits an dieser Stelle auf einen Aspekt des Handlungsvorganges zu achten, den Weber nicht explizit erwähnt. Gemeint sind damit die u.U. auftretenden 163 nichtintendierten Effekte bzw. Nebeneffekte absichtsgeleiteten Handelns. Dieser Punkt wird uns nämlich später genauer interessieren müssen. In der „Kategorienlehre“ von 1913 heißt es dann: „Menschliches (»äußeres« oder »inneres«) Verhalten zeigt sowohl Zusammenhänge wie Regelmäßigkeiten des Verlaufs wie alles Geschehen. Was aber, wenigstens im vollen Sinne, nur menschlichem Verhalten eignet, sind Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten, deren Ablauf verständlich deutbar ist.“ Und in „Wirtschaft und Gesellschaft“ findet sich sodann die gewissermaßen „ausgereifte“ Definition des Gegenstandsbereiches der „Soziologie“. Diese „soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. »Handeln« soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. »Soziales« Handeln aber soll ein solches heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten a n d e r e r bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist.“ Es ist nunmehr die zentrale These, dass die Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass in genau diesem Sinne das „humanspezifische Mit- und Gegeneinander“ überhaupt stattfinden kann, wenn die Agenten solcherart Geschehens sprachbegabte und in genau diesem Sinne kommunikativ kompetente Individuen sind, was sich in den nachstehend noch einmal wiedergegebenen vier Sätzen des Abschnitts II. 2. „abspiegelt“, nämlich: 1. Menschliches (»äußeres« oder »inneres«) Verhalten zeigt sowohl Zusammenhänge wie Regelmäßigkeiten des Verlaufs wie alles Geschehen. Weil aber der Mensch und nur der Mensch über das Instrument der Sprache verfügt, eignen seinem Verhalten Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten, deren Ablauf verständlich deutbar ist. 2. Das soziale Handeln menschlicher Individuen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist, ist deshalb deutend verstehbar und genau dadurch in seinem Ablauf wie in seinen Wirkungen ursächlich erklärbar, weil es wesentlich sprachlich organisiert ist: Menschliche Individuen können – zumindest „im Prinzip“ – immer und überall miteinander sprechen. 164 3. Soziologie und Linguistik bilden eine Komplementareinheit, denn virtuell sind menschliche Formen des Gemeinschaftslebens Gesprächsvergemeinschaftungen. Oder anders ausgedrückt: Idealtypologisch lässt sich, da aus diesem Blickwinkel die Sprache als (humanspezifische) Basisinstitution aufgefasst werden muss, welche die Kernstruktur sozialen Handelns überhaupt ausmacht, jedwede humanspezifische Interaktions- und Kommunikationsform als Gespräch im Gadamerschen Sinne deuten. 4. Die Fähigkeit sprachlich zu kommunizieren ist die unabdingbare Voraussetzung für sozialen Handeln im strengen Weberschen Sinne, wodurch das Habermas’sche Konstrukt der „Kommunikativen Kompetenz“ genau diejenige präzise Bedeutung bekommt, die es bislang nicht hatte: Kommunikative Kompetenz und genuin sprachlich organisierte Interaktions- und Kommunikationsformen sind komplementär aufeinander bezogen. Die ersten beiden Sätze sind eindeutig (widerspruchsfreie) „Verknüpfungen“ der Weberschen „Verstehenssoziologie“ mit den bei dem „Sozialbehavioristen“ Stryker aufgelisteten „anthropologischen Grundannahmen“, wohingegen der dritte Satz auf die Gadamersche Idealtypologie des „Gesprächs“ verweist. Der vierte Satz wiederum soll uns den Zugang erstens zu dem etwas komplizierten Gefüge der „Kommunikativen Kompetenz“ und zweitens zur Frage nach der Bedingungen der Möglichkeit je individueller Identitätskonstanz verschaffen. Es ist nämlich die zentrale These Gadamers, dass jedwede sprachlich organisierte Kommunikativdynamik, die sich der Idealtypologie des eigentlichen „Gesprächs“ annähert immer zugleich auch bei den Gesprächsteilnehmern Identitätsmetamorphosen (den Begriff führe ich hier ein) bewirkt. Wäre diese These tatsächlich tragfähig, so hätten wir einen ersten Anhaltspunkt für die Konstruktion des Begriffs der benignen Identitätskrise. Wie zuvor auch, gehe ich hierbei texthermeneutisch vor und zitiere zunächst einmal die mir wichtig erscheinenden Textausschnitte aus dem faszinierenden hermeneutischen Grundlagenwerk Gadamers, welches den Titel trägt „Wahrheit und Methode“, zerlege dann die betreffenden Textausschnitte in ihre einzelnen Aussagenbestandteile und gewinne so, wie ich hoffe, den Übergang zum Identitätsproblem. Auch hierbei werde ich wiederum mit den üblichen Techniken der Hervorhebung arbeiten, weise bereits an dieser Stelle darauf hin, dass sich streng genommen überall dort, wo Gadamer von der „Sache“ spricht auch der Begriff des „Problems“ einsetzen lässt. Wenn also Gadamer von dem „Zur-sprache-kommen der Sache 165 selbst“ spricht, dann bedeutet das gewissermaßen „zunehmende Problemklärung bzw. Problemlösung“. Gadamer schreibt: „Wenn wir das hermeneutische Phänomen nach dem Modell des Gespräches, dass zwischen zwei Personen statthat, zu betrachten suchen, so besteht die leitende Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden scheinbar so sehr verschiedenen Situationen, dem Textverständnis und der Verständigung im Gespräch, vor allem darin, daß jedes Verstehen und jede Verständigung eine Sache im Auge hat, die vor einen gestellt ist. Wie einer sich mit seinem Gesprächspartner über eine Sache verständigt, so versteht auch der Interpret die ihm vom Text gesagte Sache. Dieses Verständnis der Sache geschieht notwendig in sprachlicher Gestalt, und zwar nicht so, daß ein Verständnis nachträglich auch in Worte gefaßt wird, vielmehr ist die Vollzugsweise des Verstehens ob es sich um Texte handelt oder um Gesprächspartner, die einem die Sache vorstellen, das Zur-sprache-kommen der Sache selbst. So folgen wir zunächst der Struktur des eigentlichen Gesprächs, um die Besonderheit jenes anderen Gesprächs, das das Verstehen von Texten darstellt, dadurch zur Abhebung zu bringen. Während wir oben die konstitutive Bedeutung der Frage für das hermeneutische Phänomen am Wesen des Gesprächs herausgehoben, gilt es nun, die Sprachlichkeit des Gesprächs die ihrerseits dem Fragen zugrunde liegt, als ein hermeneutisches Moment nachzuweisen. Zunächst halten wir fest, daß die Sprache, in der etwas zur Sprache kommt, kein verfügbarer Besitz des einen oder des anderen der Gesprächspartner ist. Jedes Gespräch setzt eine gemeinsame Sprache voraus, oder besser: Es ist da etwas in die Mitte niedergelegt, wie die Griechen sagen, an dem die Gesprächspartner teilhaben und worüber sie sich miteinander austauschen. Die Verständigung über die Sache, die im Gespräch zustande kommen soll bedeutet daher notwendigerweise, daß im Gespräch eine gemeinsame Sprache erst erarbeitet wird. Das ist nicht ein äußerer Vorgang der Adjustierung von Werkzeugen, ja es ist nicht einmal richtig zu sagen, daß sich die Partner einander anpassen, vielmehr geraten sie beide im gelingenden Gespräch unter die Wahrheit der Sache, die sie zu einer neuen Gemeinsamkeit verbindet. Verständigung im Gespräch ist nicht ein bloßes Sichausspielen und durchsetzen des eigenen Standpunktes, sondern eine Verwandlung ins Gemeinsame hin, in der man nicht bleibt, was man war.“149 149 Gadamer [Wahrheit und Methode“] S. 360 166 Sodann geht Gadamer noch auf die Eigendynamik von Gesprächsformen ein, die nach unserer Auffassung in relativ reiner Form dem Rationalitätskriterium genügen. „Rationalität“ ist hierbei strukturelle Eigenschaft einer Interaktiv- und Kommunikativkonstellation nicht jedoch Merkmal der Personen, die an einem solchen „Gespräch“ teilhaben. Dennoch ist klar, dass nur und ausschließlich Personen, die ein gewisses Minimum an entsprechender rationaler und sozialer Kompetenz aufweisen die personellen Bedingungen der Möglichkeit bilden, dass eine solche Gesprächsform überhaupt statthaben kann. Wir werden auf diesen Punkt des öfteren noch zu sprechen kommen. Wenden wir uns noch einmal Gadamer zu, der wie ich finde, die endogene Dynamik solcher Gesprächsformen meisterhaft geschildert hat: „Wir sagen zwar, daß wir ein Gespräch ‚führen’, aber je eigentlicher ein Gespräch ist, desto weniger liegt die Führung desselben in dem Willen des einen oder des anderen Partners. So ist das eigentliche Gespräch niemals das, das wir führen wollten. Vielmehr ist es im allgemeinen richtiger zu sagen, daß wir in ein Gespräch geraten, wenn nicht gar, daß wir uns in ein Gespräch verwickeln. Wie da ein Wort das andere gibt, wie das Gespräch seine Wendungen nimmt, das mag sehr wohl eine Art Führung haben, aber in dieser Führung sind die Partner des Gesprächs weitweniger die Führenden als die Geführten. Was bei einem Gespräch ‚herauskommt’ weis keiner vorher. Die Verständigung oder ihr Misslingen ist wie ein Geschehen, das sich an uns vollzogen hat ... All dies bekundet, dass das Gespräch seinen eigenen Geist hat und daß die Sprache, die in ihm geführt wird, ihre eigene Wahrheit in sich trägt, d.h. etwas ‚entbirgt’ und heraustreten läßt, was fortan ist“.150 Die erste Textstelle, zerfällt in zwei Abschnitte, die sinnstrukturell zu einer, wie ich finde, gerade im Hinblick auf das in dieser Arbeit ins Zentrum gestellte Identitätsproblem hoch interessanten Thetik verknüpft sind: Jedes Gespräch im eigentlichen Sinne löst, weil es immer zugleich auch kognitive Umorientierungen induziert, bei den „Gesprächspartnern“ Identitätskrisen aus. Im idealen Fall jedoch sind solche Identitätskrisen grundsätzlich benigner Natur, bewirken doch genuin „gadamerianische“ Gesprächsformen, da sie immer den Erfahrungshorizont erweitern, echte Identitätsmetamorphosen – das sind wesentlich auf „Mündigkeit“ hin dimensionierte Persönlichkeitswandlungen. 150 Es ist nun klar, ibid. S. 361 167 dass damit der Begriff der „Identitätsmetamorphose“ wesentlich verknüpft werden müsste mit jener Klasse von Lernvorgängen, die kognitive Umorientierungen genannt zu werden pflegen. Aus diesem Blickwinkel fungiert dann natürlich das Gadamersche „Gespräch“ als ein Wesenselement jedweder Sozialisationsagentur. Doch so einfach ist die Sache nicht, wie wir gleich sehen werden. Die zweite Textstelle kann als Erläuterung der ersten aufgefasst werden, jedoch kommt hierbei noch ein, wie ich finde, hochinteressantes Moment hinzu: Identitätsmetamorphosen sind objektiv statthabende Prozesse, die als Resultanten eines Lerngeschehens angesehen werden müssen, bei welchem die Beteiligten sich dessen, was da mit ihnen geschieht, gar nicht bewusst sind. Wir haben also hier den etwas seltsamen Fall von kognitiven Umorientierungsprozessen vor uns, bei dem die eigentlich wichtigen Momente der kognitiven Umorientierungen unbewusst verlaufen. Genau hier liegt, wie mir scheint, der notwendige Überschritt zu einer genuin psychoanalytischen Re-Interpretation des „Gesprächsgeschehens“. Doch hierzu erst später. Zerlegen wir die Textstellen nunmehr in ihre Bestandteile, wobei wir den ersten Text in Teil A und Teil B zerlegen und die zweite Textstelle als Teil C bezeichnen: Teil A: 1. Wenn wir das hermeneutische Phänomen nach dem Modell des Gespräches, dass zwischen zwei Personen statthat, zu betrachten suchen, so besteht die leitende Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden scheinbar so sehr verschiedenen Situationen, dem Textverständnis und der Verständigung im Gespräch, vor allem darin, dass jedes Verstehen und jede Verständigung eine Sache im Auge hat, die vor einen gestellt ist. [Übersetzen wir: Die minimale soziale Situation, die das Interaktionsgeschehen zwischen zwei humanen Individuen ausmacht, ist virtuell eine Gesprächssituation, in welcher sich der Kommunikationsprozess als Verständigungsprozess sach- bzw. problembezogen vollzieht.] 2. Wie einer sich mit seinem Gesprächspartner über eine Sache verständigt, so versteht auch der Interpret die ihm vom Text gesagte Sache. 3. Dieses Verständnis der Sache geschieht notwendig in sprachlicher Gestalt, und zwar nicht so, dass ein Verständnis nachträglich auch in Worte gefasst wird, vielmehr ist die 168 Vollzugsweise des Verstehens ob es sich um Texte handelt oder um Gesprächspartner, die einem die Sache vorstellen, das Zur-sprache-kommen der Sache selbst. [Der Sachbezogene Verständigungsprozess, der in jeder, virtuell eine Gesprächssituation verkörpernder minimaler sozialer Situation sich vollzieht, ist, weil als (komplementäre) „Vollzugsweise des Verstehens“ aufzufassen, dass „Zur-sprache-kommen der Sache“ selbst, woraus sich logisch ergibt: Kommt die „Sache“, um die es „beiden“ geht, nicht „richtig heraus“, so muss das „Gespräch“ als gescheitert gelten.] 4. So folgen wir zunächst der Struktur des eigentlichen Gesprächs, um die Besonderheit jenes anderen Gesprächs, das das Verstehen von Texten darstellt, dadurch zur Abhebung zu bringen. [Pädagogisch vollzieht Gadamer hier eine sog. „Zeigehandlung“151, welche besagt „schauen wir uns die „Struktur des Gesprächs“ genauer an, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das, was den Wesenskern des Gesprächs ausmacht. Das ist, wie der nächste fünfte Satz ausweist, die Sprache bzw. die Sprachlichkeit.] 5. Während wir oben die konstitutive Bedeutung der Frage für das hermeneutische Phänomen am Wesen des Gesprächs herausgehoben, gilt es nun, die Sprachlichkeit des Gesprächs die ihrerseits dem Fragen zugrunde liegt, als ein hermeneutisches Moment nachzuweisen. [Fragestellung: Worin genau liegt die Sprachlichkeit des Gesprächs? Oder anders noch gefragt: Ist nicht jedwede humanspezifische Form der Kommunikation virtuell auf Gespräch hin angelegt? Das ist sicher der Fall, handelt es sich doch hierbei um genau jene „minimale soziale Situation“, die den Gegenstand der Weberschen „Begriffslehre“ bildet. Folglich macht „Sprache“ das Eigentliche aller minimalen sozialen Situation aus. Was aber ist das: „Sprache“ bzw. „Sprachlichkeit“? Die Antwort wird lauten: Ein Geschehen, dass sich an uns vollzieht. Genau dies ist der Clou, welcher der Interpretation bedarf.] Teil B: 1. Zunächst halten wir fest, dass die Sprache, in der etwas zur Sprache kommt, kein verfügbarer Besitz des einen oder des anderen der Gesprächspartner ist. 2. Jedes Gespräch setzt eine gemeinsame Sprache voraus, oder besser: 151 Vgl. Dietlinde Michael zur „Funktion des Gadamerschen Gesprächs für den pädagogischen Prozess“. 169 3. Es ist da etwas in die Mitte niedergelegt, wie die Griechen sagen, an dem die Gesprächspartner teilhaben und worüber sie sich miteinander austauschen. 4. Die Verständigung über die Sache, die im Gespräch zustande kommen soll, bedeutet daher notwendigerweise, dass im Gespräch eine gemeinsame Sprache erst erarbeitet wird. 5. Das ist nicht ein äußerer Vorgang der Adjustierung von Werkzeugen, ja es ist nicht einmal richtig zu sagen, dass sich die Partner einander anpassen, vielmehr geraten sie beide im gelingenden Gespräch unter die Wahrheit der Sache, die sie zu einer neuen Gemeinsamkeit verbindet. [Wohlgemerkt: Es ist die Sache, die sie zu einer neuen Gemeinsamkeit verbindet, was heißt: Die Gesprächspartner müssen sich, weil sie „unter die Wahrheit der Sache geraten“, zu einer neuen Gemeinsamkeit verbinden. Diese Form der Vergemeinschaftung ist nicht das Resultat von etwas, was beide gewollt haben oder nicht gewollt haben. Es ist eine unbeabsichtigte Konsequenz dessen, was sie eigentlich wollten.] 6. Verständigung im Gespräch ist nicht ein bloßes Sichausspielen und durchsetzen des eigenen Standpunktes, sondern eine Verwandlung ins Gemeinsame hin, in der man nicht bleibt, was man war. Teil C (Ich nehme mir nachstehend die Freiheit, die Sätze nur noch in ihrem Sinngehalt wiederzugeben. Dies geschieht deshalb, weil ich hierbei bereits wörtliches Zitat und Interpretation zusammenfüge): 1. Je eigentlicher ein Gespräch ist, desto weniger liegt die Führung desselben in dem Willen des einen oder des anderen Partners. [Aus Weberscher Sicht ein etwas verblüffender Satz, wie man sieht: Was wird eigentlich hierbei aus dem „subjektiv sinnhaften Sichverhalten zu Objekten“? Gibt es denn ein solches „subjektiv sinnhaftes Sichverhalten zu Objekten“, welches in einem eigentlichen „Gespräch“ sozusagen „ins Hintertreffen gerät“?] 2. [Noch schärfer:] Das eigentliche Gespräch ist niemals das, was wir führen wollten. 3. Handelt es sich um ein „eigentliches Gespräch“, so „geraten“ wir in ein solches bzw. wir „verwickeln uns“ in ein solches, woraus sich logisch ergibt: Je mehr eine Kommunikationsform die Struktur des sog. „eigentlichen Gesprächs“ annimmt, desto mehr „geraten“ wir in ein solches, werden in ein solches „verwickelt“. Dies eine Aussage, aus der 170 wiederum die Aussage 2 in diesem Teil logisch folgt. Diese wird dadurch zu einer streng allgemeinen Aussage: Wann immer und wo immer eigentliche Gespräche – das sind Gespräche, die konsequent auf eine Sache ausgerichtet sind – sich vollziehen, vollziehen diese sich niemals nach Maßgabe dessen, was die „Gesprächsführer“ eigentlich wollen, gewollt haben bzw. wollten; woraus wiederum logisch folgt: 4. Die Partner eines „eigentlichen Gesprächs“ sind immer die „Geführten“, woraus logisch folgt: 5. Prinzipiell ist der Ausgang eines eigentlichen Gesprächs nicht vorhersehbar, woraus logisch folgt: Je vorhersehbarer der Ausgang eines Gesprächs ist, desto weniger erreicht ein solches Gespräch das Kriterium, ein „eigentliches Gespräch“ zu sein. [Wir können dieses Prinzip als das Prinzip der grundsätzlichen Emergenz aller Gespräche im eigentlichen Sinne bezeichnen, denn in jedem solchen „Gespräch“ ereignet sich etwas Neues, nicht Vorhergesehenes bzw. etwas nicht Vorhersehbares.] 6. Die Verständigung ebenso wie das Misslingen derselben ist ein (sprachlich) objektiv ablaufendes Geschehen, dass sich an den Partnern vollzieht bzw. vollzogen hat. 7. [Fazit:] Ein eigentliches Gespräch beinhaltet eine objektiv statthabende autonome Logik, deren Dynamik sich ohne das bewusste Zutun der Beteiligten „über deren Köpfe hinweg“ vollzieht, denn die Sprache, die in diesem „Gespräch“ sich artikuliert, „trägt ihre eigene Wahrheit in sich“. Sie ist es, die etwas prinzipiell Neues, nicht Vorhersehbares heraustreten lässt. Oder anders: Bei einem echten „Gespräch“ entsteht eine „neue Wahrheit“. Oder noch anders: Genuine Gespräche sind prinzipiell sprachlich emergent, woraus folgt: Die grundsätzliche Emergenz jedweden genuinen Gesprächs betrifft dessen Sprachlichkeit: Heraustreten tut eine neue Wirklichkeit, weil sich eine neue Sprache ergeben hat. Dass in den Gadamerschen Ausführungen sich Ideal und Idealtypus derartig stark überschneiden, liegt natürlich an dem schon fast unerträglich wirkenden „hegelianischexistenzialistischen Jargon“. Deswegen interessiert uns auch z.B. weniger der letzte Satz des Teils C in der Hinsicht, die Gadamer wohl im Auge hat. Wir müssten ihn für unsere Belange eigentlich völlig umformulieren, worauf hier verzichtet werden soll, denn mir kommt es dabei 171 auf etwas anderes an, was erst deutlich werden kann, wenn man auf die Gadamersche „Idealtypologie des Gespräches“ sozusagen mit „weberianischen Augen blickt“. Gadamer geht es hier natürlich um die Demonstration des sog. „hermeneutischen Phänomens“, welches sich seiner Auffassung zufolge sowohl beim Textverständnis als auch bei Formen des sozialen Handelns geltend macht, denn er will des Nachweis führen, dass ganz allgemein die Methode der „Texthermeneutik“ nach Maßgabe der im „Gespräch“ aufweisbaren „Verstehensprinzipien“ erfolgt bzw. zu erfolgen hat, was uns gleichwohl an dieser Stelle weniger interessiert. Uns interessiert vielmehr die idealtypologisch gefasste Struktur von genau denjenigen Kommunikationsformen, die Gadamer hier unter dem Oberbegriff „Gespräch“ subsumiert. Auffällig nämlich ist, dass sich praktisch jede Aussage der drei Textteile in eine normative Aussage überführen lässt, ohne dass sich der Sinngehalt dabei wesentlich verändert. Das aber heißt: Gadamer kommt es überhaupt nicht darauf an – und dies zu Recht –, empirisch nachprüfbare Aussagen über wirklich stattgehabte Formen sprachlich dominierter Vergemeinschaftungsprozesse zu formulieren. Es handelt sich also hierbei auf gar keinen Fall um empirisch falsifizierbare Hypothesen, über deren Wahrheit oder Falschheit mittels empirischer Überprüfung befunden werden könnte. Vielmehr handelt es sich um ein idealtypisches Schema, welches als Maßstab für mögliche Beschreibungen fungiert. Das genau ist es, was Habermas vollständig verkennt. In der sog. „gesellschaftlichen Wirklichkeit“ dürfte es wohl eher selten sein, dass Annäherungen an das hier von Gadamer entworfene „Ideal“ optimaler Sachbezogenheit bzw. optimalen Problemlösungsverhaltens zu beobachten sind. Das jedoch ist das Wesen der sog. „Idealtypen“. Dass Gadamer sich allerdings einer Sprache bedient, die im sog. „deutschen Idealismus“ beheimatet ist, braucht uns nicht zu stören und sollte uns folglich auch nicht weiter stören. Es handelt sich eben um eine idealtypische Konstruktion, und es gibt, wie Max Weber es einmal drastisch formuliert hat, Idealtypen von Staaten ebenso wie es Idealtypen von Bordellen gibt. Verknüpfen wir in diesem Sinne und aus dieser Perspektive die begriffliche Struktur der Anfangssequenz des ersten Abschnitts (Teil A) mit der begrifflichen Struktur der Schlußsequenz des zweiten Abschnittes (Teil B), so ergibt sich in thetischer Überschärfung die obige Fundamentalaussage: Findet zwischen mindestens zwei Personen, die sich auf ein echtes Gespräch einlassen, ein solches Gespräch auch statt, dann erfolgt, weil dann eine „Verwandlung ins Gemeinsame hin“ sich herausbildet eine Identitätsmetamorphose bei beiden Gesprächsteilnehmern, d.h. die 172 beiden Gesprächspartner haben sich in ihrer jeweiligen Persönlichkeitsstruktur verändert, ohne dass sie dies bemerkt haben. Das ist zweifelsohne die Kernaussage der Gadamerschen Gesprächstypologie. Wie aber lässt sich dies zeigen und was bedeutet das? Analysieren wir die Argumentationsstruktur noch etwas genauer: Da wir uns nicht für das Gadamersche Anliegen interessieren, das sog. „hermeneutische Phänomen“ sowohl am „Textverständnis“ als auch am „Gespräch“ nachzuweisen, können wir die „Wenn-Dann-Struktur“ des ersten Satzes (Teil A) ignorieren und diesen Satz in eine apodiktische Behauptung transformieren: Anhand der Gesprächstypologie lässt sich nachweisen, dass Verstehens- und Verständigungsvorgänge in beliebigen Interaktions- und Kommunikationszusammenhängen sach- und problemorientiert, nicht jedoch personenorientiert sind. Je mehr also die Bedingungen des „idealen Gesprächs“ in beliebigen Interaktions- und Kommunikationszusammenhängen realisiert sind, desto stärker schwächt sich die genuin psychologische Dimension bei Verstehens- und Verständigungsvorgängen ab. Oder auch (kantianisch) ausgedrückt: Gesprächspartner, denen es ein wirkliches Anliegen ist, ein bestimmtes Problem – eine „Sache“ – zu klären, müssen sich zunächst einmal als „Zweck an sich“ anerkennen, bevor sie sich kooperativ um der möglichen Lösung eines Problems willen auf ein genuines „Gespräch“ einlassen. Den zweiten Satz (Teil A) können wir aus den obig genannten Gründen vernachlässigen und gegen gleich zum dritten Satz (Teil A) über. Auch hierbei vernachlässigen wir die „texthermeneutische Analogaussage“ und haben dann: „Dieses Verständnis der Sache geschieht notwendig in sprachlicher Gestalt, und zwar nicht so, dass ein Verständnis nachträglich auch in Worte gefaßt wird, vielmehr ist die Vollzugsweise des Verstehens [durch den oder die] Gesprächspartner, die einem die Sache vorstellen, das Zur-sprache-kommen der Sache selbst.“ Dieser dritte Satz von Teil A – er beinhaltet die Kernbehauptung, welche die prozessurale Struktur von Gesprächen betont und auf das humanspezifische Phänomen der Sprachlichkeit abzielt – zerfällt in die folgende sechs Teilsätze: (Dritter Satz Teil A) 1. Das Verständnis der Sache geschieht notwendig in sprachlicher Gestalt. 173 (Dritter Satz Teil A) 2. Ein solches Verständnis besteht nicht darin, dass es „nachträglich in Worte gefasst“ wird. (Dritter Satz Teil A) 3. Das Verständnis der Sache vollzieht sich im Vorgang des Verstehens, woraus sich trivialerweise ergibt: (Dritter Satz Teil A) 4. Verständnis ist nicht etwas, was „urplötzlich über einen kommt“, es hat wesentlich eine prozessurale Struktur, ist ein dynamischer Vorgang. (Dritter Satz Teil A) 5. Einer von beiden muss die „Sache“, um die es gehen soll, (zunächst einmal) vorstellen. Das tut er natürlich in einer ersten ganz und gar groben Form. Bei Max Weber geschieht das in Gestalt der sog. „Arbeitsdefinition“. (Dritter Satz Teil A) 6. Der Verstehensvorgang ist ein objektiv statthabender Prozess, in welchem „die Sache“ zur Sprache kommt. Bemerkenswert ist natürlich der 2. Satz, der zunächst etwas befremdlich klingt, dann jedoch deutlich wird, wenn man ihn aus der Perspektive des 3. und 4. Satzes betrachtet: Ein Verständnis, welches nachträglich in Worte gefasst werden würde, würde nur rationalisieren, was man meint, intuitiv und von Anfang an „sowieso“ verstanden zu haben. Hier ist derjenige Fall gegeben, der sozusagen als „Normalfall“ zumeist uns begegnet (Paradigma „politische Talkshow im TV): Die Sprache tritt, da völlig ritualistisch, phraseologisch und formelhaft geworden, so stark in den Dienst einer – zumeist demagogischen bzw. selbstdarstellerischen – Absicht, dass sie ihre Eigendynamik gar nicht entfalten kann. Beispiele hierfür wären ganz allgemein die Turnier- und Kampfgespräche, bei denen es nur darum geht, in erster Linie sich selbst, nicht jedoch „die Sache“ ins rechte Licht zu rücken. Der Betreffende, der so verfahren würde, würde sich auf ein echtes Gespräch eben gar nicht einlassen bzw. eingelassen haben. Er wäre dann ganz einfach nicht an der „Sache“ bzw. an dem Problem, um welches es dabei geht, interessiert. Siehe hierzu weiter oben die zitierten Ausführungen meines Kollegen Schönleben, über die sog. „Streitgespräche“, bei denen ja notorisch gegen das Postulat der strengen Trennung von Entdeckungs- und Begründungszusammenhang verstoßen wird. Wir brauchen das hier nicht weiter auszuführen, denn der Sachverhalt, um den es dabei geht, dürfte wohl ziemlich klar sein. Aus diesem Blickwinkel hat dann natürlich der 6. Satz apodiktische Geltung. Von ihm ist auszugehen, was Gadamer sodann ja auch in Satz 4 von Teil A explizit betont, nämlich: 174 Betrachten wir – so die Gadamersche „Zeigehandlung“ in diesem Teil A – nunmehr die Struktur des eigentlichen Gespräches (Satz 4 von Teil A) weisen nach, dass das Wesen des Gespräches in der Sprachlichkeit (Satz 5 von Teil A) begründet ist und ziehen eine Schlußfolgerung dahingehend, dass wir uns anschauen, was bei diesem ganzen Vorgang eigentlich mit den Gesprächsteilnehmern, den Agenten des hierbei statthabenden Sozialgeschehens passiert. Dies nämlich der zentrale Punkt, um den es mir hier geht. In diesem Sinne bemühen wir uns um einen Kommentar zu den Sätzen von Teil B, der gleichwohl sehr eng bezogen bleibt auf die Gadamerschen Ausführungen selbst, also: Zu Satz 1 von Teil B: Selbstverständlich ist die „Sprache in der etwas Zur-sprache-kommt, kein verfügbarer Besitz des einen oder des anderen der Gesprächspartner“, ist sie doch als gemeinmenschliche Institution das allen menschlichen Wesen eignende Kommunikationsmedium, was dann ja auch in Satz 2 von Teil B („Jedes Gespräch setzt eine gemeinsame Sprache voraus“) bzw. in Satz 3 von Teil B („Es ist da etwas in die Mitte niedergelegt, wie die Griechen sagen, an dem die Gesprächspartner teilhaben und worüber sie sich miteinander austauschen“) zum Ausdruck kommt. In Satz 4 von Teil B haben wir dann eine apodiktische Kausalbehauptung, die sich in mehrfacher Formulierung fassen lässt: Weil die Verständigung über die Sache im Gespräch zustande kommen soll, muss im Gespräch eine gemeinsame Sprache erst erarbeitet werden. Oder: Die Erarbeitung einer gemeinsamen Sprache im Gespräch ist die notwendige Bedingung dafür, dass die Verständigung über die Sache, die im Gespräch zustande kommen soll, auch tatsächlich eine Chance hat, zustande zu kommen. Oder: Dann und nur dann, wenn im Gespräch eine gemeinsame Sprache erarbeitet wird, kann Sachverständigung im eigentlichen Sinne erreicht werden. Usw. usw. Wir beziehen das, worum es hier geht, nunmehr auf das obige Emergenzprinzip, so dass gilt: Nur und ausschließlich in solchen Gesprächen hat sachbezogener Konsens bzw. Problemlösung eine Chance zustande zu kommen, wenn sich dabei eine linguistische Innovativstruktur herausbildet. Diese jedoch wird den Gesprächsteilnehmern niemals „geschenkt“ sie ist vielmehr das Resultat harter gedanklich disziplinierter Arbeit. 175 Wichtig ist hier die Sachaussage, dass diejenige Sprache, in welcher schließlich „Verständigung über eine Sache“ erreicht werden kann, zu Beginn eines „eigentlichen Gesprächs“ noch gar nicht existiert. Sie ist vielmehr immer, wie gesagt, das Resultat harter gedanklich disziplinierter Arbeit.152 Um den Clou des Gadamerschen Grundgedankens herauszuschälen, stellen wir die folgende Frage: Worauf genau richtet sich eigentlich das Bemühen der Gesprächsteilnehmer? Wollen sie etwa eine „neue Sprache“ erarbeiten? Das ist ganz sicherlich nicht der Fall. Ihre ganze Bemühung richtet sich vielmehr auf die ihnen „vorgegebene Sache“, sie wollen u.U. ein Problem gemeinsam lösen und ihre ganze Aufmerksamkeit ist, insofern es sich tatsächlich um ein „eigentliches Gespräch“ handelt, auf „die Sache“, auf das „Problem“, welches wie Gadamer so schön sagt, „in die Mitte zwischen sie beide gelegt ist“, gerichtet. Und der entscheidende Punkt hierbei, um den es Gadamer – und eben auch uns – wesentlich geht: Je mehr die Aufmerksamkeit sowie die gedankliche Anstrengung der sprachlichen Kooperation zweier Personen von dem „Problem“ bzw. von der „Sache“ absorbiert ist, an dem sozusagen beide „arbeiten“, um sich „darüber zu verständigen“ oder auch sich darüber klar zu werden, desto weniger können sie auf ihre Sprache, ihre Redeweise, auf die Formulierungen bzw. auf „Wohlgeformtheit der Worte und Sätze“ achten. Das aber heißt: Die beiden Gesprächspartner, die sozusagen ungewollt sprachlich kreativ werden müssen, weil es ihnen um „etwas“ geht, bilden eine neue gemeinsame Sprache heraus, ohne dies zu wollen – klassischer Fall dessen, was die traditionelle Soziologie die „unbeabsichtigten Konsequenzen absichtsgeleiteten Handelns“ genannt hat. Der Satz 4 von Teil B lautet nunmehr, wie mir scheint: Die mühselige „Erarbeitung“ einer neuen gemeinsamen Sprache ist ungewollter Nebeneffekt – oder in Weberscher Sprache ausgedrückt ist nicht Objekt des komplementär aufeinander bezogenen subjektiv sinnhaften Sichverhaltens – des im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehenden Versuches, sich einer schwierigen Sache, die „im Gespräch zustande kommen soll“, gemeinsam zu bemächtigen. 152 Vgl. hierzu auch die Ausführungen meiner Kollegin Dietlinde Michael in ihrem bereits erwähnten Vortragspapier über die „Funktion des Gadamerschen Gespräches für den pädagogischen Prozess“. 176 Auf genau diesen „Nebeneffekt“ kommt es uns natürlich wesentlich an, denn mit ihm passiert noch etwas Unvorhergesehenes, was wir uns nunmehr in Satz 5 von Teil B anschauen wollen, nämlich: Die beiden Gesprächspartner geraten so „unter die Wahrheit der Sache, die sie zu einer neuen Gemeinsamkeit verbindet“, dass sie beide (nunmehr Satz 6 von Teil B) nicht bleiben, was sie (ursprünglich) waren. Mit der neuen Sprache, die sie nunmehr sprechen, sind sie „andere“ geworden, sie haben eine Persönlichkeitsveränderung durchgemacht, ohne dies überhaupt zu bemerken. Die Gadamersche Kernaussage ist somit sonnenklar, wie mir scheint: Verändert sich wirklich die Sprache eines Menschen, so verändert dieser Mensch sich in seiner systemischen personalen Struktur. Genau diesen Tatbestand nenne ich nunmehr Identitätsmetamorphose. Wir können uns jetzt auch, so glaube ich, erneut mit dem Teil C befassen, ohne Gefahr zu laufen, dabei dem hegelianisch-existenzialistischen Jargon aufzusitzen. Dabei richten wir sogleich unsere Aufmerksamkeit auf den 7. Satz in Teil C: Die Beteiligten haben ohne dies überhaupt zu bemerken, weil sie nach einem solchem Gespräch eine andere Sprache sprechen, mithin also auch „die Welt mit anderen Augen sehen“, eine Identitätsmetamorphose durchgemacht. Stellen wir die folgende zentrale Frage: Was genau wird hier beschrieben bzw. was genau haben die beiden Gesprächskontrahenten durchgemacht? Es wird ein Lernprozess beschrieben, der sich auf ein „Objekt“ bezieht. Die beiden Gesprächskontrahenten haben ein Lernprozess durchgemacht, der sich nicht „auf den anderen“ bezieht – beide haben also nicht „einander“ besser kennengelernt –, und der sich auch nicht auf das sprachliche Geschehen selbst bezieht, der sich vielmehr auf „eine Sache“, auf „etwas“ von beiden „ins Auge gefasstes“ bezieht. Die zentrale These lautet nunmehr: Lernen als kognitive Umorientierung geschieht bei menschlichen Wesen sprachlich. Spricht jemand anders, so hat er sich in seiner Persönlichkeitsstruktur verändert, und ist dies der Fall, so hat er eine Identitätsmetamorphose „durchgemacht“. Entscheidend aber ist: Ein solcher Prozess findet statt bzw. kann stattfinden, ohne dass sich ein „Individuum“ einer solchen 177 Veränderung „seiner“ Persönlichkeit bewusst sein muss. Die stattgehabte Veränderung wird einfach zum selbstverständlichen Bestandteil seiner (sprachlichen) Verhaltenseigentümlichkeiten, und erst, wenn massive Irritationen auftreten, die sich z.B. in bestimmten Fehlleistungen äußern mögen, stellt sich auf der Bewusstseinsebene die Identitätsfrage. Identitätsmetamorphosen finden statt, ohne dass die betreffenden Individuen dies bemerken müssen, stellt sich jedoch die Identitätsfrage, wie auch immer sich dies symptomatisch äußern mag, so erfüllt das eben den Tatbestand der Identitätskrise. 5.5. Das DN-Modell einer wissenschaftlicher Erklärung Es wurden zwei Aufgabenbereiche für die Erfahrungswissenschaften festgelegt: Erklärung und Entdeckung. Es wurde, wie erinnerlich, gesagt, dass die Zielsetzung der Erfahrungswissenschaften darin bestehe, „Erklärungen zu liefern für alle Phänomene der realen Welt, die uns einer Erklärung bedürftig erscheinen“. Und bei diesem Versuch, Phänomene der realen Welt erklären zu wollen, ergeben sich dann Entdeckungen, auf die wir vorher nicht gekommen wären, wenn wir uns nicht dem Abenteuer der Forschung überantwortet hätten. „Forschung“, so hatten wir gesagt, ziele ab auf Problematisierung des Selbstverständlichen, Entfremdung des uns „Vertrauten“. Und so ergibt sich eine gewisse Dialektik: Indem wir Phänomene, die uns einer Erklärung bedürftig erscheinen, aufklären, konstruieren wir sprachliche Instrumente (Begriffe, Hypothesen, Theorien) die es uns ermöglichen, Dinge zu sehen, Aspekte zu verdeutlichen, auf die wir vorher keinerlei Aufmerksamkeit gerichtet hatten. Popper hat hierfür das Schema „Problem“ – „Problembeschreibung“ – tentative „Problemlösung“ – „Konstruktion einer Theorie“ – „Neubeschreibung“ entwickelt. Wir versuchen also Phänomene mittels ganz bestimmter Theorien zu beschreiben bzw. zu erklären, erforschen im Lichte dieser Theorien die zuvor beschriebenen Phänomene, entdecken dabei vorher nicht Bekanntes, begehen Irrtümer, die wir sodann mittels erneuter Theoriekonstruktionen zu eliminieren versuchen, stoßen auf neue Phänomene, die uns neue Rätsel aufgeben, formulieren hierfür erneute Erklärungen usw. usw. Zur Verdeutlichung zitiere ich aus einem 1970 publizierten 178 Aufsatz Popper’s, wo er sein „Erkenntnisfortschrittsschema durch Theorienkonstruktion“ ausgesprochen anschaulich, wie ich finde, geschildert hat: „I shall ..., schreibt er, present a general tetradic schema which I have found more and more useful as a description of the growth of theories. It is as follows: P1 → TT → EE → P2 Here »P« stands for »problem«; TT stands fot »tentative theorie«; »EE« stands for »(attempted) error-elimination«, especially by way of critical discussion. My tetradic schema is an attempt to show that the result of critism, or of error-elimination, applied to a tentative theorie, is as a rule the emergence of e new problem: or indeed, of several new problems.“ Denn: „Problems, after they have been solved and their solutions properly examined, tend to beget problem-children: new problems often of greater depth and ever greater fertility than the old ones. This can be seen especially in the physical sciences; and I suggest that we can best gauge the progress made in any science by the distance in depth and expectendess between P1 and P2: the best tentavive theories (and all theories are tentative) are those which give rise to the deepest and most unexpected problems“.153 Poppers ganze Aufmerksamkeit konzentrierte sich, wie bekannt, auf das Problem der Evolution der menschlichen Erkenntnis, die forschend zu immer umfassenderen und immer präziseren Theorien gelangt sei, und bezogen auf genau diese Problematik stellt sich sodann naturgemäß die Frage, wie eigentlich diese Theorien beschaffen sein müssten, um einen solchen Erkenntnisfortschritt zu ermöglichen. Die Antwort auf eben diese Frage macht den eigentlichen „Clou“ der Popperschen Wissenschaftsphilosophie aus: Wenn mittels des sog. „DN-Schemas einer wissenschaftlichen Erklärung“ tatsächlich, wie es ja nicht nur von Popper sondern auch von den anderen Wissenschaftstheoretikern, die der sog. „Wiener Schule“ nahestanden, behauptet wurde, das „logische Gerippe“ jedweden Erklärungsvorgangs mit Anspruch auf Rationalgeltung wiedergegeben werde, dann müssten die dabei verwendeten Theoriegebilde ganz bestimmten Bedingungen genügen. Popper selbst formuliert dies schlagwortartig ungefähr so: Der – oben schematisch beschriebene – Erkenntnisfortschritt beruht auf dem Mechanismus der optimalen Kritisierbarkeit bestimmter Erklärungsangebote (tentative Theorieentwürfe – siehe obiges Schema), und optimale Kritisierbarkeit ist gleichbedeutend mit prinzipieller Falsifizierbarkeit, was den fraglichen Theorien eine ganz 153 Popper, K. R. [A Realist View], S. 287 179 bestimmte logische Struktur aufherrscht: Sie müssen widerspruchsfrei, gesetzesartig formuliert und „durch widerstreitende Erfahrung“ widerlegbar sein. Und dies wiederum bedeutet: Empirisch falsifizierbare Theorien müssen als streng allgemeine Allsatz-Systeme so aufgebaut sein, dass ihre Widerlegung möglich ist. Poppers „(attempted) error-eliminations“ erfolgen über den Mechanismus der effektiven Falsifikation. Deshalb kann der Erkenntnisfortschritt auch aufgefasst werden als ein Prozess der falsifizierenden Aussonderung von vormals für „wahr“ gehaltenen Theorien. Stegmüller hat diesen hier von Popper beschriebenen Tatbestand dadurch Rechnung getragen, dass er das „Wesen der Wissenschaft“ als ein prinzipielles „Wissen auf Widerruf“ bezeichnet hat. Wir haben scharf zwischen „Forschungsmodus“ und „Anwendungsmodus“ unterschieden. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Popper z.B. dieser Frage streng genommen gar keine Aufmerksamkeit geschenkt hat, denn das Problem der sog. „angewandten Wissenschaften“ interessierte ihn nur am Rande. In einem Punkt jedoch herrscht Übereinstimmung: Mag auf lange Sicht tatsächlich selbst die bestbestätigte Theorie sich als unzulänglich („falsifiziert“) herausstellen, so sind dennoch hier und heute vorgenommene Aktionen der Wirklichkeitsveränderung – z.B. in Gestalt von therapeutischen Eingriffen in „natürliche Abläufe“ – nur mittels gut bewährten, streng allgemein formulierten Theorien möglich, die sich sozusagen aus gesetzesartigen Aussagegebilden („nomologische Hypothesen“) „zusammensetzen“. Es ist deshalb an dieser Stelle einschränkend auf folgendes hinzuweisen, bevor wir uns dann der logischen interessieren Struktur uns wissenschaftlicher bisweilen keineswegs Erklärungen das Abenteuer zuwenden: der Lebenspraktisch Forschung und die Neuentdeckungen, die damit verbunden sind. Vielmehr interessiert uns mindestens genauso stark, dass die Wissenschaft z.B. in Gestalt der „klinischen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften“ (Weber) in den Dienst der Lebenspraxis gestellt werden kann, weil sie bessere Instrumente zur Bewältigung bestimmter Probleme zur Verfügung stellt, als z.B. die Religion. Es geht also nicht nur um den Erkenntnisfortschritt an sich und um die Konstruktion immer umfassenderer und immer präziserer Theorien, sondern eben auch um die Verbesserung der menschlichen Lebensverhältnisse, um die Linderung des menschlichen Leidens, um die Heilung von Krankheiten und die Verhinderung des vorzeitigen Todes. Es ist, wie Max Weber ausgeführt hat, geradezu ein Kennzeichen der Moderne, dass der durch die Wissenschaft eingetretene Prozess der „Entzauberung der Welt“ ja auch die praktische Lebensweise des Menschen der Moderne grundsätzlich gewandelt hat. Paradigmatisches 180 Belegstück hierfür ist die Entwicklung der modernen Medizin. Und bei aller Kritik muss doch darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Medizin in vieler Hinsicht, gerade weil sie streng wissenschaftlich diszipliniert ihre Grundlagenforschung betrieben hat, menschliches Leid gelindert hat. Kultursoziologisch ist es ja sogar die Aufgabe der Medizin dieses zu tun, nur muss man eben scharf unterscheiden zwischen medizinischer Grundlagenforschung und „Klinik“. In diese „Rahmenbedingungen“ soll nunmehr eine spezifische Ergänzung des für den wissenschaftlichen Auftrag unserer Fachdisziplinen geltenden Postulatenkatalogs vorgenommen werden. Wie erinnerlich, ist das wichtigste Instrument der wissenschaftlichen Erklärungen das Gefüge von Theorien, mittels derer wir die Erklärung der uns interessierenden Phänomene bewerkstelligen. Eine Erklärung, so wurde gesagt, bestehe in der kausalen Verknüpfung von mindestens zwei empirischen Tatbeständen auf der Grundlage mindestens einer gesetzesartigen Annahme/Theorie. Für eine solche gesetzesartige Annahme/Theorie gilt als das oberste Postulat das Postulat der Widerspruchsfreiheit und hervorgehoben wurde, dass neben den „Begriffen“ es vor allen Dingen die gesetzesartigen Hypothesen seien, die die wichtigsten Bestandteile erfahrungswissenschaftlicher Theorien sind: Echte Theorien bestehen aus gesetzesartigen Hypothesen. Die strenge wissenschaftstheoretische Forschung hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass sich für jede „wissenschaftlich korrekte“ Erklärung eine ganz bestimmte logische Struktur angeben lässt, die, wenn sie im Prinzip für alle Formen von Erklärungen gilt, ganz bestimmte Konsequenzen zeitigt, z. B. für den Aufbau einer Sozialisationstheorie. Und darum genau geht es uns hier ja. Machen wir uns also anhand bestimmter Beispiele klar, wie das „logische Gerippe“ dessen aussieht, was die Wissenschaftstheoretiker das „deduktiv-nomologische-Schema einer wissenschaftlichen Erklärung“ (DN-Modell) nennen und was aus Dankbarkeit an zwei Wissenschaftstheoretiker auch das „Hempel-Oppenheim-Schema“ (HO-Modell) genannt wird. Was ist eine „Erklärung“ und was ist eine „wissenschaftliche Erklärung“? Eine wissenschaftlich korrekte Erklärung ist die Antwort auf eine Warum-Frage. Es handelt sich dabei um eine logische Operation, bei der zwei Klassen von Aussagen im Spiele sind154: 154 Wir betrachten hier bewusst nur den einfachen Fall, dass es um die Erklärung eines ganz bestimmten singulären Ereignisses geht. 181 Die Klasse derjenigen Aussagen, die das Ereignis beschreibt welches erklärt werden soll, „Explanandum“ genannt, und die Klasse derjenigen Aussagen, die die erklärenden Argumente repräsentieren: das „Explanans“ des Explanandums. Das Explanans wiederum zerfällt in zwei Klassen von Aussagen: in die Klasse derjenigen Aussagen, die Zustände beschreiben, welche dem Phänomen, welches erklärt werden soll, zeitlich vorausgehen (auch die Klasse von Aussagen sind singuläre Aussagen), und die Klasse derjenigen Aussagen, die das logische Band bilden zwischen diesen beiden Aussagen: gesetzesartige Aussagen. Die letzte Klasse von Aussagen repräsentiert immer ein mehr oder weniger gut gesichertes Gefüge nomologischer Hypothesen, die niemals eine singuläre Struktur haben. Man beachte, dass niemals Tatbestände aus anderen Tatbeständen „abgeleitet“ werden können. Abgeleitet („deduziert“) werden können nur Aussagen aus anderen Aussagen. Wir geben das in Form eines Schemas wieder und erläutern dies anhand des berühmt gewordenen Leichenbeispiels von Karl Raimund Popper: G (allgemeines Gesetz) A (singuläre Anfangsbedingung/Randbedingung) E (explanandum) Die logische Operation der „Erklärung“ lässt sich dann folgendermaßen demonstrieren: Wenn gilt (=wahr ist), dass alle menschlichen Organismen zu allen Zeiten und an allen Orten, nach der Einnahme von mindestens drei Milligramm Zyankali, innerhalb von mindestens zehn Minuten sterben, und wenn gilt (=wahr ist), dass diese, hier an diesem Ort an diesem Tag befindliche Person zu diesem Zeitpunkt fünf Milligramm Zyankali zu sich genommen hat, dann folgt logisch, dass diese Person innerhalb von zehn Minuten gestorben ist. 182 Für das hier ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückte Problem der „klinischen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften“ ist nun wichtig, dass mehrere Fälle denkbar sind, bei denen wir die kognitive Fruchtbarkeit dieses „DN-Schemas“ studieren können: Erklärung, Prognose, empirische Überprüfung und Anwendung. Im ersten Fall (Erklärung) haben wir einen Tatbestand, den es festzustellen, den es zu beschreiben und den es zu erklären gilt. Im zweiten Fall (Prognosededuktion) haben wir einen Tatbestand, den wir relativ präzise beschreiben können, weil wir eine „Theorie“ haben, die uns eine solche Beschreibung ermöglicht, wodurch ja zugleich immer auch eine Erklärung geliefert werden könnte, und wir machen dann eine Voraussage. Im dritten Fall (Überprüfung) haben wir eine Theorie/Hypothese, konstruieren aus einer Menge möglicher Tatbestände, auf welche unsere zu prüfende Theorie anwendbar sein könnte, einen ganz bestimmten Tatbestand, sagen voraus, was wahrscheinlich zu erwarten ist, und stellen dann fest, ob unsere Voraussage zutrifft oder nicht. Die Prognosededuktion ist also das wichtigste Hilfsmittel bei der Überprüfung von Theorie- und Hypothesengebilden. Sie ist es auch im vierten Fall, wo es um deren Anwendung (Applikation) geht. Hier haben wir einen Tatbestand, den wir mittels einer bestimmten Theorie erklären können, machen eine Voraussage darüber was sich ereignen wird, und greifen handelnd ein, – wir verändern also die Randbedingung –, um zu verhindern, dass der von der Theorie vorausgesagte Tatbestand eintritt. Die Prognosededuktion wird also benötigt, um vorab durchsimulieren zu können, was sich ereignen würde, d.h. welcher Tatbestand zu erwarten wäre, würde man nicht eingreifen. Popper konzentriert sich zunächst auf den ersten Fall (Erklärung), um so überhaupt zu erläutern, worauf es beim sog. „DN-Schema“ eigentlich ankommt. Er schreibt (ich „reinige“ seine Beschreibung ein wenig, indem ich z.B. die Begriffe „explicans“ und „explicandum“, die bereits in der Begriffslehre ihre feste Bedeutung haben, durch die passenderen Ausdrücke „explanans“ und „explanandum“, die sich in der Wissenschaftslehre mittlerweile durchgesetzt haben, ersetze, hebe das mir wichtig und erläuterungsbedürftig Erscheinende mittels Kursive hervor und arbeite zur Verdeutlichung mit eckigen Klammern): „Wir finden eine Leiche und wollen erklären, was denn hier geschehen ist. Das Explanandum [der Tatbestand also, der erklärt werden soll], kann in dem Satze „Dieser Mensch hier ist (vor 183 kurzem) gestorben“ beschrieben werden. Dieses Explanandum ist uns durchaus bekannt – die Tatsache liegt sehr real vor uns. Wenn wir sie erklären wollen, so führen wir (wie sie ja aus Detektivgeschichten wissen) hypothetische, also viel weniger gut bekannte Erklärungen ein. Eine solche Hypothese [hier im Sinne von „Vermutung“]155 ist vielleicht, dass dieser Mensch sich mit Zyankali vergiftet hat. Das kann man insofern als eine brauchbare Hypothese bezeichnen, als sie uns (1.) hilft, ein Explanans zu formulieren, aus dem das Explanandum deduziert werden kann, und (2.) gestattet, das Explanans unabhängig vom Explanandum nachzuprüfen. [Wir hätten dann zunächst einmal die folgende singuläre Kausalbehauptung, welche unsere Vermutung beinhaltet bzw. wiedergibt: Dieser Mann ist, da noch keine Leichenstarre eingetreten ist, vor kurzem gestorben, weil er zuvor Zyankali zu sich genommen hat]. Das Explanans, daß jene Hypothese nahelegt, besteht nicht nur aus dem Satz „Dieser Mensch hier hat Zyankali eingenommen“, denn daraus kann man das Explanandum [weil es ein singulärer Satz ist] nicht deduzieren. Wie müssen vielmehr als Explanans zwei verschiedene Arten von Prämissen verwenden – allgemeine Gesetze, und singuläre Anfangsbedingungen/Randbedingungen. In unserem Fall wäre das allgemeine Gesetz etwa so zu formulieren: „Wenn ein Mensch wenigstens drei Milligramm Zyankali einnimmt, so stirbt er binnen zehn Minuten“. Die (singuläre) Anfangsbedingung würde etwa lauten: „Dieser Mensch hier hat kürzlich, aber vor mehr als zehn Minuten, wenigstens drei Milligramm Zyankali eingenommen“. Von diesen Prämissen [die sich also zusammensetzen aus der streng allgemein gefassten Hypothese, die den Zusammenhang von Zyankali-Genuss und Erstickungstod betrifft, und der „Anfangsbedingung/Randbedingung“, dass hier in diesem speziellen Fall Zyankali-Einnahme vorliegt] können wir nun in der Tat deduzieren, daß dieser Mensch hier (vor kurzem) gestorben ist. [Sodann weist Popper auf den eigentlichen wichtigen Punkt hin, nämlich:] All dies scheint sehr trivial zu sein. Aber bitte beachten Sie eine meiner Thesen – daß das, was ich Anfangsbedingung genannt habe alleine niemals zur Erklärung hinreicht, sondern daß wir immer auch ein allgemeines Gesetz brauchen. Diese These ist nun nicht trivial; im Gegenteil, sie wird gewöhnlich gar nicht gesehen. Auch sie werden vielleicht dazu neigen, die Bemerkung „Dieser Mensch hat Zyankali eingenommen“ auch ohne das allgemeine Gesetz über die Wirkungsweise des Zyankali als Erklärung hinzunehmen. Aber nehmen Sie für einen Augenblick an, daß es einen allgemeinen Satz gibt, daß jeder Mensch, 155 Der Begriff der Hypothese wird in der Übersetzung des Popper-Artikels leider doppeldeutig verwendet. Popper spricht an dieser Stelle im Text sozusagen „umgangssprachlich“. Hypothese meint hier ganz einfach eine Vermutung. Von dieser umgangssprachlichen Bedeutung muss der streng wissenschaftstheoretische Begriff der „Hypothese“ scharf unterschieden werden. Es handelt sich dabei um eine gesetzesartige nomologische „Hypothese“. 184 der Zyankali einnimmt, sich für eine Woche besonders wohl fühlt und mehr leistet als je zuvor. Würde, wenn dieses Gesetz gilt, der Satz „Dieser Mensch hat Zyankali eingenommen“ noch immer als eine Erklärung seines Todes gelten können? Offenbar nicht. Wir kommen also zu dem wichtigen und oft übersehenen Resultat, daß eine Erklärung durch besondere Anfangsbedingungen allein nicht möglich ist und daß wir immer auch wenigstens ein allgemeines Gesetz brauchen, obwohl dieses Gesetz manchmal so gut bekannt ist, daß es als trivial weggelassen wird“.156 Ich habe diese Erläuterung so gewählt, weil gerade das Popper’sche Beispiel, obwohl es eigentlich ziemlich klar ist, zu mannigfachen Missverständnissen Anlaß gegeben hat, die ich hier von vorneherein vermeiden möchte. Halten wir deshalb das, worauf es wesentlich ankommt, noch einmal in expliziter, d.h. apodiktischer Form fest: Es gibt keine Erklärung irgendeines beliebigen singulären Tatbestandes, bei dem nicht mindestens eine streng allgemein formulierte Hypothese im Spiel ist. Oder anders formuliert: Sage mir irgendein beliebiges Beispiel, bei dem Du zwei singuläre Tatbestände kausal miteinander verknüpfst, und ich sage Dir, wo und wie sich implizite dabei mindestens eine als streng allgemeiner Allsatz formulierbare „gesetzesartige Aussage“ bzw. „nomologische Hypothese“ befindet. Und da nun gezeigt werden kann, dass ein solches „Gesetz“ in der Regel niemals für sich alleine steht, sondern immer in irgendeiner Form Bestandteil von hypothetischen Zusammenhängen ist, ergibt sich folgerichtig: Es gibt keine Kausalbehauptung ohne eine darin verborgene Theorie, wobei Theorie hier genauso definiert ist, wie im „Thesenkatalog“ ausgeführt: ein widerspruchsfreies, durch Ableitbarkeitsbeziehung miteinander verknüpftes System empirisch falsifizierbarer Hypothesen („gesetzesartige Aussagen“). Und der für unsere Belange entscheidende Punkt ist der folgende: Es handelt sich hierbei selbst um eine streng allgemeine Aussage der Wissenschaftstheorie, die völlig unabhängig von dem möglichen Umstand gilt, dass die im Spiele befindlichen nomologischen Hypothesen z.B. gut gesicherte naturwissenschaftliche Gesetze sind. Es kann sich dabei auch lediglich um 156 Popper, K.R.: „Naturgesetze und theoretische Systeme“, in: Theorie und Realität, hrsg. von Hans Albert, J.C.B Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1964, S. 94f 185 bloße „Annahmen“ handeln. Worauf es alleine ankommt, ist, dass die betreffenden „Gesetzmäßigkeiten“ die logische Struktur von streng allgemeinen Allsätzen haben. In diesem Sinne ist das obige „Zyankali-Gesetz“ genauso eine streng allgemeine Hypothese, wie die bekannte Spruchweisheit von Wilhelm Busch, dass jemand, der sich freut, wenn ein anderer sehr betrübt ist, sich zumeist ziemlich unbeliebt macht. Ich erinnere deshalb an die entsprechende Passage aus dem obigen „wissenschaftstheoretischen Thesenkatalog“: Eine wissenschaftliche Erklärung, so hieß es dort, besteht darin, dass verschiedene empirische Tatbestände in einen kausalen Zusammenhang gebracht werden auf der Grundlage streng allgemeiner Gesetzmäßigkeiten, (in der Wissenschaftslehre „nomologische Hypothesen“ genannt). Und wir halten hier in apodiktischer Form fest: Tatbestände lassen sich dann und nur dann in dem Sinne erklären, dass sie mit anderen Tatbeständen in einen Kausalzusammenhang gebracht werden, wenn sie in Form einer Satzmenge beschrieben worden sind, die sich aus einer anderen Satzmenge ableiten lässt, die selbst wiederum in zwei Teilmengen zerlegbar ist: In die Teilmenge derjenigen Sätze, welche die „Anfangsbedingungen“ bzw. die „Randbedingungen“ des erklärungsbedürftigen Ereignisses beschreiben, und in die Teilmenge derjenigen Sätze, die aus einer Menge nomologischer, d.h.: gesetzesartiger Hypothesen bzw. einer Theorie besteht. Dieser Punkt ist deswegen von Bedeutung, weil sich natürlich nicht „Tatbestände“ aus anderen Tatbeständen „ableiten“ lassen: Nur Sätze lassen sich aus anderen Sätzen ableiten. Der Begriff der „Erklärung“ bezieht sich also genaugenommen nicht auf „Tatbestände“, sondern auf den Zusammenhang zwischen bestimmten Satzklassen. Wenden wir uns dem zweiten Fall (Prognosededuktion) zu: Hypothesen bzw. zu Theorien zusammengestellte Hypothesensysteme können zu Voraussagezwecken benutzt werden. Die Prognosededuktion stellt gewissermaßen die „Umkehrsituation einer Erklärung“ dar, woraus sich ergibt: Während wir im Erklärungsfalle mit Hilfe einer empirisch falsifizierbaren Hypothese/Theorie einen Blick in die Vergangenheit werfen können, gestattet uns eine solche empirisch falsifizierbare Hypothese/Theorie im umgekehrten Fall den Blick in die Zukunft. Popper schreibt: „Während im Falle der Erklärung das Explanandum gegeben ist und ein passendes Explanans gesucht wird, geht die Prognosendeduktion umgekehrt vor. Hier ist die Theorie gegeben ..... und ebenso die Anfangsbedingungen (durch Beobachtung festgestellt). Wie fragen nach den 186 Konsequenzen, d.h. nach gewissen soweit unbeachteten logischen Folgerungen. Diese sind die Prognosen. (Anstelle von E tritt in unserem Schema die Prognose P)“157, so dass sich ergibt: G (allgemeines Gesetz) A (singuläre Anfangsbedingung/Randbedingung) P (Prognose) Die logische Operation der „Prognose“ lässt sich dann folgendermaßen demonstrieren: Wenn gilt (=wahr ist), dass alle menschlichen Organismen zu allen Zeiten und an allen Orten nach der Einnahme von mindestens drei Milligramm Zyankali innerhalb von mindestens zehn Minuten sterben, und wenn gilt (=wahr ist), dass diese hier an diesem Ort an diesem Tag befindliche Person gerade zu diesem Zeitpunkt und für alle sichtbar in genau diesem Augenblick im Begriff ist, fünf Milligramm Zyankali zu sich zu nehmen, dann folgt nicht logisch, sondern nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass diese Person innerhalb von zehn Minuten sterben wird. Dass der Schluss auf die Zukunft immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, nie jedoch mit „logischer Sicherheit“ gezogen werden kann, ist von großer Bedeutung. Denn wie gesagt: Nur die sog. „Tautologien“ gewähren Sicherheit, erkaufen jedoch diese Sicherheit mit einem Opfer, welches wir als Empiriker nicht zu geben bereit sind: Wir erfahren nichts über die (vorausgesagte) Zukunft, was uns nicht bereits durch die Analyse der Aussage selbst bekannt ist. Die betreffende Hypothese/Theorie hätte, wie es der Fachmann ausdrückt, keinen Informationsgehalt. So ist, um das bereits erwähnte Beispiel hier erneut zu nehmen, die 157 Popper [Naturgesetze], S. 96 187 Aussage – sie hat logisch gesetzesartige Struktur, weil es sich ja auch um einen Allsatz handelt! –, dass dann, wenn der Hahn auf einen Misthaufen kräht, sich entweder das Wetter ändern wird oder aber nicht ändern wird, natürlich nicht den geringsten Informationsgehalt, kann nichts erklären und gestattet keinen echten Blick in die Zukunft. Dasselbe wäre der Fall, wenn wir eine entsprechende Formulierung für den Zusammenhang zwischen ZyankaliEinnahme und Tod wählen würden: Die Aussage, dass jemand, der mindestens drei Milligramm Zyankali zu sich nimmt, entweder einen Erstickungstod erleiden wird oder aber nicht erleiden wird, gestattet uns keine echte Prognose, eben weil eine solche „Hypothese“ aufgrund der Tatsache, dass in ihr nur die logischen Zeichen, wesentlich vorkommen, die deskriptiven jedoch zu vernachlässigen sind, keinen Informationsgehalt bzw. empirischen Gehalt hätte. Empirisch falsifizierbare Hypothesen können deshalb auch als „Verbote“ aufgefasst werden, was in unserem Fall bedeuten würde: Wenn gilt (=wahr ist), dass alle menschlichen Organismen zu allen Zeiten und zu allen Orten nach der Einnahme von mindestens drei Milligramm Zyankali innerhalb von mindestens zehn Minuten sterben, dann gilt (logisch trivialerweise), dass es niemanden gibt, der irgendwo auf der Welt drei Milligramm Zyankali zu sich nehmen würde und nicht daran sterben würde. Diese gesetzesartige Aussage „verbietet“ also das Auftreten eines ganz bestimmten Falles, dass nämlich jemand drei Milligramm Zyankali zu sich nimmt und überlebt. Abstrakt ausgedrückt: Eine echte empirisch falsifizierbare Hypothese muss logisch bzw. linguistisch „so gebaut“ sein, dass sie das Auftreten von mindestens einer Klasse von Fällen verbietet. Wir sehen nunmehr, welche Rolle echte Prognosen bei der Überprüfung von Hypothesen/Theorien spielen, und damit sind wir bei unserem dritten Fall (Überprüfung). In [Naturgesetze] macht Popper mit Recht darauf aufmerksam, dass das DN-Schema vorzüglich „zur Analyse des Nachprüfungsvorganges“ geeignet sei. Dieser bestehe „darin, daß wir Prognosen P deduzieren und mit der tatsächlich beobachtbaren Situation vergleichen. Stimmen die Prognosen mit der beschriebenen Situation nicht überein, so ist das Explanans als falsch erwiesen, falsifiziert, und wir wissen dann, daß entweder die Theorie oder die Anfangsbedingungen eine Situation beschreiben, die nicht realisiert wurde (d.h., daß die Anfangsbedingungen falsch sind)“.158 158 ibid., S. 96f 188 Von entscheidender Bedeutung für die von Popper vertretene Position des sog. „methodologischen Falsifikationismus“ ist nun die Asymmetrie zwischen „Verifikation“ und „Falsifikation“, welche besagt, dass man zwar eine streng allgemein formulierte Hypothese/Theorie effektiv falsifizieren, nie jedoch endgültig verifizieren könne, was, wie gesagt, den Münchner Wissenschaftstheoretiker Stegmüller zu der Formulierung veranlasst hat, dass selbst unser bestens bestätigtes naturgesetzliches Wissen letztendlich eben doch nur ein „Wissen auf Widerruf“ sei. Popper schreibt: „Obwohl ... die Falsifikation der Prognose das Explanans falsifiziert, ist das Umgekehrte nicht der Fall; das heißt, es ist unrichtig und irreführend, die Verifikation der Prognose als eine Verifikation der ... Theorie anzusprechen. Denn eine wahre Prognose kann sehr gut aus einem falschen Explanans deduziert worden sein. Es ist sogar irreführend, wenn wir jede Verifikation einer Prognose als eine praktische Bewährung (oder Konfirmation) des Explanans ansehen; es ist richtiger zu sagen, daß nur die Verifikation von sonst »unerwarteten« Prognosen als Bewährung ... der Theorie angesehen werden soll ...“.159 Vor allem deswegen komme es darauf an, die Bedingungen für die Prüfung von Hypothesen/Theorien so schwierig wie nur möglich zu gestalten und sodann Prognosen zu formulieren, die darauf angelegt sind, die entsprechenden Theorien/Hypothesen zu falsifizieren (Postulat des sog. „ernsthaften Falsifikationsversuches“), denn es sei „ja schließlich klar, daß nur dann, wenn der Kandidat eine hinreichend schwere Prüfung“ bestehe, das „Bestehen der Prüfung etwas über seine Qualität“ aussage. Schließlich könne „auch für den schwächsten Kandidaten immer eine Prüfung arrangiert werden ...., die er ohne Schwierigkeiten“ bestehe.160 Mit Popper halten wir hier fest, dass der „Theoretiker .... daran interessiert“ sei, „allgemeine Gesetze zu finden und zu überprüfen. Bei der Überprüfung verwendet er alle möglichen anderen Gesetze, die zu seinem Erwartungshorizont gehören, viele von ihnen auch ohne sich über sie Rechenschaft zu geben, sowie auch verschiedene Anfangsbedingungen.“161 Stellen wir mit direktem Bezug auf die Darlegung bei Popper die Situation des Theoretikers in dem folgenden Schema dar: 159 ibid., S. 97 Hervorhebung durch Popper 160 ibid., S. 97 161 ibid., S. 98 189 G0 G0 G0 ....... G1 G2 G3 ....... A1 A2 A3 ....... P1 P2 P3 ......162 G0 ist in diesem Schema das Gesetz bzw. die (streng allgemein formulierte) Hypothese, welche überprüft werden soll. Zusammen mit anderen Gesetzmäßigkeiten G1, G2, G3 etc., mit denen unsere zu überprüfende Hypothese ein widerspruchsfreies System, eine Theorie also, bildet, sowie mit den dazugehörigen Anfangsbedingungen A1, A2, A3 etc. wird sie als validierungsbedürftig festgehalten und dazu verwendet, um verschiedene Prognosen P1, P2, P3 etc. abzuleiten, welche sodann mit den nunmehr beobachtbaren Tatbeständen verglichen werden können. Lassen sich die dergestalt prognostizierten Tatbestände sodann auch tatsächlich beobachten, bzw. treten sie, nachdem man bestimmte Anfangsbedingungen experimentell hergestellt hat, wie vorausgesagt, ein, so gilt unser zu überprüfendes Gesetz als (vorläufig) verifiziert, wodurch ja zugleich auch die anderen mit diesem Gesetz (Hypothese) „im Spiele befindlichen“ Gesetzmäßigkeiten, da sie logisch mit unserer „Prüfkandidatin“ verbunden sind – so die Definition des Begriffs „Theorie“ – als „gut bestätigt“ gelten können. Halten wir hier mit Popper fest (die Hervorhebungen des Autors wieder mittels Unterstreichung, meine Hervorhebungen mittels Kursive): „Wir haben gesehen, daß eine befriedigende Erklärung immer eine Theorie verlangt, die unabhängig vom Explanandum nachgeprüft werden kann. Das bedeutet aber, daß eine befriedigende Theorie immer mehr aussagen muß, als in den Explananda, die zur Aufstellung führten, enthalten war. Mit anderen Worten, befriedigende Theorien müssen grundsätzlich über die empirischen Fälle, die zu ihrer Aufstellung Anlaß geben, hinausgehen; andernfalls würden sie .... zu zirkulären Erklärungen führen.“163 162 ibid., S. 98 163 ibid., S. 98 190 Auf das Sonderproblem der sog. „zirkulären Erklärungen“ soll hier nicht näher eingegangen werden. Statt dessen lenken wir die Aufmerksamkeit noch auf einen anderen Punkt, der mir wichtig erscheint. Er betrifft das unterschiedliche Niveau von Theoriekonstruktionen und ist mir deswegen von Bedeutung, weil ja eine Theorie, welche sich sozusagen „im Anfangsstadium ihrer Entwicklung“ befindet, gemessen an den hochkorroborierten Theorien der strengen Naturwissenschaften zunächst einmal notwendigerweise kein sehr hohes Niveau haben kann. Genau das ist nämlich mit der von uns hier ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückten Sozialisationstheorie der Fall. Mir ist es tatsächlich ernst mit meinem Plädoyer für Kooperation, Kritik und Diskurskultur: Die Konstruktion einer ätiologisch wertvollen Sozialisationstheorie, die es gestattet, mittels des „Identitätskonstruktes“ irgendwann einmal die Pathogenese gravierender Verhaltensstörungen aufzuklären, kann gar nicht das Werk eines einzelnen Forschers bzw. einer einzelnen Forscherin sein. Wir sollten diesen Punkt im Auge behalten. Zitieren wir also zur Frage des Niveaus und zum Problem des Forschungsganges, der nötig ist, um einen Theorievorschlag in genau diesem Sinne gegebenenfalls zu verbessern, zu verfeinern oder vielleicht auch abzuändern, noch einmal die Popper’schen Ausführungen über den Zusammenhang von Falsifizierbarkeit, Kritisierbarkeit und Allgemeinheits- wie Präzisierungsgraden bestimmter Theorie. Im Anschluss hieran werden wir das Zyankalibeispiel etwas variieren, um erstens den Prüfvorgang „am besonderen Fall“ zu demonstrieren und zweitens den Zugang zu finden zu dem ja noch offen stehenden vierten Fall, dem Bereich des „therapeutischen Eingriffs in den natürlichen Ablauf der Geschehnisse“. Popper schreibt: „Wie wir gesehen haben, führt die Ansicht, es sei die Aufgabe der Wissenschaft, zu erklären oder (was im wesentlichen auf dasselbe hinausläuft) die theoretischen Grundlagen für Prognosen und andere Anwendungen zu schaffen, zu der methodologischen Forderung der (unabhängigen) Nachprüfbarkeit der Theorien. Nun gibt es aber Grade der Prüfbarkeit; Theorien können mehr oder weniger gut prüfbar sein. Wenn wir unsere methodologische Forderung so verschärfen, daß wir besser und besser prüfbare Theorien verlangen, so erhalten wir ein methodologisches Prinzip – oder eine Formulierung der Aufgabe der Wissenschaft –, daß es gestattet, eine große Anzahl von Ereignissen in der Geschichte der Wissenschaften rational zu erklären; nämlich als Schritte, die in dem Versuch unternommen werden, die Aufgabe der Wissenschaft zu lösen. (Gleichzeitig erhalten wir eine Bestimmung der Aufgabe der Wissenschaft, die es uns ermöglicht, zu sagen, was in der Wissenschaft als Fortschritt zu 191 betrachten ist; denn in der Wissenschaft – im Gegensatz zu den meisten anderen Tätigkeiten, insbesondere der Kunst – gibt es wirklich so etwas wie einen Fortschritt.)“164 Halten wir hier fest: Wenn es die Aufgabe der Wissenschaft ist, zu erklären, indem dadurch zugleich die theoretischen Grundlagen sowohl für Prognosen als auch für „Anwendungen“ geschaffen werden, ergibt sich das methodologische Postulat der „prinzipiellen Überprüfbarkeit“ dieser „theoretischen Grundlagen“, was, wie ausgeführt, gleichgesetzt werden muss mit dem Postulat der „prinzipiellen Falsifizierbarkeit“. Und hieraus ergibt sich nunmehr – bezogen auf unser Problem des vernünftigen klinischen Umgangs mit den sog. „Geistes- und Gemütskrankheiten“ – trivialerweise: Eine empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie, welche durch umfangreiche, unabhängige Überprüfungen ihre „Geltung“ hat sichern können, bildet das Fundament nicht nur für die Ätiologie entwicklungspsychopathologisch auffälliger Verhaltensstörungen und folglich auch nicht nur für deren Diagnostik, deren Anamnese und deren Prognostik, sondern auch – und hierin scheint mir der zentrale Punkt aller Überlegungen zu liegen – für „Anwendungen“ in den „klinischen Disziplinen der medizinischen (psychiatrischen) Wissenschaften“ in Gestalt geeigneter therapeutischer Maßnahmen. Ich erinnere an meine obige (S. 79) „Wenn-dann-Aussage“. Im Unterschied zu Popper, der sich mehr für das wissenschaftsphilosophische Problem des Erkenntnisfortschritts interessiert, bin ich also aus anderen Gründen an der Frage interessiert, wie sich das Niveau von Theorien mittels der Erhöhung der „Grade ihrer Prüfbarkeit“ verbessern ließe bzw. was dabei zu beachten ist, und folge in genau diesem Sinne Poppers Ausführungen: „Eine Analyse der Grade der Prüfbarkeit von Theorien zeigt ..., daß die Prüfbarkeit mit dem Grade der Allgemeinheit einer Theorie zunimmt sowie mit dem Grade ihrer Bestimmtheit oder Präzision.“165 Um was es dabei gehe, sei „überaus einfach“, nämlich: „Mit dem Grade der Allgemeinheit einer Theorie wächst der Bereich der Ereignisse, über die die Theorie etwas voraussagen 164 ibid., S.99 165 ibid., S. 99 192 kann. Und damit der Bereich der möglichen Falsifikation. Die Theorie, die leichter falsifizierbar ist, ist aber zugleich, die Theorie, die besser prüfbar ist.“166 Es ergibt sich mithin die auf unser Problem bezogene Aussage: Gelingt es, den Allgemeinheitsgrad einer empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie und damit die intersubjektive Überprüfbarkeit derselben zu erhöhen, dann verbessern sich auch die Chancen für die Ausarbeitung einer Ätiologie der Mentalerkrankungen. Verbessern sich aber damit zugleich auch immer Diagnostik, Prognostik und (mögliche) Therapie? Das ist wohl nur dann der Fall, wenn mit dem Grade der Allgemeinheit der Theorie zugleich auch deren Präzision verbessert werden kann. Denn: „Ähnlich steht es mit dem Grade der Bestimmtheit oder Präzision. Eine präzise Aussage ist leichter zu widerlegen als eine vage Aussage und daher besser prüfbar. In dieser Weise können wir auch die Forderung, qualitative Aussagen wenn möglich durch quantitative Aussagen zu ersetzen, auf die Forderung nach größerer Prüfbarkeit zurückführen.“167 Jedoch sei das „Kriterium der Messbarkeit“ als solches nicht unbedingt zugleich die notwendige Bedingung, warnt Popper, eine Warnung, auf die wir selbst noch des öfteren – vor allem im Zusammenhang mit der Transformierbarkeit klassifikatorischer Aussagen in komparative Aussagen in den „Rationalitätskatalogen“ – hinweisen werden: Die „Messung“ sei zwar „als Hilfsmittel zur Überprüfung von Theorien .... im Verlaufe des wissenschaftlichen Fortschrittes ... immer wichtiger“ geworden, sie dürfe jedoch „wegen [ihres] späten und bedingten Auftretens, und weil [ihrer Anwendbarkeit] immer von theoretischen Voraussetzungen abhängig“, sei, „niemals zur Charakterisierung der Wissenschaft oder der Theoriebildung im allgemeinen verwendet werden.“168 Wir hatten bereits weiter oben auf das hier mittels der Forderung nach größerer Allgemeinheit von Theorien und deren Verbesserung durch Präzision genauer umschriebene Prinzip der optimalen Kritisierbarkeit von Erklärungsvorschlägen hingewiesen. Popper hat das einmal so ausgedrückt: Wir müssen einer Theorie das Überleben so schwer wie nur möglich machen, denn nur dann, wenn sie unsere schwierigsten Überprüfungsprozeduren übersteht, können wir auch vertrauen in ihre Geltung haben und auf ihre jeweiligen Hypothesen erstens unsere Prognosen und zweitens unsere (vernünftigen) „Eingriffe in die Wirklichkeit“ gründen. Doch 166 ibid. 167 ibid. 168 ibid. 193 wie gesagt, geht es mir hier mehr um das Problem des Verhältnisses zwischen „Grundlagenforschung auf hohem Niveau“ (das ist die Konstruktion immer allgemeinerer und immer präziserer Theorien) und den dadurch (vielleicht) sich ergebenden Möglichkeiten, Diagnostik, Prognostik und Therapie zu verbessern. Denn genau bezüglich dieses Punktes, so hatte ich in der Einleitung betont, beansprucht meine hier vorgelegte Arbeit Relevanz. Um demonstrieren zu können, worum es uns hier geht – nämlich um den Zusammenhang zwischen Nachprüfbarkeit, Prognosededuktion und möglichem therapeutischen Eingriff – variieren wir das Zyankali-Beispiel. Das mag vielleicht ein wenig konstruiert wirken, aber darauf kommt es natürlich ebenso wenig an wie auf die Frage, der „empirischen Geltung“ und braucht uns folglich auch nicht zu stören. Unterstellt sei ein Forscher, der sich sein ganzes Leben lang derartig intensiv mit den chemischen Eigenschaften von Zyankali beschäftigt hat, dass er in dieser Beziehung einen leichten Tick ausgebildet hat, der ihn überall den verborgenen Einfluss von Zyankali vermuten lässt, wenn jemand irgendetwas zu sich nimmt, woran er dann stirbt. Sein neustes Forschungsprojekt beziehe sich nun auf Leute, die an einer Pilzvergiftung gestorben sind. Da er selbst ein Liebhaber von Pilzgerichten ist, ist ihm natürlich bekannt, dass sehr viele Pilzsorten schmackhaft und bekömmlich, einige ungenießbar und einige tödlich giftig sind. Sein Ehrgeiz bestehe nun darin – und genau dafür arbeitet er an einer Verbesserung seiner Theorie –, ein Klassifikationsschema auszuarbeiten, welches eine genaue Ordnung aller Pilzsorten nach Maßgabe von Bekömmlichkeit und Gefährlichkeit ermöglicht und folglich seiner Auffassung zufolge in jedes moderne Buch für Pilzsammlung und Pilzesser gehöre. Jedoch sei sein praktisches Interesse geringer als sein Interesse an der Verbesserung seiner Theorie. Hierin erschöpfe sich jedoch nicht sein Ehrgeiz. Gelänge ihm tatsächlich der Nachweis, dass bei jeder Pilzvergiftung mit tödlichem Ausgang „irgendwie Zyankali im Spiele sei“, so würden sich ja vielleicht sogar, wie erhofft, Diagnostik, Prognose und (mögliche) Therapie bei „normalerweise“ tödlich verlaufenden Pilzvergiftungen verbessern. Worauf es mir hierbei ankommt, ist, dass unser Zyankali-Pilz-Forscher zunächst einmal, bevor er überhaupt an irgendwelche praktischen bzw. klinischen Konsequenzen denken kann, seine Hypothese validieren muss. Und hierfür muss er Prognosen formulieren, in dem er sich „Bedingungen“ ausdenkt, deren „Setzung“ in Gestalt von „Anfangsbedingungen“ die Formulierung von Prognosen überhaupt gestattet. Dies aber ist in diesem Fall – und darauf kommt es mir bei diesem etwas konstruiert wirkenden Beispiel wesentlich an – etwas schwierig, wie sich denken lässt. 194 Sein an Hand des Studiums der Zyankali-Eigenschaften entwickeltes theoretisches System lege nun die Hypothese nahe, dass jede Pilzsorte, die in irgendeinem Zusammenhang mit irgendwelchen tödlichen Konsequenzen für die Pilzgenießer steht, irgendwelche u.U. jenseits der technischen Analysemöglichkeiten (Messgenauigkeit) liegende Spuren von Zyankali enthalten müsse. Genau diese Hypothese, an der vielleicht große Teile an seiner allgemeinen „Zyankali-Theorie“ hängen und die ihm ausgesprochen bedeutsam für eine mögliche Erweiterung dieser Theorie erscheint, will er nun überprüfen und deshalb formuliert er sie in Gestalt der folgenden beiden miteinander verknüpften streng allgemeinen Aussagen, welche besagen: a) Nur diejenigen Pilzsorten sind tödlich giftig, welche irgendwelche Anteile von Zyankali enthalten. Und folglich gilt: b) Wenn irgendein Mensch an einer Pilzvergiftung gestorben ist, dann liegt es letztendlich nicht an irgendwelchen Arsenanteilen, sondern ausschließlich an bestimmten – vielleicht jenseits der Messbarkeit liegenden – Zyankali-Anteilen. Die entscheidende Frage ist, wie sich eine solche Aussagenkombination überprüfen lässt, denn Experimente, welche ihm die Setzung von Anfangsbedingungen erlauben würden, kann unser Forscher nicht machen, will er nicht mit unseren Strafgesetzen in Konflikt geraten. Ich habe dieses Beispiel ganz bewusst so konstruiert, weil ich zeigen will, dass sich manchmal die Überprüfung einer „Grenzbehauptungshypothese“ sehr schwierig gestalten kann. Unser Pilz-Zyankali-Forscher muss zur Überprüfung jedoch auf jeden Fall eine Prognose formulieren, denn erklären kann er natürlich relativ problemlos bei so konstruiertem Beispiel, warum z.B. bestimmte Fälle nicht in den Geltungsbereich seiner Hypothese fallen bzw. zu fallen scheinen: Der Hinweis auf das „Messbarkeitsproblem“ kann jedes Argument neutralisieren. Das Problem der Überprüfbarkeit besteht in diesem Fall tatsächlich darin, dass sich bezüglich des möglichen Geltungsbereiches der fraglichen Hypothese – unser Forscher spricht nur von menschlichen Organismen! – die Anfangsbedingungen nicht experimentell herstellen lassen: Menschenversuche sind verboten und überdies ist unser Forscher nun doch nicht so verrückt, ein solches Experiment überhaupt in Betracht zu ziehen. Das ist ihm „seine“ Theorie nun denn doch nicht wert. Um eine „prognose-ähnliche“ Situation herzustellen, fügen wir eine weitere Überlegung hinzu. Diese besage, dass sowohl für unseren Forscher als auch für andere Zyankali195 Spezialisten nicht in Zweifel stehe, dass der empirische Zusammenhang zwischen „ZyankaliEinfluss“ und u.U. letale Auswirkungen auf das menschliche Atemsystem sehr eng und empirisch gut gesichert sei. Unser Forscher formuliere also eine „prognose-ähnliche“ Aussage bezüglich all derjenigen Fälle, die er noch nicht gesehen und folglich auch nicht begutachtet hat. Diese Aussage stelle ein Implikat der These dar, dass „irgendwie Zyankali im Spiel sein muss“, weil immer und überall in irgendeiner Art und Weise bei allen Pilzvergiftungen mit tödlichem Ausgang die Atmungsorgane betroffen seien. Diese Verknüpfung zweier Hypothesen, die natürlich in der Gemeinschaft der Zyankalispezialisten „so“ nicht Konsens ist, sei eine Kernthese unseres Zyankaliforschers. Wir unterstellen jetzt zweierlei: Erstens, dass in dieser Hinsicht keine „Messprobleme“ zu gewärtigen sind, dass also Betroffenheit der Atmungsorgane immer nachweisbar ist, und zweitens, dass unser Forscher Kenntnis über eine Pilzvergiftung mit tödlichem Ausgang aus der Ferne erlangt hat, ohne dass er sich die fraglichen Toten hat ansehen können und ohne dass er irgendwelche Ahnung von Atemproblemen hat. Seine gutachterliche Meinung wird also angefragt, ohne dass er selbst die Leichen gesehen und ihre Atmungsorgane hat inspizieren können. Nunmehr muss seine „Prognose“ lauten „bei den von Ihnen mir angezeigten armen Menschen, die an einer Pilzvergiftung gestorben sind, wie sie mir am Telefon sagten, müssen in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall die Atmungsorgane mitbetroffen sein. Schauen sie in dieser Hinsicht nach und sie werden sehen, dass meine Voraussage richtig ist.“ Die relativ ernsthafte „Überprüfung“, die Popper fordert, ist in diesem Zusammenhang ja zweifelsohne gewährleistet, wenn wir nicht sophistisch werden wollen. Das Beispiel ist zwar zugestandenermaßen ein wenig konstruiert und vielleicht auch etwas skurril, jedoch lehrt es, wie ich meine, sehr schön den Mechanismus der Überprüfung durch „prognostische“ bzw. „prognose-ähnliche“ Relevanz. Lässt sich nämlich nunmehr bei denen im Krankenhaus XY befindlichen Personen keinerlei Zusammenhang zwischen Pilzgenuss, Todesfolge und eventuell stattgehabten Atmungsproblemen nachweisen, so wird auch unser begeisterter und ein wenig auch verrückter Zyankali-Pilz-Forscher gezwungen sein, seine Hypothese als falsifiziert anzusehen, und damit beginnt erneut die – nunmehr notwendig gewordene – mühselige „Umbauarbeit“ an seiner „immer-und-überall-Zyankali-Theorie“. Diese hatte „verboten“, dass der Fall auftritt, es liege eine Pilzvergiftung mit tödlichem Ausgang vor und es sein kein Zyankali im Spiel. Da nun die Untersuchung der Atmungsorgane das Vorhandensein von Zyankali effektiv hatte ausschließen können, ist 196 indirekt damit die streng allgemein formulierte Hypothese, bei jeder Pilzvergiftung sei Zyankali im Spiel, falsifiziert. Normalerweise liegt der Fall etwas einfacher, wie man leicht sieht: Es existiert eine bis dahin relativ gut bestätigte Hypothese/Theorie und es wird dann eine Anfangsbedingung/Randbedingung experimentell „hergestellt“, wobei sodann ein Schluss gezogen wird auf das, was nunmehr passieren wird bzw. muss. Zeigt sich dann, dass der vorausgesagte Effekt nicht eintritt, so ist die strenge Allgemeinheit der Aussage in Frage gestellt, d.h. falsifiziert. Man beachte nun, dass eine solche „Prognose“ immer nur unter gewissen Einschränkungen ihre Prüfungsfunktionen erfüllen kann, die sich auf das Vorliegen der Anfangsbedingungen/Randbedingungen beziehen, nämlich: 1. Selbst bei den sichersten Gesetzmäßigkeiten kann bei konkretem Fall nur mit Wahrscheinlichkeit auf die Zukunft geschlossen werden. 2. Es muss gewährleistet sein, dass keine Störungen eintreten. Auf unser Standardbeispiel bezogen haben wir dann: G (allgemeines Gesetz) A (singuläre Anfangsbedingung/Randbedingung) Non-S (keine Störung) P (Prognose) Die logische Operation der „Prognosededuktion“ lässt sich dann folgendermaßen demonstrieren: Wenn gilt (=wahr ist), dass alle menschlichen Organismen zu allen Zeiten und an allen Orten nach der Einnahme von mindestens drei Milligramm Zyankali innerhalb von mindestens zehn Minuten sterben, und 197 wenn gilt (=wahr ist), dass diese, hier an diesem Ort an diesem Tag befindliche Person gerade zu diesem Zeitpunkt und für alle sichtbar in genau diesem Augenblick im Begriff ist, fünf Milligramm Zyankali zu sich zu nehmen, und wenn der Ablauf der Zyankali-Einnahme nicht in irgendeiner Art und Weise gestoppt, als „gestört“ wird, dann folgt mit recht großer Wahrscheinlichkeit, dass diese Person innerhalb von zehn Minuten sterben wird. Ist das nicht der Fall und besteht auch keine irgendwie unbemerkt gebliebene „Störung“, so muss die entsprechende Hypothese als „falsifiziert“ angesehen werden. Man beachte jedoch, dass damit ihre streng allgemeine Geltung in Frage gestellt wird und nunmehr „Umbauten“ in unserem Hypothesensystem notwendig werden. Es tritt also das ein, was mit dem obigen „general tetradic schema“ Poppers so eindrucksvoll beschrieben wurde. Diesen Weg wollen wir jedoch hier nicht weiter verfolgen, denn die damit verbundenen wissenschaftstheoretischen Probleme sind ausgesprochen kompliziert, wie bereits im obigen „wissenschaftstheoretischen Thesenkatalog“ betont. Mir kommt es an dieser Stelle mehr auf die Behandlung des vierten Falles (Anwendung/Applikation) an, den wir nunmehr, wie ich meine sehr leicht erörtern können, wenn wir uns die „Störungsvorbehaltsklausel“ etwas genauer ansehen. Wegen der äußerst wichtigen Funktion der „Prognose“ sowohl für die empirische Überprüfung einer Hypothese/Theorie als auch für deren Anwendung, ist die Ansicht – insbesondere bei Praktikern – sehr weit verbreitet, dass eine erfolgreiche Anwendung immer zugleich auch eine Theorie bestätige und eine fehlgeschlagene Anwendung immer zugleich auch einer Theorie als „Falsifikation“ angelastet werden müsse bzw. könne. Diese Ansicht ist jedoch nicht richtig, wie bereits des öfteren betont und wie eine etwas eingehendere Lektüre der oben zitierten Ausführungen Poppers nunmehr ja auch gezeigt hat: Schlägt eine „Anwendung“ fehl, so kann das sowohl an einer Schwäche der zugrundeliegenden Theorie/Hypothese als auch an bestimmten Randbedingungen liegen, welche sich „störend“ ausgewirkt haben könnten, ohne dass man dies bemerkt hat, ja vielleicht sogar, ohne dass man dies überhaupt hat bemerken können. Gefragt werden muss also abschließend, welche Funktion den empirisch falsifizierbaren Hintergrundstheorien/Hypothesen der medizinischen Wissenschaften für deren klinische Disziplinen, denen es ja in erster Linie um praktisch-therapeutische Anwendung geht, 198 eigentlich zukommen kann. Und zu berücksichtigen wird dabei, wie ich meine, zweierlei sein: erstens, das was wir bisher über den Zusammenhang von Falsifizierbarkeit/Prüfbarkeit, Prognosededuktion und empirischem Gehalt (Erklärungskraft) gelernt haben, und zweitens, das was wir bei Max Weber über den "Erfolgschancen-Satz" sowie den "Kosten-Satz" haben nachlesen können. Bevor wir jedoch hierauf (abschließend) zu sprechen kommen, um sodann auch in einem Rückblick die bisher entwickelten Thesen zusammenfassen zu können, was wir bisher haben erarbeiten können, noch einige Bemerkungen genereller Art, die sich auf die Identitätsproblematik beziehen: Wie erinnerlich hatten wir anlässlich der Vorstellung des Thesenkatalogs auf ein ganz bestimmtes Beispiel hingewiesen: Bei einer jungen Frau trete eine massive Lähmung auf, für die sich keine adäquate Diagnose formulieren lasse, weil die Ätiologie hierfür nicht erklärungsfähig genug sei. Mit anderen Worten: Da wir keine präzise Pathogenese auszuformulieren in der Lage sind, ergebe sich zugleich auch eine etwas unsichere Symptombeschreibung. Der psychoanalytisch geschulte Kollege biete sodann eine Diagnose an, die die schwere Lähmung als ein konversionshysterisches Syndrom interpretiert. Uns interessiert an dieser Stelle nicht, ob und inwiefern „Konversionshysterien“ sich neurologisch validieren lassen. Uns interessiert ausschließlich der von der Psychoanalyse behauptete Zusammenhang zwischen den Erkrankungen des konversionshysterischen Formenkreises und bestimmten somatisch sich bemerkbar machenden Verhaltensstörungen. Die singuläre Aussage, die das Explanandum umschrieb, lautete: Diese junge Frau leidet unter einer gravierenden Beeinträchtigung ihrer Gehfähigkeit. Die Erklärung die der Psychoanalytiker nun abgibt, lässt sich in dem Satz formulieren: Weil diese junge Frau eine Konversionshysterie „ausweist“, kann sie sich nicht richtig bewegen. Wo aber ist hier die singuläre Anfangsbedingung? Wie in dem Leichenbeispiel müssten hier zwei singuläre Tatbestände kausal miteinander verknüpft werden. Und ebenso muss sich natürlich auch hier eine allgemeine Gesetzmäßigkeit angeben lassen. Wir geben diese mit dem etwas primitiven Satz wieder: Konversionshysterien erzeugen Lähmungserscheinungen. Jederzeit können wir diesen allgemeinen Satz in eine strenge allgemeine Form überführen, so dass der Postulatorik des HO-Schemas Rechnung getragen ist. Er würde ungefähr so aussehen (dies sozusagen in halbformaler Sprechweise): Für alle x gilt: Wenn X eine menschliche Person ist und X unter einer konversionshysterischen Erkrankung leidet, dann ist eine Möglichkeit diejenige, dass z.B. schwere Lähmungserscheinungen auftreten. 199 Noch einmal gefragt: Welches ist die singuläre Randbedingung dafür, dass bei der jungen Frau eine Lähmung aufgetreten ist? Der allgemeine Hinweis des Psychoanalytikers auf die Konversionshysterie liefert ganz offensichtlich keine genaue Erklärung, und dies ist in genau diesem Fall ganz offensichtlich deshalb so, weil die hierzu in Betracht zu ziehende Anfangs- bzw. Randbedingung nicht explizit ausgezeichnet wurde. So sind seinerzeit, wenn wir einen Blick in die Geschichte der Psychoanalyse werfen, Breuer und Freud auch nicht vorgegangen. Sie haben vielmehr tatsächlich zwei empirisch gesicherte Tatbestände zunächst einmal kausal miteinander verknüpft und erst dann begonnen, ihre Theorie hierzu zu entwickeln und zu verfeinern: Eine junge Patientin hatte jahrelang hingebungsvoll ihren kranken Vater gepflegt und erst als der Vater gestorben war, sie also eigentlich von einer schweren Last befreit war, trat die massive Lähmung bei ihr auf. Breuer und Freud vermuteten ein dahintersteckendes allgemeines Problem im Jahre 1895. Die Theorie der konversionshysterischen Formen war zu diesem Zeitpunkt nicht ausgearbeitet, steckte vielmehr in ihren Anfängen, ein Hinweis, der mir aus den bereits oben genannten Gründen sehr wichtig ist. Unser hypothetischer Psychoanalytiker müsste also, wenn er wirklich sorgfältig hätte verfahren wollen, mit Hilfe der ausgearbeiteten Theorie über konversionshysterische Syndrome auch auf spezifische Randbedingungen/Anfangsbedingungen, die den spezifischen Anlass zu beschreiben gestatteten, schließen können. Mit anderen Worten: Die fragliche Hypothese über den Zusammenhang zwischen konversionshysterischen Tatbeständen und dem Auftreten einer Gehlähmung müsste so präzise sein, dass sie einen Zusammenhang postuliert zwischen einer Konversionshysterie, dem Auftreten ganz bestimmter Erfahrungstatbestände (z.B. Pflegedienste an eine geliebten Person, die dann stirbt) und dem Auftreten sich bemerkbar machender Verhaltensstörungen, ein Zusammenhang, der z. B. nur das Auftreten einer Gehlähmung vorauszusagen gestattet. Aus diesem Grunde hatte ich weiter oben auch gesagt, dass es eine Möglichkeit ist, eine schwere Lähmung zu entwickeln, wenn die Diagnose „konversionshysterisches Syndrom“ korrekt sein soll, woraus sich ja zwanglos ergibt, dass unsere fragliche Hypothese eben nicht präzise genug ist. Doch wie auch immer. Als Kliniker müsste er jedenfalls mit dieser Hypothese ,,im Hinterkopf“' nach ganz konkreten krankheitsauslösenden Faktoren suchen, die präzise zu beschreiben natürlich eine Angelegenheit der entsprechend allgemein gefassten und präzise ausgestalteten Theorie ist. Man sieht hier sehr schön, wie ich finde, das bestätigt, was Popper über den Zusammenhang 200 zwischen dem Allgemeinheits- und Präzisionsgrad einer Theorie und ihrer Erklärungs- und Prognoserelevanz ausgeführt hat, und man sieht bereits hier, dass es nicht ganz leicht sein dürfte, eine Theorie der Identitätskrisen zu entwickeln, die den kausalen Zusammenhang zwischen ganz bestimmten Kategorien von Identitätskrisen mit ganz bestimmten empirisch beobachtbaren Verhaltensmustern auf der einen Seite und ganz bestimmten familialen Bedingungskonstellationen auf der anderen Seite in einen kausalen Zusammenhang zu bringen gestattet. Doch legen wir dies hier vorerst beiseite. Zu beachten ist zunächst einmal, dass unsere Erklärung nicht zirkulär sein darf. Das bedeutet, dass Konversionshysterien unabhängig definiert werden müssen von denjenigen Definitionskriterien, die den Ausdruck „Lähmung“ betreffen. Würde der Psychiater gefragt werden, wie er denn darauf komme, dass eine Konversionshysterie die Lähmung hervorgerufen habe, dann wäre es albern wenn er antworten würde: Aber schauen Sie doch, die junge Frau ist ja schließlich gelähmt.169 Ich weise auf dieses Problem besonders hin, weil sehr viele Arbeiten, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Identitätskrisen und personellen Zerrüttungsformen befassen, genau diese hier angeprangerte logische Todsünde begehen. Das wird nur deshalb zumeist nicht offensichtlich, weil die verwendete Begrifflichkeit so unpräzise ist, dass die semantischen Überschneidungen sich gerade nicht in Wenn-Dann-Hypothesen abspiegeln lassen.170 Aus diesem Grunde ist mir die Methodik von Redlich und Freedman so wichtig, die, wie angedeutet, zu Recht unterscheidet zwischen beobachtbarem Verhalten und erschlossenen d.h. immer vermuteten – kausalen Hintergründen, die ihren Ort in einer nicht präzise ausformulierten Theorie haben. Fast notorisch lässt sich diese logische Sünde 169 Vgl. hierzu das bei Popper in [Zielsetzung] so eindringlich beschriebene "Neptun-Beispiel". 170 Ein berühmter Verfassungsrechtler - Carl Schmitt - hat die These formuliert, dass immer dann, wenn man von politischen Verhältnissen reden wolle, es sich dabei um "Freund-Feind-Verhältnisse" handele. Schmitt macht nicht hinreichend deutlich, ob er damit eine empirische Hypothese im Auge hat, oder ob er damit lediglich angeben möchte, wie er "politische Verhältnisse" zu verstehen wünscht. Fast alle Aussagen die Carl Schmitt in seiner Schrift "Der Begriff des Politischen" formuliert, "hängen" an dieser Formulierung und ihrer Grundsicherheit. Seinen angebotenen "Erklärungen" für die Dynamik realer politischer Verhältnisse, die auf den ersten Blick verblüffend plausibel erscheinen, werden dadurch fast wertlos: Man kann einfach nicht entscheiden, ob hier Aussagen mit hohem Informationsgehalt vorliegen, oder ob man es mit bloßen Scheinerklärungen zu tun hat. Die bereits beklagte "begriffliche Not" in vielen psychoanalytischen Abhandlungen konfrontiert selbst einen wohlwollenden Betrachter dieser faszinierenden Theorie mit genau demselben Dilemma. Deshalb wurde im Text scharf unterschieden zwischen der beobachtbaren Gehunfahigkeit unserer Patient in und einer möglichen Erklärung, die sich auf eine Theorie stützt, welche konversionshysterische Tatbestände betrifft. Zu einer etwas genaueren Betrachtung vgl. weiter unten die Ausruhrungen zu den "Rationalitätskatalogen". 201 nachweisen, wenn es um den Aufweis kausaler Voraussetzungen für die primordiale Identitätsbildung geht. Das soll an dieser Stelle jedoch zunächst einmal nicht weiterverfolgt werden. Hier ist mir vorerst ein anderer Aspekt wichtiger: Der Psychoanalytiker, welcher ein konversionshysterisches Syndrom diagnostiziert, rekurriert dabei auf eine Menge von gesetzesartigen Aussagen, deren begriffliche Präzision bisweilen sehr zu wünschen übrig lässt. Bezogen auf unser Beispiel heißt das: Eine Konversionshysterie kann sich – den theoretischen Prämissen zufolge – ebenso wie eine „Identitätskrise“ – sehr wohl auch in anderen Symptomstrukturen manifestieren als in einer schweren Lähmung. Die Theorie selbst ist es in diesem Fall, die uns wegen ihrer nicht besonders gut ausgebauten Ätiologie keine genauen Angaben darüber zu machen gestattet, wann eine Konversionshysterie zu Lähmungserscheinungen, wann zu herzneurotischen Erscheinungsformen und wann zu massiven Magen-Darm-Problemen führt. Aus diesem Grunde ist streng genommen der Hinweis auf die konversionshysterische Hintergrundsfolie nicht ausreichend. Wenden wir nunmehr diese Überlegung auf unser eigenes Beispiel an. Gesagt wurde eingangs, dass die strukturellen Bedingungen von Identitätskrisen zu Devianzen mannigfaltiger Art führen. In dieser Form ist dieses „Theoriekonstrukt“ viel zu unspezifisch, d.h. viel zu wenig ausgearbeitet, um uns sagen zu können, welche Form von Devianz wir eigentlich erwarten können. Problemlos sehen wir, dass und inwiefern der Ausdruck der Identitätskrise in diesem Fall nicht mehr ist, als ein bloßes Etikett für eine eigentlich zu konstruierende hypothetische Mannigfaltigkeit: Erst wenn wir den Begriff der Identitätskrise genauer explizieren und im Bezugsrahmen einer streng empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie „ansiedeln“ könnten, so dass sich hier einige klassifikatorische Prinzipien ergeben könnten, lassen sich auch differenzialdiagnostische Präzisierungen für die jeweilige Form von Devianzen herleiten. Hier handelt es sich um eine Schwäche der Theoriekonstruktion und um eine Schwäche der Empirie.171 171 Wir werden später sogar sehen, das streng genommen der behauptete Zusammenhang zwischen Identitätskrisen und jeglicher Form von Devianz nicht einmal ganz richtig ist. Er gilt nämlich nicht für eindeutig politische Formen von Devianz und nur bedingt für delinquente Formen von Devianz. Ich weise auch hier auf ein Beispiel hin: In der Zeit des Nationalsozialismus haben sich bekanntlich vor allem konsequente Kommunisten und Mitglieder der sog. „Zeugen Jehovas“ in einem geradezu radikalen Sinne deviant verhalten. Ihr Sozialisationsmilieu wies Werte auf, die im krassen Gegensatz zu der damals geltenden Werteordnung und deren legalistische Formen standen. Dennoch wird man wohl kaum behaupten können, dass hierbei massive Identitätskrisen im Spiel waren. Wir sehen einmal mehr, wie notwendig es ist, eine empirisch gehaltvolle Sozialisationstheorie zu konstruieren, in deren Rahmen der Begriff der Identitätskrise seinen relativ gut bestimmbaren Ort erhalten kann. Dieser Punkt lässt sich als methodologische Maxime formulieren: Dann und 202 Das „DN-Schema einer wissenschaftlichen Erklärung“ ist, wie gesagt, derartig oft Gegenstand erbitterter Grundlagenkontroversen geworden und in diesem Zusammenhang nahezu immer pauschalisiert worden, dass man seine klärende Kraft eigentlich gar nicht mehr gesehen hat. Ich möchte deshalb an dieser Stelle noch einige Möglichkeiten durchspielen, um so die Relevanz dieser wissenschaftstheoretisch faszinierenden Einsicht für die hier in Frage stehende Problemsituation verdeutlichen zu können. Gehen wir von der Situation aus, dass wir über eine sehr gut bestätigte nomologische Hypothese verfügen, die, wie in unserem Popper'schen Beispiel den Zyankaligenuss mit normalerweise ziemlich sicher zu erwartenden letalen Folgen für den betreffenden Organismus verbindet. Ist die oben bereits beschriebene Bedingung gegeben, wo ein bestimmter Mensch gerade dabei ist Zyankali zu sich zu nehmen, so können wir unter Berufung auf unser allgemeines Gesetz in diesem ganz konkreten singulären Fall voraussagen („prognostizieren“), was mit diesem Menschen in den nächsten Minuten passieren wird. Dennoch ist natürlich nicht absolut sicher, was passieren wird, denn erstens kann unser Gesetz ja irgendwie doch durchaus falsch sein, und zweitens wäre immerhin denkbar, dass dieser Mensch bereits bei der Einführung in den Mund sich erbrechen muss („störende Bedingungen“, siehe oben). Wichtig ist mir, dass selbst in diesem „todsicheren“ Fall unser empirisches Gesetz letztendlich eben doch nur unter „ceteris-paribus-Vorbehalt“ gilt. Das Gesetz selbst beinhaltet eben doch nur einen hypothetischen Zusammenhang, es designiert keinen ontologischen Determinismus. Die Wahrscheinlichkeit mag auch noch so groß sein, gesetzesartiges Wissen ist in der Tat immer nur, wie der bereits zitierte Wissenschaftsphilosoph Stegmüller es ausgedrückt hat, „ein Wissen auf Widerruf“. Aber auch noch aus einem anderen Grunde ist mir die genauere Erläuterung unseres Beispiels wichtig, denn es ergeben sich zwei Möglichkeiten. Hierbei habe ich nunmehr nicht so sehr den Blick in die Zukunft, sondern den Blick in die Vergangenheit im Auge, die mittels des Erklärungsvorgangs ja angesprochen ist. Dieser Punkt ist mir deswegen wichtig, weil gemäß meiner einleitend formulierten These eine adäquate „Identitätskrisentheorie“ einen strukturellen Zusammenhang postulieren muss zwischen den primordialen nur dann, wenn eine empirisch gehaltvolle Sozialisationstheorie genügend Hypothesen zur Verfügung stellt, um "Identitätskrisen" differenzialdiagnostisch kategorisieren zu können, lässt sich der behauptete Kausalzusammenhang von "Identitätskrisen" und pathologischen Formen der Devianz relativ genau spezifizieren. 203 Konstitutionsbedingungen subjektiv sinnhaften sozialen Handelns im familialen Sozialisationsverband und den im späteren Leben eines Individuums auftretenden und zunehmend maligner sich herausbildenden Identitätskrisen, in deren Verlauf das (subjektiv sinnhafte) rationale Handeln dieses Individuums sich mehr und mehr mit „gestörten Verhaltensmustern“ durchsetzt, wodurch zunehmend auch dessen „Rationalstruktur“ zersetzt wird. Wie Porath richtig betont hat172, ist nämlich auch ein auf einer solchen Hypothese basierender Rückgriff in die Vergangenheit, der von einer gegenwärtig diagnostizierten schweren Verhaltensstörung auf vergangene, nämlich in der frühen Kindheit liegende Ereignisse schließt, streng genommen ebenfalls nur eine „Wahrscheinlichkeitsaussage“. Machen wir uns auch diesen Aspekt der DN-Problematik so deutlich wie möglich: Der erste Fall betrifft den von Popper beschriebenen. Der Gutachter, welcher die Zyankalivermutung des Dedektives bestätigt, könnte im Zweifelsfalle die Ereigniskette, die von der (vermuteten) Einnahme des Zyankali zum Versagen der Vitalfunktionen führte, lückenlos rekonstruieren und uns so gewissermaßen ein recht klares Bild von den stattgehabten Ereignissen liefern, ohne dass wir in der Lage wären, diese Ereigniskette auch wirklich beobachten zu können. Obwohl also der Schluss auf die „in der Vergangenheit“ stattgehabte Ereigniskette streng genommen ein theoretisches Konstrukt beinhaltet, können wir dennoch, um es in der Sprache der Juristen auszudrücken, mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ eine entsprechende Aussagenklasse formulieren. Man beachte gleichwohl, dass diese „Sicherheit“ nahezu vollständig abhängt von dem Ausmaß, in dem die behauptete Verknüpfung von Zyankaligenuss und Ableben empirisch validiert ist, woraus sich ja trivialerweise ergibt: Die Rekonstruktion vergangener und prinzipiell der Beobachtung nicht mehr zugänglicher Ereignisse kann umso sicherer vollzogen werden, je größer der Informationsgehalt der jeweiligen Hypothese/Theorie – deren Allgemeinheit und Präzision also – ist, auf der diese „Rekonstruktion vergangener Ereignisse“ beruht.173 Wir wollen nunmehr den Fall in zwei Richtungen verfolgen: Gesetz den Fall, dass wir „Fremdeinwirkung“ ausschließen können und wir nunmehr die Frage klären wollen, warum dieser arme Mensch Selbstmord begangen hat, haben wir dann nicht mehr ein biologisches 172 In Porath, H.-J., [Narratives Paradigma] 173 Vgl. hierzu Baumgartner/Rüsen [Erträge], S. 691ff, in: Lämmert, E., [Erzählforschung], wo die Kontroverse referiert wird, die sich zu Porath’s „Theoretizitätsthese“ auf dem Harzburger Kongreß ergeben hatte. 204 bzw. ein biochemisches, sondern ein psychologisches Problem. Nehmen wir weiter an, wir hätten hinreichend Kenntnisse von seiner sozialen Lage: Der arme Mann ist plötzlich arbeitslos geworden, hat monatelang die Familie darüber nicht informiert, hat immer mehr Schulden gemacht etc. etc. Wie sieht nunmehr die Logik aus? Zweifelsohne besteht eine starke „Evidenz“, d.h. wir können sehr gut verstehen, warum dieser offenkundig verzweifelte Mann sich umgebracht hat. Ist aber unsere Erklärung dann auch valide genug? Dies wäre offensichtlich nur dann der Fall, wenn wir über eine gesetzesartige Hypothese verfügten, die den Zusammenhang von „verzweifelter Lebenssituation“ und „Selbstmordtendenz“ als einen Kausalzusammenhang behauptet. Der entscheidende Punkt auf den es hier ankommt ist der folgende: Wir hätten auf Grund der Kenntnis seiner verzweifelten Lage und mit Bezugnahme auf die hier angedeutete psychologische Hypothese ganz sicher nicht genau prognostizieren können, dass dieser Mann sich umbringen wird, und noch weniger sicher hätten wir sein können, dass er sich dabei des Zyankalis bedienen wird. Es folgt: Die Validität einer Erklärung hängt dergestalt von der dabei benutzten gesetzesartigen Hypothetik ab, dass man im Prinzip auch hätte prognostizieren können, was Menschen in verzweifelten Situationen tun werden. Man beachte, dass ich dieses Beispiel nicht diskutiere um damit den Unterschied zwischen psychologischen und eventuellen biochemischen Gesetzmäßigkeiten zu dramatisieren. Die hier verwendete „psychologische“ Gesetzmäßigkeit ist lediglich weniger gut empirisch bestätigt als die Zyankali-Vermutung, gleichwohl handelt es sich um eine gesetzesartige Aussage. Nur darauf kommt es an. In einer etwas abstrakteren Sprechweise bedeutet dies: Selbstverständlich sind bei jeder Erklärung ebenso wie bei jeder Prognose gesetzesartige („nomologische“) Hypothesen im Spiel, die sich, wenn wir sie in einen logischen Ableitungszusammenhang bringen können, eben auch als Theorien präsentieren. Eine Erklärung wird ebenso wie eine Prognose umso unsicherer, je weniger gut bestätigt die Menge der nomologischen Hypothesen ist, mit denen wir unsere Erklärung zustande bringen oder aber Prognosededuktion vollziehen. Das jedoch haben wir ja hinreichend anlässlich der DN-Problematik ohnehin erläutert. Wir müssen nunmehr den Fall noch in einer etwas anderen Richtung betrachten, um den Bezug zu unserer Sozialisationstheorie herstellen zu können, die ja wie eingangs behauptet einen kausalen Sinnbogen konstruiert zwischen bestimmten Ereigniskonstellationen in der frühen Kindheit eines Menschen und dem Auftreten bestimmter psychopathologischer 205 Verhaltensmuster, was bedeutet: Die Kausalkette zwischen dem vermuteten Anfangsereignis und dem zu erklärenden Schlussglied der Kette, kann unter Umständen sehr lang sein, ohne das dadurch an der Logik des Erklärungsvorganges nicht das geringste sich ändert. Die wissenschaftstheoretische Forschung spricht in diesem Zusammenhang von den sog. „historisch genetischen Erklärungen“. In seiner Auseinandersetzung mit dem traditionellen Methodologen der Geschichtswissenschaft hat Porath nachweisen können, dass die sog. narrativen Erklärungen der Geschichtsschreibung in fundamentaler Diskrepanz zu den Objektivitätsprinzipien des Wissenschaftsdenkens sich befinden, wobei er sich auf ein modifiziertes DN-Schema gestützt hat, welches die Wahrscheinlichkeitsstruktur von Retrodiktionen – das sind, ähnlich wie bei unserem Zyankali-Pilz-Forscher, „rückwärtsgewandte Prognosen“ – noch sehr viel stärker einbezieht, als dies bei Popper der Fall ist.174 Zwar wird die Erklärungskette der sog. narrativen Beschreibungen und Erklärungen ziemlich komplex und entsprechend unsicher, jedoch müssen die dabei im Spiele befindlichen Hypothesensysteme ebenso eine grundsätzlich nomologische Struktur haben, wie die zumeist in strenger mathematischer Sprache repräsentierten Theorien der Naturwissenschaften. Auf diese Untersuchung stütze ich mich, wenn ich nunmehr auf den folgenden Aspekt der allgemeinen Erklärungsproblematik bezug nehme: Wie in dem obigen „wissenschaftstheoretischen Thesenkatalog“ bereits angedeutet, verknüpft der Psychoanalytiker seine Diagnose bezüglich des konversionshysterischen Syndroms mit einer ganz bestimmten Grundannahme der psychoanalytischen Theoriekonstruktion: Die Erlebniswelt der frühen Kindheit sei ein zwar komplexer aber im Prinzip aufklärbarer Hintergrund für eine adäquate Ätiologie der Konversionshysterien. Man sieht hier ohne große Schwierigkeiten, dass es sich hierbei um eine Konstruktion handelt, die eine sehr „störanfällige“ Kette temporal angeordneter Ereignisglieder betrifft. Die „Randbedingungen“ werden dabei in der Regel nur sehr hypothetisch konstruiert werden können. Das ändert gleichwohl an der logischen Struktur unserer Argumentation nicht das geringste. Wie bereits bei Popper nachgelesen werden kann, der allerdings die sog. „historischen Erklärungen“ nicht korrekt hat beschreiben können.175 Bei dem Versuch eine 174 ibid. 175 Ich habe sie deshalb bei meinen obigen „DN-Lehrstücken“ auch nicht erwähnt. Was gleichwohl die Beweisstruktur als solche betrifft, besteht zwischen Popper und Porath Konsens. Näheres hierzu in Lämmert, E., [Erzählforschung], wo im Anhang zu Poraths Aufsatz die Kontroverse vor allem zwischen der Rüsen’schen, der 206 Sozialisationstheorie zu konstruieren, die die Genese ganz bestimmter Identitätskrisen so aufzuklären gestattet, dass ein kausaler Zusammenhang behauptet werden kann zwischen ganz bestimmten Identitätskrisen und ganz bestimmten Formen abweichenden (sozialen) Verhaltens wird uns eben dieser Aspekt noch sehr viel genauer interessieren müssen. Abschließend noch ein kurzer Hinweis auf eine Differenz, die sehr oft nicht genügend beachtet wird: Hält man daran fest, dass sowohl Erklärungen als auch Prognosen, mithin also sowohl der Blick in die Vergangenheit als auch der Blick in die Zukunft an der These von der „Gesetzesartigkeit“ bestimmter Hypothesen festzumachen ist, so sieht man, dass es sich hierbei auch um die Position einer prinzipiellen deterministischen Vorgehensmöglichkeit handelt, wie sie ja auch von Freud in seiner „Vierten Fundamentalannahme“ vertreten wird. Man darf nur eins nicht verwechseln: Gut bestätigte Aussagen erhöhen die Wahrscheinlichkeit zum einen retrospektiv erschlossener zum anderen prognostizierter Ereignisse, jedoch kann diese Wahrscheinlichkeit eben variieren. Nie jedoch kann diese Wahrscheinlichkeit in Sicherheit übergehen, dergestalt, dass sich ein ontologischer Schluss anbieten würde: Wir bewegen uns immer im Bereich von Propositionen (Sätzen, Aussagen, statements) und wir hoffen natürlich, dass wir mit diesen Propositionen „Sicheres“ treffen. Zu glauben jedoch, dass eine wie auch immer geartete „Wirklichkeit“ von sich aus Sicheres anzeigt, bezeichne ich als ontologischen Fehlschluss. Der „Determinismus“, den ich hier in Anlehnung an Porath's Forschungen vertrete, kann immer nur ein methodologischer Determinismus sein. Kehren wir nunmehr abschließend auf die weiter oben aufgeworfene Frage zurück, welche Funktion den empirisch falsifizierbaren Hintergrundstheorien/Hypothesen der medizinischen Wissenschaften für deren klinische Disziplinen, denen es ja in erster Linie um praktischtherapeutische Anwendung geht, eigentlich zukommen kann. Und dabei wollen wir erstens berücksichtigen, was wir bisher über den Zusammenhang von Falsifizierbarkeit/Prüfbarkeit, Prognosededuktion und empirischem Gehalt (Erklärungskraft) gelernt haben, und zweitens, was wir bei Max Weber über den „Erfolgschancen-Satz“ sowie den „Kosten-Satz“ haben nachlesen können. Dann ergibt sich nunmehr: Während sich bei der Prozedur der Überprüfung die Aufmerksamkeit des Forschers, wie am Dantoschen, der Habermas’schen und der Porath’schen Position abgedruckt ist. Vgl. Baumgartner/Rüsen [Erträge], S. 691ff 207 Beispiel unseres etwas verrückten Zyankali-Forschers dargelegt, in der Regel nur auf die zu überprüfende Hypothese richtet, kommen bei der klinischen Anwendungspraxis zwecks „Therapie“ immer zugleich auch alternative Hypothesen ins Spiel. Genau dies macht, streng wissenschaftslogisch betrachtet, den Unterschied zwischen der „Anwendung“ einer Hypothese z. B. im Experiment, welches den Zweck hat, die betreffende Hypothese zu überprüfen, und der therapie-intendierten „Anwendung“, die den Zweck hat, mittels bestimmter, für „wahr“ gehaltener Hypothesen und mittels bestimmter als geeignet erachteter „Mittel“ die Wirklichkeit zu verändern, aus. Der Punkt ist wissenschaftslogisch deswegen von Bedeutung, weil hierdurch sich ganz besonders sinnfällig der Handlungscharakter aller „angewandten Wissenschaften“ offenbart. Und dies bedeutet natürlich - das ist nach allem, was bisher ausgeführt wurde, offenkundig und genau darauf kommt es mir natürlich an -, dass vornehmlich die anwendend-therapeutische Praxis in den Kompetenzbereich des genuin soziologischen Denkens fällt. Überspitzt ausgedrückt: Die klinisch-therapeutische Praxis designiert paradigmatisch die soziologische Grundsituation sinnhaft-rationalen sozialen Handelns. Ich wiederhole also um der Kontinuität meiner Argumentationsstruktur willen, was bereits mehrfach genau hierzu weiter oben ausgeführt wurde: 1. Die Konstruktion wie auch die empirische Validierung streng erfahrungswissenschaftlich gefasster Verhaltenstheorien, so hieß es auf S. 125, bilde die Voraussetzung dafür, dass bei beliebig vorgeprägtem Therapieziel das in der Grundlagenforschung akkumulierte Wissen auch erfolgreich angewendet werden kann. Tut man das jedoch, so ist man ganz automatisch mit all denjenigen methodologischen Fragen konfrontiert, die das Verhältnis zwischen „Erklärung“, „Prognose“ und (technologischer) „Applikation“ betreffen: Therapeutische Anwendung von „Grundlagenwissen“ besteht in dem gezielten Eingriff in ein ansonsten „natürlich“ ablaufendes Geschehen. Um jedoch einen solchen „gezielten Eingriff" überhaupt vornehmen zu können, muss zuvor eine Prognose erstellt werden, die besagt, wie der infrage stehende Ablauf z. B. einer Tuberkulose sich gestalten würde, würde man einen gezielten Eingriff unterlassen. Und auf S. 132 hieß es: 2. „Soziologisch ist die Psychiatrie ebenso wie die Justiz ein organisatorisch durchgebildetes komplexes System der sozialen Kontrolle, die sich mittels einer eigenen Fachsprache und mit einem ganz bestimmten kulturellen Auftrag auf das Verhalten der Individuen in unserer Gesellschaft bezieht. Wie Redlich und 208 Freedman richtig gesehen haben, bezieht sich deshalb die psychiatrische Fachsprache als der Jargon einer sozialen Institution auf ganz bestimmte Tatbestände, die sie als Verhaltensmuster und damit als „typisch“ in einer generellen Form umschreibt, wobei in Gestalt eines kulturell vorgegebenen Menschenbildes in der Regel immer zugleich auch ein ganz bestimmtes Ideal desselben eine mehr oder weniger große Rolle spielt. Prinzipiell lässt sich das terminologische Arsenal der Psychiatrie insgesamt als ein komplexes Klassifikationsschema in ähnlicher Weise, wie dies in der Jurisprudenz geschieht, präsentieren, so dass auch in dieser Beziehung eine ziemlich weitreichende Analogie zu unseren als „Strafrecht“ bekannten Systemen der sozialen Kontrolle besteht: Der klinische Mediziner ist ebenso wie der praktisch tätige Strafrechtler gezwungen, den infrage stehenden „Tatbestand“ so präzise wie möglich zu beschreiben, weil davon die Wahl der Maßnahmen abhängt, die vorschreiben, wie man mit einem solchen – erwünschten oder unerwünschten – Tatbestand umzugehen hat. Wir haben es hier wesentlich mit einem Problem der Sprache zu tun: Existiert keine wirklich gut entwickelte Ätiologie, so kann eben auch keine wirklich treffsichere Diagnose formuliert werden: Je allgemeiner und präziser eine das infrage stehende Krankheitsgeschehen betreffende Theorie ist, welche eine entsprechend umfassende Ätiologie beinhaltet, desto präziser ist die Diagnose und desto genauer lässt sich zum einen eine Erklärung, zum anderen eine Prognose formulieren." Und nunmehr hinzuzufügen wäre: Eine sinnvolle Erörterung bestehender Therapiemöglichkeiten beruht auf dem simulativen Durchspielen denkbarer Prognosen, was umso genauer geschehen kann, je allgemeiner und je präziser die dabei vorausgesetzte und bisher "korroborierte" Theorie ist. Es ergibt sich dann bezüglich der Wahl eventuell zu ergreifender therapeutischer Maßnahmen, was weiter oben auf S. 138 nach dem „Schaubild 1“ nachgelesen werden kann: 3. Wissenschaften, so hieß es dort mit Bezug auf den „Thesenkatalog“, seien „rationale Formen der Wahrheitssuche“, die sich arbeitsteilig in normative Wissenschaften (Ästhetik, Ethik, Rechtswissenschaft), in formale Wissenschaften (Mathematik, Logik), in Erfahrungs- bzw. Wirklichkeitswissenschaften und in sog. „angewandte Wissenschaften“ zerlegen ließen. Als Kriterium fungiere hierbei das Merkmal, dass es sich wesentlich um ganz bestimmte Aussagenstrukturen handele, die hierbei infrage kämen: Erstens normative Sätze 209 bzw. Werturteile, zweitens Satzsysteme, die nur dem Widerspruchsfreiheitspostulat zu genügen hätten (Mathematik und Logik), und drittens erfahrungswissenschaftliche Satzsysteme, welche außer, dass sie dem Widerspruchsfreiheitspostulat zu genügen hätten, zusätzlich noch so „gebaut“ sein müssten, dass sie empirischen Gehalt besitzen würden. Nur dann nämlich seien sie überhaupt „anwendbar“, denn nur dann auch könnten sie Erklärungen liefern und gestatteten nur dann auch die Formulierung von Prognosen, welche selbst wiederum von entscheidender Bedeutung für die Wahl eventueller therapeutischer Maßnahmen wären. Man könne problemlos sehen, so heißt es dann weiter, wie sehr hier alles zugeschnitten sei auf das von uns ins Zentrum gestellte Problem des Verhältnisses zwischen „Forschung“ und „Anwendung“, woraus sich ergibt: „Vor allem die Erfahrungswissenschaften sind es, die uns hier interessieren, liefern uns diese doch in erster Linie diejenigen „Erkenntnisinstrumente“, mittels derer wir die natürliche wie soziale Welt, in der wir leben, rational durchzukonstruieren und vernünftig umzugestalten imstande sind, wobei wir im Zuge dieser vernunftgeleiteten Tätigkeiten permanent Neues „an“ und „in“ unserer Welt entdecken bzw. zu entdecken hoffen. Das Erkennen von Zusammenhängen, die Entdeckung von Neuem, die (wahrheitsfähige) Beschreibung von Tatbeständen sowie die Erklärung derselben bzw. deren Voraussage und schließlich die sinnvolle bzw. vernünftige Veränderung von „Wirklichkeit“ designieren gewissermaßen die Systemziele wissenschaftlichen Handelns und dafür bedarf es eben ganz bestimmter Instrumente oder auch Erkenntnisinstrumente“. Diese „Erkenntnisinstrumente“ seien dann die erfahrungswissenschaftlichen Theorien. Abschließend beziehe ich mich dann noch auf den obigen Hinweis in der „Weber-Interpretation“, die sich mit dem sog. „Erfolgschancen-Satz“ sowie dem „Kosten-Satz“ befasste: 4. Die Begriffe für die diagnostische Symptomatologie könnten nämlich, so hieß es auf S. ..., „umso schärfer gefasst werden, je besser eine theoretische Grundlage für eine gute Ätiologie sorgt. Eine gute Ätiologie jedoch ist gleichbedeutend mit einer entsprechenden „guten“, d.h. erklärungskompetenten, d.h. explanativen Theorie ...“. Die Konstruktion von Theorien fiele jedoch nicht in den Bereich der angewandten Forschung, wurde gesagt. Sie sei eine Angelegenheit der Grundlagenforschung. Man könne jedoch sehen, dass hier tatsächlich ein systematischer Zusammenhang bestehe zwischen dem Theorieniveau der 210 Grundlagenforschung, dem „Ausgeprägtheitsgrad“ einer ganz bestimmten Ätiologie und der „Treffgenauigkeit“ präziser symptomatologischer Diagnostik. Die Begriffe für die diagnostische Symptomatologie können nämlich in der Tat, wie wir nunmehr im Anschluss an die Behandlung des DN-Schemas sehen können, umso schärfer gefasst werden, je besser eine theoretische Grundlage für eine gute Ätiologie sorgt. Eine gute Ätiologie kann also tatsächlich, wie weiter oben behauptet, als gleichbedeutend mit einer entsprechenden „guten“, d.h. erklärungskompetenten, d.h. explanativen Theorie aufgefasst werden, beruht jene doch auf dieser, wie oben gezeigt. Fassen wir also auch diesen Zusammenhang in Form einer expliziten Aussage: Je besser, umfassender und fachterminologisch ausgefeilter die Grundlagenforschung einer medizinischen Disziplin, desto allgemeinere und präzisere Theoriegebilde mit entsprechend größerem empirischen Gehalt lassen sich konstruieren, und da das terminologische Gerüst der theoretischen Forschung ja zugleich das Vokabular abgibt für Symptomatologie und Diagnostik, gilt nunmehr, dass eine präzise Diagnostik eine direkte „Funktion“ des verfügbaren theoretischen Hintergrundswissens ist. Und hieraus lässt sich dann die folgende Regel ableiten: Sage mir, auf welche allgemeine theoretische Grundlage Du Dich berufst, und ich sagen Dir, wie gut Deine Krankheitsformenlehre ist und wie präzise Deine Diagnostik gestaltet werden kann. Die Beantwortung der Frage, welche Mittel geeignet sein könnten, um bestimmte Zwecke realisieren zu können - dies ja eine Fiktivüberlegung setzt voraus, dass man über eine einigermaßen gut gesicherte Prognose verfügt, die angibt, was passiert, wenn nicht in den infrage stehenden Ablauf eingegriffen würde. Und in der Tat ist dies, wie weiter oben bereits angedeutet wurde, der entscheidende Punkt: Die gedankliche Überlegung, was sein könnte, geht immer der jeweiligen Therapiemaßnahme als einem „subjektiv sinnhaften Handeln“, welches um eines ganz bestimmten Zweckes willen mit ganz bestimmten hierfür für „geeignet gehaltenen Mitteln“ praktisch sich betätigt, voraus. Das auf praktische Urteilskraft beruhende „menschliche Ermessen“ des erfahrenen Klinikers hat nur hierin eine entsprechend gesicherte Grundlage. Ich wiederhole deshalb in Gestalt einer „Therapie-Maxime“, was bereits oben anklang: Je besser – d. h. nunmehr: je allgemeiner und präziser diejenige Theorie ist, welche dem Hintergrundswissen einer praktisch-klinischen Maßnahme zugrundeliegt, und je besser diese sich empirisch bewährt hat – d. h. je schwierigere Überprüfungen 211 bzw. „echten Falsifikationsversuchen“ sie bislang überstanden hat –, desto präziser auch die Prognose und desto risikoärmer natürlich auch die empfohlene Therapiemaßnahme. Und in der Tat: Ob unser Kliniker eine solche Theorie nun bewusst handhabt oder hierbei mehr intuitiv – sozusagen von seinem reichhaltigen Erfahrungssatz ausgehend – vorgeht, ändert ja nichts an der grundsätzlichen methodologischen Sachlage: Immer bildet eine jeweils für „wahr“ gehaltene Theorie dabei den kognitiven Hintergrund für seine Prognose und diese wiederum den Fiktivhintergrund für die entsprechende „Wahl der Mittel“ um den prognostizierten Ablauf des Krankheitsverlaufes kulturwertbezogen – zugunsten des Patienten – zu beeinflussen: Die „Grenzen unseres Wissens“ designieren zugleich auch die Grenzen der praktischen – z.B. therapeutischen – Möglichkeiten. Das folgt ja nunmehr ganz zwanglos. Und auch der zweite Aspekt, auf den in diesem Zusammenhang hingewiesen wurde, ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung, wie man nunmehr deutlich sehen kann, wenn wir uns an das Poppersche „tetradic-schema“ erinnern: Die „Grenzen unseres Wissens“ sind keine Konstanten, sie sind vielmehr Variablen. Fragen wir nämlich ganz naiv, worin sich der jeweilige Forschungsstand, an dem sich unsere praktischen Handlungsmöglichkeiten orientieren müssen, eigentlich präsentiert, dann stoßen wir sofort auf das für jedwede Ätiologie relevante theoretische Hintergrundswissen, so dass folgt: Je allgemeiner und präziser das erreichte Theorieniveau in einer Wissenschaft ist, desto mannigfaltiger ist der Handlungsspielraum für den verändernden Eingriff in das, was normalerweise völlig selbstverständlich geschieht. 5.6. Der systemische Gesichtspunkt und die Zerlegung der Erklärungen in Funktional- und in Kausalerklärungen: Organismische und personale Systeme Bereits weiter oben hatten wir hier und da eine Sprache gewählt, die „systemisch“ genannt zu werden pflegt. Wir müssen uns hiermit aus zwei Gründen befassen: Erstens, weil sich Kausalerklärungen auch als Funktionalerklärungen interpretieren lassen – und umgekehrt – und zweitens, weil die systemisch funktionale Sprechweise sich mehr anbietet, wenn man menschliche Wesen nicht in der umgangssprachlich verständlich gewordenen „Individual- und Personalsprache“, sondern in der „biologisch-organismischen“ Sprechweise beschreibt. Sowohl in der biologischen Sprache als auch in bestimmten 212 systemtheoretisch abgefassten Teilsprachen von Soziologie und Psychologie spricht man von personalen Systemen bzw. von kulturellen Systemen oder auch von sozialen Systemen. Unser Selbstmörder im vorangegangenen Denkabschnitt hatte zwar auch einen Namen und repräsentierte eine ganz bestimmte Person, zugleich jedoch war er auch ein biochemisch bzw. psychosomatisch beschreibbares systemisches Geschehen. Vorab ist freilich zu betonen, dass diese „strukturell-funktionalistische“ Sprechweise nicht, wie sehr oft angenommen, andere Formen des Erklärens beinhaltet, als eine Sprechweise die, wie wir es im vorigen Abschnitt demonstriert haben, explizit mit Kausalerklärungen operiert. Die Wissenschaftstheorie hat offensichtlich minutiös nachweisen können – ich denke hier vornehmlich an die Untersuchungen von Ernest Nagel – dass sich jede Funktionalerklärung mit entsprechendem logischen Aufwand in eine Kausalerklärung umwandeln lässt. Uns interessiert der Grundlagenstreit, der sich in der strengen Wissenschaftslehre hierzu entwickelt hat, nur am Rande. Wichtig ist lediglich, dass sich auch Funktionalerklärungen nur dann als adäquat erweisen, wenn dabei mit gesetzesartigen Annahmen operiert wird. Ob diese sich dann funktionalistisch oder „rein kausal“ präsentieren, kann uns gleichgültig sein. Gehen wir noch einmal auf das in II. 4. 1. skizzierte „Grunddilemma der Psychiatrie“ zurück. Worin genau bestand es? Nun es bestand darin, dass die allgemeinen Werte der Institution der Psychiatrie und damit auch die therapeutischen Ziele keine „Binnenwerte“ der Psychiatrie sind, sondern dass wir es hierbei vielmehr mit kulturell vorgegebenen Werten und Zielen zu tun haben. Es muss also dem Mediziner darauf ankommen, auch eine Sprache zu sprechen, die es gestattet, die ihm vorgegebenen Soll-Werte (gesund bzw. mündig) in einer Sprache abzuspiegeln, die ihm das klinische Vorgehen ermöglicht. Es kommt also dem Mediziner darauf an, insoweit das notwendig sein sollte, die „Soll-Zustände“ wie „Ich-Stärke“, „gesund“, „normal“, „Mündigkeit“, „Rationalität“ etc. die ihm in unsere Gesellschaftsformation als therapeutische Ziele, als Sozialisationsziele, wie auch als Re-Sozialisationsziele kulturell vorgegeben sind – und damit natürlich auch kulturell variieren können –, in eine quasi-objektivistische Fachsprache zu übersetzen. Dafür bedarf es ganz bestimmter Übersetzungsregeln und genau diese Übersetzungsregeln liefert eben die systemische Sprechweise. Werfen wir deshalb noch einmal einen kurzen Blick auf den „Redlich/Freedman“, wobei deutlich werden soll, wie sehr auch von diesen beiden Autoren der von mit vertretene Standpunkt des methodologischen Determinismus vertreten wird. Man muss hierbei lediglich 213 „mit den Augen“ dessen lesen, der gerade versucht hat, die obige „DN-Analyse“ nachzuvollziehen. Zu Beginn formulieren Redlich und Freedman ihre methodologische Grundposition, welche dieselbe ist, wie ich sie im vorherigen Abschnitt als die meinige skizziert habe: die Position des methodologischen Determinismus. Die Psychiatrie nehme „einen deterministischen Standpunkt“ ein. Sie sei „als Technologie auf die biologischen und Verhaltenswissenschaften gegründet“. Sie sei verpflichtet, „in jedem Falle mit wissenschaftlichen Methoden nach wesentlichen und verlässlichen Zusammenhängen zu suchen“. Kausalität werde vorausgesetzt. Darunter sei der „Grundsatz“ zu verstehen, „dass gleichartige Komplexe von Voraussetzungen (wobei immer Organismus und Umwelt zu berücksichtigen sind) auch gleichartige Komplexe von Folgen hervorbringen“. Dabei werde im allgemeinen genauso vorgegangen wie bei den theoretischen Grundlagenwissenschaften, indem zu bestimmen versucht wird, „innerhalb welcher Grenzen ein bestimmter Komplex von Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu gleichen Folgen führt. Stimmen die Ergebnisse nicht mit dem überein, was nach den Voraussetzungen zu erwarten gewesen wäre, so ist nach unberücksichtigen Faktoren im Organismus oder in der Umwelt zu suchen, die diese Differenzen erklären. Beim Menschen haben wir es, wie bei allen biologischen Systemen, mit einem Organismus zu tun, der sich an veränderlichen Zielen orientiert. Wir [die Psychiater] schauen also nicht nur nach zeitlich vorangehenden Ursachen, sondern versuchen auch die Ziele und Zwecke des betreffenden Systems zu erkennen. Wir [die Psychiater] untersuchen, welche Faktoren die Ziele bestimmten und mit welchen Mitteln das Verhalten auf diese Ziele hin strukturiert wird.“ Und sodann der entscheidende Satz: „Kausale und teleologische Erklärungen bilden heute keinen unversöhnlichen Gegensatz mehr, seit die Kybernetik den Begriff der Rückkoppelung eingeführt hat. Diese fundamentale Konzeption ermöglicht es uns [Psychiatern], zweckmäßige, zielgerichtete Aktionen – sei es bei ferngelenkten Geschossen, Amöben oder im menschlichen Verhalten – als durch bestimmbare Ursachen gesteuert zu betrachten, d.h. als gelenkt durch innere und äußere Signale, die die psychobiologischen Abläufe aktivieren, bremsen, korrigieren“.176 Worauf kommt es mir hier an? 176 Redlich/Freedman S. 126f Hervorhebungen mittels Kursiv durch mich Ch. K. 214 modifizieren, Zunächst einmal darauf, dass sich die zitierten Äußerungen von Redlich und Freedman problemlos in eine Sprache übersetzen ließen, die sich bei dem, was die Autoren hierbei über das Prinzip konsequenten Kausaldenkens zu sagen haben, explizit des HO-Schemas bedient. Das brauchen wir wohl kaum in ausführlicher Weise vorzuführen. Der Punkt auf den es mir hier ankommt, ist jedoch darüber hinaus der folgende: In der Kennzeichnung von Redlich und Freedman wird nicht nur aus der Position des methodologischen Determinismus heraus für eine systemtheoretische Sprache plädiert, die, wie die beiden Autoren zurecht sagen, nicht im Widerspruch gesehen werden darf zu den Prinzipien der im vorigen Abschnitt behandelten DN-Erklärung, es wird auch und gerade für eine solche „systemische Methodologie“ um einer möglichen Integration der verschiedenen „Theorieansätze“ willen plädiert. Auf genau diesen, wie ich meine: zentralen, neuralgischen Punkt sollte sich unsere Aufmerksamkeit richten, wobei zunächst einmal einige „Warntafeln“ zu beachten sind, die eine möglich Konfusion von handlungstheoretischer und „systemischer“ Sprechweise betreffen. Funktionale Zuordnung von determinierenden Faktoren im Hinblick auf ganz bestimmte SollZustände organismischer Systeme ist deckungsgleich mit der Formulierung von strengen Kausalerklärungen. Das ist jedenfalls kaum strittig. Dennoch ist auffällig, dass die hierbei auftretenden zentralen Begrifflichkeiten an genau diejenige Sprechweise erinnern, die wir aus der „Begriffslehre des sozialen Handelns“ kennen und die wir in Abschnitt II. 8. noch genauer erläutern werden. Wir müssen bei der Lektüre systemtheoretisch verfasster Arbeiten allerdings sehr genau den Unterschied beachten, auf den es hier wesentlich ankommt: Die menschliche Niere hat beispielsweise hinsichtlich der Aufrechterhaltung eines stabilen Kreislaufsystems eine ganz bestimmte Funktion, dennoch würde es eine bedenkliche Metaphorik bedeuten, wenn man daraus den Satz zu gewinnen versuchen würde, die Niere habe die Intention, zur Aufrechterhaltung der Stabilitätsbedingungen des Kreislaufsystems irgendetwas beizutragen. Überspitzt formuliert: Nieren können nun einmal nicht „subjektiv sinnhaft handeln“, erfüllen gleichwohl ganz bestimmte systemstabilisierende Funktionen, welche das somato-mentale Geschehen „menschlicher Organismus“ betreffen. Bezogen auf das Nierenbeispiel ist also offenkundig, dass eine handlungskonzeptionellintentionalistische Sprechweise unbedingt vermieden werden muss, wenn man die Funktionen systemischer Strukturen zu beschreiben versucht. Leider ist in vielen Abhandlungen der sog. strukturell-funktionalen Theorie die dabei zu beachtende Sorgfalt häufig nicht zu 215 beobachten.177 Das liegt vor allem daran, dass auch soziale Institutionen, die in einer systemischen Sprechweise funktionalistisch beschrieben werden, als soziale Kollektive ausgefasst werden, die so etwas wie einen kollektiven Willen haben könnten. Das jedoch ist vollkommen falsch: Institutionen haben soziale Funktionen bzw. kulturell vorausdefinierte Zielvorgaben, sie haben aber nicht die Absicht, irgendetwas zu tun bzw. nicht zu tun, irgendetwas zu unterlassen oder irgendetwas zu wollen. Formulierungen wie „die Psychiatrie hat die Absicht“ oder aber „das Interesse einer bestimmten sozialen Schicht“, erwecken den Eindruck, als könne man Handlungskonflikte ohne Gefahr der Konfusion der Sprachebenen in stetem Wechsel von Handlungsvokabular und systemischem Vokabular unbestraft charakterisieren. Doch das mag als metaphorische Sprechweise noch einigermaßen hingehen. Ausgesprochen problematisch wird es allerdings, wenn sich z.B. die Psychoanalytiker des metaphorischen und anthropomorphistischen Charakters ihrer Funktionsbeschreibungen („das Über-Ich zensiert“) nicht bewusst sind. Dann dient eine funktionalistische und systemische Sprechweise zur Maskierung unseres Nichtwissens bzw. Noch-Nicht-Wissens bezüglich dessen, was wir bei genauerer Kenntnis der jeweiligen systemischen Strukturen in einer tatsächlich „objektivistischen“ Sprache beschreiben könnten, wäre unser „Theoretizitätsniveau“ höher.178 Gerade im Gebiet der Seelenforschung, wo nach wie vor unser theoriefähiges Detailwissen noch derart gering ist, ergäbe sich eine ausgesprochen gefährliche, da im Grundprinzip forschungsfeindliche Handlungs- und Willensmetaphorik. Ich weise an dieser Stelle auf das hierbei involvierte Problem lediglich hin, behalte mir jedoch vor, bestimmte Bedenken geltend machen zu können, wenn es um die Beschreibung z.B. von „Ich-Funktionen“ geht. 177 Genau hierzu vgl. vor allem die Homans’sche Funktionalismuskritik, die sich konsequent an genau den selben Argumenten abstützt, wie wir sie anlässlich der „DN-Analyse“ entwickelt haben. Homans plädiert aus eben diesem Grunde für eine konsequente „Reduktion“ der gesamten soziologischen Forschung auf „Psychologie“. Er ist nämlich unter Berufung auf das DN-Schema der Meinung, nur so könne die „Wissenschaftlichkeit“ der Soziologie gerettet werden, die das Problem der gesellschaftlichen Dynamik in den Griff zu bekommen versucht. Ich zeige bereits an dieser Stelle, dass dieser „Fundamentalpsychologismus“ gar nicht nötig ist, worauf zurecht eben Redlich und Freedman hinweisen: „Systemische Sprechweise“, Kausalprinzip und Funktionalerklärungen widersprechen sich keineswegs. Hier wäre naturgemäß eine entsprechende – nämlich sehr differenzierte – Kritik an der Position des sog. „methodologischen Individualismus“ angebracht, wie in Abschnitt II. 4. 1. betont. Eine solche Kritik muss ich mir allerdings versagen. 178 Der Ausdruck von Porath [Forschungsantrag]. Siehe hierzu das obige Zitat im „Thesenkatalog“. 216 Sodann wenden sich die Autoren dem mit dem sog. „Integrationsproblem“ engstes verknüpften Problem der Multifaktorialität verursachender Bedingungen zu, was gleichfalls, wie unschwer gesehen werden kann, mit dem übereinstimmt, was wir anhand der DNAnalyse kennengelernt haben: „Sowohl in der Medizin wie auch in der Psychiatrie haben sich Erklärungen, die nur einen einzelnen Faktor berücksichtigen, seit langem als unzureichend erwiesen. Selbst für solche Krankheiten, für die sich eine wesentliche und notwendige Ursache auffinden ließ – z.B. Infektionskrankheiten –, gilt es doch, nicht nur den Erreger, sondern die Wechselwirkungen zwischen diesen und dem Wirtsorganismus unter den gegebenen Umweltbedingungen zu begreifen. Eine solche mehrdimensionale Betrachtungsweise ermöglicht einerseits angemessene Erklärungen des Geschehens, andererseits rückt sie auch ganz spezifische Variablen in den Blick (z.B. Resistenzfaktoren), die gesondert zu untersuchen sind. Alle Überlegungen zur Ätiologie psychiatrischer Erkrankungen müssen die biologischen Gegebenheiten des betreffenden Patienten, seine materielle und soziale Umwelt und vor allem die wechselseitigen Beziehungen berücksichtigen, die der Patient in der Vergangenheit und in der Gegenwart zu anderen Menschen hatte. Der subjektive Niederschlag dieser Beziehungen in Form von Gedanken, Erinnerungen, Gefühlen – kurz: psychologische Variablen sind ebenfalls entscheidend wichtige Determinanten menschlichen Verhaltens“.179 Genauso ist es. Die analytische Heuristik einer dergestalt streng methodisch aufgebauten Psychiatrie ist damit klar ausgesprochen: Die „Ursachen“ für bestimmte pathologisch auffällige Verhaltensmuster bilden ein „Mehrfaktorengefüge“, was bei der Zuordnung bestimmter Einflussfaktoren für ganz bestimmte Effekte peinlichst genau beachtet werden muss. Niemand der am Wissenschaftsprinzip festhält würde dieser Heuristik widersprechen. Was jedoch bedeutet dies ganz konkret für die Ausarbeitung einer Sozialisationstheorie, deren Grundbegriff der Begriff der „Identitätskrise“ sein soll? Dass bei dem Ausbau einer solchen Theorie biologische, psychologische und soziale Faktoren interdependenzfunktional „ineinanderspielen“, dürfte nicht zweifelhaft sein.180 Würde es aber genügen, wenn man eine solche Sozialisationstheorie aufzubauen versucht und dabei ganz einfach Begriffe und Methoden der Biologie der Psychologie und der Soziologie mischt? 179 Redlich/Freedman a.a.O. S. 126f Hervorhebungen mittels Kursiv und Unterstreichung durch mich. 180 Zur Methodologie der sog. „Interdependenzrelationen“ vgl. den, wie ich finde, nach wie vor vorzüglichen Artikel von Hans Zetterberg [Theorie, Forschung und Praxis] in René Königs [Handbuch] aus dem Jahre 1962. 217 Doch offenkundig nicht, können wir nunmehr unter Berufung auf unsere Ausführungen bezüglich der Geltung des DN-Schemas expressis verbis betonen. Bei einem solchen Verfahren könnte man nämlich die entsprechenden Faktoren nicht im Hinblick auf die fraglichen pathologischen Verhaltensmuster konkret gewichten. Das aber genau ist unser zentrales Problem, eben weil es den eigentlichen neuralgischen Punkt der sog. „Integrationsproblematik“ unmittelbar berührt. Wir werden nämlich sehen, dass hierbei eine zentrale Voraussetzung aller Integrationsversuche, die das Problem der kausalen Gewichtung multifaktorieller „Einwirkungen“ betrifft – dies gilt selbst für diese ansonsten mustergültige Monographie von Redlich und Freedman – keine Berücksichtigung findet: Wir benötigen ein idealtypisches Konstrukt rationalen Handelns, welches in der „empirischen Wirklichkeit“ nirgendwo anzutreffen ist, um sodann die entsprechenden kausalen Faktoren, die die beobachtbaren Verhaltensmuster „hervorbringen“, gewichten zu können, denn genau dafür benötigen Komparativierungen, wie sich anhand der weiter unten vorgeführten „Rationalitätskataloge“ (Abschnitt II. 8. 2.). Aus genau diesem Grunde ist eine streng soziologische, d.h. rollenstrukturell ergänzte Konzeption des sozialen Handelns, wie sie eigentlich zu entwickeln wäre, unabdingbar. An dieser Stelle möchte ich lediglich an folgendes hinweisen: Die Mentalerkrankungen, von denen die moderne klinische Psychiatrie spricht, scheinen vor allem bezogen auf den sog. psychotischen Formenkreis durchwegs ein „Privileg“ menschlicher Wesen zu sein. Ist dem aber so, dann bedarf es eines idealtypologischen Konstruktes, welches genau diesem „Privileg“ auch Rechnung trägt. Und genau hier liegt der methodische Ort, der in der vorliegenden Arbeit getätigten systematischen Anleihe bei der Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“ und dessen Methodologie der sog. idealtypologischen Konstruktion. Ist aber diese Überlegung einmal einigermaßen gesichert – und wir werden anhand der „Rationalitätskataloge“ sehen, wie sie gesichert werden kann –, dann muss ein ganz bestimmter Zusammenhang existieren zwischen ganz bestimmten Rollenkonfigurationen, die ein Mensch im Verlaufe seiner Sozialisation „durchlebt“ hat und ganz bestimmten Dispositionen zu genuin pathologischen Formen des Verhaltens. Natürlich darf daraus nicht abgeleitet werden, dass es pauschal „die Gesellschaft“ sei, welche „die Menschen krank macht“. Man sieht mühelos, dass eine solche Pauschalaussage streng genommen gar nicht überprüfbar wäre, gestattet sie doch gerade nicht die bitternotwendige Gewichtung derjenigen „Wirkfaktoren“, die in einem multifaktoriellen Gefüge möglicher „Ursachen“ repräsentiert wären. Ganz gewiss nämlich, gibt es im strengen Sinne kränkend sich auswirkende Interaktiv- und Kommunikativkonstellationen, die bei entsprechender 218 Krankheitsdisponiertheit verstärkend wirken. Um genau diese geht es, wenn wir uns um die Konstruktion einer auch und gerade das „Krankheitsgeschehen“ miteinbeziehende Sozialisationstheorie bemühen. Und genau hier ist auch der methodische Ort, des weiter oben idealtypisch gefassten „Gadamerschen“ Gespräches: Nicht an sich sind solche Gesprächsformen bereits „pathologieblockierend“ bzw. von „therapeutischer Bedeutung“ und bewirken relativ sanft sich ereignende Identitätsmetamorphosen, jedoch kann sehr wohl bei geeigneter personeller Disposition der Gesprächspartner eine solche Gesprächstruktur sich in dieser oder jener Form auswirken. Welche Auswirkungen genau jedoch zu gewärtigen sind, kann nur in einer allgemeinen Sozialisationstheorie „durchgespielt“ und auf den jeweiligen konkreten Fall bezogen werden. Wie auch immer. Jedenfalls können wir den nachstehend zitierten Überlegungen von Redlich und Freedman aus all den hier aufgeführten Gründen nur aus vollem Herzen zustimmen: „Mehrere verschiedene Ursachen können auf eine gemeinsame Wirkung hin konvergieren; was Verhalten anbetrifft, so steht jede Verhaltensreaktion immer im Dienste mehrerer verschiedener Funktionen und bringt mehrfache Wirkungen hervor. Damit ist natürlich spekulativen Interpretationen viel Spielraum gegeben [den wir ja gerade einengen wollen]. Unsere Aufgabe [der Psychiater] ist es, festzustellen, wie Ausgangsbedingungen [die ihren pathogenetischen Hintergrund z.B. in den primordialen Lebensverhältnissen eines Patienten haben können] und Folgen miteinander verknüpft sind [eben!], und die speziellen Bedingungen aufzuzeigen, unter denen ein bestimmtes Verhaltensphänomen sich am wahrscheinlichsten ereignen wird. In der Praxis versuchen wir uns ein Bild zu machen, wie die verschiedenen Determinanten zusammenwirken und welche von ihnen jeweils dominieren; wir versuchen für den betreffenden Einzelfall eine Hypothese über den Stellenwert der einzelnen Determinanten und ihr wahrscheinliches Ergebnis aufzustellen – was im üblichen medizinischen Sprachgebrauch der Diagnose und Prognose spricht.“181 Und wie genau geschieht das? Was genau muss dabei beachtet werden. Überdeutlich sehen wir nunmehr, wie ich meine, welchen Sinn diese Ausführungen machen, wenn wir sie im Lichte des weiter oben behandelten DN-Schemas betrachten: Der „Spielraum“ für „spekulative Interpretationen“ engt sich ja ganz automatisch ein und gestattet die genaue Verknüpfung von „Ausgangsbedingungen – das sind die im DN-Schema 181 Redlich/Freedman a.a.O. S. 128f Hervorhebungen mittels Kursiv durch mich 219 behandelten Randbedingungen – und Folgen“, die „speziellen Bedingungen [also auch], unter denen ein bestimmtes Verhaltensphänomen sich am wahrscheinlichsten ereignen wird“. Die „Hypothese“ von der die Autoren sprechen ist dann natürlich die gesetzesartige Annahme im DN-Modell, wobei im Auge zu behalten ist, dass eine solche „Hypothese“ u.U. die Form einer recht komplexen Sozialisations(-Theorie) annehmen kann und vielleicht sogar muss. Man darf sich das Ganze also, wie bereits mehrfach betont, nicht so einfach vorstellen: Die „Hypothese“ von der hier die Rede ist, impliziert unter Umständen eine komplexe Ätiologie, stellt also ein Gefüge von Hypothesen, ein streng allgemeingefasstes und in sich widerspruchsfreies Gefüge von Hypothesen, eine Theorie also, dar. Zu der Ausarbeitung einer solchen formulieren wir in dieser Arbeit lediglich die ersten – bisweilen recht unsicheren Schritte.182 Wichtig ist mir die bereits weiter oben getroffene Feststellung: Je präziser und allgemeingefasster jene Theorie ist, die bestimmte „Anfangsbedingungen“ mit ganz bestimmten als pathologisch einzuschätzenden Verhaltensmustern kausal zu verknüpfen gestattet, desto präziser gestalten sich Symptomatologie und Anamnese. Doch wie wir nunmehr sehen können nicht nur dies: Auch die Prognose wie die eventuellen therapeutischen Eingriffsmöglichkeiten resultieren aus der „Erklärungskraft“ der hierbei infrage stehenden Sozialisationstheorie. Was bedeutet das nun für unsere Problemstellung? Auch dies wollen wir an dieser Stelle in Gestalt einer relativ abstrakten Aussage zumindest festhalten: Je allgemeiner und je präziser eine die hier vorgeführten Überlegung einbeziehende Sozialisationstheorie ist, desto präziser lassen sich die möglichen „Auslösefaktoren“ für ein bestimmtes Krankheitsgeschehen erfassen und desto präziser ergeben sich Diagnose, Prognose und mögliche therapeutische Eingriffe. Wenn man also zugesteht – und Redlich und Freedman tun dies – das genuin soziale Faktoren überhaupt auf irgendeine Art und Weise die Verhaltensmuster genuin pathologischer Formen der Devianz beeinflussen können, dann muss man wohl auch zugestehen, dass eine streng soziologisch aufgebaute Sozialisationstheorie zu einer möglichen Gewichtung genau dieser Faktoren auch 182 Insofern stellt die vorliegende Arbeit zugleich auch ein Plädoyer dar für konsequente interdisziplinäre Kooperation. Ich maße mir nämlich ganz bestimmt nicht an, alleine leisten zu wollen, mit dem hier vorgestellten Entwurf ganz bestimmt nicht bereits die Bewältigung dessen an, was Aufgabe eines Teams sein muss, in welchem sich verschiedene Spezialisten aus anderen Fachgebieten zusammenfinden können. Und ich mache lediglich auf den genuin soziologischen Aspekt im Rahmen einer solchen Zusammenarbeit aufmerksam, und zwar, wie Weber so schön sagt, „unter durchaus einseitigen Gesichtspunkten“. Vgl. hierzu meine einleitend formulierten Ausführungen zur Frage der „Relevanz“ der hier vorgelegten Arbeit. 220 einiges beitragen könnte. Um mehr als die Plausibilisierung genau dieser Grundüberlegung geht es mir in diese Arbeit ja auch gar nicht. Und in genau diesem Sinne wäre dann abschließend auch das folgende zu verstehen: „Wir [die Psychiater] betrachten biologische Organismen, einschließlich des Menschen, als Systeme, die Information verarbeiten und physikalische Energie umsetzen. Ein solches biologisches oder Verhaltenssystem – überhaupt jedes Rückkopplungssystem – verfügt über Einrichtungen zur Festsetzung von Zielen sowie über die Fähigkeit, über innere Umordnungen Aktivitäten in Gang zu setzen, die das betreffende Ziel entweder zu erreichen oder zu modifizieren versuchen. Alle einzelnen Bestandteile eines Verhaltenssystems, gleich welcher Art, sind durch codierte Muster (coded patterns) gegliedert und miteinander verknüpft. Es wäre denkbar, dass der geregelte Umsatz physikalischer Energie, wie er ständig im Körper vor sich geht, Signale liefert, die schließlich zu Verhaltensaktivitäten führen; solche energetischen Prozesse dienen jedoch in erster Linie zur Aufrechterhaltung der zellulären Funktion“.183 Wie nunmehr unschwer erkennbar, wäre bei etwas „verschobener“ Blickrichtung sehr wohl auch ein anderer Standpunkt denkbar: „Irgendwie“ beeinflussen ja ganz sicher diejenigen „Reizimpulse“ der sozialen Welt, welche das „Informationsverarbeitungssystem Mensch“ zu bewältigen hat, wenn es als ein „Neugeborenes“ überhaupt erst einmal die Bühne dieser sozialen Welt betreten hat, bewältigen muss, jenen „geregelten Umsatz physikalischer Energie, wie er ständig im Körper vor sich geht“ auf eine je spezifische, d.h. kausale, Art und Weise. Ansonsten wäre das ganze Gerede von den vielzitierten „psycho-somatischen Zusammenhängen“ ja auch ziemlich nichtssagend. Ich sage ganz bewusst „denkbar“, denn Voraussetzung hierfür wäre zunächst einmal die Erarbeitung einer konsequent sozialwissenschaftlich ausgestatteten und methodologisch sensibilisierten Sozialisationstheorie mit wesentlich höherem Erklärungs- und Prognoseniveau als demjenigen, welches die bisher vorhandenen „Ansätze“ aufweisen. Oder überspitzt ausgedrückt: Die sog. „systemische Sprechweise“ in den Humanwissenschaften kann nur metaphorisierenden Charakter haben, solange wir nicht über eine empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie verfügen, welche zumindest in die Nähe desjenigen 183 Redlich/Freedman a.a.O. S.129 Hervorhebungen mittels Kursiv durch mich. 221 Niveaus kommt, welches z.B. die Hypothesenkonstruktionen der sog. „Neurowissenschaften“ derzeitig bereits aufweisen. Bei dem gegenwärtigen Forschungsstand gesellschaftswissenschaftlichen „Theoriewissens“ ist jedenfalls die so viel beschworene „Integration“ neurowissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Hypothesensysteme kaum mehr als ein Wunschtraum im durchaus psychoanalytischen Sinne. 6. Die Psychoanalyse und ihre Grundannahmen 6.1. Rückblick und Fragen Wie einleitend gesagt, stellt sich die vorliegende Arbeit die Aufgabe, Rolle und Funktion der sog. „Identitätskrisen“ zum einen für gelungene, zum anderen für misslungene Sozialisationsvorgänge abzuklären. In den vorangegangenen Abschnitten haben wir uns zunächst einmal auf die Heraushebung des genuin soziologischen sowie des genuin methodologischen Gesichtspunktes bei dieser Problemstellung konzentriert und in diesem Zusammenhang in einer noch etwas groben Weise die Webersche „Begriffslehre des sozialen Handelns“ skizziert. In dieser jedoch, die ja bestrebt ist, explizit den genuin soziologischen „point of view“ zu akzentuieren, um so mittels des Handlungsbegriffs sowie der Methode des Verstehens die „Soziologie“ gegenüber der „Psychologie“ scharf abgrenzen zu können, taucht genaugenommen der Begriff der „Identitätskrise“ gar nicht auf, darf dies noch nicht einmal. Gleichwohl ist ohne große Schwierigkeiten einsehbar, dass gerade die Webersche „Begriffslehre des sozialen Handelns“, die ja mit den Konstrukten des „subjektiv sinnhaften individuellen Verhaltens“ bzw. des „zweckrationalen Handelns“ arbeitet, ganz selbstverständlich ein solches „Identitätskonstrukt“ ebenso voraussetzen muss, wie sie ja auch stattgehabte Sozialisationsvorgänge unterstellen muss, was trivialerweise bedeutet: Gäbe es den sozialen Tatbestand des Sozialisationsvorganges nicht, so gäbe es auch kein individuelles subjektiv sinnhaftes (soziales) Sichverhalten zu „wirklichen“ oder „imaginierten“ Objekten. Und der für die Identitätsproblematik entscheidende Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass eines dieser „imaginierten“ oder auch „wiklichen“ Objekte, zu dem das subjektiv sinnhafte Sichverhalten eines Einzelindividuums Stellung nehmen kann (oder muss), eben dieses Einzelindividuum selbst ist oder sein kann, woraus trivialerweise folgt: Sich seiner selbst bewusst sein oder werden – Selbst-Bewusstsein also „haben“ –, ist eine Form des subjektiv sinnhaften Sichverhaltens, des intentionalen Handelns. Und genau diese Form des 222 intentionalen Handelns sollte dann auch, wie ich meine, Identitätskonstruktion genannt werden, schließt doch die Fähigkeit des subjektiv sinnhaften Sichverhaltens zu sich selbst immer zugleich auch die Fähigkeit ein, „seine“ durch bestimmte Umstände vielleicht fragwürdig gewordene Identität mehr oder weniger erfolgreich stets aufs Neue konstruieren zu können. Dennoch: Zunächst einmal sind in expliziter Form sowohl das „Identitätskonstrukt“ als auch der Begriff der „Identitätskrise“ wesentlich basale Begriffe der Psychologie, oder genauer noch: der kognitiven Lerntheorie(n), mittels derer „mentale Zustände“ designiert werden, welche der direkten Beobachtung zwar nicht zugänglich sind, die wir jedoch erschließen können, ein Problem, auf welches wir hier nur hinweisen, auf das wir jedoch nicht explizit eingehen können. Hier halten wir nur fest: Sozialisationsvorgänge sind in erster Linie Lernvorgänge, welche streng behavioristisch als Verhaltensmodifikationen und im Rahmen der sog. „kognitiven Theorien“ als kognitive Umorientierungen zu interpretieren sind. Auf den geistesgeschichtlichen Hintergrund, der das Verhältnis des strengen Behaviorismus in Beziehung setzt zu der Entstehungsgeschichte der sog. kognitiven Theorien, kann ich in dieser Arbeit nicht eingehen. Nur soviel sei hierzu gesagt: Mittels der sog. „Hypothesentheorien der sozialen Wahrnehmung“ lassen sich (mittlerweile) streng behavioristisch gefasste Verhaltensmodifikationen als kognitive Umorientierungen deuten. Die Detailprobleme sind auch methodologisch sehr kompliziert, vielfach nach wie vor völlig ungeklärt und interessieren in der vorliegenden Arbeit, der es ja zunächst einmal nur darum geht, die „Bauelemente“ für eine mögliche Sozialisationstheorie zusammenzustellen, nur am Rande. Denn die Gewichtung des Aufmerksamkeitsschwerpunktes ist hier anders gesetzt: Wählen wir für den Bereich des „Gesellschaftlichen“ den Oberbegriff der „sozialen Tatbestände“, worunter sowohl institutionelle als auch psychologische Tatbestände zu subsumieren sind, so haben wir es, wie bereits in der These 10 des Abschnitts II. 1. dargetan, mit zwei Klassen von Theorien zu tun, deren „Bündelung“ uns die gesuchte empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie ermöglichen soll: Lerntheorien, die sich mit der Verhaltensdynamik personaler Systeme und Institutionentheorien, die sich mit der „Metamorphose“ rollenstrukturell beschreibbarer sozialstruktureller Tatbestände (sozialer Systeme) befassen. Denn selbstverständlich sind in diesem Sinne auch Sozialisationsvorgänge sowie 223 Enkulturationsvorgänge ebenso soziale Tatbestände wie au fond psychologische Tatbestände, die dem sog. „Affektdrosselungsgeschehen“ (Norbert Elias) angehören und die in der strengen Psychoanalyse als Sublimierungs- Versagens- und Verdrängungsvorgänge beschrieben werden. In diesem Sinne ist auch der Untertitel der vorliegenden Arbeit zu verstehen: Diskutieren wir die „sozialisationstheoretische Dimension des sozialen Handelns“, so diskutieren wir ebenso einen sozialen Tatbestand, wie wir es tun, wenn wir z.B. die Psychoanalyse selbst oder auch die „Handlungssoziologie“ als einen kulturellen bzw. sozialen Tatbestand diskutieren. Und selbstverständlich handelt es sich dann auch beispielsweise bei der Pädo-Psychiatrie, welche wir als Teilsystem der Systeme der sozialen Kontrolle auffassen, um einen sozialen Tatbestand.184 Dass und inwiefern wir diesen Oberbegriff dringlichst benötigen, werden wir später noch genauer sehen. Beziehen wir uns auf die „sozialisationstheoretische Dimension des sozialen Handelns“, so geht es uns wesentlich um die „Werdestruktur“ dessen, was Weber in seiner „Begriffslehre“ als kompetentes soziales Handeln zu umschreiben versucht hat. Dass er dies mit der erklärten Absicht getan hat, vornehmlich die institutionellen Tatbestände des sozialen Geschehens in den Blick zu nehmen, diejenigen Aspekte also, die wir z.B. mittels der sog. „Rollentheorie“ zu fassen versuchen, braucht uns an dieser Stelle nicht zu interessieren. Interessieren tut uns vielmehr, was es denn nun eigentlich mit der sog. „Psychoanalyse“ auf sich hat, und hierzu ergeben sich dann die folgenden Fragen: Warum erscheint uns ausgerechnet die Psychoanalyse geeignet für eine vornehmlich psychiatrisch-relevante Sozialisationstheorie, die es gestatte, dass „Identitätskonstrukt“ sowie den Begriff der „Identitätskrise“ so zu präzisieren, dass es tatsächlich möglich sei, zwischen „gelungenen“ und „misslungenen“ Sozialisationsverläufen zu unterscheiden? In was für einem Verhältnis steht die Psychoanalyse zur Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“? Und wenn doch – gemäß der Weberschen „Begriffslehre“ – das Hauptaugenmerk bei der Konstruktion einer auch psychiatrisch-relevanten Sozialisationstheorie auf die „Werdestruktur“ des rationalen sozialen Handelns gelegt werden muss, weshalb sind dann nicht, wie bei nahezu allen entwicklungspsychologischen Erklärungsmodellen, die im engeren Sinne kognitiven Lerntheorien wesentlich besser geeignet, interpretieren diese doch die für 184 Auf das auch methodologisch außerordentlich schwierige Problem, in welchem historisch realisierte Gesellschaftsformationen, welche (sozialen) Tatbeständen dem jeweiligen kulturellen System angehören bzw. nicht angehören, gehe ich hier natürlich nicht ein. Vgl. hierzu demnächst Porath [Historische Forschungslogik]. 224 den „normalen“ Sozialisationsverlauf infrage kommenden Verhaltensmodifikationen nach Maßgabe der sog. „Hypothesentheorien der Wahrnehmung“ explizit als kognitive Umorientierungen? Könnten wir denn hierbei nicht relativ problemlos den funktionalen Stellenwert bewusst gehandhabter Identitätskonstruktionsmethoden deutlich machen? Warum müssen wir uns also eigentlich, wie bereits einleitend bemerkt, mit jenem „Unbewussten“ herumschlagen, welches bekanntlich den eigentlichen Kern der sog. Psychoanalyse ausmacht? Gibt es denn so etwas wie „unbewusst“ gehandhabte Identitätskonstruktionen überhaupt? Beinhaltet nicht vielmehr bereits das begriffliche Gefüge „Methode der Identitätskonstruktion“ als solches, dass es sich dabei um etwas bewusst gehandhabtes handeln muss? Liegt es nicht auch und gerade aus diesem Blickwinkel einer wesentlich auf die Methodik der Hermeneutik gegründeten „Verstehenden Soziologie“ näher, die Piaget’sche bzw. die Kohlbergsche Variante der kognitivistischen (Entwicklungs-)Psychologie als „Ergänzung“ zur Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“ zu verwenden, um so vornehmlich die kognitive Struktur von Sozialisationsvorgängen aufklären zu können? Diese würden doch immerhin, wie Habermas beharrlich zu zeigen versucht hat, der fundamentalen Divergenz von humanspezifischen und „infrahumanen“ Lernprozessen sehr viel besser Rechung tragen, als die Psychoanalyse, die ihrem Selbstanspruch zufolge ja eine konsequent naturwissenschaftliche Theorie hatte sein wollen. Vor allem aber: Müsste sich nicht eigentlich, wo doch die Psychoanalyse vornehmlich die unbewusste Dimension von (humanspezifischen) Lernprozessen betont, die sie ja als sehr viel wichtiger erachtet als die dem Rationalitätsprinzip sehr viel näher stehenden kognitiven Umorientierungen, das Problem ergeben, den „Identitätsbegriff“ sowie das Problem der „Methode der Identitätskonstruktion“ so eng mit dem „Ich-Begriff“ zusammenzuschließen, dass sozialstrukturelle Tatbestände wie z.B. die Rollenstruktur familialer Sozialisationsagenturen notwendigerweise „außen vor“ bleiben müssten? Ja, wäre es nicht vielleicht dann sogar denkbar, dass ein mündig gewordenes menschliches Wesen zwei Identitäten, eine „bewusste“ und eine „unbewusste“ hat, die dann natürlich auch in Konflikt miteinander liegen könnten und so eventuelle „Identitätskrisen“ auslösen würden? Überspitzt formuliert: Sind maligne Identitätskrisen u.U. letztendlich eben doch so etwas ähnliches wie „Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Syndrome“ und liegt hier vielleicht das Geheimnis der sog. „Schizophrenie“ verborgen? Ja und Nein. Die Beantwortung dieser Fragen ist, wie man sich denken kann, nicht ganz einfach, werfen sie doch unabdingbar eine ganze Reihe sowohl methodischer als auch methodologischer 225 Probleme auf, deren Lösung für die Absichten der hier vorgelegten Arbeit zwar wichtig sind, die jedoch nur teilweise behandelt werden können. Unser Plädoyer für eine psychoanalytische Ergänzung des genuin soziologischen „point of view“, mittels derer wir uns um eine empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie bemühen wollen, gründet sich jedenfalls auf etwas anderes, nämlich: Die sog. „kognitivistische Psychologie“ gestattet nicht – jedenfalls nicht für sich allein – die Ausarbeitung eines Forschungsprogramms, welches Aussicht hätte, die eingangs genannte „Kernfrage“ einer „empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie“ irgendwann einmal beantworten zu können. Ihr Basalbegriff des „Lernens“ ist wesentlich gebunden an die Beschreibungsmöglichkeiten des Mechanismus´ der kognitiven Umorientierungen, eine „adäquate“ Sozialisationstheorie muss jedoch vor allem auch die Transformation organismischer Verhaltensmodifikationen in der Postnatalperiode in die ersten Ansätze „subjektiv sinnhaften Sichverhaltens zu Objekten“ beschreiben und erklären können. Wie bereits in der Anmerkung (34) betont, ist die Psychoanalyse das bislang einzig verfügbare Theoriekonstrukt, welches zumindest den Versuch gemacht hat, die hereditären bzw. konnatalen Faktoren des humanspezifischen Sozialisationsprozesses mit den primordialen Ansätzen subjektiv sinnhaften Sichverhaltens zu (imaginären bzw. „äußeren“) Objekten evolutiv zusammenzuschließen Genau hier liegt ihr systematischer Ort. An dieser Stelle halten wir zunächst einmal diejenige These fest, die, bereits einleitend erwähnt, für die Ausarbeitung einer allgemeinen Sozialisationstheorie von, wie wir glauben, entscheidender Bedeutung ist: Zu jedem Sozialisationsgeschehen, welches dem Handlungsparadigma zufolge wesentlich eine Abfolge von kognitiven Umorientierungen ist, muss ein äußerst komplexes unbewusstes „Beiprogramm“ hinzugedacht werden, welches die Modalitäten der auf kognitiven Umorientierungen beruhenden Verhaltensänderungen tiefgreifend beeinflusst. Wenn dem nämlich so ist, so ist jedwede idealtypologische Konstruktion des Begriffs der „Identitätskrise“, die nur die kognitive Dynamik des Sozialisationsgeschehens, nicht jedoch deren „unbewusstes Beiprogramm“ berücksichtigt, wesentlich defizient.185 Und die entscheidende Frage betrifft natürlich auch in diesem 185 Kriterium für „Irrationalität“ ist, wie wir später sehen werden, anhand des Ausmaßes beurteilbar, in dem idealtypologisch konstruiertes Rationalhandeln beeinträchtigt ist. Bezeichnenderweise ist es Freud niemals gelungen, die Extremformen irrationalen Verhaltens in Form einer idealtypologischen Konstruktion ähnlich einleuchtend „abzuspiegeln“, wie dies Max Weber bezüglich des Rationalitätskonstruktes gelungen ist. Jedoch wird es uns natürlich darauf ankommen, zusätzlich ein Kriterium angeben zu müssen, welches wiederum pathologisch auffällige Formen der „Irrationalität“ gegenüber bloß „normalaffektiv“ verzerrten Formen des Rationalhandelns zu diskriminieren gestattet. Man kann freilich eben diese Überlegung nur präzisieren, wenn man mit operativen Begrifflichkeiten arbeitet, und dafür sind nun einmal Komparativierungen klassifikatorischer Begriffsschemata erforderlich. Insofern hat naturgemäß auch das Tafelbild 3 („Irrationalität“) ein nur begrenzten Aussagewert. Auf der Grenzlinie zwischen „noch verstehbaren“ Irrationalismen und „psychopathologisch 226 Zusammenhang den dabei ins Spiel kommenden sozialisationstheoretischen Aspekt, so dass sich nunmehr zwanglos die zur einleitend formulierten „Kernfrage des Sozialisationsgeschehens“ komplementäre psychoanalytische (Doppel-)Frage ergibt: Wie und wodurch ist eigentlich dieses von Sigmund Freud entdeckte „unbewusste Beiprogramm“ subjektiv sinnhaften Sozialverhaltens entstanden und welcher funktionale Stellenwert kommt diesem „unbewussten Beiprogramm“ z.B. bei der mehr oder weniger erfolgreichen Handhabung je subjektiver Identitätskonstruktionen zu? Offenkundig gibt es dafür nämlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder bringt jedes neu auf die Welt kommende menschliche Wesen bereits bei seiner Geburt dieses „Beiprogramm“ fix und fertig mit, oder aber es ist Bestandteil des Sozialisationsprozesses. 6.2. Die Fundamentalannahmen Das in wissenschaftstheoretischer Hinsicht sehr komplizierte Netzwerk von geistigen Leistungen, die vor allem mit dem Namen Sigmund Freud verbunden sind, nämlich die „Psychoanalyse“, ist zugleich ein ausgesprochen komplexes und heterogenes erfahrungswissenschaftliches Theoriegebilde, eine Forschungsmethode, eine medizinische Disziplin und eine therapeutische Methode, die sich – ihrem Selbstverständnis zufolge – einem Notstand der klinischen Praxis verdankt. An diesen Punkt muss zunächst einmal erinnert werden. Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr und mehr naturwissenschaftlich ausgerichtete Medizin war vornehmlich bezüglich der sog. „Geistesund Gemütskrankheiten“ auf – wie es den Anschein hatte: prinzipielle – Schwierigkeiten gestoßen, die sowohl die Ätiologie als auch die Therapie des sog. „Irrsinns“ betrafen und das Lebenswerk von Sigmund Freud stellte, wie Mahrenholz und Porath [Kelsen] gezeigt haben, den Versuch einer Lösung dieser einstigen klassischen Problemlage der modernen Medizin dar, welche sich offensichtlich seinerzeit in einer echten „Paradigmakrise“ befand.186 auffälligen“ Verhaltensmustern scheinen die meisten von Freud beschriebenen Formen psychopathologischen Alltagshandelns zu liegen. 186 Ich beziehe mich hier auf ein Arbeitspapier, welches Porath 1985 für einen Vortrag im „Wiener Kolloquium“ ausgearbeitet hat, den er seinerzeit mit dem damaligen Stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesverfassungsgerichts Mahrenholz über den Rechtswissenschaftler Hans Kelsen gehalten hat. 227 Von Anbeginn an war deshalb auch diese Psychoanalyse als ein neuer streng naturwissenschaftlich orientierter Forschungsansatz im Rahmen der klassischen Medizin erstens mit den somatisch zwar auffälligen, jedoch somatisch-ätiologisch nicht zureichend erfassbaren Krankheiten und zweitens mit den Mentalerkrankungen, d.h. mit den irrationalen Verhaltensmustern, konfrontiert bzw. mit klinisch auffälligen Syndromen konfrontiert, die jedoch – das galt vornehmlich für die sog. „Hysterien“ –, weil sie keine eindeutige somatische Grundlage zu haben schienen, gar nicht als „krankhaft“ diagnostiziert wurden. Beginnen wir mit einer prima facie etwas paradox anmutenden Frage: Was genau in einem genuin soziologischen Sinne ist eigentlich die Psychoanalyse? Makrosoziologisch ist die Psychoanalyse, da sie den wesentlich therapeutisch ausgerichteten Institutionen zugehört, ein Teilsystem der Systeme der sozialen Kontrolle unserer Gesellschaft und hat, wie alle diese Systeme, eine wesentlich konfliktregulative Aufgabe, die sich auf ganz bestimmte Devianzformen bezieht. Ihrer Entstehungsgeschichte zufolge ist sie dasjenige Teilsystem derjenigen therapeutisch funktionierenden Systeme der sozialen Kontrolle, welches die Funktion hat, konfliktregulativ auf die genuin irrationalen Formen der Devianz zu reagieren.187 Die Psychoanalyse ist aus diesem Grund als ein Teilsystem der medizinischen Systeme der sozialen Kontrolle dasjenige Institut, welches von Anbeginn an für die psychopathologischen Erscheinungsformen abweichenden sozialen Verhaltens zuständig war. Mikrosoziologisch hingegen haben wir es, sobald wir es mit dem therapeutischen Medium der Psychoanalyse schlechthin, dem Gespräch, befassen, geradezu mit einer klassischen minimalen sozialen Situation zu tun, welche konstitutiv in die überkommenen Formen traditionellen medizinischen Handelns „hineinpasst“. Wir sprechen hier von denjenigen psychiatrischen Grundsituationen, die gemeinhin als das „Vertrauensverhältnis“ zwischen „Arzt und Patient“ genannt zu werden pflegen. So ist die Psychoanalyse zuallererst einmal eine neue verhaltenstherapeutische Methode, welche die therapeutische Funktion des „Gesprächs“ ins Zentrum der Aufmerksamkeit medizinischen Denkens und Handelns gerückt hat, zugleich jedoch war sie für das Medium 187 Nämlich auf solche, die sich dem damaligen „normalen“ juristischen wie medizinischen Verständnis verschlossen. Dass ein von starkem Wundfieber Befallener sich halluzinatorisch abweichend verhält, ist und war auch der damaligen bürgerlichen Welt völlig verständlich, das mörderische Verhalten Woyzeks jedoch beschäftigte seinerzeit eine ganze Reihe von Juristen wie medizinischen Sachverständigen. 228 des „Gesprächs“ von Anfang an auch eine neue (humanwissenschaftliche) Forschungsmethode und eine mit dem Verhalten der menschlichen Individuen befasste erfahrungswissenschaftliche Theorie, welche der Institution „Psychologie“ zugeordnet werden muss. Ausdrücklich hat Freud darauf bestanden, dass genau diese „Theorie“, die er als „Metapsychologie“ verstanden wissen wollte, als systematischer Beitrag zur psychiatrischen Grundlagenforschung aufgefasst werden müsste. In dieser Eigenschaft interessiert sie uns an dieser Stelle zunächst einmal, weshalb wir nunmehr versuchen, einige ihrer vornehmlich in dieser Beziehung interessanten Grund- bzw. Fundamentalannahmen aufzulisten. Den bisherigen Ergebnissen der Forschungsgruppe Dossenheim zufolge sind das die folgenden vier, die ich anschließend benenne und zugleich auf meine bisherigen Arbeitsergebnisse zu beziehen versuchen werde: 1. Die erste Fundamentalannahme der Psychoanalyse betrifft den Tatbestand, dass es so etwas wie „das Unbewusste“ überhaupt gibt: Analysiert man ausschließlich die kognitiv-evaluative Dimension des Sozialisationsprozesses, dann wird das Internalisierungsgeschehen, welches die kulturspezifischen Werte und Ideen von Sozialmilieus ganz allgemein betrifft, von denen wir annehmen, sie würden Handlungsrelevanz erlangen, nur unzulänglich erfasst. Und dies aus dem ganz einfachen Grund, weil sie im späteren Leben eines Menschen bewusst gar nicht mehr in Erscheinung treten. Es besteht also die Gefahr, das die Enkulturationsdimension von Sozialisationsvorgängen, welche die primordiale Vermittlung bestimmter Werte und Ideen betrifft, ganz allgemein viel zu sehr ins Hintertreffen gerät. Wie auch immer. Ohne die Grundannahme, es gäbe „Unbewusstes“, gelingt es der psychoanalytischen Auffassung zufolge nicht, jene irrationalen Formen devianten Verhaltens ätiologisch in befriedigender Weise zu deuten, die dem neurotischen bzw. dem psychosomatischen oder aber dem psychotischen Formenkreis individuellen Verhaltens zugerechnet zu werden pflegen. Streng genommen ist in dieser Beziehung die Webersche Kategorienlehre methodologisch unterbestimmt – wohlgemerkt: das ist nur aus dieser Perspektive der Fall – so dass sie in folgender Weise der tiefenpsychologischen – oder, wie Freud selbst sagt: der „metapsychologischen“ – Ergänzung bedarf: Die wichtigsten seelischen Vorgänge, die Vorgänge mithin, die eigentlich das Handeln von Menschen steuern – und so eben auch deren jeweilige 229 unverwechselbare Identität konstituieren –, sind die unbewussten Vorgänge.188 Soll also eine ganz bestimmte Handlung eines ganz bestimmten Menschen in einer ganz bestimmten Situation wirklich adäquat gedeutet werden, dann muss nach denjenigen Vorgängen im Seelenleben dieses Menschen gesucht werden, die diesem Menschen selbst gerade nicht bewusst sind. Dies hat Konsequenzen: Ein Mensch, welcher nach den Gründen seines Verhaltens gefragt wird, wird diese Frage in der Regel nicht in strengem Sinne kausalanalytisch zu beantworten in der Lage sein. Er wird, wie es umgangssprachlich so schön heißt, zu nachträglichen Rationalisierungen tendieren, indem er die Gründe seines Verhaltens benennt, um so sein Verhalten vor sich und den anderen rechtfertigen zu können. Und dies nicht deshalb weil er eine echte Kausalanalyse seines Verhaltens nicht leisten will, sondern deshalb, weil er dies nicht kann. Immer erscheint aus diesem Blickwinkel die eigentlich interessante Kausalfrage als ein Legitimationsproblem. Die psychoanalytische Ergänzung der sog. „Verstehenden Soziologie“ geht, wie unschwer zu sehen, sehr viel weiter als es z.B. die kognitiven Lerntheorien tun würden: Prinzipiell kann ein Mensch niemals die richtige Auskunft bezüglich seines Handelns geben, weil ihm die wirklichen seelischen Gründe dafür gar nicht bewusst sein können. Gewiss ist „Seelisches“ auch das, was Menschen denken, sich vorstellen, fühlen, wünschen oder auch wollen. Aber: Das, was Menschen offen über ihre Wünsche, Gefühle, Imaginationen und Gedanken sagen (können) ist auf gar keinen Fall dasselbe wie das, was sie in ihrem Unbewussten wirklich „denken“, „sich vorstellen“, „fühlen“, „wünschen“ oder „wollen“, woraus logisch folgt: Es gibt unbewusstes Denken, Imaginieren, Fühlen, Wünschen, Wollen, welches sich immer so oder so auf das jeweilige rationale soziale Handeln auswirkt. Gibt es aber deshalb auch zweierlei Methoden der Identitätskonstruktion? So gefasst doch offenkundig nicht. Und während das entscheidende Problem für die konsequent naturwissenschaftlich ausgerichtete psychoanalytische Forschung selbst zunächst einmal darin besteht, dieses „Unbewusste“ als einen real existierenden Bereich auch nachzuweisen, besteht für die psychiatrie-relevante Sozialisationsforschung das gravierende Problem darin, das Wechselwirkungsverhältnis 188 zwischen den Später wenn wir das Tafelbild 3 („Irrationalität“) interpretieren, werden wir diese Aussage umformulieren müssen: Unbewusste Vorgänge sind diejenigen seelischen Vorgänge, die das subjektiv sinnhafte Verhalten eines Individuums mehr oder weniger stark beeinträchtigen. Ob sie tatsächlich die wichtigsten bzw. die das subjektiv sinnvolle Handeln bestimmenden sind, wie es die Psychoanalyse behauptet, können wir dabei getrost dahingestellt sein lassen. Hier zeigt sich jedenfalls, welche argumentativen Konsequenzen es hat, wenn man die hier aufgeworfene Thematik konsequent aus dem Blickwinkel der „Soziologie“ zu betrachten versucht. 230 handlungstheoretisch fassbaren kognitiven Umorientierungen und der Dynamik der unbewusst verlaufenen Lern- und Denkvorgänge aufzuzeigen. Dies jedoch geht aus offenkundig methodischen Gründen nur, wenn man die eventuellen „Impulse aus dem Unbewussten“ als Störungen des Kognitivgeschehens interpretiert. Oder anders noch formuliert: Unbewusstes beeinträchtigt Kognitives. 2. Die zweite Fundamentalnahme der Psychoanalyse betrifft die Homogenität des Kausalgeschehens für jedwede Form abweichenden wie konformen Handelns und Verhaltens: In der Verursachung nicht nur der Nerven-, Gemüts- und Geisteskrankheiten spielen diejenigen Triebregungen, welche man nur als sexuelle (dies sowohl im engeren wie im weiteren Sinne) bezeichnen kann, eine schlechterdings ausschlaggebende Rolle. Diese sexuellen Triebregungen sind es auch, die den eigentlichen Nährboden für die höchsten kulturellen (künstlerischen bzw. wissenschaftlichen) wie sozialen Leistungen des Menschengeistes bilden. Sexuell „eingefärbte“ Wünsche, Gedanken, Phantasien, welche ihren Ursprung im Unbewussten haben, sind es, die gleichermaßen neurotisch Kranke wie charismatisch Geniale in ihrem sozialrelevanten Verhalten ausmachen. Oder anders formuliert: Neurosen und Psychosen sind die differenzialdiagnostischen Erscheinungsformen für Außeralltäglichkeit in jeder Form, denn Außeralltäglichkeit wird nun einmal seitens der sozialen Mitwelt, wenn sie diese nicht bewundert, immer verrechnet als „Irrationalität“. 3. Die dritte Fundamentalannahme der Psychoanalyse betrifft die Gewichtung primordialer Wahrnehmungs-, Erfahrungs- und Lernprozesse für die sog. „Persönlichkeitsentwicklung“. Und genau diese Fundamentalannahme ist nun von kaum überschätzbarer Bedeutung für unseren Versuch, mittels der Aufdeckung der Wurzeln der kognitiven Dynamik subjektiv sinnhaften sozialen Verhaltens zugleich auch die eingangs bereits vorgestellte Kernfrage einer allgemeinen empirisch falsifizierbaren Theorie des Sozialisationsgeschehens zu beantworten. Sie wurde seinerzeit nicht als skandalös empfunden und besagt, dass insbesondere die frühe Kindheit eines Menschen von ausschlaggebender Bedeutung für die spätere Handlungsdynamik sei. Insofern ist sie sogar fast schon eine Trivialität. Erst in Verbindung mit der zweiten Grundannahme erzeugte sie allgemeine Empörung: Der Mensch ist qua organismischer Daseinsform bereits im frühsten Kindesalter ein wesentlich sexuell getriebenes Wesen, welchem erst im Verlaufe vornehmlich der frühkindlichen Phase des Lerngeschehens so etwas wie „Sozialverträglichkeit“ 231 beigebracht wird. Die Sexualität, so argumentierte Freud, erwache keineswegs erst mit der in der Pubertät sich entwickelnden hormonellen Reifung, sie sei vielmehr konstitutives Moment auch und gerade der Reifungsphasen in den ersten Lebensjahren, in denen ganz bestimmte Bereiche des endokrinologischen Systems, wie man damals glaubte, schlichtweg noch gar nicht vorhanden wären: Ebenso wie die Kompetenz sprechen zu können, nicht gelernt werden muss, ebenso muss der menschliche Organismus die Sexualität als solche nicht lernen. Sie ist, wenn mir diese Wortschöpfung erlaubt ist, primartriebstrukturell. Lernen muss das Kind allerdings – und genau hier liegt natürlich die Bedeutsamkeit der Psychoanalyse für die (mögliche) Konstruktion einer Theorie des Sozialisationsgeschehens –, die Voluptativstrukturen, die sein primartriebstrukturelles Motivgeschehen ausmachen, in ein sozial überlebensfähiges Verhältnis zu bringen, sie in „Einklang“ zu bringen mit den komplexen Erfordernissen der externen Realität. Dem sog. „Ich“ kommt ja bekanntlich in den späteren Phasen der Verhaltensdynamik eines Individuums genau diese Funktion zu: Lernen muss ein sozial handlungskompetenter Organismus im Zuge seiner „Ich-Werdung“ zusammen mit der „Beherrschung“ seines Triebgeschehens die Ausbildung eines „mit sich identischen Selbst“, welches in den nachfolgenden Stadien des Sozialisationsprozesses in der Lage ist, situationsadäquat und in genau diesem Sinne rational zu handeln. Und genau dafür muss ein solches menschliches Individuum eben die Methode beherrschen, in beliebigen Konfliktlagen und angesichts noch so komplex erscheinender „Realitäts- und Rollenzumutungen“ jederzeit seine Identität neu konstruieren zu können. Die „sozialverträgliche Handhabung“ der Sexualität ist so eine Funktion des Erwerbs derjenigen Kompetenzen, die in den primordialen Sozialisations- und Enkulturationsphasen eines menschlichen Lebens ihr Fundament haben. Und es ist aus diesem Blickwinkel ja sonnenklar, dass und inwiefern die sozialstrukturelle Beschaffenheit der familialen Mitwelt eines Kleinkindes von entscheidender Bedeutung ist, womit wir wiederum bei der Soziologie wären. 4. Es gibt noch eine vierte Fundamentalannahme der Psychoanalyse, die im Hinblick auf die moralphilosophischen Grundlagen pädagogischen Denkens letztendlich mindestens genauso skandalös ist wie die anderen der bereits genannten, die jedoch in diesem Umfang bzw. in diesem Ausmaß zunächst einmal nicht als skandalös empfunden worden ist. Es handelt sich dabei um die psychoanalytische Leitregel des methodologischen Determinismus. Freud selbst spricht in seinen „Vorlesungen zur 232 Einführung in die Psychoanalyse“ in diesem Zusammenhang von der „Illusion“ der psychischen Freiheit (S.70) und nennt diese (S.121) den „tief wurzelnden Glauben an psychische Freiheit und Willkürlichkeit ...., der aber ganz unwissenschaftlich [sei] und der vor der Anforderung eines auch das Seelenleben beherrschenden Determinismus die Segel streichen“ müsse. Mit genau dieser „Leitregel“ haben wir dann unsere liebe Not, sieht sie doch im diametralen Gegensatz zum Handlungskonzept, welches ja gerade die Fähigkeit zur freien Entscheidung bei gegebenen Wahlalternativen postuliert, ja postulieren muss, wie wir angesichts der weiter unten zu behandelnden „Rationalitätskataloge“ sehen werden. Unschwer ist zu sehen, dass aus diesem Blickwinkel unser gesamter Ansatz ebenso vom Kollaps in den Selbstwiderspruch bedroht ist, wie ich ihn eingangs dem Resch’schen „Lehrbuch“ vorgerechnet habe. Halten wir zunächst einmal diejenige zentrale These der Psychoanalyse fest, die wir für den Aufbau einer psychiatrisch interessanten Sozialisationstheorie dringlichst benötigen: Die unbewussten Vorgänge, welche, da sie die Tiefendimension des Verhaltens ausmachen, das subjektiv sinnhafte und damit das zumindest der Möglichkeit nach rationale Sozialverhalten „störend“ bzw. „verstörend“ beeinflussen, sind die, sozusagen die gegenwärtigen Bewusstseinsvorgänge, das Wahrnehmungsgeschehen wie auch die sichtbare Handlungsdynamik „einrahmen“, „einfärben“, „steuern“. Sie stammen aus der Entwicklungsphase der Persönlichkeitsstruktur, in welcher sie die einzige Art von seelischen Vorgängen waren: aus der Phase der frühsten Kindheit. Da die Psychoanalyse – zumindest ihrem Anspruch zufolge – so einen Kausalzusammenhang postuliert zwischen den Erlebnis- und Erfahrungsgehalten eines einstmals sehr wohl zu subjektiv sinnhaftem Sichverhalten disponierten Individuums in der frühen Kindheit und dessen tatsächlicher hic et nunc beobachtbarer pathologischer Verhaltensdynamik, verfügt sie virtuell über die methodischen Instrumente, die erforderlich sind, um pathogenetische Vorgänge in einer – zumindest im Prinzip möglichen – empirisch überprüfbaren Art und Weise rekonstruieren zu können. Dezidiert bezieht sich nämlich die Psychoanalyse auf die (möglichen) Wurzeln subjektiv sinnhaften (sozialen) Handelns und gestattet so u.U. Einblicke in jene ausgesprochen schlechten „Startbedingungen“ in der primordialen Sozialisationsphase eines menschlichen Wesens, die dessen (gegenwärtige pathologische) kognitive Dynamik geprägt haben könnten. Sie lieferte so ja vielleicht auch ganz bestimmte Erklärungen dafür – wäre mithin also auch sozusagen „ätiologisch kompetent“ –, dass bei ganz bestimmten 233 Individuen mit ganz bestimmten problematischen Startbedingungen ganz bestimmte Formen von Identitätskrisen mehr und mehr maligne Gestalt annehmen mussten und folglich sodann auch dergestalt in ganz bestimmte identitätskritische Dauerzustände übergegangen sind, das über kurz oder lang eben auch die ursprünglich durchaus auf Rationalität hin angelegt gewesene Kognitivdynamik des Handelns dieses Menschen erodierte. 7. Devianzformen – Eine fundamentale Differenzierung 7.1. Das Kriterium der (gegenwärtigen) Moral- und Rechtsordnung und die Formen der Devianz Es müsse, so hatte ich in der Einleitung hervorgehoben, in der hier vorgelegten Arbeit darum gehen, die Begriffe „Identitätskrisen“, „Devianz“ und „soziale Kontrolle“ in ihrem Bedeutungsgehalt so zu explizieren, dass sich dabei ein Erklärungsmodell ergibt, aus dem sich empirisch überprüfbare Hypothesen ableiten lassen. Ein solches Modell habe, so wurde ausgeführt, zunächst einmal und vor allem eine Differenzierung abweichenden sozialen Verhaltens zu leisten. Gelänge es nämlich, den Bedeutungsgehalt der Begriffe „Identitätskrise“, „Devianz“ und „soziale Kontrolle“ dergestalt präzise aufzuklären, dass sich ein Erklärungsmodell für klinisch auffälliges abweichendes soziales Verhalten ergibt, dann müsste sich – aus diesem Blickwinkel – im Hinblick auf die Ätiologie der sog. „Geistes- und Gemütskrankheiten“ eine verbesserte Diagnostik und, bezogen auf diese, sodann auch eine verbesserte therapeutische Methode ergeben. Bereits aus dieser noch relativ abstrakt und allgemein gehaltenen Skizzierung der Problemlage ergibt sich, was vor allem ein solches Modell zu leisten hätte: eine zumindest ungefähre Charakterisierung psychiatrisch-therapeutischer Zielvorstellungen. Die damit zusammenhängenden Fragen sollen zumindest ansatzweise in den folgenden Abschnitten dieser Arbeit geklärt werden. Differenzierung heißt zunächst einmal Klassifizierung. Weiter unten, wo ich die Methode der idealtypologischen Konstruktion soweit wie möglich anschaulich machen werde, wird sich dann zeigen, dass klassifikatorische Begriffskonstruktionen nur dann auch eine hinreichend große Aussagekraft besitzen, wenn komparative Hypothesen formuliert werden können, 234 mittels derer sich die klassifikatorischen Kriterien genauer bestimmten lassen.189 Die in diesem Zusammenhang zu diskutierenden begriffstheoretischen Probleme sind nicht ganz einfach zu lösen. Das liegt daran, dass eine therapierelevante Symptomatologie genaue klassifikatorische Zuordnungsprinzipien benötigt, dass jedoch die eigentliche theoretische Grundlage für die Konstruktion klassifikatorischer Systeme immer in einer erklärungskompetenten Theorie verankert ist, welche operative Begrifflichkeiten benötigt. Entgegen weitverbreiteter Auffassung ist nämlich die Webersche „Idealtypologie“ keineswegs so klar, dass man sich ihrer ganz einfach bedienen könnte. Interessanterweise sind diejenigen Probleme, die bereits Max Weber zur vollen Zufriedenheit nicht hatte lösen können, auch in der neueren Wissenschaftslehre noch weitgehend ungeklärt. An dieser Stelle jedoch geht es zunächst einmal ausschließlich um die klassifikatorische Präsentation. In den nachstehenden Abschnitten werden wir sodann die bereits in diesem Abschnitt angeschnittenen Problembereiche noch wesentlich genauer analysieren. Der besseren Übersicht halber liste ich jedoch bereits an dieser Stelle diese Problembereiche schlagwortartig auf: 1. Das Begriffspaar „rational-irrational“, welches sich idealtypisch auf das sog. „Normal-Ich“ anwenden lassen muss, liefert zugleich die analytischen Möglichkeiten für eine systematische Zerlegung von Verhaltensmodifikationen, die deren kognitiven Bereich betreffen: Das „Normal-Ich“ ist ausgestattet – dies allerdings nur dann, wenn es die Hürden der primordialen Sozialisation erfolgreich genommen hat – mit Rollendistanzkompetenz, kommunikativer Kompetenz, sowie der Fähigkeit zu subjektiv sinnhaften Handeln, was immer die Fähigkeit einschließt, angesichts stets neu sich stellender positionaler Zumutungen sowie der damit vrbundenen Rollenerwartungen stets neu erforderlich werdende Identitätskonstruktionen bewerkstelligen zu können. Die sog. Interaktivkompetenz, das ist die Kompetenz zur virtuellen Rollenübernahme auch dann, wenn die Dimensionen der kommunikativen 189 Die Komparativierung von Begriffen, die der Deskription dienen, ist unabdingbares Erfordernis für die Bildung von empirisch gehaltvollen Hypothesen, welche ja explanativ zur Verwendung gelangen sollen: Eigenschaftszuschreibungen, wie z.B. die „kommunikative Kompetenz“, müssen komparativ abstufbar gemacht werden können, sollen Korrelationen bzw. kausalhypothetisch interpretierbare Korrelationen formulierbar sein. Bei solchen muss dann z.B. der Begriff der kommunikativen Kompetenz in einen operativen Begriff (ich benutze hier die Homans’sche Terminologie) umgewandelt werden können. Wie wir vor allem in Abschnitt II. 8. anhand des Begriffspaares „rational-irrational“ sehen werden, lassen sich nur so die Übergänge von den „bloßen Definitionen“ zu den empirisch falsifizierbaren Hypothesen bewältigen. Wie sich zeigen wird, wird nur so auch die Webersche Idealtypologie eigentlich als ein wirklich brauchbares Erkenntnisinstrument verständlich. 235 Kompetenz massiv eingeschränkt sind, darf uns selbstverständlich nur am Rande interessieren, da sich hierbei eine sehr spezielle und deshalb schwierig zu bewältigende Kasuistik von sozialstrukturellen Zusammenhängen ergibt.190 2. Makrosoziologisch haben wir uns hier mit dem derzeitig geltenden Moral- und Rechtssystem zu befassen, denn in dieses „eingebunden“ sind die beiden wichtigsten Systeme der sozialen Kontrolle, die sich selbst wiederum in mannigfaltige Teil- und Untersysteme zerlegen. Diesen geht es ja nicht nur um Bewahrung bestimmter kultureller Werte, sondern auch und gerade um deren Realisation. „Mündigkeit“, „Ich-Stärke“, „Selbstverantwortung“ etc. werden ja nicht nur seitens einer mehr oder weniger unverbindlichen Ethik postuliert, vielmehr handelt es sich dabei um personalkonfigurative Werte, welche zu den Systemzielen unseres gegenwärtig geltenden Moral- und Rechtssystems zählen und deren Realisation der endogenen Dynamik z.B. von Strafjustiz und Psychiatrie überantwortet wird: Ihre Realisation ist auf gar keinen Fall lediglich fakultativ. In genau diesem Sinne sind die „Funktionäre“ genau dieser beiden Systeme der sozialen Kontrolle aufgrund der ihnen qua Position zugeschriebenen Rollen angehalten, sich streng wertrational zu verhalten: Den familialen Funktionären unserer Sozialisationsagenturen (sog. „Eltern“) obliegt, da vor allen in ihren Hände die Enkulturationsvorgänge gelegt sind, die Internalisierung der in unserer Gesellschaftsordnung herrschenden Kulturwerte der „Mündigkeit“ und der „Selbstverantwortung“ etc. Den justiziären Funktionären (sog. „Organe der Rechtspflege“) obliegt die doppelte Aufgabe des „Gemeinschaftsschutzes“ sowie der „Re-Integration“ bzw. der „Re-Sozialisation“ delinquentgewordener Agenten unseres Gemeinwesens und den „Gesundheitsfunktionären“, die sich grob in die Teilgruppe der für somatische Leiden 190 Das Beispiel der arbeitsproduktiven Integration der sog. „Gastarbeiter“ vornehmlich in den 60er und 70er Jahren in der damaligen BRD, zeigt schlagend, dass aus den Funktionalerforderlichkeiten der seinerzeitigen Fabrikarbeit ganz bestimmte, nämlich „interaktivkompetente“ Rollenanforderungen vorgegeben waren, denen seitens „unserer“ Gastarbeiter natürlich genügt werden musste: Die in den damaligen deutschen Produktionsprozess integrierten Arbeitskräfte, die aus den Ländern mit sehr unterschiedlicher Kultur und Sprache rekrutiert worden waren, mussten natürlich insofern „interaktiv kompetent“ sein, als sie ganz sicher über die Fähigkeit zu subjektiv sinnvollen sozialen Handeln verfügten. In Bezug auf den damaligen westdeutschen „Sozial- und Lebensraum“ waren sie gleichwohl bezüglich ihrer kommunikativen Kompetenz restringiert, brauchten sie doch bekanntlich noch nicht einmal der deutschen Umgangssprache mächtig zu sein. Das änderte sich freilich, als mit zunehmender Automatisierung der Produktionsroutinen sich auch die Anforderungen des Leistungsniveaus erhöhten: Wer „Einrichter“ oder gar Ingenieur werden wollte, musste für die hierfür erforderlichen Schulungskurse naturgemäß auch über entsprechende Deutschkenntnisse verfügen, war also gezwungen das Niveau seiner kommunikativen Kompetenz zu erhöhen. Interessanterweise wurde gleichwohl bei Auftreten von „Delinquenz“ eine „Vollverantwortlichkeit“ postuliert, welche dem Delinquenten entsprechende kommunikative Fähigkeiten zugestand. Mir kommt es hier lediglich auf die begriffliche Unterscheidung, nicht jedoch auf die dabei ja auch involvierten Zusammenhänge zwischen „Interkulturalität“ und kommunikativer Kompetenz an. 236 Zuständigen und in die Teilgruppe der für Mentalerkrankungen Zuständigen zerlegen lässt, obliegt die Sorge für das Kulturgut „geistige und körperliche Gesundheit“. Vor allem die zweite Teilgruppe unserer „Gesundheitsfunktionäre“ hat es mit denjenigen Formen der „Devianz“ zu tun, bei denen die „Rationalitätskompetenz“ massiv beeinträchtigt ist. 3. Selbstverständlich bildet das, was wir hier grob die „gegenwärtige Moral- und Rechtsordnung“ genannt haben, kein in sich logisch kohärentes System von Werten, Ideen, Normen, und Rollenerwartungen mit entsprechender Verbindlichkeitsverpflichtung für alle Mitglieder dieser Gesellschaftsordnung. Dazu sind sie ganz einfach in sich viel zu heterogen und überdies ändern sich ja auch fortlaufend die jeweiligen „Akzentuierungen und Gewichte“ unserer Ideen und Werte nach Maßgabe differenzierter Sozial- und Kulturmilieus: sie sind eben kulturell differenziert und historisch variabel. Dennoch – und darauf kommt es mir hier wesentlich an – lässt sich zweifelsohne, was die Sozialisationszielvorgaben anbetrifft, die praktisch alle im Rahmen unserer Rechtsordnung wirkenden Sozialisationsagenturen zu beachten normativ verpflichtet sind, zumindest so etwas wie einen „gemeinsamen Nenner“ ausmachen, auf den sich die allen unseren Sozialisationsagenturen und Systemen der sozialen Kontrolle gemeinsamen Legitimationshintergründe bringen lassen. Nur darauf kommt es mir an dieser Stelle an. 4. Strafjustiz und Psychiatrie sind die uns hier am meisten interessierenden Systeme der sozialen Kontrolle. Sie reagieren, so hatten wir gesagt, konfliktregulativ auf ein naturwüchsig stets sich neu bildendes Universum von Devianzen. Und es muss uns selbstverständlich in ganz besonderem Maße interessieren, wie sie das tun und welcher wissenschaftlicher Hilfsmittel sie sich dabei bedienen. Jedenfalls haben wir es in diesem Zusammenhang grob umschrieben zum einen mit einem Resozialisierungsauftrag, zum anderen mit einem Therapieauftrag zu tun, eine Begrifflichkeit, die ja bereits von sich aus auf bestimmte Techniken der Handlungs- und Verhaltensevaluation hindeutet.191 191 Die in der modernen Industriegesellschaft „verbandsmäßig“ organisierten Rechts- und Moralsysteme sind die Bildnerinnen von Kulturwerten und sie fungieren in diesem Sinne als Systeme der sozialen Kontrolle und als Sozialisationsagenturen sowie als Re-Sozialisationsagenturen. Allen Systemen der sozialen Kontrolle obliegt so die Realisation bestimmter Kulturwerte, was selbstverständlich auch für dasjenige System der sozialen Kontrolle gilt, welches „Familie“ genannt zu werden pflegt und welches sozusagen als primäre Sozialisationsagentur fungiert. Primär deshalb, weil dieser Agentur die Realisation des Wertes „Individuum“ obliegt, ein „Wert“, welcher sozusagen das „Material“ für die anderen Sozialisationsagenturen wie für die „regulierenden“ Systeme der sozialen Kontrolle abgibt. Die „Familie“ stellt diesen Wert her und macht ihn den anderen Systemen der sozialen Kontrolle verfügbar. 237 Dies sozusagen eine „Vorausschau“ auf die nachfolgenden Argumentationsschritte. In diesem Abschnitt jedoch geht es mir zunächst einmal, wie bereits gesagt, um bloße Klassifikation. Grob lassen sich die Formen abweichenden sozialen Verhaltens soziologisch in zwei große Teilklassen zerlegen, deren „Behandlung“ in den Kompetenzbereich von genau zwei komplexen und (in unserer Gesellschaft) perfekt durchorganisierten Systemen der sozialen Kontrolle fällt: a) delinquentes Verhalten, welches in den Kompetenzbereich der justiziären Systeme der sozialen Kontrolle in „unserer“ Gesellschaft und b) klinisch auffälliges Verhalten bzw. „krankhaftes“ Verhalten, welches in den Kompetenzbereich der klinisch-fürsorgerischen Systeme der sozialen Kontrolle in „unserer“ Gesellschaft fällt Nach meinem Dafürhalten ist diese auf den ersten Blick eigentlich recht triviale Unterscheidung seitens der psychiatrischen Fachliteratur viel zu sehr vernachlässigt worden, ist sie doch bei genauerem Hinsehen alles andere als trivial. Wird nämlich der seitens unserer großen sozialstrukturell dominierenden Systeme der sozialen Kontrolle öffentlich – das genau heißt: politisch – definierte „Therapieauftrag“ unserer klinischen Institutionen zu sehr in den Hintergrund gerückt, dann werden auch die normativ definierten Kriterien für das sog. „normale Verhalten“ zu sehr abgeschattet und es wird sodann auch der folgende Zusammenhang zu sehr vernachlässigt: Unsere derzeitig geltende Moral- und Rechtsordnung, die, nebenbei gesagt, völlig unabhängig von dem „Verhalten“ der innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches stehenden Agenten als ein objektiv bestehendes Normen- und Wertgefüge, wie es so schön heißt, „in Geltung ist“, ermöglicht eine sehr präzise Festlegung des Begriffs der „Mündigkeit“ – nämlich in Gestalt des Begriffs der „Strafmündigkeit“ –, und dieser Tatbestand wird wiederum getreulich widergespiegelt zum einen mittels des soziologischen Fachterms des sozialen Handelns, zum anderen mittels des psychologischen Fachterms der Ich-Stärke, wodurch immerhin so etwas wie ein erster Zugang eröffnet wird zu dem bekanntermaßen ausgesprochen prekären Problem einer scharfen Unterscheidbarkeit zwischen den rationalen und den im eigentlichen Sinne irrationalen Formen des abweichenden Verhaltens: Der Begriff der „Ich-Stärke“, hier zunächst einmal arbeitsdefinitorisch gefasst als die „Kompetenz eines Individuums, die in seinem (bisherigen) Sozialisationsprozess angehäuften, mithin also (gegenwärtig bewusst oder unbewusst) mental 238 repräsentierten gesellschaftlichen Anforderungen mit den je eigenen Triebansprüchen realitätsadäquat und handlungsrelevant in Einklang zu bringen“, der sich ja problemlos komparativ fassen lässt, designiert je spezifische Funktionsmöglichkeiten bzw. „Ausprägungsgrade“ realitätsadäquater Handlungsmuster von personalen Systemen. Justiziäre Re-Sozialisierungsmaßnahmen müssen sich ebenso wie alle pädagogischen Institutionen unserer Gesellschaft („Sozialisationsagenturen“) oder aber eben auch der therapeutische „Eingriff“ in bestimmte Lebensverläufe an diesem „Leitwert“ für soziales Verhalten in ihrem jeweiligen praktischen Prozedere orientieren. Bezogen auf die Webersche Theorie des sozialen Handelns, lässt sich mithin das folgende Anschauungsmodell konstruieren, jedoch ist dabei mitzubedenken, dass ein solches „Modell“ zunächst einmal lediglich eine klassifikatorische Bedeutung hat: Soziales Handeln Konformes Handeln/Verhalten A bw eichendes Handeln/Verhalten P olitische Devianz Delinquenz Verw ahrlosungsdevianz Innovation Pathologische Devianz Tafelbild 2 Erläuterung: Wir richten in dieser Arbeit unseren Blick vor allem auf das abweichende soziale Handeln und nicht auf das konforme soziale Handeln. Es muss jedoch darauf aufmerksam gemacht werden, dass es ja auch konforme Formen des Verhaltens gibt, die psychiatrisch interessant sind oder sein können.192 Darüber hinaus unterscheiden wir an dieser Stelle ganz bewusst nicht zwischen „Handeln“ und „Verhalten“. 192 Auf diese hat expressis verbis Kraus aufmerksam gemacht und so rollentheoretisch eine Symptomatologie zu entwerfen versucht, die es gestattet, zwischen manisch-depressiven und psychotischen Verhaltensmustern zu unterscheiden: Der Psychotiker tendiere zu realitätsfugativ-rollendiffundierenden Verhaltensmustern, der 239 Es handelt sich hier noch um ein sehr grobes Schema. Streng genommen müsste man, wenn man konsequent handlungssoziologisch vorgehen wollte, außer der bereits erwähnten Delinquenz sowie der pathologischen Devianz noch mindestens drei weitere Formen abweichenden Sozialverhaltens unterscheiden: die innovatorische Devianz, die „Verwahrlosungsdevianz“ und die politische Devianz. Auch und gerade aus dem Blickwinkel einer streng soziologischen Betrachtungsweise vermeintlich genuin psychiatrisch auffälliger Probleme müsste eigentlich sehr viel genauer auf diese Formen der Devianz eingegangen werden, als dies hier geschehen kann. An dieser Stelle nur soviel dazu: Genuin politische Formen abweichenden Verhaltens, für deren genaue Analyse vor allem die Weberschen Forschungen zur Herrschaftssoziologie hinzugezogen werden müssten, sind ebenso wie delinquente Formen der Devianz, für deren genaue Analyse vor allem die Weberschen Forschungen zur Rechtssoziologie hinzugezogen werden müssten, Formen des rationalen sozialen Handelns, bei denen die wesentlichen primordial erworbenen „IchQualifikationsfunktionen“ – das gilt vor allem für den Erwerb der bereits weiter oben angesprochenen sog. „kommunikativen Kompetenz“ – erhalten geblieben sind. Allerdings besteht natürlich zwischen Delinquenz und politisch motivierter Verletzung geltender Normen ein Unterschied, der sich auf das Legitimitätsproblem und damit auf die Modalitäten der kulturellen Systeme der makrosoziologisch zu interpretierenden gesellschaftlichen Kontrollmechanismen bezieht: Während der politische Abweichler das den dominierenden Systemen der sozialen Kontrolle zugrundeliegende Wertsystem als solches infrage stellt, tut es der „Delinquenzler“ gerade nicht. Das genau macht den Unterschied zwischen krimineller Aktivität und Widerstand aus: Während der „Widerständler“ darauf hinzielt, Proselyten zu machen, rechnet der Dieb darauf – und muss dies tun! –, dass andere die Eigentumsordnung nicht verletzen. Gemäß dem hier ins Zentrum der Aufmerksamkeit gestellten Kriterium (Orientierung an der gängigen rechtlichen Praxis) gehört das innovative Verhalten weder zum delinquenten noch zum „klinisch auffälligen“ bzw. „krankhaften“ Verhalten. Es handelt sich dabei also aus Manisch-Depressive hingegen mehr zur Rollenüberidentifikation. Unklar bei Kraus bleibt, ob er diese Einsichten als Definitionen oder aber als empirische Hypothesen verstanden wissen will. Zu den rollenfixativen Ritualen vgl. auch das bekannte von Robert Merton [Social Structure] entwickelte Klassifikationsschema zum Anomieproblem: Ritualismus lässt sich rollentheoretisch zum einen mit dem Begriff der „Rollenfixation“, zum anderen mit dem bereits erwähnten Kraus’schen Begriff der „Rollenüberidentifikation“ fassen. Aus psychiatrischer Sicht scheint sich so ein Zusammenhang zu ergeben mit der Symptomatologie der anankistischen Syndrome. 240 dieser Perspektive um eine sog. „Residualkategorie“. Dennoch beansprucht meine Untersuchung eine systematische Verortung genau dieser Form von abweichendem Verhalten, die hier freilich nur unzulänglich geleistet werden kann: Aus der Weberschen „Kategorienlehre“ fällt zunächst einmal die „Innovation“ genannte Devianz heraus, hingegen gewinnt sie systematische Bedeutung, wenn man, wie ich es in der vorliegenden Arbeit versuche, mittels der Forschungsmethode der Psychoanalyse die sozialisationstheoretische Dimension sozialen Handelns herausarbeitet, behauptet diese doch in ihrer zweiten Fundamentalannahme, dass die sexuellen Triebregungen den Nährboden sowohl für die Hauptformen der Mentalerkrankungen als auch für die höchsten geistigen Leistungen der Menschen bilden. Wir sehen bereits hier, dass und inwiefern die psychoanalytische Heuristik theoretisch kompetenter sein muss als die Webersche Kategorienlehre und dies zu zeigen, ist auch der eigentliche Sinn der vorliegenden Arbeit: Identitätskrisen sind die strukturellen Bedingungen der Möglichkeit für das Auftreten von Devianzen jeglicher Art, und wenn es gelingt, eine Sozialisationstheorie zu entwickeln, die es gestattet, Identitätskrisen differenzialdiagnostisch zu kategorisieren, dann müsste es auch möglich sein, die jeweils zu erwartenden Formen der Devianz differenzialdiagnostisch zu behandeln.193 193 Zum Problem der innovatorischen Formen abweichenden sozialen Handelns verweise ich an dieser Stelle auf die Forschungsprogramme meiner Kollegin Dietlinde Michael (Ästhetische Sensibilisierung und Erziehung zur Mündigkeit) und meiner Kollegin Marina Demetriou (Die poetische Konstruktion der Wirklichkeit bei Gottfried Benn. Studie zur kulturgeschichtlichen Signifikanz des sog. „Frühexpressionismus“.) Diese beiden Arbeiten können als „komplementär“ zu dem hier vorgestellten Forschungsprogramm aufgefasst werden. Frau Michael, die sich in diesem Zusammenhang ähnlich, wie ich es tun werde, auf die Gadamersche Idealtypologie des „Gesprächs“ stützt, versucht nachzuweisen, dass eine jegliche auf „Mündigwerdung“ abzielende Pädagogik konstitutiv angewiesen ist auf jene Klasse von „Zeigehandlungen“, die mittels des Terms der „Ästhetischen Sensibilisierung“ zu umschreiben sind. Und Frau Demetriou zeigt an Hand einer texthermeneutischen Analyse der „Morgue-Gedichte“ werkästhetisch auf, wie sich die nicht zuletzt auch berufsbedingte Identitätskrise eines jungen Arztes aus dem bildungsbürgerlichen familialen Umfeld des preußisch-deutschen Kaiserreiches („lutherisch-protestantisches Pfarrhaus“) in Gestalt einer ganz bestimmten „poetischen Konstruktion der Wirklichkeit“, nämlich fragmentarlytrisch, und damit wesentlich innovativ ausgewirkt hat: Die texthermeneutisch als ein kohärentes Ganzes zu interpretierenden „Morgue-Gedichte“ repräsentieren das paradigmatische Belegstück für die Konstruktion eines (fiktiven) sozialen Universums, ein lyrisches Ortsgefüge, „in“ welchem sich der Dichter-Arzt Gottfried Benn in Gestalt „seines“ lyrischen Ichs selbst positional zu situieren versucht hat. Frau Demetriou hat bereits jetzt überzeugend zeigen können, in welchem Umfange nicht nur „poetische Formgestaltungskompetenz“, sondern überdies sogar poetologische Reflexionen – metakommunikative Kompetenzen also – vonnöten sind, wenn der „Wille zur Gestaltung“ sich in benigne und eben nicht in maligne „Wirklichkeitsverarbeitungsprozeduren“ ummünzen soll. Der Lebensverlauf des Gottfried Benn scheint mir, wenn Frau Demetriou’s Thesen sich als tragfähig herausstellen sollten, ein ausgezeichnetes Beispiel für die immer problematische „Gradwanderung“ zwischen au fond „innovativträchtigen“ und „malignen“ Möglichkeiten der Identitätsstabilisierung zu sein: In der Zeit des Nationalsozialismus sind dann ja auch gerade die „Morgue-Gedichte“, die bereits „bei ihrem Erscheinen nicht nur ein für die damalige Zeit ungewöhnliches Aufsehen erregt, sondern überdies exorbitant heftige Abwehrreaktionen hervorgerufen haben“ (M. Demetriou), als besonders krasse Belegstücke „entarteter Kunst“ nicht nur verboten, sondern überdies als Ausgeburten krankhaften Phantasierens perhorresziert worden. Zweifellos also gehörten zur ihrer Zeit insbesondere die „Morgue-Gedichte“ Gottfried Benns zu derjenigen Klasse der von Redlich und Freedmann als 241 Auf ein weiteres Problem, welches das in dieser Arbeit zum Tragen kommende intime Verhältnis von „Methodologie“ und „Inhalt“ (Gegenstandsbereich) betrifft, ist an dieser Stelle zumindest aufmerksam zu machen: Ausgehend von der Weberschen „Begriffslehre des sozialen Handelns“ wird auch die „Theorie der Elementarformen des sozialen Verhaltens“ von G.C. Homans im Hinblick auf ihre Aussagenstruktur nach zwei Gesichtspunkten hin betrachtet werden müssen. Es muss scharf unterschieden werden zwischen „quasiaxiomatisch“ gesetzten Grundannahmen einer theoretischen Konzeption und deren empirisch falsifizierbaren Haupthypothesen. Ein bloß klassifikatorisches Schema repräsentiert diese fundamentale Unterscheidung nur sehr unzulänglich. Die als empirisch falsifizierbare Hypothesen formulierten „Lerngesetze“ des sozialen Verhaltens machen nämlich nur Sinn unter der Prämisse, dass ganz bestimmte und eben nicht falsifizierbare „Grundannahmen“ gelten. Dieses methodologische Instrument – Zerlegung in nicht falsifizierbare Grundannahmen und erklärungskompetente, weil falsifizierbare Hypothesen – benötigen wir, um wichtige Überschneidungen der Weberschen „Begriffslehre“ mit der Homans’schen Theorie der „Elementarformen des sozialen Verhaltens“ herausarbeiten zu können. Sie betreffen vor allem Fragen des Rationalitätsproblems. Die Homans’schen Grundannahmen, sich erklärtermaßen auf Elementarformen des sozialen Verhaltens beziehend, sind nämlich – wie ich meine: bezeichnenderweise – deckungsgleich mit den Grundannahmen der Weberschen „Begriffslehre“. In dieser Beziehung von entscheidender Bedeutung – gemeint ist das Rationalitätsproblem – ist die Homans’sche Grundannahme, die sich auf die Kompetenz eines – im Weberschen Sinne – „mündigen“ Individuums bezieht, Handlungsalternativen wahrnehmen zu können. Floride Formen insbesondere des schizophrenen Formenkreises sind nämlich genau dazu unfähig. Handlungsalternativen kann ein menschliches Individuum dann und nur dann wahrnehmen, wenn es über ein Minimum an Kompetenzen zur Unterscheidung zwischen kommunizierten Inhalten und metakommunikativem Bezug verfügt: Das Spielverhalten des kleinen Kindes mag noch so sehr, wenn eben das Kind sich von „seinem“ Spiel gefangen nehmen lässt, den hier gemeinten „abnorme, subnormale, unerwünschte, inadäquate, unangemessene, unangepasste oder fehlangepasste“ beschriebenen „Verhaltensweisen, deren gemeinsames Kennzeichen es ist, dass sie zu den Normen und Erwartungen des sozialen und kulturellen Systems, dem der Patient angehört, im Widerspruch stehen.“ War aber Gottfried Benn tatsächlich auch „unfähig“, seine „innere und äußere Realität angemessen zu bewältigen und [seine] sozialen Beziehungen konstant und adäquat zu organisieren“? War er tatsächlich außerstande, sich sozial oder sexuell oder im Beruf gemäß den Erwartungen [seiner] Umwelt zu betätigen“? Litt er etwa und „[machte] andere leiden“? Man sieht zweifelsohne das Problem, um das es hier geht. Ich werde noch ausgiebig hierauf zurückkommen. Die Zitate an dieser Stelle alle aus dem „Redlich-Freedman“. 242 Unterschied verwischen. Lernt das Kind aber den Unterschied tatsächlich irgendwann nicht, dann ergibt sich sozusagen eine Einbahnstrasse zu den genuin malignen Identitätskrisen. 194 Das Schema orientiert sich, weil es zunächst einmal nicht „psychiatrisch“ sondern streng soziologisch „gebaut“ ist, an der gängigen rechtlichen Praxis, das bedeutet: Wird ein Individuum in der Form sozial auffällig, d. h. verhält es sich in der Form abweichend, dass seitens unserer Systeme der sozialen Kontrolle der Verdacht ausgesprochen wird, es liege eine Straftat vor, dann muss als erstes geklärt werden, ob das Individuum schuldhaft gehandelt hat oder nicht. Um dies zu können, muss die Schuldhaftigkeit des Individuums, welches abweicht, festgestellt werden. Es muss festgestellt werden, ob das betreffende Individuum für sein abweichendes Verhalten verantwortlich gemacht werden kann. Stellt sich heraus, dass es nicht für sein Tun verantwortlich gemacht werden kann, so wird es in den Kompetenzbereich der medizinisch – psychiatrischen Betreuung überstellt, denn die Gesellschaft, in der wir leben, geht mit Delinquenten anders um als mit psychisch Kranken.195 Wofür ist diese hier angesprochene Unterscheidung von bedeutender Wichtigkeit? Vor allem: Was hat diese Unterscheidung mit unserem Gegenstand des Identitätsproblems zu tun? 194 Streng genommen lernt ein solches Kind dann nicht eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Fähigkeit zur personellen Identitätskonstruktion. Diese empirische Hypothese ist abgeleitet aus den seinerzeitigen Befunden des wesentlich kognitivistisch ausgerichteten „Double-Bind-Paradigmas“, wie sie in dem Sammelband „Schizophrenie und Familie“ zusammengestellt worden sind. Eine konsequent vom rollentheoretisch-soziologischen „point of view“ durchgeführte texthermeneutische Feinanalyse der dort zusammengestellten Befunde stellt zwar ein dringliches Desiderat dar, müssen wir uns gleichwohl in der vorliegenden Untersuchung leider versagen. Für eine solche Untersuchung müsste sehr viel intensivere methodologische Vorarbeit geleistet werden im Hinblick auf eine mögliche „Amalgamierung“ von „Freud“, „Weber“ und den sog. kognitiven Lerntheorien. In der projektierten Arbeit meiner jungen Kollegin Janna Rinderknecht, die erst kürzlich Mitglied des „Dossenheimer Kreises“ ist und deren methodische wie methodologische Ausbildung sehr viel intensiver als die meinige ist, wird genau dieses Problem behandelt werden. 195 Dies muss hier explizit betont werden, denn bekanntlich ist in der Zeit des Nationalsozialismus dieser Unterschied aufgeweicht worden – ein wesentlicher Unterschied zwischen dem NS-Rechtssystem und dem unsrigen: Psychisch Kranke und delinquent Gewordene verfielen dem gleichen Verdikt des „Asozialen“. Zur totalitären Aufweichung rechtsstaatlichen Denkens und damit zur „Psychiatrisierung“ insbesondere der Strafjustiz im Nationalsozialismus vgl. die im Rahmen der „Dossenheimer Forschungsgruppe“ betreute Habilitationsschrift von G. Werle [Verbrechensbekämpfung]. 243 Eine genuin soziologische Reformulierung psychiatrischer Probleme hat die Aufgabe, aufzuzeigen, nach Maßgabe welcher Kriterien in unserer Gesellschaft ein Individuum, welches sich deviant verhält, dem Kompetenzbereich der Jurisprudenz oder dem der Medizin zuzuweisen ist bzw. zugewiesen zu werden pflegt. Hierbei müsste dann der Begriff der „Mündigkeit“ als Kriterium explizit in den Mittelpunkt gestellt und mit dem Weberschen Konstrukt des „kompetenten sozialen Handelns“, welches selbst wiederum wesentlich mit dem Rationalitätskonstrukt konnotiert ist, in Beziehung gesetzt werden. An dieser Stelle halte ich zunächst einmal fest: Mündigkeit, soziale Handlungskompetenz sowie kommunikative Kompetenz überschneiden sich in ihren semantischen Kerngehalten, wenn man dabei auf die Grundannahme zurückgreift, dass diese drei Fähigkeiten wesentlich assoziiert sind mit der Kompetenz zur Wahrnehmung eventueller Handlungsalternativen und damit trivialerweise zur simulativen Beurteilung eventueller Handlungskonsequenzen.196 Dann nämlich, und nur dann, gilt auch die Erweiterung des Konstrukts der Handlungskompetenz durch den weiter oben bereits erörternden „Kostensatz“. Kompetent in diesem Sinne kann freilich ein „Individuum“ nur dann sein, wenn es mit Erfolg seine Lektion in der Ausbildung ganz bestimmter Ich-Funktionen und damit zum einen seine Lektion in „Metakommunikation“, zum anderen „seine“ Methode der Identitätskonstruktion gelernt hat: Ein Kind muss sozial lernen, zwischen dem was es sagt bzw. sagen will und dem Modus zu unterscheiden, in welchem gesagt wird, was es sagen will. Und hierfür muss es gelernt haben, virtuell seine Identität konstruieren zu können. Man kann in diesem Zusammenhang von dem „Sozialisationsnadelöhr der Realitätsprüfung“ sprechen, durch welches ein Sozialisand nun einmal „hindurch muss“, soll sein ihm „von Natur aus mitgegebenes“ Repertoire von Verhaltensbereitschaften sich erfolgreich um die Dimension der Befähigung zu subjektiv 196 Vgl. hierzu die in Abschnitt II. 8. 2. vorgeführten Variationen des „Rationalitätskatalogs“, wo der „Theoriekern“ genuin soziologisch gebauter Sozialisationsmodelle herauszuschälen versucht wird: die Relation zwischen dem (primordialen) Erwerb der kommunikativen Kompetenz, der „auf Dauer gestellten“ Fähigkeit zur kognitiven Bewältigung von Entscheidungssituationen und Fähigkeit zur Aufrechterhaltung von Rationalitätsprinzipien subjektiv sinnhaften sozialen Handelns. Wie wir sehen werden, gestaltet sich diese Herausschälung eines solchen „Theoriekerns“ keineswegs einfach, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass um der Transparenz der Argumentationsstruktur willen auf formalistische Vorgehensweisen verzichtet werden muss. Später werden wir dann sehen, dass und inwiefern die Analyse der für „Normale“ konstitutiven Fähigkeit zu meta-kommunikativen Deutungen situativ vorgegebener „Cues“ wesentlich von der Ausarbeitung eines solchen „Theoriekerns“ abhängig ist. Und erst aus dieser Perspektive wird sodann auch Licht geworfen auf jenen Übergang vom „bloßen Verhalten“ zu sinnhaftem sozialen Handeln, der sich in der Primordialphase jedweden Sozialisationsgeschehens abspielt und der, wie die vorliegende Abhandlung behauptet nur und ausschließlich mittels ganz bestimmter Theorieteile der psychoanalytischen Forschungsmethodik geleistet werden kann. 244 sinnhaftem Handeln bereichern, um so einen ganz anderen, ganz neuen Zugang zu seiner sozialen Mitwelt gewinnen zu können. – Das „Normal-Ich“ und die 7.2. Zum Problem der Irrationalität psychopathologischen Erscheinungsformen von „Konformität“ und „Devianz“: Selbstverantwortliches Handeln und zwanghaftes Verhalten Der Weberschen Verstehenslehre zufolge sind die Affekte, welche rationales Handeln verzerren gerade nicht im klinischen Sinne „irrational“, sie gehören vielmehr dem verstehbaren Verhalten an. Bei den nachstehend vorgestellten „Rationalitätskatalogen“ ist aus diesem Grunde immer mitzudenken, dass „Irrationalität“ – auch und gerade dann, wenn wir uns mit Extremformen derselben im durchaus klinischen Sinne zu beschäftigen haben – nicht automatisch der Gegenbegriff zum Rationalitätskonstrukt ist. Vielmehr geht es im Hinblick auf die Formen irrationaler Verhaltensmuster immer um Struktur und Umfang der Beeinträchtigung idealtypologisch konstruierter Rationalitätsprinzipien. Max Webers „Verstehenslehre“ schließt deshalb als durchaus subjektiv sinnhaftes Verhalten die Formen der Irrationalität ein, legt jedoch entschiedenen Wert darauf zu zeigen, dass die Extremformen der Irrationalität generell aus dem Umkreis des verständlich Deutbaren herausfallen: Ebenso wie die Webersche „Begriffslehre des (sozialen) Handelns“ keine Sozialisationstheorie ist, ist sie selbstverständlich als solche auch keine Psychologie, und insofern „Psychologisches zur Sprache kommt“ (Neid, Liebe, Stolz, Haß, Leidenschaftlichkeit, Eifersucht etc. etc.), kommt es als etwas zur Sprache, was jedermann, der halbwegs seine fünf Sinne beieinander hat, problemlos verstehend nachvollziehen kann, weil er die und ähnliches ja auch einmal „am eigenen Leibe“ erfahren hat. Ganz bewusst habe ich hier auf einen umgangssprachlichen Jargon zurückgegriffen, um die sog. „Affektstrukturen“ charakterisieren zu können. Hinsichtlich einer adäquaten Behandlung des sog. „Irrationalitätsproblems“ gilt deshalb, wie insbesondere der nächste Arbeitsschritt darzutun bemüht sein wird, das Webersche idealtypologische Grundpostulat der „Verstehenden Soziologie“: Es ist prinzipiell unmöglich, die Erscheinungsformen der Irrationalität – gleichgültig ob noch normal und verständlich oder im klinischen Sinne pathologisch – beschreiben und erklären zu können, ohne zuvor ein idealtypologisches Rationalitätssystem entwickelt zu haben. Hierbei wirkt sich sozusagen erkenntnispraktisch aus, dass die arbeitsteilige Zerlegung der sozialwissenschaftlichen 245 Gegenstandsbereiche ein ausschließlich erkenntnistheoretisches, nicht jedoch ein ontologisches Problem darstellt. Wir haben es hierbei tatsächlich mit der, wie Max Weber es scharfsinnig ausgedrückt hat, „denkenden Ordnung der empirischen Wirklichkeit“ zu tun. Dass also beispielsweise zwischen „Handeln“ und „Verhalten“ scharf unterschieden werden muss, ist ein idealtypologisches Postulat, welches ausschließlich den Sinn hat, Dimensionen der sozialen Wirklichkeit erschließen zu können, die unserem Erkenntnisstreben ansonsten verschlossen blieben. Wie ein Blick auf das anschließend vorgeführte Tafelbild lehrt, muss aus dem Blickwinkel der Methodik der sog. „Verstehenden Soziologie“, welche das Ausmaß der Beeinträchtigung rationalen sozialen Handelns als „Irrationalität“ verrechnet, scharf unterschieden werden zum einen zwischen den Klassen von „Beeinträchtigungen“, die noch zum „Normalbereich“ des intuitiv Nachvollziehbaren gehören, zum anderen zwischen zwei Extremformen von „Beeinträchtigungen“, die folglich extremtypologisch als im klinischen Sinne bedeutsam zu umschreiben sind. Und der für uns interessante Punkt ist, dass die „Verstehenssoziologie“ als solche eine derartige scharfe Trennung nicht vornehmen kann. Das eigentliche Problem in der Methodik der sog. „Verstehenden Soziologie“ besteht darin, den Grenzbereich einigermaßen klar beschreiben zu können, der sich zwischen „noch verstehbaren“ und nur noch psychologisch erklärbaren Irrationalismen erstreckt. Zu mehr jedoch ist die Verstehenslehre außerstande. Angesprochen hat Max Weber dieses Problem bereits in der „Kategorienlehre“ von 1913. Wir müssen sehen, dass es nicht zufälligerweise um „Grenzbereiche“ geht, bei denen nicht immer scharf unterschieden werden kann, ob ein bestimmtes affektbesetztes Verhalten noch psychologisch verständlich nachvollziehbar, oder aber bereits als „unverständlich“ und damit als prinzipiell irrational einzuschätzen ist. Zu konstruieren ist jedenfalls eine Menge von Verhaltensmustern, welche „uns“, die wir in einem bestimmten Kulturraum aufgewachsen sind, „unverständlich“ oder gar als „abartig“ vorkommen, die jedoch in anderen kulturellen Zusammenhängen als völlig normal oder eventuell sogar als bewundernswert eingeschätzt werden. Gewiss liegt hier ein gleichfalls psychiatrisch sehr kompliziertes Problem vor, welches Tellenbach in [Normalität] zwar angesprochen, jedoch nicht gelöst hat. Ich zitiere: „Die spezifische Evidenz des zweckrationalen Sichverhaltens hat natürlich nicht zur Folge, daß etwa speziell die rationale Deutung als Ziel soziologischer Erklärung anzusehen wäre. Bei 246 der Rolle, welche »zweckirrationale« Affekte und »Gefühlslagen« im Handeln des Menschen spielen, und da auch jede zweckrational verstehende Betrachtung fortgesetzt auf Zwecke stößt, die ihrerseits nicht mehr wieder als rationale »Mittel« für andere Zwecke gedeutet, sondern nur als nicht weiter rational deutbare Zielrichtungen hingenommen werden müssen, - mag ihre Entstehung als solche dann auch weiterhin Gegenstand »psychologisch« verstehender Erklärung sein, - könnte man ebensogut das gerade Gegenteil behaupten. Allerdings aber bildet das rational deutbare Sichverhalten bei der soziologischen Analyse verständlicher Zusammenhänge sehr oft den geeignetsten »Idealtypus«: die Soziologie wie die Geschichte deuten zunächst »pragmatisch«, aus rational verständlichen Zusammenhängen des Handelns. Derart verfährt z.B. die Sozialökonomik mit ihrer rationalen Konstruktion des »Wirtschaftsmenschen«. Ebenso aber überhaupt die verstehende Soziologie. Denn als ihr spezifisches Objekt gilt uns nicht jede beliebige Art von »innerer Lage« oder äußerem Sichverhalten, sondern: Handeln. »Handeln« aber (mit Einschluß des gewollten Unterlassens und Duldens) heißt uns stets ein verständliches, und das heißt ein durch irgendeinen, sei es auch mehr oder minder unbemerkt, »gehabten« oder »gemeinten« (subjektiven) Sinn spezifiziertes Sichverhalten zu »Objekten«. Die buddhistische Kontemplation und die christliche Askese der Gesinnung sind subjektiv sinnhaft auf für die Handelnden »innere«, das rationale ökonomische Schalten eines Menschen mit Sachgütern auf »äußere« Objekte bezogen. Das für die verstehende Soziologie spezifisch wichtige Handeln nun ist im speziellen ein Verhalten, welches 1. dem subjektiv gemeinten Sinn des Handelnden nach auf das Verhalten anderer bezogen, 2. durch diese seine sinnhafte Bezogenheit in seinem Verlauf mitbestimmt und also 3. aus diesem (subjektiv) gemeinten Sinn heraus verständlich erklärbar ist. Subjektiv sinnhaft auf die Außenwelt und speziell auf das Handeln anderer bezogen sind nun auch die Affekthandlungen und die für den Ablauf des Handelns, also indirekt, relevanten »Gefühlslagen«, wie etwa: »Würdegefühl«, »Stolz«, »Neid«, »Eifersucht«.“197 Interpretation: Ich habe dieses relativ lange Zitat gebracht, weil es mir aus mehreren Gründen bemerkenswert erscheint. Was fällt auf? Weber, dem die stilistischen Mittel der deutschen Bildungssprache vorzüglich zur Verfügung standen, schreibt hier einen Stil, der als ausgesprochen umständlich erscheint. Dies kann zwei Gründe haben: 197 Weber [Kategorienaufsatz] Hervorhebungen mittels Unterstreichung durch mich Ch. K. 247 1. rein psychologische Gründe, als da sind: mangelnde Beherrschung des Stoffes, etc. 2. Weber betritt, wie anhand des Gadamerschen „Gespräches“ weiter oben demonstriert, intellektuelles Neuland und nimmt aus diesem Grunde stilistische Unbeholfenheit in Kauf, um der Erfassung der Sache willen. Texthermeneutisch interessiert uns hier ausschließlich der zweite Aspekt. Schauen wir daraufhin den Text genauer an. Es sind zwei Problemklassen, die Max Weber in diesem Text in einem Argumentgang zu bewältigen versucht. Zum einen das weiter oben beschriebene Problem des Grenzbereiches von affektgeladener Handlungsoption und Irrationalität, zum anderen das Problem der methodologischen Funktion des Idealtypus. Diese beiden Problemstränge sind durch Interpretation zu entzerren, um so das von Weber in einem komplizierten intellektuellen Verfahrensgang Entdeckte für die in dieser Arbeit interessierende Problematik fruchtbar zu machen. Es sind hierzu drei Aspekte, welche zunächst einmal festzuhalten sind: das Problem der rationalisierenden Formen des Verstehens von Handlungen und Handlungszusammenhängen, die Frage nach der Erkenntnisfunktion der konsequenten Rationalisierung in Gestalt von idealtypologischen Konstruktionen und das Problem, ein zuverlässiges Kriterium zu konstruieren, welches die noch psychologisch nachvollziehbaren „Gemütslagen“ von den unverständlichen, da dem klinischen Bereich zuzuordnenden Irrationalismen zu unterscheiden gestattet. In expliziter Weise ergibt sich also: 1. Da jede Handlung objektbezogen bzw. intentional ist, ergibt sich bei jedweder Form menschlichen Handelns notwendigerweise ein affektgeladenes Beiprogramm, welches mit den jeweiligen Zielen des Handelns assoziiert zu sein pflegt. In der „historischempirischen Wirklichkeit“ gibt es keine menschlichen Handlungszusammenhänge, die ausschließlich von Rationalitätserwägungen gesteuert sind. Eine in diesem Sinne rationale Deutung realen Verhaltens als Ziel soziologischer Erklärung, würde die Wirklichkeit, dass nämlich immer Gefühlslagen und Affekte in Form von Wünschen oder Befürchtungen im Spiele sind, wenn es tatsächlich „um etwas geht“, permanent verfehlen. 248 2. Dennoch hat die Reflexion der rationalen Fiktion für die Interpretation affektgeladenen Handelns eine wichtige Erkenntnisfunktion: Wir könnten das Ausmaß der durch Affekte verzerrten Zweckrationalität gar nicht abschätzen, wenn wir nicht zuvor uns in Gestalt einer idealtypologischen Konstruktion vollständig klargemacht hätten, wie die Handelnden sich verhalten würden, wenn alles streng rational ablaufen würde. 3. Wir bewegen uns hier im Bereich des psychologisch Nachvollziehbaren. Das eingangs beschriebene Problem einer wirklich präzisen Diskriminierung genuin irrationaler Verhaltensmuster gegenüber den psychologisch verständlichen affektgeladenen Gemütslagen wird jedoch nicht berührt. Wir bemühen uns um eine Feininterpretation der Textstelle im Lichte unserer bisherigen Arbeitsergebnisse und fragen mit Max Weber, ob nicht unter Umständen „die rationale Deutung als Ziel soziologischer Erklärung anzusehen“ ist. Würde dies der Fall sein, so würde das bedeuten, dass es bei der Interpretation aller empirisch aufweisbarer Handlungsvollzüge letztendlich darum gehen muss, implizites oder explizites rationales Handeln zu unterstellen. Bekanntlich verfahren einige Historiker genauso: Sie zeigen, wenn sie sich um Erklärungen bemühen, dass bei einer historisch bedeutsamen Handlungskonfiguration letztlich alles so hat kommen müssen, wie es dann auch gekommen ist. Die dabei zu konstruierenden Kausalzusammenhänge pflegen zumeist hierbei rationalisierend „zurecht gebogen“ zu werden. Diese der Erzähllogik innewohnende „retrospektive Rationalitätskonstruktion“ ist Bestandteil sehr vieler Geschichtserzählungen, die der historischen Mannigfaltigkeit Gewalt antun, indem sie dieser eine Rationalität unterstellen, die sie in Wahrheit natürlich nicht gehabt hat. Sehr viele Zeugenaussagen, ja überhaupt die meisten Erzählungen, konstruieren im Nachhinein eine „Logik der Ereignisse“, bei der immer nur aufgezeigt wird, dass es genauso hat kommen müssen, wie es dann gekommen ist. Dergestalte „Erklärungen“ sind empirisch völlig gehaltlos: In [Narratives Paradigma] ist diese Erklärungslogik als „Ex-postfacto-Erklärung“ beschrieben worden, und es konnte gezeigt werden, dass genau so die zirkulären Erklärungen gebaut sind. Im Nachhinein wird eine Rationalstruktur in die Ereignisse hineinprojeziert, ein entsprechendes Schema konstruiert, und es wird sodann im Lichte dieser Projektion nur das an den Tatsachenzusammenhängen selektiv beschrieben, was 249 zu diesem Schema passt. Die meisten konspirationstheoretischen Deutungen operieren mit solch einer Logik.198 Wie auch immer. Weber weist mit Recht daraufhin, dass man auch genau umgekehrt verfahren kann: Ziel soziologischer Erklärung wäre es dann, die normale Affektbetontheit allen Handelns hervorzuheben, um so zeigen zu können, dass sich überhaupt keine soziale Ordnung bilden kann. Auch dieses Argument lässt sich leicht ad absurdum führen: Würde die soziale Wirklichkeit vollständig chaotisch verlaufen, so wäre das Ausmaß von relativer Geordnetheit, auf das wir uns bei unserem Planen und Handeln alltäglich stützen müssen, schlicht unerklärlich. Es ergibt sich mithin die Frage, welche Erkenntnisfunktion der rationalen Deutung von Handlungen, von Handlungszusammenhängen zukommt. Völlig richtig weist Weber daraufhin, dass Soziologie und Geschichtsschreibung „zunächst pragmatisch“ d.h. „aus rational verständlichen Zusammenhängen des Handelns“ deuten. Diese pragmatische Interpretation ist das wichtigste Hilfsmittel, um überhaupt Zusammenhänge einigermaßen kohärent darstellen zu können, ohne konspirationstheoretisch zu werden. Dies bedeutet: 1. Es muss die Situation rekonstruiert werden, in der sich der Handelnde befand bzw. vor die er sich gestellt sah und die ihm ganz bestimmte Probleme bereitet hat. Diese zumeist retrospektiv dargestellte „Logik der Situation“ ist in der Tat vom Betrachter objektiv darlegbar, indem man den eigentlichen Problemkern, vor den jeder sich „normalerweise“ gestellt sieht herausarbeitet. Als typisch für eine solche Rekonstruktion einer Situationslogik gilt die klassische Schlacht: Kennen wir die geographischen Verhältnisse, Truppenstärke, Bewaffnung usw., so können wir ungefähr abschätzen, wie groß die Chancen sind, dass der Feldherr A oder der Feldherr B die Schlacht gewinnt. 2. Wir können uns also fiktiv in die Lage eines solchen Feldherren versetzen und können so „durchsimulieren“, wie die Schlacht hätte verlaufen müssen, wenn den Beteiligten alle diejenigen Informationen zur Verfügung gestanden hätten, die uns, die wir das Schlachtergebnis kennen, zur Verfügung stehen. Man muss also fiktiv unterstellen, 198 Porath hat diesen Bereich als die „Kernproblematik der Historischen Forschungslogik“ beschrieben und so die Frage gestellt, wie angesichts unserer normalen Tendenz, „die Vergangenheit nach Maßgabe des uns selbstverständlich Gewordenen“ zu beschreiben, überhaupt historische Objektivität möglich sei. 250 dass sich jemand einer Logik bzw. den Erfordernissen genau dieser Situation angemessen völlig zweckrational verhält. Das aber heißt: Man muss die Frage zu beantworten versuchen, wie sich der Betreffende hätte verhalten müssen, wenn er völlig rational hätte handeln wollen und können. Bei dieser „Berechung“ läuft alles nach einer fiktiven Logik ab, jedoch wissen wir natürlich, dass sich in Wirklichkeit die Dinge nie so verhalten, wie es unser Kalkül erfordert. 3. Der dritte Schritt ist nun der wichtigste, jedoch muss uns bewusst sein, dass wir ihn überhaupt nicht gehen könnten, wenn wir die ersten beiden Gedankenschritte nicht gemacht hätten. Dieser dritte Schritt besagt, dass nunmehr die Beeinträchtigung des (fiktiven) rationalen Handelns durch „Affektverzerrung“ abzuschätzen ist: Eigentlich hätte der XY sich in dieser Situation, wenn er sich völlig rational hätte verhalten können und wollen, so und so verhalten müssen. Da er jedoch „blind vor Hass, Liebe und Eifersucht“ war, hat er sich tatsächlich folgendermaßen verhalten und z.B. die Schlacht in den Sand gesetzt. Zu Recht verweist Max Weber auf das Lehrbeispiel der Sozialökonomie, die mit einem sozusagen affektfreien „homo oeconomicus“ arbeitet, um real ablaufende Wirtschaftsverläufe beschreiben und erklären zu können. Hier ist jedoch nur ins Extrem getrieben („idealtypisch konstruiert“), was für jede Form des Handelns gilt. Wir sollten hierbei durchaus sorgfältig verfahren, um klarzumachen, welche Funktion der Konstruktion möglichst reiner Typen für die Erfassung der empirischen Wirklichkeit zukommt. Denn die Formel bei Max Weber besagt, dass es um „subjektiv sinnhaftes“ Handeln geht. Auch hierbei ein Beispiel: Ein Geschäftsmann will ein größeres Geschäft abschließen, hat seine Ressourcen korrekt berechnet und steht nunmehr vor der Entscheidung, ob er die endgültige vertragliche Regelung unterzeichnen soll oder nicht. Wir wählen zwei Typen von Geschäftsleuten: Einen extrem gläubigen Katholiken und einen extrem gläubigen Calvinisten. Der Katholik hält es für subjektiv geboten, d.h. vernünftig, zwecks glücklichen Gelingens eine Kerze anzuzünden und seiner Kirche einen größeren Betrag zu spenden. Außerdem betet er natürlich heftig, um so Gott Vater milde stimmen zu können. Es gehört zu den Glaubensüberzeugungen dieses Mannes, dass Gebet und Opfer wesentliche Bestandteile vernünftigen Handelns sind. Sehen wir also den Katholiken sich so verhalten wie er sich verhält, so handelt er subjektiv sinnvoll, da in Übereinstimmung mit seinen Glaubensüberzeugungen. Wie sieht die Sache für den Calvinisten aus? 251 Für diesen sind die religiösen Handlungen des Katholiken schlicht sündhaft, da hierbei der Versuch gemacht wird, den allmächtigen Gott zu bestechen. Dass der radikale Calvinist auf diese Hilfsmittel verzichtet, ist im Rahmen seiner Glaubensüberzeugung vernünftig und sinnvoll: Die Kerze ist Hokuspokus, das Gebet ein unzulässiger Bestechungsversuch und der Betrag den er seiner Kirche stiftet hat bestenfalls die Funktion das eigene schlechte Gewissen zu beruhigen. Ich habe dieses Beispiel gewählt, um zu zeigen, dass beide aus ihrem jeweiligen Blickwinkel heraus durchaus zweckrational handeln. Was wäre nun in diesem Zusammenhang irrational? Das wird deutlich, wenn wir das Beispiel des Calvinisten nehmen, der im letzten Moment vor dem Geschäft sozusagen „Angst vor der eigenen Courage bekommt“ und eben doch zu den Hilfsmitteln greift, die er eigentlich als konsequenter Calvinist als abergläubisch ablehnen müsste. Hierbei wird durch die plötzlich auftretende Angst („Affektgeladenheit“) das eigentlich zu erwartende Handeln beeinträchtigt. Für unsere Fragestellung ist hierbei von Wichtigkeit, dass wir die plötzliche Angstanwandlung des Calvinisten durchaus verstehen können, ist doch ein konsequenter und hartgesottener calvinistischer Geschäftsmann (ein reiner Typus) vermutlich genauso selten wie ein Kalb mit zwei Köpfen. In genau diesem Sinne ist die obige Textstelle zu verstehen: „Subjektiv sinnhaft auf die Außenwelt und speziell auf das Handeln anderer bezogen sind nun auch die Affekthandlungen und die für den Ablauf des Handelns, also indirekt, relevanten »Gefühlslagen«, wie etwa: »Würdegefühl«, »Stolz«, »Neid«, »Eifersucht«.“ Man sieht, dass die Textstelle so keine großen gedanklichen Schwierigkeiten bereitet: „Normale“ Gefühlslagen, die wir alle aus eigener Erfahrung kennen, beeinträchtigen fortlaufend irgendwelche rational durchkonstruierten Pläne und Handlungen. Ja wir können sogar soweit gehen zu sagen, dass jemand, der in idealtypischer Reingestalt in geradezu perfekter Form in jeder Situation sich rational zu verhalten versucht und in dieser Beziehung fortlaufende Perfektion anstrebt, psychopathologisch genauso verdächtig ist, wie derjenige, der sich vollständig seinen Triebregungen und seinem Wunschdenken hingibt und sozusagen immer „aus dem Bauch heraus“ entscheidet. Worauf es mir hier ankommt ist folgendes: Die Weberschen „Gefühlslagen“ beeinträchtigen also die jeweilige idealtypisch konstruierte rationale Handlungsweise. Schauen wir jedoch hier noch etwas genauer hin, so stoßen wir auf Schwierigkeiten, die den weiter oben bereits 252 angedeuteten „Grenzbereich“ zwischen verständlichen Gefühlslagen und möglichen psychopathologisch auffälligen Handlungsmustern betrifft. Auch hierfür versuchen wir uns in einem Fallbeispiel: Jemand hat einem anderen all sein Hab und Gut überschrieben, weil er diesen anderen abgöttisch liebt. Natürlich nehmen wir an, dass er dies vor allem deshalb getan hat, weil er den anderen auf irgendeine Weise dazu veranlassen wollte, ihn ebenfalls zu lieben. Objektiv ist diese Handlung allerdings irrational. Stellt sich nämlich heraus, dass seine Rechnung nicht aufgeht, zeigt sich, dass es ein Fehler war, alle seine Trümpfe aus der Hand zu geben. Und in der Tat: Nachdem er dem Objekt seiner Liebe alles überschrieben hat, versetzt dieser andere ihm einen Tritt. Gemessen an dem Vernunftmaßstab, ist seine Verhaltensweise irrational gewesen. Dies ist jedoch nicht der Aspekt der uns hier interessiert. Das sieht man daran, dass sehr wohl noch andere Deutungen möglich sind: Nehmen wir an unser Liebender, der, wie man so schön sagt, mit seiner hingebungsvollen Liebe bzw. mit seiner Berechnung so schlimm auf die Nase gefallen ist, zeigt im Nachhinein nicht das geringste Bedauern. Dann kann es sehr wohl sein, dass er einem ganz anderen Liebesideal frönt, einem Ideal, welches bedingungslose Liebe mit Selbstaufopferung und völliger Hingabe bei konsequenter Absage an irgendwelche selbstsüchtigen Interessen gedanklich verknüpft. Weil seine Liebe so groß war, war es subjektiv sinnvoll, dem geliebten Anderen alles zu geben. In diesem Fall ist ja sogar unwichtig, wer oder was charakterlich „der andere“ in Wirklichkeit ist. Der Betreffende handelte ganz einfach gemäß der „Maxime seines Wollens“, dass wahre Liebe in konsequenter Selbstaufgabe bestehe, die nichts für sich wolle. Hierbei ist restlos alles davon abhängig, welchen Maßstab man anlegt. Legt man den Maßstab des gesunden Selbstinteresses an, so hat der Betreffende irrational gehandelt. Hierbei jedoch wäre dieser Maßstab völlig unangebracht, ist doch das subjektive Weltbild unseres hingebungsvoll Liebenden in sich völlig stimmig, da in Übereinstimmung mit den Grundauffassungen dessen, was für ihn „wahre Liebe“ heißt. Der wirkliche Verlierer in diesem Spiel ist dann zweifelsohne der andere, hat dieser doch, wie die Bibel es ausdrückt, „Schaden an seiner Seele genommen“. Anders ausgedrückt: Unser vermeintlich irrational handelnder Liebender handelt gemäß dem Wertmaßstab des Zusammenhangs von hingebungsvoller Liebe und Selbstaufopferung, was zentraler Bestandteil seiner Überzeugungen ist, und ist durchaus mit sich und der Welt im Reinen. Das Beispiel aber lässt sich noch in einer anderen Hinsicht deuten. Dabei hängt restlos alles davon ab, wie für den Betreffenden die „Wertlogik“ seiner Liebesethik im Kern aussieht. Insofern ist der Tatbestand, dass er „nicht aus Schaden klug geworden ist“, durchaus in 253 Ordnung. Es ist jedoch unübersehbar, dass die ganze Angelegenheit sich etwas schwieriger gestaltet, wenn wir den Tatbestand berücksichtigen wollen, dass es bei der ganzen Sache nicht um ein gessinungsethisch radikalisiertes Prinzip, sondern tatsächlich um „heimlichen Lustgewinn“ geht, wobei hierbei die in Frage kommende gesinnungsethische Maxime nichts anderes als eine bloße Rationalisierung darstellt. Die ethische Maxime hat ihren Wert darin, dass aus einer Ideologie des Leidens heraus hierbei konsequent gehandelt worden ist. Die in diesem Sinne radikale Absage an jeglichen Lustgewinn, bildet dabei den eigentlichen moralischen Kern. Nun zeige aber unser armer Trottel, nachdem er sozusagen formvollendet auf die Nase gefallen ist, offenkundige Anzeichen von Lustempfinden, d.h.: Er leidet mit Lust, könnte auch einem klinisch auffälligen „Liebeswahn“ verfallen sein, der aus dem Leiden seelischen Gewinn zieht. Die Scheidelinie zwischen „psychiatrisch interessant“ und „gesinnungsethisch radikal“ ist, wie man sieht, hauchdünn. Gerade weil dieser hier angesprochene Bereich so schwierig zu erfassen ist, sprach ich von „Grenzbereich“. Die Anzeichen offenkundigen Lustempfindens, die vielleicht ein sensibler Psychoanalytiker entdeckt, strafen die prätendierte ethische Regel Lügen und wir haben in Wahrheit einen waschechten Masochisten vor uns. Es ist ohne große Phantasie problemlos zu sehen, wie eng bisweilen komplizierte ethische Zusammenhänge in Verbindung stehen zu genuin psychopathologischen Tatbeständen. Wenden wir uns nunmehr dem folgenden Tafelbild zu, welches zuerst zu beschreiben und zu erläutern, dann vor allem im Lichte der psychoanalytischen Fundamentalannahmen zu interpretieren ist: 254 Soziales Handeln Konformes Handeln/Verhalten Irrationale Konformität Abweichendes Handeln/Verhalten Rationale Konformität Rationale Devianz Irrationale Devianz ? Pathologische Konformität « Rollendistanz» Schwere Zwangsneurosen Fehlleistungen Politische Devianz Delinquenz Verwahrlosungsdevianz ? Innovation Fehlleistungen Pathologische Devianz Halluzinatorische Psychosen Tafelbild 3 Beschreibung und Erläuterung. Der besseren Übersichtlichkeit halber listen wir auch hier die uns interessierenden Punkte auf. Im Hinterkopf zu behalten ist hierbei die Eingangsthese, dass den genuin pathologischen Verhaltensmustern immer (maligne) identitätskritische Mentalzustände zugrunde- und vorausliegen. Der Bezug zu den Identitätskrisen wird uns nämlich später ganz besonders interessieren (müssen). Es ergibt sich dann: 1. Wie das obige Tafelbild 2 auf S. 239, ist auch das vorliegende normen- und rollenstrukturell angeordnet: Jemand verhält sich normen- und rollenkonform bzw. normen- und rollendiskrepant. Während jedoch das vorherige Tafelbild sich auf die Formen der Devianz konzentrierte, ist das hier vorgestellte Tafelbild am Irrationalitätsproblem orientiert, wobei „Irrationalität“ als Beeinträchtigung von Rationalität „definiert“ wird. Dies ein Problem, welches uns im nächsten Abschnitt noch ausführlich beschäftigen wird. Im strikt klassifikatorischen Sinne ist dieses Tafelbild nicht ganz korrekt, da es bereits mit einigen Vermutungen operiert, die 255 jedenfalls an dieser Stelle noch völlig unausgewiesen sind. Diese betreffen vor allem die Schemata in der letzten Zeile und haben hier ausschließlich thetischen Charakter: Angenommen wird, dass die von Sigmund Freud beschriebenen Formen der „Psychopathologie des Alltagslebens“ erstens noch wesentlich „näher“ zu rationalen Verhaltensformen stehen und dass diese „Fehlleistungen“ zweitens gleichermaßen bei schweren Zwangsneurosen wie auch bei sich abzeichnenden halluzinatorischen Psychosen auftreten. Dies ist jedoch ein Sonderproblem auf das weiter unten noch einmal zu sprechen zu kommen sein wird. 2. Das vorliegende Tafelbild trägt dem bereits des öfteren erwähnten Tatbestand Rechnung, dass pathologische Verhaltensmuster keineswegs immer als deviante Formen auffällig sind. Es gibt, wie wir wissen, pathologische Verhaltensmuster die durch ihre „Überangepasstheit“ auffallen. Später werden wir in diesem Sinne scharf unterscheiden, zwischen realitätsfugativen und realitätsverengenden Verhaltensmustern. Die psychoanalytische Interpretation ist hierbei nicht ganz einfach, da mehrer Deutungen möglich sind, um die sog. „anankistischen“ Syndrome als neurotische „Reinformen“ gegenüber den halluzinatorischen Psychosen diskriminieren zu können. 3. Verwahrlosungsdevianz und Innovation sind hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt, bleiben jedoch systematisch außer Betracht. Die gestrichelten Linien sowie die Fragezeichen, tragen dem Rechnung und sollen zugleich darauf verweisen, dass ihr Verhältnis zu dem Irrationalitätsproblem weitgehend ungeklärt ist. Insbesondere die Innovation ist es ja, die hierbei interessant ist. Darauf jedoch näher einzugehen wäre nur dann möglich, wenn der sozialisationstheoretische Hintergrund bereits deutlicher herausgearbeitet wäre, als er es ist. 4. Orientierungskern ist die schraffierte Fläche, welche die rationalen Verhaltensmuster betrifft: Widerstand und Delinquenz wurden in diesem Sinne bereits weiter oben behandelt. Aus einem ganz bestimmten Grunde prekär ist der Zusammenhang zwischen Rationalität, Konformität und Rollendistanz. Auch hierbei ließe sich erst genaueres sagen, wenn man auf den sozialisationstheoretischen Hintergrund bezug nehmen könnte. Vorgreifend sei jedoch auf folgendes aufmerksam gemacht: Der Ausdruck Rollendistanz wurde in Anführungszeichen gesetzt, weil gezeigt werden kann, dass diese Verhaltenseigentümlichkeit wesentlich zu einem normalen ich256 starken Rationalverhalten gehört. Man kann sogar soweit gehen zu sagen, dass Rollendistanz zum Wesenskern dessen gehört, was man als „Normal-Ich“ aufzufassen pflegt. Weiter oben (S. 53) wurde hierauf bereits hingewiesen. Es hieß dort: „Webers Idealtypologie des sozialen Handelns beinhaltet die hypothetische Konstruktion eines „Normal-Ich“, d. h. eines menschlichen Individuums, welches in dem Sinne rational zu handeln im Stande ist, dass es seine Interessen und Bedürfnisse sinnadäquat zu interpretieren und zu deren Durchsetzung bzw. Befriedigung entsprechend zu handeln vermag, welches „aus Schaden klug zu werden“ und Fehlverhalten zu korrigieren vermag“. Ich vermute, dass die Konstruktion eines solchen „Normal-Ichs“ wesentlich verkettet ist zum einen mit der weiter oben behandelten „kommunikativen Kompetenz“, zum anderen mit der Fähigkeit eines menschlichen Individuums zur „Rollendistanz“. 5. Wie gesagt ist die schraffierte Fläche unser Bezugssystem für eventuell auftretende und zu beschreibende Irrationalität. Ganz besonders interessant ist für uns also das Verhältnis zwischen „Rationalität“ und „Irrationalität“, ist doch gemäß den obigen Ausführungen genau darin das eigentliche methodische wie methodologische Kernproblem der hier vorgelegten Arbeit insgesamt verborgen. 6. Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Zeile vier, so wird genau diese Problematik konkret: Pathologische Konformität sowie pathologische Devianz designieren die Extremtypen bezogen vor allem auf das Problem des Widerstandes und der Delinquenz. Hierbei haben wir nämlich die Möglichkeit, den Begriff des „Zwanges“ einzuführen. Widerstand und Delinquenz sind ja vor allem deshalb genuin rationale Formen der Devianz, weil den betreffenden Handlungstypen die Möglichkeit zur Entscheidung offen steht: Sie können die Position des „Diebes“ bzw. des „Revolutionärs“ einnehmen oder aber auch nicht, und sie wissen um die mit diesen sozialen Positionen verbundenen Rollenerwartungen, wissen in der Regel auch, mit welchen Handlungskonsequenzen sie jeweils zu rechnen haben, kennen die „Kosten“ ihrer Entscheidungen, können das alles sozusagen im Vorhinein fiktiv durchrechnen. Genau dieses Merkmal der Entscheidungsfreiheit im Prinzip, welche sie seitens der „Gesellschaft“ sozusagen „handhaftbar macht“, fehlt sowohl den pathologischen Konformitätstypen als auch den pathologischen Devianztypen, was man insbesondere an den sog. „Fehlleistungen“ ablesen kann. Hierauf wird zum einen in der gegenwärtigen Auflistung zum anderen – und dies vor allen Dingen –, in den 257 „Rationalitätskatalogen“ im nächsten Abschnitt noch einmal zurückzukommen sein: Die Fähigkeit, zwischen simulativ durchgespielten Wahlalternativen Entscheidungen treffen zu können, kann als „Basalcharakteristikum“ der personellen Rationalität angesehen werden. 7. Auch eine ganz bestimmte Differenzierung, die – bezeichnenderweise – im vorliegenden Tafelbild nicht explizit erscheint, muss zumindest erwähnt werden. Zuwenden können wir uns dieser Differenzierung erst im Rahmen der Behandlung der „Rationalitätskataloge“ im nächsten Abschnitt. Es ist die Differenzierung in solitäres und in soziales Handeln. Überschrieben ist das Tafelbild mit dem „sozialen Handeln“. Aber: Obwohl hier in enger Anlehnung an die Webersche Soziologiedefinition das soziale Handeln in den Blick genommen wird, ist dennoch das Tafelbild, wie unschwer erkennbar, wesentlich individuenzentriert. Dass dennoch hier auf beides abgezielt wird, hat seinen Grund darin, dass wir aus dem Blickwinkel der Weberschen Soziologiedefinition zwischen zwei verschiedenen Formen von psychopathologischen Verhaltensmustern scharf unterscheiden müssen: zwischen denjenigen, welche ganz allgemein als Beeinträchtigungen subjektiv sinnvollen Verhaltens aufzufassen sind, wobei diese Beeinträchtigungen sich wesentlich auf das solitäre Individuum beziehen, und denjenigen, die sich auf das Sozialverhalten beziehen. 8. Der klinisch arbeitende Psychiater wird in diesem Schema die Auflistung von „Fallbeispielen“ vermissen, bei denen bekanntermaßen der theoretische Hintergrund eklektizistisch zusammengebunden zu werden pflegt mit unmittelbar in der Diagnostik beschriebenen beobachtbaren Verhaltensmustern. Ganz bewusst nimmt das Tafelbild nicht bezug auf solche als „typisch“ geltende Verhaltensmuster, die der unmittelbaren Beobachtung zugänglich sind. Der Grund hierfür ist jedoch, wenn man dem Argumentgang der vorliegenden Arbeit bis zu diesem Punkt aufmerksam gefolgt ist, ganz offenkundig: Das Verhältnis zwischen beobachtbaren Verhaltensmustern und den diesen zugrunde liegenden und immer nur erschlossenen identitätskritischen Zuständen, ist ja gerade ein offenes methodologisches Problem, wie weiter oben in II. 3 ( wissenschaftstheoretischer Thesenkatalog) ausgeführt worden ist. 9. Ebenfalls ausgespart ist das Problem der Ätiologie, Diagnostik und Anamnese der sog. psychosomatischen Krankheitsformen. Auch dies hat seinen Grund: Wie bereits hervorgehoben, soll die vorliegende Studie ja vor allem insofern einen Beitrag zur „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ liefern, als sie die Möglichkeit eröffnet, auf längere Sicht auch diagnostische klassifikatorische Schemata konstruieren zu können. 258 Denn die eigentliche Nagelprobe einer psychiatrisch relevanten Sozialisationstheorie wäre natürlich zugestandenermaßen eine wesentliche Verbesserung des differenzialdiagnostischen Prozedere. Sie darf jedoch nicht ihre Kompetenzen überschreiten. Ansonsten würde die Ausbeute, welche der hier verfolgte rigoros soziologische Standpunkt sowie die mit diesem verbundenen Methodologie ja mit sich bringen soll, ganz automatisch wieder verloren gehen. Wenn überhaupt die Phänomengruppe der psychosomatischen Krankheitsformen diagnostisch einigermaßen präzise abgrenzbar wäre gegenüber den Zwangsneurosen auf der einen Seite und gegenüber den halluzinatorischen Psychosen auf der anderen Seite, dann nur, indem man die beiden letzteren unter dem Blickwinkel einer streng soziologisch bzw. psychoanalytisch gefassten Verknüpfung von Identitätskrisen und psychopathologischen Verhaltensmustern betrachtet. Im übrigen aber muss das Problem offen bleiben: Solange der Bezug der massiven Beeinträchtigungen der je subjektiven Kompetenzen zur Identitätskonstruktion – genau so ist nunmehr der Begriff der „Identitätskrise“ arbeitsbegrifflich zu fassen – zu genuin zwangsneurotischen und genuin psychotischen Verhaltensmustern nicht wirklich überzeugend herstellbar ist, kann man bezüglich des Phänomenfeldes der sog. „Konversionshysterien“ auch nicht allzuviel sagen, wie mir scheint. Vielleicht ergibt ja die Diskussion meines hier vorgestellten „Ansatzes“ in dieser Hinsicht mehr. 10. Dem Betrachter wird die relative Sonderstellung der sog. „Fehlleistungen“ auffallen. Das Tafelbild nimmt an, dass diese zwar immer im Grenzbereich von „noch normalen“ und bereits pathologischen angesiedelt sind, dass sie jedoch nicht ätiologisch eindeutig behandelt werden können. Folgt man konsequent der Freudschen Argumentation und verknüpft diese mit dem Identitätsproblem, so lässt sich zumindest sagen, dass durch Fehlleistungen bestimmte Identitätsirritationen sich gewissermaßen „ankündigen“. Unklar ist jedenfalls auch im Rahmen der Psychoanalyse, ob sie psychotische oder neurotische Krankheitsformen designieren. Ja selbst der Bezug zu den psychosomatisch begründeten Spannungskopfschmerzen und Migräneattacken ist alles andere als geklärt. Dem trägt das Tafelbild insofern Rechnung, als diese Fehlleistungen an zwei Stellen notiert sind. Hinzu kommt jedoch ein aus der soziologischen Perspektive noch sehr viel wichtigerer Aspekt: Betrachtet man den von Homans mitgeteilten Fall eines jugendlichen Keglers, der, obwohl in der Gruppenhierarchie sozial sehr niedrig positioniert, bei dem – seitens der Gang hoch bewerteten – Kegelspiel überraschend gute Leistungen zeigt, so ist folgendes 259 interessant: Die Gruppenmitglieder empfinden den Widerspruch als Zumutung und beginnen ganz automatisch den betreffenden Jungen gezielt zu irritieren. Der Junge reagiert zunächst einmal mit Aggressivität – einer in diesem Zusammenhang durchaus vernünftigen Reaktion –, dann jedoch häufen sich seine Fehlwürfe, die ganz offenkundig darauf zurückzuführen sind, dass der Betreffende ganz einfach nicht mehr weiß, ob er sich mit seinem niedrig dotierten Gruppenstatus oder mit seiner Rolle als „Leistungsstarker Kegler“ identifizieren soll/darf. Der Gruppendruck ist hierbei so groß, dass die gute Leistungsfähigkeit schließlich aufgegeben wird, um nur ja nicht der Zuwendung der anderen Gangmitglieder verlustig zu gehen. Jedesmal wenn ähnliche Situationen anstehen häufen sich bei dem Jungen nicht nur die kegelbezogenen Fehlleistungen, er fängt auch an zu stottern und macht Unmengen von Symptomgesten. In diesem Fall geht „ätiologisch eindeutig“ eine Serie psychopathologischer Verhaltensmuster auf das Konto des Gruppenkonflikts, der ihm eine rollensystematische Identitätsentscheidung zumutet, der er sich nicht gewachsen fühlt. Die durch Fehlhandlung auffällig gewordenen realitätsfugativen Tendenzen sind sinnenfälliger Ausdruck seiner in dieser Situation sich geltend machenden Unfähigkeit zur Identitätskonstruktion. Konkret aber bedeutet das, dass wir es hierbei mit eindeutig sozialstrukturell bedingten psychopathologischen Verhaltensmustern zu tun haben, bei der sich zwei konfligierende Identitätsstrukturen überschneiden: Die durch die niedrige Positionierung „eingeschliffene“ Identitätsverortung des Jugendlichen befindet sich im Widerspruch mit der Identitätsanmaßung desselben, eine hochbewertete Gruppenleistung möglichst gut zu bringen. Die hier angesprochene Fehlleistungsproblematik ist jedoch noch aus einem anderen Grunde für unser Thema hoch interessant: Sinnvoll lässt sich der Begriff der „Fehlleistung“ nur dann verwenden, wenn wir mit einer – wie oben beschrieben – idealtypischen Fiktion operieren. Sie lässt sich ungefähr folgendermaßen skizzieren: Eigentlich, das heißt „normalerweise“, hätte der XY in der und der Situation sich folgendermaßen verhalten müssen, was er jedoch nicht getan hat. Wie unschwer zu sehen, stoßen wir selbst in diesem Zusammenhang auf das analytische Hilfsmittel der idealtypologischen Konstruktion. 11. Völlig außer Acht gelassen wird überdies das Problem der personalen Desintegration, oder genauer noch: der variierenden Erscheinungen von personaler Desintegration. Auch dies ist ganz bewusst geschehen. Der mögliche Zusammenhang zwischen malignen Identitätskrisen bzw. identitätskritischen 260 Dauerzuständen mit personalsystemischen Desintegrationserscheinungen bildet ein eigenes Problemfeld, auf welches so lange nicht eingegangen werden kann, solange die theoretischen Voraussetzungen einer adäquaten Diagnostik nicht geklärt sind. Angesprochen wird hiermit jedenfalls – und darauf muss zumindest hingewiesen werden – ein Problem der Psychodynamik, zu dessen genauer Behandlung ganz einfach die bisher vorliegenden klinsich-psychiatrischen Fachkenntnisse und Erfahrungen nicht ausreichend sind. Zweifelsohne wird der erfahrene klinische Praktiker zu genau diesem Problem durchaus sehr viel mehr zu sagen haben, der Soziologe hingegen würde sich einer Kompetenzenüberschreitung schuldig machen. Interpretation im Lichte des bisher erarbeiteten Erkenntnisstandes: 1. Bekanntlich wird aus dem Blickwinkel der Psychoanalyse das Auftreten psychopathologischer Verhaltensmuster generell unter dem Oberbegriff der „IchSchwäche“ subsumiert, wobei gleitende Übergänge angenommen werden von „noch normalen“ bis hin zu den extremen Formen. Aus diesem Blickwinkel sind Zwangsneurosen komparativ und gestaffelt: Erscheinungsformen Einige des Psychoanalytiker psychotischen umschreiben Formenkreises die graviden psychotischen Erscheinungsformen als narzisstische Zwangsneurosen, andere plädieren für eine prinzipielle Trennung. Freud selbst zeigt bei der Interpretation dieses Problems einige Schwankungen, die nur durch konsequente texthermeneutische Analyse geklärt werden könnten. Jedenfalls sind sowohl die Zwangsneurosen als auch die Krankheitsformen des psychotischen Formenkreises extrem realitätsfugative Verhaltensformen, welche, als Erscheinungen von „Ich-Schwäche“, sich sozusagen aus „zwei Quellen“ speisen, wenn man hierbei konsequent rollensystematisch vorgeht: Realitätsfugativität wird gleichbedeutend aufgefasst mit der Unfähigkeit, dem Anforderungskatalog der dem „Ich“ zugemuteten sozialen Rollen adäquat Rechnung tragen zu können, und ist Resultante einer primordial „angelegten“ Unfähigkeit, in bestimmten „kapazitätsüberfordernden“ Handlungskontexten die einmal gelernten Identitätskonstruktionsprinzipien anzuwenden. Das Tafelbild 3 zerlegt die möglichen Realitätsabweisungen in zwei große Teilmengen: Entweder „klammert“ sich das durch soziale Anforderungen überforderte „Ich“ an ganz bestimmte Rollenstereotype, die dann ritualistisch und „zwanghaft“ wahrgenommen werden – wir haben dann den Tatbestand der „Rollenfixation“ –, oder aber – so drückt es Freud selbst aus – das 261 durch Realität bedrohte „Ich“ zieht sich in eine Wahnwelt zurück und ist bei identitätskritischem Dauerzustand letztendlich nur noch damit beschäftigt, diese „innere Realität“ möglichst logisch perfekt durchzukonstruieren. 2. Mir kommt es hier ausschließlich darauf an, darauf hinzuweisen, dass sich, wenn man das soeben aufgewiesene Problemfeld ernst nimmt, eine extrem spannende Diskussion zwischen psychoanalytisch orientierten Psychiatern und genuin soziologischem „point of view“ ergeben könnte, die vielversprechend zu sein scheint. Es ist unschwer zu sehen, wie sich im Schnittpunkt beider Perspektiven das sog. Irrationalitätsproblem ausgesprochen fruchtbar diskutieren ließe, jedoch müsste man dann wohl von der in dieser Arbeit verfolgten Heuristik ausgehen, die seitens der psychoanalytisch orientierten Psychiater vorgetragene Klassifikation von Krankheitsformen nach Maßgabe ihrer jeweiligen Beeinträchtigung idealtypisch gefassten rationalen Verhaltens zu diskutieren. Dafür jedoch müssten erst einmal die derzeitig in den meisten „Krankheitsformenlehren“ üblichen klassifikatorischen Schemata so komparativiert werden, wie ich es im nächsten Abschnitt an Hand der „Rationalitätskataloge“ vorführen werde. 3. Ausschließlich in diesem zuletzt angedeuteten Sinne, d.h. mit Block auf mögliche Komparativierungen und sodann eben auch mit Blick auf die Erarbeitung möglicher empirisch falsifizierbarer Hypothesen erinnern wir an die in Abschnitt II. 6. 2. vorgestellten „Fundamentalannahmen der Psychoanalyse“ und versuchen aus diesem Blickwinkel eine entsprechende Interpretation. Die wichtigsten seelischen Vorgänge, so hieß es in der ersten Fundamentalannahme, seien die unbewussten Vorgänge. Dieser Interpretation zufolge bilden dann die Formen des subjektiv sinnhaften rationalen Handelns des „Normal-Ichs“ lediglich so etwas wie eine „Verhaltensoberfläche“. Die Annahme postuliert auch und gerade bezüglich der mit dem Rationalitätsetikett versehenen schraffierten Fläche des Tafelbildes ein mitlaufendes unbewusstes Begleitprogramm von Lernprozessen. Es wäre ja auch extrem unwahrscheinlich, dass beispielsweise der klassische „Widerständler“ oder aber der „reine Delinquent“ niemals psychopathologisch auffällig werden könnten. Zuzugeben jedoch wäre, dass sich hierbei eine interessante These ergäbe: Psychopathologische Erscheinungsformen in der Verhaltensdynamik korrelieren negativ mit virtuos gehandhabter Delinquenz oder radikalem Widerstandsverhalten. Bekanntlich ist in den militanten Randgruppen der 68er-Bewegung, insbesondere vom 262 sog. „Sozialistischen Patientenkollektiv“, genau diese These später dann auch vertreten worden. Hierauf gehe ich in dieser Arbeit nicht näher ein. Wichtiger ist mir an dieser Stelle vielmehr, dass aus der hier entwickelten soziologischen Perspektive und mit Blick auf mögliche Komparativierungen, die sozusagen den „Übergang markieren“ für die eventuellen empirisch falsifizierbaren Hypothesen die erste Fundamentalannahme umformuliert werden muss. Sie lautet dann: Unbewusste Vorgänge sind diejenigen Vorgänge, die sich durch Beeinträchtigungen eigentlich zu erwartenden rationalen Handelns als Zwänge bemerkbar machen. Diese Zwänge drücken gewissermaßen auf das subjektiv sinnhafte intentionale Handeln und beeinträchtigen die zum Handlungskonzept ja genuin zugehörigen Entscheidungsspielräume, was noch deutlicher werden wird, wenn wir uns nachstehend mit den „Rationalitätskatalogen“ eingehender befasst haben werden. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang auch an die Erläuterung der ersten Fundamentalannahme: In der Regel kann ein rational handelnder Mensch die Frage, warum er so und nicht anders gehandelt habe im Nachhinein durchaus beantworten und auf diese Art und Weise gemachte Fehler analysieren und seine Auffassung revidieren. Mit anderen Worten: Er kann aus seinen Fehlern lernen. Dies ist jedoch nur idealtypisch der Fall, würde der aufmerksame Psychoanalytiker – und dies in der Tat zu Recht – anmerken: Wirklich konsequent kann er das keineswegs, da ihm die eigentlichen Gründe seines fehlerhaften Verhaltens gar nicht bewusst werden können. Daraus aber folgt: Fehlerkorrektur in rationalem Umfang ist zwar bis zu einem gewissen Punkt möglich, dieses rationale Verhalten wird jedoch mit Sicherheit sofort aufgekündigt, wenn es an den eigentlichen Affekthaushalt geht. Problemlos ist so sichtbar, in welcher Hinsicht das Webersche Konstrukt des „subjektiv sinnhaften Verhaltens“ aus psychoanalytischer Sicht ergänzungsbedürftig wäre. 4. Reflektieren wir – dies ebenfalls aus dem mit der vorigen These sich eröffnenden Blickwinkel – die zweite Fundamentalannahme so lässt sich die Struktur der Beeinträchtigung rationalen Handelns aus dem Bereich des Unbewussten sogar inhaltlich „auffüllen“: Es sind insbesondere die sexuellen Triebstrukturen, die vornehmlich ganz bestimmte Beeinträchtigungen rationalen Handelns verursachen. Eine genauere Erfassung dieser Form von Beeinträchtigungen jedoch wäre nur dann überhaupt möglich, wenn wir uns näher mit dem von Freud analysierten Verdrängungsmechanismus beschäftigen würden. Das ist an dieser Stelle natürlich 263 nicht möglich, bräuchten wir doch hierfür die erst im nächsten Denkabschnitt vorgeführten Ausformulierungen des Rationalitätsproblems. Jedoch können wir durchaus eine Zusatzhypothese bereits an dieser Stelle wagen: Je umfassender die Impulse aus der sexuellen Dynamik in der Primordialphase der Sozialisation einst verdrängt worden waren, desto massiver die jeweiligen psychopathologisch auffälligen Verhaltenssyndrome. 5. Ich komme zum (vorläufigen) Abschluss und fasse zusammen: Aus dem Blickwinkel einer Idealtypologie rationalen Verhaltens, wie sie die Webersche „Begriffslehre des sozialen Handelns“ liefert, sind die irrationalen Verhaltensmuster in ihrer ganzen Bandbreite streng genommen Ausnahmefälle. Aus dem Blickwinkel der Psychoanalyse jedoch ist es genau umgekehrt: Tatsächliches Rationalverhalten ist der absolute Ausnahmefall, welcher in „reiner“ Form in der Psychoanalyse genauso wenig auftreten kann wie in der Verstehenssoziologie. Dieser Punkt ist mir sehr wichtig, verweist er doch auf das mir am Herzen liegende methodologische Grundproblem. Wie ein Blick in den obig behandelten wissenschaftstheoretischen Thesenkatalog lehrt, standen wir vor dem gravierenden Problem, dass die Zusammenfügung vom soziologischen Handlungsmodell und psychoanalytischem „point of view“ einen glatten Selbstwiderspruch in den Grundannahmen erzeugen würde. Wie wir sehen können, ist dies auch der Fall, und zwar nicht erst im Hinblick auf das erkenntnistheoretische Verstehensproblem. Wir sehen jedoch, dass genau dann, wenn es uns gelingt, die „Beeinträchtigungsthese“ in Gestalt von Komparativierungen und operativen Begrifflichkeiten auszuformulieren, eine vernünftige Chance besteht, Psychoanalyse und Handlungssoziologie so miteinander zu verknüpfen, dass ein solcher Selbstwiderspruch vermeidbar ist. Wir müssen uns lediglich der Tatsache bewusst sein, dass wir damit konsequent das Problem des Zusammenhangs von „Identitätskrisen“ und „psychopathologischen auffälligen Verhaltensmustern“ auf das Gebiet der methodologischen Betrachtungsweise verlagern. Und das genau ist das Anliegen der vorliegenden Arbeit, woraus sich vorläufig ergibt: Pathologische Erscheinungsformen humanspezifischen Verhaltens manifestieren sich Verhaltensmuster, – die gegenüber sich der sowohl im sozialen Mitwelt – als irrationale Konformitätsbereich als auch im Devianzbereich antreffen lassen. Während jedoch deviante Formen der Irrationalität zumeist realitätsfugativ sind, sind die in Gestalt von anankistischen Syndromen sich 264 äußernden rollenfixativen Irrationalismen in der Regel realitätsverengend. Das subjektiv sinnhafte Verhalten von Menschen beruht auf der gekonnten Handhabung der in der primordialen Sozialisationsphase erworbenen Methoden der Identitätskonstruktion, die, wie zu vermuten ist, ein ganz bestimmtes Grundmuster bei jedem Individuum aufweisen, auf das in den späteren identitätskritischen Phasen immer wieder zurückgeriffen wird, sich dann bewähren kann oder auch nicht. Die pathologischen Verhaltensmuster sind dann die Resultanten jeweils auf eine bestimmte Art und Weise angewandter erfolgloser Methoden der Versuche Identitäten zu rekonstituieren. 8. Zum Problem der Rationalität 8.1. Einige überleitende Bemerkungen – Der genuin soziologische Gesichtspunkt und die zentrale Bedeutung des Handlungsbegriffs Zu erinnern ist an dieser Stelle zunächst einmal an die Eingangsausführungen, in denen darauf hingewiesen wurde, dass die vorliegende Arbeit im Problembereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie – oder genauer noch: im Problembereich der sog. „psychosozialen Heilkunde“ – angesiedelt ist. Es ist also davon auszugehen, dass das, was hier als soziologische Perspektive entwickelt wird, auf einen Rezeptionsraum zugeschnitten ist, dem vieles von dem, was „Soziologie“ heißt, fremd sein dürfte. Nachstehend werden in diesem Sinne einige soziologische Selbstverständlichkeiten zur Sprache kommen, die dem Fachsoziologen trivial erscheinen mögen. Das braucht uns jedoch nicht zu kümmern. Hier geht es ausschließlich darum, den genuin soziologischen Standpunkt so klar wir nur möglich hervortreten zu lassen, um von diesem her das Problem der „Identitätskrisen“ vor allem diagnostikrelevant beleuchten zu können. Zu beachten ist bei den nachstehenden Ausführungen in erster Linie die (selbstgesetzte) Aufgabenstellung des hier Vorgelegten, wie sie weiter oben in dem „Relevanzabschnitt“ der Einleitung formuliert wurde: Zwar sind letztendlich nur genuin maligne Identitätskrisen in dem Sinne diagnostikrelevant, als sie mit genuin irrationalen Verhaltensmustern verknüpft 265 sind, jedoch lassen sich dergestalt „irrationale“, d.h. Verhaltensmuster im klinischpathologischen Sinne, nur und ausschließlich vor dem Hintergrund einer als Bezugssystem fungierenden Idealtypologie rationalen sozialen Handelns, wie Max Weber sie erarbeitet hat, überhaupt diagnostizieren. Was aber ist – noch einmal gefragt – die „Soziologie“ und was genau ist ihr Gegenstand, wenn wir versuchen, bei der Bestimmung desselben erst noch einen Schritt hinter das von Max Weber Geleistete zurückzugehen? Denn wie bei der Skizzierung des Forschungsstandes bereits angedeutet, dürften sehr wenige mit dem Wort „Soziologie“ mehr als nur Triviales verbinden. Sie ist diejenige Wissenschaft, die sich mittels der Methode des „deutenden Verstehens sozialen Handelns“ mit dem Phänomen, „Gesellschaft“ als einem Tatbestand an sich befasst, als einem Tatbestand also, der auf unserem Planeten irgendwann einmal eingetreten ist, und den diese „Soziologie“ eben als ein sich entwickelt habendes und nach wie vor sich weiter entwickelndes Geschehen in seinen mannigfaltigen Formen zu analysieren versucht.199 Ihren Gründungsvätern zufolge – ich denke hierbei vor allem an Durkheim und Weber – ist sie eine Notwendigkeit, weil die anderen Wissenschaften, die sich mit bestimmten Aspekten genau dieses Geschehens befasst haben bzw. befassen, einen wesentlichen Gesichtpunkt bei der Erforschung genau dieses Teilphänomens der „Menschenwelt“ außer Acht gelassen haben, außer Acht lassen mussten bzw. es nach wie vor müssen: den Gesichtspunkt, dass zwei oder mehr Menschen, die sich aufeinander beziehen und sich in ihrem „Verhalten“ subjektiv sinnhaft aneinander orientieren, etwas anderes bilden und sind, als sie es jeweils für sich oder 199 Ganz bewusst habe ich diesen prima facie etwas umständlich wirkenden heuristischen Zugang gewählt. Ebenso wenig wie „die Sprache an sich“ etwas konkret vorfindliches ist und streng genommen nur als Kunstprodukt der seit Saussure bestehenden strengen Linguistik „existiert“, ebenso steht es mit dieser „Gesellschaft“. Wie meine Kollegin Marina Demetriou die mich auf diesen Aspekt eines Forschungsansatzes freundlicherweise hingewiesen hat, sich bei ihren „ästhetiko-linguistischen“ Forschungen auf die hierzu relevanten Ausführungen von F. de Saussure stützt, tue auch ich es bei meinem Soziologieverständnis. Dies allerdings in enger Anlehnung an die Webersche „Begriffslehre des sozialen Handelns“, die ich so gewissermaßen „saussureanisch“ behandelt wissen will: Ebenso wie es zwar Unmengen von historisch gewordenen „Sprachen“, nicht jedoch „die Sprache an sich“ gibt, gibt es Unmengen von historisch realisierten „Formen des menschlichen Gemeinschaftslebens“, nicht jedoch „die Gesellschaft an sich“. Der Grundgedanke, auf den ich hier abhebe, ist als solcher vermutlich sehr wohl bei Max Weber vorhanden, jedoch hat die monopolistisch gehandhabte dogmatische Weber-Exegese vor allem der „Heidelberger Schule der Kultursoziologie“ (Lepsius, Schluchter, Schwinn) ihn „so“ noch nicht einmal bemerkt. 266 auch als Angehörige der – biologisch gefassten – Spezies „Mensch“ sind.200 Sowie nämlich mindestens zwei Menschen sich ins Benehmen zueinander setzen, passiert etwas, was eben Gegenstand der Soziologie und nur der Soziologie sein kann: Die beiden Individuen müssen handeln bzw. sozial handeln, weil sie „urplötzlich“ in einem allgemeinen, institutionell vorausgestifteten Sinnzusammenhang stecken. In genau diesem Sinne ist der Begriff des „sozialen Handelns“ der eigentliche Grundbegriff derjenigen Abteilung der empirischen Sozialforschung, die „Soziologie“ genannt zu werden pflegt. Diesen Gedanken galt es in der vorliegenden Untersuchung in enger Anlehnung vornehmlich an die Webersche Grundlagenforschung konsequent und möglichst umfassend so zu entwickeln, dass dadurch vom soziologischen Standpunkt her Licht geworfen wird auf bestimmte Aspekte der „Psychiatrie“, welche sie selbst aufgrund ihres spezifischen Erkenntnisstandpunktes notwendigerweise nicht so deutlich sehen kann. Genauso hat bereits Marx in einem 1846 geschriebenen Brief an Annenkow den Begriff der „Gesellschaft“ definiert: „Gesellschaft“ sei „das Produkt des wechselseitigen Handelns der Menschen“ und folgerichtig findet sich bei Weber die Soziologiedefinition welche besagt, dass es sich bei der sog. „Soziologie“ um diejenige „Wissenschaft“ handele, welche „soziales Handeln deutend verstehen“ und eben dadurch dieses soziale Handeln „in seinem Ablauf wie in seinen Wirkungen ursächlich erklären“ wolle. Wir können uns vorläufig auf die Formel stützen: Menschliche Wesen als biologische Organismen verhalten sich ebenso wie menschliche Wesen psychologisch als Individuen sich verhalten, wohingegen sie soziologisch gesehen „subjektiv sinnhaft Handeln“ und sich dabei an anderen gleichfalls subjektiv sinnhaft Handelnden orientieren (können). Oder um ein berühmtes Beispiel Max Webers zu nehmen: Stoßen zwei Radfahrer zufällig zusammen, weil sie vielleicht für einen Augenblick die nötige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr vernachlässigt haben, so verhalten sie sich (bloß), sehen sie jedoch – vielleicht erst im letzten Moment – auf, nehmen den anderen wahr, erkennen die Gefahrensituation und versuchen noch einander auszuweichen, in der Absicht den drohenden Zusammenstoß zu vermeiden, dann handeln beide subjektiv sinnhaft, ganz einfach deshalb, weil sie etwas zu vermeiden trachten, was als bedrohlich empfunden unmittelbar auf sie zukommt. In genau diesem Augenblick, in welchem sie sozusagen „im letzten Moment“ aufeinander Bezug nehmen und 200 In dem wunderschönen Film „Die Reisen des Mr. Leary“ hat dies der Protagonist ungemein treffend formuliert: „Wichtig ist nicht so sehr, dass bzw. ob man jemanden liebt, sondern vielmehr: was man ist, wenn man mit jemand anderem zusammen ist.“ 267 sich auszuweichen versuchen, „passiert“ Gesellschaft, denn nunmehr ist die „Interaktion“ zwischen den beiden zuvor in ihre je eigene Gedankenwelt versunkenen Radfahrer, welche ihre Pflichten gegenüber ihren Rollen als Verkehrsteilnehmer gröblichst verletzt hatten, durch die wechselseitige Bezugnahme auf das mögliche Handeln „des anderen“ strukturiert, d.h. wir haben eine typische „minimale soziale Situation“, für die selbstverständlich auch ganz bestimmte soziale Ordnungskriterien angegeben werden können: Die beiden Radfahrer interagieren in genuin soziologischem Sinne, könnten ja vielleicht auch noch mimischgestisch kommunizieren, tun es vielleicht sogar, und müssen überdies – bei einem eventuellen Prozess, welcher die Schuldfrage juristisch zu klären hätte – miteinander über den Vorfall sprechen. Alles das aber ist virtuell nur und ausschließlich denkbar, weil ein vorausgestifteter institutioneller Sinnzusammenhang überhaupt existiert. Insofern gilt eben auch die in Abschnitt II. 2. vorgestellte zweite Grundannahme des sog. „symbolischen Interaktionismus“, die ich an dieser Stelle noch einmal der Deutlichkeit halber zitiere: „Die Theorie [des symbolischen Interaktionismus] nimmt ferner an, dass der fruchtbarste Weg zu einem wissenschaftlichen Verständnis des menschlichen Verhaltens über eine Analyse der Gesellschaft führt.“ Und er „hält ..... daran fest, dass jedes denkbare Individuum in eine bestehende ..... Kultur [bzw. in ein vorausdefiniertes Rollensystem] hineingeboren wird. Statt eine metaphysische Priorität der Gesellschaft vor dem Individuum oder umgekehrt zu behaupten, umgeht der „symbolische Interaktionismus“ diese philosophische Frage dadurch, dass er seine Analyse [ebenso wie Max Weber] mit dem sozialen Handeln beginnt und daraus sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft ableitet. Auf diese Weise sorgt er für eine klare Soziologie und Sozialpsychologie: Die erstere beginnt mit dem sozialen Handeln und baut darauf auf bis zur Gesellschaft; die letztere beginnt ebenfalls mit dem sozialen Handeln und arbeitet in die andere Richtung, nämlich in Richtung auf das Individuum.“ Um vollends deutlich zu machen, worum es geht, wenn von genuin soziologischen Sozialphänomenen die Rede ist, denken wir uns einen Verkehrpolizisten, der den Vorfall des Radfahrerzusammenstoßes durch ein Videogerät hat verfolgen können. Für ihn als den am unmittelbaren Vorfall ja unbeteiligten Beobachter, befinden sich die beiden Radfahrer in bestimmten durch die jeweilige Verkehrssituation – dies die institutionelle Rahmenbedingung – festgelegten sozialen Positionen, die in diesem Fall überdies auch noch geographisch 268 bestimmt sind – was soziologisch eigentlich keine Rolle spielt201 –, denen ganz bestimmte Rollenverpflichtungen auferlegt sind und die sie ganz offenkundig wegen ihrer Unaufmerksamkeit nicht situationsadäquat wahrnehmen bis zu dem Moment, wo sie, „in letzter Minute“ vor dem drohenden Zusammenstoß erschreckend, hoch blicken und nunmehr ihre Rolle gemäß ihrer verkehrsmäßigen Positioniertheit auch subjektiv zu übernehmen versuchen, was ihnen freilich wirklich situationsadäquat kaum noch gelingen dürfte. Dies können wir natürlich auch in einer etwas anderen Sprache ausdrücken, die auf unser Thema zurückführt: Die im letzten Moment erfolgten Rollenübernahmen designieren zugleich auch den sozialen Tatbestand, dass sich unsere beiden erst im letzten Augenblick und vermutlich viel zu spät mit ihren Rollen als verantwortliche Verkehrsteilnehmer identifizieren. Wenn es nachstehend um die Aufhellung der Struktur(en) der personalen Rationalität gehen wird, ist dieser genuin soziologische „Sinnzusammenhang“, auf den expressis verbis bereits in Abschnitt II. 2. aufmerksam gemacht wurde, immer mitzudenken: „Gegenstand der Menschenwissenschaften“, so hieß es dort, seien „Wesen, die, weil sie kommunikativ (sprachlich) kompetent mithin also auch zu subjektiv sinnhaftem Sozialverhalten fähig sind, etwas wollen, und die bezüglich dessen, was sie wollen, eben Mittel anwenden, von denen sie glauben, dass sie zur Erreichung dessen, was sie wollen, geeignet sind. Sie handeln, insofern sie im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind, als aktiv Handelnde, die gelernt haben (müssen), dass es andere aktiv Handelnde gibt, die ebenfalls ihre Interessen verfolgen bzw. etwas wollen, und die bezüglich dessen, was sie wollen, (gleichfalls) Mittel anwenden, von denen sie glauben, dass sie zur Erreichung dessen, was sie wollen, geeignet sind.“ 201 Worauf es soziologisch ausschließlich ankommt, ist, dass die verschiedene Positionierung der beiden Radfahrer je spezifische situationsadäquate zweckrationale Handlungsmuster erforderlich macht: Der von links kommende Verkehrsteilnehmer – muss sich gemäß der objektiv bestehenden Verkehrsituation – dies der sozialstrukturelle Aspekt – gemäß anders verhalten als der von rechts kommende Radfahrer. Beide haben in diesem durch die formellen wie informellen (Verkehrs-)Regeln bestimmten „Spiel“ verschiedene Positionen und nehmen folgerichtig auch verschiedene Rollen ein, welche ganz bestimmte (normierte) Anforderungen bzw. Erwartungen beinhalten. 269 8.2. Personale Rationalität Unter diesem Gesichtspunkt seien an dieser Stelle zunächst einmal acht Kriterien für rationales Handeln aufgelistet und zwar der individualbezogenen Rationalität. Zu beachten ist hierbei, dass die Auflistung der nachstehenden Postulate – zunächst noch – relativ willkürlich ist, ja, relativ willkürlich sein muss. Es wird lediglich so etwas eine Vorverständigung bezüglich dessen angestrebt, was bei näherer Betrachtung sodann um der Konstruktion empirisch falsifizierbarer Hypothesensysteme willen präzisierungs- und modifizierungsbedürftig ist. Geachtet wird bei den nachstehenden „Postulaten“ lediglich darauf, dass wir uns zumindest einigermaßen im Einklang befinden mit der bereits eingeführten Weberschen Begriffsbestimmung des Gegenstandsbereiches der Soziologie als einer „Verstehenden Sozialwissenschaft“, welche, wie gezeigt, sowohl mit den Strykerschen als auch mit den Gadamerschen idealtypologisch gefassten anthropologischen „Grundannahmen“ übereinstimmt und in expliziter Form besagt: „Soziologie (im hier verstandenen Sinn dieses sehr vieldeutig gebrauchten Wortes) soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. „Handeln“ soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. „Soziales“ Handeln aber soll ein solches heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten a n d e r e r bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist.“202 202 Weber [Wirtschaft und Gesellschaft] S.1. Bisher ist wohl noch nicht bemerkt worden, dass und inwiefern hier eine begriffliche Ungereimtheit steckt, die Weber eigentlich nicht hätte unterlaufen dürfen. Genau müsste es heißen: „Soziologie ... soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. »Handeln« soll dabei ein menschliches Verhalten heißen, wenn und insofern als der oder die (sich) Verhaltenden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden.“ Das sieht man sofort, wenn man diese „Definition“ sprachlich stringenter fasst: Dann und nur dann, wenn ein menschliches Wesen sich dergestalt verhält, dass es mit diesem Verhalten bzw. insofern es mit diesem Verhalten einen subjektiven Sinn verbindet, wollen wir von dem „Handeln“ eben dieses menschlichen Individuums sprechen. Soziologie ist also dieser Nomenklatur zufolge diejenige Wissenschaft, die nur und ausschließlich (humanspezifische) 270 Es wurde des öfteren bereits auf diese Soziologiedefinition Max Webers bezuggenommen. An dieser Stelle, wo es um die Demonstration der Erkenntnisfunktion des Rationalitätskonstruktes geht, geht es um folgendes: Wie bereits weiter oben festgestellt, unterscheidet Weber scharf zwischen dem Verhalten eines Menschen und seinem Handeln, wie man sieht. An einem etwas primitiven Beispiel lässt sich mühelos demonstrieren was damit gemeint ist: Fällt plötzlich Licht ins Auge, so verhält sich das Individuum, in dem sich seine Pupillen verkleinern und es „blinzelt“. Sein organisches Geschehen passt sich den veränderten Lichtverhältnissen an und dieser Anpassungsvorgang ist als situationsadäquates (Reflex-)Verhalten ebenso beobachtbar wie z.B. sein Verbalverhalten. Verbindet ein Individuum hingegen mit seinem „Verhalten“, in dem es z.B. an einem kleinen Teich angelt – entweder zu seinem Vergnügen oder aber um Fische zu fangen, die es dann verzehren bzw. verschenken oder verkaufen möchte – einen subjektiven Sinn, so steckt dahinter eine Absicht, ein Wille – die betreffende Person handelt. Und zwar handelt sie in diesem Sinne zweckrational. Insbesondere in ihrem Verhältnis zur Medizin ist dieser Punkt, wie unschwer zu sehen, von großer Bedeutung, betrifft er doch die Struktur des Interaktionsverhältnisses zwischen ihm und der Person die er untersucht: Der Arzt, der einen Patienten zwecks Feststellung von dessen gesundheitlichen Befinden untersucht, konzentriert sich in der Regel mehr auf das organismische Geschehen, d.h. er handelt zweckrational, um überprüfen zu können, ob alles im „Normalbereich“ liegt, orientiert sich jedoch nicht – das gilt zumindest für diesen Fall – am gleichfalls möglichen subjektiven sinnhaften Verhalten des Patienten. Konsequent durchgeführt haben wir hier also keine genuin soziologische Situation, da die Interaktion zwischen Arzt und Patient in diesem Falle wesentlich assymetrisch verläuft. Der Arzt überprüft mehr das Verhaltensrepertoire seines Patienten als dessen Handlungsrepertoire. Es ist unschwer zu sehen, dass und inwiefern in einer genuin psychiatrischen „minimalen sozialen Situation“, zumal dann, wenn der Arzt als Psychoanalytiker sich versteht, die ganze Angelegenheit völlig anders aussieht. Die im soziologischen Sinne zwischen dem Arzt und dem Patienten sich ereignende „Gesellschaftlichkeit“, wie wir sie oben beschrieben haben, nimmt erst dann konkrete Formen an, wenn der betreffende Arzt das Handlungsrepertoire eines Menschen in den Mittelpunkt seiner Interaktion mit diesem stellt, wodurch sich die Situation zwischen ihm und dem Verhaltensvorgänge analysiert, welche mit subjektivem Sinn verbunden sind. Ein Kind in der (unmittelbaren) Postnatalperiode handelt nicht, es verhält sich. 271 Patienten fundamental wandelt. Reflektiert der betreffende Arzt überdies auch noch sein soziales Handeln, so wird er gewissermaßen zu einem praktischen Soziologen. Und dies ist genau die Situation, die wir im streng soziologischen Sinne vor uns haben, wenn ein sensibler Psychiater wirklich verstehen will, was im Inneren seines Patienten vorgeht. Natürlich müsste die hier nur grob skizzierte Situation positions- und rollentheoretisch wesentlich verfeinert werden. Darauf muss an dieser Stelle verzichtet werden, denn in diesem Abschnitt geht es mir mehr um die Kasuistik der Idealtypologie der Rationalität. Jedoch ist ganz sicher: Gerade ein kundiger und sensibler Arzt will auch verstehen, warum etwas bei einem Menschen so ist, wie es ist, und dabei nun bezieht er sich eben auch auf das, was sein Patent will bzw. wollte. Halten wir lediglich fest: Handeln ist als intentionales Verhalten in der Regel objektbezogen: Man will etwas und handelt entsprechend, um das, was man will, auch zu bekommen. Wenden wir uns erneut unserem Beispiel zu: Der an seinem kleinen See sitzende Angler handelt subjektiv sinnvoll und in der Regel naturgemäß auch „zweckrational“. Er handelt gewissermaßen solitär, denn er orientiert sich bei dem was er tut ja nicht an anderen Handelnden und bezieht sich in diesem Fall auch nicht auf solche. Und handelt er aus bloßem Vergnügen, so „genügt“ sein Handeln, wie man so schön sagt, „sich selbst“. Sein Handeln wird erst dann zu sozialem Handeln, wenn er mit anderen 1. interagiert 2. (mimisch-gestisch) kommuniziert 3. spricht. 203 203 In der Soziologie der Frankfurter Schule – dies gilt ganz besonders für die Arbeiten von Jürgen Habermas und seine Schüler – wird auf die moralphilosophische Einbettung dieses Zusammenhang viel zu viel Wert gelegt, wodurch, wie ich finde, der genuin soziologische Gesichtspunkt, welchen ich explizit hier herauszuarbeiten versucht habe, viel zu sehr ins Sozialphilosophische hineinverlagert wird. Genau dieser Punkt ist ja auch dann – wie ich heute meine: bezeichnenderweise – zwischen dem Habermasschüler Rolf Zimmermann und mir in unserer kleinen Kontroverse am 17.03.2004 zum Angelpunkt unserer – wie ich heute finde: prinzipiellen – Auseinandersetzung geworden: Faktisch mögen die Ebenen der „Interaktion“, der „Kommunikation“ und des „Gespräches“ noch so sehr „ineinander fließen“, soziologisch analytisch hingegen müssen sie scharf auseinandergehalten werden, dürfen also auf gar keinen Fall moralisch interpretiert werden. Beachtet man diese wissenschaftsanalytische Maxime nicht, so setzt man sich eben dem Vorwurf der „Ideologisierung“ aus, wie ich Herrn Prof. Zimmermann betont habe: Es gibt nun einmal Interaktionsformen die rollenstrukturell so perfekt durchgebildet sind, dass die Kommunikativ- und Gesprächsanteile gegen Null 272 Sind andere wie er selbst zum subjektiv sinnvollen Handeln Fähige, mit „im Spiele“ – wie auch immer –, dann haben wir eine Handlungskonfiguration, bei der sich die „Agenten“ subjektiv sinnhaft aufeinander beziehen können oder müssen: interaktiv, kommunikativ und sprachlich. Es hat sich, wenn z.B. mehrere Angler sich an dem kleinen See einfinden, die entweder konkurrieren oder aber kooperieren, eine soziale Gemeinschaft gebildet, die - in diesem Falle – nach Maßgabe ihrer gemeinsamen Interessen sich vergesellschaftet: Ihr gemeinsames Hobby – das Angeln – fungiert so als Vergesellschaftungsmodus. Und wichtig im Sinne des in dieser Arbeit verfolgten Vorhabens ist nun, dass sich in diesem Zusammenhang ein System von Rollen herausbilden kann, bezüglich derer eben konformes wie deviantes Verhalten stattfinden kann. Die Beteiligten orientieren sich dann nicht mehr direkt aneinander, um Vergemeinschaftung überhaupt erst einmal auszubilden, sie orientieren sich vielmehr an den jeweiligen sozialen Positionen, die die Anglerkollegen hierbei einnehmen – sie können nebeneinander sitzen, sie können Konkurrenten sein, der eine kann den anderen mit fehlendem Gerät aushelfen etc. etc. – indem sie mit diesen Positionen bestimmte (Rollen-)Erwartungen verknüpfen. Handelt es sich gar um einen behördlich registrierten – einen sog. „eingetragenen“ – Anglerverein, der sich hier wöchentlich einmal trifft, so verfestigen sich Positionen und Rollen, weil sich ein bestimmtes organisatorisches Niveau ausbildet bzw. ausgebildet hat. Und ist dies einmal geschehen, so bilden sich natürlich auch in unserem kleinen Anglerverein ganz bestimmte Systeme der sozialen Kontrolle heraus. Ob und wie die Beteiligten sich einigen, streiten, beneiden oder aber einander bewundern etc., ob nach Maßgabe bestimmter gemeinsam akzeptierter Werte, Hierarchieverhältnisse sich einspielen, dass alles ist für die hier verfolgten Zwecke nebensächlich. Mir kommt es ausschließlich darauf an zu demonstrieren, was gemeint ist, wenn der Soziologe von einer genuin „soziologisch“ sich gebildet habenden „Gemeinschaft“ bzw. „Gesellschaft“ spricht. In seiner Kritik an Stammler hat Max Weber anhand eines „typisch deutschen“ Skatspiels verdeutlicht, was mit dieser „Arbeitsdefinition“ des genuin soziologischen „point of view“ gemeint ist. Man kann jedoch auch jedes andere Beispiel einer typischen Spielsituation nehmen, um sich zu verdeutlichen, um was es hier geht: „Gesellschaft“ ist, wie Marx in dem bereits zitierten Brief an Annenkow es ausdrückt, „das Produkt wechselseitigen Handelns der tendieren, und diese gilt es soziologisch zu analysieren, anstatt sie als „unmenschlich“, weil das Gegenüber zum Objektmachend, zu bewerten. 273 „Individuen“. Menschliche Individuen vergemeinschaften bzw. vergesellschaftlichen sich auf der Grundlage bestimmter historisch gewachsener institutionalisierter Gegebenheiten, die als „Regeln“ ihr jeweiliges Verhalten zueinander ordnen und die dabei im Spiel befindlichen Ordnungsgesichtspunkte wiederum sorgen dafür, dass die „so“ oder „so“ vergesellschafteten Menschen ganz bestimmte Rollen übernehmen, welche sie sinnstrukturell zu spielen haben, soll das entsprechende „Spiel“ zustande kommen und aufrechterhalten werden. Tritt im Zuge einer Spielpartie zu starke „Devianz“ auf, so ergeben sich „Störungen“ bzw. „Verstörungen“, die, wenn sie eine bestimmte Toleranz überschreiten, den Kollaps des Spiels herbeiführen. Diskutieren wir die personalen Rationalitätskriterien, so diskutieren wir die sozialen Kompetenzprinzipien, die erforderlich sind, soll ein solcher Spielkollaps vermieden werden. Den Fall, den der soziologische Fachbegriff der „Anomie“ betrifft, lassen wir dabei ebenso außer Betracht wie den Tatbestand, den Max Weber in seiner Herrschafts- und Religionssoziologie mittels des Begriffs des „Charismatikers“ beizukommen versucht hat. Von vorneherein achten sollte man jedoch bei den nachstehenden Katalogen auf Kriterien, die das sozusagen „solitäre Individuum“ und auf Kriterien, die das „sozial kompetente Individuum“ betreffen. Wie wichtig diese Differenzierung ist, haben wir ja bereits herauszuarbeiten versucht. Sozialisationstheoretisch stehen nämlich diese beiden Kriterien in einem ganz bestimmten Verhältnis zueinander.204 Doch davon später. Der Deutlichkeit halber indizieren wir diese beiden Aspekte der personalen Rationalität (solitär vs. sozial kompetent, d.h. Kompetenz zu subjektiv sinnvollem und absichtsgeleitetem Handeln auf der einen Seite und interaktivem, kommunikativem und sprachlichem Bezug auf der anderen Seite), indem wir in eckigen Klammern die entsprechenden Zuordnungen vornehmen. In diesem Sinne gilt sodann: 204 Es kann nämlich sein, dass wir gezwungen sind, subjektiv sinnhaft gestaltetes Handeln eines bestimmten Individuums von seinen sozialen Kompetenzen zu trennen, um empirisch beobachtbare Zusammenhänge in Form von Hypothesen abspiegeln zu können. Zweifelsohne gibt es ja florid Schizophrene, deren subjektiv 274 Katalog I 1. Ein rational handelndes Individuum muss die Fähigkeit der Entscheidung besitzen. Es muss seine Wahlalternativen wahrnehmen können. [solitäre Entscheidungskompetenz] 2. Ein rational handelndes Individuum, ist auf das Verhalten anderer bezogen, bezieht also das (mögliche) Verhalten anderer in seine Überlegungen mit ein. Oder genauer noch: Ein rational handelndes Individuum muss die Fähigkeit besitzen, sich auf das Verhalten anderer beziehen zu können, muss also imstande sein, das mögliche Verhalten anderer in seine Überlegungen einzubeziehen. [solitäre Entscheidungskompetenz und Sozialverträglichkeit] 3. Ein rational handelndes Individuum ist gesprächsfähig (kommunikativ kompetent).205 Kommunikative Kompetenz schließt die Fähigkeit ein, Symbole (Spielkartenbilder, Spielfiguren, Verkehrszeichen etc.) situationsadäquat deuten zu können.206 [solitäre Kompetenz und soziale Kompetenz] sinnhaft gestaltete (endogene) Kompetenz negativ korreliert mit den entsprechenden sozialen Kompetenzen. Ich zitiere hier nur das bekannte bon mot, welches besagt „nicht jeder Schizophrene ist verrückt“. 205 Ich erinnere an die obigen Ausführungen Abschnitt II. 2. sowie und Abschnitt II. 5. 4.: Die vorliegende Arbeit interessiert sich vor allem für den Zusammenhang zwischen der – in der primordialen Sozialisationsphase erworbenen – Rollendistanz, der Ausbildung entsprechender Rollenübernahmekapazitäten und der dazugehörigen kommunikativen Kompetenz. Wir stoßen hier allerdings auf ein ausgesprochen schwieriges sozialisationstheoretisches Problem, welches zur vollen Zufriedenheit in der vorliegenden Arbeit ganz sicher nicht gelöst werden kann: Auf das Problem derjenigen Dimension des (primordialen) Sozialisationsprozesses, die in der linguistischen wie in der psycho-linguistischen Forschung „Spracherwerbsprozess“ genannt wird. Es ist zu hoffen, dass gerade aus dem in der vorliegenden Arbeit explizit gemachten soziologischen Blickwinkel sich ja vielleicht auch Gewinn ziehen lässt für die z.T. festgefahrenen Diskussion der Linguisten und PsychoLinguisten. Hierzu sind in unserer Forschungsgruppe derzeitig vier Arbeiten geplant: die von Marina Demetriou, die von Eleni Liousi, die von Dietlinde Michael und die von Janna Rinderknecht. Im Resch’schen Lehrbuch ist dieser Aspekt absolut unzulänglich abgehandelt. Marina Demetriou und Porath glauben, dass die hierzu einschlägige Auseinandersetzung zwischen Linguisten und Psychologen vor allem deshalb so festgefahren ist, weil man den genuin soziologischen Aspekt des Problems wie er dezidiert bei Saussure noch vorherrschte, bereits bei Chompsky völlig in den Hintergrund getreten ist. Überdies scheint, wenn Porath Recht hat, die nativistische Chompskysche Argumentation wie auch die von dessen Epigonen vor allem daran zu kranken, dass nicht scharf genug unterschieden wird zwischen idealtypologischer Begriffskonstruktion, Grundannahmen und empirischen Hypothesen. 206 Ich erinnere hier an die Ausführungen II. 2., wo es um die Erläuterung der dritten Grundannahme des symbolischen Interaktionismus ging. Dort hieß es, dass der Mensch auf eine soziale Umwelt reagiere, die sich ihm von Anbeginn seines Lebens an – nämlich im Bezugsrahmen des familialen Interaktions- und Kommunikationsgefüges – als ein kategorial vermitteltes Symbolsystem darbiete, welches rollenstrukturell „immer schon“ seiner Daseinsform vorausliege und aus genau diesem Grunde könne er überhaupt subjektiv 275 4. Ein rational handelndes Individuum, muss nach Lage der Dinge unterscheiden können, was möglich ist und was nicht. [solitäre Entscheidungskompetenz und Realitätsadäquatheit] 5. Ein rational handelndes Individuum, muss die Konsequenzen je nach Entscheidung einkalkulieren können. Es muss die Kosten einkalkulieren können, die sich ergeben könnten, wenn eine bestimmte Entscheidung nun einmal getroffen worden ist. Und der entscheidende Punkt: Bevor es das tut, muss es gemäß den Bedingungen realgegebener Verhältnisse durchdenken können, welche möglichen Konsequenzen sich aus einer stattgehabten Entscheidung ergeben könnten. [solitäre Entscheidungskompetenz, Realitätsadäquatheit und Sozialverträglichkeit]207 6. Ein rational handelndes Individuum muss, bevor es Entscheidungen trifft, seine Interessen erkennen und interpretieren können. [solitäre Entscheidungskompetenz. Basale Bedarfsstrukturen müssen hierfür als „Interessen“ interpretierbar geworden sinnhaft handeln. Eines dieser rollensystemisch strukturierten Symbolsysteme ist nämlich die „Familie“, welche in der primordialen Sozialisationsphase ja zugleich auch die Identitätsbildung bestimmt. Menschen reagieren nämlich tatsächlich – und dies von Anfang an vermutlich – keineswegs nur „quasi reflexologisch“, sie sind vielmehr Wesen, die von Anbeginn ihres Lebens an mit Phantasie begabt das ihnen je zu eigene Reaktionspotenzial kreativ zu handhaben wissen. Nicht die Individuen als solche seien es, so wurde betont, vielmehr seien sie es als menschliche Wesen, die in genau dieser Hinsicht als „kreativitätskompetent“ aufgefasst werden müssen. Dass der Mensch in diesem Sinne sowohl Handelnder als auch Reagierender sei, dass er nicht auf die Umwelt als einer bloß physikalischen Gegebenheit, sondern auf eine Umwelt antworte, wie sie symbolisch vermittelt ist, sei von ausschlaggebender Bedeutung: „Da [nämlich] die Menschen auf symbolische Umwelten reagieren und die Menschen ihre eigenen Symbole produzieren, kann der Mensch sich also selbst stimulieren“, hieß es dann wörtlich in dem Stryker-Zitat. 207 Ich erinnere hier an den Schlußabsatz von II. 7. 1., wo es um das „Sozialisationsnadelöhr der Realitätsprüfung“ ging. Es hieß dort: Mündigkeit, soziale Handlungskompetenz sowie kommunikative Kompetenz überschneiden sich in ihren semantischen Kerngehalten, wenn man dabei auf die Grundannahme zurückgreift, dass diese drei Fähigkeiten wesentlich assoziiert sind mit der Kompetenz zur Wahrnehmung eventueller Handlungsalternativen und damit trivialerweise zur simulativen Beurteilung eventueller Handlungskonsequenzen. Dann nämlich, und nur dann, gilt auch die Erweiterung des Konstrukts der Handlungskompetenz durch den weiter oben bereits erörternden „Kostensatz“. Kompetent in diesem Sinne kann freilich ein „Individuum“ nur dann sein, wenn es mit Erfolg seine Lektion in der Ausbildung ganz bestimmter Ich-Funktionen und damit zum einen seine Lektion in „Metakommunikation“, zum anderen „seine“ Methode der Identitätskonstruktion gelernt hat: Ein Kind muss sozial lernen, zwischen dem was es sagt bzw. sagen will und dem Modus zu unterscheiden, in welchem gesagt wird, was es sagen will. Und hierfür muss es gelernt haben, virtuell seine Identität konstruieren zu können. Man kann in diesem Zusammenhang von dem „Sozialisationsnadelöhr der Realitätsprüfung“ sprechen, durch welches ein Sozialisand nun einmal „hindurch muss“, soll sein ihm „von Natur aus mitgegebenes“ Repertoire von Verhaltensbereitschaften sich erfolgreich um die Dimension der Befähigung zu subjektiv sinnhaftem Handeln bereichern, um so einen ganz anderen, ganz neuen Zugang zu seiner sozialen Mitwelt gewinnen zu können. 276 sein! Die Interpretation der Bedürfnisformationen als (eigene) Interessenlagen ist dem jeweiligen „Entscheidungsverhalten“ vorgeschaltet.]208 7. Ein rational handelndes Individuum muss Kompromisse schließen können um seine Interessen mit anderen abstimmen zu können. [soziale Entscheidungskompetenz und Sozialverträglichkeit] 8. Ein rational handelndes Individuum muss erkennen ob es das, für was es sich entschieden hat, auch wirklich will. [solitäre Entscheidungskompetenz und Identitätskonstruktionsprinzip] 209 Was fällt auf, wenn wir hierbei zunächst einmal a) die sprachliche Form, sodann b) die Webersche „Definition“ des Gegenstandsbereiches und schließlich c) unsere bisher eingeführten Sozialisationszielvorstellungen berücksichtigen? Selbstverständlich ist die hierbei relevante Kasuistik nicht nur auf relativ künstliche Handlungskontexte, wie es die Spiele ja nun einmal sind, beschränkt: Man kann problemlos auch das Beispiel einer ampelgeregelten Verkehrskreuzung oder eines Überholmanövers auf dicht befahrener Landstrasse, oder aber auch unser Radfahrerbeispiel nehmen, um zu zeigen, dass und inwiefern die Verkehrsteilnehmer sich gemäß der Weberschen „Definition“ verhalten (müssen bzw. sollten). Beim Durchspielen von Fallbeispielen müssen wir allerdings im Auge behalten, dass erstens Engagement, Interesse und Motiv sehr stark variieren (starke 208 Der Interessenbegriff ist einer der schwierigsten Begriffe der Weberschen Soziologie. Darauf muss an dieser Stelle zumindest hingewiesen werden. Wie Jürgen Habermas zu Recht hervorgehoben hat, sind „Interessen“ und „Bedürfnisse“ immer interpretierte „Interessen“ und „Bedürfnisse“. In genau diesem Sinne ist auch die methodische Leitregel der „Verstehenden Soziologie“ zu interpretieren, die sich in der „Einleitung in die Wirtschaftsethik der Weltreligionen“ aus dem Jahre 1916 findet: „Interessen (materielle wie ideelle), nicht: Ideen, beherrschen unmittelbar das Handeln der Menschen. Aber: die »Weltbilder«, welche durch »Ideen« geschaffen wurden, haben sehr oft als Weichensteller die Bahnen bestimmt, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln fortbewegte.“ Weber [Einleitung] Hervorhebungen mittels Kursiv durch mich Ch. K. 209 Man beachte dass in dieser Auflistung von Rationalitätskriterien ein ganz bestimmtes Postulat, welches gemeinhin als wichtigstes für „Rationalität“ überhaupt aufgeführt zu werden pflegt, fehlt: die sog. „Triebaufschubskompetenz“. Das Aussparen dieses Postulates geschieht an dieser Stelle mit voller Absicht. Im übrigen aber gilt natürlich: Zu entscheiden, ob man das, was man will, auch wirklich will, bedeutet: entscheiden zu müssen, ob das, was man will, denjenigen Kriterien entspricht, die man für sich als typisch erachtet. Genau hier liegt nämlich der Bezug zur subjektiven Identitätskonstruktion. 277 bzw. schwache Affektbesetzung) und sich auch auf sehr unterschiedliche Ziele richten können und zweitens, das erforderliches Teamverhalten (z.B. die Kooperation der Mannschaftsmitglieder in einem Fußballspiel) die Rationalitätskriterien anders gewichten können. Der Phantasie setzt die Kasuistik mögliche Handlungskonfigurationen kaum irgendwelche Grenzen, wenn man verdeutlichen will, um was es hier gehen soll: Immer geht es um ein Minimum an allgemeinen Verhaltenskompetenzen, wenn einem bestimmten Individuum die Teilhabe an den eigentlich wichtigen rollenstrukturell interpretierbaren Handlungskontexten in „unserer“ Kultur nicht versagt bleiben soll. a) Zur sprachlichen Form: Da sie Postulate sind, repräsentieren die Sätze, mittels derer die hier aufgeführten Rationalitätskriterien festgelegt worden sind, Normen. Es sind Soll-Sätze, was nicht verwunderlich ist, da wir es hier mit definitorischen Festlegungen für den Rationalitätsbegriff zu tun haben. Als „Soll-Sätze“ sind sie nicht wahrheitsfähig, und würde man sie zu einem einheitlichen in sich widerspruchfreien Ganzen zusammenfassen, indem man eventuelle Abhängigkeiten zwischen ihnen konstruiert, so entstünde ein Rationalitätsmodell, welches als solches gleichfalls wesentlich definitorisch-postulatorischen Charakter hätte, mithin als solches ebenfalls nicht wahrheitsfähig wäre. Die Angelegenheit sieht natürlich anders aus, wenn man die in diesem Katalog aufgelisteten Definitionen von Rationalitätskriterien in assertorische Sätze umformt, was weiter unten geschehen soll. b) Zum Gegenstandsbereich: Immer geht es um Handlungskontexte, welche dem jeweiligen „subjektiv sinnhaften“ und „auf das Verhalten anderer bezogen[en]“ Verhalten (historisch) vorgegeben sind und denen sich unser „Akteur“ anzupassen hat. Das ist, wie wir später sehen werden, sogar dann der Fall, wenn wir die Verhaltensaktivitäten „sozial isolierter Individuen“ (die sog. „Robinsonaden“) in den Blick nehmen. Allerdings ist der einzelne Handelnde, das solitäre Individuum, insofern ein Sonderfall, als bei ihm ja nur partiell die obige Weberdefinition in Geltung ist: Ein Mann, der an einem abgelegenen See angelt – so ja das von Homans gewählte Beispiel – handelt zweifelsohne ebenso, „subjektiv sinnhaft“ wie der in ein Gebet versunkene 278 Gläubige, jedoch handeln beide natürlich nicht in demjenigen strengen Sinne „sozial“, da ihr subjektiv sinnhaftes Verhalten ja gerade nicht auf andere bezogen bzw. „an dem Verhalten anderer orientiert“ ist: Weder interagieren sie mit anderen, noch kommunizieren sie mit anderen, noch sprechen sie mit anderen.210 Ich erwähne diesen Punkt dennoch explizit, weil u.U. psychopathologisch interessant werden könnte, dass jemand „mit sich selbst“ interagiert, kommuniziert oder aber Selbstgespräche führt.211 c) Zu den Sozialisationszielvorstellungen: Betrachten wir die Beispiele unserer Kasuistik, so fällt auf, dass zwischen zweierlei Sozialisationszielvorgaben scharf unterschieden werden muss: kontextualbezogene und „allgemeine“. Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkt unseren bisherigen Katalog von Rationalitätskriterien, so zeigt sich, dass hier allgemeine Bedingungen erfüllt sein müssen – 210 Die vornehmlich auf mikrosoziale Tatbestände – das sind in der Regel soziale Gruppen – bezogenen Begriffe der Interaktion und der Kommunikation „Gesprächs“ designieren, wie bereits weiter oben angedeutet, strukturelle Beschaffenheiten von beliebigen Formen des menschlichen Gemeinschaftslebens, die als Handlungskonfigurationen beschrieben und rollenstrukturell interpretiert werden können. Gegeben sein muss in jedem Fall die sog. „minimale soziale Situation“, jene „gruppoide Vergemeinschaftsform“, die soziologisch „Paar“ genannt zu werden pflegt. Beispiele für „reine“ Interaktionen – das sind Interaktionen mit relativ niedrigem Kommunikativanteil – ergeben sich immer dann, wenn Rituale mit hohen Anteilen an Fremdbestimmung involviert sind, wie es z.B. bei den Akkordarbeitergruppen unter Fließbandbedingungen der Fall gewesen ist: Die Interaktionsdensität war hierbei sogar sehr hoch, obwohl Kommunikation sehr wenig ausgeprägt war und das „Gespräch“ u.U. sogar unmöglich war. Hohe Bandgeschwindigkeit und die dadurch bedingte starke Vigilanzabsorbtion reduzierten drastisch bei dergestalt institutionell durchregulierten Arbeitsabläufen den möglichen Blickkontakt oder eventuelle „Gespräche“. 211 Prof. Achim Aurnhammer (Uni Freiburg), ein ehemaliger Schüler von Porath, der wie Prof. Rolf Zimmermann dem Dossenheimer Forschungskreis nahesteht – er hat im März 2002 im Rahmen unserer Arbeitssitzung einen hochinteressanten Vortrag über „Identitätskonstruktionen in der Lyrik der Klassischen Moderne“ gehalten – arbeitet derzeitig an einem von der DFG geförderten Forschungsprojekt zu den sog. „Pathographien“. Untersucht wird dabei vor allem das Briefwerk U.v.Huttens, in dem dieser deutsche Humanist des 16. Jhs. In Form von „Gesprächen mit seiner Krankheit“ – v. Hutten war an der Lues erkrankt die damals unheilbar war – versucht, so etwas wie einen „Selbstheilungsprozess“ in Gang zu halten, der ihm zumindest die drohende Geisteskrankheit ersparen sollte. Auf Porath’s Rat hin ist das Projekt so angelegt, dass die psychoanalytische Methodik hierbei sozusagen streng literaturwissenschaftlich als texthermeneutische Methodik zur Anwendung gelangt. Untersucht werden soll die Funktion genuin ästhetischer Formen der Identitätskrisenbewältigung für die Ausbalancierung des mentalen Gleichgewichts, welches durch den Schock einer seinerzeit als unheilbar geltenden Krankheit massiv gestört worden war. In diesem Fall liegt also eine Identitätskrise vor, bei der sich nachweisen lässt, dass sich dem betreffenden Individuum die „Identitätsfrage“ in einer ganz besonders vitalen Weise stellte: Die Dialogisierung des „Ich“ mit „seiner“ personifikativdefinierten Krankheit spaltet dieses „Ich“ ja ganz konsequent in ein mental erkranktes bzw. von mentaler Erkrankung bedrohtes „Ich“ und dem Krankheitsgeschehen selbst auf. 279 nämlich die acht Rationalitätskriterien –, damit kontextualbezogene Regelstrukturen ganz bestimmter Handlungskontexte überhaupt gelernt werden können. Hierbei ergeben sich dann Minimalbedingungen der Rationalität, die natürlich den Anforderungen spezifischer Handlungskontexte gemäß variieren können: Ein heranwachsender Jugendlicher ist mithin im Erwerb entsprechender Rationalitätskriterien von unterschiedlicher Kompetenz. Was mit diesen Andeutungen gemeint ist, wird sofort deutlich, wenn wir in den obigen Kriterienkatalog diejenige Kontextualindizierung expressis verbis einführen, für die uns unser „Radfahrerbeispiel“ das Material liefert. Auch dies exerzieren wir der Klarheit halber vollständig durch [Man achte dabei auf die grammatikalische Funktion des Modalverbs „müssen“, welches ich deshalb mittels Unterstreichung hervorhebe, weil es um die Normstrukturen des institutionellen Sinnzusammenhangs „Strassenverkehr“ verweist]: Katalog II 1. Ein Rad- oder Autofahrer, der seine Rolle als Verkehrsteilnehmer erfolgreich und verantwortungsvoll wahrnehmen will, muss in dem Sinne ein rational handelndes Individuum sein – d.h. er muss die Voraussetzungen hierfür mitbringen –, als er über die Fähigkeit verfügen muss Entscheidungen zu treffen. Hierfür muss er selbstverständlich in der Lage sein, Wahlalternativen wahrnehmen zu können, sonst könnte er an dem institutionell vorausgestifteten Sinnzusammenhang „Verkehr“ eben nicht situationsadäquat teilnehmen. [Entscheidungskompetenz] 2. Ein Rad- oder Autofahrer, der seine Rolle als Verkehrsteilnehmer erfolgreich und verantwortungsvoll wahrnehmen will, muss in dem Sinne ein rational handelndes Individuum sein – d.h. er muss die Voraussetzungen hierfür mitbringen –, als es auf das Verhalten anderer (Verkehrsteilnehmer) sich beziehen, mithin das (mögliche) Verhalten anderer (Verkehrsteilnehmer) in seine Überlegungen mit einbeziehen kann. [Sozialverträglichkeit] 3. Ein Rad- oder Autofahrer, der seine Rolle als Verkehrsteilnehmer erfolgreich und verantwortungsvoll wahrnehmen will, muss in dem Sinne ein rational handelndes Individuum sein – d.h. er muss die Voraussetzungen hierfür mitbringen –, als es 280 gesprächfähig (kommunikativ kompetent) ist. Kommunikative Kompetenz schließt die Fähigkeit ein Symbole (Spielkarten, Spielfiguren, Verkehrszeichen etc.) situationsadäquat deuten zu können). 4. Ein Rad- oder Autofahrer, der seine Rolle als Verkehrsteilnehmer erfolgreich und verantwortungsvoll wahrnehmen will, muss in dem Sinne ein rational handelndes Individuum sein – d.h. er muss die Voraussetzungen hierfür mitbringen –, als es nach Lage der Dinge unterscheiden können muss, was möglich ist und was nicht. 5. Ein Rad- oder Autofahrer, der seine Rolle als Verkehrsteilnehmer erfolgreich und verantwortungsvoll wahrnehmen will, muss in dem Sinne ein rational handelndes Individuum sein – d.h. er muss die Voraussetzungen hierfür mitbringen –, als es die Konsequenzen je nach Entscheidung einkalkulieren können muss. Es muss die Kosten einkalkulieren können, die sich ergeben könnten, wenn eine bestimmte Entscheidung nun einmal getroffen worden ist. Und der entscheidende Punkt: Bevor es das tut, muss es gemäß den Bedingungen real gegebener Verhältnisse durchdenken können, welche möglichen Konsequenzen sich aus einer stattgehabten Entscheidung ergeben könnten. 6. Ein Rad- oder Autofahrer, der seine Rolle als Verkehrsteilnehmer erfolgreich und verantwortungsvoll wahrnehmen will, muss in dem Sinne ein rational handelndes Individuum sein – d.h. er muss die Voraussetzungen hierfür mitbringen –, als es, bevor es Entscheidungen trifft, seine Interessen erkennen und interpretieren können muss. 7. Ein Rad- oder Autofahrer, der seine Rolle als Verkehrsteilnehmer erfolgreich und verantwortungsvoll wahrnehmen will, muss in dem Sinne ein rational handelndes Individuum sein – d.h. er muss die Voraussetzungen hierfür mitbringen –, als es Kompromisse schließen zu können muss, um seine Interessen mit anderen (Verkehrsteilnehmern) abzustimmen zu können. 8. Ein Rad- oder Autofahrer, der seine Rolle als Verkehrsteilnehmer erfolgreich und verantwortungsvoll wahrnehmen will, muss in dem Sinne ein rational handelndes Individuum sein – d.h. er muss die Voraussetzungen hierfür mitbringen –, als es erkennen, können muss, ob es das, für was er sich entschieden hat, auch wirklich will. 281 Vermutlich gilt die empirisch falsifizierbare Hypothese, auf die wir später zurückkommen werden: Notwendige Bedingung dafür, dass ein Individuum die in 1,2,4,5,6,7 und 8 beschriebenen Fähigkeiten ausbildet ist die in 3 beschriebene Fähigkeit. Wäre dies richtig, so würde das bedeuten, dass Rationalität wesentlich verknüpft ist zum einen mit der Fähigkeit zur (subjektiven) Identitätskonstruktion, zum anderen mit kommunikativer Kompetenz. Identitätskonstruktionskompetenz und kommunikative Kompetenz (im Sinne der Ausführungen der Abschnitte II. 2. bzw. II. 5. 4.) wären dann idealtypisch wesentlich miteinander verknüpft. Erinnern wir uns, dass wir bereits in der Einleitung vermieden haben, die Webersche Konzeption als eine „Theorie“ zu charakterisieren. In Anlehnung an den Winckelmann‘schen Vorschlag haben wir den Ausdruck „Begriffslehre“ gewählt. Wie wir nun sehen können, bewährt sich diese Vorsicht: Webers Rationalitätskonstruktion designiert ein idealtypisches Gebilde, im Bezug auf welches wir nun die irrationalen Formen des Verhaltens als Annäherungshypothesen konstruieren können212: Intentionales Handeln ist rational, hingegen verhalten sich in einem eindeutig empirischen Sinne bestimmte Menschen in bestimmten Situationen irrational.213 Und erst aus dieser Perspektive wiederum lässt sich sodann auch empirisch feststellen, ob sich eine bestimmte Person in einer bestimmten Situation rational verhalten hat oder nicht. Diese Heuristik ist, wie wir nun sehen können, völlig übereinstimmend mit unserer bereits eingangs genannten These, dass die „Begriffslehre des sozialen Handelns“ den empirisch gehaltvollen Lerntheorien explizit oder implizit implantiert ist. Trivialerweise folgt daraus, dass eine Theorieanstrengung, die sich auf 212 Wir unterscheiden an dieser Stelle nicht zwischen denjenigen „irrationalen“ Einflüssen auf das rationale Handeln, die auf „hohe Affektbeträge“ zurückzuführen sind, und denjenigen, die im klinischen Sinne als pathologisch einzustufen sind. Dies muss hier unbedingt betont werden, weil die „Methodik des Verstehens“ wie Weber sie entwickelt hat, solche „durch Leidenschaften normale Verzerrungen“ noch explizit in das „Verstehen“ einbezieht. 213 Der große Vorteil, den die Verwendung des Verhaltensbegriffs mit sich bringt, besteht darin, dass er gegenüber den „Kognitivitätsproblemen“ neutral gebraucht werden kann: Beschreibbar wird dadurch etwas Beobachtbares, wie vor allem die Behavioristen zu Recht immer wieder betont haben: Die Streckung des Beines nach Reizung durch einen Gummihammer ist ein beobachtbarer Verhaltensvorgang eines menschlichen Organismus, jedoch handelt natürlich der Organismus dabei nicht, weder rational noch irrational. Man sieht: Ein bloß deskriptiv erfasster Verhaltensakt z.B. im Rahmen einer Schachspielpartie bedarf der Deutung und genau dies leistet der Handlungsbegriff. Verfügt der Beobachter nicht über hinreichende Kenntnisse bezüglich der Regeln, die die Ordnung des Spiels ausmachen, so kann er die entsprechenden Spielhandlungen auch nicht sinnadäquat deuten, ganz einfach deshalb, weil er sie nicht versteht. Dem Verhalten eines jungen Mädchens, welches in einem Kaufhaus in der Kosmetikabteilung einen Lippenstift in seine Handtasche steckt, sieht man ja zunächst einmal nicht an, um was für eine Art von Handlung es sich hierbei dreht. Erst durch Interpretation z.B. durch den in dieser Beziehung hochvigilanten und zur Beurteilung des betreffenden Verhaltens kompetenten Warenhausdetektiv klärt sich auf, dass wir es hier mit einer sog. „Diebstahlshandlung“ zu tun haben. 282 psychopathologische Verhaltensmuster bezieht, wesentlich defizient ist, wenn sie sich dieser „Begriffslehre des sozialen Handelns“ nicht explizit versichert. In thetischer Überschärfung formuliert aber heißt das: Jede bisher vorgelegte Ätiologie abnormer Verhaltensmuster leidet unter dieser Schwäche.214 Die Argumentation trifft gleichermaßen mangelhafte Repräsentanten psychiatrischer Publikationen wie auch solch bewundernswerte Arbeiten wie die von Redlich und Freedman oder Resch et al. Schauen wir uns unter diesem Gesichtspunkt nun noch einmal den Katalog genauer an, wobei wir schon jetzt darauf achten wollen, dass der Rationalitätsbegriff assoziiert ist mit den Begriffen der „Mündigkeit“, der „Ich-Stärke“, der „Selbstverantwortlichkeit“ und des „Normal-Ich“. Wir sprechen also hier vom „Typischen“ nicht jedoch von jemandem der sich gelegentlich in der genannten Art und Weise verhält. Als erstes muss gesehen werden, dass wir den Begriff des Handelns durch den Begriff des Verhaltens ersetzen müssen. Dann erhalten wir: Katalog III 1. Ein Individuum, welches sich irrational verhält, hat erhebliche Schwierigkeiten sich entscheidungsrelevant zu verhalten. Es ist unfähig angesichts ganz bestimmter momentan gegebener Entscheidungssituationen Wahlalternativen korrekt einschätzen bzw. wahrnehmen zu können. [Sind diese Kriterien tatsächlich persönlichkeitsspezifisch so wird – auf unser Beispiel angewandt – ein solches Individuum wohl kaum in der Lage sein die Rolle eines erfolgreichen und verantwortungsbewussten Verkehrsteilnehmers zu übernehmen]. 2. Ein Individuum welches sich irrational verhält, zeigt massive Beeinträchtigungen in seinem Sozialverhalten. Insbesondere jene Teilklasse sozialen Verhaltens, die in den 214 Siehe hierzu auch die vielleicht etwas zu hart ausgefallene Kritik in dem Abschnitt „Forschungsstand“ der Einleitung. 283 „Elementarformen sozialen Verhaltens“ unter dem Oberbegriff „Kooperation“ subsumiert wird, demonstriert erhebliche Defizienzen. 3. Ein Individuum welches sich irrational verhält, zeigt Beeinträchtigungen in seiner kommunikativen Kompetenz (Gespräch).215 Es ist überdies auch nicht in der Lage, Symbole situationsadäquat zu deuten. 4. Ein Individuum welches sich irrational verhält, hat massive Schwierigkeiten die Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die eine fiktive Entscheidung mit sich bringen würden (logisches Implikat von 1), woraus sich sodann ergibt: Wenn ein Individuum erhebliche Schwierigkeiten hat, sich entscheidungsrelevant zu verhalten, dergestalt, dass es unfähig ist angesichts ganz bestimmter momentan gegebener Entscheidungssituationen bzw. Wahlalternativen korrekt einschätzen bzw. wahrnehmen zu können, dann hat dieses Individuum auch massive Schwierigkeiten, die Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die eine fiktive Entscheidung mit sich bringen würden.216 Der entscheidende Punkt um den es hierbei geht: Es ist unwichtig, ob und in welchem Umfang die obige „Hypothese“, empirisch validiert werden kann, wichtig ist ausschließlich die Möglichkeit, die obige Aussage als empirisch falsifizierbare Hypothese deuten zu können. Dies jedoch setzt voraus – und hier liegt der „Irrationalitätskonstrukt“ eigentliche die Clou – dass idealtypologische das hier verwendete Konstruktion des Rationalitätskonstruktes definitorsich voraussetzt. 215 Auch hier weise ich explizit auf die obigen Ausführungen vor allem in Abschnitt II. 5. 4. hin, wo es um das Gadamersche „Gespräch“ ging. Ein Aspekt sollte in diesem Zusammenhang nämlich noch angesprochen werden, der in den „Katalogen“ leider viel zu kurz kommt. Gemeint ist der im „wissenschaftstheoretischen Thesenkatalog“ in Abschnitt II. 3. 2. erwähnte: Der Begriff der „kommunikativen Kompetenz“ ist ebenso wie die Begriffe „Identität“, „Identitätskrise“ etc. ein theoretischer Begriff dem unmittelbar sicherlich nichts „Beobachtbares“ korrespondiert. Wir haben also hier dasselbe Problem wie in der Linguistik: Das „Sprechen“ ist – als „sprachliches Verhalten“ – beobachtbar, nicht jedoch die „competence“. Und dasselbe gilt natürlich für die Fähigkeit Symbole adäquat deuten zu können: Die Fähigkeit dies zu können, lässt sich natürlich nicht direkt beobachten. Und dennoch: An dem gehäuft auftretenden rollendiskrepanten Verhalten eines vermeintlich kompetenten Skatspielteilnehmers, welche die im Spiel auftretenden Spielkartensymbole ganz offenkundig nicht „richtig lesen“ kann, dürfte „immer und überall“ relativ schnell deutlich werden, ob jemand hinreichend „skatspielkompetent“ ist oder nicht. 216 Genaugenommen stimmt das natürlich nicht, dann nämlich nicht, wenn wir die „Irrationalitätsliste“ als ein Gefüge von empirischen Hypothesen auffassen: Ein Individuum kann sehr wohl in der Lage sein, Entscheidungsimplikationen realitätsadäquat durchzusimulieren, und dennoch zu wirklichen Entscheidungen völlig unfähig sein. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn auf mögliche Handlungskonsequenzen geschaut 284 5. (Weiteres Implikat der Sätze 1 und 4) Ein Individuum welches sich irrational verhält, kann die Kosten nicht adäquat kalkulieren, die mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden. Anhand dieses Satzes, lässt sich nunmehr in Gestalt einer empirischen Hypothese das schwierige Konstrukt der „Realitätsadäquanz“ einführen: Können die Konsequenzen möglichen Entscheidungsverhaltens nicht adäquat durchkalkuliert werden, so wird das Individuum mehr oder weniger drastisch dazu gezwungen sein gegebene „Realitäten“ zu verzerren. 6. Ein Individuum welches sich irrational verhält, ist unfähig seine Interessen adäquat zu kognizieren. 7. Ein Individuum welches sich irrational verhält, demonstriert ein konfliktiöses Kompromissverhalten: Weil es seine Interessenlage nicht adäquat kognizieren kann, ist auch seine Kooperativfähigkeit massiv beeinträchtigt, denn in kooperativ vergemeinschafteten Teams bedarf es einer Synchronisation der je eigenen Interessenlage mit den Interessen der „anderen“. Problemlos können wir dies nunmehr auch positions- und rollentheoretisch beschreiben, nämlich: 8. Ein Individuum welches sich irrational verhält (Implikat von 2), zeichnet sich in seinem Rollenverhalten defizient aus: Es kann sich in einem Sozialgefüge nicht positional verorten und folglich auch nicht rollenadäquat verhalten. Es ist aus diesem Grunde unfähig zu entscheiden was es wirklich will und welche Konsequenzen damit verbunden sein könnten, wenn es sich für eine bestimmte Rolle in einem bestimmten Handlungskontext entscheidet. Dies sodann der Ausgangspunkt für eine erste präzisere Fassung des Identitätskonstrukts und des mit diesem assoziierten Konstrukt der „Identitätskrise“, nämlich: 9. Ein Individuum welches sich irrational verhält – dies sozusagen ein allgemeines Implikat der bisherigen Sätze –, zeigt streng soziologisch – d.h. aus dem Blickwinkel dieser idealtypologischen Konstruktion des rationalen sozialen Handelns – massive Beeinträchtigungen seines Identitätsverständnisses. Weil es nicht mehr weiß wo es sich positional verorten soll bzw. kann und wie es sich rollengemäß zu verhalten hat, ist es unfähig zu entscheiden, was es wirklich will wofür es sich entscheiden kann, soll wird, die angsterregend sind. Hier kommt der Sachverhalt der „Phantasiebegabung“ ins Spiel, den wir eigentlich wesentlich genauer hätten betrachten müssen. 285 ect. ect. Hier ist mit Händen zu greifen, dass bei bestimmten persönlichkeitsspezifischen Voraussetzungen – die wir uns eigentlich genauer anschauen müssten – ganz bestimmte sozialstrukturelle Bedingungen gegeben sein können dafür, dass ein bestimmtes Individuum in eine Identitätskrise gerät, in eine Station also gerät, in welcher es eben nicht mehr in der Lage ist, „seine“ Identität zu konstruieren. Anhand des von Homans mitgeteilten Falles des jugendlichen Kegelspielers wäre z.B. dieser Aspekt genauer zu betrachten sein. Hier halten wir lediglich ganz allgemein fest: 10. Die Fähigkeit eines Individuums zu jener Form von subjektiver Sinnkonstruktion, die wir Identitätskonstruktion nennen, ist positiv korreliert mit der Annäherung an das Rationalitätskriterium und negativ korreliert mit der Annäherung an das Irrationalitätskriterium. Verknüpfen wir diese Annahme sodann mit dem Begriff der Identitätskrise, so folgt [zunächst einmal] eine Definition, welche besagt: 11. Es soll dann und nur dann von einer Identitätskrise gesprochen werden, wenn die Fähigkeit zur subjektiven Identitätskonstruktion, welche ja immer zugleich auch eine subjektive Sinnkonstruktion nach Weberschem Muster ist – mithin also die Fähigkeit zum rationalen Handeln – massiv beeinträchtigt ist, woraus sich nunmehr trivialerweise ergibt: 12. Identitätskrisen fördern die Tendenz zu irrationalem Verhalten. Und schließen wir diese Aussage wiederum zusammen mit der von uns bisher entwickelten Thetik, dass das Lernverhalten in einem systematischen Zusammenhang steht mit dem Vorhandensein einer Identitätskrise, so folgt: 13. Maligne Identitätskrisen beeinflussen das Lernverhalten von Individuen negativ, woraus sich trivialerweise eine etwas veränderte Fassung des zweiten Teils des Satzes 5 ergibt: 14. Maligne Identitätskrisen, dadurch definiert, dass die Fähigkeit zur subjektiven Identitätskonstruktion und damit die Fähigkeit zu rationalem (sozialen) Handeln massiv beeinträchtigt ist, wirken sich dahingehend aus, dass die Konsequenzen möglichen Entscheidungsverhaltens nicht mehr adäquat durchkalkuliert werden können, mithin das Lernverhalten massiv Realitätsverzerrungen auftreten müssen. 286 beeinträchtigt ist und folglich Um verdeutlichen zu können, worum es hierbei geht, stellen wir zunächst einmal die Frage: Könnten wir in ähnlicher Weise, wie bei der Auflistung der Rationalitätskriterien (Katalog I) vorgehen und die Irrationalitätskriterien als Postulate einführen? Natürlich können wir das tun, nur müssen wir dann beachten, dass die Sätze anders gefasst werden müssten als bei der Auflistung der Rationalitätskriterien, nämlich: Wir nennen ein irrational (in diesem Fall) handelndes Individuum ein solches, welches erhebliche Schwierigkeiten hat sich entscheidungsrelevant zu verhalten. Wir nennen es deshalb so, weil es angesichts ganz bestimmter momentan gegebener Entscheidungssituation unfähig ist, Wahlalternativen korrekt einschätzen bzw. wahrnehmen zu können. Unschwer zu sehen ist gleichwohl, das man dann gezwungen wäre, wiederum das Verhaltensmuster der „Entscheidungsrelevanz“ zu bestimmen, was mit ziemlicher Sicherheit erneut auf die Frage nach den „Rationalitätskriterien“ zurückführen würde. Oder aber: Wir nennen ein Individuum „irrational“, wenn es Beeinträchtigungen in seiner kommunikativen Kompetenz (Gespräch) zeigt. Ein solches Individuum ist überdies auch nicht in der Lage, Symbole situationsadäquat zu deuten. Usw. usw. Später werden wir sehen, dass diese Nuancen in der Variation der sprachlichen Logik alles andere als uninteressant sind. Dennoch: So verführerisch es auch sein mag, den hier sich andeutenden Grundgedanken der vorliegenden Arbeit bereits an dieser Stelle weiterzuführen, wollen wir hier abbrechen, da es ja vorerst lediglich darum geht, in expliziten Propositionalkonstruktionen „vorzuführen“, was alles an Selbstverständlichem in manchen psychiatrischen Diagnosen steckt, und zwar an Selbstverständlichem, welches sich bei genauem Zusehen als hochproblematische unter der Hand eingeführte Hintergrundsthese herausstellt. Fragen wir erneut: Was fällt auf? 287 Der erste Punkt betrifft auch die sprachliche Form: Hier werden keine Kriterien für irrationales Verhalten postulatorisch vorgeführt, vielmehr wurden sie aus dem ersten Katalog abgeleitet, vorausgesetzt, man formuliert den Begriff der Irrationalität als Gegenbegriff, was ja durch den umgangssprachlichen Gebrauch der entsprechenden Ausdrücke nahegelegt werden würde. Konsequenterweise sind die dabei auftretenden Sätze wesentlich assertorisch, nicht jedoch normativ, d.h. es handelt sich um Behauptungssätze. Problematisch ist in diesem Zusammenhang allerdings der Begriff der „Ableitung“, denn in streng logischem Sinne lassen sich assertorische Sätze nicht aus normativen Sätzen „ableiten“ und umgekehrt. Doch dies ist ein Sonderproblem, auf welches wir auf dieser Stelle nicht eingehen wollen. Da assertorische Sätze wahrheitsfähig sind (d.h. wahr oder falsch sein können), wäre denkbar, dass es sich insgesamt bei den aufgeführten 14 (Katalog III) Sätzen um empirisch falsifizierbaren Hypothesen mit Allgemeinheitsanspruch handelt. Dies ist z.T. ja auch der Fall. Bei genauerem Hinsehen jedoch kommen bedenken. Das liegt daran, wie wir nunmehr sehen können, dass der Irrationalitätsbegriff hierbei wesentlich auftritt, dass jedoch seine Bedeutung, wie vor allem die Sätze 1-4 (Katalog III) zeigen, völlig von dem in der ersten Liste (Katalog I) definitorisch festgelegten Rationalitätsbegriff abhängig ist. Und erst mit dieser Voraussetzung gleiten wir in die Formulierung empirisch falsifizierbarer Hypothesen hinüber, wie sodann die nachfolgenden Sätze des letzten Katalogs (Katalog III) zeigen. Und dennoch: Auch bei diesen gilt, dass der postulatorisch eingeführte Rationalitätsbegriff seine starke Stellung behauptet. Vor allem der 10. Satz (Katalog III) zwingt uns dazu, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob wir ihn als „Definition“ oder aber als „empirische Hypothese“ betrachten wollen. Wie wir nunmehr tatsächlich sehen können, nimmt uns gerade bei der Frage der Interpretation ganz bestimmter Teile idealtypologisch konstruierter Gebilde niemand eine solche Entscheidung ab. Hier liegt offenkundig einer der Gründe dafür, dass die Konstruktion einer empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie, welche denjenigen wissenschaftlogischen Prinzipien zu genügen hätte, die in den vorangegangenen Abschnitten der Arbeit ausführlich zur Sprache gekommen sind, so exorbitant schwierig ist. Doch dies hier nur nebenbei. Wie aber steht es nunmehr mit den jeweiligen entsprechenden Handlungskontexten und den Sozialisationszielvorgaben? Wichtig scheint mir vor allem zu sein, dass wir in jedem einzelnen Fall gezwungen sind, Handlungskontexte, in denen die entsprechenden Verhaltensweisen jeweils auftreten, explizit 288 auszuzeichnen. Täten wir das nicht, so würden wir eine Theorie konstruieren, welche Persönlichkeitstypen zu umschreiben versuchen würde. Nicht zufällig verschwimmen die Grenzen nämlich in den letzten Aussagen, wo wir fast unmerklich dazu übergegangen sind die Irrationalitätszuschreibungen als charakterologische Attributionen vorzunehmen. Sowie wir die Kontextualindizierung weglassen, bewegen wir uns automatisch in Richtung auf charakterologische Zuschreibungen, die z.B. einem bestimmten Patienten „persönlichkeitsspezifische“ Eigenschaften attribuieren. Die hier beschriebene Schwierigkeit, auf welche wir fast zufällig gestoßen sind, ist nämlich alles andere als ein Zufall. Bereits die weiter oben vorgeführte Überlegung zur Vorzugsstellung der Begrifflichkeit der kommunikativen Kompetenz zeigt sich das. Hier deutet sich nämlich das an, was in einer möglichen Theorie der Sozialisation naturgemäß noch sehr viel genauer ausgeführt werden müsste. An dieser Stelle halten wir lediglich fest, dass insbesondere der zweite Teil der vorgeführten Sätze des dritten Katalogs nicht mehr ganz so eindeutig „ins Bild passt“. Zweifellos liegt das daran, dass wir hierbei begonnen haben, Charaktereigenschaften zu postulieren, die wir einem bestimmten Individuum dauerhaft attribuieren.217 Des weiteren halten wir fest, dass wir angesichts bestimmter Sätze nicht unbedingt von vorneherein klar sagen können, ob es sich dabei (noch) um begriffliche Konstruktionen oder vielleicht schon um empirisch falsifizierbare Hypothesen handelt. Warum es mir so sehr auf genau diesen Aspekt ankommt, kann mühelos aus meiner einleitend formulierten Kritik an der gängigen „Theorie und Praxis der Psychiatrie“ angesichts der Skizzierung des „Forschungsstandes“ abgelesen werden. Interpretation unserer bisherigen drei Kataloge (vorläufiges Fazit): Der erste Katalog designiert ein idealtypologisches Konstrukt, indem es ein Ensemble von „Grundannahmen“ repräsentiert, die als Maßstab dienen für Beschreibungen und Erklärungen von Phänomenen, die wir in der Realität antreffen. Auf die Funktionen solcher idealtypologisch gefassten Grundannahmen für die Beschreibung der Wirklichkeit müsste 217 Ich erinnere hier an die Eingangsthetik: Die Malignität bzw. Benignität einer Identitätskrise, ablesbar an genuin irrational/rationalen Formen der Wirklichkeitsverarbeitung, ist Resultante der Persönlichkeitsstruktur, die selbst wiederum Resultante des bis dahin stattgehabten Sozialisationsprozesses ist. 289 eigentlich genauer eingegangen werden, als es hier geschehen kann, wir können jedoch bereits an dieser Stelle das Verhältnis von idealtypologischen Konstruktionen zu empirisch falsifizierbaren Hypothesen demonstrieren. Während die erste Liste eine erste vorläufige Skizzierung des Idealtypus „rationales Handeln“ repräsentiert, fällt – und dies ist methodisch von entscheidender Bedeutung – an der dritten Liste zunächst einmal auf, dass die Konstruktion eines Idealtypus „irrationales Handeln“ gar nicht möglich ist.218 Dies ist jedoch nicht nur deswegen nicht der Fall, weil wir Gefahr liefen, auf einen logischen Selbstwiderspruch hin zu arbeiten, sondern deshalb, weil wir aus dem Blickwinkel des idealtypisch konstruierten „rationalen Handelns“ zwei Klassen von – wie wir hoffen – theoriefähigen Hypothesen herleiten wollen. Dabei bezieht sich die eine Menge von Hypothesen auf das irrationale Verhalten. Dieser Punkt ist von großer Bedeutung, zeigt sich doch, dass das in Katalog III erstellt Profil irrationalen Verhaltens wesentlich komplementar bezogen ist auf das zuvor erstellte Modell rationalen Handelns. Um zu eingehender zu demonstrieren worum es hier geht, etablieren wir eine vierte Liste: Katalog IV 1. Ein Individuum welches sich rational verhält, hat keine erheblichen Schwierigkeiten bzw. weniger Schwierigkeiten sich entscheidungsrelevant zu verhalten. Angesichts ganz bestimmter momentan gegebener Entscheidungssituationen kann es relativ gut Wahlalternativen einschätzen bzw. wahrnehmen.[Denn handelt es – gemäß den Kriterien des ersten Katalogs – rational, so hat es überhaupt keine Schwierigkeiten sich entscheidungsrelevant zu verhalten und folglich kann es auch optimal Wahlalternativen einschätzen und wahrnehmen] 2. Ein Individuum welches sich rational verhält, zeigt manchmal weniger manchmal mehr Beeinträchtigungen in seinem Sozialverhalten. [Denn handelt es – gemäß den Kriterien des ersten Katalogs – rational, so zeigt es überhaupt keine Schwierigkeiten 218 So lässt sich bezeichnenderweise bezüglich solch massiver Mentalerkrankungen wie der Schizophrenie gerade nicht behaupten, deren Kriterien würden zusammenfallen mit den Extremwerten für Irrationalität. 290 in seinem Sozialverhalten. Es handelt streng rational und bezieht sich in seinem Verhalten auf das gleichfalls von ihm als streng rational eingeschätztes Verhalten anderer. Und tut es dies zu Recht, so dass auch sein Gegenüber sich in genau diesem Sinne streng rational verhält, dann haben wir eine Handlungskonfiguration vor uns, die den Kriterien des Arche-Typos rationalen Gesellschaftshandelns des Markttausches genügt.] 3. Ein Individuum welches sich rational verhält, hat keine, manchmal weniger manchmal mehr Beeinträchtigungen in seiner kommunikativen Kompetenz. [Denn handelt es – ..... – rational, dann ist seine kommunikative Kompetenz niemals beeinträchtigt. Hierbei gilt dasselbe wie bezüglich die im zweiten Satz skizzierte Situation: Sind beide Handlungspartner im vollen Sinne kommunikativ kompetent und geht es ihnen darum, ein Problem wirklich zu lösen, so verhalten sie sich, wie man so schön sagt, streng sachlich und wir haben dann eine Handlungskonfiguration vor uns, welche den von Gadamer gesetzten Kriterien des vernünftigen Gespräches genügt.] 4. Ein Individuum welches sich rational verhält, hat keine massiven bzw. weniger, oder zwischendurch mehr Schwierigkeiten. [Denn handelt es – ......... – rational, dann hat es überhaupt keine Schwierigkeiten die Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die eine fiktive Entscheidung mit sich bringen würde. Und nimmt ein solches Individuum an einem Markttausch oder an einem wissenschaftlichen Gespräch (im Gadamerschen Sinne) teil, so ...... . Wir können das jetzt mühelos auch auf die Bedingungen des ersten Satzes in diesem Katalog „umrechnen“ wie man sieht.] 5. Ein Individuum welches sich rational verhält, kann die Kosten, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden, entscheidungsvariierend adäquat kalkulieren [Denn handelt es – ......... – rational, so kann es seine Kosten welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen immer adäquat einkalkulieren] und folgerichtig ist ein Individuum welches sich in diesem Sinne rational verhält, nicht gezwungen, gegebene Realitäten zu verzerren. Ein solches Individuum ist damit in der Lage aus Fehleinschätzungen gemäß Bedingungen zu lernen. 291 den nunmehr tatsächlich gegebenen 6. Ein Individuum welches sich rational verhält, ist fähig manchmal weniger manchmal mehr, seine Interessen adäquat zu kognizieren. [Denn handelt es – ......... – rational, dann kann es immer seine Interessen adäquat kognizieren]. 7. Ein Individuum welches sich rational verhält, demonstriert weniger oder kein konfliktiöses Kompromissverhalten: Weil es seine Interessenlage adäquat entscheidungsvariierend kognizieren kann, ist auch seine Kooperationsfähigkeit keineswegs beeinträchtigt, denn in kooperativ vergemeinschafteten Teams bedarf es einer Synchronisation der je eigenen Interessenlage mit den Interessen der „anderen“. [Denn handelt es – ......... – rational, dann demonstriert es überhaupt kein konfliktiöses Kompromissverhalten: Es kann seine Interessenlage adäquat kognizieren und seine Kooperationsfähigkeit ist überhaupt nicht beeinträchtigt. Auch hierbei können wir mühelos eine positionen- und rollentheoretische Kasuistik entwickeln wie man sieht. Beispiele wären Mannschaftsteams, Forschungsgruppen etc. Nämlich:]. 8. Ein Individuum welches sich rational verhält, zeichnet sich in seinem Rollenverhalten weniger oder gar nicht defizient aus: Es kann sich in einem Sozialgefüge fast immer positional verorten und folglich auch fast immer rollenadäquat verhalten. Es ist aus diesem Grunde mehr bzw. weniger fähig zu entscheiden was es wirklich will und welche Konsequenzen damit verbunden sein könnten, wenn es sich für eine bestimmte Rolle entscheidet. [Denn handelt es – ........... – rational, dann hat es keine Defizienzen in seinem Rollenverhalten. Es kann sich in einem Sozialgefüge immer positional verorten und folglich immer rollenadäquat verhalten. Aus diesem Grunde kann es sich immer entscheiden was es will und welche Konsequenzen damit verbunden sein könnten, wenn es sich für eine bestimmte Rolle entscheidet]. Dies sodann der Ausgangspunkt für eine erstere präzisere Fassung des Identitätskonstrukts und des mit diesem assoziierten Konstrukt der „Identitätskrise“, nämlich: 9. Ein Individuum welches sich rational verhält, zeigt auch rollenstrukturell, d.h. in diesem Sinne streng soziologisch keine massive Beeinträchtigungen seines Identitätsverständnisses. [Ein rational handelndes Individuum .....]: Weil es „in der Regel“ bzw. „normalerweise“ wie und wo es sich positional verorten soll bzw. kann und wie es sich rollengemäß zu verhalten hat, ist es in der Regel ja auch imstande, zu entscheiden, was es wirklich will, wofür es sich entscheiden kann, soll etc. Interessant wird die Sache allerdings, wenn ein solcher Art rationales Individuum in einen echten 292 Rollenkonflikt gerät. Interessant vor allem auch deshalb, weil wir in diesem Zusammenhang noch gar keine Anleihe tätigen müssen bei der Psychoanalyse. Wie sich nämlich anhand des von Homans mitgeteilten Falles des jugendlichen Kegelspielers zeigen lässt, gerät dann auch ein eigentlich ganz normal rational Handelnder ausschließlich wegen des permanenten Rollenkonflikts in eine Identitätskrise. Ob und inwiefern dieses Individuum dann auch bestimmte Symptome zeigt, Fehlverhalten oder nicht, hängt dann gerade nicht von seinen unbewussten Triebstrukturen ab, sondern wesentlich vom Verhalten der Gruppenmitglieder ihm gegenüber ab. Aber auch hier halten wir fest: 10. Die Fähigkeit eines Individuums zur (subjektiven) Identitätskonstruktion ist positiv korreliert mit der Annäherung an das Rationalitätskriterium und negativ korreliert mit der Annäherung an das Irrationalitätskriterium. Verknüpfen wir diese Annahme sodann mit dem Begriff der „Identitätskrise“ so folgt (zunächst) eine Doppeldefinition, welche besagt: 11. Wenn die Fähigkeit eines Individuums zur (subjektiven) Identitätskonstruktion positiv korreliert ist mit der Annäherung an das Rationalitätskriterium und negativ korreliert ist mit der Annäherung an das Irrationalitätskriterium, so ergeben sich trivialerweise zwei Klassen von Identitätskrisen: benigne, bei denen das betreffende Individuum seine Fähigkeit zur (subjektiven) Identitätskonstruktion beibehält, was es als ein „im Prinzip“, d.h. charakterologisch, rational kompetent handelndes Individuum ausweist, und maligne, bei denen dieses Individuum seine Fähigkeit zur (subjektiven)Identitätskonstruktion (zunehmend) einzubüßen droht, was dieses Individuum als ein „im Prinzip“, d.h. ebenfalls charakterologisch, irrational wie auch sozial inkompetent sich verhaltendes Individuum ausweist. Hoch interessant ist nun, wie ich meine, was dann aus unserer Aussage 12 im dritten Katalog wird. Wir haben hierbei natürlich nämlich eine glatte Bestätigung unserer Eingangsausführungen, was ausformuliert so aussieht: 12. Identitätskrisen als solche fördern keineswegs immer die Tendenz zu irrationalem Verhalten. Es hängt vielmehr von der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur, von dem Charakter und mithin von dem jeweiligen bis dahin stattgehabten Sozialisationsverlauf ab, ob ein bestimmtes Individuum mehr zu malignen oder mehr zu benignen Identitätskrisen tendiert. In beiden Fällen geht es aber um die jeweils an 293 das Rationalitätskriterium gebundene Fähigkeit zur (subjektiven) Identitätskonstruktion, deren Ursprünge, wie wir nunmehr zu vermuten mehr als genug Anlass haben, sich irgendwo in den jeweiligen sozialstrukturellen Bedingungen der jeweiligen primordialen Sozialisationsphase auffinden lassen. Denn schließen wir die in dieser Aussage involvierte Erkenntnis wiederum mit der von uns bisher entwickelten Thetik zusammen, dass das Lernverhalten, in diesem Falle also die Fähigkeit zur situations- und realitätsadäquaten kognitiven Umorientierung, in einem systematischen Zusammenhang steht mit dem Vorhandensein einer (malignen oder benigen) Identitätskrise, so folgt: 13. Während maligne Identitätskrisen, die ihren „Ursprung“ in den sozialstrukturellen Verhältnissen der frühen Kindheit haben, das Lernverhalten eines Individuums negativ beeinflussen – es wird mithin ein Zusammenhang behauptet zwischen malignen Identitätskrisen und den sog. „pathologischen“ Lernvorgängen, wie sie vor allem Deutsch beschrieben hat –, beeinflussen benigne Identitätskrisen, welche ja ebenfalls ihren „Ursprung“ in den sozialstrukturellen Verhältnissen der frühen Kindheit haben, das Lernverhalten eines Individuums positiv, woraus sich, wie nunmehr zu sehen, eine sehr veränderte Fassung des zweiten Teils des Satzes 5 der bisherigen Kataloge ergibt: 14. Während maligne Identitätskrisen, dadurch definiert, dass die – gleichfalls in der frühen Kindheit erworbene – Fähigkeit zur subjektiven Identitätskonstruktion und damit die Fähigkeit zu rationalem, nämlich subjektiv sinnvollem und absichtsgeleitetem (sozialen) Handeln massiv beeinträchtigt ist, sich dahingehend auswirken, dass die Konsequenzen möglichen Entscheidungsverhaltens nicht mehr adäquat durchkalkuliert werden können, mithin das Lernverhalten massiv beeinträchtigt ist und folglich sowohl Lernblockaden als auch Realitätsverzerrungen auftreten (müssen), wirken sich benigne Identitätskrisen, dadurch definiert, dass die – gleichfalls in der Kindheit erworbene – Fähigkeit zur subjektiven Identitätskonstruktion und damit die Fähigkeit zu rationalem, nämlich subjektiv sinnvollem und absichtsgeleitetem (sozialen) Handeln nicht nur vollständig erhalten, sondern – dies ein Implikat des Verstärkergesetztes – überdies massiv gestärkt wird, was wiederum die Konsequenz hat, dass die Konsequenzen möglichen Entscheidungsverhaltens immer besser und immer adäquater durchkalkuliert werden können, mithin auch das Lernverhalten sich immer besser gestaltet und irgendwelche 294 Lernblockaden „abgebaut“ werden (können), weil Realitätsverzerrungen überhaupt nicht notwendig sind. Auch bei diesem Katalog fällt das auf, was wir bereits beim „Irrationalitätskatalog“ haben sehen können. Darüber hinaus jedoch zeigt sich nun: Der vorstehende Katalog demonstriert die Transformation eines ansonsten lediglich klassifikatorisch gefassten Begriffsgefüges in ein Gefüge von komparativen Begriffen. Damit tragen wir dem Postulat Rechnung, Eigenschaftsbegriffe in operante Begriffe umformen zu müssen, wenn wir Wert darauf legen, mittels eines bestimmten Vokabulars empirisch falsifizierbare Hypothesen bzw. Theorien formulieren zu wollen. Der vorstehende Katalog selbst könnte nicht als Arsenal bereits formulierter empirischer Hypothesen fungieren. Auch er verbleibt im Stadium noch der rein begrifflichen Klärung, was deutlich wird, wenn man die in den eckigen Klammern ausgeführten Zusätze betrachtet. Würde man ihn als ein Katalog von empirischen Hypothesen auffassen, so würden die dabei resultierenden Aussagen keinen empirischen Gehalt haben. Dies ist sofort ersichtlich, wenn wir einige herausgegriffene Aussagen in diejenige Form bringen, die für empirische Aussagen gültig ist. Im ersten Fall würde er dann in der überschärften Weise, wie in der eckigen Klammer aufgeführt wurde, lauten: Wenn ein Individuum sich rational verhält, dann hat es überhaupt keine Schwierigkeiten, sich entscheidungsrelevant zu verhalten. Der Satz hätte nur dann empirischen Gehalt, wenn das Antecedenz „rational“ unabhängig definiert werden könnte vom Konsequenz, was aber natürlich nicht der Fall, da mit Hilfe des Konsequenz das Antecedenz ja definitorisch festgelegt ist. Die Ausbeute dieser Überlegung scheint sich also zunächst einmal darauf zu beschränken, dass wir hierbei lediglich Komparativierungen der Begrifflichkeiten gewonnen haben. Wie jedoch die immer komplizierter werdenden Bemühungen um klare Aussagen im zweiten Teil dieses Katalogs IV sinnenfällig demonstrieren, ist das keineswegs der Fall, worauf weiter unten zurückzukommen sein wird, wenn wir versuchen werden, Beziehungen zwischen den hier aufgeführten Eigenschaften herzustellen und mit operativen Begrifflichkeiten zu arbeiten beginnen. An dieser Stelle bleiben wir jedoch zunächst einmal etwas bescheidener, weil es 295 uns dabei vorerst um den Zusammenhang zwischen den Komparativierungen mit der Bildung von Extremtypen geht. Also: Derjenige Begriff der hier im Mittelpunkt steht ist der Begriff der „Rationalität“. Er wird nunmehr komparativiert und zugleich präzisiert. Wir können nämlich nunmehr mittels unseres Rationalitätsbegriffs Extremtypen bilden. Extremtypen zeichnen sich dadurch aus, dass sie wie die Idealtypen auf keine empirisch vorfindlichen Struktur zutreffen. Für den Rationalitätsbegriff im Hinblick auf den Handlungsbegriff ist die Angelegenheit klar: Es gibt ganz einfach kein Individuum welches in idealtypischer Reingestalt den genannten Kriterien genügen könnte. Auf unseren Katalog angewendet heißt das z.B.: Jedes empirisch vorfindliche Individuum hat in irgendeiner Weise irgendwelche Schwierigkeiten, sich entscheidungsrelevant zu verhalten. Hat es diese jedoch generell, so dürfte sein Rollenlernverhalten massiv blockiert sein, wie am Verkehrsteilnehmerbeispiel sinnfällig ablesbar. Wir können nunmehr auch sehen, inwiefern es zwar keinen Idealtypus für „Irrationalität“ gibt, sehr wohl jedoch lässt sich ein Extremwert angeben, dem bestimmte Individuen sich annähern können. Und damit haben wir (möglicherweise) den Übergang von der komparativen Begriffsbildung zu komparativen Hypothesen, die wahr oder falsch sein können: Katalog V 1. Je größer die Schwierigkeiten sind, die ein bestimmtes Individuum damit hat, sich entscheidungsrelevant in bestimmten Situationen zu verhalten, desto mehr entfernt sich dieses Individuum vom reinen Typ „rationalen Handelns“ und nähert sich dem Irrationalitätskriterium. (Wir haben hier ebenso eine definitorische Festsetzung wie beim ersten Katalog, denn wir können ja mühelos ein „soll“ einführen, ohne dass der Sinn des Satzes verändert werden würde. Und genau dasselbe gilt weiterhin, wie unschwer zu erkennen.) 2. Je mehr ein Individuum Beeinträchtigungen seines Sozialverhaltens zeigt, desto mehr nähert es sich dem Irrationalitätskriterium. (definitorische Festsetzung) 296 3. Je mehr ein Individuum Beeinträchtigungen seiner kommunikativen Kompetenz zeigt, desto mehr nähert es sich dem Irrationalitätskriterium. (definitorische Festsetzung) 4. Je mehr ein Individuum massive Schwierigkeiten zeigt, Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen, desto mehr nähert es sich dem Irrationalitätskriterium. (definitorische Festsetzung) 5. Je mehr ein Individuum seine Kosten, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden, nicht entscheidungsvariierend adäquat kalkulieren kann, desto mehr nähert es sich dem Irrationalitätskriterium. (definitorische Festsetzung). Und: Je weniger ein Individuum imstande ist, die Kosten, die ein mögliches Entscheidungsverhalten mit sich bringen würden, zu kalkulieren, desto größer ist die Gefahr, dass dieses Individuum zu Realitätsverzerrungen tendiert. [definitorische Festsetzung oder empirische Hypothese?] 6. Je mehr ein Individuum zeigt, dass es seine Interessen nicht adäquat kognizieren kann, desto mehr nähert es sich dem Irrationalitätskriterium. (definitorische Festsetzung) 7. Je mehr ein Individuum ein konfliktiöses Kompromissverhalten demonstriert, desto mehr nähert es sich dem Irrationalitätskriterium. (definitorische Festsetzung) 8. Je mehr ein Individuum sich in seinem Rollenverhalten defizient auszeichnet, desto mehr nähert es sich dem Irrationalitätskriterium. (definitorische Festsetzung) 9. ??? 10. Je stärker die Fähigkeit eines Individuums zur (subjektiven) Identitätskonstruktion beeinträchtigt ist, desto mehr nähert dieses Individuum dem Irrationalitätskriterium. 11. Es soll dann und nur dann von einer Identitätskrise gesprochen werden, wenn die Beeinträchtigung eines Individuums zur (subjektiven) Identitätskonstruktion dem Grenzwert der Irrationalität zustrebt. (definitorische Festsetzung) 12. Identitätskrisen, d. h. massive Beeinträchtigungen der Fähigkeit zur (subjektiven) Identitätskonstruktion, fördern die Tendenz zu irrationalem Verhalten, und je öfter seitens des jeweiligen sozialen Umfeldes diese Tendenz zu irrationalem Verhalten bzw. zur Realitätsverzerrung belohnt wird bzw. worden ist, desto mehr verstärken sich die identitätskritischen Aspekte. Und je mehr wiederum dadurch die Fähigkeit zur 297 (subjektiven) Identitätskonstruktion beeinträchtigt wird, desto mehr => maligne Identitätskrisen !!! 13. ... ? 14. ... ? Auch hier bewegen wir uns, wie man sieht, noch im Bereich der Begriffskonstruktion, geraten dabei jedoch zunehmend in die weiter oben bereits beschriebenen Entscheidungsschwierigkeiten, was ganz einfach daran liegt, dass unsere „im Hintergrund mitspielenden“ theoretischen Überzeugungen noch nicht zu einer allgemeinen Theorie der Identitätskrisen haben ausgebaut werden können. Dafür nämlich benötigen wir sehr viel stärkere Anleihen bei der lerntheoretischen Forschung. Wir brauchen nämlich eine Sozialisationstheorie, wie eingangs behauptet. Ich verweise hier lediglich darauf, dass wir „urplötzlich“ mit dem Belohnungsbegriff zu arbeiten gezwungen gewesen sind, was alles andere als ein Zufall ist, ist doch der Belohnungsbegriff bzw. der in der behavioristischen Sprache gebrauchte Verstärkerbegriff einer der tragenden Begriffe aller Lerntheorien. Wie aber, so muss die an dieser Stelle sich ergebende, entscheidende Frage lauten, gewinnen wir aus diesen Begriffskonstruktionen überhaupt empirisch überprüfbare Hypothesen? Denn gesucht wird ja ein theoretisches System, welches den kausalen Zusammenhang zwischen (malignen) Identitätskrisen und ganz bestimmten psychopathologisch auffälligen Verhaltensmustern konstruiert. Es ergeben sich sodann nun weitere acht Kataloge, in denen erstens den bisherigen Satzkonstruktionen die Form streng allgemeiner Allaussagen gegeben wird und in denen zweitens die bisher aufgeführten Attributionen miteinander „korreliert“ werden. Wir bedienen uns dabei der sog. „halbformalen Sprechweise“. 298 Katalog VI 1. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten hat sich in bestimmten Situationen entscheidungsrelevant zu verhalten, dann wird dieses Individuum auch in bestimmten Situationen massive Beeinträchtigungen seines Sozialverhaltens zeigen. (Empirische Hypothese, die sich zum einen auf den idealen Fall der Rationalität, zum anderen auf den kontrapositionellen Extremfall der Irrationalität beziehen lässt. Auszeichnungsbedürftig sind sodann genau diejenigen Situationen, in denen die behauptete Korrelation wesentlich und konstant auftritt.) 2. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten hat sich in bestimmten Situationen entscheidungsrelevant zu verhalten, dann wird dieses Individuum auch in ganz bestimmten Situationen starke Beeinträchtigungen seiner kommunikativen Kompetenz zeigen. 3. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten hat sich in bestimmten Situationen entscheidungsrelevant zu verhalten, dann wird dieses Individuum auch in bestimmten Situationen massive Schwierigkeiten haben Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen. 4. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten hat sich in bestimmten Situationen entscheidungsrelevant zu verhalten, dann ist dieses Individuum in genau solchen Situationen auch nicht in der Lage, die Kosten adäquat zu kalkulieren, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden. 5. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten hat sich in bestimmten Situationen entscheidungsrelevant zu verhalten, dann wird dieses Individuum auch in bestimmten Situationen Schwierigkeiten haben seine Interessen adäquat kognizieren zu können. 6. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten hat sich in bestimmten Situationen entscheidungsrelevant zu verhalten, dann wird in solchen Situationen auch das Kompromissverhalten dieses Individuums umso konfliktiöser sein. 299 7. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten hat sich in bestimmten Situationen entscheidungsrelevant zu verhalten, dann wird auch in solchen Situationen das Rollenverhalten dieses Individuums umso defizienter sein, was bedeutet: Es kann sich, weil es sich in bestimmten Situationen nicht so recht entscheidungsrelevant verhalten kann, in bestimmten Rollenkontexten (Handlungskonfigurationen, Sozialgebilden) nicht positional verorten und folglich auch nicht rollenadäquat verhalten. Es ist (auch) aus diesem Grunde unfähig zu entscheiden, was es wirklich will und welche Konsequenzen damit verbunden sein könnten, wenn es sich für eine bestimmte Rolle in einem bestimmten Handlungskontext entscheidet. Dies auch hier sodann der Ausgangspunkt für eine erste präzisere Fassung des Identitätskonstrukts und des mit diesem Konstrukt assoziierten Konstrukts der Identitätskrise, nämlich: 8. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten hat sich in bestimmten Situationen entscheidungsrelevant zu verhalten, dann deutet das auf massive Beeinträchtigungen seines Identitätsverständnisses. Denn nach Obigem gilt ja: Die Kompetenz, sich positional zu verorten, um sich sodann eben auch rollengemäß verhalten zu können ist positiv korreliert mit der Kompetenz zur (subjektiven) Identitätskonstruktion. 9. Usw. 10. Usw. 11. Usw. 12. Usw. 13. Usw. 14. Maligne Identitätskrisen und die Tendenz zu Realitätsverzerrungen korrelieren positiv. Interpretation: An diesem Katalog ist erstens abzulesen, dass genau dann, wenn wir bei einem ganz bestimmten Individuum z. B. mittels „Testung“ die entsprechenden Behauptungen „verifizieren“ können, wir uns in Richtung auf eine Charakterologie bewegen, was die Konsequenz hat, medizinisch die Persönlichkeitsstruktur eines Patienten bestimmen 300 zu wollen. Und zweitens ist an ihm abzulesen, dass es einen massiven Unterschied macht, ob wir alle hierbei aufgeführten und für „typisch“ gehaltenen Zusammenhänge als „empirisch gesichert“ betrachten und zur personalkonfigurativen Kennzeichnung geeignet voraussetzen – mit diesen „Hypothesen“ also diagnostisch umgehen – oder aber, ob wir sie als zu prüfende Hypothesen auffassen, um erst noch so etwas wie eine typische psychiatrische Personalität konstruieren zu können. Worauf es hier zunächst einmal ausschließlich ankommt, ist, dass sich die aufgewiesenen „wechselseitigen Abhängigkeiten“ als empirisch falsifizierbare Hypothesen deuten lassen, mit deren Hilfe sodann ja auch Erklärungen sowie Prognosen formulierbar wären. Und sie gesagt: Hier kommt es nur und ausschließlich auf die Möglichkeit einer solchen Deutung an, nicht das geringste wird jedoch damit bereits über die tatsächliche empirische Validität der entsprechenden Hypothesen ausgesagt. Die fraglichen Hypothesen können falsch sein und nur darauf beruht, wie oben anhand des DN-Schemas ausgeführt, ihr empirischer Gehalt. Dasselbe können wir dann an allen Beispielen durchexerzieren, was der Vollständigkeit halber – und notwenig langweiligerweise – dann so aussieht: Katalog VII 1. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erheblich Beeinträchtigungen in seinem Sozialverhalten zeigt, dann wird dieses Individuum auch massive Schwierigkeiten haben, sich entscheidungsrelevant zu verhalten. (Wir haben hier die Indizierung weggelassen, weil wir auf den charakterologischen Zug in den hier aufgeführten Korrelationen aufmerksam machen wollen. Es ergibt sich dann: Bei Individuen, die zu irrationalen Verhaltensweisen tendieren, zeigt sich eine ausgeprägt hohe Korrelation zwischen Beeinträchtigungen im Sozialverhalten einerseits und massiven Schwierigkeiten, sich entscheidungsrelevant zu verhalten, andererseits. 2. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erheblich Beeinträchtigungen in seinem Sozialverhalten zeigt, dann wird dieses Individuum auch starke Beeinträchtigungen seiner kommunikativen Kompetenz zeigen. (Auch hier ergibt sich 301 die behauptete Korrelation, die auf Tendenzen zu irrationalen Verhaltensmustern verweisen.) 3. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erheblich Beeinträchtigungen in seinem Sozialverhalten zeigt, dann wird dieses Individuum auch massive Schwierigkeiten haben Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen. 4. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erheblich Beeinträchtigungen in seinem Sozialverhalten zeigt, dann ist dieses Individuum auch nicht in der Lage, die Kosten adäquat zu kalkulieren, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden. 5. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erheblich Beeinträchtigungen in seinem Sozialverhalten zeigt, dann wird dieses Individuum Schwierigkeiten haben seine Interessen adäquat kognizieren zu können. 6. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erheblich Beeinträchtigungen in seinem Sozialverhalten zeigt, dann wird das Kompromissverhalten dieses Individuums umso konfliktiöser sein. 7. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erheblich Beeinträchtigungen in seinem Sozialverhalten zeigt, dann wird das Rollenverhalten dieses Individuums umso defizienter sein. Der eigentlich interessante Fall ist nun der folgende: Katalog VIII 1. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten in seiner kommunikativen Kompetenz zeigt, dann wird dieses Individuum auch massive Schwierigkeiten haben, sich entscheidungsrelevant zu verhalten. 302 2. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten in seiner kommunikativen Kompetenz zeigt, dann wird dieses Individuum auch massive Beeinträchtigungen seines Sozialverhaltens zeigen. 3. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten in seiner kommunikativen Kompetenz zeigt, dann wird dieses Individuum auch massive Schwierigkeiten haben Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen. 4. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten in seiner kommunikativen Kompetenz zeigt, dann ist dieses Individuum auch nicht in der Lage, die Kosten adäquat zu kalkulieren, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden. 5. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten in seiner kommunikativen Kompetenz zeigt, dann wird dieses Individuum Schwierigkeiten haben seine Interessen adäquat kognizieren zu können. 6. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten in seiner kommunikativen Kompetenz zeigt, dann wird das Kompromissverhalten dieses Individuums umso konfliktiöser sein. 7. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x erhebliche Schwierigkeiten in seiner kommunikativen Kompetenz zeigt, dann wird auch das Rollenverhalten dieses Individuums umso defizienter sein, was bedeutet: Für jedes Individuum, dessen kommunikative Kompetenz massiv beeinträchtigt ist, gilt, dass es sich in bestimmten Rollenkontexten (Handlungskonfigurationen, Sozialgebilden) nicht positional verorten und folgerichtig auch nicht rollenadäquat verhalten kann. ... 8. .... 9. .... 10. .... 11. .... 12. .... 303 13. .... 14. Für alle x ... : Massive Beeinträchtigungen der kommunikativen Kompetenz korrelieren positiv mit der Tendenz zu malignen Identitätskrisen, woraus trivialerweise folgt: 15. Massive Beeinträchtigungen der kommunikativen Kompetenz und die Tendenz zu pathologischen Lernprozessen, bei denen notorisch Realitätsverzerrungen zu beobachten sind, korrelieren positiv. Der hier durchgespielte Fall ist deswegen so interessant, weil es sich anbietet, ganz allgemein die Variable der „kommunikativen Kompetenz“ mittels der konsequenten Konstruktion der anderen korrelativen Zusammenhänge definitorisch festzulegen, sodann mit dem Extremtypus der Irrationalität in Verbindung zu bringen und schließlich auf das Konstrukt der „Tendenz zu pathologischen Formen der Realitätsverarbeitung“ zu beziehen. Wir hätten dann: Sind bei einem bestimmten Individuum „in voller Blüte“ alle vorgeführten Korrelationen vorhanden, so gilt die eventuell als empirische Hypothese interpretierbare Aussage: Das Ausmaß der geschädigten kommunikativen Kompetenz bei einer bestimmten Persönlichkeit, gemessen an dem jeweiligen Gegebenheitsgrad der aufgeführten Korrelationen, kovariiert mit der Zunahme an Irrationalität, d. h. mit der Zunahme der Tendenz zu genuin pathologischen Formen der Realitätsverarbeitung. Katalog IX 1. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x massive Schwierigkeiten zeigt Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen, dann wird dieses Individuum auch Schwierigkeiten haben sich entscheidungsrelevant zu verhalten. 2. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x massive Schwierigkeiten zeigt Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen 304 mit sich bringen, dann wird dieses Individuum auch massive Beeinträchtigungen seines Sozialverhaltens zeigen. 3. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x massive Schwierigkeiten zeigt Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen, dann wird dieses Individuum auch starke Beeinträchtigungen seiner kommunikativen Kompetenz zeigen. 4. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x massive Schwierigkeiten zeigt Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen, dann ist dieses Individuum auch nicht in der Lage, die Kosten adäquat zu kalkulieren, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden. 5. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x massive Schwierigkeiten zeigt Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen, dann wird dieses Individuum Schwierigkeiten haben seine Interessen adäquat kognizieren zu können. 6. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x massive Schwierigkeiten zeigt Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen, dann wird das Kompromissverhalten dieses Individuums umso konfliktiöser sein. 7. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und x massive Schwierigkeiten zeigt Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen, dann wird das Rollenverhalten dieses Individuums umso defizienter sein. Katalog X 1. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und nicht in der Lage ist seine Kosten adäquat kalkulieren zu können, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden, dann wird dieses Individuum auch Schwierigkeiten haben, sich entscheidungsrelevant zu verhalten. 305 2. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und nicht in der Lage ist seine Kosten adäquat kalkulieren zu können, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen, dann wird dieses Individuum auch massive Beeinträchtigungen seines Sozialverhaltens zeigen. 3. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und nicht in der Lage ist seine Kosten adäquat kalkulieren zu können, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden, dann wird dieses Individuum auch starke Beeinträchtigungen seiner kommunikativen Kompetenz zeigen. 4. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und nicht in der Lage ist seine Kosten adäquat kalkulieren zu können, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden, dann wird dieses Individuum auch massive Schwierigkeiten haben Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen. 5. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und nicht in der Lage ist seine Kosten adäquat kalkulieren zu können, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden, dann wird dieses Individuum Schwierigkeiten haben seine Interessen adäquat kognizieren zu können. 6. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und nicht in der Lage ist seine Kosten adäquat kalkulieren zu können, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden, dann wird das Kompromissverhalten dieses Individuums umso konfliktiöser sein. 7. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und nicht in der Lage ist seine Kosten adäquat kalkulieren zu können, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden, dann wird das Rollenverhalten dieses Individuums umso defizienter sein. Katalog XI 306 1. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Schwierigkeiten hat seine Interessen adäquat kognizieren zu können, dann wird dieses Individuum auch Schwierigkeiten haben, sich entscheidungsrelevant zu verhalten. 2. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Schwierigkeiten hat seine Interessen adäquat kognizieren zu können, dann wird dieses Individuum auch massive Beeinträchtigungen seines Sozialverhaltens zeigen. 3. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Schwierigkeiten hat seine Interessen adäquat kognizieren zu können, dann wird dieses Individuum auch starke Beeinträchtigungen seiner kommunikativen Kompetenz zeigen. 4. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Schwierigkeiten hat seine Interessen adäquat kognizieren zu können, dann wird dieses Individuum auch massive Schwierigkeiten haben Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen. 5. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Schwierigkeiten hat seine Interessen adäquat kognizieren zu können, dann ist dieses Individuum auch nicht in der Lage, die Kosten adäquat zu kalkulieren, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden. 6. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Schwierigkeiten hat seine Interessen adäquat kognizieren zu können, dann wird das Kompromissverhalten dieses Individuums umso konfliktiöser sein. 7. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Schwierigkeiten hat seine Interessen adäquat kognizieren zu können, dann wird das Rollenverhalten dieses Individuums umso defizienter sein. 307 Katalog XII 1. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und sein Kompromissverhalten konfliktiös demonstriert, dann wird dieses Individuum auch Schwierigkeiten haben sich entscheidungsrelevant zu verhalten. 2. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und sein Kompromissverhalten konfliktiös demonstriert, dann wird dieses Individuum auch massive Beeinträchtigungen seines Sozialverhaltens zeigen. 3. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und sein Kompromissverhalten konfliktiös demonstriert, dann wird dieses Individuum auch starke Beeinträchtigungen seiner kommunikativen Kompetenz zeigen. 4. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und sein Kompromissverhalten konfliktiös demonstriert, dann wird dieses Individuum auch massive Schwierigkeiten haben Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen. 5. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und sein Kompromissverhalten konfliktiös demonstriert, dann ist dieses Individuum auch nicht in der Lage, die Kosten adäquat zu kalkulieren, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden. 6. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und sein Kompromissverhalten konfliktiös demonstriert, dann wird dieses Individuum Schwierigkeiten haben seine Interessen adäquat kognizieren zu können. 7. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und sein Kompromissverhalten konfliktiös demonstriert, dann wird das Rollenverhalten dieses Individuums umso defizienter sein. 308 Katalog XIII 1. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Defizienzen in seinem Rollenverhalten zeigt, dann wird dieses Individuum auch Schwierigkeiten haben sich entscheidungsrelevant zu verhalten. 2. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Defizienzen in seinem Rollenverhalten zeigt, dann wird dieses Individuum auch massive Beeinträchtigungen seines Sozialverhaltens zeigen. 3. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Defizienzen in seinem Rollenverhalten zeigt, dann wird dieses Individuum auch starke Beeinträchtigungen seiner kommunikativen Kompetenz zeigen. 4. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Defizienzen in seinem Rollenverhalten zeigt, dann wird dieses Individuum auch massive Schwierigkeiten haben Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen. 5. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Defizienzen in seinem Rollenverhalten zeigt, dann ist dieses Individuum auch nicht in der Lage, die Kosten adäquat zu kalkulieren, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen würden. 6. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Defizienzen in seinem Rollenverhalten zeigt, dann wird dieses Individuum Schwierigkeiten haben seine Interessen adäquat kognizieren zu können. 7. Für alle x gilt, wenn x ein Individuum ist und Defizienzen in seinem Rollenverhalten zeigt, dann wird das Kompromissverhalten dieses Individuums umso konfliktiöser sein. Interpretation: Was fällt als allererstes auf? 309 Zunächst einmal, dass wir hier eine Fülle von empirischen Hypothesen haben, die sich „extremtypologisch“ zum einen in Richtung auf den Idealfall der Rationalität, zum anderen in Richtung auf den Extremfall der Irrationalität beziehen lassen. Wir brauchen ja lediglich die betreffenden Korrelationen konjunktiv zu „häufeln“ und sodann extremtypologisch zu gewichten. Sodann fällt zweierlei auf, wie ich meine: Erstens, dass in gewisser Weise die Fähigkeit der „kommunikativen Kompetenz“ eine ziemlich dominierende Stellung einnimmt, und zweitens, dass bei genauer Betrachtung alle hier aufgeführten Hypothesen, würden sie als empirische Hypothesen formuliert werden, zwar – streng allgemein gefasst – falsch sind, jedoch sehr wohl, wie man so schön sagt, „etwas für sich haben“. Wir reden dann über Wahrscheinlichkeiten im Sinne des obigen DN-Schemas. Wir sehen sofort, dass genau dann, wenn es uns tatsächlich um die Gewinnung empirisch falsifizierbarer Hypothesen geht, wir gezwungen wären, beobachtbare Indizien für das Vorliegen bzw. die Beeinträchtigung von „kommunikativer Kompetenz“ zu konstruieren, die nicht direkt bezogen sind auf unseren „Korrelationskatalog“. Eine Möglichkeit hierfür wäre z. B. wenn man eine Anleihe bei den Freudschen Befunden zu den sog. „sprachlichen Fehlleistungen“ machen würde und die „Entscheidungsfähigkeit“ eines Individuums mittels dissonanztheoretischen Experimentaldesigns überprüfen würde. Denn der Punkt ist natürlich, dass wir alle unsere schönen Hypothesen und Begrifflichkeiten ja auch irgendwie empirisch zu validieren hätten. Festzuhalten ist an dieser Stelle zunächst einmal lediglich: Wir müssen argumentationsstrategisch scharf unterscheiden, ob wir mittels Ausarbeitung empirisch falsifizierbarer Hypothesen Kriterien entwickeln wollen, die es uns gestatten, pathologische Persönlichkeitsprofile zu erstellen, mittels derer sodann klinisch-diagnostisch umgegangen werden kann, oder aber ob wir eine solche Hypothesenmenge erst entwickeln und in Gestalt einer „Theorie über fehlgelaufene Sozialisationsverläufe“ zusammenfassen wollen: Forschung und klinische Anwendung müssen völlig voneinander getrennt werden. Mehr ist an dieser Stelle zunächst einmal nicht zu sagen. Der entscheidende forschungsheuristische Punkt, um den es hier geht: 310 Die idealtypologische Konstruktion rationalen Handelns schlechthin – ob in der bisher behandelten Weise oder in der Form, wie wir ihr ansonsten begegnen, ist völlig gleichgültig – ist die unabdingbare Voraussetzung für die Konstruktion für Irrationalitätsmodellen – gleichgültig, ob noch verstehbar oder nicht mehr verstehbar – überhaupt. Selbst der Begriff der „Fehlleistung“ macht ja letztendlich nur unter der Prämisse der gedanklichen Annahme Sinn, wie angesichts genau dieser Fehlleistung der Betreffende Handlungsakt als ein subjektiv sinnvoller Verhaltensvorgang hätte ablaufen müssen, wenn nicht irgendeine „Beeinträchtigung“ vorgelegen hätte. Die Erforschung der Gründe für das „so“ bzw. für das prima facie „völlig unverstehbare“ Verhalten eines Menschen in einer ganz bestimmten Situation kann ja nur dann überhaupt erst einsetzen. Fassen wir nunmehr der besseren Übersichtlichkeit halber in Gestalt eines Tafelbildes ein mögliches Ergebnis der vorangegangenen Arbeit an den Rationalitätskatalogen hier zusammen, um so zumindest die groben Umrisse einer (möglichen) Miniaturtheorie des Sozialisationsgeschehens immerhin andeuten zu können. Der damit gemeinte Sachverhalt würde sich dann folgendermaßen darstellen: Schwierigkeiten, sich entscheidungsrelevant zu verhalten Beeinträchtigungen des Sozialverhaltens (1) (2) Beeinträchtigungen der Fähigkeit, Möglichkeiten und Implikationen adäquat abzuschätzen, die fiktive Entscheidungen mit sich bringen (3) Unfähigkeit zur adäquaten Kalkulierung der Kosten, welche mögliche Entscheidungen mit sich bringen (4) Beeinträchtigungen der kommunikativen Kompetenz Schwierigkeiten bei der adäquaten Kognition der eigenen Interessen Konfliktiöses Kompromißverhalten (5) (6) Defizienzen rollenadäquaten Verhaltens (7) Defizienzen in der Identitätskonstruktion (8) Beeinträchtigungen des Lernverhaltens und Tendenzen zur Realitätsverzerrung Tafelbild 4: Grobfassung einer sozialisationstheoretischen Miniaturtheorie 311 (9) Zu beachten ist hierbei, dass dieses Tafelbild ausschließlich Verdeutlichungscharakter hat, eine systematische Interpretation muss ich mir an dieser Stelle leider versagen. In diesem Sinne hier nur zur Erläuterung: Das Tafelbild trägt dem in der vorliegenden Arbeit entwickelten Gedanken Rechnung, dass vor allem dem Konstrukt der „Kommunikativen Kompetenz“ eine herausragende Bedeutung in einer möglichen Theorie der humanspezifischen Sozialisation zukommen könnte. Aus diesem Blickwinkel müssten dann die anderen „wechselseitigen Abhängigkeiten“ – symbolisiert durch die relational aufeinander bezogenen Pfeile – als Korrelationen gedeutet werden. Der eigentlich Schwachpunkt dieser Argumentation liegt darin, dass „so“ keinesfalls schon entscheidbar wäre, ob alle in diesem Zusammenhang möglicherweise validierbaren Korrelationen als Bedeutungsverschärfungen des theoretischen Konstruktes der kommunikativen Kompetenz oder aber als – bereits so relativ komplexe – Klassen von abhängigen bzw. intervenierenden Variablen zu interpretieren wären. Dies könnte erst dann überhaupt einigermaßen sinnvoll diskutiert werden – und genau darauf kommt es mir hier wesentlich an –, wenn die ja nach wie vor ausstehende allgemeine Theorie des Sozialisationsgeschehens sehr viel deutlichere Konturen gewonnen hätte, als sie sie derzeitig hat. Hier geht es nur um die Zusammentragung einiger begrifflicher und methodischer „Bausteine“ hierfür: Eine Ätiologie der Mentalerkrankungen ist fundiert in einer streng allgemein konzipierten empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie, die, wie ich zu zeigen versucht habe, „auf lange Sicht“ mit der Beantwortung der Frage befasst sein muss, wann und wie sich in der (familialen) Primordialphase des psycho-somatischen Geschehens „Mensch“ dessen je individuelle Verhaltensdynamik in „subjektiv sinnhaftes (soziales) Handeln“ transformiert. 312 III. Bilanz und Ausblick Die vorliegende Arbeit hat darauf aufmerksam gemacht, dass es sich sowohl für die „Allgemeine Psychiatrie“, als auch insbesondere für die „Kinder- und Jugendpsychiatrie“ lohnen könnte, dem genuin soziologischen „point of view“ wesentlich mehr Beachtung zu schenken, als dies bislang der Fall ist. Zugleich jedoch ist dabei deutlich geworden, dass es sich, wenn man dies tut, wohl kaum umgehen lassen wird, die damit verwobenen erkenntnistheoretischen wie – im engeren Sinne – methodologischen (Grundlagen-)Probleme der Gesellschaftswissenschaften systematisch einzubeziehen. Das umgekehrt auch die strenge Wissenschaftslehre, welche sich mit dieser Grundlagenproblematik der Gesellschaftswissenschaften befasst, von einer Ausweitung ihres Horizontes in Richtung auf die Probleme der „Entwicklungspsychopathologie“ vielfältigen Gewinn haben dürfte, steht außer Frage. Was jedoch genau hat die hier vorgelegte Arbeit gezeigt? Welche Fragen lassen sich beantworten, welche Erklärungen bieten sich wofür an? Kann eventuell doch auf der Grundlage der hier entwickelten Argumentation irgendetwas erklärt werden? Die Antwort dürfte überraschen: Anhand der Leitfrage nach dem systematischen Zusammenhang zwischen „Identitätskrisen, Devianz und sozialer Kontrolle“ sollte auf die sozialisationstheoretische Dimension sozialen Handelns aufmerksam gemacht und die Bedeutung des psychoanalytischen Paradigmas für das insbesondere von Max Weber entwickelte Unternehmen einer „Verstehenden Soziologie“ herausgearbeitet werden. Dezidiert wurde dabei die Absicht verfolgt, den in „Klinischer Psychologie“ und „Psychiatrie“ repräsentierten heilkundlichen Einrichtungen unserer Gesellschaft, die sich vornehmlich mit der psycho-sozialen Dimension von „Gesundheit“ und „Krankheit“ befassen, ein wenig Hilfestellung zu leisten. Gezeigt werden konnte zumindest, worin genau diese „Hilfsdienste“ zu bestehen hätten: Jedwede Ätiologie der Mentalerkrankungen bedarf einer genuin soziologischen Komplementarisierung in Gestalt einer empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie, deren „Kern- und Generalfrage“ das Problem der Transformation humanspezifischen Verhaltens in „subjektiv sinnhaftes (soziales) Handeln“ betrifft. Wenn also die in der Allgemeinen Psychiatrie wie auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sehr oft vertretene Auffassung, es gäbe für die wirklich schweren Mentalerkrankungen 313 vornehmlich des sog. „zwangsneurotischen“ und „psychotischen“ Formenkreises bislang keine wirklich triftige Ätiologie und folglich lägen (naturgemäß) auch Diagnostik, Prognostik, Anamnestik und Therapie zum einen der im engeren Sinne „anankistischen“, zum anderen der halluzinatorisch-psychotischen Erscheinungsformen von Realitätsfugativität im Argen, korrekt ist, dann beantwortet die vorliegende Abhandlung die Frage, warum das so ist, nämlich: Es gibt bislang keine empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie in dem in dieser Arbeit beschriebenen präzisen Sinne. Eine solche jedoch – und genau dies hat die vorliegende Arbeit plausibel zu machen versucht – wäre unabdingbar, wenn der hier vorgetragenen Argumentation zugestimmt werden würde, jedwede Ätiologie entwicklungspsychopathologischer Syndrome gründe in einer solchen streng allgemein konzipierten empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie. Nur aus diesem Blickwinkel nämlich, so die Grundthese dieser Arbeit, ließen sich benigne gegenüber malignen Identitätskrisen dergestalt diskriminieren, dass die Wurzeln der kognitiven Dynamik subjektiv sinnhaften (sozialen) Handelns aufgedeckt werden könnten. Doch nicht nur dies wurde gezeigt. Es wurde auch der eigentlich Grund dafür genannt, dass eine solche psychiatrie-relevante empirisch falsifizierbare Sozialisationstheorie bislang nicht erarbeitet worden ist, nämlich: Diejenigen sozial- und kulturwissenschaftlichen Fachdisziplinen, in deren Kompetenzbereich die Ausarbeitung einer solchen Theorie fallen würde, haben bis zum heutigen Tage die mit der Konstruktion einer solchen Theorie notwendigerweise verbundenen methodologischen Probleme – hier ist vor allem das Integrationsproblem zu nennen – nicht lösen können, denn: Die je spezifische Ausbildung sinnstiftender Individualitätsmuster und damit der Prozess der „Ich-Werdung“ in der primordialen Sozialisationsphase gehen einher mit der Ausbildung der Fähigkeit zur Erstellung je subjektiver Identitätskonstruktionsprinzipien. Und die dabei zu beobachtende „Methode“ scheint wesentlich auf die Herausbildung der sog. „kommunikativen Kompetenz“ angewiesen zu sein, deren humanspezifische Idealtypologie bislang nur von Gadamer hat beschrieben werden können. Doch selbst wenn in dieser Hinsicht der Argumentgang der vorgelegten Arbeit einigermaßen überzeugte – und ich hoffe natürlich, dass er das tut –, ist dennoch nach wie vor methodologisch weitgehend ungeklärt, wie die dabei hinzugezogenen Konstruktionen, die ja z.T. völlig voneinander abweichenden „Theorieansätzen“ und „Paradigmen“ entstammen so zu einem in sich widerspruchsfreien System von Grundannahmen integriert werden könnten, dass sich daraus empirisch 314 falsifizierbare Hypothesensysteme erstellen ließen. Auch diese dürfen sich ja auf gar keinen Fall widersprechen. Worin genau besteht also das Problem? Richtig ist sicherlich die eingangs genannte streng allgemeine Aussage, dass genau dann, wenn wegen ausgesprochen schlechter „Startbedingungen“ in der primordialen Sozialisationsphase eines menschlichen Wesens die seine kognitive Dynamik bestimmenden Identitätskrisen mehr und mehr maligne werdende Gestalt annehmen und diese u.U. gar in identitätskritische Dauerzustände übergehen, tatsächlich über kurz oder lang die ursprünglich durchaus auf Rationalität hin angelegt gewesene Kognitivdynamik des Handelns dieses Menschen erodieren dürfte und dies wiederum dürfte in der Regel sodann auch die bei Redlich und Freedman beschriebenen desaströsen personalsystemischen Auswirkungen haben. Der eigentlich neuralgische Punkt dieser Sichtweise jedoch besteht darin, dass es uns bislang versagt ist, eben diese „Startbedingungen“ genau zu beschreiben. Um das zu können, benötigten wir nämlich denjenigen Teil einer „Allgemeinen Sozialisationstheorie“, der sich mit den institutionellen Dimensionen des Familialgeschehens zu befassen hätte. Es ist ja alles andere als ein Zufall, dass auch und gerade die vorliegende Arbeit in inhaltlicher Beziehung immer nur dann etwas präziser hat werden können, wenn sie sich einigermaßen auf dem relativ sicheren Boden der genuin lerntheoretischen Aspekte des Enkulturations- und Sozialisationsprozesses bewegte. Doch wie auch immer. Fragen wir zunächst einmal weiter: Worin bestand eigentlich die grundsätzliche Schwierigkeit des in der vorliegenden Arbeit angelegten „ehrgeizigen Unternehmens“ (Resch)? Nun, vor allem darin, dass in der bisher entwickelten Psychiatrie tatsächlich der genuin soziologische „point of view“ so gut wie überhaupt nicht etabliert ist, wodurch sich ja fast automatisch die Notwendigkeit ergab, permanent zugleich methodologische Grundlagenprobleme „mitdiskutieren“ zu müssen, sollte doch zumindest ein halbwegs plausibler Einblick verschafft werden in die verschiedenen methodischen Probleme sowohl der theoretischen als auch der – im engeren Sinne – empirischen „Praxis der Sozialforschung“. Die diskursive Darlegung des Identitätsproblems hätte sich nämlich sehr viel leichter gestalten lassen, wenn nicht derartig vieles an Information über bestimmte soziologische Zusammenhänge bzw. wissenschaftstheoretische Probleme notorisch hätte mitgeliefert werden müssen. Dies betrifft vor allem den Zusammenhang zwischen der „Kulturwertediskussion“ auf der einen Seite und dem Verhältnis zwischen Makro- und Mikrosoziologie auf der anderen Seite: Würde es bereits zum festen Bestand 315 allgemeinpsychiatrischer „Theorie und Praxis“ gehören, dass es sich bei den „medizinischen“ Einrichtungen um Systeme der sozialen Kontrolle mit ganz bestimmten normativ vorgegebenen Systemzielen handelt, die gar nicht von sich aus „ermächtigt“ und folglich auch nicht in der Lage sind, Sozialisationszielvorgaben autonom festzulegen und „therapeutisch“ zu realisieren, so hätte man sich viel stärker auf den Wechselwirkungszusammenhang von Rollenstrukturen in Kleingruppen und Identitätskrisen konzentrieren können, – ein Wechselwirkungszusammenhang, welcher die Problematik der „Kulturwertevorgaben“ und „Praxis“ ja auf eine ganz bestimmte Art und Weise, nämlich wesentlich konfliktiös, widerspiegelt. Bekanntlich hat Erikson den Begriff der „Ich-Identität“ eingeführt und allenthalben wird beklagt, dass dieses Konstrukt bei Erikson selbst nie die arbeitsbegrifflich handhabbare Formel geworden sei, die man benötige. Auch hier zeigt sich eine gewisse „wissenschaftslogische Naivität“ der Psychiatrie, wie mir scheint: Hinter der Erikson’schen „Kurzformel“ steckt eine ganze Theorie, und diese ist eben bei Erikson nicht klar ausformuliert, kann es auch gar nicht, wie nach allem, was in der vorliegenden Arbeit über den Zusammenhang von „Idealtypen“, „Grundannahmen“ und „empirisch falsifizierbaren Theoriegebilden“ ausgeführt wurde, zu einem solchen Unternehmen zu sagen ist. Vor allem hat Erikson gerade keine wirkliche Sozialisationstheorie vorlegen können. Es ist von daher, wie mir scheint, auch alles andere als ein Zufall, dass sich in den meisten Besprechungen des Eriksonschen „Ansatzes“ restlos alles darauf konzentriert, den „Pubertätsraum“ des Sozialisationsgeschehens in den Blick zu nehmen, um genau hier den Zusammenhang zwischen Vulnerabilität, Identitätsdiffusion und Rollendiffusion – besser: Rollenkonfusion – aufzuzeigen. Eine psychiatrie-relevante Sozialisationstheorie muss demgegenüber jedoch tatsächlich vor allem dreierlei leisten, wie einleitend betont: Sie muss erstens die kognitive Dynamik humanspezifischen Verhaltens zu beschreiben gestatten, zweitens deren Wurzeln in der frühen Kindheit freizulegen imstande sein und drittens den funktionalen Stellenwert der Identitätskrisen für die jeweilige Charakterbildung eines Menschen bestimmen können, um so zum einen „erfolgreiche“, zum anderen „gründlich schief gelaufene“ Sozialisationsvorgänge erklären zu können. Vor allem aber – dies folgt praktisch aus allem, was in dieser Arbeit anund ausgeführt worden ist – muss sie dabei den zweiten Aspekt in den Blick nehmen, was wir mittels der „Kernfrage aller Sozialisationstheorien“ zu umschreiben versucht haben: Die „Wurzeln“ der kognitiven Dynamik subjektiv sinnhaften Sichverhaltens zu (inneren wie äußeren) Objekten liegen in der frühen Kindheit, nämlich in derjenigen hochsensiblen Phase des Sozialisations- und Enkulturationsprozesses, in der sich die noch weitgehend 316 „organismisch“ ablaufenden Verhaltensmodifikationen eines menschlichen Wesens so langsam in kognitive Umstrukturierungsformen transformiert. Und genau hier stoßen wir wiederum auf das weiter oben bereits genannte sozialstrukturelle Problem, die institutionellen Dimensionen des Sozialgeschehens in der „Familialphase“ des Sozialisationsprozesses beschreiben zu müssen. Es ergibt sich also nunmehr die folgende zentrale These: Die Kette der malignen Identitätskrisen, welche zunehmend identitätskritische Dauerzustände mit entsprechend gravierenden psychopathologischen Verhaltensmustern „einschleifen“ und sodann eben auch entsprechenden personalen Zerrüttungserscheinungen den Weg bereiten, ist letztendlich zurückführbar auf ganz bestimmte in der Primordialphase von Sozialisation- und Enkulturation dominierende sozialstrukturelle Bedingungen, unter denen sich die methodischen Prinzipien der je individuellen Identitätskonstruktionskompetenzen etabliert haben. Denn es ist die Art und Weise, wie Identitätskonstruktion habitualisiert zu werden pflegt, – eben die „Methode“ – nicht jedoch die jeweilige Persönlichkeitsstruktur der primordial ausschlaggebenden Bezugspersonen als solche („schizophrenogene Mutter“ bzw. „ich-schwacher Vater“), die darüber entscheidet, ob jemand einer eher maligne oder eher eine benigne „Identitätskrisenkarriere“ durchläuft. Und bezogen auf die Ausarbeitung einer empirisch falsifizierbaren Sozialisationstheorie, welche diese Problematik zu klären hat, fällt der „Soziologie“ die Aufgabe zu, die sozialstrukturellen Bedingungen zu beschreiben und zu erklären, die jeweils gegeben sein müssen, damit sich überhaupt eine ganz bestimmte Identitätskonstruktionsmethode herausbilden kann. * 317 Abschließend noch einige Worte der Dankbarkeit. Meine Kolleginnen und Kollegen der „Dossenheimer Forschungsgruppe“ und vor allem unseren „Mentor“ werde ich nicht mit den üblichen Danksagungsformeln bedenken. Die gesamte Argumentationsstruktur der Arbeit belegt, was sinnvollerweise hierzu zu sagen wäre. Wirklich dankbar bin ich Herrn Resch und indirekt natürlich Herrn Verres, dem ich sicherlich während meiner Beratungstätigkeit an seinem Buch mehr als einmal auf die Nerven gegangen bin. Warum Herrn Resch? Weil er ein Wagnis eingegangen ist um eines möglichen Fortschrittes unseres klinischen Wissens über die Krankheiten von Kindern willen. Der 13. Juni des Jahres 2005, an dem zwischen Herrn Resch, Herrn Porath und mir die Modalitäten für die Fertigstellung meiner Arbeit besprochen worden sind, war, wenn man so will, ein historisches – genauer: ein wissenschaftshistorisches – Datum. Warum? Mein Mentor, Herr Porath, hat mich erst darauf aufmerksam machen müssen, wie weit Herr Resch in dieser Besprechung in Wirklichkeit gegangen ist. Ich selbst habe das „so“ an jenem denkwürdigen 13. Juni – naiverweise, muss man wohl sagen – nicht gesehen. Erst in den folgenden Monaten wurde immer deutlicher, dass ohne diesen „Legitimationshintergrund“, den Herr Resch mutigerweise „auf seine Kappe genommen“ hat, die Arbeit in dieser Form gar nicht hätte geschrieben werden können. Er tat es um des Schrittes in die Grundlagenforschung willen, und für genau diesen Wagemut bin ich ihm dankbar. Abschließend noch ein Wort des Dankes an eine Institution, der man normalerweise niemals Dank zu schulden glaubt: dem deutschen Staat. Hätte er mich nicht so tatkräftig vor allem in den letzten Monaten mit Sachhilfe, Geld, aber auch – in Gestalt seiner Amtsträger – mit vernünftigem Rat und großzügiger Toleranz unterstützt, wäre der Abschluss dieses Unternehmens ganz und gar unmöglich gewesen. Die hier vorgelegte Dissertation, deren Schwächen natürlich voll zu meinen Lasten gehen, ist der in dieser Hinsicht zu verstehende Versuch einer „moralischen Schuldentilgung“, wenn man so will. Doch nicht nur dies. Meine Arbeit legt ja zugleich auch Zeugnis ab dafür, dass „Interkulturalität“ im derzeitig statthabenden Prozess der europäischen Einigung keine leere Phrase bleiben muss. Deshalb meine hiermit dokumentierte Dankbarkeit gegenüber den sog. „öffentlich-rechtlichen Einrichtungen“ des deutschen Staates. 318 In diesem Sinne schulde ich des weiteren meinem Landsmann, Herrn Prof. Tsiakalos, Dank. Er hat mich abgestützt, indem er mir intellektuell kreditierte, dass ich etwas halbwegs Vernünftiges zu leisten imstande bin auf dem Felde der Sozial- und Kulturwissenschaften. Er war da, als ich mich verzweifelt bemüht habe, einen kompetenten Zweitgutachter aufzutreiben und hat sich als ein solcher vorbehaltslos zur Verfügung gestellt. Dies ja weit mehr als nur das sonst übliche Lippenbekenntnis zu „europäischer Integration“, „Interkulturalität“ und – last not least – „Frauenemanzipation“. Was ich deshalb niemals verstehen werde, ist die ablehnende Haltung von Herrn Prof. Zimmermann und Herrn Prof. Thomas Schwinn in der Frage der sog. „Zweit- bzw. Drittbegutachtung“. Aber das ist wohl eher ein Thema, welches unter dem Titel „Zivilcourage“, einem „altdeutschen“ Leiden, wie man mir sagte, abzuhandeln wäre. 319 Literaturverzeichnis Albert 1964 ALBERT, Hans (Hrsg.): Theorie und Realität. Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften. Tübingen 1964. Aurnhammer 2002 AURNHAMMER, Achim: Gruppenstile. Identitätskonstruktionen in der deutschen Lyrik der klassischen Moderne 1880-1930. Vortrag bei einer Arbeitstagung der Forschungsgruppe Dossenheim am 8. März 2002. Baumgartner/Rüsen [Erträge] BAUMGARTNER, Hans Michael; RÜSEN, Jörn: Erträge der Diskussion. Aus: Lämmert, E. (Hrsg.): Erzählforschung - Ein Symposion. Stuttgart 1982. S. 691-701. Bunge [Scientific Research I] BUNGE, Mario: Scientific Research I. The Search for System, New York 1967. Buschendorf/Porath 1996 BUSCHENDORF, Bernhard; PORATH, Hann-Jörg: Symbol und Verkörperung. Zur kultursoziologischen Dimension des kulturpsychologischen Ansatzes von Edgar Wind. Vortrag bei der "Tagung des Einstein Forums" zu dem Thema "Edgar Wind. Kunsthistoriker und Philosoph, Berlin im Feb. 1996. Demetriou [Morgue] DEMETRIOU, Marina: "Morgue und andere Gedichte": Facetten der frühen expressionistischen Lyrik Gottfried Benns. Universität Heidelberg, Neuphilologische Fakultät, Magisterarbeit 2001. Als Manuskript gedruckt. Demetriou 2002 DEMETRIOU, Marina: Die poetische Konstruktion der Wirklichkeit bei Gottfried Benn. Studie zur kulturgeschichtlichen Signifikanz des sogenannten "Frühexpressionismus". Arbeitspapier der Forschungsgruppe Dossenheim, Dissertationsentwurf, auch als Vortrag im Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg 2002. Döblin 1965 DÖBLIN, Alfred: Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf, München 1965. Durkheim [Selbstmord] DURKHEIM, Emile: Der Selbstmord. Frankfurt a. M. 1995. Durkheim 1965 DURKHEIM, Emile: Die Regeln der soziologischen Methode. Neuwied 1965. Elias [Zivilisation] ELIAS, Norbert: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, 5. Aufl., 2 Bände, Frankfurt a. M. 1968. Erikson 1965 ERIKSON, Erik H.: Identität und Lebenszyklus. Frankfurt a. M. 1966. Freud [Enttäuschung] FREUD, Sigmund: Die Enttäuschung des Krieges. IN: Studienausgabe, Band IX, S. 35ff, Frankfurt a. M. 2000. 320 Freud [Illusion] FREUD, Sigmund: Die Zukunft einer Illusion. IN: Studienausgabe, Band IX, S. 135ff, Frankfurt a. M. 2000. Freud [Massenpsychologie] FREUD, Sigmund: Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921). IN: Studienausgabe, Band IX, S. 61134, Frankfurt a. M. 2000. Freud [Studienausgabe] FREUD, Sigmund (Hrsg.): Studienausgabe. 10 Bände und ein unnumerierter Ergänzungsband. Frankfurt a. M. 2000. Freud 1908 FREUD, Sigmund: Der Dichter und das Phantasieren (1908 [1907]). IN: Studienausgabe, Band X, S. 169ff Frankfurt a. M. 2000. Freud 1911 FREUD, Sigmund: Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens. IN: Studienausgabe, Band III, S. 13ff, Frankfurt a. M. 2000. Freud 1933 FREUD, Sigmund: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1916-17 [1915-17]). Studienausgabe, Band I, S. 41ff, Frankfurt a. M. 2000. Frey; Irle 2002 FREY, Dieter; IRLE, Martin (Hrsg.): Theorien der Sozialpsychologie. 3 Bände, 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Bern, Göttingen, Toronto u. a. 2002. Gadamer 1975 GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 4. Auflage, Tübingen 1975. Gadamer 1999 GADAMER, Hans-Georg: Sprache und Verstehen; Wie schreibt die Sprache das Denken vor; Die Unfähigkeit zum Gespräch. IN: Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, Band II, 6. Auflage, S. 184ff; S. 199ff; S. 207ff, Tübingen 1999. Habermas 1987 HABERMAS, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bände, 4. Auflage, Frankfurt a. M. 1987. Handbuch KÖNIG, R. (Hrsg.): Handbuch der empirischen Sozialforschung. 2 Bände, Band I (1962), Band II (1969) Stuttgart 1962, (1969). Holland/Skinner 1974 HOLLAND, James G.; SKINNER, B. F.: Analyse des Verhaltens. München-Berlin-Wien 1971. Holzkamp [Wissenschaft als Handlung] HOLZKAMP, Klaus: Wissenschaft als Handlung. Versuch einer neuen Grundlegung der Wissenschaftslehre, Berlin 1968. Homans [Elementarformen] HOMANS, Georg Caspar: Elementarformen sozialen Verhaltens. Köln und Opladen 1968. Homans [Theorie] HOMANS, George Caspar: Theorie der sozialen Gruppe, 3. Auflage, Köln und Opladen 1968. Homans 1964 HOMANS, George Caspar: Bringing Men Back In. In: The American Sociological Review, Vol. 29. Jg. (1964), H. 5, S. 809-818. 321 Homans 1972 HOMANS, George Caspar: Grundfragen soziologischer Theorie. Aufsätze, Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Viktor Vanberg, Opladen 1972. Irle 1975 IRLE, Martin: Lehrbuch der Sozialpsychologie. Göttingen-Toronto-Zürich 1975. Janzarek 1980 JANZAREK, W.: Strukturdynamik. Aus: Peters, U. (Hrsg.): Die Psychologie des 20. Jahrhunderts. Band X, Ergebnisse für die Medizin (2) Psychiatrie Zürich 1980. Jaspers [Psychopathologie] JASPERS, Karl: Allgemeine Psychopathologie. 9. Auflage, Berlin 1973. Kant 1978 KANT, Immanuel: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? IN: Werkausgabe, Band XI, Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik 1, Hrsg. von Wilhelm Weischedel, 2. Auflage, S. 53ff, Frankfurt a. M. 1978. Karnavou [Identitätskrisen] KARNAVOU, Maria-Christina: Identitätskrisen und Delinquenzdisposition. Zum Problem der Erfassung und Gewichtung kriminogener Faktoren beim Auftreten von Juvenaldelinquenz. Universität Heidelberg, Institut für Soziologie, Magisterarbeit 2000. Als Manuskript gedruckt. Kohlberg 1974 KOHLBERG, L.: Zur kognitiven Entwicklung des Kindes. Frankfurt a. M. 1974. Kranz/Heinrich 1971 KRANZ, Heinrich; HEINRICH, Kurt (Hrsg.): Schizophrenie und Umwelt. 5. Bad Kreuznacher Symposion 1970, Stuttgart 1971. Kraus [Rollentheorie] KRAUS, A.: Bedeutung und Rezeption der Rollentheorie in der Psychiatrie. Aus: Peters, U. (Hrsg.): Die Psychologie des 20. Jahrhunderts. Band X, Ergebnisse für die Medizin (2) Psychiatrie Zürich 1980. S. 125ff. Krech/Crutchfield 1968 KRECH, David; CRUTCHFIELD, Richard S.: Grundlagen der Psychologie. Band I, Weinheim und Berlin 1968. Lämmert [Erzählforschung] LÄMMERT, E. (Hrsg.): Erzählforschung - Ein Symposion. Stuttgart 1982. Lepsius [Institutionen] LEPSIUS, Rainer M.: Interessen und Ideen. Die Zurechnungsproblematik bei Max Weber. IN: Ders.: Interessen, Ideen und Institutionen, S. 31-44, Opladen 1990. Liousi [Kompetenzbegriff] LIOUSI, Eleni: Der Kompetenzbegriff als Grundbegriff der Chomskyschen Linguistik und die Kritik an der rein linguistischen Betrachtung des Sprachproblems aus dem Blickwinkel der Psycholinguistik. Universität Heidelberg, Neuphilologische Fakultät, Magisterarbeit 2001. Als Manuskript gedruckt. Luckmann 1974 LUCKMANN, Th.: Einleitung zu Wygotski. IN: Wygotski, Lev S..: Denken und Sprechen. 5. Auflage, Berlin 1974. Mahrenholz/Porath [Kelsen] MAHRENHOLZ, Ernst Gottfried; PORATH, Hann-Jörg: Das Problem einer rationalen Rekonstruktion der Kelsenschen "Reinen Rechtslehre". Vortrag im Wiener Kolloquium. Heidelberg 1985. 322 Mead 1973 MEAD, George Herbert: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. 2. Auflage, Reutlingen 1973. Merton [social structure] MERTON, R. K.: Social Theory and Social Structure. 2. Auflage, Glencoe 1957. Michael [Ästhetische Sensibilisierung] MICHAEL, Dietlinde: Ästhetische Sensibilisierung und Erziehung zur Mündigkeit. Arbeitspapier der Forschungsgruppe Dossenheim, Dissertationsentwurf. Michael 2005 MICHAEL, Dietlinde: Funktion des Gadamerschen Gesprächs für den pädagogischen Prozess. Arbeitpapier der Forschungsgruppe Dossenheim, Vorlage für einen Vortrag im Doktorandenkolloquium Karlsruhe (Lehrstuhl Schweitzer), WS 2005/2006. Mitrov 2005 MITROV, Marija: Naturalisierung des Bewußtseins. Universität Heidelberg, Philosophisch-Historische Fakultät, Magisterarbeit 2005. Als Manuskript gedruckt. Nagel 1972 NAGEL, Ernest: Probleme der Begriffs- und Theoriebildung in den Sozialwissenschaften. IN: Albert, Hans (Hrsg.): Theorie und Realität. Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften, 2., veränderte Auflage, S. 67-85, Tübingen 1972. Opp 1970 OPP, Karl-Dieter: Methodologie der Sozialwissenschaften. Einführung in Probleme ihrer Theoriebildung. Reinbeck bei Hamburg 1970. Opp 1974 OPP, Karl-Dieter: Abweichendes Verhalten und Gesellschaftsstruktur. Neuwied 1974. Opp, Hummel 1973 OPP, Karl-Dieter; HUMMEL, Hans J.: Soziales Verhalten und Soziale Systeme. 2 Bände, Frankfurt a. M. 1973. Ostermann [Individuum] OSTERMANN, Rainer: Die Freiheit des Individuums. Eine Rekonstruktion der Gesellschaftstheorie Wilhelm von Humboldts, Frankfurt/New York 1993. Parsons 1978 PARSONS, Talcott: The Social System. IN: Parsons, Talcott; Shils, Edward A.: Toward a General Theory of Action. 3. Auflage, Harvard 1978. Peters 1980 PETERS, U. (Hrsg.): Die Psychologie des 20. Jahrhunderts. Band X, Ergebnisse für die Medizin (2) Psychiatrie Zürich 1980. Piaget 1978 PIAGET, Jean: Das Weltbild des Kindes. Stuttgart 1978. Popitz 1967 POPITZ, Heinrich: Der Begriff der sozialen Rolle als Element der soziologischen Theorie. Tübingen 1967. (= Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart. 331/332) Popper [A Realist View] POPPER, Karl R.: A Realist View of Logic, Physics and History. IN: Ders.: Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, S. 285ff, Oxford 1972. 323 Popper [Naturgesetze] POPPER, Karl R.: Naturgesetze und theoretische Systeme. IN: Albert, Hans (Hrsg.): Theorie und Realität. Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften. Tübingen 1964. S. 87-102. Popper [Zielsetzung] POPPER, Karl R.: Die Zielsetzung der Erfahrungswissenschaft. IN: Albert, Hans (Hrsg.): Theorie und Realität. Ausgewählte Aufsätze zur Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften. Tübingen 1964. S. 73-86. Popper 1966 POPPER, Karl R.: Universalien, Dispositionen und Naturnotwendigkeit. Neuer Anhang X. IN: Ders.: Logik der Forschung. 2. Auflage, S. 374ff, Tübingen 1966. Porath [Begleitpapier] PORATH, Hann-Jörg: Begleitpapier zu dem Hauptseminar "Der kulturwissenschaftliche Ansatz Edgar Winds" (Buschendorf/Buschendorf/Porath). Universität Heidelberg, Germanistisches Seminar, WS 95/96. Porath [Forschungsantrag] PORATH, Hann-Jörg: Die sozialwissenschaftlichen Grundlagen der kulturwissenschaftlichen Problemstellung - das Intellektuellenproblem. Forschungsantrag zur Erlangung des Kulturwissenschaftlichen Forschungspreises des Landes Nordrhein-Westfalen 2001 (1999). Dossenheim bei Heidelberg 2001. Porath [Narratives Paradigma] PORATH, Hann-Jörg: Narratives Paradigma, Theorieproblem und Historische Objektivität. IN: Lämmert, E. (Hrsg.): Erzählforschung - Ein Symposion. Stuttgart 1982. S. 660-690. Porath [Psychiatrische Historik] PORAT, Hann-Jörg: Psychiatrische Historik. Arbeitspapier der Forschungsgruppe Dossenheim. Porath 2003 PORATH, Hann-Jörg: Die Endlösung der Judenfrage - Ein kulturgeschichtlich bedeutsames Ereignis und ein kulturwissenschaftliches Erklärungsproblem. Vortrag vom 16. Mai 2003 im Jüdischen Historischen Institut (ZIH), Warschau. Dossenheim bei Heidelberg 2003. Redlich, Freedman [Psychiatrie] REDLICH, Fredrick C.; FREEDMAN, Daniel X.: Theorie und Praxis der Psychiatrie. Frankfurt a. M. 1970. Remplein [seelische Entwicklung] REMPLEIN, H.: Die seelische Entwicklung des Menschen im Kindes- und Jugendalter. 14. Auflage, München, Basel 1966. Resch et al. [Entwicklungspsychopathologie] RESCH, Franz, et al.: Entwicklungspsychopathologie des Kindes- und Jugendalters. Ein Lehrbuch, 2., überarb. und erw. Aufl., Weinheim 1999. Rudolph [Störende Bedingungen] RUDOLPH, Julian: Störende Bedingungen. Klaus Holzkamps Beitrag zur Analyse des Problems der experimentellen Bewertung von empirisch-wissenschaftlichen Theorien, Universität Heidelberg, Philosophisch-Historische Fakultät, Magisterarbeit 1993. Als Manuskript gedruckt. Sack [Kriminalsoziologie] SACK, Fritz: Probleme der Kriminalsoziologie. Aus: König, R. (Hrsg.): Handbuch der empirischen Sozialforschung. 2 Bände, Band I (1962), Band II (1969) Stuttgart 1962, (1969). S. 961-1049. 324 Schaaf [Macbeth] SCHAAF, Tatjana: Macbeth als politische Pädagogik im Nachkriegsdeutschland. Studie zum Reedukationsprogramm der westlichen Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland. Vortrag bei der SHINE-Konferenz 2005 in Krakau. Schmitt [Karl Jaspers] SCHMITT, Wolfram: Die Psychopathologie von Karl Jaspers in der modernen Psychiatrie. Aus: Peters, U. (Hrsg.): Die Psychologie des 20. Jahrhunderts. Band X, Ergebnisse für die Medizin (2) Psychiatrie Zürich 1980. S. 47ff. Schönleben SCHÖNLEBEN, Christian: Einleitendes Arbeitspapier zu dem Vortrag von Achim Aurnhammer "Gruppenstile ..." bei einer Arbeitstagung der Forschungsgruppe Dossenheim am 8. März 2002. Schönleben [Weltbühne] SCHÖNLEBEN, Christian: Die Weltbühne oder: Was ist Aufklärung? Der Gestaltwandel der bürgerlichen Öffentlichkeit und die Pathogenese des Faschismus - Die Entwicklung des Sozialismus von der Wissenschaft zur Utopie. Arbeitspapier der Forschungsgruppe Dossenheim, Dissertationsentwurf, auch Vortrag im Doktorandenkolloquium des IPW, Heidelberg im SS 2003. Stegmüller 1970 STEGMÜLLER, Wolfgang: Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie. 5 Bände, Berlin, Heidelberg, New York 1970. Stryker [Interaktionismus] STRYKER, S.: Die Theorie des Symbolischen Interaktionismus. IN: Soziologie der Familie. Sonderheft 14 der "Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie", Opladen 1970. Tellenbach [Wesen des Menschen] TELLENBACH, H.: Die Begründung der psychiatrischen Erfahrung und psychiatrischer Methoden in philosophischen Konzepten vom Wesen des Menschen. IN: Gadamer, H. G.; Vogler, P. (Hrsg.): Neue Anthropologie, Band XI, 138ff, Stuttgart 1975. Verres [Was uns gesund macht] VERRES, Rolf: Was uns gesund macht. Freiburg im Breisgau 2005. VuPP 2002 Verhaltenstherapie und Psychosoziale Praxis. Schwerpunkt „Therapie der Schizophrenie“ Heft 4, o. O. 2002 Weber [Einleitung] WEBER, Max: Einleitung in die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. IN: Ders.: Soziologie, Universalgeschichtliche Analysen, Politik, Hrsg. und erläutert von Johannes Winckelmann, 6. Auflage, 414ff, Stuttgart 1992. Weber [Objektivität] WEBER, Max: Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. IN: Ders.: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Hrsg. von Johannes Winckelmann, 6., erneut durchgesehene Auflage, 146-214, Tübingen 1985. Weber [Vorbemerkung] WEBER, Max: Vorbemerkung zu den Gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie. IN: Ders.: Soziologie, Universalgeschichtliche Analysen, Politik. 6. Auflage, Hrsg. und erläutert von Johannes Winckelmann, Stuttgart 1992. Weber [Wirtschaft und Gesellschaft] WEBER, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, 5. Auflage, Besorgt von Johannes Winckelmann, Tübingen 1972. 325 Werle [Verbrechensbekämpfung] WERLE, Gerhard: Justiz - Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich. Berlin/New York 1989. Winckelmann [Anmerkungen und Erläuterungen] WINCKELMANN, Johannes: Anmerkungen und Erläuterungen. IN: Weber, Max: Soziologie, Universalgeschichtliche Analysen, Politik, Hrsg. und erläutert von Johannes Winckelmann, S.532f Stuttgart 1992. Zetterberg [Theorie, Forschung und Praxis] ZETTERBERG, Hans L.: Theorie, Forschung und Praxis in der Soziologie. IN: König, R. (Hrsg.): Handbuch der empirischen Sozialforschung, Band I , Stuttgart 1962. Zimmermann [Auschwitz] ZIMMERMANN, Rolf: Philosophie nach Auschwitz. Eine Neubestimmung von Moral in Politik und Gesellschaft, Reinbeck bei Hamburg 2005. Zimmermann [Gattungsbruch] ZIMMERMANN, Rolf: Gattungsbruch. Die Bedeutung des Holocaust für die Ethik In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 52. Jg. (204), S. 667-690. Zimmermann [Utopie - Rationalität - Politik] ZIMMERMANN, Rolf: Utopie-Rationalität-Politik. Zur Kritik, Rekonstruktion und Systematik einer emanzipatorischen Gesellschaftstheorie bei Marx und Habermas, Freiburg, München 1985. 326