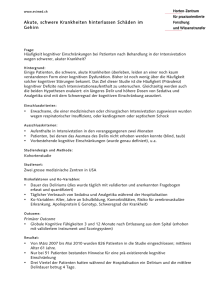Vorlesung: Förderung-Training-Intervention
Werbung

1 Vorlesung Förderung und Intervention im Bildungs- und Erziehungsbereich Skizzierung einiger theoretischer Probleme von Förderungs- und Trainingsmaßnahmen Kognitive Förderung und Denktraining (Klauer) Förderung der Lernmotivation Gestaltung lernförderlicher Schulumwelten Erziehung und Förderung von Migrantenkindern 2 Theoretische Probleme von Lern- und Denkstrategien sowie Trainingsmaßnahmen: (Empfohlene Literatur: H. F. Friedrich & H. Mandl (1992). Lern- und Denkstrategien – ein aktuelles Thema. Bern: Huber.) Vor einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit Förder- und Trainingsmaßnahmen ist es sinnvoll, aif einige ihnen allen gemeinsame theoretische Fragestellungen, Klassifikationen, Einordnungen aufmerksam zu machen. Dadurch soll eine erste Orientierung bei der Einschätzung der Reichweite und der Effektivität der jeweils vorgestellten Trainingsmaßnahmen gegeben werden. Lern- und Denkstrategien: Die gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen wie etwa die Wissensexplosion, die abnehmende Halbwertzeit von Wissensbeständen etc. zwingen den Menschen, die Frage, was wir wissen sollten und vor allem, wie wir dieses Wissen effektiv aufnehmen und verarbeiten müssen, um als autonome Bürger der Informationsgesellschaft bestehen zu können, immer wieder neu zu beantworten. Lern- und Denkstrategien sind insofern zu Schlüsselkompetenzen der Moderne zu rechnen. Zwar wird in der Literatur begrifflich Lernen eher im Sinne von Wissenserwerb und Denken im Sinne des Problemlösens, des Stiftens von Beziehungen zwischen den bisher erworbenen Informationen unterschieden, jedoch schließen sich vielfach an Phasen des Problemlösens auch Phasen des Wissenserwerbs und Lernens an, um eine angemessene Lösung zu finden. Lern- und Denkstrategien lassen sich nach Friedrich und Mandl in vier Typen unterscheiden: 1. Primär und Stützstrategien 2. Allgemeine und spezielle Strategien 3. Beschreibung nach ihrer Funktion für den Prozess der Informationsverarbeitung 4. Mikro- und Makrostrategien 1. Primär und Stützstrategien Primärstrategien wirken direkt auf die zu erwerbende bzw. zu verarbeitenden Informationen ein; Ziel ist dabei, dass diese besser verstanden, behalten, abgerufen und transferiert werden können und dadurch eine Veränderung der kognitiven Strukturen herbeiführen. Typische Primärstrategien des Wissenserwerbs sind etwa Strategien für das Lernen mit Texten, das Zusammenfassen von Texten, Zusammenfasen mit Hilfe grafischer Techniken wie etwa 3 „networking“, „mindmapping“ etc., aber auch Mnemotechniken (Techniken des Behaltens und Erinnerns). Stützstrategien dagegen zielen eher auf die Beeinflussung von motivationalen und exekutiven Funktionen ab, die auf den Prozess der Informationsverarbeitung indirekt einwirken, indem sie also bspw. Motivationen in Gang setzen, diese aufrechterhalten oder diese steuern. Beispiele hierfür sind Strategien der Selbstmotivierung, Abschirmung der Volition gegenüber konkurrierenden Handlungstendenzen, aber auch etwa Strategien der Aufmerksamkeitssteuerung und der Zeitplanung. 2. Allgemeine und spezielle Strategien Diese Unterscheidung zielt auf die Frage ab, ob die Strategien bei allen Lern- und Denkaufgaben in den verschiedensten Inhaltsgebieten zum Tragen kommen oder nur in eng umrissenen Situationen und bei ganz spezifischen Inhalten eingesetzt werden können. Als situationsübergreifende Strategien wären etwa Strategien des Selbstmanagements (Selbstmotivierung, Aufmerksamkeitssteuerung, Zeitplanung, metakognitive Kontrollstrategien) zu nennen. Dagegen sind spezielle Strategien jene, die etwa nur bei Texten anzuwenden sind oder eine spezifische Strategie beim Rechnen darstellen (z.B. Beim Addieren von ungleich großen Zahlen die kleinere auf die größere zu addieren etc.) Theoretisches Problem bei dieser Distinktion ist das sogenannte „Bandbreiten-GenauigkeitsDilemma“: Häufig tragen allgemeine Strategien wenig zur Lösung eines konkreten Problems bei; Strategien, die dagegen eine große Wirksamkeit entfalten, sind ihrerseits selten auf andere Situationen verallgemeinerbar. 3. Beschreibung der Strategien nach ihrer Funktion für den Prozess der Informationsverarbeitung Verschiedene Autoren haben Lern- und Denkstrategien nach ihrer spezifischen Funktion im Prozess der Informationsverarbeitung eingeteilt. Insbesondere sind diese Schematisierungen im Bereich des Lernens mit Texten sowie der des Problemlösens erfolgt. Bspw. unterscheiden Weinstein und Mayer (1986) folgende Klasse von Lernstrategien: 3a) Wiederholungsstrategien (rehearsal strategies): Diese bauen auf gedächtnispsychologische Befunde, die zeigen, dass Informationen relativ schnell wieder aus dem Arbeitsgedächtnis gelöscht werden, wenn sie nicht aktiv memoriert werden. Dagegen können aktives Wiederholen 4 und Aufsagen die Chance erhöhen, dass die neue Information in das Langzeitgedächtnis aufgenommen wird. Klassische Wiederholungsstrategie ist bspw. das innerliche Wiederholen einer Telefonnummer, um diese während des Wählvorganges noch präsent zu haben. Hier haben entwicklungspsychologische Längsschnittstudien sogar zeigen können, dass im Altersverlauf mit zunehmendem Einsatz von Wiederholungsstrategien auch die Gedächtnisleistungen sich verbessern. 3b) Elaborationsstrategien: Generell gilt es, bei neu erworbenem Wissen, diese in die bestehende kognitive Struktur des Individuums zu integrieren. Strategien, die dabei behilflich sind, werden als Elaborationsstrategien bezeichnet. So sind sowohl Beispiele und Analogien zu einem Lerngegenstand sowie auch die Verbindung der neuen Informationen mit den Inhalten des bisherigen Wissensbestandes (Vorwissen) typische Elaborationen. Elaborative Strategien fördern deshalb das Verstehen und Behalten des neuen Wissens, weil sie die neue Information mit dem alten Bestehendem „vernetzen“; dadurch werden im Gedächtnis verschiedene Pfade zu der zu erinnernden Information konstruiert. 3c) Organisationsstrategien: Hier werden komplexe Informationen zu größeren Sinneinheiten zusammengefasst und dadurch kognitiv handhabbar gestaltet (Reduktion von Komplexität); typisches Beispiel hierfür ist etwa das Kategorisieren verschiedener Gegenstände nach semantischen Merkmalen. Auch ein Diagramm bspw. erfüllt genau diese Funktion, indem es Informationen übersichtlich zusammenstellt. 3d) Kontrollstrategien: Ein effektives Lernen setzt stets auch ein Wissen über eigene Lern- und Denkleistungen und Denkprozesse voraus, mit deren Hilfe der Lernende das eigene Denken überwacht und evaluiert; so etwa ein Wissen darüber, bei welcher Art von Aufgaben welche Strategien die angemessensten sind. Es ist ein Wissen über die eigenen Kognitionen; deshalb Metakognition. Hierzu zählen auch Versuche bspw. während des Lesens kurz innezuhalten, sich zu überprüfen, ob das Gelesene verstanden wurde; evtl. nochmal in der Passage zurück gehen und erneut lesen etc. Metakognitives Wissen und metakognitive Strategien haben eine eminent bedeutsame Funktion für das Lernen, Denken und Problemlösen; deshalb wird vielfach gefordert, diese stärker in Trainingsmaßnahmen einzubeziehen. 5 Jedoch gibt es auch einige Hinweise, dass metakognitive Prozesse nicht unter allen Bedingungen positive Wirkungen auf das Lernen und Denken entfalten; dies ist insbesondere dann zu erwarten, wenn basale kognitive Prozesse noch nicht ausreichend beherrscht werden. Denn dann können sich metakognitive Prozesse auf die Informationsverarbeitung beeinträchtigend auswirken, weil die zusätzliche metakognitive Aktivität zu einer Aufteilung der Aufmerksamkeit führt (Friedrich & Mandl, 1992, S. 13). 4. Mikro- und Makrostrategien Lern- und Denkprozesse können auf unterschiedliche Ebenen analysiert werden. Auf der Mikroebene sind es elementare Informationsverarbeitungsprozesse mit einer kurzen zeitlichen Erstreckung, so etwa das mentale Rotieren von dreidimensionalen Gebilden, das Ziehen von Analogieschlüssen, das Finden von Oberbegriffen etc. Auf der Mesoebene dagegen werden komplexere Informationsverarbeitungsprozesse betrachtet wie etwa der Verstehensprozess beim Lesen von längeren Texten oder das Lösen von mathematischen Problemen usw. Auf einer Makroebene dagegen werden Prozesse langer zeitlicher Erstreckung untersucht, so etwa das Arbeitsverhalten im Studium und Schule, die Koordination von Lernaktivitäten mit anderen Aktivitäten, die Entwicklung bestimmter Lernstile im Laufe des Studiums etc. Jedoch zeigten sich in einigen Studien, dass sich Experten eines Fachgebietes nicht so sehr durch ihre überlegenen, effizienteren Strategien, sondern einfach durch ihre größere und wohlorganisierte Wissensbasis auszeichneten; denn Personen, die in einem Gebiet recht wenig Vorwissen haben, müssen dies durch aufwendige Suchstrategien kompensieren; Experten dagegen haben klare Schemata, die ihrerseits das Produkt von langen Problemlöseprozessen sind und benötigen deshalb keine aufwendigen Suchstrategien. Der weitere Wissenserwerb und der Problemlöseprozess wird bei ihnen durch das Vorwissen gesteuert. Andere Studien weisen darauf hin, dass Wissen für die Anwendung von Strategien eine notwendige Voraussetzung darstellt: Lernende, denen ein Minimum an Vorwissen fehlt, konnten weder von den Inhalts- noch von den Strategieinstruktion profitieren (Vgl. S. 19). Dennoch aber lassen sich interindividuelle Unterschiede nicht allein an den Unterschieden der unterschiedlichen Wissensvoraussetzungen festmachen: 6 1: Wissen ist nicht nur Voraussetzung, sondern auch Folge von Lernen, Denken und Problemlösen. Auch gibt es Belege für eine wechselseitige Beeinflussung von Wissen und Strategien. 2: Auch bei prinzipiell gleichem Vorwissen gibt es interindividuelle Unterschiede beim Abrufen und der Aktivierung dieses Vorwissens. 3: Bei Experten vs. Novizen Vergleichen – bei denen Experten in der Regel besser abschneiden lösen Experten ja Routineprobleme; wichtiger wäre es, zu schauen, welcher Methoden sie sich bedienen, wenn sie ihrerseits mit wirklich neuartigen Problemen in ihrem Wissensbereich oder gar mit Problemen aus einem anderen Wissensbereich konfrontiert werden; wenn also Experten selbst zu Novizen werden. In der Studie von Clement (1984) wurde gezeigt, dass in diesem Falle auch Experten sehr allgemeine Verstehens – und Suchstrategien anwenden. Transferprobleme: Eine Reihe von Studien zeigen, dass ein spontaner Strategietransfer eher ein seltenes Ereignis ist; d.h. zum Beispiel, dass die in einer Trainingsmaßnahme gelernten Inhalte auch auf etwa den schulischen Kontext übertragen werden. Adams (1989) vermutet das Ausbleiben dieses Transfers darin, dass Lern- und Denkstrategien immer in einem spezifischen inhaltlichen Kontext erworben werden und deshalb eingebunden sind in materialspezifische Schemata, von denen sie nur schwer zu lösen sind. Das Faktum, dass Lernen und Denken stets situationsgebunden sind, kann nicht ignoriert werden. Auch solche Programme, wie etwa Intelligenztrainings, die zwar inhaltsarmes Trainingsmaterial verwenden, sind zwar nicht an schulische, aber an andere Inhalte gebunden. In diesem Zusammenhang unterscheidet Adams zwischen abstraktem Wissen und abstrahiertem Wissen: abstraktes Wissen ist ein dekontextualisiertes Wissen, was zwar auf verschiedene Aufgaben angewendet werden kann, jedoch nicht vom Einzelnen selbst erarbeit worden ist, sondern eher fremdvermittelt wurde. Dagegen ist das abstrahierte Wissen jenes, das sich dann herauskristallisiert, wenn der Lerner Wissen, Prinzipien und Strategien in vielen und verschiedenen Situationen erprobt und dabei allmählich lernt, von den spezifischen Bedingungen zu abstrahieren. Lernprozesse, die diesen Abstraktionsprozess ermöglichen und damit einen gelingenden Strategietransfer wahrscheinlich machen, sind jedoch sehr zeitaufwendig und müssen systematisch geplant werden. Eine solche erfolgreiche Interventionsstudie ist die von Palincsar & Brown. 7 Darüber hinaus herrscht Evidenz, dass die Querbezüge von Lern- und Denkstrategien zu emotional-motivationalen Prozessen recht stark sind; Informationsprozesse bzw. Primärstrategien sind wenig ertragreich, wenn sie nicht durch entsprechende motivationale Prozesse unterstützt werden, die durch die griffe Formel: „skill and will“ als einer notwendigen Voraussetzungen für selbstgesteuerte Lernprozesse bezeichnet werden kann. Gute Strategienutzer zeichnen sich dadurch aus, dass sie davon ausgehen, dass es sich lohnt, sich anzustrengen und strategisch vorzugehen. „Nur Personen, die sich selbst Kompetenz (selfefficacy) zusprechen, kommen auf die Idee, Lern- und Denkstrategien spontan und selbstgesteuert einzusetzen“ (S. 25) Grundlegende Fragen der Anwendung: Bei der Förderung bzw. der Veränderung von Lern- und Denkstrategien stellen sich drei grundlegende Fragen: 1) Was soll verändert werden bzw. welche Strategien sollen gefördert werden? 2) Wie soll die Veränderung realisiert werden? 3) Wie können die Inhalte und das Vorgehen auf die individuellen Unterschiede sowie auf die individuellen situativen Gegebenheiten abgestimmt werden? Zu 1): Bei der Bestimmung der Frage, welche Strategien zu fördern sind, um eine bestimmte Leistung zu steigern, braucht man eine Theorie, die erklärt, welche kognitiven Prozesse für eine bestimmte Aufgabenklasse verantwortlich sind. Bei Primärstrategien sind es z.B Theorien der Informationsverarbeitung, bei Stützstrategien sind es Motivations- und Handlungstheorien. Zu 2) Die Förderung und Aktivierung der Lern- und Denkstrategien kann a) direkt über die Förderung der Prinzipien effektiven Lernens und Denkens vermittelt und geübt werden; b) sie kann indirekt über die Veränderung der Lernsituation erfolgen, indem bspw. diese so gestaltet wird, dass Lernen und Denken optimal angeregt werden. Indirekte Förderung: 1- Makro- und Systemebene: Hierbei handelt es sich um optimale Gestaltung von Schulsystemen und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. 2- Mesoebene: Gestaltung von Curricula, medienbasierten Lernumgebungen, Lernstrategien, Unterrichtssituationen (z.B. fragendes, entdeckendes Lernen etc.) 8 3- Mikroebene: optimale Gestaltung einzelner Elemente des Instruktionsprozesses; Maßnahmen zur Textgestaltung wie etwa Textfragen zur Vertiefung des Verstehens, neugierweckende Überschriften etc. Direkte Förderung: Direkte Fördermaßnahmen folgen dem Prinzip des „informierten Trainings“, wobei dem Lernenden nicht nur gesagt wird, was zu trainieren ist, sondern auch die Wirkweisen und die Vorteile der jeweiligen Strategie erklärt werden. Dies wird über folgende Schritte erreicht: 1- Lernende sollen zunächst für die Relevanz optimaler Strategien sensibilisiert werden, etwa durch: Selbstreflexion (lautes Denken), Präsentation von Modellen, die optimale oder eher defizitäre Strategien zeigen; argumentative Überzeugung vom „Nutzen“ der jeweiligen Strategie. 2- Im zweiten Schritt soll deklaratives Wissen über die einzelnen Elemente der Strategie erworben werden. Es wird Wissen vermittelt, bei welcher Aufgabe die betreffende Strategie angemessen ist. 3.- Das deklarative Wissen wird in einer Übungsphase an spezifisch hierfür ausgewählten Aufgaben kognitiv durchdrungen. 4.- In der Phase der Feinabstimmung geht es darum, die jeweilige Strategie zu automatisieren; sie an vielen Aufgaben zu üben und um den Transfer zu gewährleisten, sie an verschiedenen Aufgabenklassen zu trainieren. zu 3) Nicht jede kognitive Strategie ist für jeden Zweck angemessen; so erwiesen sich z.B. für Wörterlernen Mnemotechniken als günstiger im Vergleich mit semantisch orientierten Lernstrategien; Verstehensstrategien dagegen z.B. fördern nicht unbedingt das Behalten von Informationen und Faktenwissen, sind jedoch günstiger auf den Erwerb und Anwendung komplexen Wissens (Vgl. S. 34). Strategiemaßnahmen sind ferner abzustimmen auf interindividuelle Unterschiede in den verschiedenen Lernvoraussetzungen wie etwa: Unterschiede im Entwicklungsstand, in den kognitiven Fähigkeiten, im Vorwissen und den motivationalen Voraussetzungen. Effekte von Trainingsmaßnahmen: Was sind die Kriterien, an den der Erfolg von Trainingsmaßnahmen festzustellen ist? Sind es z. B. Schulnoten, Studierleistungen, Abschlussprüfungen etc., um eine bestimmte Strategiemaßnahme als erfolgreich zu qualifizieren? 9 Ultimates Ziel aller Strategietrainings sollte es sein, die Kompetenzen in realen Lern- und Problemlösesituationen zu steigern, jedoch werden solche globalen Erfolgsziele von vielen anderen Faktoren mitverursacht. Schulerfolg hängt z.B. sowohl von Umweltvariablen wie etwa der Qualität des Unterrichts, aber auch motivationalen und kognitiven Voraussetzungen ab. Auch ist zu bedenken, dass der Lernkontext nicht immer den Einsatz von bestimmten Strategien fördert, d.h. die Strategie kann als solche sinnvoll sein, bringt dennoch keine positiven Effekte zu Tage, weil diese vom Kontext unterdrückt wird. So berichten bspw. Ramsden, Beswick und Bowden (1986) von verstehensorientierten Studienstrategien bei Erstsemestern, die sich jedoch unter den Bedingungen des universitären Alltagens, und zwar Bewältigung großer Stoffmengen für kurzfristige Tests als nonoptimal erwiesen. Die Studenten gaben diese Strategie recht bald wieder auf und verfolgten eher Oberflächenstrategien, bei der die wörtliche Wiedergabe des Gelernten im Vordergrund stand. Was die Effekte von Trainingsmaßnahmen betrifft, fordert Bloom ambitioniert das „2-SigmaKrieterium“: d.h. die Effekte von Trainingsmaßnahmen, die für den Einsatz in großen Gruppen, Schulklassen etc. zum Einsatz kommen, sollen zwei Standardabweichungen gegenüber einer herkömmlich unterrichteten Kontrollgruppe liegen. Adams hat diese Forderung aufgegriffen und dahingehend erweitert, dass diese Effekte sich auch längefristig zeigen sollten; d.h. Individuen, die ein Training erhalten haben, sollten in der Folge die Nicht-trainierten nicht nur übertreffen, sondern diese Unterschiede sollten im Laufe der Zeit zugunsten der Trainierten größer werden. Diese geforderten Effekte (2 d) sind in den empirischen Untersuchungen jedoch kaum anzutreffen; in Gruppentrainings werden typischer weise von Effektstärken um 0.5 berichtet; bei sehr erfolgreichen Trainings werden Effektstärken von d = 1 erzielt. Eine Metaanalyse von Haller, Child und Weinberg (1988), bei der 20 Trainingsstudien zur Förderung des Textverstehens mit metakognitiven Strategien herangezogen wurde, zeigte einen Median der Effekte um 0.57; das arithmetische Mittel lag bei 0.71. Häufig moderieren die zu Beginn des Trainings vorhandenen kognitiven Strategien die weitere Wirkung der Maßnahmen. Denkbar sind folgende Fälle: Fall 1: Vom Training profitiert die leistungsschwache Gruppe, nicht jedoch die starke Gruppe: 10 Ergebnis: Training war wirksam und die trainierte Strategie spielt für die Kriteriumsleistung eine wichtige Rolle. a) Die Unterschiede zwischen den Gruppen können vollständig ausgeglichen werden: Idealfall: Kriteriumsleistungen werden allein vom trainierten kognitiven Prozess aufgeklärt. b) Leistungsunterschiede zwischen den Gruppen werden nur teilweise verringert: Ergebnis: Trainierte Strategie beeinflusst zwar die Kriteriumsleistung, dies ist jedoch auch von anderen Prozessen abhängig. Fall 2: Sowohl die schwache als auch die starke Gruppe profitiert vom Training: Fall 3: Vom Training profitiert die starke Gruppe, nicht jedoch die schwache. Ergebnis: Zwar ist der geförderte kognitive Prozess wichtig für die Kriteriumsleistung, aber es müssen offensichtlich noch weitere Voraussetzungen erfüllt sein, damit man vom Training profitieren kann; diese sind in der starken Gruppen gegeben, nicht jedoch in der schwachen (Vgl. S. 40). Trainingseffekte können unter bestimmten Bedingungen auch negative Effekte haben, und zwar dann, wenn die Person eine zuvor funktionierende Strategie verlernen muss, bevor sie eine neue aufbauen kann. In der Phase des Umlernens kann es dann zu Verunsicherungen kommen, die zu einer defizitären Informationsverarbeitung führen können. 11 Vorlesung am 24.04.2007 Förderung kognitiver Fähigkeiten durch Denktrainings: Bevor auf die Förderung durch spezielle Trainingsmaßnahmen eingegangen werden soll, sollte natürlich die Frage gestellt werden, inwieweit Kinder in ihrem häuslichen, familialen Umfeld von ihren Eltern angemessen kognitiv und intellektuell stimuliert werden können: In der Literatur werden Erfahrungen dann als „intellektuell stimulierend“ bezeichnet, wenn sie dazu beitragen, die kognitive Entwicklung von Kindern zu optimieren, was unterschiedlichen Formen geschehen kann. Drei Aspekte sind dabei hervorstechend: 1) die häuslichen Anregungsbedingungen, 2) die elterlichen Erziehungsvorstellungen, 3) die Art und Weise, wie Eltern ihre Kinder konkret anregen. Zu 1): Die Gestaltung der häuslichen Umwelt seitens der Eltern ist ein zentraler Faktor, denn das von ihnen bereitgestellte Material (z.B. Bücher, Spielzeug) bietet zunächst das Angebot an Anregung, aus dem das Kind frei auswählen kann. Im Kleinkindalter sind seine Möglichkeiten, sich selbst Anregung zu verschaffen, bzw. für intellektuell stimulierende Umgebungen zu sorgen, recht begrenzt. In den USA hat sich zur Einschätzung des familialen Anregungsmilieus die HOME-Scale (Caldwell & Bradley, 1978) als Erhebungsinstrument bewährt. Hier wird der objektive Anregungsgehalt von trainierten Beobachtern mittels Kategorien, die das HOMEinventory vorgibt, eingeschätzt. Diese beziehen sich sowohl auf materielle wie auch auf soziale Aspekte; wie etwa „Bereitstellen angemessenen Spielmaterials“ und „Gelegenheit zu vielfältiger Anregung im Alltag schaffen“. Zu 2) Auf einer globaleren Ebene geht es um elterliche Einstellungen bzw. Erziehungsstile. Diese werden im Sinne von stabilen Dispositionen verstanden und üblicherweise mittels Fragebogen erfasst. Exemplarisch ist hier die Einteilung von D. Baumrind (1978) in vier Erziehungsstile: „autoritär“, „autoritativ“, „permissiv“ und „vernachlässigend“. Dabei erwies sich ein autoritativer Erziehungsstil der Eltern als förderlich für die kognitive Entwicklung von Kindern. Die positive Wirkung dieses Erziehungsstils wurde kürzlich auch für Jugendliche nachgewiesen, und zwar sowohl für ihre schulischen Leistungen als auch sozialen Kompetenzen und ihr Selbstvertrauen (Gray & Steinberg, 1999). 12 Zu 3) Hier geht es weniger um die Einstellungs- als um die konkrete Verhaltensebene, d. h. die Eltern-Kind-Interaktion wird direkt erfasst. Inhaltlich werden hierbei meist zwei Arten von intellektueller Stimulation differenziert, die verbale und die objektvermittelte. Das elterliche Sprachtraining wurde relativ intensiv erforscht, weil soziale Anregung üblicherweise sprachlich vermittelt wird, z. B. durch die Art und Weise, wie Eltern Gespräche mit ihren Kindern führen. Sprachinhalte und –form hängen mit zahlreichen Indikatoren der kindlichen Intelligenzentwicklung im Vorschul- oder Schulalter zusammen. Ebenso wurde gemeinsames Objektspiel in zahlreichen Studien als Prädiktor des kognitiven Leistungsvermögens von Kindern, zumindest über kurzfristige Zeitabschnitte, identifiziert (Wachs & Gruen, 1982). In vielen Studien erwies sich elterliche Responsivität (kontingente Stimulation) als Schlüsselvariable der kognitiven Stimulation. Darunter ist zu verstehen, dass Anregung unmittelbar in Reaktion auf die kindlichen Initiativen erfolgt. Für dieses elterliche Verhaltensmuster wurden positive Folgen auf die kognitive und soziale Entwicklung von Kindern im Vorschul- und Schulalter nachgewiesen. Denn Responsivität fördert das Explorationsverhalten des Kindes und erhöht seine Lernmotivation, weil es ihm Kind den Eindruck vermittelt, dass sein Handeln eine Wirkung erzielt. Aufgrund solcher Erfahrungen bildet sich die „Selbstwirksamkeitsüberzeugung“ aus, d.h. die Motivation, sich selbst als wirkungsvoll zu erleben. Als relevant für eine gute intellektuelle Entwicklung von Kindern führen Ramey und Ramey (1998) folgende sechs Mechanismen an, die fester Bestandteil des kindlichen Alltags sein und ausreichend häufig und vorhersagbar vorkommen sollten. 1) Zur Exploration der Umwelt ermuntern, 2) kognitive und soziale Grundfähigkeiten überwachen, 3) neue Fertigkeiten hervorheben, 4) Erlerntes wiederholen und auf neue Bereiche übertragen, 5) unangemessene Bestrafung vermeiden, 6) Sprache und symbolische Kommunikation stimulieren. Diese sind zwar nicht erschöpfend, aber können als empirisch hinreichend belegt angesehen werden. Schulkontext: 13 Eine positive Veränderung der kognitiven Fähigkeiten von Schülern kann bereits erzielt werden, wenn gezielte Interventionen in den räumlich-materiellen Lernkontext erfolgen, d.h. der ökologischer Kontext, in dem Denken und Lernen statt findet, verändert. So konnte bereits um 1942 gezeigt werden (Wheeler, 1942), dass eine Veränderung der Umweltfaktoren zu einer positiven Entwicklung und Steigerung des IQ von Schülern beitragen kann. Eine Sanierung des Wohnumfeldes, eine Verbesserung der Infrastruktur (Beförderungssystem), eine Verbesserung der Schulausstattung und eine Erhöhung des Ausbildungsniveaus der Lehrer führte zu einem IQ Zuwachs von rund 10 Punkten innerhalb von zehn Jahren. 1930 lag der mittlere IQ der getesteten 946 Kindern der Klassen 1 bis 8 aus den östlichen Tennessee Bergen bei 82.4 Punkten; und 1940 lag er - nunmehr wurden 3252 Kinder in die Testung einbezogen - bei 92.2 Punkten. (Vgl. Gage & Berliner, 1996, S. 86) Denktrainings: Was jedoch das Denktraining bzw. die kognitive Fähigkeit des Problemlösens betrifft, so ist zunächst recht allgemein die Frage zu stellen, ob denn Problemlösen lehrbar ist. Gegen die Idee, Problemlösefähigkeit trainieren zu können, gibt es eine breite Skepsis in der Wissenschaft. Da das Lösen von Problemen vielfach von einem spezifischen Wissen abhängt, wird argumentiert, es komme es nicht darauf an, Problemlösefähigkeiten zu trainieren, sondern einfach breites Wissen zu vermitteln. Auch gibt es Studien (Dörner & Kreuzig, 1983), die zeigen, dass die Interkorrelationen der Leistungen zwischen Problemlöseaufgaben verschiedener Art gegen Null tendieren; dass es also keine Hinweise für eine allgemeine Problemlösefähigkeit gibt. Deshalb sollte bescheiden formuliert werden, welche Teilprozesse oder Komponenten des Problemlösens trainierbar sind. Warum ist die Förderung des induktiven Denkens wichtig? Induktives Denken ist essenziell für die Entdeckung von Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten sowie für die Bildung von Hypothesen. Im wissenschaftstheoretischen Kontext wird vielfach unterschieden zwischen Induktion und Deduktion; d.h. der Schluss von empirischen Einzelbeobachtungen zu einem allgemeinen Gesetz oder der Ausgang von einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit zu einer Einzelaussage. Bei der Deduktion erfolgt in logischen Termine ein Schluss von der Praemissa maior und der Praemissa minor auf die Conclusio; aus (A) und (B) folgt (C) zwingend. Bsp.: (A) Alle Menschen sind sterblich; (B) Sokrates ist ein Mensch: (C) Also ist Sokrates sterblich. (s.a. Tolstoi; der Tod des Iwan Iljitsch). 14 Diese Form des Schließens taucht häufig in der Mathematik und in der klassischen Logik auf. Der Deduktionsschluss ist apodiktisch, das heißt notwendig wahr. Er ist Wahrheit bewahrend und insoweit konservativ; jedoch kaum erkenntniserweiternd. Wenig gewürdigt wird dabei ein Konzept, das der amerikanische Pragmatist C. S. Peirce mit der Begrifflichkeit der Abduktion in die Wissenschaftstheorie einführte. Dabei wird von einer Allaussage und einer Einzelbeobachtung auf eine andere Einzelbeobachtung geschlossen. Bsp. Alle Psychologen sind erfolgreich; dieser Mensch erfolgreich – dieser Mensch ist ein Psychologe. Der Schluss ist - wohl - ziemlich unsicher, er kann jedoch "zufällig" wahr sein. Die Unsicherheit dieses Wissen ist im Gegensatz zur Induktion nicht nur ein quantitativer, sondern ein qualitativer; Peirce hat die Abduktion als eine Form des begründeten Ratens genannt; als eine besonders kreative Form der Schlussfolgerung. Der abduktive Schluss spekuliert, er verwertet Indizien. Dies entspricht in der Praxis der Tätigkeit eines Detektiven, der eine Person überführen will, oder aber auch der Tätigkeit eines Arztes, der aufgrund von bestimmten Symptomen eine (vorläufige und stets unsichere) Krankheitsdiagnose stellt. In den empirischen Wissenschaften werden die besonders kreativen, innovativen und originellen Hypothesen durch Abduktion gewonnen. Nur mit ihrer Hilfe gelangt man zu substanziell neuen Erkenntnissen. Zurück zur Induktion und dem Training des induktiven Denkens: Auch der Intelligenzforscher Spearman war von der Bedeutung des induktiven Denkens überzeugt; für ihn war der Faktor g der allgemeinen Intelligenz wesentlich durch Prozesse des induktiven Denkens bestimmt. Zunächst soll jedoch das Programm von Klauer vorgestellt werden und dann einige Studien, die kritisch sich an dieses Denktraining angeschlossen haben: Wie sieht das Programm des induktiven Denkens aus: Das „Denktraining für Kinder I“ ist das erste aus einer Reihe von Trainingsprogrammen, was auf eine bereichsspezifische Förderung des induktiven Denkens abzielt. Induktives Denken fasst Klauer dabei als das Erkennen von Regelhaftigkeiten im Ungeordneten. Dabei werden Objekte im Hinblick auf ihre Merkmale oder der Relationen zwischen ihnen verglichen. Dieses Trainingsprogramm richtet sich an 5-8-jährige Kinder und besteht aus 120 Aufgaben. Darüber hinaus hat Klauer ein Programm für den Altersbereich 10-13 Jahre sowie ein Denktraining für Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren entwickelt. Das Programm hat sechs Problemklassen: Generalisierung (GE: Gleichheit von Merkmalen), Diskrimination (DI: Verschiedenheit von Merkmalen), Kreuzklassifikation (KK: Gleichheit und Verschiedenheit von Merkmalen), Beziehungserfassung (BE: Gleichheit von Relationen), Beziehungsunterscheidung 15 (BU: Verschiedenheit von Relationen), Systembildung (SB: Gleichheit und Verschiedenheit von Relationen); zu jeder Klasse gibt es 20 Aufgaben aus den Bereichen Schule, Familie, Sport und Haushalt. Die Programme sind nach dem selben Grundkonzept realisiert; lediglich gibt es altersoder niveauabhängige Variationen bei den Inhalten oder Themen. Verteilung der Aufgabenformen und Materialien: Material General. Diskr. Kreuzkl. Bez.erfass. Bez.unters. Systemb. Summe Verbal 7 7 6 7 7 6 40 Figural 7 6 7 7 6 7 40 Numerisch 6 7 7 6 7 7 40 20 20 20 20 20 120 Summe 20 Von diesen 20 Aufgaben sind 5 Aufgaben konkrete Dinge: Bauklötzchen; 5 paradigmatische Bildaufgaben, 7 lebensnahe Bildaufgaben (Spielzeuge, Tiere, Pflanzen etc.) und 3 symbolartiges Material. Die ersten zehn Aufgaben zeigen die Aufgabenstruktur sehr klar und bieten Gelegenheit, eine angemessene Lösungs- und Kontrollstrategien zu entwickeln; die folgenden zehn dienen der systematischen Einübung des Transfers, wobei die Grundstrukturen immer schwerer zu erkennen sind. Im Laufe des Trainings soll das Kind die wenigen Grundstrukturen in wechselnden Zusammenhängen erkennen. Aufgabe ist es, zu prüfen, ob verschiedene Objekte ein Merkmal gemeinsam haben oder nicht; das kognitive Ziel ist also die Einübung in Erkennen von Regelhaftigkeit und Gesetzmäßigkeit. Als Effizienzkriterium wird der Zuwachs in Intelligenztests oder andere Leistungsmaße, wie etwa Lernzuwachs nach Unterrichtseinheiten gemessen. Typische Programminhalte sind folgende: (S. Exemplare des Denktrainings von Klauer) Lektion Lehrziel 1 Naives Problemlösen 2 Erläuterung Aufgaben lösen lassen, ohne auf die Art der Lösung eingehen; Vertrautwerden mit dem Material Unterscheiden von Merkmalen und Einführung der Begriffe „Eigenschaft“ und Relationen „Beziehung“ 16 3 Die drei Merkmalsklassen kennen 4 Die drei Relationsklassen kennen 5 Lösungs- und Kontrollprozess bei Gleichheit von Merkmalen/Relationen kennen Lösungs- und Kontrollprozess bei Verschiedenheit von Merkmalen/Relationen kennen Lösungs- und Kontrollprozess bei Gleichheit und Verschiedenheit kennen Aufgaben des Merkmalsastes wiederholen und Prozesse automatisieren Aufgaben des Relationsastes wiederholen und Prozesse automatisieren Gemischte Wiederholung zur Automatisierung der Prozesse 6 7 8 9 10 Die drei Klassen unterscheiden lernen; alle bisherigen Merkmalsaufgaben entsprechend einordnen. Die drei Klassen unterscheiden lernen; alle bisherigen Relationsaufgaben einordnen und Merkmalsklassen wiederholen Herausarbeiten, wie GE und BE Aufgaben gelöst werden und die Lösung durch die Gegenoperation überprüfen Herausarbeiten, wie DI und BU Aufgaben gelöst werden und die Lösung durch die Gegenoperation überprüfen Herausarbeiten, wie KK und SB Aufgaben gelöst werden und die Lösung durch die Gegenoperation überprüfen Einübung/Festigung der Erkenns- und Kontrollprozesse bei Merkmalsaufgaben Einübung/Festigung der Erkenns- und Kontrollprozesse bei Relationsaufgaben Einübung/Festigung der ErkennsKontrollprozesse bei allen Arten Aufgaben und von Am Ende des Trainings sollen die Kinder in der Lage sein, • beliebige induktive Aufgabe richtig klassifizieren zu können, indem sie die jeweilige Grundstruktur identifizieren, • jeder Grundstruktur die angemessene Lösungsstrategie zuzuordnen, • danach die entsprechende Kontrollstrategie einsetzen können. Vor dem Training werden den Kindern erklärt, was ein Merkmal/Eigenschaft ist; so etwa: eine Eigenschaft sagt aus, was ein Ding ist oder hat. Der Ball ist rund; rund ist eine Eigenschaft. Für Relation soll eher der Begriff Beziehung verwendet werden: Relationen sagen etwas zwischen zwei Dingen aus; diese findet man, wen man zwei Dinge miteinander vergleicht. Z.B. dieser Stift ist größer als dieser. Zwischen Objekten können immer mehrere Beziehungen bestehen (z.B. größer und schwerer; ein Ding kann auch mehrere Eigenschaften haben; rot und rund etc.). Was die Durchführung betrifft, so empfiehlt Klauer im Kindergartenalter das Training als ein Einzeltraining durchzuführen, um so die erforderliche Aufmerksamkeit zu gewährleisten; es sollte in einem störungsarmen Raum stattfinden und zeitlich 20 Minuten nicht überschreiten. Auch sollte das Training möglichst spielerisch gestaltet werden, jedoch abgebrochen werden, wenn das Kind nicht mehr ernsthaft sich mit den Aufgaben beschäftigt. In einer Sitzung sollte auch nur eine Lektion abgehandelt werden. 17 Im Grundschulalter könnten die Aufgaben jedoch auch paarweise den Kindern dargeboten werden, wobei abwechselnd eines der Kinder die Aufgaben löst und das andere das Vorgehen kontrolliert. Bei älteren Kindern kann das Training auch in Form einer Gruppenarbeit gestaltet werden, wobei zu achten ist, dass es sich um einigermaßen leistungshomogene Gruppen handelt, damit nicht einige starke Kinder die anderen dominieren. Ergebnisse des Trainings: Klauer (2001) selbst findet in einer Überblicksarbeit von insgesamt 64 Studien eine mittlere Effektstärke von d = .54 (d korrigiert); d.h. im Durchschnitt eine Verbesserung um eine halbe Standardabweichung im Vergleich zu nicht-trainierten; anders ausgedrückt: eine Verbesserung um etwa 20 Prozentränge. Zur Schätzung der Effektstärken wird folgendes Effektstärkemaß angenommen: d = (M Trainingsgruppe – M Kontrollgruppe) / S pooled Um die präexperimentellen Unterschiede zwischen den Gruppen zu berücksichtigen, wurden korrigierte Effektstärken berechnet: d korr. = (d post – d prä) Verteilung der Effektstärken bei den berücksichtigen Trainingsmaßnahmen: 20 ES Intelligenz 15 10 5 0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 >1,1 Bei 63 von 64 berücksichtigten waren stets positive Effekte zu verzeichnen; nur in einem Fall gab es einen – nicht signifikanten (d= -.05) negativen Effekt. Transfereffekte: Für die Frage, inwieweit die in den Kognitiven Trainings erworbenen Fähigkeiten sich tatsächlich transferieren lassen, wurden Versuche durchgeführt, bei denen im Anschluss an ein Training beide Gruppen, die Trainings- wie die Kontrollgruppe, gemeinsam an einer Unterrichtsstunde teilnahmen; abhängige Variable war hier also der Lernerfolg in der Unterrichtsstunde. Bei allen 18 Schularten gab es positive Effekte auf das Lernen; die stärksten Effekte wurden jedoch bei den Sonderschülern verzeichnet. Nachhaltigkeit der Effekte: Um zu testen, ob die Trainingsmaßnahmen letztlich nur die Performanz, d.h. die aktuellen und eher kurzfristigen Effekte fördern, oder aber langfristige Kompetenzen verbessern, wurden bei mehreren Experimenten einige Monate später (zw. 3-12 Monaten; im Mittel ca. 6 Monate) erneut die Tests erhoben, die unmittelbar nach dem Training durchgeführt wurden. Dabei handelte es sich um 8 Lern - sowie 17 Intelligenztests: Abhängige Variable M SD n (Anzahl berücksichtigten Effektstärken) unmittelbar 0.77 0.22 17 später 0.70 0.31 17 unmittelbar 0.56 0.36 8 später 0.74 0.56 8 der Intelligenz Lernen Die Ergebnisse zeigen, dass die Effekte weitestgehend über die Zeit stabil sind; zwar waren leichte Abnahmen bei der Intelligenz und leichte Zunahmen beim Lernen festzustellen, die jedoch nicht signifikant waren und im Großen und Ganzen eindeutig für die Stabilität der erzielten Kompetenzzuwächse sprachen. Allgemeine vs. bereichsspezifische Strategien: In einem Experiment hat Klauer die Wirksamkeit von allgemeinen Problemlösetrainings mit den Effekten eines bereichsspezifischen Trainings – dem induktiven Denken- verglichen. Sollte sich z.B. herausstellen, dass ein allgemeines Problemlösetraining auch beim Lösen von konkreten - hier induktiven- Problemstellungen als genauso gut erweist, dann ist das allgemeine dem bereichsspezifischen vorzuziehen, weil es eine generelle Strategie darstellt. 19 Die zu prüfende Nullhypothese lautet deshalb: Unter gleichen Bedingungen fördert das Training einer allgemeinen Problemlösestrategie das Lösen von induktiven Problemen in gleichem Maße wie ein Training bereichsspezifischer Strategien des induktiven Denkens: Aufgaben waren dabei aus dem CFT-2 von Cattell und Weiss (Weiss, 1972) (abstraktgeometrische Figuren): Wie sieht das Trainingsprogramm für allgemeine Problemlösestrategie aus? (Lauth, 1988): Es ist ein Programm für 7 bis 9-jährige lernbehinderte Sonderschüler: Diese geben sich beim Lernen mit sieben „Signalkarten“ folgende Selbstinstruktionen: 1. Wir wollen anfangen! 2. Langsam machen! 3. Was ist meine Aufgabe? 4. Kenne ich schon etwas Ähnliches? 5. Ich mache mir einen Plan! 6. Überprüfen: Ist es so richtig? 7. Das habe ich gut gemacht! Versuchsplan: EG 1: Prätest (CFT 1)- Training des induktiven Denkens - Posttest (CFT 2) EG 2: Prätest (CFT 1)- Allgemeines Problemlösetraining - Posttest (CFT 2) KG 1: Prätest (CFT 1)-Teilnahme am Unterricht - Posttest (CFT 2) Trainiert wurden jeweils zwei Kinder, die hierfür aus dem laufenden Unterrichtsbetrieb der ersten Klasse Grundschule herausgenommen wurden. Bei beiden Maßnahmen wurde der CFT als abhängige Variable verwendet. Trainingsdauer des induktiven Trainings: 10 Stunden Trainingsdauer des Allgemeinen Trainings: 8 Stunden Vergleich: bereichsspezifische vs. allgemeine Strategien: Prätest Posttest Effektstärke d 1.00 EG 1 (N = 10) M 13.6 24.1 Induktives Denken SD 7.8 5.8 EG 2 ( N = 10) M 13.2 19.3 Allgemeines SD 7.8 4.9 0.12 20 Problemlösetraining KG (N = 10) M 13.8 19.1 Kein Training SD 7.8 4.3 Zwar kann ein geringer Teil der Unterschiede zugunsten des induktiven Trainings auf die etwas längere Trainingsdauer zurückgeführt werden, dennoch ist bei diesen massiven Unterschieden eher anzunehmen, dass die Wirkweise des induktiven Trainings stärker ist. Auch die Differenzen, die darauf zurückgeführt werden könnten, dass das Programm von Lauth für ältere lernbehinderte Kinder entwickelt worden ist, ist dadurch kompensiert werden, dass hier dafür jüngere nichtbehinderte Kinder trainiert worden sind. Pädagogisch-praktische Konsequenzen sind, dass eher bereichsspezifische Denkstrategien gefördert werden sollten; diese weisen deutlich stärkere positive Veränderungen auf. Allgemeine Strategien werden in kleinerem Maße auch in den Bereichsspezifischen gelernt. In die ähnliche Richtung geht auch die 1996 von Hattie, Biggs und Purdie publizierte Metaanalyse: Sie behaupten, nicht die direkte Vermittlung von allgemeinen Lernstrategien, sondern vielmehr die Kombination von einer domänenspezifischen Strategie, partiell selbstgesteuertem Lernen und zusätzlicher metakognitiver Reflexion in einem von den Schülern als günstig erlebtem Schulklima zeigen hohe Effektstärken. Die ermutigenden Befunde des Trainings nach Klauer haben Möller und Appelt (2001) aufgegriffen und die Frage gestellt, inwieweit die Effekte des Kognitiven Trainings durch Auffrischungssitzungen gesichert oder noch verstärkt werden können. Hierzu wurden 107 Grundschulkinder aus der zweiten Klasse mit dem Programm von Klauer trainiert und nach sieben Monaten wurden die Trainingsinhalte noch einmal aufgefrischt. Zunächst zeigte sich, dass die trainierten Kinder im Vergleich zu den nicht-trainierten höhere Intelligenzleistungen hatten; aber noch deutlicher waren die Zuwächse bei denen, die an den Auffrischungssitzungen teilnahmen. Im Einzelnen sah das Design wie folgt aus: 1. Gruppe: Trainierte Kinder; N = 89; davon N = 37 mit Auffrischung 2. Gruppe: 17 Kinder als Kontrollgruppe. 21 32 Rohwerte im CFT 30 29,8 28 27,2 26,1 26 Auffrischung Training KG 26,3 24 22 20 22,7 21,7 20,7 19,6 21,2 18 t1 t2 t3 Zu Beginn der Studie waren die Unterschiede unbedeutend; bei der zweiten Messung nach zwei Wochen zeigten sich bereits beträchtliche Unterschiede zwischen den trainierten und nichttrainierten Kindern. Die Auffrischung fand 7 Monate später statt; der Follow-up-test weitere fünf Monate später. Vergleicht man die beiden Trainingsgruppen mit der Kontrollgruppe zu t 2, so zeigen sich Effektstärken in Höhe von d (korr) =.90; vergleicht man jedoch die Auffrischungsgruppe und die bloße Trainingsgruppe zu t 3 und berücksichtigt dabei die Unterschiede zu t 2, so zeigen sich Effektstärken von d (korr) =1.15; d.h. die Auffrischungsgruppe hatte im Durchschnitt mehr als eine Standardabweichung besser abgeschnitten. Es konnte also gezeigt werden, dass die Auffrischung die Effektivität des Denktrainings deutlich steigern kann; eine erneute Auseinandersetzung mit Strategien des induktiven Denkens scheint die gelernten Strategien optimieren zu können. Zum Abschluss noch etwas zum Knobeln für sie: Kurz vor seinem Tod holt ein Vater in der arabischen Wüste seine drei Söhne herbei und bespricht mit ihnen die Aufteilung seines Erbes: „Mein ältester, du hast Weib und Kind und sollst die Hälfte meiner Kamelherde bekommen. Mein mittlerer Sohn: Du sollst ein Drittel meiner Kamelherde bekommen.“ Und zum jüngsten sagte er: „Du mein Kleiner bist noch jung und hast Zeit und Kraft, dir ein eigenes Vermögen zu verdienen; du sollst daher nur ein Neuntel meiner Kamelherde bekommen. und zu allen Dreien gewandt, 22 sagte er noch: Last mir ja die Kamele heil.“ Dann verstarb der Vater unmittelbar danach. Die Söhnen gingen zur Herde des Vaters und zählten die Kamele zusammen: es waren insgesamt 17. Dann fingen sie an zu grübeln, wie sie das Vermächtnis ihres Vaters erfüllen und das Erbe so aufteilen können, wie er es gefordert hatte. Sie grübelten recht lange. Eine junge Psychologiestudentin (aus Potsdam), der die Eltern zum bestandenen Vordiplom eine Ägyptenreise geschenkt hatten, ritt zufällig in der Nähe auf ihrem Kamel und sah die verzweifelt nachdenkenden Brüder. Als diese ihr den Grund ihres Kopfzerbrechens erklärten, fragte sie: „Wo liegt das Problem?“ Und löste in einer halben Minute die rätselhafte Erbteilung auf. Wie sollte die Herde also geteilt werden? 23 Förderung der Lernmotivation: Lehrende unter Alltagsbedingungen machen permanent die Erfahrung, dass ihr Lehrerfolg neben ihrer Vortragsqualität insbesondere von der Lernmotivation ihrer Schüler oder Studenten abhängt. Deshalb ist die Frage, wie diese gefördert werden kann, eine der dringlichsten Anliegen im pädagogischen Kontext. Eine Möglichkeit wäre, erfolgreiche Praktiker über lange Zeit zu beobachten und aus ihrem unterrichtlichen Vorgehen spezifische „Motivierungstipps! abzuleiten. Zwar wäre dieser Ansatz etwas heterogen und theoretisch ungesichert, könnte aber auch ihren Zweck erfüllen. Eine andere Möglichkeit ist, aus den bisherigen Befunden der Motivationspsychologie Implikationen für die Praxis abzuleiten. Diese sollen im Folgenden auch im Mittelpunkt stehen. Der Motivationsförderung inhärent ist der Widerspruch, dass von „aussen“ angeregt werden soll, dass Menschen von „innen“ heraus, von sich aus, handeln bzw. tätig werden. Die Beobachtung menschlicher (freiwilliger) Tätigkeiten zeigt, dass Menschen sich weder dem äußerst Schwierigen noch dem völlig Einfachen und gänzlich Beherrschten widmen, sondern sie vielfach von dem gerade noch Machbare angezogen sind, d.h. sich Aufgaben mittlerer Schwierigkeiten annehmen, also nach den ersten Balanceakten auf einer Mauer sich nicht gleich als Hochseilartisten versuchen, sondern vielleicht eine etwas schmaleres Geländer aussuchen. Diese Bevorzugung mittlerer Schwierigkeitsgrade lässt sich entwicklungspsychologisch ab dem Alter von etwa drei Jahren beobachten. Kinder bauen von da an ein Gütemaßstab auf, an denen sich erzielte Leistungen als Erfolg oder Misserfolg bewerten lassen. Dabei sind drei Bezugsnormen relevant: 1) Sachliche Bezugsnorm: Kommt der angestrebte Effekt zustande oder nicht? Anforderung erfüllt oder nicht? 2) Individuelle Bezugsnorm: Vergleich der jetzigen Leistungen mit früheren Leistungen: Wie bin ich jetzt du wie war ich früher? 3) Soziale Bezugsnorm: Vergleich der eigenen Leistungen mit den Resultaten anderer. Wie bin ich im Vergleich mit meinem Nachbarn? Aufgrund ihrer motivationalen Konsequenzen hat die individuelle Bezugsnormorientierung für Trainingsmaßnahmen eine besondere Bedeutung. Als wirksam haben sich Trainingsmaßnahmen heraus gestellt, die an der Präferenz für mittelschwere Aufgaben, an der Tendenz der Bewertung der Leistung an individuellen Bezugsnormen, an einem selbstwertstützendem Attributionsstil und dem Erleben von 24 Selbstverantwortlichkeit orientiert sind. Denn die Zielvorstellung ist: Menschen sollen in Anforderungssituationen eine optimistisch-realistische Sichtweise annehmen und Freude daran haben, die eigenen Kompetenzen weiter zu entwickeln. Denn unabhängig von der objektiven Leistung zeigt sich im Alltag, z.B. Bergsteigern, Musikern etc., dass Menschen die Verbesserung der eigenen Kompetenzen als lustvoll und befriedigen erleben, sie also an einer Selbstoptimierung interessiert sind. Warum ist die Orientierung an mittelschweren Aufgaben, die zwar anspruchsvoll, aber noch erreichbar sind, funktional? Gerade eine Orientierung an diesen zeigt dem Handelnden recht gut, dass eigene Anstrengung und die eigene Vorgehensweise mit den erzielten Resultaten zusammenhängen. Daraus ergibt sich die motivational günstige Tendenz, bei der Ursachenerklärung der Resultate eher jene Faktoren zu berücksichtigen, die unter eigener Kontrolle sind, z.b. hohe oder niedrige Anstrengung, richtiges oder falsches Vorgehen etc. Daraus ergibt sich ein günstiges Fähigkeitsselbstbild: Das begünstigt die Tendenz, eigene Erfolge Fähigkeiten zuzuschreiben; und für die Erklärung von Misserfolgen scheidet eine Erklärung mit einer generellen mangelnden Fähigkeit aus; weil der Zusammenhang zwischen Anstrengung und Leistung in der Aufgabenstellung deutlich wird; denn durch einen Rekurs auf die individuelle Bezugsnorm kann bei Erfolg wie bei Misserfolg verhindert werden, dass die Ursachen auf stabile interne Faktoren zurückgeführt werden (denn der Schüler kann es auch anders); stattdessen wird Bezug genommen auf kontrollierbare Aspekte wie etwa geringe Anstrengung, falsches Vorgehen etc. Dabei lässt sich weiter differenzieren in Intensität, aber auch der Richtung der Leistungsmotivation: Die Richtung kann in „Erfolgsmotivation“ oder „Misserfolgsmotivation“ gehen: erfolgsmotivierte Menschen suchen häufig Leistungssituationen auf; misserfolgsmotivierte dagegen versuchen, Leistungssituationen aus dem Weg zu gehen. Erfolgsorientierte bevorzugen eher mittelschwere Aufgaben und können deshalb stärker einen Zusammenhang zwischen der eigenen Anstrengung und den resultierenden Lernergebnissen herstellen als dies bei misserfolgsorientierten der Fall ist. Atkinson hat bereist in den 50-er Jahren (1957) ein Modell entwickelt, um den Grad der Motiviertheit zu erfassen; das sog. Erwartungs-mal-Wert-Modell: Demnach hängt das Anspruchsniveau bzw. Grad der Motiviertheit davon ab, wie auf der einen Seite die Erfolgswahrscheinlichkeit des erwünschten Handlungserlebnisses (Schaffe ich das bei realistischer Betrachtung? – Erwartungskomponente) und auf der anderen Seite von der Valenz 25 bzw. dem Anreiz des Handlungsergebnisses (Wertkomponente). So ist z.B. die Erfolgswahrscheinlichkeit bei leichten Aufgaben recht groß, andererseits in der Regel der Anreiz gering; dagegen ist bei schwierigen Aufgaben der Anreiz recht groß, die Erfolgswahrscheinlichkeit dagegen gering. Bei mittelschweren Aufgaben dagegen ist davon auszugehen, dass diese eine realistische Zielsetzung bedeuten, da diese sowohl erreichbar sind sowie einen gewissen Anspruch des Handelnden erfüllen. Die Bereitschaft, eine Handlung auszuführen, stellt sich als das Produkt aus Erfolgerwartung und dem Wert dar, der den Folgen dieser Handlung zugemessen wird. Motiviertes Handeln ist demnach davon abhängig, ob sie im Vergleich zu anderen Alternativen eine positive KostenNutzen-Bilanz erwarten lässt. Atkinson legte hierzu eine Grafik dar, die die Motivationsentwicklung, abhängig von Erfolgsanreiz und Erfolgswahrscheinlichkeit darstellt. (Abb. 8.1) (Rheinberg, Krug 1999, S. 27). Tabelle: Selbstbewertungsmodell nach Heckhausen: (S. 214, Krapp & Weidenmann) Motivausprägung erfolgszuversichtlich misserfolgsmeidend Teilprozesse der Selbstbewertung Anspruchsniveau realistisch, mittelschwere unrealistisch; Aufgaben leichte/schwere Aufgaben extrem 26 Ursachenzuschreibung Erfolg Anstrengung, eigene Tüchtigkeit Glück, leichte Aufgabe Misserfolg mangelnde Anstrengung, Pech mangelnde eigene Fähigkeit/Begabung Bewertung des Handlungsergebnisses positive Erfolgs- negative Erfolgs- /Misserfolgsbilanz /Misserfolgsbilanz Misserfolgsmotivierte, die auf zu leichte oder zu schwierige Aufgaben ausweichen, können den Zusammenhang der eigenen Resultate mit den eigenen Anstrengungen kaum sehen; auch nicht sehen, wie über Zeit Wissen und Kompetenzen stiegen; deshalb können eigene Erfolge z.B auf leichte Aufgaben, Glück etc. zurückgeführt; und auf diese kann man nicht stolz sein; Misserfolge dagegen werden häufig einer mangelnden Begabung zugeschrieben; diese negativen Affekte nach einem Misserfolg sind dann belastend; das führt dazu, dass diese Person in Zukunft vielleicht Anforderungssituationen ganz aus dem Wege gehen möchte. Andererseits kann bei der Aufsuche extrem schwieriger Aufgaben auch das Selbstbild geschont werden, weil diese Aufgaben von niemandem zu schaffen sind; beide Formen, zu leichte wie zu schwierige Aufgaben, bleiben bei misserfolgsmotivierten ohne Konsequenzen für das Selbstbild. Deshalb gilt es, bei Misserfolgsmotivierten Personen an folgenden Prozessen anzusetzen, um ihnen erfolgszuversichtliche Erlebnisweisen und Strategien zu vermitteln: 1. realistische, mittelschwere, Ziel setzen (Aufgaben, die bei Anstrengung zu schaffen sind), 2. motivational günstige Ursachenerklärungen nahe bringen, 3. Selbstbewertungen unterstützen, bei denen die Freude nach Erfolg größer ist als die Betroffenheit nach Misserfolg. Vor diesem Hintergrund haben exemplarisch Krug & Hanel bereits 1976 ein Training mit 30 Grundschülern der 4. Klasse durchgeführt. Es gab 16 ein- bis zweistündige Trainingssitzungen außerhalb des regulären Unterrichts; die ausgewählten Schüler waren misserfolgsmotiviert, hatten aber einen IQ von mind. 80 und sie hatten schlechte Schulleistungen. Um keine Defensivstrategien während des Trainings zum Einsatz kommen zu lassen, wurde mit ihnen, mit schulfernem Material – Geschicklichkeitsspiele: Ballwerfen, Ringwerfen etc.- geübt, günstige Bewertungsprozesse zu erlernen. Konkret sieht das wie folgt aus: 1. Der Schüler legt fest, aus welcher Entfernung er werfen will und wie viele Treffer er schaffen will (Zielsetzung); 27 2. Nach jeder Wurfserie kreuzt er an, ob sein Abschneiden für ihn Erfolg oder Misserfolg bedeutet und wie sehr er sich über das Ergebnis freut (Selbstbewertung), 3. Dann fragt der Trainer ihn, woran sein Erfolg/Misserfolg gelegen hat (Kausalattribution) und was er in der nächsten Wurfserie tun möchte. 4. Im Anschluss daran setzt sich der Schüler sein neues Ziel. Der Trainer diente dabei als Modell: er äußerte die relevanten Kognitionen laut: machte Überlegungen zur Zielsetzung, verbalisierte nach Erfolg und Misserfolg die Ursachenzuschreibung und zeigte auch deutliche Selbstbewertungsreaktionen wie Freude oder Ärger. In Kleingruppen verbalisierten die Kinder auch laut ihre Kognitionen. Nach und nach ging das laute Sprechen zu einem inneren Sprechen über. Im Verlauf der 16 Wochen veränderte sich das Training von Geschicklichkeitsspielen, PapierBleistiftspielen zu allmählich in Richtung schulrelevantes Material. In standardisierten Testsituationen zeigte sich, dass das Zielsetzungsverhalten der trainierten Schüler realistischer war, ihre Ursachenerklärung motivational günstiger und ihre Selbstbewertung im Erfolgsfall positiver ausfiel. Auch ihr Leistungsmotiv änderte sich in Richtung Erfolgsmotivation bzw. die Misserfolgsmotivation bzw. Furcht vor Misserfolg nahm ab. Aus diesen Befunden sind einige Kriterien für den Einsatz von Motivtrainingselemente in den Unterricht abgeleitet worden: 1. Unterrichtsmaterial bzw. Aufgaben so transformieren, dass sie ein eindeutiges Ergebnis haben: richtig oder falsch; und dass diese auch vom Schüler selbst festgestellt werden kann. 2. Aufgaben sollten deutlich erkennbare Schwierigkeitsstaffelungen haben; sie sollten klar abgestufte Grade der Ausführungsgüte erkennen lassen. 3. Erfolg und Misserfolg sollten teilweise von den eigenen Anstrengungen oder anderen kontrollierbare Faktoren (Konzentration, Arbeitsweise etc.) abhängen. 4. Die Bearbeitung sollte nicht allzu lange sein, damit die Beziehung zwischen Zielsetzung, Arbeitseinsatz und Ergebnis als Einheit überschaubar und auch mehrfach durchlaufbar werden. 5. Die Schülern sollten mit den Aufgaben soweit vertraut sein, dass sie die Schwierigkeitsgrade für sich selbst einschätzen können und die Aufgabe selbstständig bearbeiten können. 28 Problematisch ist jedoch die Konstellation, wenn ein Lerner feststellt, dass trotz großer Bemühungen kein sichtbaren Erfolge sich einstellen oder nur sehr zögerliche Verbesserungen vorhanden sind: dann wird der Lerner zu dem Schluss gelangen, dass seine Fähigkeiten noch schlechter sind als ursprünglich angenommen und daraufhin vielleicht seine Bemühungen gänzlich einstellen. Aus diesem Problem hat sich die Konsequenz ergeben, Motivationstrainings gleichzeitig mit Kompetenztrainings zu verbinden bzw. den Lernenden auch erfolgreichere Lernstrategien an die Hand zu geben. Trainingsmaßnahmen, die also neben der motivationalen Förderung auch die Steigerung von Kompetenzen beinhalten, verbessern die Leistungsmotivation. Das konnten bspw. Rheinberg und Schliep (1985) zeigen, die bei außergewöhnlich rechtschreibschwachen Schülern ein Programm der Kompetenzenförderung - und ein Programm der Motivationsförderung kombiniert hatten. Sie wandten ein Rechtschreibprogramm an, bei dem die zu lernenden Grundmorpheme nach ihrem empirisch ermittelten Schwierigkeitsgrad gestaffelt waren. Das Training war so konzipiert, dass sich die Lernerfolge schnell einstellten; die Schüler erlebten eine rasche Verbesserung ihrer Rechtschreibkompetenzen; die Attributionsstrategie bezogen sich auf die dort gezeigten Leistungen; aufgrund der Erfolge konnten sie auch eher günstigere Attributionsstrategien verwenden. Beispiel: 1. Monster 2. Das Monster 3. Das hungrige Monster 4. Das hungrige Monster frisst 5. Das hungrige Monster frisst morgens 6. Das hungrige Monster frisst morgens meistens 7 Das hungrige Monster frisst morgens meistens Kekse Der Schüler legt auf seinem Arbeitsblatt fest, welchen Schwierigkeitsgrad er schaffen will (1-7); Ziel ist, den Satz vollständig erinnern und fehlerfrei in etwa drei Minuten schreiben. Dann wird die Satzfolie 10 Sekunden lang auf dem Projektor gezeigt. Anschließend wird die Folie zur Ergebniskontrolle wieder aufgelegt. In einer Evaluation ließen sich im Vergleich zu herkömmlichen Förderunterricht noch günstigere Effekte zeigen; Effektstärken lagen zwischen d =.46 und d =.74 (Vgl. Rheinberg & Fries: Motivationstraining). 29 Ausgehend von den theoretischen Annahmen der Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan, ist für den Kontext Schule die Frage zu stellen: Wie sehr können Schüler sich in der Schule autonom und kompetent erleben, gerade wenn diese zentrale Aspekte intrinsischer Motivation bilden? Bereits in einem frühen Experiment konnten Lepper et al. (1973) folgendes nachweisen: Kinder wurden zu einer Tätigkeit angeregt, die sie gerne taten, und zwar mit Filzstiften malen. Einigen Kindern wurde aber mitgeteilt, dass sie für ihr Bild einen Preis (Urkunde, einen Stern und eine rote Schleife) erhalten werden; den andern wurde kein Pries in Aussicht gestellt. Die ersten erhielten tatsächlich auch ihre Preise; die zweiten bekamen keine externe Verstärkung. Nach einer Woche konnte man beobachten, dass die belohnten Kinder deutlich seltener spontan zu den Filzstiften griffen als die Unbelohnten. Das verminderte Interesse wurde dadurch erklärt, dass sie die gezeigte Leistung in Abhängigkeit der Belohnung betrachtet hatten. (Überrechtfertigungseffekt) „Die Vorschulkinder, die für die Bilder belohnt worden waren, könnten ihre Malaktivität nachträglich mit dieser Belohnung, nicht aber mit ihrem Interesse an dieser Tätigkeit gerechtfertigt haben.“ (S. 347, Mietzel) Heißt das jedoch, dass man Schüler nicht belohnen sollte? Dieser Effekt tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf: Enthalten Belohnungen eine Information darüber, welche Kompetenzen hinter einer gezeigten Aktivität stecken (Steigerung der intrinsischen Motivation) oder sind sie als Versuche der Kontrolle über das Verhalten zu verstehen (Verminderung der intrinsischen Motivation)? (Nobel)preis für das literarische Werk (hohe intrinsische Motivation) oder Auftragsliteratur für einen Verlag (gering). Im Schulkontext kann der Einsatz von externalen Verstärkern dann gerechtfertigt sein, wenn Schüler von sich aus keine intrinsische Motivation zeigen und sich selbst nur sehr geringe Fähigkeiten zuschreiben. Da kann auch über externe Verstärker (Token-programme, die eingetauscht werden gegen interessante Aktivitäten, Gegenstände etc.) die Lernmotivation weder angeregt werden. Tokenprogramme sollten jedoch nur dann angewandt werden, wenn Schüler eine Lernhandlung durchführen sollen, die sie andernfalls vermeiden würden. Ansonsten besteht die Gefahr der Abhängigkeit von externen Verstärkern und die Tätigkeit wird sobald unterlassen, wenn die Belohnung entzogen wird. Bspw. berichtet Cohen (1973) von einem frühen Token-programm, das sogar in einer Haftanstalt mit kriminellen Jugendlichen, von denen 85 % Schulversager waren und die wegen Autodiebstahl, Einbruch, Vergewaltigung oder Mord Haftstrafen verbüßten. Sie konnten für erzielte schulische 30 Leistungen Punkte erzielen, die dann gegen materielle Güter (Bücher, Zeitschriften, ExtraBekleidung etc.) oder Dienstleistungen (Freizeit, Einkaufen gehen in der Stadt etc.) eingetauscht werden konnten. Zu Beginn des Programms hatten diese Jugendlichen sich mit einer bestimmten Punktezahl „eingekauft“; mussten also erst diese wieder abzahlen und bekamen dann erst Punkte. Trotz dieses enorm schwierigen Klientels war es aber möglich, dass Leistungszuwächse bis zu 30 oder 40 % in den Naturwissenschaften, Mathematik und auch Sozialkunde erreicht wurden. Ziel ist es, mit solchen Programmen die ungünstigen Attribuierungen der Schüler, mangelnden Kompetenz zu besitzen, zu korrigieren. Vorbeugend können Lehrer ihre eigene Kontrollfunktion in den Hintergrund und ihre informierende Funktion in den Vordergrund rücken, Token-programme sind also unter bestimmten Bedingungen wirksam: 1. Eine Tätigkeit macht in sich Freude, ist jedoch von aussen nicht erkennbar; Verstärker können dann eine Person dazu bringen, diese Tätigkeit erst einmal überhaupt in Angriff zu nehmen. Wenn dann erlebt wird, dass die Tätigkeit interessant und attraktiv ist, dann haben die Verstärker die Funktion einer „Initialzündung“ gehabt, von der aus sich überdauernde Tätigkeitspräferenzen ergeben können. 2. Verstärker können als Anreiz dienen, um bestimmte Phasen zu überbrücken; insbesondere bei jenen Tätigkeiten, die erst ab einem bestimmten Behrrschungsgrad Spaß machen und lustvoll erlebt werden (Musik, Sport); Verstärker haben hier die Funktion, dass die Person lang genug „bei der Stange bleibt“, bis sie ein bestimmtes Kompetenzlevel erreicht hat. 3. Verstärker können sinnvoll sein, wenn eine Person sich unrealistischer Weise etwas nicht zutraut, durch massive Belohnung kann sie dann zur Ausführung der Tätigkeit veranlasst werden. Sofern sie dann erfährt, dass die Tätigkeit doch nicht so abschreckend bzw. bewerkstelligbar ist, wird sie die Tätigkeit auch von sich aus in Angriff nehmen. Wie kann der Lehrer Neugier wecken? (Vgl. Mietzel, S. 350ff). Generell entsteht Neugier dann, wenn Menschen mit Situationen konfrontiert werden, die ein mittleres Maß an Neuigkeit, Überraschung oder Unsicherheit enthalten. Es sind Situationen, die sich nicht ganz mit den bisherigen Wissensinhalten decken bzw. mit bisherigen Erfahrungen nicht vereinbar sind bzw. diese in „mittlerem Grade“ in Frage stellen. Neugier vereint zwei gegensätzliche Tendenzen: Situationen, die Unbekanntes enthalten, ziehen den Menschen einerseits an, anderseits sind wir auch bestrebt, uns davor zu distanzieren, weil sie 31 auch stets als Unbekanntes gefährlich werden können; je nachdem, welcher der Impulse die Oberhand gewinnt, wird man sich entweder dem Neuen widmen oder das Neue ablehnen. Ähnliche Ergebnisse zeigt ach die Bindungsforschung: Exploration und Bindungswünsche sid ebenso zwei gegensätzliche Impulse. Für die Unterrichtssituation empfiehlt Brophy (1987) insbesondere in der Einstiegsphase, statt nüchterne Informationen über den Stoff zu liefern, möglichst viel Kontextinformationen einfließen zu lassen: „Stelle einen abstrakten Inhalt so dar, dass er persönlicher, konkreter oder vertauter wird. Definitionen, Prinzipien oder andere allgemeine oder abstrakte Mitteilungen haben für Schüler solange wenig Bedeutung, wie sie nicht in konkreter Form diskutiert werden“ (Mietzel, S. 356). Deshalb sollten Unterrichtsinhalte so konzipiert werden, dass darin Erfahrungen, Geschichten, Probleme vorkommen, die der Schüler in seine Lebenswelt übersetzen kann und die damit in Beziehung stehen. Es empfiehlt sich, bei bestimmte Fächern, Geographie, Geschichte, Sozialkunde etc. zuvor durch Fragebogen Informationen über Interessen, Kenntnisse (wer z.B. in welchem Land war, welche Hobbies hat etc.) der Schüler einzuholen und diese in die Konzeption des Unterrichts einfliesen zu lassen, um Bekanntheit und dadurch Interesse zu wecken. (z.B. das Projekt „Jasper Woodbury“). Statt an einer sozialen Bezugsgruppe mit Leistungsrückmeldung über Notengebung zu orientieren, wird aus pädagogischer Sicht stärker die Orientierung an Lernzielen empfohlen. Hier gilt es, solche Aufgaben zu stellen, die Schüler bei Anstrengung, unabhängig von ihrem Begabungs- und Fähigkeitskonzept haben, lösen können. Dadurch steigt mit erfolgreicher Bearbeitung die eigene Kompetenz. Vergleichbar ist die Beschäftigung mit sportlichen Übungen, bei denen mit steigernder Beschäftigung das Können besser wird oder der Hobbykocher etc. Schüler mit Lernzielorientierung resignieren weniger, wenn sie scheitern; sie nehmen sich nicht als Versager wahr; auch hohe Anstrengung bzw. lange Beschäftigung wird dann nicht als ein Rückschluss auf die eigene (negative) Begabung wahrgenommen; deshalb können sie ohne Risiko davon Gebrauch machen bzw. sich lange beschäftigen; mit der Zeit erfahren sie den Zusammenhang zwischen Beschäftigung / Anstrengung und dem Ergebnis. Der Unterricht hat nicht nur kognitive Folgen, sondern in der Regel gehen damit auch unbemerkt und ungewollt- emotionale, soziale und persönlichkeitsprägende Prozesse einher. 32 Cage und Berliner (S. 438-454) haben explizit für den Unterricht einige Motivierungstechniken vorgeschlagen, die hier wiedergegeben werden sollen: 1. Sage den Schülern präzis, was sie erreichen sollen: Um Schülerverhalten tatkräftig und richtungsweisend zu unterstützen, muss dem Schüler genaue Anweisungen gegeben werden, was er bei einer Aufgabe erreichen soll. Sie gehen dabei von der Beobachtung aus, dass häufig Lehrer im Unterricht sich auf eine Aufgabe stürzen und die Schüler im Unklaren lassen, was sie genau tun müssen, um die Aufgabe erfolgreich zu lösen bzw. was das Ziel der Aufgabe ist. Brophy (1982) stellte z.B. fest, dass über 20 % aller im Unterricht neu gestellten Aufgaben überhaupt nicht einleitend vorgestellt wurden, sondern die Lehrer einfach mit der Aufgabe anfingen. 2. Lobe den Schüler: Ei verbales Lob, wie etwa „gut“, „sehr schön“, „gute Arbeit“, das kontingent nach angemessenen Leistungen oder nach Annäherungen an angemessenen Leistungen angewandt wird, stellt eine wirkungsvolle Motivierungsmöglichkeit dar. Soziale Anerkennung hat einen starken Einfluss auf das Leistungsverhalten von Schulkindern. Zuviel Lob oder Lob an falscher Stelle kann jedoch zu einer Übersättigung führen und ineffektiv werden. Darüber hinaus führen Cage und Berliner an, dass extravertierte Schüler mehr durch Tadel und introvertierte, die mehr an ihren eigenen Gefühlen und Gedanken interessiert sind, mehr durch Lob zu motivieren sind. Effektives bzw. ineffektives Loben: Effektives Lob: Wird kontingent, d.h. planmäßig erteilt Die Einzelheiten des Erreichten werden spezifiziert Äußert sich spontan; wirkt glaubwürdig; verdeutlicht die klare Zuwendung zum Schüler und seiner Leistung Belohnt das Erreichen unter Einschluss der Bemühungen Informiert den Schüler über seine Kompetenz oder den wert seiner Leistung Stellt für Schüler eine Orientierungshilfe dar Verwendet frühere Leistungen des Schülers als Kontext zur Beschreibung momentaner Leistungen Erkennt die Anstrengung oder den Erfolg bei für diesen Schüler besonders schwierigen Aufgaben an Schreibt Erfolg dem Bemühen und der Fähigkeit des Schülers zu 33 Richtet die Aufmerksamkeit des Schülers auf sein aufgabenbezogenes Verhalten 3. Verwende Tests und Noten mit Bedacht: Tests und Noten werden in der Regel das Leistungsverhalten von jenen Schülern positiv beeinflussen, die in den Noten einen Wert erkennen, der jenseits des Unterrichts liegt (Anerkennung, schulische, berufliche Vorteile etc.), aber die von außerhalb auferlegten Noten können dazu führen, dass der Lerneifer außerhalb des Unterrichtskontextes nachlässt. Tests und Noten sind dann förderlich, wenn sie eingesetzt werden, um den Schüler zu informieren, wen sie ihm als Indikator für die Anstrengung des Schülers dienen; nicht jedoch, wenn sie eingesetzt werden, um den Schüler zu bestrafen oder als Nachweis dienen, wie gut oder schlecht ein Schüler im Vergleich zu den anderen Schülern steht. 4. Spannung, Entdeckung, Neugier wecken Stimuli, die neu, überraschend, komplex oder mehrdeutig sind, lassen eine Wachheit entstehen, die Berlyne (1965) als eine „epistemische Neugier“ bezeichnet hat. Ist diese Neugier vorhanden, ist der Mensch in einem motivierten Zustand; er versucht, das Ausmaß der Unordnung, mit dem er konfrontiert ist, zu mindern. Die Motivation hält so lange an, bis der Konflikt zwischen den kognitiven Schemata aufgelöst ist. Die Schüler können jedoch gelangweilt oder frustriert werden, wenn das Problem so gestaltet ist, dass sie diese nicht lösen können; d.h. es sollte mit ihren kognitiven Kompetenzen auch prinzipiell lösbar sein. 5. Tue gelegentlich etwa Unerwartetes Hier wird vorgeschlagen, im Unterricht gelegentlich bspw. auch den „Spieß“ umzudrehen, derart, dass z.B. die Schüler den Lehrer nach seinen Lernproblemen fragen, die Schüler selber mal einen Test für den Lehrer entwerfen etc. Der Effekt ist, dass die Aufmerksamkeit und die Beteiligung der Schüler steigt, wenn routinisierte Interaktionsmuster gelegentlich durchbrochen werden. 6. „Appetit anreizen“ Schüler sollten gelegentlich kleine Belohnungsproben erhalten, bevor sie mit dem Lernen beginnen. Sie sollten erfahren, was sie noch durch weitere Bemühungen bekommen können, so z.B. den Kindern eine spannende Lektüre kurz vorlesen und sie dann selber lesen lassen. Die Anfangsstadien einer Aufgabe bspw. sollten leicht gehalten werden, so dass die Schüler zu Beginn Erfolgerlebnisse haben. Dann könne sie schrittweise erhöht werden. Aneignung von Kenntnissen sollte zu Beginn mit häufigen Belohnungen einher gehen. 34 7. Verwende Bekanntes als Beispiele Empfohlen wird bspw. bei Textaufgaben den Schülern bekannte Namen (statt abgedroschene Namen wie Frau Müller oder Herrn Meyer) oder Situationen vorzugeben. 8. Wende das Gelernte auch an Das bisher Gelernte soll auch verwendet werden; dadurch wird auch die Erwartung geweckt, dass das gerade Gelernte auch später wieder gebraucht werden wird; in den jeweiligen Aufgabenstellungen sollten deshalb stets auch Bezüge zum früher Gelernten vorhanden sein. 9. Verwende Simulationen oder Spiele im Unterricht So können bspw. im Sozialkundeunterricht statt eines Vortrages über Drogen- oder Gettoisierungsprobleme diese Szenen von den Schülern in verscheiden Akteure eingeteilt (Polizei, Dealer, Süchtige, Arme etc.) gespielt und daran diskutiert werden. Spielerische Lernmethoden sorgen für Spaß; sorgen für wichtige Lernerfahrungen und können auch dem Lehrer die Möglichkeit geben, die Lernformen der Schüler nachzuvollziehen. 10. Verringere die Attraktivität konkurrierender Motivierungssysteme Hier gilt es zu analysieren, warum Schüler die Schule schwänzen, zu spät kommen oder sich den Leistungsforderungen widersetzen. Welche anderen Motive sind existent? Bedürfnis nach Anerkennung durch andere? Wie etwa bei de Klassenkaspar oder wird das Leistungsbedürfnis in der Schule nicht gut abgedeckt, dafür aber eher im Freizeit oder sportlichen Betätigungen? 11. Minimiere unangenehme Konsequenzen der Schüler bei der Beteiligung am Unterricht Beteiligung des Schülers sollte stets positiv verstärkt werden; aversive Auswirkungen, wie etwa Verlust der Selbstachtung des Schülers, wenn er die Aufgabe nicht richtig löst, oder nicht mitkommt, weil das Tempo zu schnell ist etc. gering halten. Einfluss der Familie auf die Lernmotivation: Die Bedeutung der Familie für die Genese motivationaler Orientierungen ist recht spät, erst ab den 90-er Jahren intensiv erforscht worden; die Forschung war weitestgehend fokussiert auf das Setting „Schule“. Vor dem Hintergrund der Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan hat Wild versicht, die familialen bzw. erzieherischen Haltungen zu eruieren, die Einfluss auf die Lernmotivation des 35 Kindes haben. Dabei knüpft sie auch an die empirischen Belege, die Tausch und Tausch in ihrer Erziehungspsychologie (1973) vorgelegt hatten. In neueren Studien (Ginsburg & Bronstein, 1993; Grolnick & Ryan, 1989) ist empirisch belegt, dass elterliche Autonomieunterstützung eine motivfördernde Wirkung hat bzw. elterliche Kontrolle demotivierende Wirkungen nach sich zieht. Für die Förderung des Kompetenzerlebens konnten längsschnittliche Analysen zeigen, dass ein stimulierender Familienkontext, der sich durch eine hohen Anregungsgehalt und eine starke kulturelle Orientierung auszeichnet, günstig auswirkt und die intrinsische Motivation von Schülern steigert. Was das Zusammenspiel bzw. die Interaktion schulischer und häuslicher Lernumgebungen betrifft, so zeigen sich Leistungs- und Motivationsprobleme dann, wenn Schüler eine Diskontinuität zwischen den in der Familie und in der Schule vorherrschenden Interaktionsformen erkennen (Hansen, 1986). Diesen Befund haben Paulsen, Marchant, Rothlisberg dahingehend differenziert, dass sie nachweisen konnten, dass diese wahrgenommene Inkongruenz nur bei jenen Schülern mit schlechten Leistungen einher ging, die ihre Eltern als gleichgültig, ihre Lehrer aber dagegen als autoritär beschrieben. Wild hat in ihrer Studie mit 169 Schülern im Alter von 11 bis 14 Jahren (M=12,6 J.) eine Fragebogenuntersuchung durchgeführt. Sie konnte darin zeigen, dass Schüler umso stärker intrinsisch motiviert waren, je eher die Lehrer aus der Sicht der Schüler eine autonomieunterstützende Form des Umgangs pflegten, sie über den Unterricht hinausgehndes persönliches Interesse an den Schülern zeigten, und für ein hohes Maß an Stimulation und gut strukturierten Unterricht durchführten. Die Schüler waren dagegen umso stärker extrinsisch motiviert, je mehr sie sich vom Lehrer kontrolliert fühlten. Tabelle: Zusammenhänge zwischen Instruktionsverhalten von Lehrern, elterlichen Schulengagement und der intrinsischen und extrinsischen Schülermotivation (Wild, 2001) Intrinsische Mot. Extrinsische Mot. Lehrer .48** .26** Eltern .27** -.02 Lehrer -.08 .20** Eltern .04 .27** Verhaltensdimension Autonomieunterstützung Kontrolle 36 Struktur Emotionale Zuwendung Stimulation Lehrer .24** .04 Eltern .17* .13 Lehrer .48** .22** Eltern .33** -.01 Lehrer .45** .13* Eltern .34** .05 ** p<.01; *p<.05 Es konnte also gezeigt werden, dass nicht nur die Merkmale des Lehrerverhaltens, sondern auch der elterliche Umgang mit schulischen Belangen einen substanziellen Beitrag zur Aufklärung von Unterschieden in der Lernmotivation hat; schulische und familiale Bedingungen wirkten sich in dieser Studie als kompensatorisch bzw. ergänzend auf die Lernmotivation aus. Das impliziert, dass Förderungen in den jeweiligen Kontexten die Defizite im jeweils anderen Kontext ein Stück aufheben kann. 37 03.05.: Gestaltung lernförderlicher Schulumwelten 1. Allgemeine Zusammenhänge zwischen individuellen kognitiven Fähigkeiten und Schulmerkmalen 2. Schule und individuelle kognitive Entwicklung im Kulturvergleich 3. Lern- und kognitive Förderung durch Unterricht 4. Formen und Konzeptionen des Unterrichts 5. Wirksame Lernstrategien im Unterricht 1. Allgemeine Zusammenhänge zwischen individuellen kognitiven Fähigkeiten und Schulmerkmalen 1. Zunächst ist ganz allgemein nach der Rolle der Bildungsinstitutionen in einem bestimmten kulturellen Umfeld für die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten zu fragen. Hier zeigt sich, dass die Zusammenhänge zwischen individuellen kognitiven Fähigkeiten und Schulmerkmalen – Schulform, Schul- und Unterrichtsqualität, Ausbildungsdauer etc. – meist geringer sind als die Korrelationen zur Bildungsnähe des Elternhauses (Good & Brophy, 1986). Meist ist zu erkennen, dass Vorfähigkeiten der Schüler und Persönlichkeitsmerkmale am aussagekräftigsten zur Prädiktion der Schulleistung sind: So waren z.B. bei einer Metaanalyse von Wang, Hertel und Walberg (1993) für Schulleistungen proximale Variablen (individuelle Schülermerkmale, einzelne Unterrichtsmerkmale) erklärungsmächtiger als distale Variablen (überindividuelle Schulkultur, Schulorganisation). 2. Schule und individuelle kognitive Entwicklung im Kulturvergleich Die Bedeutung des Schulunterrichts für die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten wird vor allem im Kulturvergleich noch deutlicher; allerdings ist das ein unerschöpflich breites Thema, weshalb hier nur auf einige kontrastierende und illustrierende Aspekte eingegangen werden soll. Zwar ist Schulunterricht in den meisten Ländern verbreitet, explizite und implizite Inhalte des schulischen Lernens konfligieren jedoch gelegentlich mit herkömmlichen Werten. So gilt etwa selbstständiges Denken und Infragestellen herkömmlicher Antworten oft als unerwünscht. Wober (1984) untersuchte als Beispiel den Intelligenz-Begriff traditioneller Kulturen in Uganda. Als intelligent gilt „Respekt vor den Älteren“, „Achtung der Eltern“, „Geschichte des Landes 38 auswendig kennen“, Gehorsam rangiert vor akademischen Fähigkeiten als Indikator für Intelligenz. Der Dienst an bestehenden Normen und Werten, an der Wahrung der Tradition, ihrer Sitten und Gebräuche wird honoriert, Stabilität und Harmonie stehen vor Innovation und Individualität. Kulturelle Werte spiegeln sich in Gesellschaft, Erziehungsverhalten und Schulunterricht wider, was sich auf Form und Ausprägung kognitiver Fähigkeiten auswirkt. In prämodernen Gesellschaften liegen häufig – aus westlicher Sicht betrachtet - defizitäre Unterrichtsbedingungen vor: Probleme in der Schulorganisation (Schulverwaltung, Durchsetzung der Schulpflicht usw.), veraltete Curricula, schlechte Ausstattung (fehlende Tische, Stühle und Schulbücher), eine hohe Absentismusrate (Tippelt, 2002), ein ungünstiges Schüler-LehrerVerhältnis (z.B. wird für Tansania etwa ein Verhältnis von 45:1 angegeben), oft ist Schulgeld zu bezahlen, und häufig ist die Regelschulzeit deutlich kürzer (in der Türkei bspw. bis 1998 nur eine fünfjährige Schulpflicht). Neben den eher schwierigen Unterrichtsbedingungen ist jedoch auch der praktizierte Schulunterricht lernpsychologisch für den Erwerb kognitiver Fähigkeiten oft eher ungünstig: Bspw. legen in einigen afrikanischen und arabischen Gesellschaften die Lehrer eher Wert auf mündliches Lernen und Auswendiglernen (vgl. Müller, 2002), hingegen sind Verstehen und Anwenden eher marginale Aspekte. Geprüft wird eher das korrekte Wiedergeben (Stoffmemorierung statt Verständnis); und Respekt sowie Gehorsam stellen wichtigere Orientierungen dar als selbstständiges Denken. Aber trotz suboptimaler Bedingungen lässt sich festhalten, dass ein deutlicher Intelligenzgewinn durch Schulbesuch nachweisbar (Ombredane et al., 1956) nachweisbar ist: So konnte Rindermann extreme Unterschiede in den gemessenen Intelligenztestergebnissen bei jugendlichen und erwachsenen Yanomani-Indianern zeigen: Er konnte zeigen, dass nicht beschulte Yanomami Aufgaben eines einfachen Intelligenztests trotz verschiedener Instruktionsvarianten (sprachliche Erklärung auf Portugiesisch und Yanomami, gestische Erklärung, mehrfache Durchführung, Hilfe eines dort lebenden Betreuers) nicht lösen können (Rindermann, 2002). Dabei wurde das SPM-Verfahren von Raven herangezogen, das schlussfolgerndes (induktives/logisches) Denken als Maß fluider oder analytischer Intelligenz anhand abstrakter graphischer Aufgaben misst. 39 Die Aufgaben sind ab dem 10. Lebensjahr selbsterklärlich. Mit Instruktion können die SPM auch schon bei Grundschulkindern zur Intelligenzmessung eingesetzt werden. Brasilianische Siedlerkinder im Alter von 13 oder 17 Jahren konnten die Aufgaben ohne Instruktion bearbeiten. Die Raven Matrizentests (die farbigen Coloured Progressive Matrices, CPM, die Standard Progressive Matrices, SPM, und die etwas schwierigeren Advanced Progressive Matrices, APM) werden – trotz der Kritik an der Kulturfairness dieses Tests - als gute Indikator für allgemeine Intelligenz in kulturvergleichenden kognitiven Studien betrachtet. Neben dem Fehlen der Schule spielen hier aber auch kulturelle Unterschiede eine große Rolle: Yanomami verfügen über keine Schriftsprache und kein komplexes Zahlensystem. Diese – Schrift wie Zahl (unsere nächsten Veranstaltungen werden sich den Defiziten in diesen Bereichen und ihrer Förderung widmen: Dyslexie und Dyskalkulie) bilden die stoffliche, materielle Basis für Sprache und Mathematik, wodurch in der Regel hypothetisches, kontextfreies und formales Denken gefördert wird. Yanomani-Indianer sind in ihrer visuellen Wahrnehmung und in ihrem Denken nicht geübt im Umgang mit abstrakten Zeichen, mit Schrift, Zahlen und Ziffern. Gerade die Schrift fördert in der Rezeption als Träger für sprachliche Inhalte verbale und kognitive Kompetenzen; darüber hinaus fördert Schrift bei aktiver Verwendung über die kulturell vermittelten höheren Anforderungen an grammatischer und orthografischer Korrektheit, an Anschlussfähigkeit und Hierarchie der Satzteile und Sätze untereinander, an Aufbau des Textes, Gliederung der Gedanken und Struktur der Argumente kognitive Kompetenzen der Schreibenden. Dort, wo die Möglichkeiten der Übung von Abstraktion durch Schrift, Zahlengebrauch, Geld oder Schule fehlen, erleiden auch intellektuelle Fähigkeiten eine Einbuße. Kognitive Entwicklung wird in der Regel als ein durch Umweltanregungen beeinflussbarer Prozess betrachtet. Deshalb eröffnen sich hier Möglichkeiten gezielter Förderung auf verschiedenen Ebenen: in Schulen, an der Schulstruktur, m Unterricht, bei der Freizeitgestaltung, im Elternhaus, in der Beeinflussung von Persönlichkeitsmerkmalen, sowie an kollektiv geteilten Überzeugungsmustern. 40 Im Kindes- und Jugendalter sind formale Bildungsinstitutionen zentral. Kognitive Fähigkeiten – Intelligenz und vor allem Wissen – lassen sich direkt durch Schule und Unterricht beeinflussen. Relativ unstrittig ist hierbei, dass mehr Unterricht pro Jahr und längerer Unterricht im Leben eines Heranwachsenden sich positiv auf kognitive Fähigkeiten auswirken (Ceci, 1991). Deshalb kann eine Förderempfehlung daraus lauten, a) dass möglichst viele Kinder ab möglichst jungem Alter möglichst lange mit hoher Jahresunterrichtsstundenzahl eine Schule besuchen. Hieran sollte sich eine weitere formale Ausbildung (Lehre, Studium) anschließen; b) Unterricht darf nicht ausfallen. Bei Erkrankung eines Lehrers sollte der Unterrichtsinhalt durch einen anderen Lehrer vermittelt werden (nicht nur bloße Aufsicht). Pädagogisch und für schulische wie konkrete politisch-administrative Interventionen besonders aufschlussreich sind die Zusammenhänge zwischen Schul- bzw. Unterrichtsmerkmalen und Schülerkompetenzen. Kognitive Fähigkeiten fördernde Schulen nach Good und Brophy Nach Good und Brophy (1986) zeigen sich zwischen guten und schlechten Schulen innerhalb der USA bei gleichem sozio-ökonomischen Status der Herkunftsfamilien Unterschiede von d=1 in Schülerleistungen. Eine gute Schule bedeutet: • starke Führung: Direktor führt und macht Unterrichtsbesuche, • hohe Erwartungen an die Schülerleistung aller Schüler, • Anerkennung des Schülererfolges, • klare Ziele, • klare Leistungsstandards, • maximalisierte Lernzeit die für Unterricht genutzt wird, • Evaluation des Lernfortschritts, • die Schule fühlt sich für Lernerfolge aller ihrer Schüler verantwortlich, • Lehrerweiterbildung, • gute Atmosphäre, elterliche Unterstützung und Einbeziehung sowie ein hohes Schulethos. Die Klassengröße war dagegen innerhalb gewisser Grenzen eher unwichtig. 41 3. Lern- und kognitive Förderung durch Unterricht Neben solchen schulstrukturellen Maßnahmen spielt auch die Unterrichtsqualität eine große Rolle. Gute Lehrer überwachen den Wissensfortschritt, vermitteln zeiteffektiv viel Unterrichtsstoff, steuern Unterrichtsprozesse und Wissensvermittlung, führen die Klasse lernzielorientiert und setzen themenadäquat offene Unterrichtsformen ein. Die metakognitiven Voraussetzungen für selbstständiges Lernen müssen für das Gelingen solcher Lernprozesse gegeben sein (Weinert, 1996). Bei schwächeren und jüngeren Schülern insbesondere ist unterstützende Kontrolle notwendig (Korrelation mit Leistungszuwachs bei Weinert r =.32), der Unterricht muss hier stärker lehrergeleitet und schülerzentriert sein. Eine zentrale Größe in den verschiedensten Studien sind Struktur und Klarheit (z.B. bei Weinert, Schrader & Helmke, 1989, Klarheit r = .39 mit Schülerkompetenzen). Wenn über Lernförderung gesprochen wird, ist vorab festzuhalten, dass Lernen von verschiedenen Kontextfaktoren abhängig ist, die im Unterricht verschieden gestaltet werden können: Diese Lernumgebung besteht in der Regel aus den Komponenten: • Unterrichtsmethoden und Unterrichtstechniken • Lernmaterialen • Medien Auch wenn Unterricht vielfach als Vermittlung von Wissen betrachtet wird, liegen dem Unterricht grundsätzlich als übergeordnete Ziele auch stets Fragen der Bildung bzw. der gesellschaftlichen Auffassung von einem „gebildeten Bürger“ zugrunde. Unterricht, Lehre hat neben Wissensanreicherung auch immer eine persönlichkeitsprägende Wirkung auf die Lernenden: Es hat nicht nur kognitive Folgen, sondern – es werden vielfach nebenbei - auch emotionale, soziale und andere persönlichkeitsformative Prozesse eingeleitet. 4. Formen und Konzeptionen des Unterrichts Es lassen sich zwei Extrempositionen zum Lernen und Lehren in Unterrichtskontexten aufzeigen: 1) Technologische Position: Gegenstandszentrierte Heranhegensweise: es sind geschlossene Lernumwelten; die Instruktion steht im Vordergrund. Lernumgebunden sind aus dieser Position dann optimal, wenn die im Lehrplan aufgeführten Inhalte möglichst systematisch und organisiert 42 dargeboten werden können. Der Lehr-Lern-Prozess wird als ein Prozess betrachtet, bei dem ein Wissenstransport stattfindet; der Lehrende hat eine aktive Rolle; Wissensinhalte präsentieren und erklären. Lernender haben eher eine Passive Rolle: Rezeption des dargebotenen Wissens. Durch die weitestgehend rezeptive Rolle ist jedoch mit einer Reduktion der Eigeninitiative und Selbstverantwortung der Schüler zu rechnen; Schüler können sich dadurch demotiviert bzw. extrinsisch motiviert fühlen; Mangelndes Interesse kann zu Unlust, Disziplinproblemen und Leistungsverweigerung führen. Das in geschlossenen gegenstandszentrierten Lernumgebungen und nach sachlogischen Kriterien aufbereitete Wissen hat häufig mit den komplexen und weniger strukturierten Problemen und Erfahrungen des praktischen Alltages wenig gemeinsam, so dass der Transfer sehr schwer fällt. Folge davon ist deshalb häufig ein „träges“ Wissen, was nicht oder nur unzureichend zur Anwendung kommt (Krapp & Weidemann, S. 625). 2) Konstruktivistische Positionen: Offene, situierte Lernumgebungen: Hier dominiert der Aspekt der Konstruktion des Lerngegenstandes –durch die Lerner und nicht die Instruktion durch den Lehrer. Dieser Aspekt wird in der folgenden Darstellung einen größeren Raum einnehmen, weil für Prozesse der Lernförderung sich diese eher eignen. Konstruktivismus als Ansatz: Während ein Realismus, grob verkürzt, davon ausgeht, dass eine vom Subjekt unabhängige externe Wirklichkeit existiert und dass wir prinzipiell diese externe Wirklichkeit erkennen, und insofern wissen können, wie die „Dinge an sich“ sind, bestreitet der Konstruktivismus diese Annahme und verlagert die theoretische Aufmerksamkeit auf die Interdependenz von Beobachter und beobachteter Welt. Der Konstruktivismus vertritt die These, dass die Tätigkeit des Erkennens Einfluss auf das Erkannte bzw. das zu erkennende Objekt hat, und dass die Methode der Erkenntnis Einfluss auf die Formung des Erkenntnisgegenstandes hat. Eine weitere zentrale These des Konstruktivismus ist darüber hinaus, dass das Subjekt sein Wissen auf der Grundlage seiner Erfahrung aufbaut und dass das, was wir „unsere Welt“ nennen, sich darauf aufbaut, was wir aus unseren Erfahrungen machen. Die bisher dominante Vorstellung von Wissen als einer Menge kognitiver Repräsentationen, die abstrakt und losgelöst von jedem Kontext abgespeichert sind, wird in konstruktivistischen 43 Ansätzen radikal hinterfragt. Wissen ist keine Kopie der Wirklichkeit und lässt sich nicht vom Lehrenden zum Lernenden transportieren. Bspw. lässt sich auch der Tenor der konstruktivistisch geprägten Situated Cognition-Bewegung so zusammenfassen: Wissen wird zum einen durch das wahrnehmende Subjekt konstruiert, zum anderen aber auch in der Gemeinschaft sozial ausgehandelt; d. h. Wissen wird von Individuen im Rahmen sozialer Transaktionen gemeinsam entwickelt und ausgetauscht. Wissen ist stets kontextgebunden, weshalb Person, Wissen, Handeln und Situation stets gemeinsam zu analysieren sind. Denken und Wissen erhalten erst durch das laufende Handeln in Situationen ihre Bedeutungen. Entstehung konstruktivistischer Ansätze in der pädagogischen Psychologie: Wie lässt sich träges Wissen vermeiden? Wie sind Lernende zu spontaner Aktivität und Eigenverantwortung zu motivieren? Probleme des konstruktivistischen Auffassung: • In unmittelbaren Überprüfungen der Leistungen durch Wissenstest haben Förderungen nach konstruktivistischen Prinzipien nicht auf Anhieb immer positive Ergebnisse gezeigt; erst bei Studien mit einer längerfristigen zeitlichen Perspektive konnten durchgehend positive Effekte des Einflusses des situierten Lernens gezeigt werden. • Wenn in situierten Lernumgebungen Anleitungen oder Unterstützung fehlen, kann es in der Praxis zu unerwünschten Effekten wie Desorientierung und Überforderung kommen (Gräsel & Mandl, 1993) • Leistungsstarke profitieren von situieren Lernumgebungen sehr viel stärker als leistungsschwache; es besteht daher die Gefahr, dass sich die Kluft zwischen „guten“ und „schlechten“ Schülern noch vergrößert. • Das Vorgehen ist deutlich zeitintensiver und aufwendiger; Kosten-Nutzen-Verhältnis ist ein gravierendes Problem. Ein typischer Ansatz der konstruktivistischen Methode: Cognitive-Apprenticeship-Ansatz von Collins, Brown & Newman: Cognitive Apprenticeship bezeichnet eher einen Oberbegriff für eine interaktive (zwischen Lernendem und Experten) Lernmethode, die insbesondere auf Aspekte des traditionellen MeisterLehrling Verhältnisses abzielt und diese nun auf kognitive Lernziele anwendet. Die Kognitive Lernsituation ist natürlich in vieler Hinsicht anders als das traditionelle Meister-Lehrling Konzept. Im traditionellen Apprenticeship wird das, was gelernt wird, auf die Arbeitsziele der jeweiligen 44 Industriebranche zugeschnitten. Es ist weniger interessant, ob die gelernten Fertigkeiten auch in anderen Lebensbereichen einsetzbar sind. Im Cognitive Apprenticeship ist aber eher das Gegenteil der Fall. Die allgemeinen, übertragbaren Fähigkeiten sind wichtiger als spezielle Inhalte des gelehrten Stoffes. Zum Beispiel ist es wesentlicher, sich Strategien zum Lesenlernen zu merken als nur einen einzigen Text vom Inhalt her verstanden zu haben. Was sind die Schritte des Cognitive Apprenticeship-Ansatzes: • Zeigen des Vorgehens eines Experten: der Lehrende führt sein Vorgehen vor und erläutert, was er im Einzelnen tut und sich dabei denkt. Dadurch werden internale Prozesse für den Lernenden wahrnehmbar, beobachtbar - Modeling • Individuelle Ermunterung und Förderung: der Lernende befasst sich selbst mit einem Problem und wird vom Lehrenden betreut - Coaching • Teilproblemlösung durch den Lehrer mit zunehmender Zurücknahme; wenn der Lernende das Problem nicht selbst lösen kann, hilft ihm der Lehrende – Scaffolding (Scaffold: Gerüst) and fading (der Lehrende blendet sich immer weiter aus). • Sprachliche Externalisierung des Wissens durch die Lernenden; der Lernende wird aufgefordert, seine Denkprozesse und Strategien zu artikulieren - Articulation • Vergleich der eigenen Denkprozesse mit denen der Experten; ablaufende Prozesse beim Lernen werden mit anderen und dem Lehrenden diskutiert - Reflection • Eigenständige Problemlösung durch die Lernenden; der Lehrende zieht sich ganz zurück und die Lernenden werden zu weiteren selbstständigen Problemlösungen angeregt Exploration Reciprocal Teaching als eine typische Methode des Cognitive Apprenticeship: Reciprocal Teaching läuft wie folgt ab: 1. Lehrer und Schüler lesen beide einen Text für sich; 2. Der Lehrer formuliert eine Frage und eine kurze Zusammenfassung, die auf den Text basiert; 3. Wörter, die unklar sind, werden identifiziert und Vorhersagen auf den Inhalt des Texts werden aufgestellt; 45 4. Die Rolle des Lehrers wird in späteren Sitzungen wechselnd von den Schülern übernommen (daher der Name Reciprocal Teaching). Mehrere Elemente von idealen Lern Umgebungen sind in dem Reciprocal Teaching Modell zu erkennen wie zum Beispiel: Modelling, Scaffolding, Heuristic Strategies, Coaching, und Articulation. Erfolg des Reciprocal Teaching Reciprocal Teaching ist höchst effektiv. In Studien mit Schülerkleingruppen (Palincsar u. Brown, 1984) mit 4 bis 7 Schülern stiegen Textverständniswerte von 40 % korrekt gelösten Aufgaben bis auf 80 % korrekt gelöste. Diese Verbesserung hatte sich auch nach 8 Wochen kaum verringert. In einer Studie mit Schülern, die unterdurchschnittlich gelesen haben, war ein Anstieg von 15% korrekt gelöst auf 85 % nach 20 Trainingssitzungen registriert worden. 5. Wirksame Lernstrategien im Unterricht Wie kann selbstgesteuertes Lernen gefördert werden? Für die Förderung/Beeinflussung der Lernmotivation gibt es prinzipiell zwei Ansatzpunkte (Rheinberg, 1998): die Lernsituation und / oder die Person des Lernenden. Im ersten Fall geht es darum, die Situation so zu gestalten, dass sie Selbststeuerung anregt. Im zweiten Fall geht es darum, die Person so zu verändern, dass sie günstige motivationale Voraussetzungen, z.B. in Form von angemessenen Zielsetzungen, Attributionsstilen und Selbstbewertungstendenzen, zur Bewältigung von Lernsituationen erwirbt. Im folgenden sollen einige Hinweise gegeben werden, wie Lernsituationen zu gestalten sind, damit sie selbstgesteuertes Verhalten aktivieren. Es gibt einige Gründe dafür, die gerade die allgemeinbildende Schule als besonders geeignet für die Entwicklung der Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen erscheinen lassen (Friedrich, 1997): - Die Langfristigkeit schulischen Lernens: Selbstgesteuertes Lernen lässt sich nicht im Rahmen kurzfristiger Maßnahmen realisieren, die Vermittlung muss langfristig angelegt sein. Die Langfristigkeit schulischen Lernens – zwischen neun und dreizehn Jahren – lässt das Verhältnis zwischen dem Aufwand und dem Ertrag in einem günstigen Licht erscheinen. - Die Möglichkeit zur Kombination von Inhalts- und Strategievermittlung: 46 Die allgemeinbildende Schule ist der Ort, an dem die Vermittlung von Lernstrategien in Kombination mit der Vermittlung von Inhaltswissen erfolgen kann. - Die Möglichkeit zum fach- und altersstufenübergreifenden Transfer: In der allgemeinbildenden Schule mit ihrem vielfältigen, sich jeweils über mehrere Altersstufen erstreckenden Fächerkanon besteht die Möglichkeit, die Kompetenz zum selbstgesteuerten Lernen fachübergreifend zu entwickeln. - Die Schule legt die Grundlagen für das weitere Lernen: Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass Lernstrategien und Lernmethoden im Erwachsenenalter nicht mehr so einfach zu beeinflussen sind (Friedrich, Fischer, Krämer & Mandl, 1985). Deshalb ist es naheliegend, bereits in der Schule dafür zu sorgen, dass die richtigen Lernstrategien und –methoden gelernt werden. Wenn selbstgesteuertem Lernen der Rang einer Schlüsselqualifikation zugesprochen wird, dann sollten auch verstärkt Anstrengungen unternommen werden, diese Qualifikation systematisch zu entwickeln. In der Schule sollte Lernen nicht bloß geschehen, sondern Lernende sollten am Ende ihrer schulischen Biografie über ein Repertoire an Strategien und Fertigkeiten für das selbstgesteuerte Lernen verfügen, die sie bewusst, aufgaben- und situationsangemessene einsetzen können (Dubs, 1993). Sie sollten sozusagen Experten für (Weiter)Lernen sein. Führt man sich den bereits mehrfach zitierten Sachverhalt vor Augen führt, dass selbstgesteuertes Lernen Voraussetzung, Methode und Ziel des Unterrichtens ist (Weinert, 1982), so wird klar, dass der Weg nicht einfach ist, den die Schule zu beschreiten hat, um das Ziel „selbstgesteuertes Lernen“ zu erreichen. Es geht darum, diese Zielkompetenz durch die Methode des selbstgesteuerten Lernens zu erreichen, ohne dabei interindividuelle Unterschiede in den Voraussetzungen für selbstgesteuertes Lernen zu vernachlässigen. Im folgenden werden einige Elemente skizziert, die dazu beitragen können, dieses Ziel zu erreichen. Realisierung von Unterrichtsformen, die Selbststeuerung erfordern! Selbststeuerung, auch jene beim Lernen, muss durch Situationen herausgefordert werden, die Selbststeuerung erfordern. Solche Situationen können mit Hilfe von Unterrichtsmethoden geschaffen werden, die den Lernenden Freiheitsgrade für eigene Entscheidungen einräumen bzw. eigene Entscheidungen und Verantwortungsübernahme von Unterrichtsmethoden sind beispielsweise (vgl. Wiechmann, 1999) - das Gruppenpuzzle und andere Kooperationsskripte, ihnen verlangen. Solche 47 - die Stationenarbeit, - die Wochenplanarbeit, - die Projektmethode, - das entdeckende Lernen und - die Freiarbeit. Entwicklung von Lernstrategien und Methodenkompetenz Die meisten der eben genannten Unterrichtsmethoden, die selbstgesteuertes Lernen erfordern, setzen auf Seiten der Lernenden bereits eine beachtliche Methodenkompetenz in Form effektiver Lernstrategien voraus. Eine Fähigkeit, die bei vielen dieser Unterrichtsmethoden eine zentrale Rolle spielt, ist das selbstständige Lernen mit Texten. Einige wichtige Kompetenzen, die beim Umgang mit Texten in den verschiedensten Inhaltsgebieten eine Rolle spielen, sind (Friedrich, 1995; Weinstein & Mayer, 1986): - Elaborative Lernstrategien, z.B. das eigene Vorwissen aktivieren (Schmidt, De Volder, De Grave, Moust & Patel, 1989), neue Information mit vertrauten Wissensbeständen (Beispielen, Analogien, Kategorien, Schemata) verknüpfen (Brooks & Dansereau, 1983; Mayer, 1988), sind bewährte Verstehensstrategien, die eine tiefe Verarbeitung neuer Information unterstützen und damit zumeist auch zum dauerhaften Behalten beitragen. - Reduktiv-organisierende Strategien, z.B. einen Text in wenigen Worten zusammenfassen (Friedrich, 1995b; Reder, 1985), Wissen in Form von Konzeptmaps, Begriffshierarchien u.a. Formaten darstellen (Jonassen, Beissner & Yacci, 1993; Eckert, 1999; Fischer & Mandl, 1999) erfordern ebenfalls einen aktiven Umgang mit Wissen und sind deshalb ausgesprochen verstehensund behaltensfördernd. - Metakognitive Strategien, welche die Lernenden darin unterstützen, ihre eigenen Verstehensprozesse zu planen, zu überwachen und zu kontrollieren. Hierzu gehört beispielsweise, sich vor dem Lernen inhaltliche Ziele zu setzen und deren Erreichung später zu überprüfen (Morgan, 1985), sich lernbegleitend oder nach dem Lernen Verständnisfragen zu stellen (Haller, Child & Walberg, 1988; King, 1991; Neber, 1999). 48 Die Bedeutung dieser Strategien für den Wissenserwerb wurde in vielen Untersuchungen zum Lernen mit Texten bestätigt (Ballstaedt, Mandl, Schnotz & Tergan, 1981; Kintsch, 1998; Schnotz, 1994). Die systematische Vermittlung von Lernstrategien in der Schule erfordert im Endergebnis eine gemischte Inhalts- und Prozessorientierung von Unterricht: Strategien werden zu einem Gegenstand von Unterricht wie andere Unterrichtsgegenstände auch. Inhaltsvermittlung wird dabei zugunsten der Vermittlung solcher Lernstrategien reduziert, die den späteren selbstgesteuerten Erwerb von Inhaltswissen unterstützen (Glaser, 1990). Dies bedeutet jedoch nicht, Inhaltsvermittlung durch Strategievermittlung zu ersetzen: Die Lernstrategien sollen nicht zum Selbstzweck werden, sondern Instrumente für den Erwerb von Inhaltswissen bleiben, die in der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Inhalt erworben werden. In schulorganisatorischer Hinsicht müssen im Hinblick auf einen solchen Vermittlungsansatz folgende Probleme gelöst werden (Friedrich, 1999): - Aus der Vielzahl der potenziell wichtigen Lernstrategien müssen jene ausgewählt werden, die in der betreffenden Schule systematisch vermittelt werden sollen. In der Regel werden es Strategien mittleren Allgemeinheitsgrades sein, also Strategien, die sich nicht in allen, aber doch in mehreren Fächern erfolgversprechend einsetzen lassen (z.B. Umgang mit Texten). - Es müssen Wege und Möglichkeiten für die Einarbeitung der Lehrenden in die Methodik der Vermittlung von Lernstrategien gefunden werden. Hier hat sich insbesondere die „direkte Instruktion“ bewährt, mit ihrem kontinuierlichen Übergang von eher gelenkten zu mehr selbstgesteuerten Aktivitäten (vgl. Boekarts, 1997; Friedrich, 1995; Grell, 1999; Winograd & Hare, 1988). - Die „Erstvermittlung“ der Lernstrategien muss organisiert werden, z.B. im Rahmen einführender Kurse zum Schuljahresbeginn (Klippert, 1998). - Schließlich muss die wiederholte Anwendung der Lernstrategien in verschiedenen Fächern, zu verschiedenen Zeitpunkten im Schuljahr und in verschiedenen Klassenstufen organisiert werden, damit die Strategien aufrechterhalten, ausgebaut und in verschiedenen Inhaltsgebieten angewendet werden. Hindernisse, die dem selbstgesteuerten Lernen in der Schule entgegenstehen: So berichten viele Lehrer von Misserfolgen, wenn sie selbstgesteuertes Lernen in den Klassen einführen: Dafür scheinen u.a. folgende Gründe in erster Linie verantwortlich zu sein: 49 • Schüler erhalten keine oder nur unzureichende Anleitung zum selbstgesteuerten Lernen; insbesondere wenn sie als Kinder nicht bereits schon im Elternhaus gelernt haben, sich eigenständig Ziele zu setzen, persönliche Interessen zu entwickeln und den Wissenserwerb nicht eigenverantwortlich zu organisieren, fehlt es dann in der Schule an Grundvoraussetzungen für ein selbstständiges Lernen. • In vorangegangenen Schuljahren haben sich Schüler an rezeptive Lernhaltungen gewöhnt; deshalb bevorzugen sie lehrerzentrierte Formen des Unterrichts; die Konsumentenhaltung ist verbunden mit einem Desinteresse an anspruchsvollen Denk und Lernstrategien. • Aber auch eine Prüfungspraxis, die sich weitestgehend an der Reproduktion gelernter Inhalte orientiert, fördert genau solche Tendenzen; Lerner begnügen sich mit minimalistischer passiver Wissensaufnahme und vermeiden die für das selbstgesteuerte Lernen erforderliche höhere Anstrengung. • Nicht zuletzt haben auch Lehrende Schwierigkeiten, den Unterricht in der Schule so zu gestalten, dass selbstgesteuertes Lernen angeregt wird; eher vertrauen sie auf herkömmliche Unterrichtsformen ihres Faches; aber auch ungünstige Rahmenbedingungen wie etwa Stofffülle, Kontrolle durch Schulleitung, hohe Zahl an Prüfungen etc. verhindern die Etablierung selbstgesteuerten Lernens in der Schule. Kognitive Fähigkeiten lassen sich nicht nur direkt über Unterricht und Trainings, über Beschäftigung mit kognitiv anspruchsvollen Aufgaben fördern. Eine weitere Form der Beeinflussung der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten kann indirekt über die Erhöhung der Bildungsorientierung im Elternhaus (Aufklärung, Elternarbeit) erfolgen. Vor allem bildungsferne Eltern sollten über den üblichen Elternabend hinausgehende Projekte stärker an Schulen gebunden werden (Eltern-Schule-Kooperation, Elternvereinbarungen). Elternberatung kann helfen, Freizeitbeschäftigungen von Kindern und Jugendlichen positiv zu beeinflussen. Zuletzt sollte die Förderung kognitiver Fähigkeiten – aus einer lebensspannenübergreifenden Perspektive - mit der Schul- und Ausbildungszeit nicht aufhören. Die Beschäftigung mit kognitiv anspruchsvollen Aufgaben in Beruf und Freizeit, eine Weiterbildung, das Lernen von Sprachen, die Einarbeitung in Computerprogramme, das Lesen von anspruchsvollerer Literatur und Zeitungen, die Suche nach kognitiv herausfordernden Problemen und deren Lösung sowie ein Interesse für kognitiv beanspruchende Themen fördern kognitive Fähigkeiten, Wissen und Expertise. Vor allem im Alter ist es wichtig, sich weiterhin kognitiven Herausforderungen zu 50 stellen, um Alterungsprozesse durch Strategien und Expertise ausgleichen zu können. Möglichkeiten hierfür stellen Volkshochschulen, Seniorenstudium oder ein reguläres Studium dar. Personen mit hohen kognitiven Fähigkeiten sind bei der Kompensation und Herauszögerung von kognitiven Alterungsprozessen im Vorteil (vgl. Weinert, 1992). Migration als eine spezifische Herausforderung für den Bildungskontext: Migration und sprachlich-kulturelle Vielfalt sind im Bereich der Bildung kein neues Phänomen, sondern durchzieht die gesamte Geschichte des 20. Jh. in Deutschland: So ergab bspw. eine Volkszählung von 1905, das etwa 12 % der Bevölkerung in Preußen in ihren Familien eine andere Sprachen als Deutsch (Dänen, Polen, Sorben, Tschechen etc.). Ab Mitte der 50-er Jahre hat diese Entwicklung mit der Anwerbung von „Gastarbeitern“ eine andere Dynamik bekommen. Lange Zeit, bis etwa Ende der 70-er Jahre wurde die Bildungsgeschichte von Migrantenkindern unter der Perspektive ihrer Rückkehr betrachtet und Bildungsanstrengungen betrafen nicht so sehr ihre Integration in das deutschen Schulleben, sondern eher die Reintegration in die Herkunftsländer; deshalb die Förderung der Rückehrfähigkeit durch Etablierung eines muttersprachlichen Unterrichts in der Schulen (Vgl. Krüger-Pontratz, 2006). Ab den 80-er Jahren findet ein Paradigmenwechsel von der „Ausländerpädagogik“ zur „interkulturellen Pädagogik“ statt, weil die Evidenz immer erdrückender wird, das auch in Zukunft Kinder mit Migrationshintergrund ein fester Bestand des deutschen Bildungssystems sein werden. Dennoch herrschen in Schulkontexten nicht selten eine kulturalistische bzw. kulturalisierende (d.h. Unterschiede in der Lebenswelt des Einzelnen auf seine bzw. auf die kulturellen Wurzeln der Eltern des Schülers) zurückführende, von einer Mitleidspädagogik geprägte Haltungen vor (Schanz, 2006). Da reichen auch einzelne Projekttage oder Projektwochen zum Thema „interkulturelles Zusammenleben“, in der dann die „Fremden“ im Mittelpunkt stehen, nicht aus; vielmehr ist auch Interkulturalität als Mainstream-Aufgabe zu verstehen. Der pädagogische Diskurs im Alltag von den „ausländischen Kindern“ erzeugt auf einer sprachlichen Ebene aufs Neue die Vorstellung, es handelt sich um „Fremde“, die nicht dazu gehören, obwohl vielfach die Kinder hier geboren sind und womöglich auch einen deutschen Pass haben. „Durch ihr Essen, ihre Folklore sollen sie auch einmal zeige können, was sie mitbringen. Die Erwartungen sind meist klar und auf die Ethnien als unbewegliche monolithische Blöcke fixiert: Döner und Pizza, Tarantella und Kreistänze, möglichst noch in Kostümen der alten Heimat. Werden hier nicht Kinder und Erwachsene, die längst dazugehören, erst zu Fremden gemacht? 51 (…). Durch differenzierende und auf Heterogenität hinweisende Antworten grenzt man sich ab. (Schanz, 2006, S. 112). Seit Ende der 90-er Jahre schwankt der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund um 9.5% bis 9.8% in allgemein bildenden Schulen. Zwar zeigt die Entwicklung, dass ihr Bildungserfolg angestiegen ist: so haben bspw. 1989/90 gerade mal 6.4% der Migrantenjugendlichen das Abitur geschafft; 2001/2002 waren es schon etwa 10%. Nach Geschlechtern aufgeteilt, zeigt sich sogar, dass Mädchen erfolgreicher sind als Jungen Allgemein kann eine steigende Bildungsbeteiligung bei fortdauernder Bildungsbenachteiligung festgehalten werden: Die Zahl der ausländischen Schüler ohne Abschluss ist vom 30 % zu Beginn der 80-er Jahre auf knapp 20% bei den männlichen und ca. 16% bei den weiblichen Jugendlichen mit MH (gegenüber 8.2% bei deutschen Jugendlichen) im Jahre 2001/2002 eindeutig gesunken Nach wie vor scheint jedoch der Übergang von der Grundschule auf ein Gymnasium eine entscheidende Hürde zu sein: dreimal so viele deutsche Kinder schaffe diesen Übergang im vergleich zu Kindern mit MH; je nach Bundesland ist die Widerholerrate bei Kindern mit MH dopplet oder viermal so hoch; fas doppelt so viele Jugendliche mit MH – im Gegensatz zu deutschen Jugendlichen verlassen die Schule mit nur einem Hauptschulabschluss: 40 % bei Migrantenjugendlichen gegenüber 24 bei deutschen Jugendlichen. Wenn man bspw. Pass und Herkunft trennt und eher vom Migrationshintergrund ausgeht, zeigen sich die deutliche Unterschiede: türkisch- und italienischstämmige mit deutschen Pass verlassen öfter die Schule mit Abitur als türkische und italienische Jugendliche mit dem Pass der Herkunft ihrer Eltern: 14.5 % türk. Jugendl. mit türk. Pass: 20.4% türkischstämmige Jugendliche mit deutschem Pass 21.9 % italien. Jugendl. mit italien. Pass: 35.% italienischstämmige Jugendliche mit deutschem Pass Die Bildungsnähe der Eltern, vorhandene bzw. fehlende Unterstützung im Elternhaus wirkten sich stärker auf die sprachliche Bildung der Kinder aus als die sprachlich-kulturelle Herkunft. Ein weiterer, für den pädagogischen Alltag bedeutsamer Unterschied war jedoch, dass im Vergleich zu italienischstämmigen die türkischstämmigen Jugendlichen eine geringeren Chance 52 auf eine erfolgreiche Bildungskarriere hatten; Gomolla und Radtke (2002) vermuten eine stärkere Diskriminierung von türkischstämmige Jugendlichen. Hierei wird häufig der Begriff der institutionellen Diskriminierung für die Erklärung der Benachteiligung/Misserfolg gebraucht. Der Begriff stammt aus der „Black Power“ Bewegung in den 60-er Jahren in den USA und meint, dass Diskriminierungsprozesse nicht nur auf der Ebene des Handelns von einzelnen Institutionen zu finden sind, sondern im organisatorischen Handeln bzw. Netzwerk wie etwa Arbeitswelt, Ausbildungsmarkt, Polizei, Wohnungsmarkt etc. Die Stoßrichtung der Kritik dort war, das in den zentralen gesellschaftlichen Institutionen die Interessen und Einstellung der „Weiße“ inkorporiert sind. Dabei wird in der Literatur zwischen direkter institutioneller und indirekter Diskriminierung unterschieden. Während die direkte Diskriminierung Prozesse des regelmäßigen intentionalen Handelns bezeichnet (z.B. Vorschriften Erlasse, die bestimmte Gruppierungen benachteiligen), wird mit indirekter institutioneller Diskriminierung auf die Bandbreite der institutionellen Vorkehrungen Bezug genommen, bei dem Angehörige bestimmte Gruppen, wie etwa ethnische Minderheiten, überproportional negativ betroffen sind. Dabei resultiert indirekte Diskriminierung häufig aus der Anwendung gleicher Regeln, wobei jedoch verscheiden Gruppen ungleiche Chancen zu ihrer Erfüllung haben. Prozesse institutioneller Diskriminierung sind in der Regel kaum direkt beobachtbar; sind oft normale Alltagskultur, Routine und Habitus von Institutionen und deshalb von den dort tätigen Professionellen kaum hinterfragbar (Gomolla, 2006). Als Gründe für Bildungserfolge bzw. Bildungsbenachteiligung werden auf Seiten der Schüler folgende Aspekte hervorgehoben: Verlauf des Migrationsprozesses, Sicherheit des Aufenthaltsstatus soziale Herkunft bzw. Sozialstatus im Aufnahmeland Bildungsbiografie der Eltern Gegenwärtiges Wohnumfeld der Familie. Andererseits sind die Gründe des Scheiterns nicht nur auf der Schülerseite zu sichern, sondern auch in den Institutionen: denn im internationalen Vergleich zeigt sich, dass Zuwandererkinder mit einer ähnlichen Migrationsgeschichte in Ländern mit einer weniger selektiv ausgerichteten, 53 z.B. in einigen Bundesländern bereits nach der 4. Klasse erfolgenden, Bildungsstrukturen und besseren Unterstützungssystemen deutlich bessere Schulleistungen erzielen. Darüber hinaus wird bildungspolitisch gefordert, dass die Institution Schule sprachlich-kulturelle, ethnische und nationale Pluralität im Bildungswesens als eine Normalität anerkennen müsse und die Orientierung an einer homogenen Schülerschaft, bei der Heterogenität als Abweichung fungiert, aufgebe müsse (Vgl. Krüger-Potratz, 2006). In einer europäischen Vergleichsstudie hat bspw. Allemann-Ghinda (1999) Schulen in vier europäischen Staaten nach ihrem Umgang mit Schülern mit Migrationshintergrund untersucht: in Deutschland, Schweiz, Frankreich und Italien. Im einzelnen fokussierte sie auf Berücksichtigung der Herkunftssprachen, Maßnahmen für neu zugezogenen Schüler, den Umgang mit Wertkonflikten, die Zweitsprachdidaktik und Lehrerfortbildungen. Im Ländervergleich zeigte sich, dass sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz die Förderung von Migrantenkindern ungünstiger war; es herrschten eher separierende Formen der Beschulung vor; eine Binnendifferenzierung der Schulen – wie etwa bilinguale Unterrichtsformen - war gering ausgeprägt. So hat Schanz bspw. die Erkenntnisse in einer Modellschule in Hannover, die interkulturelle Bildung in die Schulentwicklung zu implementieren versucht hat, systematisch zusammenzustellen: Folgende Prozesse bzw. Aspekte ließen sich dabei identifizieren: 1. Zunächst bedarf es einzelner oder einer Gruppe, das Kollegium von den Chancen eines Aufbruchs in der Schule zu überzeugen. 2. Einbeziehung einer Beratung von außen, die den Prozess langfristig begleitet. 3. Entwicklung einer Dialog- und Konfliktkultur im Kollegium, um sich darüber zu verständigen, was denn eine „gute interkulturelle Schule“ ist. 4. Implementierung der interkulturellen Bildung in die einzelnen Unterrichtsinhalte. 5. Kontinuierliche Unterstützung des Prozesses durch interne und externe Fortbildung. 6. Einbeziehung der Eltern, insbesondere der Eltern mit MH. 7. Öffnung der Schule nach innen (Unterrichtsinhalte, andere Lehrmethoden etc.) sowie nach außen (Dialog mit der Kommune). 54 Ein generelles Problem in Schulen bildet folgendes Dilemma: Eine Vermeidung von Stereotypisierungen führt gelegentlich dann zu einer Differenzblindheit, wenn etwa Lehrer aus einer trivialen Universalismus meinen: „Ich nehme jeden so, wie er ist. Ich mache keinen Unterscheid. Kinder sind Kinder.“ Denn in der Tat starten aber nicht alle mit gleichen Ausgangschancen die Schullaufbahn. Gegenwärtig erlaubt jedoch der Pass keinen Rückschluss auf pädagogisch-relevante Sachverhalte wie etwa auf die sprachliche Sozialisation und Sprachkompetenz des Kindes aber auch zum soziokulturellen Hintergrund (Aussiedler, die als deutsche gelten, aber kein deutsch sprechen; hier geborene Migrantenkinder, die einen deutschen Pass haben, aber in ihre Familien weitestgehend die Sprache ihrer Eltern, was nicht unbedingt die Amtssprache des Herkunftslandes sein muss, so z.B. kurdisch sprechende Kinder aus der Türkei, sardisch sprechende Kinder aus Italien, katalanisch sprechen Kinder aus Spanien, berberisch sprechende Kinder aus Marokko etc.) sprechen). Man versucht nunmehr, diesen Umstand mit Zusätze wie etwa „Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund“ zu spezifizieren. In den Niederlanden wird z.B. versucht, schon beiden Schülerdaten Geburtsort der Eltern und die Sprachpraxis in den Familien mit aufzunehmen, um Schülerleistungen angemessener beurteilen zu können. Welche Formen der sprachlichen Vielfalt existieren können, zeigt z.B. einen an einer Hamburger Grundschule durchgeführte Untersuchung (Fürstenau, Gogolin & Yagmur, 2003), in der ca. 100 verschiedene Familiensprache gezählt werden konnten, die die Schüler in die Schule mitbringen; darunter waren 20 Sprachen, die von 90 % der zweisprachig oder mehrsprachig aufwachsenden Schüler genannt wurden. Bildungspolitisch wichtig ist die Frage, wieweit die Institution Schule diese Vielfalt und diesen Reichtum wertschätzen kann und in der Praxis wertschätzt. In einer Zusammenfassung der Ergebnisse von vier Studien zu der Frage, in wie weit pädagogische Haltungen oder Umgangsweisen mit interkulturellen Situationen in der Schule verbreitet sind, findet Auernheimer (2006) folgende problematische Charakteristika: • Fixierung auf fremde „Mentalitäten“ oder „Sitten“: kulturdeterministisches Weltbild • Differenzblindheit • generalisierte Erklärungen für fremdartiges Verhalten 55 • pauschaler Fundamentalismusverdacht (bei Schülerinnen mit Kopftuch Verdacht auf patriarchale und von Zwang geprägte Familienstrukturen) • Infantilisierung von Migranteneltern; Paternalismus, Mitleid (Einschätzung nichtdeutscher Eltern als defizitär, rückständig und unmündig) • barsche Forderung nach Assimilation („Es ist durchaus notwendig, dass man diesen Eltern mal ganz rabiat bewusst macht, rabiat in Anführungszeichen,was ich von ihnen erwarte, was sie gefälligst zu tun haben und was ihre Pflicht ist“ (Marburger, 1997) • folgenlose bzw. ausgrenzende „Toleranz“; Anerkennen, dass Migranteneltern andere Erwartungen und Wünsche haben, aber keine Bereitschaft, in irgendeiner Weise diese Wünsche in Erfüllung zu bringen. • Tendenz zu zivilisatorischer Mission • keine Infragestellen eigener Wahrnehmungs- oder Bewertungsmuster • kein Eingeständnis eigenen Befremdens Fördermöglichkeiten: Resilienzförderung Nach den vielfältigen Risiken, denen Migrantenjugendliche ausgesetzt sind, ist die Frage zu stellen, welche Resilienzfaktoren es im Leben von Migrantenjugendlichen gibt, was sie trotz der Risiken, denen sie ausgesetzt sind, stark macht bzw. vor normabweichender Entwicklung schützt. Begrifflich beschreibt Resilienz einen dynamischen oder kompensatorischen Prozess positiver Anpassung angesichts bedeutender Belastungen (Holtmann & Schmidt, 2004). Resilienzfaktoren stärken also die psychische Widerstandsfähigkeit von risikobelasteten Kindern; sie erklären, wie bspw. trotz elterlicher Risiken wie Arbeitslosigkeit, Armut, Drogenabhängigkeit, psychotischer Erkrankungen, Scheidung etc. ein Teil der von diesen Risiken betroffenen Kinder dennoch relativ erfolgreich ihr Leben meistern bzw. wie sie dennoch einen hohen Grad an Widerstandskraft und Robustheit entwickeln. 1. Eindeutig zeigt die Forschung, dass die in den ersten beiden Lebensjahren etablierte sichere Mutter-Kind Bindung eine bedeutsame Entwicklungsressource darstellt (Scheithauer, Petermann & Niebank, 2000). Dieser Befund sollte in Erziehungs- und Familienberatungsstellen, Jugendämtern etc., insbesondere gegenüber Migrantenfamilien und -müttern stärker kommuniziert werden; Migranteneltern sollten davor gewarnt werden, 56 ihre Kinder je nach ihrer gegenwärtigen ökonomischen Situation im Herkunftsland bei Verwandten zu belassen, sie dort zu „parken“, um sie dann wieder zu sich zu holen, wenn sie sich ökonomisch erholt Entwicklungsgesetzlichkeiten, haben. Vielfach Entwicklungstempo und fehlt ein sensible Wissen Phasen in um der Entwicklung des Kindes. Denn die Auswirkungen unsicherer Bindung bleiben nicht auf die Kindheit begrenzt, sondern sind auch in der Jugendphase wirksam. Unsicher gebundene Jugendliche zeigen weniger Ich-Flexibilität, ein negatives Selbstkonzept, stärkere Hilflosigkeit und Feindseligkeit (Seiffge-Krenke & Becker-Stoll, 2004). 2. In der pädagogischen Praxis kann auch über die Verbesserung der Erziehungsqualität der Eltern resilienzfördernde Wirkungen erzielt werden; so etwa, wenn dem Kind systematisch beigebracht wird, eine aktive Problembewältigung zu betreiben, d.h., es dazu angehalten wird, bei auftretenden und mit eigenen Kompetenzen lösbaren Problemen diese nicht zu verleugnen oder zu vermeiden, sondern aktiv auf diese zuzugehen. Dadurch kann eher das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also das Gefühl der eigenen Kontrolle über die Entscheidungen, erworben werden. Das kann wiederum durch den systematischen Einbezug des Kindes in Entscheidungsprozesse und durch die Verantwortungsübernahme des Kindes gefördert werden. Auch hier gilt es, Migranteneltern die Bedeutung des Einbezuges des Kindes in familiale Entscheidungsprozesse zu verdeutlichen. 3. Eine Reihe von Studien zeigt, dass ein positives Schulklima eine fördernde und schützende Wirkung hat, insbesondere wenn eine gute Beziehung zum Lehrer vorhanden ist, den die Schüler als an ihnen interessiert und sie herausfordernd wahrnehmen (Wild, Hofer & Pekrun, 2006). An diesen Befund anknüpfend, lässt sich folgern, dass eine Verbesserung des Schulklimas und mehr persönliches Engagement der Lehrkräfte mit Migrantenkindern resilienzfördernd wirken. Vor allem ein Schulklima, das die kulturelle Vielfalt ihrer Schüler als Bereicherung und nicht als Hemmnis betrachtet, kann einen Beitrag zur Resilienz leisten, weil dadurch dem Einzelnen das Gefühl von Wichtigkeit, Bedeutung und Anerkennung gegeben wird (Speck-Hamdan, 1999). 4. Zusätzlich gilt es in Schulkontexten, Migrantenjugendliche noch stärker in verantwortungsvolle Positionen - ungeachtet ihrer möglicherweise geringeren sprachlichen Kompetenzen - einzubinden. Sie werden sich dann stärker mit der Aufgabe identifizieren, 57 womit die inneren Bindungen zur Schule gestärkt werden, und sie machen dadurch Erfahrungen der Nützlichkeit und der Selbstwirksamkeit. 5. Des Weiteren ist bei Migrantenjugendlichen mit schlechten Schulleistungen an die Befunde der pädagogischen Psychologie zu Bezugsnormorientierung anknüpfend, ratsam, ihre Leistungen nicht nur an einer sozialen Bezugsnorm – meistens die gleichaltrige deutsche Altersgruppe in der Klasse – zu messen. Denn dann spüren sie, dass sie trotz Anstrengungen vielfach nicht die erforderlichen Leistungen bringen und sind eher geneigt, zu resignieren. Förderlicher ist es dagegen, die individuellen Entwicklungsschritte und Verbesserungen zu berücksichtigen und diese dann zu würdigen (Rheinberg, 2006). Schule darf nicht nur der Ort der von Versagenserfahrungen sein, sondern muss Migrantenjugendlichen Gelegenheiten bieten, auch eigene Stärken zur Geltung kommen lassen können. 6. Ferner kann sich, was Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund betrifft, das „symbolisch-kulturelle Kapital“, das sie mit ihrer Mehrsprachigkeit haben, (vorausgesetzt, sie sprechen beide Sprachen relativ gut) als ein wichtiger Schutzfaktor dienen. Deshalb könnten auch hier Förderaspekte ansetzen, wie etwa die Förderung der Muttersprache, weil Mehrsprachigkeit indirekt Ressourcen erweitert und Kinder und Jugendliche weniger vulnerabel macht. Die gelegentlichen Forderungen in Kitas oder Schulen, mehr oder ausschließlich Deutsch zu sprechen, „verschenken“ dieses Kapital. Exkurs: Bilingualismus als Chance: (Vgl. Uslucan, 2005) Bilingualismus Sprache ist das vorzügliche Medium, mit dessen Hilfe sozialisierende Vorgänge eingeleitet und vermittelt, soziale Wirklichkeiten konstruiert und in sprachlichen Inhalten internalisiert werden. Die Sprache spielt eine entscheidende Rolle in der Identitätsbildung. Denkt man die sprachliche Sozialisation aus der Perspektive des symbolischen Interaktionismus, so entwickelt sich in der Interaktion mit Anderen stets auch eine soziale Orientierung, da sprachliche Symbole auch mit spezifischen Bedeutungen assoziiert werden. Durch Verwendung sprachlicher Symbole werden in den Individuen gleiche Reaktionen wie beim Kommunikationspartner ausgelöst (Mead, 1934), womit unbewusst auch stets Normen und Werte verinnerlicht werden. Spracherwerb geschieht also stets in einem kulturellen Umfeld. Das Symbolsystem einer Sprache lässt sich daher nicht 58 ohne die spezifischen Einstellungen des dazugehörigen sozialen Umfeldes übernehmen und Sprache gilt sowohl in der Selbst-, wie in der Fremdzuschreibung als ein wichtiges Kennzeichen ethnischer bzw. kultureller Identität (Fthenakis, Sonner, Thrul & Walbiner, 1985). Besonders in bikulturellen Kontexten, in denen zugleich auch mindestens zwei Sprachsysteme für die Individuen relevant werden, wird der Zusammenhang zwischen Bikulturalität und Bilingualität evident. Für Migranten bietet sich mit einer auf Dauer angelegten Migration die einmalige Chance, in einem natürlichen Kontext bilingual aufzuwachsen bzw. ein bilinguales Leben zu führen. Dabei ist mit Bilingualismus nicht nur die Fähigkeit gemeint, sich in zwei Sprachen verständlich zu machen bzw. zwei Sprachen zu beherrschen, sondern auch die Fähigkeit des Individuums, sich mit den beiden beteiligten Sprachgruppen zu identifizieren. 1 Gute Sprachkompetenzen sind eine Ressource, schwache dagegen langfristig ein Vulnerabilitätsfaktor gegenüber Akkulturationsstress. So konnte Jerusalem (1992) in seiner Untersuchung mit türkischen Jugendlichen feststellen, dass nicht die Aufenthaltsdauer allein, sondern vielmehr die Sprachkompetenz mit einem höheren Akkulturationsniveau einherging; höhere Sprachkompetenzen reduzierten interethnische Spannungen, ermöglichten eine differenzierte Selbstdarstellung und erleichterten dadurch die soziale Akzeptanz. Dagegen erwies sich eine lange Aufenthaltsdauer mit schlechter Sprachbeherrschung kontraproduktiv; denn dann stieg die Belastung mit zunehmendem Aufenthalt. "Mitglied einer ethnischen Minderheit zu sein und gleichzeitig durch sprachliche Schwierigkeiten beeinträchtigt und sozial isoliert zu werden, ist längerfristig vermutlich besonders selbstwertbedrohlich und einsamkeitsfördernd." (Jerusalem, 1992, S. 23). Die Chancen, die sich durch Bilingualismus ergeben, sind nicht auf Wortschöpfungen begrenzt, die durch Code-Switching entstehen, nur den bikulturell Sicheren zugänglich sind und eine offensichtliche Form der Bereicherung darstellen, die der monolingualen Mehrheits- wie auch der Minderheitskultur entgeht, sondern mit Bilingualismus gehen auch gut belegte und nachvollziehbare kognitive Potenziale einher. 2 So zeigen eine Reihe von empirischen Studien, 1 Der Begriff des Bilingualismus bzw. der Zweisprachigkeit ist problematisch: Werden nur jene Menschen als zweisprachig bzw. bilingual bezeichnet, die beide Sprachen vollkommen und fehlerfrei beherrschen, dann gibt es kaum Zweisprachige; wird jedoch die Definition dahingehend aufgeweicht, dass als bilingual alle jene Menschen zu bezeichnen sind, die eine zusätzliche Sprache verstehen und in ihr auch einige kommunikative Akte vollziehen können, dann sind wieder enorm viele Menschen (in Deutschland alle, die einige Worte Englisch in der Schule gelernt haben) als zweisprachig zu bezeichnen. Bei Migrantenkindern oder Kindern aus bikulturellen Ehen ist eher von einer „natürlichen Zweisprachigkeit“ (Kielhöfer & Jonekeit, 1983), die die Kinder in ihren gewohnten ökologischen Kontexten erwerben, zu sprechen, um diese von der bewußt gelernten zweiten Sprache, etwa, wenn ein Deutscher in Deutschland aktiv Französisch lernt, besser abheben zu können. 2 Dieser begriffliche Gegensatz von monolingual vs. bilingual ist im Alltag nicht durchzuhalten und sollte zugunsten eines Kontinuums aufgelöst werden; denn jede monolinguale Person verfügt mehr oder weniger auch über andere Sprachvarietäten (etwa Dialekte, Soziolekte etc.). 59 dass bilinguale Personen sowohl im Bereich der allgemeinen Intelligenz als auch in den kognitiven Stilen und den metalinguistischen Fähigkeiten sich monolingualen überlegen erweisen (Bialystok, 1988; Clarkson & Galbraith, 1992; Baker, 1993). Bilingual erzogene Kinder neigen weniger dazu, Begriff und Referent zu verwechseln, d. h. die Differenz zwischen Wort und Gegenstand ist ihnen eher gegenwärtig, weil sie durch ihre Zweisprachigkeit eher eine gewisse Distanz zu der eigenen und der erworbenen Sprache entwickeln und erkennen, dass sprachliche Symbole für die Bezeichnung von Gegenständen auswechselbar sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass im Leben von bilingual aufwachsenden Kindern ein doppelter sprachlicher Input ihre metasprachlichen Fähigkeiten fördert, so z. B. die oben erwähnte Einsicht in die Arbitrarität (Willkürlichkeit) des Zeichens erleichtert und insgesamt dem Abstraktionsvermögen zugute kommt. Cummins (1976, 1979 in Tracy & Gawlitzek-Maiwald, 1999) versuchte eine Präzisierung durch Formulierung eines Schwellenmodells, in dem die Frage des Eintritts in den Zweitspracherwerb diskutiert wird. Er vertritt die These, dass ohne eine etablierte Kompetenz in der Muttersprache ein Zweitspracherwerb nicht vollständig erfolgen könne, bzw. ab einem gewissen Alter nur noch mit einem subtraktiven Bilingualismus, d.h. mit unzureichenden Kenntnissen in beiden Sprachen, zu rechnen sei (Cummins, 1979 in Tracy & Gawlitzek-Maiwald, 1999). An diese Befunde anknüpfend ist also die Frage zu stellen, unter welchen Bedingungen Bilingualität eher als eine Chance genutzt werden kann. Empirische Studien zum Zweitspracherwerb zeigen, dass diese phonologisch dann korrekt erworben wird, wenn mit ihrer Aneignung vor dem Alter von elf Jahren begonnen wird. Bei dieser Konstellation ist eher ein akzentfreier Erwerb zu erwarten, was die Voraussetzung einer gelungenen sprachlichen Integration darstellt. Im Alter von 11 bis 15 Jahren war häufiger ein Akzent anzutreffen und beim Zweitspracherwerb nach dem Alter von 15 Jahren waren Akzente die Regel. Daraus kann abgeleitet werden, dass zumindest ein Spracherwerb im frühen Alter die beste Voraussetzung einer Integration darstellt (Mägiste, 1985). Grundschüler im Alter von sechs bis elf Jahren erwerben in deutlich kürzerer Zeit den aktiven Wortschatz einer fremden Sprache als Schüler der Oberstufe im Alter von 13 bis 19 Jahren. Spontaneität und Kontaktbereitschaft sind vermutlich im jüngeren Alter deutlich größer, wodurch mehr Kommunikationssituationen entstehen, die wiederum bei den Beteiligten zu Sprechanlässen und zur Performanz bisheriger Kompetenzen führen und die Motivation für den weiteren Erwerb steigern (Kuhs, 1989). Konsistent ist der Befund, dass eine elaborierte Kenntnis der Muttersprache eine grundlegende Voraussetzung bildet, um eine fremde Sprache grammatikalisch korrekt zu erwerben (Cummins, 1979; Fthenakis, Sonner, Thrul & Walbiner, 1985; Kuhs, 1989). Für eine Vielzahl von Migrantenkindern gilt jedoch, dass sie ihre Muttersprache in vielfachen Interaktionen mit ihren 60 Eltern erwerben, die ihrer eigenen Sprache aufgrund ihrer Bildungsdefizite nicht sehr mächtig sind und somit deutlich schlechtere Chancen haben, auch die deutsche Sprache grammatikalisch korrekt zu erwerben. Diese mangelhafte Kompetenz der eigenen Muttersprache kann dazu führen, dass von den Kindern vermehrt Bestrebungen unternommen werden, diese Lücke mit einer „Überanpassung“ an die neue Kultur zu kompensieren und bspw. aus dem Wissen um Lücken in der Muttersprache auch dann die Zweitsprache verwenden, obwohl sie den Sachverhalt hätten auch in ihrer Muttersprache kommunizieren können. Semilingualismus ist aber auch typisch für Migranten in Situationen erlebter Diskriminierung und Identitätskonflikte und stellt nicht immer ein individuelles Defizit dar (Toukomaa & SkutnabbKangas, 1977). Gerade erfahrene Diskriminierungen dürften die Motivation und die Bereitschaft, positive Einstellungen zur Mehrheitskultur zu bilden und die Sprache der Mehrheitskultur zu erwerben, eher mindern. Positive Auswirkungen auf den Zweitspracherwerb haben dagegen eine ausgeglichene Haltung zur eigenen und eine ausgeglichene Haltung zur Zweitsprache. Eine ablehnende Haltung zur Fremdsprache, aber auch eine die eigene Sprache ablehnende oder eindeutig die Fremdsprache favorisierende Haltung dagegen mindert eher den Lernerfolg in der Zweitsprache bzw. zeigt nicht den erwarteten Lernerfolg (Kuhs, 1989). Eine Diskriminierung kann bereits darin liegen, dass Sprachkompetenzen von Migranten, die sie nämlich in der eigenen Sprache haben, eine systematische Nicht-Anerkennung als Kompetenz erfahren; bei Migrantenkindern im pädagogischen Alltag ihre Kommunikation in der Sprache ihrer Eltern systematisch abgewertet und als störend für den Erwerb der Sprache der Mehrheitskultur betrachtet wird. Problematisch vor diesem Hintergrund ist daher auch die gelegentlich im Alltagsdiskurs geäußerte Empfehlung, Migrantenkinder sollten zu Hause mit ihren Eltern deutsch sprechen, um ihre Kompetenzen besser auszubilden. Denn in der Regel macht das Kind seine ersten sprachlichen Erfahrungen in der Muttersprache, lernt seine Erlebnisse und Gefühle in dieser Sprache mitteilen. Diese Sprache ist ein elementarer Teil seiner Identität; sie also bewusst ablehnen oder leugnen zu müssen, belastet zum einen die Eltern-Kind-Beziehung, weil beide Sprachen durch beide Seiten nicht elaboriert beherrscht werden, dadurch also geringe sprachliche Interaktionen zu erwarten sind, zum anderen wirkt sich das negativ auf das Selbstwertgefühl des Kindes aus, weil ein Aspekt der eigenen Identität abgelehnt wird. Viel wichtiger ist es, dass das Kind seine Muttersprache gut und solide erwirbt und dass seine Muttersprache im Alltag auch eine Anerkennung findet. Bilingualität als Ressource wird nicht nur durch soziale Konfliktlagen, sondern auch durch sprachinterne Eigentümlichkeiten erschwert: So ist in der Kindheit eher mit Schwierigkeiten zu rechnen, wenn zu große strukturelle Ähnlichkeiten in den beiden Sprachen, wie etwa zwischen der 61 deutschen und der englischen, vorhanden sind. Gibt es zu viele „Grauzonen“, partielle Überlappungen, wie etwa phonologische Ähnlichkeiten bei bedeutungsverschiedenen Partikeln wie etwa „up“ vs. „ab“, „auf“ vs. „off“, "an" vs. "on" etc., so kann sich das als hemmend für den Erwerb der Zweitsprache auswirken (Tracy & Gawlitzek-Maiwald, 1999, S. 526). Vor diesem Hintergrund scheint eine Sprachdistanz für den Zweitspracherwerb günstiger zu sein. 7. Schulprojekte wie „Großer Bruder“, „Große Schwester“, wie sie exemplarisch vom deutsch-türkischen Forum in Stuttgart durchgeführt werden (dort ist das Projekt unter der türkischen Bezeichnung „Agabey-Abla-Projekt“ aufgeführt), bei denen kompetente ältere Jugendliche Risikokindern (Kindern aus chaotischen, ungeordneten Elternhäusern, Elternhäusern mit psychischer Erkrankung der Eltern etc.) zugeordnet werden und Teilverantwortungen für sie übernehmen, haben resilienzfördernde Wirkung. Diese „Brüder“ oder „Schwester“– werden - im Gegensatz zu den Eltern, die in diesen Konstellationen nicht als Vorbilder taugen - zu positiven Rollenvorbildern und können wünschenswerte Entwicklungen stimulieren. 8. Nicht zuletzt haben sich auch so genannte „Rucksackprojekte“, die bspw. von der „Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien“ (RAA) durchgeführt werden, bei denen Mütter und Kinder gemeinsam in Bildungsprozesse einbezogen sind, als integrationsförderlich bewährt. Diese zielen zum einen auf eine Förderung der Muttersprachenkompetenz, aber zugleich auch auf die Förderung des Deutschen und bei Müttern auf die Förderung der Erziehungskompetenz ab. Denn insbesondere die Integration der Mütter ist für die Frage der intergenerativen Weitergabe von Gewalt ein entscheidendes Merkmal: so konnten Mayer, Fuhrer & Uslucan (2005) zeigen, dass bei einer gut integrierten (türkischen) Mutter sowohl die Weitergabe der selbst als Kind erfahrenen Gewalt abgepuffert wurde und auch dass die Kinder dieser Mütter weniger in Gewalthandlungen verwickelt waren. 9. Gleichwohl diese Projekte keine näheren Angaben zu der Form ihrer Evaluationen machen, so berichten sie von hohen Zufriedenheitsraten (etwa bis zu 77%) seitens der Teilnehmer; beispielsweise. von deutlich gestiegenen persönlichen Kompetenzen der Erziehungsfähigkeit, der Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktionen und der Verbesserung der Deutschkenntnisse von Müttern und Kindern sowie eine Zunahme der Lernfreude der Kinder (vgl. http://www.raa.de/rucksack.html) 62 Als Fazit lässt sich schlussfolgern, dass Migrantenjugendliche nicht nur Risiken für die Mehrheitsgesellschaft darstellen und Defizite haben, sondern sie auch oftmals nicht beachtete Stärken aufweisen. Gerade die Resilienzforschung stellt hier einen wichtigen Ansatz dar, wie Entwicklungspfade dennoch positiv beeinflusst werden können, wenngleich natürlich dadurch die Risiken selbst nicht aus dem Weg geräumt werden, da Resilienzfaktoren indirekt, als Moderatoren der Beziehung zwischen Krisen und Verhaltensauffälligkeiten wirken. Zuletzt gilt es, für pädagogische Kontexte zu berücksichtigen: Gerade wenn Migranten und Jugendliche mit Migrationshintergrund unter einer höheren Anzahl bzw. an intensiveren Risiken leiden, wie es offensichtlich in vielen Studien deutlich wird (vgl. Uslucan, 2005a, b), dann müsste auch eine ganz „normale“, unauffällige Lebensführung von Migrantenjugendlichen zunächst erklärungsbedürftig sein. Deshalb gilt es, nicht nur die positiven Fälle hervorzuheben, sondern auch die Anstrengungen „zur Normalität“ bei den „Unauffälligen“ besonders zu honorieren und anzuerkennen. Denn gelungene Integration geschieht vielfach „unauffällig“. 63 Erziehungsstile: Parenting Style as Context: An integrative Model (Darling & Steinberg, 1993): Differenzierung in drei Aspekten notwendig: Erziehungsziele: Im Hinblick auf welche Ziele soll die Sozialisation des Kindes erfolgen? Erziehungspraktiken: Welche Praktiken gebrauchen Eltern, um diese Ziele zu erreichen? Erziehungsstil: Der Kontext, das emotionale Klima, in dem Erziehung stattfindet. Darling & Steinberg plädieren dafür, Erziehungsstile nicht als inhaltliche Spezifika zu verstehen, sondern als den Kontext, indem Erziehung statt findet. Erziehungsstile als eine Konstellation von Einstellungen zum Kind und die Herstellung eines emotionalen Klimas, indem das elterliche Verhalten ausgedrückt wird. Eltern können dieselben Ziele sehr technisch und nüchtern, emotionsarm, oder in einem warmen, emotional zuträglichem Klima verfolgen. „Parenting styles“ sollten deshalb das Milieu beschreiben, in dem elterliche Erziehung erfolgt. 3 Komponenten der Parenting styles: 1. Emotionale Beziehung zwischen Eltern und Kind 2. Elterliche Praktiken und Verhalten 3. Überzeugungssysteme der Eltern. Sozialisation in der Tradition von Baumrind: Einerseits das Kind in Übereinstimmung bringen mit den Anforderungen anderer; andererseits auch : Erhalt der persönlichen Integrität des Kindes. Der ausgeübte Erziehungsstil verändert seinerseits die Bereitschaft des Kindes, sich erziehen zu lassen bzw. sich elterlichen Einflüssen gegenüber zu öffnen. Gleichwohl immer wieder zu unterstreichen ist, dass Kinder uns Jugendliche auch Gestalter ihrer eigenen Entwicklung sind, indem sie auf Eltern Einfluss nehmen und so auch die Erziehungsstile und Haltungen der Eltern beeinflussen. Zwar ist Konsens in der erziehungspsychologischen Literatur, dass eine autoritative Erziehung kompetente Kinder „hervorbringt“, die genauen Mechanismen sind jedoch nicht ganz eruiert. Maccoby and Martin (1983) haben die ursprüngliche Typologie von Baumrind dahingehend differenziert, dass sie zwei Dimensionen ausfindig machen: 1: Anzahl und Typ elterlicher Anforderungen an das Kind und 2: Elterliche Verstärkung, Zuwendung Autoritative Eltern sind demnach hoch in Anforderungen und Zuwendung (demandingness and responsiveness); autoritäre Eltern dagegen hoch in den Anforderungen und gering in der 64 Zuwendung; gewährende Eltern wiederum niedrig in den Anforderungen und hoch in der Zuwendung und vernachlässigende niedrig auf beiden Komponenten. Anforderungen wurden später bei Baumrind noch einmal in differenziert: Verhaltenskontrolle und psychische Kontrolle. Autoritative wie autoritäre Eltern haben beide eine hohe Verhaltenskontrolle, jedoch kommt bei autoritären Eltern auch eine hohe psychische Kontrolle (Angsterzeugung, Liebesentzug etc.) hinzu. Sie sind restriktiver als autoritative Eltern. 5 Erziehungsstile Offenheit des Kindes, sich zu erziehen zu lassen 1 Erziehungsziele und Werte der Eltern 4 6 2 Erziehungspraktiken 3 Erziehungsstile wirken also als Moderatoren, die die kindliche Auswirkungen elterlicher Erziehung Beziehung von elterlichen Erziehungspraktiken und kindlichen Auswirkungen beeinflussen; auch die Variable, „Offenheit des Kindes“, beeinflusst die Beziehung, inwiefern elterliche Praktiken die gewünschten Auswirkungen zeitigen. Insofern haben elterliche Erziehungsstile eine eher indirekte Wirkung auf die kindliche Entwicklung. Kultureller Kontext der Erziehungsstile: Dornbusch et al. (1987) und Steinberg et al. (1991) konnten nachweisen, dass der Zusammenhang zwischen autoritativer Erziehung und Schulleistung deutlich stärker in europäischen Familien war, jedoch schwächer ausgeprägt war bei asiatischen oder afroamerikanischen Jugendlichen. Auch denkbar ist, dass der autoritative Erziehungsstil zwar über alle Kulturen hinweg gleichermaßen effektiv ist, sich jedoch die Erziehungsziele unterscheiden und deshalb andere Auswirkungen bei der kindlichen Entwicklung hervorbringen. 65 Auch variieren – historisch stets sich wandelnde- elterliche Erziehungspraktiken mit den Entwicklungsgegebenheiten des Kindes, wie etwa dessen Alter; kleine Kinder brauchen vielmehr Kontrolle und Überwachung; bei Jugendlichen ist dagegen die Förderung der Autonomie wichtiger (Darling & Steinberg, 1993, p.495). Erziehung im Spannungsfeld zwischen Eigenem und Fremdem Im Folgenden möchte ich mich den Hintergründen der besonderen Sozialisationsbedingungen von Migrantenkindern und -jugendlichen widmen, die generellen Mechanismen und Probleme des Akkulturationsprozesses benennen und einige Aspekte zugleich exemplarisch an der Gruppe der türkischen Migranten näher veranschaulichen. Die Einschränkung auf die türkischstämmige Population folgt inhaltlichen Kriterien: Mit über zwei Millionen Mitgliedern stellt sie die größte ethnische Minderheit innerhalb der rund sieben Millionen zugewanderter Menschen dar. Vielfach entwickeln Familien türkischer Herkunft in der Aufnahmegesellschaft einen stärker behütenden und kontrollierenden Erziehungsstil als Familien in der Türkei, weil sie die rasche Akkulturation (Erwerb der relevanten Verhaltensaspekte der Fremdkultur) ihrer Kinder als eine Entfremdung von ihren herkunftskulturellen Bezügen deuten; denn die Kinder ihrerseits sehen sich unter dem Druck, sich in der schulischen Sozialisation rasch an die Kultur des Einwanderungslandes zu akkulturieren, verlieren aber gleichzeitig ihre sozialisatorischen Bindungen an ihre Herkunftskultur. Das Verhalten der Eltern läßt sich daher als eine Reaktion auf eine als gefährdend wahrgenommene Migrationssituation verstehen. Gleichzeitig bilden Kinder für ihre Eltern ein Medium der Vermittlung der neuen Kultur bzw. eine „Brücke“ zwischen der Kultur des Herkunfts- und des Einwanderungslandes, wodurch sie mehr und mehr das Privileg bekommen, an Informationen heranzukommen, die für sie sonst nicht zugänglich wäre. Damit ergibt sich aber innerhalb der Familie eine Umkehrung der familialen Hierarchien innerhalb der Generationen, die den üblichen Rollenerwartungen entgegengesetzt ist, weshalb aus der Perspektive der Eltern sie mehr und mehr ihre Autorität gefährdet sehen. Beispielhaft sind hierfür türkische Kinder, die vielfach Übersetzerdienste für ihre Eltern leisten müssen. Bidirektionale Sozialisationsverläufe, bei denen also Kinder ihre Eltern "sozialisieren", sind bei Migrantenfamilien ein häufig anzutreffendes Phänomen. Den Studien von Nauck (1990) zufolge ist erzieherisches Verhalten türkischer Eltern wesentlich vom Ausbildungsniveau der Eltern determiniert. Je länger die Schulbildung der Eltern war, desto weniger waren traditionelle Geschlechtsrollenorientierungen und behütende Erziehungseinstellungen. Hierbei ist zu bedenken, dass bis 1998 in der Türkei nur eine fünfjährige Schulpflicht bestand und diese erst seit 1998 auf acht Jahre angehoben ist. In der Hierarchie der Erziehungsdispositionen in türkischen Familien nahm die Behütung den ersten Rang ein, gefolgt 66 von der autoritären Rigidität; Permissivität (d.h. Gewährenlassen, liberale Einstellung zu den Wünschen der Kinder) dagegen nahm den letzten Rang ein, d.h. war am wenigsten wichtig (Nauck & Özel, 1986, S. 302). Auf der einen Seite überbehütend und rigide, verfolgen türkische Eltern auf der anderen Seite sehr hohe Bildungsaspiration für ihre Kinder, d. h. wünschen hohe Berufsziele; manchmal solche, die in Widerspruch zu den Fähigkeiten und Kompetenzen der Kinder stehen und die die Kinder offensichtlich zu überfordern drohen. Diese hohe Bildungsaspiration ist möglicherweise darin begründet, daß viele türkische Eltern das duale System in Deutschland nicht kennen und qualifizierte Berufe direkt mit akademischen Abschlüssen verbinden, wie es in der Heimat in der Regel auch üblich ist. Von den Eltern geht in der Erziehung latent eine widersprüchliche Haltung aus, die sich alltagssprachlich wie folgt umschreiben läßt: "Passe dich geistig der deutschen Kultur an, bleibe aber emotional deiner Herkunft treu!". Generell scheinen Inkonsistenzen zwischen den familialen Wertvorstellungen der jeweiligen ethnischen Minderheiten und den bspw. durch die Schule vermittelten Werten der Aufnahmegesellschaft bei Migrantenkindern höher zu sein; diese Inkonsistenzen haben Auswirkungen auf das Selbstbild und auf die Leistungsbereitschaft. Durch ihre sprachlichen Defizite erfahren sich vielfach Migrantenkinder als weniger Wert; erfahren weniger Anerkennung, die sie vielfach durch körperliche Auseinandersetzungen (Aggression gegen andere) zu kompensieren trachten. Bei einer familialen Migration finden Sozialisationsprozesse nicht nur bei Kindern, sondern in der gesamten Familie statt. Alle Personen der Familie sind gezwungen, ihr Verhaltensrepertoire zu erweitern, zu ändern und umzuorganisieren. In dem Maße, indem eine Akkulturation, d.h. ein allmählicher Erwerb der Standards der Aufnahmekultur erfolgt, findet in der Regel auch ein Entfernung von den Werten der Herkunftskultur statt; dieser Widerspruch, einerseits zu integrieren, andererseits aber auch kulturelle Wurzeln nicht auszulöschen, wird bisher von der Mehrzahl der Migrantenfamilien kaum befriedigend gelöst. Gleichwohl sind auch die gesellschaftlich-politischen Rahmenbedingungen nicht geklärt, wie die Diskussionen um die deutsche Leitkultur, Zuwanderungsdebatte, doppelte Staatsangehörigkeit etc. sie in der jüngsten Gegenwart zeigten. Pointiert formuliert, läßt sich festhalten: In der Migration kommt es in jedem Falle zu einer Werteveränderung, und zwar auch dann, wenn die Werte der Herkunftskultur aufrechterhalten werden; denn dann neigen Migranten vielfach dazu, die neue Umwelt mit ihren neuen Werten abzuwehren und sich stärker von ihr zu differenzieren; d.h. sie bilden dann Defensivstrategien aus.