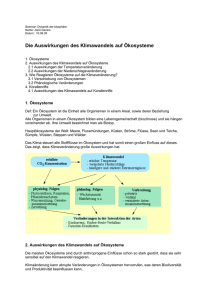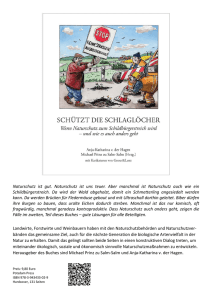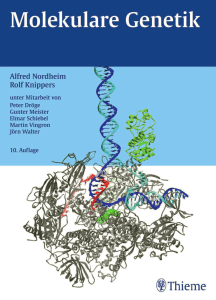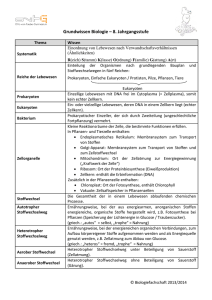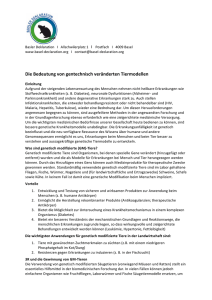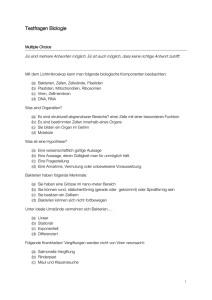Zusammenfassung Ökologie WS 2002/03
Werbung
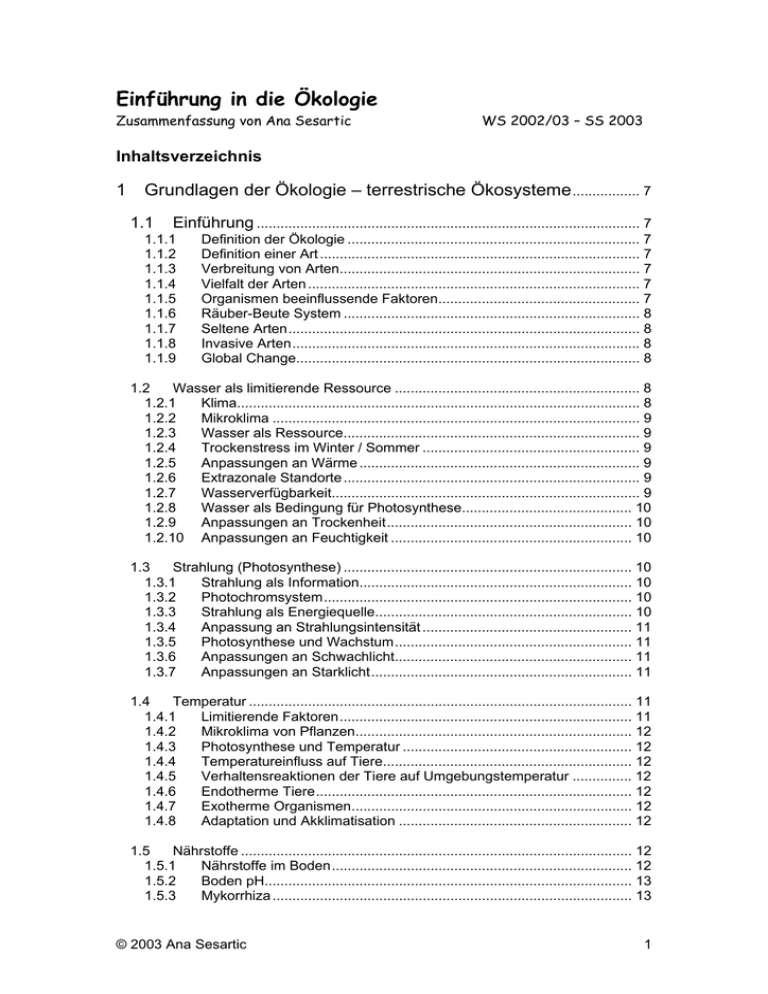
Einführung in die Ökologie Zusammenfassung von Ana Sesartic WS 2002/03 – SS 2003 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen der Ökologie – terrestrische Ökosysteme ................. 7 1.1 Einführung ................................................................................................. 7 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Definition der Ökologie .......................................................................... 7 Definition einer Art ................................................................................. 7 Verbreitung von Arten............................................................................ 7 Vielfalt der Arten .................................................................................... 7 Organismen beeinflussende Faktoren................................................... 7 Räuber-Beute System ........................................................................... 8 Seltene Arten......................................................................................... 8 Invasive Arten........................................................................................ 8 Global Change....................................................................................... 8 1.2 Wasser als limitierende Ressource .............................................................. 8 1.2.1 Klima...................................................................................................... 8 1.2.2 Mikroklima ............................................................................................. 9 1.2.3 Wasser als Ressource........................................................................... 9 1.2.4 Trockenstress im Winter / Sommer ....................................................... 9 1.2.5 Anpassungen an Wärme ....................................................................... 9 1.2.6 Extrazonale Standorte ........................................................................... 9 1.2.7 Wasserverfügbarkeit.............................................................................. 9 1.2.8 Wasser als Bedingung für Photosynthese........................................... 10 1.2.9 Anpassungen an Trockenheit.............................................................. 10 1.2.10 Anpassungen an Feuchtigkeit ............................................................. 10 1.3 Strahlung (Photosynthese) ......................................................................... 10 1.3.1 Strahlung als Information..................................................................... 10 1.3.2 Photochromsystem.............................................................................. 10 1.3.3 Strahlung als Energiequelle................................................................. 10 1.3.4 Anpassung an Strahlungsintensität ..................................................... 11 1.3.5 Photosynthese und Wachstum............................................................ 11 1.3.6 Anpassungen an Schwachlicht............................................................ 11 1.3.7 Anpassungen an Starklicht.................................................................. 11 1.4 Temperatur ................................................................................................. 11 1.4.1 Limitierende Faktoren.......................................................................... 11 1.4.2 Mikroklima von Pflanzen...................................................................... 12 1.4.3 Photosynthese und Temperatur .......................................................... 12 1.4.4 Temperatureinfluss auf Tiere............................................................... 12 1.4.5 Verhaltensreaktionen der Tiere auf Umgebungstemperatur ............... 12 1.4.6 Endotherme Tiere................................................................................ 12 1.4.7 Exotherme Organismen....................................................................... 12 1.4.8 Adaptation und Akklimatisation ........................................................... 12 1.5 Nährstoffe ................................................................................................... 12 1.5.1 Nährstoffe im Boden............................................................................ 12 1.5.2 Boden pH............................................................................................. 13 1.5.3 Mykorrhiza ........................................................................................... 13 © 2003 Ana Sesartic 1 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 Standorte – Nährstoffgradient ............................................................. 13 Pflanzenwachstum – Standortanpassung ........................................... 13 Nährstofflimitierung bei Tieren............................................................. 14 Zersetzung und Abbau ........................................................................ 14 1.6 Störungen ................................................................................................... 14 1.6.1 Definition und Bedeutung von Störungen............................................ 14 1.6.2 Mechanische Störungen...................................................................... 14 1.6.3 Feuer ................................................................................................... 14 1.6.4 Habitatfragmentation ........................................................................... 15 1.7 Intraspezifische Konkurrenz ....................................................................... 15 1.7.1 Definition und Bedeutung von Konkurrenz .......................................... 15 1.7.2 Dichte der Populationen ...................................................................... 15 1.8 Interspezifische Konkurrenz ....................................................................... 15 1.8.1 Typen Interspezifischer Konkurrenz .................................................... 15 1.8.2 Konkurrenz bei Pflanzen ..................................................................... 15 1.8.3 Konkurrenz bei Tieren ......................................................................... 16 1.8.4 Komplexe Interaktionen....................................................................... 16 1.8.5 Konkurrenz-Koexistenz-Modell............................................................ 16 1.9 Populationen............................................................................................... 16 1.9.1 Definition Population............................................................................ 16 1.9.2 Populationsdynamik ............................................................................ 16 1.9.3 Unitares bzw. modulares Wachstum ................................................... 16 1.9.4 Lebenszyklen....................................................................................... 17 1.9.5 Lebenstafeln ........................................................................................ 17 1.9.6 Überlebenskurven ............................................................................... 17 1.9.7 Metapopulation .................................................................................... 17 1.10 Positive Interaktionen ................................................................................. 17 1.10.1 Definition positiver Interaktionen ......................................................... 17 1.10.2 Kommensalismus ................................................................................ 17 1.10.3 Symbiose............................................................................................. 17 1.10.4 Mutualismus ........................................................................................ 18 1.10.5 Parasitismus ........................................................................................ 18 1.11 Koexistenz und Nische ............................................................................... 18 1.11.1 Fundamentale Nische.......................................................................... 18 1.11.2 Realisierte Nische................................................................................ 18 1.11.3 Konkurrenzausschlussprinzip.............................................................. 18 1.11.4 Charakterverschiebung ....................................................................... 18 1.11.5 Räumliche Differenzierung .................................................................. 18 1.11.6 Zeitliche Differenzierung...................................................................... 18 1.12 Strategie ..................................................................................................... 19 1.12.1 Definition.............................................................................................. 19 1.12.2 Funktionelle Pflanzentypen ................................................................. 19 1.12.3 Trade-Offs ........................................................................................... 19 1.12.4 Strategien ............................................................................................ 19 © 2003 Ana Sesartic 2 2 Grundlagen der Ökologie – aquatische Ökosysteme .................. 20 2.1 Wasser als Lebensraum (Salinität)............................................................. 20 2.1.1 Bedeutung aquatischer Lebensräume................................................. 20 2.1.2 Stehende Gewässer ............................................................................ 20 2.1.3 Fliessgewässer.................................................................................... 20 2.1.4 Grundwasser ....................................................................................... 20 2.1.5 Zonierung der Ozeane......................................................................... 20 2.1.6 Zonierung der Seen............................................................................. 20 2.1.7 Dichteanomalie von Wasser................................................................ 20 2.1.8 Löslichkeit von Gasen im Wasser ....................................................... 21 2.1.9 Wärmekapazität................................................................................... 21 2.1.10 Wichtige Wasserinhaltsstoffe .............................................................. 21 2.1.11 Zirkulation / Stagnation von Wasserkörpern........................................ 21 2.1.12 Einfluss von Wasserorganismen auf wichtige Wasserinhaltsstoffe..... 21 2.1.13 Osmotische Regulation ....................................................................... 21 2.1.14 Quellen ................................................................................................ 22 2.1.15 Grundwasser- und Höhlenbewohner................................................... 22 2.1.16 Fliessgewässer.................................................................................... 22 2.1.17 Flussabschnitt-Charakterisierung durch Leitfische.............................. 22 2.2 Strahlung und Thermik ............................................................................... 22 2.2.1 Strahlungsklima ................................................................................... 22 2.2.2 Reflexion an der Wasseroberfläche .................................................... 22 2.2.3 Absorption im Wasserkörper ............................................................... 22 2.2.4 Spektrale Transparenz ........................................................................ 23 2.2.5 Thermische Schichtung von Seen....................................................... 23 2.2.6 Thermische Schichtung von Ozeanen................................................. 23 2.2.7 Thermik von Fliessgewässern ............................................................. 23 2.3 Nährstoffe als limitierende Ressource ........................................................ 23 2.3.1 Stoff- und Energietransfer ................................................................... 23 2.3.2 Minimumgesetz nach Liebig ................................................................ 24 2.3.3 Dynamik der Mehrfachvorräte ............................................................. 24 2.3.4 Limitierende Nährstoffe ....................................................................... 24 2.3.5 Essentielle Nährstoffe.......................................................................... 24 2.3.6 Stöchiometrie des Wassers................................................................. 24 2.3.7 Eignung des Wassers als Nährlösung................................................. 24 2.3.8 Abhängigkeit der Wachstums / Konsumrate vom Substrat-Angebot... 24 2.3.9 Dosis – Response – Beziehung .......................................................... 25 2.3.10 Photosynthese – Licht – Beziehung .................................................... 25 2.3.11 Nicht substituierbare Ressourcen........................................................ 25 2.3.12 Substituierbare Ressourcen ................................................................ 25 2.3.13 Stickstoff .............................................................................................. 25 2.3.14 Sauerstoff ............................................................................................ 25 2.4 Hydrodynamik............................................................................................. 26 2.4.1 Strömungsarten – Wasserbewegungen .............................................. 26 2.4.2 Corioliskraft und Grosse Ströme ......................................................... 26 2.4.3 Vertikale Strömungen im marinen Bereich .......................................... 26 2.4.4 Oberflächenwellen............................................................................... 26 2.4.5 Gezeiten .............................................................................................. 26 2.4.6 Fliessgewässer.................................................................................... 27 2.4.7 Längsverlauf von Fliessgewässern ..................................................... 27 © 2003 Ana Sesartic 3 2.4.8 2.4.9 2.4.10 Grenzschicht........................................................................................ 27 Anpassungen der Fliesswasserorganismen........................................ 27 Anpassungen der Planktonorganismen............................................... 27 2.5 Intraspezifische Interaktionen ..................................................................... 28 2.5.1 Wechselwirkungen in der Natur........................................................... 28 2.5.2 Wechselbeziehungen .......................................................................... 28 2.5.3 Biologische Wechselwirkungen ........................................................... 28 2.5.4 Analyse der Wechselwirkungen .......................................................... 28 2.5.5 Konkurrenz-Ausschlussprinzip ............................................................ 29 2.5.6 Faktoren innerartlicher Konkurrenz ..................................................... 29 2.5.7 Intrinsisches Populationswachstum..................................................... 29 2.5.8 Zeitverzögertes Wachstum und Überschiessen der Kapazität............ 29 2.5.9 Chaos .................................................................................................. 30 2.5.10 Dichteabhängige Entwicklung der Populationen ................................. 30 2.5.11 Signale in der Umwelt.......................................................................... 30 2.5.12 Revierverhalten ................................................................................... 30 2.5.13 Schwarmverhalten............................................................................... 30 2.5.14 Crowding Effect (Gedrängewirkung) ................................................... 30 2.5.15 Brutpflege ............................................................................................ 31 2.5.16 Wanderung .......................................................................................... 31 2.6 Nahrungsnetze, Nahrungsketten, Nahrungspyramiden.............................. 31 2.6.1 Trophiestufen....................................................................................... 31 2.6.2 Nahrungsnetz ...................................................................................... 32 2.6.3 Nahrungsketten ................................................................................... 32 2.6.4 Nahrungspyramiden ............................................................................ 32 2.6.5 Energiefluss......................................................................................... 32 2.6.6 Futtereffizienz ...................................................................................... 32 2.6.7 Bergmannsche Regel – Allen Regel.................................................... 32 2.6.8 Räuber-Beute-Beziehungen (Lotka-Volterra) ...................................... 33 2.6.9 Beutevermeidungsstrategien............................................................... 33 2.7 Antrophogene Störung der Gewässer ........................................................ 33 2.7.1 Ökomorphologie .................................................................................. 33 2.7.2 Qualitative und quantitative Bedrohung der Gewässer ....................... 33 2.7.3 Restwasser.......................................................................................... 34 2.7.4 Abfluss................................................................................................. 34 2.7.5 Eutrophierung ...................................................................................... 34 2.7.6 Selbstreinigung.................................................................................... 34 2.7.7 Saprobien- und Makroindex ................................................................ 35 2.7.8 Abwasserreinigung .............................................................................. 35 2.7.9 Seesanierung ...................................................................................... 35 2.8 Ökologische Nische und Einnischung ........................................................ 35 2.8.1 Definition.............................................................................................. 35 2.8.2 Eindimensionale Nische ...................................................................... 35 2.8.3 Ökogramme......................................................................................... 35 2.8.4 Fundamentale Nische – Realisierte Nische......................................... 35 2.8.5 Nischenseparation............................................................................... 36 2.8.6 Wiederbesetzung einer Nische nach Störung ..................................... 36 2.8.7 Vermeidung von Konkurrenz ............................................................... 36 2.8.8 Adaptive Radiation .............................................................................. 36 2.8.9 Konvergenz ......................................................................................... 36 2.8.10 Funktionelle Gruppen .......................................................................... 36 © 2003 Ana Sesartic 4 2.8.11 River – Continuum – Concept ............................................................. 36 2.9 Verteilung in Raum und Zeit, Ausbreitung der Arten .................................. 37 2.9.1 Arten-Areal-Kurven.............................................................................. 37 2.9.2 Mosaikzyklus-Konzept......................................................................... 37 2.9.3 Inseltheorie .......................................................................................... 37 2.9.4 Ökologisches Gleichgewicht................................................................ 37 2.9.5 Sukzession .......................................................................................... 37 2.10 Lebenszyklus-Strategien im Wasser .......................................................... 38 2.10.1 Strategien des Überlebens .................................................................. 38 2.10.2 Konkurrenzvermeidungsstrategie........................................................ 39 2.10.3 Trochopteren Emergenz...................................................................... 39 3 Naturschutz .................................................................................................. 40 3.1 Grundlagen ................................................................................................. 40 3.1.1 Was ist Ökologie und was nicht........................................................... 40 3.2 Die Konzepte Umwelt, Umweltschutz und Mitwelt...................................... 40 3.2.1 Definitionen.......................................................................................... 40 3.2.2 Kritik am Begriff „Umwelt“.................................................................... 40 3.3 Ökosystem: Ein wichtiges Konzept der Bioökologie................................... 41 Hierarchischer Aufbau der Lebewelt ................................................... 41 3.3.2 Holismus und Reduktionismus: wichtige Konzepte ............................. 41 3.3.3 Ökosystem........................................................................................... 41 3.3.4 Merkpunkte zum Leben ökologischer Systeme................................... 41 3.3.5 Typologie der Ökosysteme aufgrund des Einflusses des Menschen .. 42 3.3.1 3.4 Biodiversität der Erde und der Schweiz...................................................... 42 3.4.1 Bekannte und geschätzte Artenzahlen weltweit .................................. 43 3.4.2 Bekannte und geschätzte Artenzahlen in der Schweiz ....................... 43 3.4.3 Genetische und Ökosystemare Biodiversität (BD) .............................. 43 3.4.4 Global Biodiversity Hotspots................................................................ 43 3.4.5 Methoden zur Abschätzung der globalen Biodiversität der Arten........ 43 3.4.6 Sinn des Biodiversität-Monitorings ...................................................... 44 3.5 Naturschutz und Biodiversität ..................................................................... 44 3.5.1 Warum Naturschutz............................................................................. 44 3.5.2 Wodurch Arten bedroht werden........................................................... 44 3.6 Stichworte zum Naturschutz in Mitteleuropa .............................................. 46 3.6.1 Was ist Naturschutz / Wieso Naturschutz ........................................... 46 3.6.2 Gefährdung von Arten, Lebensgemeinschaften und Naturprozessen. 47 3.6.3 Rote Listen .......................................................................................... 48 3.6.4 Ökosysteme in der Landschaft, Inseltheorie und Naturschutz ............ 48 3.7 Naturschutzexkursion Greifensee............................................................... 49 3.7.1 Hochstamobstgärten ........................................................................... 49 3.7.2 Hecken und Waldrand ......................................................................... 50 3.7.3 Entstehung der heutigen Riedgebiete, Veränderung der Landschaft.. 50 3.7.4 Riedvegetation..................................................................................... 51 3.7.5 Vögel ................................................................................................... 51 © 2003 Ana Sesartic 5 3.7.6 3.7.7 4 Amphibien............................................................................................ 52 Renaturierung...................................................................................... 52 Stadtbioökologie ......................................................................................... 53 4.1 Das Thema ................................................................................................. 53 4.2 Abiotische Grundlagen ............................................................................... 53 4.2.1 Stoff- und Energieumsatz .................................................................... 53 4.2.2 Stadtklima............................................................................................ 53 4.2.3 Nutzungs- und Biotypen ...................................................................... 53 4.2.4 Siedlungsentwicklung: Von Stadt und Dorf zum Siedlungsbrei........... 54 4.2.5 Herkunft der Stadtnatur ....................................................................... 54 4.3 Stadtflora .................................................................................................... 54 4.4 Stadtfauna .................................................................................................. 54 4.4.1 Charakterisierung städtischer Tiergemeinschaften ............................. 54 4.4.2 Beispiel Eidechsen .............................................................................. 55 4.4.3 Beispiel Igel ......................................................................................... 55 4.4.4 Brutvögel ............................................................................................. 55 4.5 Bioökologische Stärken, Gefährdungen und Potentiale ............................. 55 4.6 Naturnahe Gestaltung und Pflege .............................................................. 56 4.6.1 Ziele, Rechtliche Grundlagen und Instrumente ................................... 56 4.6.2 Checklisten .......................................................................................... 56 4.6.3 Massnahmen (Beispiel Wasser).......................................................... 56 4.6.4 Massnahmen (Dächer Begrünen) ....................................................... 57 © 2003 Ana Sesartic 6 1 Grundlagen der Ökologie – terrestrische Ökosysteme 1.1 Einführung 1.1.1 Definition der Ökologie „Ecology is the scientific study of the distribution and abundance of organisms and the interactions that determine distribution and abundance“ (nach Townsend, Harper, Begon) bzw. “ Untersuchen der Interaktionen zwischen Organismen und zwischen Organismen und ihrer Umwelt als Erklärungsfaktoren für deren Verbreitung und Häufigkeit.” 1.1.2 Definition einer Art Eine Art ist eine Gruppe sich tatsächlich oder potentiell (Hybride) kreuzender natürlicher Populationen, wobei die Individuen in ihren wesentlichen Merkmalen untereinander übereinstimmen. 1.1.3 Verbreitung von Arten Organismen sind gleich verbreitet, ihr Areal, in denen sie vorkommen ist beschränkt. Ökologie sucht Faktoren, die den beobachteten Verbreitungsmustern der Arten zugrunde liegen. Ökologische Verbreitungsmuster können vom Betrachtungsmasstab abhängig sein. z.B. Ratten sind weit verbreitet und kommen überall vor. Grosse Populationen, lokal extrem häufig. Wanderfalken sind selten und brauchen grosse Reviere. Kleine Populationen, selten oder sporadisch. 1.1.4 Vielfalt der Arten Heute sind 1.4 Mio. Arten bekannt. Die wirkliche Artenzahl beträgt aber 3-30 Millionen Arten. Ein Grossteil der noch unbekannten Organismen umfasst Insekten aus dem tropischen Bereich. Die Anzahl bekannter Pflanzenarten beträgt 250'000. Pflanzen bilden die Struktur des Ökosystems, die Grundlage der Nahrungskette und produzieren viel Biomasse. Artenvielfalt zeigt sich auch in den morphologischen, physiologischen und funktionellen Unterschieden zwischen den Arten. Homologe Strukturen bei Wirbeltieren: z.B. Ausprägung der Gliedmassen. Homolog=gemeinsame Basis, unterschiedliche Ausprägungsformen. Biome sind Grosslebensräume, die charakteristisch für die Haupt-Klimagebiete der Erde sind. Diese unterscheiden sich strukturell hauptsächlich durch die Wuchsform der dominierenden Pflanzen und die Dichte der Vegetation. Ewiges Eis Tundra (Permafrostboden, Nass, Moose, Flechten, Sträucher) Borealer Nadelwald Temperater Laubwald Temperates Grasland Chapparal (Mediterranes Klima) Wüste Savanne (Grasland mit einigen Bäumen) Tropischer Regenwald 1.1.5 Organismen beeinflussende Faktoren Faktoren, die Verbreitung und Häufigkeit der Organismen direkt oder indirekt beeinflussen. © 2003 Ana Sesartic 7 Abiotisch: Strahlung, Temperatur, Wasser- und Nährstoffangebot, Substrat Biotisch: Sozialverhalten, Konkurrenz, Symbiose, Parasitismus, Prädation, Herbivorie, Krankheit Faktoren können sich auch untereinander beeinflussen. 1.1.6 Räuber-Beute System Zyklische Schwankungen in der Häufigkeit des Schneeschuhhasen (Beute) und Luchs (Räuber). Nicht nur Luch reguliert die Hasen, sonder auch Toxine in der Birke (gebildet bei zu starkem Frassdruck durch Hasen) liessen diese schwächer werden. Ausserdem ist das Rauhfusshuhn eine mögliche Ausweichbeute für den Luchs, wenn zuwenig Hasen vorhanden sind. 1.1.7 Seltene Arten Veränderung und Zerstörung vieler Habitate durch die Landnutzung des Menschen ist der Hauptfaktor für den aktuellen Rückgang vieler Arten. (so ist z.B. Lungenflechte wegen Luftverschmutzung selten geworden) Endemismus: Organismen, die aufgrund natürlicher Ursachen (Kontinentaldrift und dadurch Klimazonen Verschiebung, Topographie) kleine geographische Verbreitung haben. Von allen jemals existierenden Arten sind heute nur noch ca. 1% erhalten. In jüngerer Zeit sind hundert mal mehr Arten (v.a. bei Wirbeltieren) ausgerottet worden, als durch natürliches Aussterben (wie z.B. bei Dinosauriern) geschehen wäre. 1.1.8 Invasive Arten Heute besteht Trend zur Abnahme der Biodiversität. Grund sind vor allem Invasive Organismen, die durch den Menschen in neue Gebiete verschleppt wurden, und sich dort explosionsartig ausbreiteten und die einheimischen Arten verdrängten. Dies führte zur Homogenisierung der Biosphäre und dem Rückgang der Biodiversität (letzteres u.a. auch wegen Habitatsfragmentation). Ein Beispiel solcher invasiver Art ist die Goldraute, die aus den USA in die Schweiz eingeschleppt wurde. Solche eingeschleppten Unkräuter verursachen auch massiven ökonomischen Schaden. 1.1.9 Global Change Die von Menschen verursachten Umweltänderungen und ihre Auswirkungen auf die ökologischen Prozesse in der Biosphäre: Anstieg der Treibhausgase Akkumulation von Umweltgiften Zunehmender Ressourcenverbrauch durch weiter zunehmende Weltbevölkerung Homogenisierung der Biota („Ökologische Globalisierung“) Rückgang der Biodiversität. Die Änderung der Oberflächentemperatur auf der Erde verlief sehr inhomogen. Insgesamt sind die Temperaturen steigend. Je nach unterschiedlichen berücksichtigten Faktoren ist der Anstieg aber verschieden stark. 1.2 Wasser als limitierende Ressource 1.2.1 Klima Das Klima ist der mittlere Zustand der Atmosphäre über einem bestimmten Gebiet und der für dieses Gebiet charakteristische Ablauf der Witterung. © 2003 Ana Sesartic 8 Jahreszeitenklima: Klimatische Unterschiede hängen von Jahreszeiten ab. Tagesschwankungen gering. Tageszeitenklima: grosse Schwankungen während dem Tag, kleine Schwankungen während dem Jahr. Arides Klima: Niederschlagsmenge geringer als Verdunstung Humides Klima: Niederschlagsmenge höher als potentielle Verdunstung 1.2.2 Mikroklima Lokale Topographie beeinflusst das Klima. Das je nach Standort variierendes Klima wird Mikroklima genannt. So ist z.B. die Luftfeuchtigkeits-Schwankung grösser in Tallagen. Dort wird die Wärmestrahlung besser aufgenommen / abgegeben, es bilden sich Kaltluftseen, Nebel, etc. 1.2.3 Wasser als Ressource Wasser spielt als Umweltfaktor eine Rolle im Temperaturhaushalt (Verdunstungskälte), als mechanischer Faktor (Eis, Schnee, Fliessgewässer) und als Lebensraum. Gleichzeitig ist es eine Ressource. Problem: steigender Verbrauch an Süsswasser durch den Menschen. Heute sind bereits 50% der Süsswasserreserven der Erde genutzt. (v.a. für Bewässerung) 1.2.4 Trockenstress im Winter / Sommer Trockenstress kommt auch im Winter vor, da Wasser gefroren wird und nicht aus dem gefrorenen Boden von den Pflanzenwurzeln aufgenommen werden kann. Transpiration als Kühlungsmechanismus, gleichzeitig müssen Organismen ein Wasserdefizit durch zu starke Transpiration vermeiden. 1.2.5 Anpassungen an Wärme Assel in algerischer Wüste gräbt senkrechte Löcher in denen vorteilhafte Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Verhältnisse herrschen. Konflikt: Wärmeschutz vs. Nahrungssuche und Fortpflanzung. Käfer in Namib Wüste stellt sich so in den Wind, dass die Luftfeuchtigkeit aus dem Nebel an ihm kondensiert und Wasser in sein Maul läuft. 1.2.6 Extrazonale Standorte Extrazonale Standorte haben durch besondere edaphische (den Erdboden betreffende) und mikroklimatische Faktoren Charakteristika, die nicht den sonstigen Gegebenheiten der Vegetationszone entsprechen. „Wüste“ auf Island: bedingt durch Gebirge, Erdwärme und austrocknende Wind ist ein extrazonaler Standort, passt also nicht zum sonstigen regionalen Klima. Ein weiterer solcher Standort ist der Rothenfels im Hunsrück. Dort wächst (sub)mediterrane Flora und Fauna, bedingt durch dunkles, wärmespeicherndes Gestein und den Regenschatten. Dies ist ein Relikt aus der Eiszeit. 1.2.7 Wasserverfügbarkeit Bodenwasserverfügbarkeit für die Pflanzen hängt ab vom Bodenwassergehalt, Porengrösse und Kolloidgehalt. Feldkapazität des Bodens: Gehalt des Wassers der bei vollständiger Sättigung gehalten werden könnte. Ton und Lehm bindet Wasser sehr stark, Permanenter Welkepunkt wird früher erreicht. © 2003 Ana Sesartic 9 1.2.8 Wasser als Bedingung für Photosynthese C3 – Pflanzen mit normaler Photosynthese (highly productive photosynthesizers, relatively wasteful of water, reach maximum rates of photosynthesis at relatively low radiation intensities) C4 – Pflanzen: räumliche Trennung von RubisCO und CO2 Aufnahme und dadurch stärkere CO2 Anreicherung als bei C3 Pflanzen. (the higher the radiation, the more effective the photosynthesis, high affinity for carbon dioxide – absorb more per unit of water loss) CAM – Pflanzen: (Crassulacean Acid Metabolism) zeitliche Trennung von RubisCO und CO2 Aufnahme. Nehmen CO2 nachts auf, da dann die Luftfeuchtigkeit höher ist. ( open stomata and absorb carbon dioxide at night, which they fix as malic acid; closed stomata during day, internal release of CO2 for photosynthesis ) 1.2.9 Anpassungen an Trockenheit Weitere Anpassungen um übermässigen Wasserverlust durch Transpiration zu vermeiden: Ruhephase (Geophyten, annuelle Pflanzen, z.B. Hungerblümchen saisonale Anpassung, kurzer Lebenszyklus) Laubabwerfen während der Trockenperiode (Trockenwälder) Immergrüne Blätter mit geringer Transpiration (z.B. Stechpalme) Unterschiedliche Blattformen während Trocken- und Regenzeit Heideschnecken: Schleimdeckel an Schalenöffnung und hochklettern an Pflanzenstengel verhindern Austrocknung Flechte: eingerollte Loben (Blattlappen) und helle Farbe als Strahlungs- und Hitzeschutz. Im ausgetrocknetem Zustand besonders hitze- und kälteresistent 1.2.10 Anpassungen an Feuchtigkeit Torfmoos: wächst permanent aus dem Wasser heraus und stirbt nach unten in der anaeroben Zone ab. Strauchflechte: Durchlüftungsgewebe Mangroven: Luftwurzeln 1.3 Strahlung (Photosynthese) 1.3.1 Strahlung als Information Sonnenstrahlung wir als Informationsquelle genutzt (v.a. als Zeitgeber) So dient die Tageslänge als Indikator für die Jahreszeit, Sonnenstand zur Richtungsorientierung etc. (Periodizität: Eierlegen, Blühen; Keimung: Hemmung durch Dunkelrotstrahlung) 1.3.2 Photochromsystem Pigmentsystem, das je nach Lichtqualität in zwei verschiedenen Zuständen vorliegen kann, dient zur Steuerung von z.B. Richtungswachstum (Phototrophismus) und Keimung. Wenn viel Hellrotes Licht absorbiert wird, wird die physiologisch Aktivität angeregt, bei Dunkelrot-Absorption wird Aktivität gehemmt. 1.3.3 Strahlung als Energiequelle Photosynthese ist von Lichtintensität abhängig, steigt zuerst linear, nähert sich aber mit zunehmender Lichtstärke asymptotisch der Lichtsättigung an. Lichtkompensationspunkt: CO2 Aufnahme durch Photosynthese und CO2 Abgabe durch Photorespiration und Dunkelatmung heben sich auf, Pflanze ist gerade noch © 2003 Ana Sesartic 10 lebensfähig. Kein lineares Kurvenwachstum, da CO2 wegen kleiner atmosphärischer Konzentration limitierend wirkt. 1.3.4 Anpassung an Strahlungsintensität An unterschiedliche Standorte adaptierte Pflanzen unterscheiden sich in der Lage des Lichtkompensationspunkt und der sättigenden Lichtstärke. Die CO2 Aufnahme gut angepasster C4 Pflanzen folgen dem Tagesverlauf der Strahlungsintensität – sie können Licht maximal ausnutzen. C3 Pflanzen erreichen Lichtsättigung früher und nutzen darum Einstrahlung nicht maximal aus, weil sie durch CO2 limitiert sind. Schattenpflanzen erreichen den Lichtkompensationspunkt deutlich früher und können viel früher im Tagesverlauf bereits Netto-Photosynthese betreiben, werden aber bei höherer Beleuchtung geschädigt. Schattenblätter eines Baumes sind grösser und haben höhere Lichttransmission da sie weniger Zellschichten haben, Sonnenblätter sind kleiner und dicker. Pflanzen an sonnigen Standorten (v.a. im Gebirge) entwickelten Mechanismen und Strukturen zum Schutz vor Übertemperaturen und Strahlungsschäden (z.B. weisser Pelz des Edelweiss, Nord-Süd Ausrichtung des Kompasslattichs, etc.) 1.3.5 Photosynthese und Wachstum Beleuchtungsstärke ist möglicher limitierender Faktor für das Pflanzenwachstum. Allgemein schlägt sich auch stark unterschiedliche Ressourcenverfügbarkeit in intraspezifischen Unterschieden im Wachstum nieder. So koreliiert Grösse und Alter eines Baumes nicht unbedingt miteinander (dünne, bzw. breite Jahresringe) Die Tundravegetation (und auch z.B. soldanella alpina) kann auch unter der Schneedecke (als Isolation) Photosynthese betreiben. 1.3.6 Anpassungen an Schwachlicht Dünne Blätter, grosse Samen, frühe Blütezeit Tiefe Dunkelatmung, Lichtsättigung, max. Photosyntheserate und Kompensationspunkt Kein Etiolement (Längenwachstum ohne seitliche Verzweigung), grosse Plastizität der Blattform und starke Resistenz gegen Pilzinfektionen Keimen und Bilden Blüten auch im Schatten Saprophyten wie die Nestwurz verzichten völlig auf Photosynthese, leben in Symbiose mit Pilzen und ernähren sich von organischem Material. Leuchtmoos hat die Fähigkeit Licht zu bündeln. Ein völlig lichtloses terrestrisches Ökosystem, das auf Chemotrophie (Schwefeloxidierende Bakterienrasen) basiert ist das Movile Höhlensystem in Rumänien. 1.3.7 Anpassungen an Starklicht Dicke Blätter, kleine Samen, späte Blütezeit Hoche Dunkelatmung, Lichtsättigung, max. Photosyntheserate und Kompensationspunkt Etiolement bei schwachem Licht, geringe Plastizität der Blattform, schwache Resistenz gegen Pilzinfektionen Keimen nicht und bilden keine Blüten im Schatten 1.4 Temperatur 1.4.1 Limitierende Faktoren Vitalität von Organismen kann je nach Intensität relevanter Umweltfaktoren stark schwanken. Der limitierende Faktor ist der, von dessen Intensitätsänderung die Vitalität des Organismus entscheidend abhängt, d.h. der am nächsten beim © 2003 Ana Sesartic 11 Vitalitätsminimum liegt. Limitierende Faktoren können toxische Stoffe, Nährstoffe, Temperatur und pH-Wert sein. Verbreitungsgrenzen korellieren oft mit Isothermen, was aber nicht heissen muss, dass die Verbreitung durch die Temperatur limitiert wird. Häufig sind auch Extremereignisse entscheidend. (z.B. die Anzahl Frosttage) 1.4.2 Mikroklima von Pflanzen Temperaturen können zwischen den verschiedenen Körperregionen einer Pflanze (innen und aussen) stark variieren. 1.4.3 Photosynthese und Temperatur Photosynthese ist auch von der Temperatur abhängig. Bei zu hohen Temperaturen kann es zur Enzym-Hemmung und Denaturierung kommen. 1.4.4 Temperatureinfluss auf Tiere Entwicklung (besonders von ektothermen Organismen) ist von der Temperatur abhängig und erfolgt bei höheren Temperaturen schneller (RGT-Regel !). Viele Insekten benötigen für die Entwicklung einen bestimmten Betrag an physiologischer Zeit (konstantes Produkt aus Temperatur und Zeitdauer der Temperatur). 1.4.5 Verhaltensreaktionen der Tiere auf Umgebungstemperatur Transpiration, Hecheln, Winterschlaf, Torpor, Zugverhalten (Vögel), Viviparie (z.B. bei Reptilien) 1.4.6 Endotherme Tiere Vögel und Säugetiere regulieren ihre Körpertemperatur durch eigenproduzierte Wärme (Sauerstoffverbrauch steigt mit sinkender Temperatur). Haben konstante innere Temperatur und dadurch hohen Energiebedarf (v.a. kleine Tiere) 1.4.7 Exotherme Organismen Sie sind auf externe Wärmequellen angewiesen und suchen durch Verhaltensreaktionen den Temperaturbereich des physiologischen Optimums auf. Sie sind bei niedrigen Temperaturen nicht agil, benötigen jedoch wenig Energie. Einige Organismen haben gewisse Regulationsmöglichkeiten (Flugmuskulatur, metabolische Wärmeproduktion). 1.4.8 Adaptation und Akklimatisation Anpassung derselben Arten an unterschiedliche Temperaturverhältnisse können auf verschiedene Weise erfolgen. Genetische Anpassung, Physiologische Anpassung auf verschiedene Klimatische Bedingungen. (arktischer und gebirgs Ökotyp, Wüstenbzw. Küstenklone) Evolutive Adaption vs. Akklimatisation 1.5 Nährstoffe 1.5.1 Nährstoffe im Boden Der Boden ist ein hochkomplexer Reaktor. Tonpartikel bilden zusammen mit Quarz, organischem Material und Wasser wichtige Strukturkomponenten des Bodens. 98% der Nährstoffe im Boden sind fest gebunden, 2% sind an Tonmineralien reversibel gebunden (d.h. für die Pflanzen verfügbar), nur 0.2% sind im Bodenwasser gelöst. © 2003 Ana Sesartic 12 1.5.2 Boden pH Der Boden-pH ist abhängig vom Ausgangsgestein, Regen und Vegetation. Er wirkt sich auf die Bodenstruktur, Verwitterung, Humifizierung und Nährstoffmobilisierung im Boden aus. Bestimmte Pflanzen sind Zeiger für saure Böden (Sphagnum spp.), andere für basische Böden. (tussilago farfara) siehe auch Botanik Junge Böden (Mitteleuropa) sind nährstoffreich, alte Böden (Tropen) sind oft ausgewaschen, dadurch nährstoffarm, und durch Eisenoxide rot gefärbt. Bei tieferen pH Werten wird die Toxizität des Aluminiums problematisch. Ansonsten können Pflanzen bei pH 3-9 existieren. Der pH beeinflusst Wachstum und Keimung der Pflanzen. 1.5.3 Mykorrhiza Pflanzen gehen eine Symbiose mit Pilzen ein und bilden so die Mykorrhiza. Die Pilzfäden vergrössern die Wurzeloberfläche für Nahrungsaufnahme auf das 100 bis 1000 Fache. Dies ist besonders vorteilhaft bei nährstoffarmen Böden. Ektomykorrhiza: Bilden an der Zelloberfläche das sog. Hartigsche Netz und dringen nur in den interzellulären Raum vor. (bei Bäumen) Endomykorrhiza: Pilzhyphen dringen in Wurzelzellen ein, wachsen aber auch in Interzellularen ohne ein Hartigsches Netz zu bilden. 90% aller höheren Pflanzen haben Mykorrhiza. Vesicular-Arbuscular-Mycorrhiza (VAM) findet man in den meisten krautigen Pflanzen, vielen Gehölzen, Farnen und Moosen. Bei phosphorlimitierten Bedingungen profitieren beide Symbiosepartner, bei fruchtbaren Böden profitiert der Pilz mehr, die Pflanze jedoch dadurch, dass die Mykorrhiza den Angriff von pathogenen Pilzen an der Pflanze verhindert. 1.5.4 Standorte – Nährstoffgradient Hochmoore sind extrem nass, sauer und nährstoffarm, weil die Torfmoose ständig nach oben wachsen und den Kontakt zum Muttergestein und Grundwasser verlieren. Nährstoffeintrag erfolgt nur durch Regenwasser (das leicht sauer ist). Blockhalden, Felsköpfe etc. sind ebenfalls extrem nährstoffarm, aber trocken und starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Substrat für höhere Pflanzen muss durch Pioniervegetation erst noch gebildet werden. Basalt-Blocksteinhalden enthalten nährstoffreichen Stein (Ca + Mg). Granitblockhalden sind nährstoffarme Gesteine. Lägerfluren sind Stellen mit besonders mastigem Pflanzenwuchs innerhalb rasenartiger Alpenweiden. Gedüngt weil als Kuh-Lagerplatz oder Kuh-WC gebraucht. Dort wachsen nitrophile, wuchskräftige Stauden. Baumrinden des Bergahorns sind neutral und fruchtbar, die Rinde von Birken und Fichten ist sauer und nährstoffarm. 1.5.5 Pflanzenwachstum – Standortanpassung Das Wachstum unterschiedlicher Pflanzenarten kann je nach Standortanpassung auf steigende Nährstoffverfügbarkeit unterschiedlich reagieren. Fettwiesenpflanzen haben hohe Plastizität, da an Nährstoffreichtum gewöhnt, Magerwiesenpflanzen reagieren nicht, weil sie auf nährstoffarme Böden angepasst sind. Charakteristiken von Pflanzen nährstoffarmer Standorte: Kleine Grösse Xeromorphie: ausdauernde ledrige Blätter die wenig wachsen und Schutzstoffe gegen Herbivoren besitzen. Vor dem Laubfall werden Nährstoffe aus den Blättern zurückgenommen. Hohes Wurzel zu Spross Verhältnis (Speicherwurzeln) Symbiose mit Stickstoff fixierenden Bakterien (Fabaceae) © 2003 Ana Sesartic 13 Zusätzlicher Stickstoff von gefangenen Insekten (Drosera) 1.5.6 Nährstofflimitierung bei Tieren Tiere beziehen Stickstoff und andere Nährstoffe aus organischem Material. Stickstoffkonzentration in Pflanzenteilen variiert aber stark. Xylem-Saft ist extrem Stickstoffarm. Samen enthalten viel Stickstoffe, damit der Keimling genug Nährstoffe fürs Wachstum hat, ausserdem werden Tiere dadurch animiert diese zu fressen (und nicht die Blätter) und somit zur Verbreitung beizutragen. Wachstumseffizienz steigt linear mit der zunehmenden N-Konzentration im Gewebe der Nahrungspflanzen. 1.5.7 Zersetzung und Abbau Der Nährstoffgehalt und die strukturelle Zusammensetzung von totem organischem Material bestimmt die Zersetzungsrate desselben. Die Zersetzung von pflanzlichem Detritus geschieht durch Zellulose- und Ligninabbauende Pilze, Bakterien, etc. 1.6 Störungen 1.6.1 Definition und Bedeutung von Störungen Störungen sind mehr oder weniger starke äussere Eingriffe in die Struktur und Entwicklung von Individuen, Populationen oder Lebensgemeinschaften, und dadurch wichtige Standortfaktoren der meisten Ökosystemen. 1.6.2 Mechanische Störungen Mechanische Störungen können natürliche oder antrophogene Ursachen haben. Beispiele mechanischer Störungen und ihre Folgen: Lawinen: Ansammlung von Schnee im Ausflussbereich, wodurch Vegetationswachstum verzögert wird. Grosse Schneelasten: Erzwingen Anpassung in der Wuchsform, bzw. fördern niederliegende und kriechende Gehölzpflanzen Erdrutsche: Transportieren Vegetation in tiefere Lagen und schaffen Neufläche für Pionierarten Wind: Austrocknungs-, und Eisstrahleffekt. Bäume sterben ab, oder zeigen kriechende bzw. Broomstick Formen auf. Waldgrenze kann wegen Wind tiefer liegen als üblich. Wind transportiert auch Pflanzensamen und Tiere über grosse Distanzen. Starkwindereignisse: Vernichten ganze Wälder, ändern Struktur und Zusammensetzung der Waldökosysteme stark, und z.T. dauerhaft Frost: Frostbedingte Hebung des Oberbodens im Tages bzw. Jahreszeitenrhythmus. Häufig in tropischen Gebirgssystemen und Alpen. Kammeisbildung erzwingt Anpassung der Pflanzen. 1.6.3 Feuer Einflüsse vom Feuer auf Ökosysteme: Freisetzung von Nährstoffen aus der verbrannten oberirdischen Biomasse Erleichterung der Keimlingsetablierung durch Vernichtung der Streuauflage Brechung der Dormanz in an Feuer angepassten Arten Vernichtung von allelopatischen Substanzen an der Bodenoberfläche Anpassungen an Feuerzyklen (v.a. in ariden und semiariden Gebieten): Resistenz durch dicke feuerfeste Borke Regenerationsfähigkeit ausgehend vom Wurzelstock Spezielle unterirdische Speicherorgane (Lignotuber) Freisetzung von Samen nach dem Durchgang eines Feuers © 2003 Ana Sesartic 14 Forstmanagement durch kontrollierte Lauffeuer. Damit vermeidet man, das sich zuviel flammbares Material ansammelt und sich invasive Arten ansiedeln. Brandrodung von Tropenwäldern ist problematisch, weil sie das artenreiche Ökosystem zerstört und zum Anstieg des CO2 Gehalt in der Atmosphäre beiträgt. 1.6.4 Habitatfragmentation Zerschneiden und Zurückdrängen von ursprünglich grösseren, zusammenhängenden Habitaten in kleine, meist isolierte und entfernte Habitatinseln durch zunehmende urbane bzw. agrarische Flächennutzung. Fragmentation verringert die Populationsgrösse und genetische Variabilität von betroffenen Arten, so dass sie weniger Nachkommen produzieren und lokal vom Aussterben bedroht sein können. 1.7 Intraspezifische Konkurrenz 1.7.1 Definition und Bedeutung von Konkurrenz Konkurrenz ist die Wechselbeziehung zwischen Individuen bzw. Arten durch gemeinsamen Anspruch auf begrenzte Ressourcen. Intraspezifische Konkurrenz innerhalb einer Art ist besonders stark wegen nahezu identischen Standortansprüchen (d.h. gleichen Nischen). Konkurrenzphänomene beeinflussen bzw. limitieren das Populationswachstum. 1.7.2 Dichte der Populationen Intraspezifische Konkurrenz auf Nahrung bei grosser Dichte lässt die Mortalität ansteigen. Ausserdem beeinflusst hohe Dichte die Grössenhierarchie. Es gibt sehr wenig grosse Pflanzen und viel kleine. Eine allgemeine Grössenreduktion ist die Folge. Unter den verschärften Konkurrenzbedingungen einer hohen Populationsdichte reguliert frühzeitige Mortalität die Populationsdichte nach unten. Gesetz des Konstanten Endertrags: Verhältnis Halm (Ramet) zum Rest der Pflanze (Gamet) ist immer etwa gleich, unabhängig von der Populationsdichte. Der Zusammenhang zwischen Pflanzengrösse (w) und Populationsdichte (d) wird bei Erreichen der Kapazitätsgrenze des Populationswachstums durch das –3/2 Potenzgesetz oft gut beschrieben: log w = log c – 3/2 log d Exponentielles Wachstum hängt grundlegend von der durchschnittlichen Anzahl produzierter Individuen ab (Fekundität), während logistisches Wachstum auch den Dichteeffekt berücksichtigt. 1.8 Interspezifische Konkurrenz 1.8.1 Typen Interspezifischer Konkurrenz Direkte Interaktion zwischen zwei Arten Indirekte Interaktion (Ausnutzung einer gemeinsamen Ressource) Indirekte Effekte offensichtlicher Konkurrenz: Gemeinsamer Fressfeind: Wachstum einer Population begünstigt Feind und erhöht den Räuberdruck auch auf andere Population Spezifischer Mutualist: Begünstigt einen Konkurrenten 1.8.2 Konkurrenz bei Pflanzen Nachweis und Analyse der Stärke interspezifischer Konkurrenz durch sog. Ersetzungskriterien (Konkurrenzexperimente mit zwei Arten in Mischkultur). Viele Arten haben eine breite ökologische Amplitude. Bei Monokulturen bilden sie eine sog. Optimumkurve. Bei interspezifischer Konkurrenz in Mischkultur können die © 2003 Ana Sesartic 15 starken Arten die anderen in ihrem Optimalbereich jedoch stark unterdrücken und an den Rand drängen. Asymmetrische Konkurrenz: paarweise Konkurrenz zw. Pflanzen zweier verschiedener Arten. Die höher wachsende Art ist bei Lichtkonkurrenz im Vorteil. Symmetrische Konkurrenz: Bei überwiegender Wurzelkonkurrenz tritt der Effekt des Höherwachsens nicht auf. 1.8.3 Konkurrenz bei Tieren Konkurrenz entsteht häufig um gleiches Futter. Um nachzuweisen, ob zwei Tierarten mit überlappendem Nahrungsspektrum sich konkurrenzieren, entfernt man die Arten selektiv und misst die Futterdichte. 1.8.4 Komplexe Interaktionen Konkurrenzeffekte können durch Interaktion mit anderen Faktoren (Frass, Pathogene, etc.) verändert werden. Die stärke der Interaktion kann auch von Art zu Art verschieden sein. 1.8.5 Konkurrenz-Koexistenz-Modell Zwei konkurrierende Arten, die von zwei verschiedenen essentiellen Ressourcen limitiert werden, können je nach Verhältnis der einen zur andern Ressource einander verdrängen oder in Koexistenz zueinander leben. Eine limitierende Ressource Konkurrenzausschluss. Koexistenz unmöglich. Zwei limitierende Ressourcen potentielle Koexistenz 1.9 Populationen 1.9.1 Definition Population Eine Population ist eine Gruppe von Individuen einer Art, die im selben Raum und zur gleichen Zeit vorkommt. Die vier fundamentalen Prozesse, die Dynamik von Populationen bestimmen sind Geburt, Tod, Einwanderung und Auswanderung. Populationsökologie untersucht die biotischen und abiotischen Faktoren, die diese Prozesse beeinflussen. Populationsentwicklung: Nt = Nt-1 + G – T + E – A 1.9.2 Populationsdynamik Einwanderung und Auswanderung sind wichtige Populationsdynamische Prozesse. Wanderformen (z.B. von Heuschrecken) bilden sich, wenn die Intraspezifische Konkurrenz zu gross wird. Es kommt zur Emigration. Kleine Populationen an ungünstigen Standorten können sich nur durch Einwanderung aufrecht erhalten. 1.9.3 Unitares bzw. modulares Wachstum Unitare Organismen: Entwicklung und Form sind weitgehend festgelegt, Anzahl der Individuen ist klar festgelegt und kann prinzipiell leicht erfasst werden. Modulare Organismen: Im Verband lebende Individuen, die sich klonal vermehren und deren Entwicklung und Form nicht festgelegt ist. Individuen sind nicht klar abgrenzbar und lassen sich schwer erfassen. (z.B. Koralle als Polypenkolonie) Beispielhafter Aufbau Modularer Pflanzen: Genet (Klon): aus einer Zygote entstanden (z.B. einzelne Pflanze) Ramet (Spross): Modul des Klons Blätter als Teilmodule des Rameten © 2003 Ana Sesartic 16 1.9.4 Lebenszyklen Der Lebenszyklus ist die Abfolge morphologischer Stadien und physiologischer Prozesse, welche eine Generation mit der nächsten verbindet und umfasst Wachstum, Differenzierung, Speicherung, Reproduktion und Überleben. Vegetative Vermehrung Einfacher Lebenszyklus einjähriger Organismen Mehrjährige Organismen mit überlappenden Generationen 1.9.5 Lebenstafeln Lebenstafeln enthalten Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen verschiedenen Altersstufen, Moralitätsmuster und Fekunditäten. Untersuchung der Kohorte (Gruppe von gleichaltrigen Individuen) Betrachtung der gesamten Population in einem bestimmten Zeitsegment (Momentaufnahme der Altersstruktur) 1.9.6 Überlebenskurven Typ I (konvex): Mortalität nimmt erst im Alter stark zu (z.B. Menschen) Typ II (linear): Mortalitätsrate ist relativ konstant (z.B. Samen in Samenbank) Typ III (konkav): hohe Mortalität bei jungen Organismen (typisch) 1.9.7 Metapopulation Die totale Population eines Gebiets, die durch das Standorts-Mosaik in mehrere Subpopulationen unterteilt ist, wobei jede dieser Subpopulationen eine eigene, interne Dynamik hat und die Subpopulationen durch Migrationen von Individuen bzw. Genen untereinander in Verbindung stehen. Stabilität der Metapopulation = Kolonisationsrate: Aussterberate der Subpopulationen 1.10 Positive Interaktionen 1.10.1 Definition positiver Interaktionen Positive Interaktionen sind Interaktionen zwischen Individuen oder Populationen, die das Wachstum, die Entwicklung bzw. die Fitness auf der Ebene von Individuen oder Populationen steigern. 1.10.2 Kommensalismus Profitieren einer Art von der anderen, ohne dass diese beeinflusst wird. 1.10.3 Symbiose Enges Zusammenleben zwischen Individuen verschiedener Arten, die für beide Partner nützlich, in der Regel sogar lebensnotwendig ist. Im Verdauungssystem von Tieren finden sich hochdiverse Gesellschaften mikrobieller Symbionten, die u.a. beim Celluloseabbau helfen. Weitere Symbiose Beispiele sind Akazien und Ameisen (Ameisen schneiden Nachbarpflanzen zurück und attackieren Blätterfressende Herbivoren, kriegen dafür Wohnraum und Futter), oder Pilz-Bakterium-Ameise Symbiose (Bakterium produziert Antibiotika die parasitäre Pilze befällt und somit die von Ameisen kultivierten Pilze schützt). Flechtensymbiose ist notwendigerweise gar keine, denn es wurden schon freilebende Flechtenalgen gefunden. © 2003 Ana Sesartic 17 1.10.4 Mutualismus Mutualismus ist Interaktion verschiedener Arten zum beidseitigen Nutzen. Wichtige Mutualismen sind die zwischen Mensch und landwirtschaftlich genutzten Pflanzen bzw. Vieh. Ebenfalls wichtig ist der Mutualismus zwischen Pollinatoren (Bestäubern) und Blütenpflanzen. Mutualisten sind meist wenig auf bestimmte Arten spezialisiert und brauchen keine spezielle Ausbreitungsstrategie. Sexuelle Vorgänge sind in Mutualisten oft vollständig unterdrückt. (Einfache Lebenszyklen) 1.10.5 Parasitismus Parasiten leben in enger Assoziation mit einem oder wenigen Organismen einer anderen Art und beziehen von ihnen Ressourcen, töten sie aber normalerweise nicht direkt sondern schädigen sie nur. Hemiparasiten (wie z.B. Mistel) beziehen nur teilweise Ressourcen vom Wirt (Wasser und Nährstoffe), betreiben aber selber Assimilation. Parasiten spezialisieren sich zunehmend und Wirte entwickeln stetig Abwehrmechanismen (Wettrüsten). Es gibt viele oft wirtsspezifische Parasitenarten, deren Überleben von effizienter Ausbreitung erfolgt, denn Parasiten Vermehren sich sexuell um genetisch mit dem Wettrüsten stand zu halten. 1.11 Koexistenz und Nische 1.11.1 Fundamentale Nische n-dimensionaler Raum (n = Anzahl relevanter Umweltfaktoren) innerhalb dessen ein Organismus theoretisch leben und sich vermehren könnte. 1.11.2 Realisierte Nische Nische in der eine Art aktuell vorkommt. In Anwesenheit von Konkurrenten, werden Arten auf realisierte Nischen zurückgedrängt. Je nach Nischennutzung, Nischenüberlappung und der Breite des Ressourcenspektrums ergibt sich unterschiedlich hohe Artendiversität. 1.11.3 Konkurrenzausschlussprinzip Wenn zwei Arten die gleiche ökologische Nische besetzen, wird die unterlegene Art verdrängt. Durch Nischendifferenzierung können konkurrierende Arten jedoch koexistieren. (eine Grundlage der hohen Biodiversität) 1.11.4 Charakterverschiebung Physischer Unterschied zwischen zwei verwandten Arten entstand durch natürliche Selektion infolge Konkurrenz. Kann nach entfallen der Konkurrenz als evolutiver Fortschritt bestehen bleiben. 1.11.5 Räumliche Differenzierung Besetzung unterschiedlicher physikalischer Räume als Strategie zur Konkurrenzvermeidung. 1.11.6 Zeitliche Differenzierung Zeitliche Nischenverschiebung auf verschiedene Jahresabschnitte, bzw. verschiedenartige Wuchsrhythmik. Z.B im tropischen Regenwald können Pflanzen ganzjährig blühen, sie tun es aber nur in bestimmten Zeitfenstern, weil es dadurch zur Verminderung der Konkurrenz um Bestäuber kommt. © 2003 Ana Sesartic 18 1.12 Strategie 1.12.1 Definition Eine Strategie ist ein bestimmtes Aktivitätsmuster aus einer Reihe von Alternativen. Sie beschreibt komplexe Anpassungen (Lebenszyklus und Verhalten) an die Umweltbedingungen. Für Pflanzen ist sie eine Gruppierung von ähnlichen oder analogen genetischen Merkmalen. Unterscheidung der Strategietypen hängt vom geographischen bzw. taxonomischen Massstab ab. Evolutionär stabile Strategie (ESS): in Populationen in denen ESS vorherrscht können sich keine Mutationen oder alternative Strategien entwickeln und durchsetzen. Beispiel einer ESS ist die Ausbreitung. 1.12.2 Funktionelle Pflanzentypen Einteilung der Pflanzen je nach Lage der überdauernden Meristeme (Organe). Phaenerophyten: Sträucher, Bäume Chamaephyten: Zwergsträucher Hemikryptophyten: Erdschuttpflanzen Kryptophyten: Zwiebelpflanzen, etc. Therophyten: annuelle Pflanzen, überdauern als Samen 1.12.3 Trade-Offs Trade-Off: Investition in eine bestimmte Funktion geht auf Kosten der Investition in eine andere Funktion. Eine erfolgreiche Lebenszyklusstrategie muss Kompromiss der Ressourcenallokation für alle Trade-Offs finden um Fitness des Individuums bzw. der Art zu optimieren. Organismen können in folgende Eigenschaften Energie investieren: Wachstums- und Entwicklungsrate Grösse des Organismus Speicherung Ausbreitung Aufwendung für die Reproduktion 1.12.4 Strategien Nettozuwachs einer Population: dN/dt = rN (1 – N/K) t: Zeit, N: Populationsgrösse, r: spezifischer natürlicher Zuwachs, K: Kapazität K-selektierte Population: stabile Habitate in der Nähe der Kapazitätsgrenze Intensive Konkurrenz Weniger und grössere Samen Langsameres Wachstum Längere Generationszeit r-selektierte Population: instabile Habitate. Population bricht vor Erreichen der Kapazitätsgrenze zusammen. Hohe Fortpflanzungsrate Kleine Samen Schnelles Wachstum Kurze Lebensdauer r- oder K-Selektion kann es auch innerhalb einer Art geben in Abhängigkeit vom Habitat. CSR – Konzept: Competition: viele Stauden, Gehölzpflanzen Stress: Polsterpflanzen, einige Rosettenpflanzen, etc. Ruderal: Annuelle, Monocarp Perenne © 2003 Ana Sesartic 19 2 Grundlagen der Ökologie – aquatische Ökosysteme 2.1 Wasser als Lebensraum (Salinität) 2.1.1 Bedeutung aquatischer Lebensräume 71% der Erde sind von Wasser bedeckt Ozeane sind Klima- und Atmosphärenpuffer (CO2 und O2) 2‰ der Primärproduktion 100Mio t Biomasse jährlich gefischt Vertikal gestaffelte Lebensräume Planktonverbreitung v.a. in N und S Gewässern und an den Küsten (Auftriebszonen) Nur 6% ist Süsswasser (2/3 Grundwasser, 1/3 Eiskappen, <0.01% Seen) Lange Nahrungsketten (gute Nährstoffverwertung) 2.1.2 Stehende Gewässer Alter der Seen ist im Gegensatz zu Ozeanen limitiert. Alpenrandseen entstanden nach der letzten Eiszeit. Die grossen älteren Seen (Baikal, Malawi) haben viele endemische Arten. Seen als „Inseln“. (isolierte Biotope) 2.1.3 Fliessgewässer Fliessgewässer kann man als das Blutgefäss-System der Landschaft bezeichnen. Flusslandschaft besteht aus Fluss, Interstitial (Flussbett in Verbindung mit Grundwasser) und terrestrischem Umfeld. 2.1.4 Grundwasser Grundwasser hat chemisch und physikalisch konstante Faktoren. Temperatur und O2 Gehalt sind tief. Energie für Grundwasserbewohner kommt ins System durch Infiltration von der Oberfläche bzw. Chemosynthese. 2.1.5 Zonierung der Ozeane Ausdehnung des Ozeans umfasst die offene Wasserfläche, das Pelagial und die ufernahen Schelfgebiete. Benthal ist der Boden und Rand der Meere, bewohnt vom Benthos. Meeresoberfläche (Pleustal) wird bewohnt vom Neuston. Der offene Ozean (Pelagial) wird bewohnt vom Plankton (treibend) und Nekton (Schwimmend). Litoral (Küste) ist scharf Zoniert aufgrund der Salztoleranz der Bewohner. Stark beansprucht durch Wellenschlag und osmotische Wechselwirkungen. Uferzone ist tolerant gegenüber wechselnden Salzkonzentrationen. Schwarze Zone ist so gefärbt wegen Tintenstrichalgen und die weisse Zone wegen Salzverkrustung. An einer Gezeitenküste kann der Wasserspiegelstand bis zu 14-16m zwischen Ebbe und Flut schwanken. 2.1.6 Zonierung der Seen Seen werden nach der thermischen Schichtung eingeteilt ins Epilimnion (warm), Metalimnion (Sprungschicht) und Hypolimnion (kalt). 2.1.7 Dichteanomalie von Wasser Wasser hat Dipolcharakter aufgrund der in 105° Abstand angeordneten H-Atome. Es bilden sich Wasserstoffbrücken und dadurch Cluster. Bei 4°C sind die Cluster (und die Dichte) im Wasser am grössten. Je wärmer das Wasser wird, desto stärker © 2003 Ana Sesartic 20 zerfallen die Cluster und das Volumen vergrössert sich. Die Dichteanomalie gilt nicht strikt im Meer wegen dem Salz und grossem Druck in der Tiefe. 2.1.8 Löslichkeit von Gasen im Wasser Gase können sich im kaltem Wasser besser lösen als im warmen. Gesetz von Henry: Cs = Ks * dp Sättigungskonzentration des Gases = spez. Löslichkeitskoeffizient * Gas Partialdruck 2.1.9 Wärmekapazität Wasser hat eine grosse Wärmekapazität. Auf dem Weg Richtung N transportieren Meeresströmungen (z.B. Golfstrom) riesige Wärmemengen. 2.1.10 Wichtige Wasserinhaltsstoffe Die Stoffe des Wasser sind in einem Kreislauf auf Zeit verfügbar und kreisen durch die Stufen der Nahrungspyramide. Die Kreisläufe sind aber nicht geschlossen, ein Teil der Stoffe sedimentiert aus dem Wasser an den Grund oder verdampft. POC: Partical Organic Carbon DIC: Dissolved Inorganic Caron DOC: Dissolved Organic Carbon Natrium, Calcium, Kalium, Magnesium, Hydrogencarbonat, Chlorid, Nitrat, Sulfat, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxiod, Methan, Schwefelwasserstoff 2.1.11 Zirkulation / Stagnation von Wasserkörpern Winterzirkulation durchmischt den Wasserkörper in der horizontalen und vertikalen. In der Sommerstagnation schichtet sich der See thermisch. Warmes Wasser schwimmt und tauscht molekulare Stoffe nicht aus (partikuläre aber schon). Algen produzieren Sauerstoff. Durch unvollständige Rezirkulation nimmt der Gehalt an Pflanzennährstoffen in der Wassersäule im Lauf der Vegetationsperiode ab. Durch Rücklösung aus dem Sediment und erneuter Zufuhr vom Ufer werden die Depots während der Zirkulationsphase wieder aufgefüllt. Auch die Sauerstoffkonzentration nimmt in der Vegetationsperiode ab durch frühsommerliche Ausgasung. Dieser Sauerstoff fehlt dann im Tiefenwasser für den Abbau. 2.1.12 Einfluss von Wasserorganismen auf wichtige Wasserinhaltsstoffe Phytoplankton: O2: ↑ pH-Wert: ↑ Biomasse: ↑ Nährstoffe: ↓ 2.1.13 Bakterien: ↓ ↓ ↓ ↑ Fische / Zooplankton ↓ ↓ ↓ ↑ Osmotische Regulation Euryhaline Arten ertragen wechselnde Salzkonzentrationen (0.5-11%). Sie findet man v.a. im Uferbereich bzw. im Brackwasser. Im offenen Ozean sind Stenohaline Arten vertreten, die die höhere Salzkonzentration vertragen. (3.4% Salz im Meereswasser) Süsswasserarten ertragen kaum 0.3% Salzgehalt. © 2003 Ana Sesartic 21 2.1.14 Quellen Durch Ausgasung von Kohlendioxid an den Quellen durch Druckentlastung, kommt es zu Kalkausscheidung und –ablagerung. 2.1.15 Grundwasser- und Höhlenbewohner Die Grundwasserbewohner sind alte tigmotaktische Organismen (meist Kleinkrebse und Würmer), lang, farblos und blind. Tiefe Organismendichte, da wenig Nährstoffe vorhanden. Eiszeiten oder Erderwärmung wirken sich auf die Grundwasserorganismen katastrophal aus. (z.B. durch Ausbleib der Infiltration von O2 und Nährstoffen) 2.1.16 Fliessgewässer Headwaters: kleine Bäche aus verschiedenen Quellebieten. Schwanken stark in Wasserführung und Chemie. Unterlauf: stabile chemische und physikalische Bedingungen. Bodenbesiedlung innerhalb des Flussquerschnitts ändert sich in Abhängigkeit vom Bodensubstrat. Wichtigste Organismen im Fliessgewässer leben am Boden, es gibt nur wenig Plankton. 2.1.17 Flussabschnitt-Charakterisierung durch Leitfische Europäische Fliessgewässer können durch folgende Leitfische charakterisiert werden: Forellenregion (Bergbach, kaltes nährstoffarmes Wasser) Äschenregion Barbenregion (Mittelland) Brachsenregion (in CH ca. bei Basel) Kaulbarsch-Flunder-Region (Unterlauf) 2.2 Strahlung und Thermik 2.2.1 Strahlungsklima Weg der extraterrestrischen Strahlung: Reflexion an Wolken, Boden und Wasseroberfläche (Albedo) Absorption in Atmosphäre, Wasser, an Partikeln im Wasser Streuung in Atmo- und Hydrosphäre Fluoreszenz (Umwandlung von kurzwelligem in langwelliges Licht) Strahlung ändert sich je nach Tageslänge. (Winkel Erdachse-Sonne). Absorption in Atmosphäre ist im UV und IR Bereich sehr gross. Wasserdampf ist der wichtigste Absorber im IR Bereich. Streuung ist für die Farbe der Atmosphäre verantwortlich. Photosynthese basiert auf dem Spektrum des sichtbaren Lichts von 400-700nm. Je nach geographischer Breite ist Bilanz aus Ein- und Ausstrahlung verschieden. Global ist Gesamtbilanz von Ein- und Ausstrahlung null. Lokal ist Nettoeinstrahlung positiv oder negativ (wird über Winde, Meeresströmungen global ausgeglichen). 2.2.2 Reflexion an der Wasseroberfläche Anteil des vom Wasser reflektierten Lichts nimmt mit abnehmendem Einfallswinkel der Sonne zu. Reflexion bei Wind ist stärker, wegen der Wellen. 2.2.3 Absorption im Wasserkörper Wasser und Partikel absorbieren wellenlängenselektiv das Licht. Abnahme der Strahlung im Wasser folgt exponentiellem Verlauf (falls Wassersäule homogen). © 2003 Ana Sesartic 22 Absorption (bzw. der Auslöschungskoeffizient ε ) ändert sich im Jahreslauf, je nach Zusammensetzung der Partikel / Lebewesen im Wasser. Absorptionsgleichung: Iz = I0e-εz Im Meer gibt es bis in 300m Tiefe noch photosynthetisch aktive Organismen. Bei der Kompensationstiefe, d.h. wo noch 1% des Lichts übrig blieb, hört die trophogene Zone auf. (Photosynthese = Respiration) Absorption und Streuung zusammen ergeben die Lichtattenuation (Lichtabschwächung). Streuung erfolgt ebenfalls exponentiell. 2.2.4 Spektrale Transparenz Destilliertes Wasser hat grösste Transparenz im Blaubereich. Ultraoligotrophe Seen erscheinen tiefblau. In kalkreichen, sauberen Seen liegt das Maximum im blaugrünen Bereich. In eutrophen Seen im grün-gelben und in dystrophen Seen (z.B. Moorseen) in orange-braunen (Humin) Bereich. Blau-grünes Licht ist gut durchgängig und dringt am tiefsten ein. Rotes Licht nimmt im sauberen Wasser schnell ab. (in der Tiefe sieht man keine roten Farben) 2.2.5 Thermische Schichtung von Seen Dichte des Süsswasser ist maximal bei 4°C. Kälteres Wasser ist wieder leichter, was zur inversen Schichtung im See-Winter führen kann. Diese Dichteanomalie basiert auf dem Zerfall der Cluster und der thermischen Ausdehnung. Sie ist wesentlich für das Zirkulationsverhalten der Seen. Dimiktische Seen: zirkulieren zweimal. (flache windreiche Seen unserer Breiten) Monomiktische Seen: nur Winterzirkulation (tiefe windgeschütze Seen) Meromiktische Seen: Zirkulieren nie bis zum Grund Die Thermik stehender Gewässer wird hauptsächlich durch Einstrahlung und Verdunstung bestimmt. Epilimnion: erwärmte Oberflächenzone ohne grosse Temperatur-Gradienten Metalimnion: Sprungsschicht mit hohen Temperaturgradienten Hypolimnion: Tiefenwasserzone mit geringen Temperaturgradienten 2.2.6 Thermische Schichtung von Ozeanen Wärmekapazität des Wassers ist sehr hoch. Es kann viel Wärme speichern und gibt sie nur langsam wieder ab. Klimatische Pufferwirkung. Gemässigte Ozeane sind bis in ca. 200m Tiefe saisonal geschichtet. Ab ca. 500m Tiefe permanente thermische Schichtung. Wasserdichte ist auch von Salinität abhängig. Schichtet sich Süss- über Salzwasser, ergibt sich eine stabile thermokline Schichtung. 2.2.7 Thermik von Fliessgewässern Unmittelbar nach der Quelle zeigen Flüsse eine geringe Temperatur-Dynamik, diese nimmt mit der Fliesstrecke zu. Frieren im Winter nie total durch. Verschiebung der Kalt- und Warmphase im Jahresverlauf gegenüber der Strahlung um ein bis zwei Monate. 2.3 Nährstoffe als limitierende Ressource 2.3.1 Stoff- und Energietransfer Energie durchfliesst die Ökosysteme in einer Einbahnstrasse, d.h. die Wertigkeit der Energie nimmt ab, die Energie bleibt aber erhalten. Daher kann langfristig eine stufe der Nahrungspyramide nicht grösser sein als die vorhergehende. Durch Respiration verlässt Energie irreversibel einen Organismus. © 2003 Ana Sesartic 23 Bei allen Transformationen wird ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt Entropiezunahme. Offene Systeme wirken als Entropie-Pumpen. Ökosysteme halten ihre innere Ordnung durch Entropie-Export aufrecht. Recycling von Energie ist nicht möglich, das von Substanzen schon. Photosynthese (und z.t. Chemosynthese) liefern Energie für die Biosynthese. 2.3.2 Minimumgesetz nach Liebig Zu jedem Zeitpunkt begrenzt immer ein Element das Wachstum. Ertrag lässt sich nur steigern, wenn fehlendes Element erhöht wird. Während im Winter Temperatur und Strahlung den Wachstumsprozess im See bestimmen, sind es im Sommer die knappen Nährstoffe. Stehende Gewässer sind Systeme mit sehr knappen Ressourcen. Besonders die Ozeane und oligotrophe Seen. 2.3.3 Dynamik der Mehrfachvorräte Durch Steigerung mehrerer Faktoren, kann man eine höhere Umsatzrate der Photosynthese erzielen. 2.3.4 Limitierende Nährstoffe C:N:P = 106:16:1 gleichen sich in allen marinen Planktonproben. Die Algen haben sich an die sehr niedrigen P- und N-Konzentrationen im Meer angepasst. In Pflanzen beträgt C:N = 40:1 wenn weder P noch N limitierend sind. Limitierende Nährstoffe werden möglichst gut gespeichert. Dies ermöglicht Überleben an extremen Standorten. So speichern z.B. Kakteen Wasser und Blaualgen P- und N-Salze. 2.3.5 Essentielle Nährstoffe Essentielle Nährstoffe sind nicht substituierbar. Substituierbar sind nur solche Stoffe, die das selbe Element enthalten. Essentielle Elemente sind C, O, H, N, S, P, Makronährstoffe, Fe, Mg, Ca, K und in Spuren Cu, Co, Mo, Zn, B, Mn. Pflanzen nehmen Nährstoffe einzeln auf, Tiere meist als Paket mit der Nahrung. 2.3.6 Stöchiometrie des Wassers Natürliches Wasser ist ein Multikomponentensystem hoch verdünnter Lösungen. Seen ohne Abfluss, Salzseen und Ozeane haben höheren Salzgehalt als DurchflussSeen. Konzentration von Gasen ist abhängig von Beziehung AtmosphäreHydrosphäre via Henry-Gesetz und Feststoffkonzentration von Beziehung Lithosphäre-Hydrosphäre via Löslichkeitsgleichgewicht. Je länger die Verweilzeit ist und je mehr Kontakt mit Carbonat-haltigem Gestein vorkommt, um so mehr wird das saure Wasser neutralisiert. 2.3.7 Eignung des Wassers als Nährlösung Natürliche Seen und Ozean sind arm an Biomasse weil sie nährstoffarm sind. Je grösser die Eutrophierung desto höher die Produktion. Michaelis Menten Kinetik: die Aufnahmerate eines Nährstoffs richtet sich nach seiner Konzentration im Wasser und dem Bedarf der Oganismen an diesem Stoff. ( kein unendliches Wachstum, beim Maximum nützt auch weitere Nährstoffzufuhr nichts) 2.3.8 Abhängigkeit der Wachstums / Konsumrate vom SubstratAngebot Für gewisse Organismen muss zuerst ein genügend grosses Substratangebot vorhanden sein, damit sich die Aufnahme lohnt. Bei Überangebot kommt es zur © 2003 Ana Sesartic 24 Sättigung, da dann andere Prozesse die Wachstumsgeschwindigkeit bestimmen. Droop-Modell für Nährstofflimitiertes Wachstum: Algenpopulationen zeigen erst Wachstum nachdem die nötige Zellquote erreicht ist. Das Wachstum kommt dann zum Stillstand, wenn die zellinterne Konzentration wieder beim kritischen Wert angelangt ist. 2.3.9 Dosis – Response – Beziehung Einzelne Substrate zeigen bei geringen Dosen positive Wachstumsraten, bei zu hohen Konzentrationen wirken sie toxisch, die Wachstumsrate wird negativ. Ionen sind meist giftiger als komplex gebundene Spezies. Tiefe ph-Werte wirken sich auf folgende Weisen aus: Störung der Osmoregulation, der Enzymaktivität oder de Gasaustausches Erhöhte Konzentration toxischer Metalle (z.B. Aluminium) Qualitätsverringerung der Nahrung Verknappung des verfügbaren Kohlenstoffes 2.3.10 Photosynthese – Licht – Beziehung Lichtoptimum mit maximaler Umsatzrate ist bei der Photosynthese sehr gering. Im 3D Wasserkörper gibt es räumliche Nischen für unterschiedlicht Lichtempfindliche Organismen. 2.3.11 Nicht substituierbare Ressourcen Essentielle Nährstoffe sind nicht substituierbar. Kohlenstoff als Baustoff der Organismen, P als Bestandteil von ATP, DNA etc. und N als Proteinbestandteil sind ebenfalls nicht substituierbar. Bei heterotrophen Organismen decken die Ressourcen den Bedarf des Baustoffwechsels und die Energie für den Betriebsstoffwechsel. Autotrophe Organismen benötigen die Aufbaustoffe und die Energie separat. (Biosynthese) 2.3.12 Substituierbare Ressourcen Formen von Stickstoff (Nitrat, Ammonium, elementarer Stickstoff bei StickstoffFixierenden Spezialisten) sind substituierbar, nicht aber der Stickstoff selbst. Sauerstoff wird als Elektronenakzeptor (Oxidationsmittel, wird reduziert) bei Abbauprozessen verwendet. Er kann ersetzt werden durch Nitrat, Sulfat etc. 2.3.13 Stickstoff Pflanzen bevorzugen Ammonium (NH4+) als Stickstoffquellen, fehlt dieses, wird unter Energieaufwand Nitrat (NO3-) reduziert. Elementarer Stickstoff (N2) kann nur von Spezialisten (Cyanobakterien, Knöllchenbakterien) fixiert werden. Dazu sind stark reduktive Verhältnisse nötig. Nur nachts bzw. in spezialisierten Zellen ohne Photosynthese (O2 blockiert die Reaktion) kann Stickstoff in die Aminoform gebracht werden. 2.3.14 Sauerstoff Sauerstoff ist essentiell, der Gehalt im Wasser ist aber bescheiden. Sauerstoffminimum im Metalimnion, da dort vermehrt Abbaureaktionen stattfinden und nur wenig Sauerstoff nachgeliefert wird. Bei Photosynthese wird genau so viel Sauerstoff an die Umgebung abgegeben, wie beim Abbau bzw. bei der Respiration wieder verbraucht wird. Im Wasser wird der Sauerstoff aus der Photosynthese nicht völlig gelöst, sonder perlt teilweise an die Atmosphäre aus. Dies führt zu Sauerstoffdefiziten in der Nacht. Während die Nachlieferung aus der Luft im Fliessgewässer meist ausreicht, entstehen in stehenden eutrophen Gewässern © 2003 Ana Sesartic 25 Defizite, die entsprechende Anpassungen der Organismen erfordern. Sättigungslinie ist durch die Temperatur bestimmt. 2.4 Hydrodynamik 2.4.1 Strömungsarten – Wasserbewegungen Laminar bzw. turbulenter Wasserfluss Wellen, Oberflächenwellen, Wirbel (Eddies) Walzenbewegungen, Zirkulationen Schaukelbewegungen (Seiches) Gezeitenströme Uferparallele Strömungen (kinet. Energie + Coriolis-Ablenkung) Einschichtungen von Flusswasser entsprechend spezifischer Dichte Turbulenz ist für das Schweben des Planktons wichtig. Wirbeldiffusion hat eine geringe Energie, ist aber für den diffusen Stofftransport wichtig. Strömungen und Resonanz-Wellen besitzen grosse Energie und sind für den advektiven Stofftransport zuständig. Oberflächenwellen sind erst im Uferbereich wichtig. 2.4.2 Corioliskraft und Grosse Ströme Durch die Trägheit von Wasser gegenüber der Erdrotation (Coriolis-Kraft) kommt es zu zikulären Strömungen, die auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn bzw. auf der Südhalbkugel im Gegenuhrzeigersinn verlaufen. Die Coriolis-Ablenkung am Äquator beträgt 40’000km/Tag, an den Polen ist sie null. Circumpolare Strömungen verlaufen von West nach Ost. Die Meeresströme Transportieren Organismen und beeinflussen das Globale Klima (z.B. Golfstrom) Auch in begrenzten Systemen (z.B. Seen) findet Coriolis-Ablenkung statt. Dort läuft das Wasser durch uferparallele Führung im Gegenuhrzeigersinn auf der Nord- bzw. im Uhrzeigersinn auf der Südhalbkugel. 2.4.3 Vertikale Strömungen im marinen Bereich In polaren Zonen sinkt das kalte schwere Wasser ab und taucht wieder an den Küsten der Kontinente auf. Diese Upwelling Zonen sind sehr plankton- und fischreich. (Westküste Südamerikas, Südwestküste Afrikas) El Niño: In mehrjährigen Rhytmen reicht die Kraft des Auftriebswassers nicht aus um Oberflächenwasser zurückzudrängen. Warmes Wasser überschichtet kaltes, hohe Verdunstung, heftige Stürme, Veränderung des Klimas. Warmes Wasser ist nährstoffarm, enthält wenig Plankton, Nahrungskette ist gestört, Nährstoffmangel für Meeresbewohner. 2.4.4 Oberflächenwellen Innerhalb von Oberflächenwellen beschreiben Teilchen Trochoidenbahnen und werden nicht verdriftet. Mit der Tiefe nimmt die Amplitude exponentiell ab (jeweils um die Hälfte pro λ/9). Die Brandung aus windgetriebenen Oberflächenwellen und Gezeitenströmen ist enorm erosiv auf die Küste. 2.4.5 Gezeiten Periodische Schwankung des Meeresspiegels in Ebbe und Flut verursacht durch die Anziehungskraft von Sonne und Mond. Bei Neu- und Vollmond kommt es zu Springtiden, da Sonne und Mond auf einer Achse liegen. Bei Halbmond sind die Gestirne um 90° verschoben und es kommt zu Nipptiden. In abgetrennten Meeren ist der Tidenhub schwach, in Ozeanbuchten kann der Tidenhub bis zu 20m erreichen. © 2003 Ana Sesartic 26 2.4.6 Fliessgewässer In Fliessgewässern herrscht gerichtete Strömung. Im Unterlauf herrschen höchste Fliessgeschwindigkeiten. Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit nimmt gegen Mündung zu. Die Transportkraft ist direkt proportional zum Gefälle aber umgekehrt proportional zur Tiefe. Im Oberlauf werden grosse Brocken transportiert, dort ist die Sohle rau, es herrscht grosser Reibungswiderstand. Im Unterlauf wird feines Material transportiert. Flüsse transportieren jährlich Millionen von Tonnen als Partikel gelöstem Erosionsmaterial in die Meere, wo sich an den Mündungen oft Deltas bilden. Die Fracht ist in der Nähe des Äquators und in Monsungebieten am grössten. 2.4.7 Längsverlauf von Fliessgewässern Krenal (Quellregion, Bachtobel, Oberlauf, Headwaters): relativ gerades und enges Gerinne. Viel Materialverschiebung, wenig Nährstoffe. Ritral (Mittellauf, Oberlauf unterhalb der Schwemmebene bis zum Unterlauf): Fluss mäandriert, es bilden sich Auengebiete, Altarme werden abgeschnitten es entstehen Oxbow-lakes. Alle CH Flüsse gehören zum Ritral Potamal (Unterlauf): Rhein ab Basel. Breite überschwemmte Auengebiete, Gewässersohle wandernd, Erosion am Prallhang, Ablagerung am Gleithang (nach Korngrösse sortiert). 2.4.8 Grenzschicht Aufgrund der Viskosität des Wassers entsteht über jedem angeströmten festen Körper eine laminare Grenzschicht, in der die Strömung mit zunehmender Nähe zum Körper gegen Null absinkt. Stofftransport geschieht nur durch Diffusion. Durch Rauhigkeit der Sohle entstehen Tot- und Hinterwasserzonen, in der Wasser turbulent ausgetauscht wird, aber nicht strömt. Hier sedimentieren viele organische Partikel. 2.4.9 Anpassungen der Fliesswasserorganismen Morphologische Anpassungen: Flacher Körperbau Stromlinienförmiger Körper Grenzschichtbewohner klein Festhaltemöglichkeiten Beschwerung mit Ballast Physiologische Anpassungen: Ventilation der Tracheenkiemen Netzbau für Futtersammeln (Netz wird nicht ohne Strömungsreiz gebaut) Hämoglobin im Blut (im strömungsarmen eutrophen Wasser oder Interstitial) Anpassungen des Verhaltens: Rheophiles Verhalten (Strömungsliebend, können nicht im stehenden Wasser überleben) Emergenz-Verhalten (Landtiere die sekundär ins Wasser gehen, bzw. Teil der Entwicklung im Wasser durchmachen) Tag-Nacht Aktivität 2.4.10 Anpassungen der Planktonorganismen Viele Plankter leben in viskoser Umwelt (Zähigkeit des warmen Wassers geringer als im kalten), sind also von Grenzschicht umgeben. Sie müssen dauernd gegen das Absinken ankämpfen. Dies tun sie mittels: Eigenbeweglichkeit (Ruder, Geisseln, etc.) © 2003 Ana Sesartic 27 Kleine Dimensionen (gutes Schwebeverhalten) Erhöhung des Formwiderstandes durch passive Schwebehilfen (Fallschirm, Haare, Stacheln, Stengel...) Erniedrigung des spezifischen Gewichtes (Gas- und Ölvakuolen, Gallerte) 2.5 Intraspezifische Interaktionen 2.5.1 Wechselwirkungen in der Natur Abiotische Wechselwirkungen: Signalwirkung, Orientierung Modifizierte Wirkung Limitierende Wirkung Mutagene Wirkung (Strahlung) Biotische Wechselwirkungen: Signale, Reize Koexistenz Detrivorie Kooperation Konkurrenz Raub, Parasitismus 2.5.2 Wechselbeziehungen Auftreten von Organismen in Raum und Zeit (Demökologie) ist Resultat von autökologischen Ansprüchen und biologischen Wechselwirkungen (Synökologie). Steuernde Faktoren Signal- oder Orientierungshilfen (z.B. Licht) Modifizierende Faktoren (z.B. Winterpelz wegen tiefer Temperatur) Limitierende Faktoren Beeinflussen Population von der Nahrungsbasis her (Bottom up oder Top down) Mutagene Faktoren (z.B. Chemikalien und radioaktive Stoffe) 2.5.3 Biologische Wechselwirkungen Interspezifisch: Verschiedene Arten. Selektioniert die Arten in der Evolution. Anpassung und Spezialisierung. „Wettrüsten“ und Koevolution. Intraspezifisch: Inneralb der Art. Steuert die Fitness der Population, reguliert die Bestandesdichte direkt oder über Nutzung der gemeinsamen Ressourcen. Rivalenkämpfe, Brutpflege. Starke Konkurrenz wegen gleicher Bedürfnisse aufgrund gleichen Erbgutes, spielt aber nur eine Rolle, wenn Populationsdichte hoch, bzw. Kapazitätsgrenze überschritten ist. 2.5.4 Analyse der Wechselwirkungen Wechselwirkung Art1 Art2 Bedeutung Neutralismus 0 0 keine Beeinflussung Konkurrenz gegenseitige Hemmung Amensalismus 0 Hemmung, Toxine Parasitismus + Räuber kleiner als Wirt Raub + Räuber grösser als Wirt Kommensalismus + 0 Schmarotzer Mutualismus + + obligatorische Symbiose Protokooperation + + Zusammenwirken positiv aber fakultativ Unterschied von Herbivore, Prädatoren und Parasiten liegt in den Grössenverhältnissen zum Wirt und in der Vollständigkeit des Frasses. Carnivoren: Beute wird getötet und ziemlich vollständig gefressen © 2003 Ana Sesartic 28 Herbivoren: ernähren sich meist nur von einem Teil der Pflanze, sie wird i.d.R. nicht getötet Parasiten: viel kleiner als Wirt und töten diesen nicht, bei Massenbefall jedoch schädlich 2.5.5 Konkurrenz-Ausschlussprinzip Interspezifische Konkurrenz verschlingt viel Energie („Rüstungsindustrie“) und kann durch direkte Interaktion oder über die parallele Ausbeutung der Ressource erfolgen. Mit zunehmender Populationsdichte konkurrieren Individuen um Raum und Nahrung was sich auf Fortpflanzung, Wachstum und Mortalität auswirkt. Zwei Arten welche exakt die gleiche ökologische Nische besetzen, können auf die Dauer nicht koexistieren. Spezialisierung der Arten durch Evolution (Artenvielfalt) erlaubt Koexistenz wenn Artendichte gering ist. Konkurrenz wird erst wichtig, wenn Ressourcen knapp werden. Exploitive Konkurrenz (Ausschluss durch Konkurrenz) entsteht, wenn eine Ressource von min. 2 Arten genutzt wird, aber die eine unter den geg. Bedingungen immer besser ist. Die unterlegene Art ist aber bei anderen Bedingungen überlegen. 2.5.6 Faktoren innerartlicher Konkurrenz Dichteabhängige Faktoren: Nahrungsqualität/ -verbrauch Ausbreitung von Krankheiten Sterblichkeit Fruchtbarkeit Wanderung, Territorialität Dichteunabhängige Faktoren: Klima, abiotische Umwelt Zwischenartliche (interspezifische) Konkurrenz Sterblichkeit durch nicht ansteckende Krankheiten Bei hoher Dichte wird ein Wandertrieb ausgelöst. (Es ist nicht klar ob dies genetisch bedingt ist oder nicht.) 2.5.7 Intrinsisches Populationswachstum Intrinsisch = durch innere Veranlagungen gegeben Exponentielles Wachstum beruht auf konstanten Vermehrungs- und Todesraten. Mortalität und Wachstum sind aber dichteabhängig. Bei logistischem Wachstum geht man von beschränkter Kapazität des Lebensraumes aus und gleichzeitigem sinken der Wachstumsrate gegen Null, sobald die Zahl der möglichen Organismen die Kapazität des Lebensraumes erreicht hat. Bei Erreichen der Kapazität ist eine Population im stabilen Gleichgewicht, ist die Dichte geringer als K, wächst sie; ist sie grösser als K schrumpft sie. Einwirkung von fremden Arten hat je nach Trefferwahrscheinlichkeit zwischen erster und zweiter Art mehr oder weniger Einfluss. 2.5.8 Zeitverzögertes Wachstum und Überschiessen der Kapazität Futtersituation vor Eiablage ist entscheidend über die Anzahl Nachkommen. Die Futtersituation beim Schlüpfen kann jedoch grundlegend anders sein. Zeitverzögerte Reaktion auf die Dichte führt zu Populationsschwankungen, die auch über die Kapazität überschiessen können. Wegen Risiko-Verteilung gibt es of ungleich grosse Eigelege. © 2003 Ana Sesartic 29 2.5.9 Chaos Chaos ist dann zu erwarten, wenn ein hohes Wachstumspotential (hohe Eizahlen) und lange Intervalle zwischen den Reproduktionsschüben (Einmalige Reproduktion) zusammentreffen. Ein System kann nur vier Zustände einnehmen: Es strebt einem konstanten Zustand zu Es vollzieht regelmässige Schwingungen Es strebt dem unendlichen zu Es ist chaotisch 2.5.10 Dichteabhängige Entwicklung der Populationen Dichteabhängige Geburts- und Sterberaten führen zu einer Regulation der Populationsgrösse. Hohe Populationsdichte an Organismen begünstigt den Ausbruch von Ansteckenden Krankheiten und es kommt auch zu Verhaltensstörungen. Lockere Allianzen und Herdentrieb fördern umgekehrt die Natalität. Wandernde oder eingeführte Tiere können einheimische Arten mit tödlichen Krankheiten infizieren oder diese verdrängen. In grossen stehenden Gewässern ist die Möglichkeit der Begegnung von Geschlechtspartnern sehr gering, deshalb findet oft Klonbildung durch Parthenogenese statt. 2.5.11 Signale in der Umwelt Ausgesandte Signale können auch in Form chemischer Substanzen das Zusammenleben regulieren: Hormone steuern den Stoffwechsel innerhalb des Organismus Pheromone (Lockstoffe) führen Geschlechtspartner zusammen Kairomone (Schreckstoffe) warnen vor Feinden und können Abwehrmassnahmen auslösen 2.5.12 Revierverhalten Funktion von Revieren: Sicherung einer hinreichenden Ernährung Schutz der Jungtiere Zugang zu Sexualpartnern Zugang zu sicheren Unterschlupfen Revierinhaber kennen ihr Revier gut, die gejagten Aussenseiter ohne Revier werden häufig in Kämpfe verwickelt und brauchen viel Energie. Innerhalb des Reviers herrscht Intraspezifische Konkurrenz um Nahrung, Wohnraum, Laichplätze und Geschlechtspartner. 2.5.13 Schwarmverhalten Schwärme werden zusammengehalten durch die Konzentration jedes Individuums auf das Zentrum. Vorteile von Schwärmen: Areitsteilung, Schutz durch Verwirrung der Feinde, gemeinsame Jagd. Zusammenwirken vieler Denkprozesse führt zu neuen Leistungen, Jungtiere profitieren von Erinnerungen älterer Tiere (Massenintelligenz). Schwärme wirken auch der Inzucht entgegen. Nachteile sind, das im Zentrum des Schwarms weniger Futter vorhanden ist und die Schwarmränder gefährdeter sind und gegenüber grossflächig jagenden Carnivoren keinen Schutz bieten. 2.5.14 Crowding Effect (Gedrängewirkung) Crowding kann führen zu: © 2003 Ana Sesartic 30 Verhaltensstörungen (Gesteigerte Aggressivität, Kannibalismus, Unterlassen der Jungenpflege) Anstieg des Blutdrucks (Tod durch Nierenversagen als Konsequenz) Selbstregulation durch Ovulationshemmer, Resorption der Embryonen im Mutterleib, vermehrte Geburten von Männchen Revierverhalten Selbst in dichten Schwärmen braucht das Individuum private Umgebung, dessen Ausdehnung erblich codiert ist. In der Praxis ergibt sie sich durch den Radius der verteidigt werden kann. Crowdingeffekte treten auch schon auf, wenn die Kontakte mit den Geschlechtsgenossen zunehmen, ohne dass der Raum oder Futter limitierend sind. 2.5.15 Brutpflege Brutpflege vermindert die Mortalität der Jungen erheblich. Sie ist auch im Wasser sehr verbreitet. Die Eier und Embryonen werden mitgetragen. Eier werden mit energiereichem Aufbaumaterial versehen, um möglichst schnell und unabhängig vom Nahrungsangebot in der Natur zu wachsen. Sie werden auch im Litoral an Pflanzen angeheftet, weil es dort mehr Verstecke und genug Futter gibt. 2.5.16 Wanderung Vorteile der Laichwanderung für Lachse: Laichvorgang im Kies Hohe Futterdichte für die Jungtiere Jungtiere und adulte kommen sich nicht in die Quere Keine Geschützten Räume im Meer oder an der Uferzone, diese jedoch in Flussoberläufen vorhanden Nachteile: Gefahren an zwei Standorten und auf der Wanderung Anpassung an Veränderungen an allen Standorten nötig. Wanderung kann als Konkurrenzverminderung angesehen werden. 2.6 Nahrungsnetze, Nahrungsketten, Nahrungspyramiden Biogene Stoffumsatz: Produktion, Konsumation, Destruktion Organismen: Primärproduzenten, Konsumenten, Destruenten Destruenten nutzen abgestorbene organische Substanz als Energiebasis Konsumenten (Herbivoren, Carnivoren) sind heterotroph. 2.6.1 Trophiestufen Primärproduzenten sind autotroph und betreiben Biosynthese aus Grundstoffen mittels Photosynthese oder Chemosynthese. Bei Sekundärkonsumenten ist Nahrung gleichzeitig Energielieferant und Stofflieferant für die Biosynthese. Terrestrische Nahrungskette: Herbivoren fressen Pflanzen nur teilweise Jedes Beutetier einzeln gefangen Landpflanzen aus Zellulose und Lignin (schlecht verwertbar) Aquatische Nahrungskette: Phytoplankton wird vollständig gefressen. Primärproduktion muss von den Überlebenden getragen werden. Beuteerwerb meist mittels Filtrierung Algen enthalten viel Eiweiss und werden gut verwertet Lange Nahrungsketten © 2003 Ana Sesartic 31 2.6.2 Nahrungsnetz Nahrungsbeziehungen sind vielfältig und wirken stabilisierend. Konsumenten leben meist von mehreren Beutearten. Unterschiedliche Ernährung je nach Lebensstadien und Saison. Zusammenfassung koexistierender Formen in Nahrungsketten bzw. Trophiepyramiden. 2.6.3 Nahrungsketten Nahrungsketten sind in lineare Abschnitte aufgelöste Nahrungsnetze, die einzelnen Ketten sind vielfach miteinander verzahnt. Carnivoren / Herbivoren-Kette, Parasitenkette und Detrivorenkette. Bei den Carnivoren nimmt die Individuengrösse von Stufe zu Stufe zu, bei der Parasitenkette nimmt sie ab. Es gibt auch Tag- und Nacht-Nahrungsketten. Die Nachträuber müssen höher entwickelt sein, weil es schwieriger ist nachts zu jagen. Dafür sind Tagbeutetiere intelligenter als Nachtbeutetiere. 2.6.4 Nahrungspyramiden Zuordnung der Organismen zu einer Trophiestufe (Produzenten, Konsumenten x-ter Ordnung). In Pyramiden kann man vergleichen: Zahl der Individuen auf der gleichen Fläche Deren Biomasse (meist in g/m2 Trockengewicht) Energie welche von Stufe zu Stufe fliesst Thermodynamik verhindert, dass Energiefluss-Pyramiden auf dem Kopf stehen. Zahlen und Biomassen-Pyramiden können aber auf dem Kopf stehen. Die Qualität der Nahrung ist mitverantwortlich für die Pyramidenform. Ca. 90% der Energie gehen beim Übergang von einer zur nächsten Stufe als Betriebsstoff verloren. 2.6.5 Energiefluss Der Energiefluss ist eine Einbahnkette durch das Ökosystem. Bei jedem Übergang von einer Stufe zur Nächsten geht Energie verloren. (Energiemenge reduziert sich um ca. eine Dezimale.) Der trophische Wirkungsgrad bezeichnet den Anteil der Energie, der in Form von Wachstum bei der nächsthöheren Stufe messbar wird im Vergleich zur aufgewendeten Energie. 2.6.6 Futtereffizienz Gleiche Menge Futter bringt im Schnitt die ca. gleiche Sekundärproduktion. Die Grösse der Organismen, die dieses Futter Fressen ist für die Geschwindigkeit des Umsatzes wesentlich. 2.6.7 Bergmannsche Regel – Allen Regel Grosse Tiere haben eine bessere Relation von Oberfläche und Volumen. Kleine Tiere müssen pro Zeiteinheit mehr fressen als grosse. Bergmann: Die Körpergrösse von Tieren gleicher systematischer Kategorie nimmt zu den Polen hin zu. Allen: Säuger in kalten Klimazonen haben gedrungene Körperform und kurze Körperanhänge. Säuger in warmen Klimazonen haben vergrösserte Körperoberfläche durch grosse Ohren, längere Körperanhänge, und sind graziler gebaut. © 2003 Ana Sesartic 32 2.6.8 Räuber-Beute-Beziehungen (Lotka-Volterra) Die Individuenzahlen von Räuber und Beute schwanken bei sonst konstanten Bedingungen periodisch. Die Durchschnittsgrösse einer Population ist konstant. Es gibt eine Phasenverschiebung der Schwingungen der Populationsdichten von Räuber und Beute. Im See ist eine echte Räuber-Beute-Beziehung möglich. Dadurch entstehende sogenannten Klarwasserstadien. Nicht alle Räuber sind in der Lage ihre Beute nachhaltig zu kontrollieren, insbesondere die Jäger (ähnliche Grösse von R und B) nicht. Hingegen können Parasiten (grosse B, kleine R) und auch Filtrierer (R deutlich grösser als B) die Beutepopulationen einschneidend dezimieren. Wachstumsverhältnis der Beute ändert durch den Frassdruck. Wird viel Beute gemacht, hat diese weniger intraspezifische Konkurrenz und die Individuen werden grösser – und umgekehrt. Somit gibt es im mittleren Bereich ein Maximum. 2.6.9 Beutevermeidungsstrategien Morphologische, physiologische und verhaltensmässige Anpassungen zum Schutz / Abwehr von Feinden: Grössere Individuen sind konkurrenzstärker als kleine Kleine Individuen können sich besser verstecken Morphologische Anpassungen: Panzer, Schuppen, Stacheln, Nesselkapseln, Gebiss, Geweih, etc. Tarnung: kryptische Tracht, Mimikry, Durchsichtigkeit, etc. Chemische Abwehr, meist gekoppelt mit Warnfärbung Schleimabsonderung oder Tintensekret Saisonale Änderung der Körperform (z.B. bei Daphnien Ausbildung von Helm oder Nackenzahn um sperrig für kleinere Räuber zu werden) 2.7 Antrophogene Störung der Gewässer 2.7.1 Ökomorphologie In der CH sind 95% der ehemaligen Feuchtgebiete verschwunden und viele Bäche sind eingedohlt worden. Die grösseren Gewässer sind reguliert und hydrologisch verändert. Viele Gewässer müssten renaturiert werden, bloss wenige Kilometer pro Jahr werden aber revitalisiert. 2.7.2 Qualitative und quantitative Bedrohung der Gewässer Qualitative Bedrohung: Häusliches Abwasser (Fäkalien, Waschmittel, etc.) Gewerbliches und industrielles Abwasser (org. und anorg. Inhaltsstoffe) Quantitative Bedrohung: Resultiert aus Nutzungskonflikten (Drainage, Uferverbauung, Strassenbau...) Physikalische Eingriffe: Wärmeentzug, -Eintrag, Pumpspeicherkraftwerke, Veränderung des Wärmehaushalts und der thermischen Schichtung, Trockenlegung des Litorals, etc. Kategorien der Abwasserinhaltsstoffe: Leicht abbaubare organische Stoffe: Ökosysteme sind auf solche Stoffe angepasst, Endprodukte oft anorganische Bausteine in oxidierter oder reduzierter Form Abhilfe durch: Trennsystem der Kanalisation Schwer abbaubare organische Stoffe: Abbau dieser schädlichen Inhaltsstoffe benötigt längere Anpassungszeit. Schränken Wassernutzung schon in © 2003 Ana Sesartic 33 geringen Mengen stark ein und reichern sich in der Nahrungskette an. (z.B. halogenierte Kohlenwasserstoffe, Mineralöl, Phenole, org. Komplexbildner) Abhilfe durch: gesetzliche Massnahmen, Aktivkohle-Filtration Eutrophierende Stoffe: anorg. Nährstoffe die zur Steigerung pflanzlicher Produktion führen. (z.B. Phosphor) Abhilfe durch: P-Verbot in Waschmitteln, ARA mit P-Fällung, TiefenwasserAbfluss, See-Belüftung. Nicht abbaubare Stoffe: anorganische Stoffe, insbesondere Salze, Schwermetalle Abhilfe durch: Massnahmen an der Quelle, Nebeneffekt in ARA durch adsorptive Mitfällung in Flockungsfiltrationen 2.7.3 Restwasser Elektrizitätswerke fragmentieren das Habitat Fliessgewässer. Organismen können nicht mehr wandern. Wasserkraftwerke halten Wasserüberfluss im Sommer zurück und geben ihn im Winter ab. Eine bestimmte Restwassermenge darf nicht unterschritten werden. Abflussmenge Q347 wird so ermittelt, dass Q347 dem 10. kleinsten Wert entspricht, diese natürliche Niedrigwassermenge wird um 1/5 gekürzt und ergibt dann den Restwasserwert. 2.7.4 Abfluss Rund 1/3 des Meteorwassers gelangt in die Bäche. Das Abflussregime ist beeinflusst durch die Hydrologie des Einzuggebietes. Kurzfristige extreme Schwankungen in lokalen Einzugsgebieten verwischen sich in grossen Gewässern. Langfristige Abflussmengen folgen der saisonalen Entwicklung der Niederschläge bzw. der Schneeschmelze. Das Natürliche Abflussregime wird bei vielen Gewässern durch Wasserkraftnutzung mit Speicherbetrieb überlagert. Extreme Hochwassersituationen werden durch Regulierung durchflossener Seen aufgefangen. Die CH ist sehr wasserreich, hat aber wegen den Wasserkraftwerken kaum noch natürliche Gewässer. 2.7.5 Eutrophierung Die limitierende Wirkung des Phosphors wird durch den antrophogenen Eintrag beseitigt. Grosse Wassermassen sind sehr träge und dämpfen dies zuerst, dafür wirkt aber auch die Eutrophierung lange nach. Frühe Kläranlagen entfernten Phosphor noch nicht, so das 70% noch im Wasser verblieb. Bei anaeroben Seen löst sich auch P aus dem Sediment. Massnahmen an der Quelle (Herabsetzung der externen Zufuhr von Schadstoffen und Düngstoffen) sind nötig um Eutrophierung zu senken. Eutrophierung wirkt sich negativ auf den Fischbestand aus. Fische wachsen zu schnell und der Laich kann nicht in anaerobem Milieu der Tiefenschicht überleben. 2.7.6 Selbstreinigung Autolyse: in Zellen abgestorbener Organismen werden Enzyme frei die Selbstverdauung durchführen. Mikrobieller Abbau: organische Reste dienen Kleinlebewesen als Nahrung Mineralisation: aerobe Zersetzung. Bei genug O2 oxidieren Nitritbakterien Ammonium zu Nitrit, dieses wird von Nitratbakterien zu Nitrat umgesetzt. Fäulnis: anaerobe Zersetzung. Anaerobe Bakterien zersetzen org. Substanzen zu CO2, Dihydrogenphosphat, und giftigen Substanzen wie Methan, Ammoniak und Schwefelwasserstoff © 2003 Ana Sesartic 34 2.7.7 Saprobien- und Makroindex Saprobienindex: Beurteilung der Gewässer nach Fäulegrad. Polysaprobe Gewässer müssen mehr abbauen als sie aufbauen. Hypertrophe Seen produzieren mehr als sie abbauen können. Es kommt zur Faulschlammbildung. Makroindex: Beurteilung anhand der Präsenz oder Absenz der empfindlichen Steinoder Köcherfliegenlarven. 2.7.8 Abwasserreinigung Konzept von Kläranlagen: 1. Stufe: physikalisch-mechanische Reinigung 2. Stufe: Abbau organischer Stoffe durch Mikroorganismen in der belüfteten Zone (Nitrifikation) und Denitrifikation in der unbelüfteten Zone 3. Stufe: Ausfällung von Phosphat 4. Stufe: Filtrationsstufe 2.7.9 Seesanierung Sanierung der Seen erfolgt durch künstliche Belüftung des Tiefenwassers oder des Sediments mit reinem Sauerstoff oder durch Anreicherung des Tiefenwasser mit Sauerstoff an der Oberfläche und anschliessender Rückführung. 2.8 Ökologische Nische und Einnischung 2.8.1 Definition Die Nische einer Art ist das n-dimensionale Hypervolumen, innerhalb welchem sie lebensfähige Populationen erhalten kann. Es ist also ein Konzept, das die Bedürfnisse der Organismen einer Art beschreibt und somit für diese Art charakteristisch ist. Spezifische Lebensweise einer Art in einem bestimmten Lebensraum. Es beinhaltet auch die von biotischen und abiotischen Faktoren geprägten Wechselbeziehungen der Art zu den verschiedenen Ressourcen. 2.8.2 Eindimensionale Nische Stenök: Art mit engen Ansprüchen, gegenüber ändernden Umweltfaktoren intolerant (z.B. stenohalin, stenotherm) Euryök: Tolerant gegenüber Umweltfaktoren (z.B. euryhaline Brackwasser Arten) Darstellung der eindimensionalen Ökologischen Nische durch eine Glockenkurve die das Gedeihen eines Organismus in Abhängigkeit von einem sich verändernden Umweltfaktor beschreibt. Im optimalen Bereich herrscht maximale Aktivität. Die Maximal- und Minimalwerte sind Letalpunkte. 2.8.3 Ökogramme Zeigen die Ausdehnung einer Spezies bezüglich zweier Faktoren. Die Überlappung in Ökogrammen weist auf Konkurrenz hin, dies wird aber möglichst vermieden, da es Energie kostet. 2.8.4 Fundamentale Nische – Realisierte Nische Fundamentale Nische: beschreibt den durch die abiotischen Umweltfaktoren definierten n-dimensionalen Raum in welchem eine Art potentiell lebensfähige Populationen erhalten kann. Realisierte Nische: ist der entsprechende Teilraum, der bei Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen den Lebewesen besetzt wird. © 2003 Ana Sesartic 35 2.8.5 Nischenseparation Köcherfliegenlarven bauen unterschiedlich dichte Netze, wessen Bau durch eine minimale Fliessgeschwindigkeit ausgelöst wird. Altertümliche und wenig konkurrenzstarke Arten konnten sich nur auf abgelegenen Inseln erhalten. Die Entwicklung neuer Arten ist auf Inseln bei geringerer Konkurrenz besser möglich, denn auf grossen Kontinenten sind die meisten Nischen schon besetzt. Es gibt mehr Arten als Nischen. Bei Invasion von Spezialisten kommt es zur Ausrottung einheimischer Arten. 2.8.6 Wiederbesetzung einer Nische nach Störung Insekten zeigen eine Drift flussabwärts. Somit werden Nischen im Oberlauf leer. Kompensation erfolgt durch wandern der Larven stromaufwärts und Verbreitungsflug der Imagines. 2.8.7 Vermeidung von Konkurrenz Unterschiedliche Aktivitäten zu bestimmten Tages- bzw. Jahreszeiten Unterschiedliche Fortpflanzungszeiten Unterschiedliche Nutzung des Nahrungsangebots im Lebensraum Unterschiedliche Lebensräume Durch Saisonalität sind Nischen immer besetzt, aber jeweils abwechslungsweise durch verschiedene Arten. 2.8.8 Adaptive Radiation Entstehung vieler neuer Arten aus einer Stammform durch Einnischung in erdgeschichtlich kurzer Zeit. Aufspaltung einer Gründerart in viele Arten durch Anpassung an verschiedene Umweltbedingungen. Nahrungsvielfalt und fehlende Konkurrenz starke Vermehrung, grosse genetische Vielfalt (Mutationen) Konkurrenz um Raum und Nahrung Selektionsdruck Spezialisierung beim Nahrungserwerb neue ökologische Nischen 2.8.9 Konvergenz Zunehmende Ähnlichkeit (von Organen und Organismen) zweier phylogenetisch unabhängiger Linien bei gleichem Selektionsdruck. Mit zunehmender Artenzahl steigt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Konvergenzen. Stellenäquivalenz: Tiere in verschiedenen Regionen oder Kontinenten besetzen dieselbe ökologische Nische. Konvergenz: Stellenäquivalente Tiere bilden ähnliche Merkmale aus wodurch sie an ihre ökologische Nische angepasst sind. Konvergenz bei Eintagsfliegenlarven: abgeplattete Form für Leben in Grenzschicht 2.8.10 Funktionelle Gruppen Saisonale und räumliche Besetzung von Nischen erfolgt oft nach funktionellen Kriterien. anstelle von systematischen Einheiten werden funktionelle Strukturen verglichen (z.B. unterschiedliche Schwebetypen von Plankton je nach Jahreszeit) 2.8.11 River – Continuum – Concept Schematische Darstellung eines Flusses als Kontinuum von ökologischen Faktoren und Lebensgemeinschaften. Oberlauf: allochtone Zufuhr von Nahrung von aussen (Laub). Primärproduktion gering aber von hoher Qualität. Zerkleinerer und Sammler. © 2003 Ana Sesartic 36 Mittellauf: grössere autochtone Produktion via Photosynthese. Sammler und v.a. Weidegänger. Unterlauf: mitdriftendes organisches Feinmaterial. Sammler Kreislaufprozesse lösen sich in Spiralen auf, weil der Produktionsort nicht mit dem Abbauort übereinstimmt. 2.9 Verteilung in Raum und Zeit, Ausbreitung der Arten 2.9.1 Arten-Areal-Kurven Diese Kurven zeigen die Individuenzahl in Abhängigkeit von der Biotopfläche auf. Organismen brauchen eine Mindestfläche zum Überleben. Mit jeder Nahrungskettenstufe nimmt Raum- und Nahrungsbedarf zu. Revierverhalten ist darum besonders unter grosen Räubern ausgeprägt. Elimination von Schlüsselräubern (durch Arealverkleinerung) kann Biozönose dramatisch verändern. Je grösser die Stichprobengrösse (Areal), desto grösser die Artenzahl. Zunehmende Artendiversität von den Polen zu den Tropen. 2.9.2 Mosaikzyklus-Konzept Zentrale Ursache für raum-zeitliche Dynamik sind Störungen. Das MosaikzyklusKonzept beschreibt die dynamische Entwicklung naturnaher Biotope und Landschaften. Viele Arten schützen sich vor Konkurrenz und Extinktion durch bewohnen von Nischen. In der Ausbreitung eingeschränkte Arten zeigen eine Mosaikstruktur in der Arten-Areal-Kurve. Winzige Arten lassen sich schlecht ausrotten, da sie sich schnell anpassen können, während grosse Organismen durch direkte Einwirkung (Raub) und durch Konkurrenz (Lebensraum wird kleiner) schneller von Ausrottung bedroht sind. Wald bildet oft ein stabiles System von Zyklen einzelner Standorte, die Abfolge nach einer Störung entspricht sekundärer Sukzession (dh. Ohne Bodenaufbau). 2.9.3 Inseltheorie Viele Tierarten benötigen einen Gesamtlebensraum, der sich aus verschiedenen, oft auch miteinander verbundenen, Biotopen zusammensetzt. (z.B. Froschwanderung) Bei zehnfacher Flächenvergrösserung verdoppelt sich die Artenzahl. Durch zunehmende Distanz vom Festland nimmt die Immigration von Arten auf eine Insel bei gleichbleibender Extinktionsrate ab. Die Häufigkeit der Einwanderung und Extinktion bestimmen die Artenzahlen auf einer Insel. Kleine Insel: grosse Extinktion, wenig Ressourcen und Nischen, hohe Konkurrenz Grosse Insel: grosse Einwanderung, da Wahrscheinlichkeit zum Stranden bei grosser Uferlinie grösser. 2.9.4 Ökologisches Gleichgewicht. Ökologisches Gleichgewicht entspricht einem dynamischen Auf und Ab. In der Natur besteht ein Fliessgleichgewicht als Folge von Zuwachs und Verlust. Störungen sind verantwortlich dafür, dass es nicht nur Klimaxgesellschaften gibt sondern verschiedene Sukzessionsstadien. Durch Aufgabe der Nutzung sind viele Ökosysteme bedroht. (z.B. Riedlandschaften) 2.9.5 Sukzession Zeitliches Nacheinander von verschieden zusammengesetzten Pflanzenbeständen an demselben Wuchsort (Entwicklungsreihe von Pionier zu Klimax). Sukzessionsrichtung: © 2003 Ana Sesartic 37 Primär progressiv Sekundär progressiv (Regeneration) Regressiv Discessiv = richtungsneutral Achtung! ≠ Zonierung (graduelle Unterschiede von Ökofaktoren) Durch Störungen, welche sich in bestimmtem Zeit-Raum-Muster ereignen, wird Entwicklung eines Gebietes immer wieder zurückversetzt. Artendiversität zur Beginn der Sukzession gering (Pionierpflanzen), wächst aber an, es gibt viele Generalisten und einige Spezialisten. Im Klimax ist sie oft geringer als vorher, da es nur noch Spezialisten gibt. Vereinfachte Eigenschaften von Sukzessions- und Endstadien der Ökosystementwicklung: Charakteristikum des Ökosystems Entwicklungsstadien während Sukzession Klimaxstadien Produktion : Biomasse Hoch Niedrig Artendiversität Meist niedrig Meist hoch Nischenbreite der Arten Eher breit Eher eng Lebenszyklus Oft einfach Oft komplex Selektionsbedingungen r-Selektion K-Selektion Tiergemeinschaft dominiert durch Herbivoren (autotrophe Sukzession) oder Detrivoren (heterotrophe Sukzession) Herbivoren und Detritivoren, ferner Carnivoren 2.10 Lebenszyklus-Strategien im Wasser 2.10.1 Strategien des Überlebens r-Strategie: Grosse Wachstumsrate Kurzlebige Generationen Viele Nachkommen Schnelle Nutzung der kurzzeitig vorhandenen Ressourcen Meist kleine Organismen Grosses Verbreitungspotential Unvorhersagbare, temporäre Habitate K-Strategie: Geringe Wachstumsrate Langlebige Generationen Wenige Nachkommen Viele Anpassungen zur effizienten Nutzung der Ressourcen Meist grosse Organismen Geringes Verbreitungspotential Elterliche Fürsorge (bei Tieren) Vorhersagbare, konstante Habitate Plankton ist im Vergleich zu Meeressäugern alles r-Strategen, differenzieren aber untereinander. Bei hohem Nahrungsangebot eher r-Strategen, bei Nahrungsmangel eher K-Strategen. In Höhlen ohne zusätzliches Nahrungsangebot legen die Organismen weniger, aber grössere Eier und haben eine lange Entwicklung. © 2003 Ana Sesartic 38 2.10.2 Konkurrenzvermeidungsstrategie Innerartliche Variabilität: verschiedene Entwicklungsstadien stellen unterschiedliche Nahrungs- und Wohnraumansprüche an den Lebensraum. Beispiel: Insekten. Larvenentwicklung im Wasser, Adulte auf Land. 2.10.3 Trochopteren Emergenz Larvenentwicklung erfolgt im Wasser, die Adulttiere wechseln nach dem Schlüpfen ans Land und legen ihre Eier wieder ins Wasser ab. Die Emergenz (Wechsel Wasser – Land) findet nach Absolvierung von einer artspezifischen temperaturabhängigen (Temperaturtage) Entwicklung mit lunarer Periodizität statt. Wiederkehrende saisonale Ereignisse bewirken spezifische AnpassungsMechanismen. Unvorhersehbare Störungen verursachen grosse Verluste bei den Organismen. © 2003 Ana Sesartic 39 3 Naturschutz 3.1 Grundlagen 3.1.1 Was ist Ökologie und was nicht Bioökologie (Umweltbiologie): Naturwissenschaft von den Beziehungen der Lebewesen untereinander und zur unbelebten Umwelt (inkl. Einflüsse des Menschen). Nicht normativ! (d.h. wertfrei, objektiv) Townsend, Begon, Harper: Untersucht Verteilung und Häufigkeit von Organismen. Gibt Informationen darüber wie Beziehungen der Lebewesen untereinander und zur unbelebten Umwelt sind, aber nicht wie sie sein sollten! Dafür ist Natur- und Umweltschutz zuständig. Systemanalyse, Gesamtbetrachtung: Lehre von den Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen bzw. Prozessen; Vernetzungen, Systemtheorie. Nicht normativ! Philosophische Ökologie: Betrachtung der Beziehung Mensch – Natur im philosophischen Sinn; deep ecology; Ganzheitsbetrachtung Naturschutz: Gesamtheit der Massnahmen zur Erhaltung von Tieren und Pflanzen wildlebender Arten, ihrer Lebensgemeinschaften und –grundlagen. Oft auch Kulturlandschafspflege. Normativ! (wertend) ≠ Tierschutz (Haus- / Zootiere) Umweltschutz: Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen, sowie Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. (Art. 1 USG) Normativ! Ökologismus, ökologische Bewegung: Politische Weltanschauung, die sich auf die Bioökologie beruft. Normativ! Personalunion zwischen Bioökologie und Naturschutz. Natur- und Umweltschutz haben auch ethische Komponente. 3.2 Die Konzepte Umwelt, Umweltschutz und Mitwelt 3.2.1 Definitionen Umwelt: Gesamtheit aller ökologischen Faktoren, die effektiv auf einen Organismus oder Organismen einwirken. Umweltschutz: Massnahmen zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Gesundheit des Menschen einschliesslich ethischer und ästhetischer Ansprüche vor schädigenden Einflüssen aus Landnutzung und Technik. (Biologischer und technischer Umweltschutz) Mitwelt: Mensch als Mitglied der Gemeinschaft von Lebewesen. 3.2.2 Kritik am Begriff „Umwelt“ Der Begriff „Umwelt“ setzt automatisch den Menschen in den Mittelpunkt. Dieses antrophozentrische Denken hat zur Plünderung der Ressourcen und Schädigung der Natur durch den Menschen geführt. Der Mensch sollte lernen sich als Mitgeschöpf aller anderer Lebewesen zu betrachten und sich in die Natur einzufügen, anstatt sich im Zentrum zu sehen. © 2003 Ana Sesartic 40 3.3 Ökosystem: Ein wichtiges Konzept der Bioökologie 3.3.1 Hierarchischer Aufbau der Lebewelt Ganzheit Zelle Organismus Biozönose Funktionelle Einheiten Verbände gleichartiger Bausteine Bausteine Organell Organe Makromoleküle Zellen Funktionelle LandschaftsArtengruppen Ökosysteme Populationen Formationen Organismen Biome Mizelle Gewebe (Membranen...) Biosphäre Lebensgemeinschaften (Ökosystem) Pfeilrichtung zeigt den zunehmenden Organisationsgrad. Je nach Organisationsstufe bedeutet gleicher Einfluss ganz verschiedenes. Zum Teil können Massnahmen auf der Ebene von Biotop- und Ökosystempflege ausreichen, z.T. müssen Massnahmen auf internationaler bzw. kontinentaler Ebene durchgeführt werden. 3.3.2 Holismus und Reduktionismus: wichtige Konzepte Holismus: Ganzheit nur auf Stufe der Ganzheit verstehbar. Ganzes mehr als die Summe seiner Teile. (Emergenz, Neues) Reduktionismus: aus Eigenschaften der Teile ist auch das Ganze verstehbar. Kausal-analytischer Ansatz. 3.3.3 Ökosystem Ein Ökosystem (Biogeozönose) umfasst einen Biotop (Lebensort, Habitat, abiot. Standort) und eine Biozönose (Organismen- bzw. Lebensgemeinschaft). Die Biozönose ist abhängig vom Biotop, denn er bestimmt die Auswahl der Organismen. Das Ökosystem wird beeinflusst von unabhängigen, ökosystembildenden Faktoren wie Grossklima (Strahlung, Niederschläge, Wind), Relief, Muttergestein (Boden, Nährstoffe, Wasser, Luft), Zeitfaktor, Organismen und dem Mensch als besonderen Faktor. Artenzahlen in einem Bestand (einige ha) im Laubmischwald in ebener Lage auf Mischgestein im schweizer Mittelland: (Total 3'000 Arten) Tiergemeinschaft, Pflanzengemeinschaft, Verschiedene Mikroorganismen-Gem. Zoozönose Phytozönose Algen Pilze Bakterien 2000 100 100e 800 Viele 100 Artenbestand in einigen 10km2 Landschaft ohne Stadt und See im CH Mittelland: Fauna Flora Versch. Algen Pilzflora Protistenflora ≥ 10’000 1’000 1’000e Einige 1’000 Viele 100 3.3.4 Merkpunkte zum Leben ökologischer Systeme Offenheit bezüglich Energie, Stoffen und Information Erhaltung von Energie und chemischen Elementen © 2003 Ana Sesartic 41 Energiefluss (nicht Kreislauf) → mit Kohlenstoffkreislauf gekoppelt (Photosynthese und Atmung) → Biosysteme schaffen Ordnung; anorganische Systeme zunehmende Entropie ! → Energie wichtig auch als Wärme, Wind, Steuerung von ökologischen Prozessen, etc. Stoffkreislauf → durch Energiefluss angetrieben → grosse Stoffmengen in Reservoiren, nur geringe im Umlauf → Kreislauf offen oder geschlossen, je nach Stoff und Grenze Vielzahl von Teilen und Prozessen Wechselwirkungen zwischen Teilen, Interdependenz → meist gegenseitige Abhängigkeiten (Rückkopplung) A ↔ B Veränderung der Arten (Teile) selbst im Laufe der Zeit durch Mutation, Selektion, usw. → Zeitabhängigkeit, Geschichtlichkeit und Einmaligkeit biologischer Systeme! Hierarchischer Aufbau Entstehung von ökologischen Systemen: → Sukzession (Tage bis Jahrhunderte): gerichtete Abfolge verschiedener Ökosysteme am gleichen Ort (kann auch zyklisch sein). (Keine klare Abgrenzung zu) → Evolution und Koevolution (Jahre bis Jahrmillionen), d.h. genetische Veränderungen der Arten. Das Ganze ≠ Summe seiner Teile → Es entsteht grundsätzlich Neues mit neuen Eigenschaften, welche nicht alle aus den Eigenschaften der Teile voraussagbar sind. 3.3.5 Typologie der Ökosysteme aufgrund des Einflusses des Menschen Ökosystemtypen und ihre Gliederung unter dem Gesichtspunkt menschlicher Beeinflussung und Nutzung: Bioökosysteme: Überwiegend aus natürlichen Bestandteilen aufgebaute und durch biologische Abläufe gekennzeichnete Ökosysteme. Natürliche Ökosysteme Naturnahe Ökosysteme Halbnatürliche Ökosysteme Agrar- und Forst-Ökosysteme Techno-Ökosysteme: Überwiegend aus technischen Strukturen und Funktionen bestehende, von Menschen bewusst geschaffene Systeme. Dorf-, Stadt-, Grosstadt-, Industrie-, Verkehr-, u.a. Ökosysteme 3.4 Biodiversität der Erde und der Schweiz Biodiversität ist die Vielfalt an biologischen Einheiten: ökosystemare Diversität, Arten-Diversität, Genetische Diversität (Rassen) © 2003 Ana Sesartic 42 3.4.1 Bekannte und geschätzte Artenzahlen weltweit Pflanzen Tiere Gesamtartenzahl Bekannte Artenzahl Geschätzte Artenzahl 284'535 1'273'075 1'646'240 450'000 22'013'830 28'013'830 5 – 50 Mio. 3.4.2 Bekannte und geschätzte Artenzahlen in der Schweiz Bekannte Artenzahl Arthropoda Chordata Total Tiere Total Gefässpflanzen Total Moose Total Pilze Gesamtartenzahl CH Geschätzte Artenzahl 19'590 33'700 376 376 20'000 40'431 2'696 (Im Jahr 2002 3'144 (+ Neophyten)) 1'030 24’000 80'000 – 100'000 - 3.4.3 Genetische und Ökosystemare Biodiversität (BD) Genetische BD: Biodiversität unterhalb der Stufe der Art. Haustierrassen Kultivierte Obstsorten Genotypen innerhalb einer Population Ökosystemare BD: Biodiversität auf der Stufe Ökosystem bzw. Lebensgemeinschaft: Ca. 30 Pflanzengesellschaften in Feuchtgebiet Greifensee 235 Lebensraumtypen in der Schweiz 10 Vegetationszonen auf der Erde 3.4.4 Global Biodiversity Hotspots Die 25 Biodiversitäts-Hotspots beherbergen auf nur etwa 1.4% Erdoberfläche 44% aller bekannten Pflanzen- und 35% aller bekannter Wirbeltierarten. Nur etwa 1/3 dieser wertvollen Gebiete sind bisher unter Schutz gestellt. Mittelmeerbecken, Madagaskar, Neuseeland, Indonesien, tropische Anden, Westafrikanische Wälder, Karibik, Kaukasus, etc. 3.4.5 Methoden zur Abschätzung der globalen Biodiversität der Arten Man nimmt Artenzahlen und betrachtet die Proportionen zwischen ihnen. Artenzahlen an Tagfaltern im Verhältnis zu jenen aller Insekten (Von den Insekten hat es am meisten Arten!) Grössenvergleich (Artenzahl steigt umgekehrt proportional zur Körpergrösse). Struktur terrestrischer Ökosysteme und Artenzahlverhältnisse. Abschätzung mittels Hochrechnen von Käferarten auf einer tropischen Baumart. Für jede Säugetier- oder Vogelspezies der gemässigten und borealen Klimazonen sind jeweils zwei tropische Arten zu finden. Häufigkeit mit der neue Spezies gefunden werden. © 2003 Ana Sesartic 43 Anzahl der Tierarten nimmt mit abnehmender Körpergrösse zu. (Reduktion der Körperlänge um Faktor 10 ist mit Zunahme der Artenzahl um Faktor 100 verbunden.) Käferreichtum im Laubdach tropischer Bäume 3.4.6 Sinn des Biodiversität-Monitorings Argumente für das Erfassen der Arten-Biodiversität: Überblick über die BD ermöglicht Vergleiche und das Treffen von Schutzmassnahmen Überblick über gefährdete Arten und Erfassung von Zusammenhängen Überblick über Schwankung / Veränderung der Verbreitung / Anzahl der Arten / Artenreichtum und Biotop Qualität / Grösse Ausarbeitung von Gesetzesbestimmungen möglich Etc. 3.5 Naturschutz und Biodiversität 3.5.1 Warum Naturschutz Aussterben von Arten durch Menschliche Aktivitäten wie Überjagung, Habitatzerstörung, Einführung exotischer Schädlinge und Umweltverschmutzung. Säugetiere und Vögel auf Inseln weisen eine besonders hohe Aussterbewahrscheinlichkeit auf. Die meisten rezenten Arten werden irgendwann auf natürlichem Wege aussterben. Die gegenwärtig beobachtete Rate ist aber 100 bis 1000 mal höher als diese natürliche Hintergrundaussterberate. Aus paleontologischen Befunden konnte man ermitteln, dass es bis jetzt fünf natürliche Massenaussterben gab. Um die Natur politisch schützenswert zu machen, muss man ihr einen ökonomischen Wert zuordnen. Die ökonomische Einschätzung beruht auf dem unmittelbaren Produktwert, dem indirekten wirtschaftlichen Wert und dem ethischen Wert. Durch den Artenschutz wird also eine potentiell äusserst wertvolle Ressource erhalten. Um erfolgreich Naturschutz zu betreiben, muss man Ziele setzen und Gebiete identifizieren, in denen sich diese Ziele am besten erreichen lassen. 3.5.2 Wodurch Arten bedroht werden Artenklassifizierung nach Aussterberisiko: Empfindlich: Wahrscheinlichkeit der Auslöschung der Art in den nächsten 100 Jahren liegt bei 10%. Gefährdet: Mit 20% Sicherheit Auslöschung der Art in den nächsten 20 Jahren oder 10 Generationen. Kritisch: Risiko des Aussterbens für nächste 5 Jahre oder 2 Generationen beträgt 50%. Bedroht: Arten fallen in eine der obigen Kategorien (43% aller Wirbeltierarten) Seltenheit einer Art hängt ab von: Intensität: lokale Populationsdichte innerhalb einzelner Besiedlungsgebiete Prävalenz: allgemeine Verbreitung; Anzahl und Grösse der insgesamt zur Verfügung stehenden Lebensräume. Seltenheit kann sich beziehen auf ein begrenztes Verbreitungsgebiet, eine eingeschränkte Habitatbreite oder Populationen geringer Grösse (niedrige Intensität). © 2003 Ana Sesartic 44 Kategorien von Häufigkeit und Seltenheit: Prävalenz Geographische Weit Verbreitung Eng Intensität Ökologische Amplitude Grosse lokale Populationen Kleine lokale Populationen Breit Schmal Wanderratte Schilf Spatzen Nicht selten! Wanderfalke Fischadler Breit Schmal Rotbuche Schwertlilien Inselpflanzen Grosser Rotmilan Panda Endemit! Arten mit engem Verbreitungsgebiet tendieren zu lokal niedrigen Populationsdichten. Dadurch sind seltene Arten doppelt Gefährdet. Menschen sind für die Auslöschung vieler grosser Tiere verantwortlich. Tiere, die zur Herstellung von Schmuck oder als exotische Haustiere dienen, sind für die Sammler um so wertvoller, je seltener sie sind. Dies trifft auch auf Pflanzen zu. Lebensräume werden durch den Menschen negativ beeinflusst durch Zerstörung des Habitats, Habitatsverschmutzung und Störung des Habitats zum Nachteil einiger ansässiger Arten. Waldrodungen sind die Häufigsten Ursachen für Habitatszerstörung. Dadurch wird der Lebensraum fragmentiert. Degradation von Lebensräumen durch Pestizide, sauren Regen bis hin zu globalen Klimaveränderungen. Habitatstörungen haben nicht so weitreichende folgen, aber einige Arten können sehr empfindlich reagieren. (Bsp. Fledermäuse in durch Touristen gestörte Höhlen) Immer mehr exotische invasive Arten werden versehentlich oder absichtlich eingeführt und führen häufig zur Abnahme der Biodiversität. Vor allem endemische arten (Taxa die nur in abgegrenztem kleinen Gebiet vorkommen) sind durch die invasiven bedroht. (Bsp. Rückgang der Anzahl Waldvogelarten auf der Pazifikinsel Guam durch die Nachtbaumnatter) Populationsgenetische Gesichtspunkte: Genetische Variabilität ist Ergebnis aus natürlicher Selektion und genetischer Drift. Häufigkeit der Drift ist abhängig von der effektiven Populationsgrösse, welche die Zahl der den Genpool beeinflussenden Individuen darstellt. Durch unausgeglichenes Geschlechterverhältnis, nicht-zufällige Verteilung der Nachkommen und Schwankungen in der Populationsgrösse ist die effektive Populationsgrösse meist deutlich kleiner als die tatsächliche. Genetische Vielfalt ist nötig zur Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen. Problem dabei ist Inzucht, da potentiell schädliche oder letale rezessive Allele dann homozygot vorliegen. Meist führen mehrere Faktoren zum Aussterben (Aussterbestrudel ein Faktor gefährdet Population für andere Risiken, Population nimmt stetig ab) einer Art, wobei Habitatsverlust, invasive Arten und übermässige Ausbeutung die wichtigsten Faktoren sind (jeder ist zu ca. ¼ für das Aussterben verantwortlich). Die starke interaktive Vernetzung verschiedener Arten kann auch zum sekundären Aussterben führen, bei dem das Aussterben einer Art eine andere mit sich zieht. © 2003 Ana Sesartic 45 3.6 Stichworte zum Naturschutz in Mitteleuropa 3.6.1 Was ist Naturschutz / Wieso Naturschutz Naturschutz ist Gesamtheit der Massnahmen zur Erhaltung von wildlebenden Arten, ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensgrundlagen. Z.T geht es auch um Landschaftsschutz und Kulturlandschaftspflege. Massnahmen die für den Naturschutz ergriffen werden müssen: Naturwissenschaftliche Grundlagen erarbeiten Politisch-planerische Aspekte berücksichtigen Praktisches Anwenden der naturwissenschaftlichen Grundlagen Finanzierung Gesetze anwenden Ethisch-psychische Aspekte ernst nehmen Naturschutz umfasst biotische, abiotische und ästhetische Ressourcen, Nachhaltigkeit, Leistungsfähigkeit und ökologische Prozesse sowie Schutz von Prozessen und Entwicklung einer bestimmten Qualität (Renaturierungsgebot). Naturschutz schützt nicht nur die unberührte Natur, sondern ebenso halbnatürliche Ökosysteme und anthropogene Ökosysteme. Es genügt allerdings nicht, Natur- bzw. Kulturschutzgebiete einfach zu schützen, sonder sie müssen auch entsprechend ihrem Charakter gepflegt werden. Argumente für den Naturschutz: Ethisches Argument Kulturhistorisches Argument Ästhetisches Argument Medizinisches Argument Psychohygienisches Argument (ökologische Wiedergutmachung) Pädagogisch-wissenschaftliches Argument Wirtschaftliches Argument Politisches Argument Gesetzliche Aufgabe des Staates Argumente gegen den Naturschutz: Ökonomische Nachteile Einschränkung der Freiheit und Bequemlichkeit Nur emotionale und ideelle Werte (elitär), nicht quantifizierbar Nützt Naturschutz der Natur (noch) Resignation Vehikel für politische (gesellschaftskritische) Aktivitäten Menschenrechte vor Naturschutz Tradition (man hat’s immer so gemacht – wieso jetzt ändern) Pseude-Religiosität Die Natur ist ein evolutiver und selbsterhaltender Prozess Naturschutz ja, aber nicht bei mir Naturschützer sind selber uneinig Naturschutz mischt sich überall ein Gesetzliche Grundlage des Naturschutzes: Internationale Abkommen (Rio, CITES, Washingtoner Artenschutzabkommen, Berner Konvention, Smaragdnetz, etc.) Bundesverfassung der Schweiz (Nachhaltigkeit als Staatsziel, NHG, USG, Ratifizierung der Rio Konvention) Bundesgesetze, kantonale NHGs, Verordnungen, Reglemente, Bestimmungen, etc. © 2003 Ana Sesartic 46 3.6.2 Gefährdung von Arten, Lebensgemeinschaften und Naturprozessen Biotopzerstörung Strukturverarmung Verinselung, Isolierung Biozide Jagd Sammelwut Bewusste Ausrottung Umweltverschmutzung Einfuhr fremder Pflanzen- und Tierarten, die vorhandene Arten verdrängen, bzw. Krankheitsübertragung Weitere Störungen durch den Menschen (Fluchtdistanz) Vernichten von Nahrung, Wirt, Symbionten usw. Kettenreaktion Derzeitiges direktes und indirektes Ausrotten ist 1000 bis 10'000 mal rascher als natürliches Aussterben. Viele Gebiete sind von früherer Naturlandschaft durch Diversifizierung in eine „gestrige“ naturnahe Kulturlandschaft und schlieslich durch Monotonisierung in eine heutige Naturferne Kultur- und Zivilisationslandschaft übergeführt worden. Früher war das Ziel der Schutz des Menschen vor der Natur, heute muss man die Natur vor dem Menschen schützen. Frühere Naturlandschaft bestand aus: Sumpf- und Moorwälder, Laubmischurwälder Seeufer, Hochmoore Fluss- und Bachläufe, Bachtobel Naturweiher, Quellen, Grundwasseraufstösse und Felsfluren Heute findet man: Intensivkulturland, Siedlungen Intensivkulturen mit geringer biologischer Vielfalt, „sterile Ökosysteme“ „Kulturwald“, Verlandung, Verheidung und Verbuschung stark verdrängte natürliche Zonen verbaute Fliesswasserläufe, veränderte Bachbette, Deponien Ursachen des Rückgangs von Farn- und Blütenpflanzen: Änderung der Nutzung Aufgabe der Nutzung Beseitigung von Sonderstandorten Auffüllung, Bebauung Entwässerung Einführung von Exoten, etc. Verursacher des Rückgangs von Farn- und Blütenpflanzen: Landwirtschaft Forstwirtschaft und Jagd Tourismus und Erholung Rohstoffgewinnung, Kleintagebau Gewerbe, Siedlung und Industrie, etc. © 2003 Ana Sesartic 47 Schätzung der Grössenordnungen der Veränderung von Artenzahlen in ZH: Ursprünglich Mittelalter Gestern Landschaftstyp Naturlandschaft Pflanzenarten 300 Brutvogelarten 70 Gründe für Veränderungen Naturnahe Kulturlandschaft + 400 690 + 30 100 Landund Forstwirtschaft Mitte 20. Jh. Heute Kulturlandschaft (Zivilisationslandschaft) - 200 ~490 - 30 ~70 Intensivierung Von Land- u. Forstwirt-schaft, Tourismus, Wasserwirtschaft 3.6.3 Rote Listen Rote Listen beurteilen die Aussterbewahrscheinlichkeit einer Art. Einstufung der Gefährdung beruht auf der Populationsgrösse, der Bestandesveränderung, Grösse des Verbreitungsgebietes, räumlicher Populationsstruktur sowie der Grösse und Qualität des Lebensraumes. Rote Liste der gefährdeten CH Brutvogelarten enthält 77 Arten (39%) und die der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen der CH 990 Taxa (31.5%). IUCN Einstufungskategorien Regionally Extinct, Critically Endangered, Endangered, Vulnerable, near threathened, least concern. Regional ausgestorben, vom Aussterben bedroht, stark gefährdet, verletzlich, potenziell gefährdet, nicht gefährdet. Blaue Listen enthält RL Arten mit Zunahme oder Stabilisierung (z.B. Eisvogel, Sibirische Schwertlilie, Fadenmolch). Sie dienen als Motivation und positive Propaganda für den Naturschutz. Einer der Gründe für die Stabilisierung der Arten ist das Anwenden geeigneter Naturund Umweltschutztechniken, diese werden erfasst und weiterentwickelt. Etwa 1/3 der nicht ausgestorbenen RL arten sind auf den BL vertreten, für viele weiter sind Förderungstechniken lokal erfolgreich erprobt worden. Das Problem ist die Umsetzung und Akzeptanz von Naturschutz. 3.6.4 Ökosysteme in der Landschaft, Inseltheorie und Naturschutz Bei Zerschneidung der Landschaft ist grösse der Inseln und geographische bzw. ökologische Entfernungen zwischen ihnen entscheidend. Die Isolationswirkung durch Strassen ist sehr gross. Eine Verdoppelung der Artenzahl erfordert eine Verzehnfachung der Fläche der (homogenen) Biotopinsel. Die meisten naturschützerisch wertvollen (Tier-) Arten kommen nur in den grossen Biotopinseln vor. Auch die Erreichbarkeit und Form der Inseln ist wichtig. Es ist ein Verbundnetz von Naturschutzgebieten in der Landschaft nötig. Manche Tiere benötigen Grenzen bzw. mehrere Biotope zum Überleben. Für Pflanzen gilt die Inseltheorie nur beschränkt. © 2003 Ana Sesartic 48 Stichworte zu Ursachen für grossen Raumbedarf vor allem bei Tieren Grosser Nahrungsbedarf bei sehr grossen Tieren Nahrung dünn verteilt Ökologische Nische dünn verteilt Biotopwechsel Ethologische Gründe (Territorialverhalten, Fluchtdistanz, etc.) Population braucht bestimmte Grösse und somit bestimmten grossen Raum Langfristig sind grosse Populationen und somit grosser Raumbedarf von Vorteil, damit eine genügend grosse genetische Variabilität vorhanden ist für evolutive Anpassung an Umwelteränderungen. Dynamik und Artenzahl eines Gebietes (Biotopinsel): Hauptfaktoren sind Einwanderung (Abhängig von der Entfernung von versorgendem Gebiet) und Aussterben und Auswandern (abhängig von der Populationsgrösse). Es herrscht Gleichgewicht der Artenzahl wenn Einwanderungsrate = Aussterberate. (Raten jeweils Anzahl Arten pro Zeit). SLOSS Problematik (single large or several small nature conservation areas). Anwendung der Inseltheorie im Naturschutz muss vorsichtig und artbezogen geschehen. Einige Arten sind auf Übergangsgebiete zwischen verschiedenen Ökosystemen, also Ökotone, angewiesen, z.B. Vögel des Gewässerufers. Inseltheorie gilt nicht für folgende Situationen / Artengruppen: Arten mit kleinem Flächenbedarf Arten mit Biotopwechsel Arten von Übergängen zwischen den Biotopen Viele relativ kleine (Biotop-)Inseln verringern Risiko von Epidemien von Parasiten oder Überhandnehmen von konkurrenzkräftigen Allerweltsarten Isolation günstig gegen Ausbreitung von Parasiten oder konkurrenzkräftigen Allerweltsarten Umgebungsschutzzone um Naturschutzgebiet: Nicht oder nur indirekt gedüngt Keine Veränderung des Bodenwasserhaushaltes Keine schädlichen Immissionen Keine Pestizide Beschattung beachten Ungehinderte Möglichkeit zum Ein- und Auswandern bestimmter Tiere Wenn immer möglich naturnahe Korridore zu benachbarten NSG erhalten oder einrichten, also wenig intensive Landwirtschaft Sichtschutz für Tiere wichtig 3.7 Naturschutzexkursion Greifensee 3.7.1 Hochstamobstgärten Vorteile: Bereicherung der Landschaft Erholungsraum Lebendes Kulturgut Windschutz Schattenspender für Mensch und Tier Vielfältiger Lebensraum: Erhaltung der Artenvielfalt Unzählige Obstsorten: genetische Vielfalt Doppelte Landnutzung: Obst und Weide Erntearbeit im Herbst gut mit Viehhaltung kombinierbar © 2003 Ana Sesartic 49 Diversifizierung des LW Betriebes Braucht weniger Pflege als Niederstämme Weniger Insektizide Als Ökoausgleichsfläche anrechenbar, Ökobeiträge Nachteile: Geringer Verdienst für Landwirt Früchte weniger genormt Volle Erträge erst nach ca. 10 Jahren Grosse Ertragsschwankungen Schwierige Umstellung bei Marktänderungen Flächen darunter nicht als Fruchtfolgefläche nutzubar Wiesen darunter schwierig zu mähen Jungpflanzungen werden durch Mäuse stark geschädigt Viele alte Obstsorten mit schlechter Resistenz und Lagerfähigkeit Gründe für den Rückgang der Hochstamm-Obstgärten: Überbauungen Politik Prämien für Fällen von Hochstämmen in den 50er und 60er Jahren Konsumverhalten Südfrüchte und andere Getränke beliebter als Äpfel Bewirtschaftungsmethoden Der ökologische und landwirtschaftliche Wert der Hochstamm-Obstgärten wird heute wieder höher eingeschätzt, auch Bund und Kantone setzen sich für deren Erhaltung ein. 3.7.2 Hecken und Waldrand Hecke ist ein dichter, schmaler Gehölzstreifen, der mit Sträuchern und allenfalls mit Bäumen bestockt ist. Zu jeder Hecke gehört beiderseits ein Krautsaum. Niederhecke: 2-3m hoch Hochhecke: Schichten niederer und höherer Sträucher, kleiner als 6m Baumhecke: Hochhecke mit Bäumen, höher als 6m In den Hecken wachsen viele Sträucher wie Corylus avellana, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Viburnum sp., Sambucus sp., Lonicera xylosteum etc. Bedeutung der Hecken: Windbremse Erhöhen Boden- und Luftfeuchtigkeit Verhindern Rutschen von Lawinen, bremsen Wassererosion Tierische Artenvielfalt stabilisiert Ökosystem Verschönerung des Landschaftsbildes, heimatkundlicher Wert Bewirtschaftungsgrundsätze für Hecken: Nie Kahlschlag, sondern abschnittweise selektiv auf Stock setzen 2-3m Platz für Krautsaum lassen (alle 1-2 Jahre schneiden) Waldrand abstufen 3.7.3 Entstehung der heutigen Riedgebiete, Veränderung der Landschaft Der Greifensee entstand während letzter Eiszeit, war ürsprünglich viel grösser, die Vegetation um den See bestand v.a. aus Wald. Durch Rodung und Bewirtschaftung durch Siedler entstand einie vielfältige Kulturlandschaft. Durch Glatt-Korrektion wurde der Wasserspiegel gesenkt, die grossen Riedflächen entwässert und gedüngt und dadurch zur Landwirtschaftsfläche umgewandelt. Durch Zerstörung dieser © 2003 Ana Sesartic 50 wertvollen Standorte nahm die Vielfalt der Landschaft deutlich ab, gleichzeitig stieg die Bevölkerungszahl stark an. Bis 1976 waren über 80% der Feuchtgebiete verschwunden, über die Hälfte der Sumpf- und Wasserpflanzen sind gefährdet. Mögliche Massnahmen zum Schutz der Natur am Greifensee Verbesserung der Kläranlagen Einsetzen von Jungfischen Renaturierung der Ufervegetation Keine weitere Entwässerungen, evtl. Vernässung Pufferzonen Einrichten von Sperrzonen Zusammenführen von Schutzzonen Badi Egg 3.7.4 Riedvegetation Natürliche Abfolge der Verlandungsvegetation am Mittellandsseen Schwimmblattgesellschaften Röhricht (Schilf) Gross-Seggenried (Carex elata) Weidengebüsch (Salix cinerea, Frangula alnus) Schwarzerlen-Moorwald (Alnus glutinosa) Eschenmischwald (Fraxinus excelsior) Buchenwald (Fagus sylvatica) Regelmässiger Schnitt im Herbst führt zu Schwimmblattgesellschaften Röhricht (Schilf) Gross-Seggenried (Carex elata) Kleinseggenried (Schoenus) Pfeifengraswiese (Moelinia caerulea) Düngung und Schnitt bzw. Verbrachung Schwimmblattgesellschaften, evtl. Algenwatten Röhricht (Schilf) Gross-Seggenried (Carex elata) Hochstaudenflur (Carex acutiformis, Solidago, Filibendula, z.T. Urtica) Wechselnasse Fettwiese (Arrhenaterum, Dactylis, Chaerophyllum, Alopecurus) Düngeeinfluss und Pufferzonen Eintrag von Nährstoffen hat erheblichen Einfluss auf Artenzusammensetzung. Rückentwicklung ist – wenn überhaupt – nur noch sehr langsam möglich (Nährstoffanreicherung im Boden, neue Pflanzen haben sich etabliert, wachsen auch mit weniger Nährstoffen). Einschwemmung von Nährstoffen kann durch Pufferzonen verhindert werden. 3.7.5 Vögel Greifensee ist ein bedeutendes Überwinterungs- und Durchzugsgebiet (60 Brutvogelarten, insgesamt 219 Vogelarten). Besonders wertvolle Gebiete sind Uferbereiche mit breiter Verlandungszone (nur ein Drittel des Ufers müsste abgesperrt sein, um fast die ganze Vielfalt zu erhalten). © 2003 Ana Sesartic 51 3.7.6 Amphibien Die Ansprüche einzelner Amphibienarten sind sehr verschieden. Am greifensee wurden viele im Kanton Zürich vorkommende Amphibienarten nachgewiesen. Wichtigste Lokalität ist die Kiesgrube und das Riedgebiet. 3.7.7 Renaturierung Was für Naturschutzgebiete sollen geschaffen werden? Ziele Massnahmen Erläuterungen Beispiele Unberührte Natur; Prozessschutz Natur von selbst zurückkehren lassen Langsames Erreichen heutiger potentieller Natur Brache, Verhochstaudung, Verbuschung, Wiederbewaldung Ursprüngliche Natur vor dem Eingreifen des Menschen Standortsbedingungen wiederherstellen, Tiere und Pflanzen wiederansiedeln Ansiedlung entsprechender Tier und Pflanzenarten Standortbedingungen, Ansiedlung von Tieren und Pflanzen, Pflege Standortbedingungen, Ansiedlung von Tieren und Pflanzen, Pflege Standortbedingungen, Ansiedlung von Tieren und Pflanzen, Pflege Ziel unerreichbar; kleine Flächen, Tiere z.T. ausgestorben (Auen) Wald Erreichung des Ziels möglich Laubmischwald Erreichung des Ziels möglich Vegetationsarme Flachwasserseen Erreichung des Ziels möglich Pfeifengrasried, evtl. Hochstamm-Obstgarten Erreichung des Ziels möglich Gefährdete Pflanzen Standortbedingungen, Erreichung des Ziels Ansiedlung von Tieren möglich und Pflanzen, Pflege Angepflanzte Hecke, ausgedolter Bach Heutige potentielle Natur Mangel-Ökosystem (Mangel)-Ökosystem der traditionellen Kulturlandschaft Gefährdete Arten in künstlichem Ökosystem Vernetzungs- oder Trittsteinökosystem © 2003 Ana Sesartic 52 4 Stadtbioökologie 4.1 Das Thema Vision: Natur, technische Funktion, Nutzung, Ökonomie, Erleben und Ästhetik bilden gemeinsam ein Paket, und funktionieren in der Stadtlandschaft. Artenreichtum der Stadt beruht auf dem Siedlungs- / Nutzungsmosaik. Es gibt viele Grenzen zwischen Biotoptypen. Trampelpfade entstehen durch Gesetz der Bündelung Einzelne Pfade schliessen sich zusammen. Biodiversität ist hier ein kostenloses Nebenprodukt der dynamischen Nutzung. 4.2 Abiotische Grundlagen 4.2.1 Stoff- und Energieumsatz Trennung in Produktionssystem (Land) und Konsumationssystem (Stadt) Globalisierung des Stoffumsatzes Auslagerung des Abbaus Verlagerung ins Anorganische (Nahrungsketten stark verkürzt oder denaturiert) Zufuhr von Fremdenergie 4.2.2 Stadtklima Netto-Wärmegewinn durch lokalen Treibhaus-Effekt, Backofen-Effekt, geringe Evapotranspiration und anthropogene Wärmeproduktion führt zu innerstädtischer Wärmeinsel. In Wärmeinsel blühen Pflanzen früher oder sind wärmeliebende Arten anzutreffen. Geringere Windgeschwindigkeiten, kleinräumige Stau- und Düseneffekte, Flurwinde (entstehen durch Wärmeunterschied zwischen Stadt und Umgebung). Etwas mehr Regen, durch mehr Kondensationskeime und Konvektionsprozesse, aber schneller Abfluss und verminderte Speicherung. Starke Bodenversiegelung, unterschiedliche Durchlässigkeit von Bodenbelägen. Grundwasserabsenkung, Verdichtung, Mischen der Bodenhorizonte, künstliche Aufträge, Alkalisierung durch Baumaterial, Eutrophierung durch Abfälle, Schadstoffbelastung durch Schwermetalle, etc. Gewässer of eingedolt, verbaut und kanalisiert. Extreme Hoch- bzw. Niedrigwasser infolge Bodenversiegelung. Im Vergleich zur Landschaft ist die Stadt wärmer und trockener. Städtische Böden sind basenreicher, oft verdichtet, schadstoffbelasteter, sehr mager bis sehr nährstoffreich. Insbesondere trockene nährstoffarme und besonnte Böden sind biologisch interessante Extremstandorte, die in der Landschaft selten sind. 4.2.3 Nutzungs- und Biotypen Bebauung ist entscheidender Faktor für die Artenzusammensetzung. Die Nutzung der Bauten bestimmt welche Arten vorkommen. Wohnbebauung Industrie, Gewerbe, Ver- und Entsorgungsanlagen © 2003 Ana Sesartic 53 Strassenverkehrsraum Bahnanlagen Öffentliche Grünanlagen Reste der Kulturlandschaft Die Stadt ist ein Ökosystemkomplex, ein kleinräumiges heterogenes Mosaik unterschiedlichster Biotoptypen. Eine Folge davon sind die sehr langen, vielgestaltigen Nutzungsgrenzen. Beides begründet die Artenvielfalt der Stadt. 4.2.4 Siedlungsentwicklung: Von Stadt und Dorf zum Siedlungsbrei Bis ins 19. Jahrhundert waren Dorf und Stadt klar getrennt. In der Industrialisierung gab es vermehrt Blockrandbebauungen und Villen, nach 1950 auch Blockbebauung mit Gemeinschaftsgrün sowie Einfamilienhäuser. Bis heute fand eine Konvergenz der Siedlungsentwicklung zum Siedlungsbrei hin. 4.2.5 Herkunft der Stadtnatur Die kleinflächigen und mosaikartigen Siedlungslebensräume und die grossflächigen Lebensräume in der Landschaft gleichen sich ökologisch in vieler Hinsicht: Gebäude – Felsen Rasen – Weide Garten – Acker Baulager – Flussaue Park – Wald 4.3 Stadtflora Einteilung der Spontanflora nach Einwanderungsverhalten: Idiochorophyten: einheimische Arten im engeren Sinn Archaeophyten: nicht einheimische, vor 1500 eingewanderte Arten Neophyten: nicht einheimische, nach 1500 eingewanderte Arten Invasive Arten (z.B. Goldrute) Gegen 50% der Stadtarten sind Neophyten. Die Neophytenflora trägt aber wenig zur zoologischen Diversität bei. Etwa 10% der Arten auf dem Gebiet der Stadt Zürich kommt, unabhängig der Überbauung, praktisch überall vor. Es sind meistens stickstoffbedürftige Arten. Viele gefährdete Getreideunkräuter sind auch in der Stadt ausgestorben; einige haben Ersatzlebensräume gefunden. Die Stadtflora ist sehr dynamisch. In letzten 10 Jahren sind viele Arten neu aufgetreten, bzw. haben sich stark ausgebreitet. Es sind meist wärmebedürftige Arten. Stadtnatur kann von der Klimaerwärmung profitieren und den Sprung in die anliegende Naturlandschaft schaffen. 4.4 Stadtfauna 4.4.1 Charakterisierung städtischer Tiergemeinschaften Lebensbedingungen: Stadtklima, Stadtböden, Immissionen, Biozide. Kleine, heterogen, mosaikartige, isolierte Lebensräume Dauernde Störung und Veränderung durch Menschen Transport (Import) von Tieren Stadtspezifisches Angebot an Nahrung, Wohn- und Bruträumen Merkmale, Anpassungen: Allrounder Arten, ausbreitungsstark und störungsangepasst Selten Spezialisten (ausser Biotop vorhanden, Kulturfelsenbewohner) © 2003 Ana Sesartic 54 Viele eingeschleppte, fremdländische, invasive Arten Oft Zentrum – Peripherie Verteilungsmuster Genetisch Differenzierungen (Industriemelanismus, Giftresistenz) Verhaltensänderungen Benachteiligte Arten: Ausbreitungsschwache bzw. solche mit grossem Raumanspruch Störungsanfällige, biozid bzw. emissionsempfindliche Spezialisten Habitatgebundene Zoologisch wichtige Biotoptypen: Gebäudeteile Brachen, Ruderalflächen, Abbaugebiete Vegetationsfreie Stellen Gehölzbestände in Parks, etc. Extensiv bewirtschaftete Wiesen- und Rasenflächen Staudenreiche, unbegiftete Gärten Offene Gewässer, wasserabhängige Vegetation und Uferbereich 4.4.2 Beispiel Eidechsen Eidechsen brauchen Nahrung, Verstecke und Wärmeplätze. Viele Tiere sind am Sonnenhang des südexponierten Waldrandes. Diejenigen die mehr Schatten vertragen sind am Nordhang, dort hat es Allmende und Magerwiesen. Viele Mauereidechsen am Bahngeleise, da es dort warm ist. 4.4.3 Beispiel Igel Igel legt grosse Strecken zurück. Beansprucht keine spezifischen Lebensräume, unspezialisiert und nutzt alles. Braucht Verstecke als Tages- und Winterschlafplätze. Hauptprobleme sind Strassenüberquerungen und Barrieren. Trotzdem ist die Igeldichte in der Stadt grösser als im Land. 4.4.4 Brutvögel Siedlungsräume sind artenreicher als das Kulturland, aber artenärmer als der Wald. Innerhalb des Siedlungsgebietes sind ältere und locker überbaute Gebiete artenreicher als neue und dicht überbaute. Für den Artenreichtum der Bebauungstypen gilt: Einfamilienhäuser > Mehrfamilienhäuser > Industrie > Kernbereiche. Verstädterte Arten mit hohen Ansprüchen sind Segler, Schwalben und Dohlen. Mehlschwalben bauen Lehmnester an der Fassade unter Dächern oder Vorsprüngen, die Rauchschwalbe baut offene Nester in Gebäuden. Auch Mauersegler und Alpensegler brüten vielfach in den Städten. 4.5 Bioökologische Stärken, Gefährdungen und Potentiale Stärken der Stadt: Lebensraum für Kulturfelsenbewohner Lebensraum für Bewohner warmer, trockener, offener Pionierstandorte Vielfältig strukturierte, vernetzte, teils extensiv gepflegte Grünanlagen und gärten mit alten Baumbeständen Reste der Naturlandschaft und der traditionellen Kulturlandschaft Gefährdungen: Bodenversieglung Ordnung und Sauberkeit Monotone Gestaltung und Pflege © 2003 Ana Sesartic 55 Umweltgifte Flächenmässig grösste Potentiale: Versiegelte Plätze und Wege Intensiv gepflegte Zierrasen Unbegrünte Flachdächer Bodendecker und exotische Gehölze Scharfe Nutzungsgrenzen 4.6 Naturnahe Gestaltung und Pflege 4.6.1 Ziele, Rechtliche Grundlagen und Instrumente Ziele naturnaher Gestaltung: Natur im Alltag erleben Der Natur mehr Raum lassen Lebensgrundlagen schonen Kosten senken Rechtliche Grundlagen und Instrumente: Bundesgesetze und –verordnungen, Umsetzung durch Kantone Ortplanung der Gemeinden Finanzielle Anreize (z.B. verursacherbezogene Gebühren) Naturnahe Objektplanung und Grünflächenpflege 4.6.2 Checklisten Bauprojektierung: Bestehende Naturwerte schonen, Ersatzmassnahmen sichern Besonderheiten des Ortes berücksichtigen Differenzierte naturnahe Lebensräume schaffen, Naturpotential ausschöpfen Grünflächen mit der Umgebung vernetzen, Tierfallen vermeiden Bauliche Voraussetzungen für naturnahe, kostengünstige Pflege schaffen Bauten für einheimische Pflanzen und Tiere besiedelbar gestalten Wasserkreisläufe schliessen Lokale, energiearme, umweltfreundliche Materialien verwenden Vielfältige Nutzungen und aktive Betätigung in der Natur ermöglichen Bereiche mit unterschiedlicher Nutzungsintensität vorsehen Pflanzplanung: Besonderheiten des Ortes herausarbeiten Benutzer einbeziehen Ökologische Ziele und Gestaltung festlegen Pflege sichern Pflanzplan mit Artenlisten erstellen Arbeiten vergeben Pflegeplanung: Bestehende Naturwerte erkennen Entwicklungspotentiale erkennen Ökologische Absichten festlegen Nutzung und Gestaltung festlegen Organisatorische Rahmenbedingungen abklären, evtl. ändern Bereiche unterschiedlicher Pflegeintensität festlegen 4.6.3 Massnahmen (Beispiel Wasser) Prioritäten für die Liegenschaftsentwässerung mittels: Rückhaltung des Wassers auf der Liegenschaft (Dachbegrünung, etc.) Flächige Versickerung (Durchlässige Beläge, etc.) © 2003 Ana Sesartic 56 Versickerungsmulde (z.B. Weiher) Unterirdische Versickerungsanlage Zentrale Rückhaltung und Versickerung Ableitung in Vorfluter (Fluss, Bach) Wenn obengenannte Ansätze nicht möglich, Ableitung in Kanalisation Bewuchs- und sickerfähige Beläge: Schotterrasen Kiesbelag (Chaussierung) Rasengittersteine (90% Wasser versickert!) Weitfugiger Natursteinbelag Betonsteine mit Distanznocken 4.6.4 Massnahmen (Dächer Begrünen) Aufbau der Dachbegrünung in Funktionsschichten: Vegetation Substratschicht Filterschicht Drainschicht Schutzlage Wurzelschutzschicht Trennlage Dachabdichtung Übergänge von extensiver zur intensiver Begrünung möglich: Sedum, Moos Kraut, Gras, Sedum Kraut, Gras Gehölze, Stauden Funktionen der Dachbegrünung: Lebensraum für einheimische Pflanzen und Tiere Regenwasserrückhaltung, Entlastung der Kanalisation Verbesserung des Stadtklimas Harmonisierung und Verschönerung des Stadtbildes Nutzbarer Freiraum Verbessertes Innenklima Schutz der Dachhaut vor extremen Temperaturen © 2003 Ana Sesartic 57