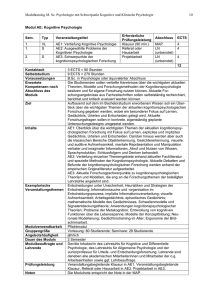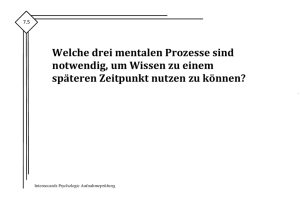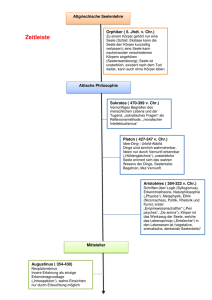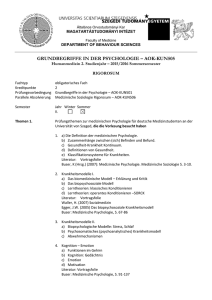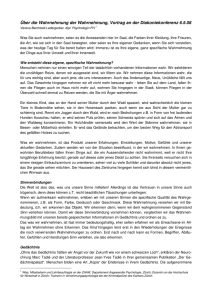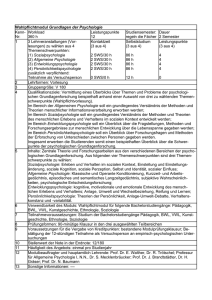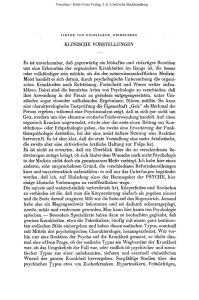Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens
Werbung
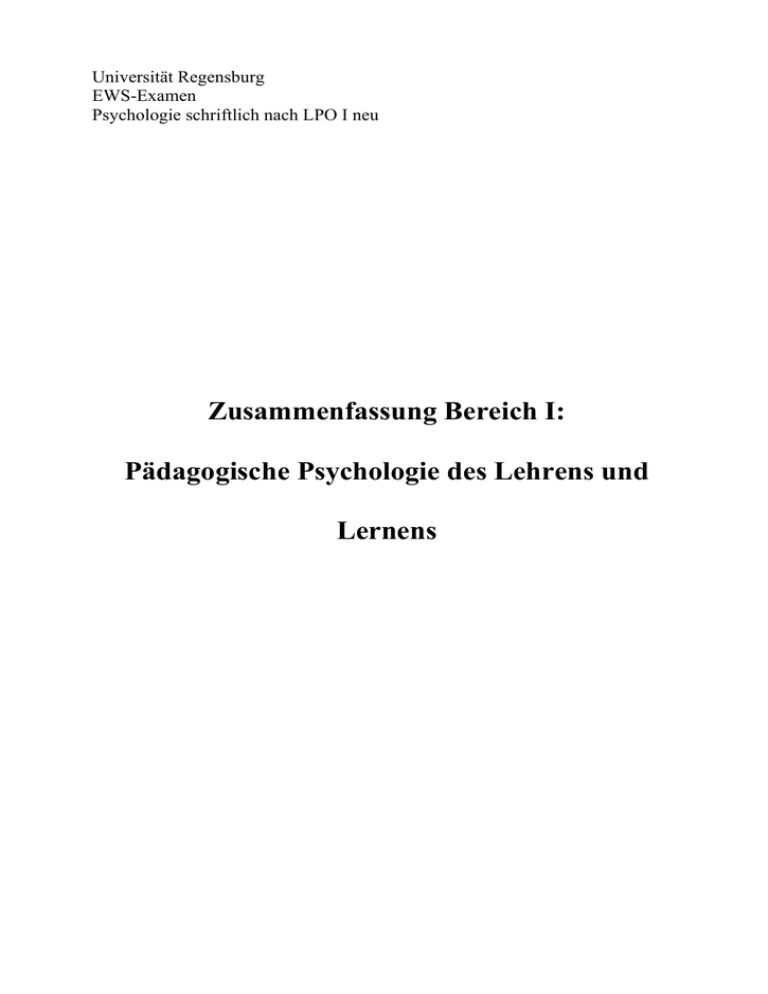
Universität Regensburg EWS-Examen Psychologie schriftlich nach LPO I neu Zusammenfassung Bereich I: Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens Inhaltsverzeichnis ÜBERBLICK ÜBER BEREICH I ....................................................................................................................... 3 *1. GRUNDBEGRIFFE UND DEFINITIONEN ............................................................................................... 4 1.1 PSYCHOLOGIE ............................................................................................................................................... 4 1.2 LERNEN ......................................................................................................................................................... 6 1.2.1 Lernen als Verhaltensänderung ............................................................................................................ 6 1.2.2 Lernen als Wissenserwerb .................................................................................................................... 7 1.3 GEDÄCHTNIS ................................................................................................................................................. 7 *2 BEHAVIORISTISCHE LERNTHEORIEN .................................................................................................. 9 2.1 ASSOZIATIVES LERNEN (VERKNÜPFUNGSLERNEN) ....................................................................................... 9 2.2 KLASSISCHES KONDITIONIEREN .................................................................................................................. 10 2.2.1 Klassisches Konditionieren- was ist das? ........................................................................................... 10 2.2.2. Paradigma d. klass. Konditionierens: Der Pavlovsche Hund ........................................................... 11 2.2.3 Die Phasen des Konditionierens genauer betrachtet.......................................................................... 12 2.2.4 Weitere Konditionierungsprozesse ..................................................................................................... 14 2.2.5 Anwendungsbereiche der klassischen Konditionierung ..................................................................... 16 2.3 OPERANTES KONDITIONIEREN .................................................................................................................... 20 2.3.1 Operantes Konditionieren, was ist das? ............................................................................................. 20 2.3.2 Grundprinzipien des operanten Konditionierens................................................................................ 21 2.3.2.1 Reaktions-Konsequenz-Konstellation........................................................................................................... 22 2.3.2.2 Allgemeine Möglichkeiten der Verstärkung ................................................................................................. 24 2.3.2.3 Möglichkeiten zum Verhaltensauf- und abbau ............................................................................................. 25 2.4 GELERNTE HILFLOSIGKEIT .......................................................................................................................... 29 *3. SOZIAL-KOGNITIVE LERNTHEORIE (MODELLLERNEN) ............................................................ 30 3.1 STADIEN / PHASEN DES BEOBACHTUNGSLERNENS ...................................................................................... 32 3.2 WIRKUNGEN DES BEOBACHTUNGSLERNENS ............................................................................................... 34 3.3 STEUERUNG DES EIGENEN LERNENS ............................................................................................................ 36 3.4 ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR MODELLLERNEN ........................................................................................... 37 *4. THEORIEN DES KOGNITIVEN LERNENS ........................................................................................... 38 4.1. WISSENSERWERB ....................................................................................................................................... 38 4.1.1 Deklaratives Wissen ........................................................................................................................... 39 4.1.1.1 Speicherung und Repräsentation im Gedächtnis (Wissensstrukturen) .......................................................... 39 4.1.1.2 Aufnahme und Erwerb von deklarativem Wissen......................................................................................... 45 4.1.1.3 Auswirkung des Vorwissens auf Informationsaufnahme & -verarbeitung ................................................... 45 4.1.2 Prozedurales Wissen........................................................................................................................... 47 4.2. PROBLEMLÖSEN ......................................................................................................................................... 50 4.3 TRANSFER ................................................................................................................................................... 52 4.3.1 Aspekte über Transfer ......................................................................................................................... 52 4.3.2 Förderung von Transfer im Unterricht............................................................................................... 53 *5. GEDÄCHTNIS- UND WISSENSPSYCHOLOGIE ................................................................................... 54 5.1 GEDÄCHTNISPROZESSE ............................................................................................................................... 54 5.2 GEDÄCHTNISMODELLE ................................................................................................................................ 56 5.2.1 Mehr-Speicher-Modell (Atkinson & Shiffrin (1968)) ......................................................................... 56 5.2.2 Einspeichermodell (Craick & Lockhart (1972)) ................................................................................. 57 5.2.3 Die ACT-Theorie nach Anderson ....................................................................................................... 57 5.3 GEDÄCHTNISARTEN .................................................................................................................................... 57 5.3.1 Sensorisches Gedächtnis .................................................................................................................... 59 5.3.2 Kurzzeitgedächtnis ............................................................................................................................. 60 5.3.3 Langzeitgedächtnis ............................................................................................................................. 61 5.4 VERGESSENSTHEORIEN ............................................................................................................................... 62 *6. GEDÄCHTNIS- UND LERNHILFEN, LERNSTRATEGIEN................................................................. 64 6.1 UNTERSCHEIDUNG VON LERNSTRATEGIEN.................................................................................................. 64 6.2 VERSCHIEDENE KOGNITIVE LERNSTRATEGIEN ............................................................................................ 65 6.3 FÖRDERUNG IM UNTERRICHT ...................................................................................................................... 67 6.4 GUTE UND SCHLECHTE STRATEGIENUTZER ................................................................................................. 68 Überblick über Bereich I Lernen als Wissenserwerb als Verhaltensänderung Gelernte Hilflosigkeit Behavioristische Lerntheorien Sozial–kognitive Lerntheorie Assoziatives Lernen Klassisches Konditionieren n Theorie des kognitiven Lernens Operantes Konditionieren Wissenserwerb (Problemlösen) Gedächtnis- und Wissenspsychologie Lernhilfen und Lernstrategien • • • Infoaufnahme und Infoverarbeitung LZG (Vergessenstheorien) : Diese Themen kommen sehr häufig im Staatsexamen dran. (…) : Diese Themen kommen gelegentlich im Staatsexamen dran. Es können vier Arten des Lernens unterschieden werden: Klassisches Konditionieren Operantes Konditionieren basal, passiver Organismus Modell-Lernen Wissenserwerb (Theorie des kogn. Lernens) kognitiv, aktiver Organismus I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 4 *1. Grundbegriffe und Definitionen 1.1 Psychologie Psychologie (ursprügl.: = Seelenwissenschaft, Psyche = Atem, Hauch): Def. (Pongratz, 1967): Psychologie ist die Erfahrungswissenschaft vom Erleben und Verhalten, wobei Erleben den Innenaspekt und Verhalten den Außenaspekt des Gegenstandes der Psychologie beschreibt Erleben: „Input“ (Wahrnehmung, Informationsverarbeitung, Kognition, Emotion) Verhalten: „Output“ (Handlungen, Verhaltensweisen) Psychologie ist eine empirische Wissenschaft: • Erkenntnisgewinn durch Untersuchungen, Befragungen, Experimente, Tests, etc. • Empirische Befunde • Beschreibung psychotischer Sachverhalte, wie Motivation, Kognition (Vorgänge, um Kenntnis von seiner Umwelt zu erlangen = Denken, Wahrnehmung, Gedächtnis und Sprache ), Lernen, Wahrnehmung, etc. Aufgaben der Psychologie: Beschreibung der Phänomene Erklärung dieser Phänomene Entwicklung von Verfahren für zielbezog. Veränderung (= Histographisches Wissen) (= Nomologisches Wissen) (= Technologisches Wissen) Bezieht sich auf den Ist-Zustand zu gegebenem Zeitpunkt ohne Verknüpfung der Merkmale untereinander und ohne Generalisierungsanspruch. Def. (Bunge, 1967) Gesetzartiges Wissen: entspricht den versch. Theorien über einen Sachbereich, wie er in Hypothesen, Gesetzten und Verknüpfungen von Gesetzen formuliert ist. Technologisches Wissen ist auf die Beherrschung der Welt ausgerichtet. Technologische Aussagen haben Anweisungen zum Inhalt, durch welche Handlungen unter gegebenen Randbedingungen bestimmte erwünschte Zielzustände hergestellt werden können. (z. B. Umfragedaten) -> Nomol. Wissen soll Ereignisse erklären Perrez, 1980: Für welche Personen lassen sich durch welche Trainer welche Trainingsziele unter welchen Lernsettings mit welchen Lehrmethoden am besten approximieren? Teilfächer der Psychologie: • Pädagogische Psychologie (I und II): Psychologie in päd. Situationen ( z.B. Schule, Uni, Jugendarbeit, Medienpsychologie (Fernsehen), etc.); Feldforschung(Theorie) und Praktische Anwendung der Erkenntnisse Lernen, Gedächtnis • Sozialpsychologie (III): Gruppe, Interaktion, +/- Sozialverhalten, Aggression, Vorurteile, Einstellungen • Entwicklungspsychologie (IV): Kognition, Persönlichkeit, kognitive Entwicklung, Moral, Sozialverhalten, Gedächtnis • Diagnostik/Methodenlernen (V): Bewerten, Beurteilen • Klinische Psychologie (IV): Therapie, Verhaltensauffälligkeit, psychische Störung, psychische Erkrankungen z.B. ADS, ADHS, LRS, Gewalt, Angst, Legasthenie, Aggression I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 5 Pädagogische Psychologie: Ewert, 1979: - „Verkürzte“ Darstellung der Psychologie für LehrerInnen (Wichtiges aus den Bereichen allgemeine und differentielle Psychologie, Entwicklungs- / Sozialpsychologie, Diagnostik) - Die päd. Psychologie beschreibt und erklärt die Erziehungswirklichkeit mit der empirischen Methodik der Psychologie - Päd. Psychologie als Theorie und Praxis (nicht von außen Theorien an Erziehungsund Lernprozesse herantragen, sondern Prozesse zur Theoriebildung verwenden) -> Hofer, 1987: Päd. Psychologie ist Teilbereich der Psychologie - Päd. Psychologie = System technologischer Regeln (mit Handlungsanweisung), in der expliziert wird, wie erwünschter Zielzustand erreicht werden kann. Aufgaben der pädagogischen Psychologie: Brandstätter, Reinert, Schneewind, 1979: Entwicklung, Vermittlung und Anwendung psych. Wissens zur “Optimierung” von Erziehungs-, Unterrichts- und Sozialisationsprozessen. Brandstätter, 1976: Die Erkenntnis der päd. Psychologie soll sich an die Praktiker wenden, die ihr Handeln in 4 Analyseschritte gliedern können: Zielanalyse (Was ist störend? Was soll erreicht werden?) Bedingungsanalyse (Welche Ausgangssituation liegt vor?) Intervention (Welche Maßnahmen können helfen?) Evaluation (Welche Effekte haben sich eingestellt?) Pädagogik: Def. (Zecha, 1992): Pädagogik ist das Gesamt aller Erkenntnisbemühungen, das Kulturphänomen Erziehung oder bestimmte Aspekte davon zu beobachten, zu beschreiben und zu erklären, dadurch auch zu verstehen..., häufig mit dem Versuch, daraus Normen und Ideale für die Erziehung zu gewinnen. Def. Erziehung (Brezinka, 1978): Erziehung = Handlungen [...], durch die Menschen versuchen, das Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Komponenten zu erhalten oder die Entstehung von Dispositionen, die als schlecht bewertet werden, zu verhüten. Einteilung der Pädagogik in Großbereiche: - Erziehungswissenschaft (Wissenschaft von Versuchen, Menschen so zu beeinflussen, dass sie bestimmte Persönlichkeitsverfassungen erwerben) - Philosophie der Erziehung - Praktische Pädagogik (Erziehungslehre) - Metatheorien der Erziehung Erziehungswissenschaft und päd. Psychologie haben in etwa die gleiche Intention (Es wird nach Bedingungen geforscht, unter denen Menschen werden, was sie werden sollen). Unterschied: Psychologen setzten Ergebnisse der psychol. Grundlagendisziplinen voraus und übertragen sie auf Kontexte, in denen päd. Handeln optimiert werden soll. I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 6 1.2 Lernen Es existiert angeblich keine Definition, die alle Aspekte des Lernens umfasst! Alltagssprache: Erwerb von Wissen (Wissenserwerb) und von mot. und sprachl. Fertigkeiten (Verhaltensänd.). Allgemeine Definition: Lernen (Edelmann) • Jede Verhaltensänderung, die durch Übung oder Beobachtung entstanden ist [Erwerb motorischer und sprachlicher Fertigkeiten]. • Aufnahme und Verarbeitung von Informationen [Wissenserwerb]. • Vorgänge, bei denen die Person Ziele und Mittel zur Erreichung der Ziele willentlich und verantwortlich auswählt [zielgerichtetes Denken]. Lehren und Lernen stehen in unmittelbarem Zusammenhang. Man kann keinen der beiden Prozesse einzeln für sich behandeln! Phasen menschlichen Lernens: 1) Vorbereitungsphase: Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Reizunterscheidung 2) Aneignungsphase: Verknüpfungsprozess 3) Speicherungsphase: Innere Verarbeitung mit Kodierung (Jegliche Bearbeitung des Materials, z.B. Mehrfachkodierung (Bild und Sprache)) der Erfahrung und Speicherung im Gedächtnis. 4) Erinnerungsphase: Abrufen des gespeicherten Materials Dekodierung Reaktion/Wiedergabe Verschiedenen Arten der Darbietung: • Intentionelles Lernen (absichtlich, zielgerichtet) • Inzidentielles Lernen (beiläufig, häufig effektiver, unbewusst, manchmal unerwünscht!) • Programmiertes Lernen (Lerntempo, Lernschritte): (Skinner (1954)) Prozess(erfolgreicher Lehrer)– Produkt(Schüler)-Forschung (Schwäche: Ergebnisse des Lernprozesses werden betrachtet, nicht aber der Lernprozess selber!) 1.2.1 Lernen als Verhaltensänderung Definition: Lernen (Zimbardo) Lernen ist ein Prozess, der zu relativ stabilen Veränderungen im Verhalten oder im Verhaltenspotential führt und auf Erfahrung (bzw. Übung oder Beobachtung) aufbaut. Lernen ist nicht direkt zu beobachten. Es muss aus Veränderungen des zu beobachtbaren Verhaltens erschlossen werden. Verhalten = nicht nur beobachtbare motorische (sprachliche) Verhaltensweisen, sondern auch interne Zustände, Gefühle und Änderungen in der kognitiven Struktur. Behavoristische Lerntheorien: [siehe 2] Noch heute zentral in der Schule! - Klassisches Konditionieren (Reiz-Reaktion-Lernen) - Operantes Konditionieren (Lernen durch Konsequenzen) Sozial-kognitive Lerntheorie: [siehe 3] - Modelllernen / Beobachtungslernen Auch in der Schule relevant! Definition: Lernen (Hilgard & Bower, 1970, S.16) Lernen ist der Vorgang, durch den eine Aktivität im Gefolge von Reaktionen des Organismus auf eine Umweltsituation entsteht oder verändert wird. Dies gilt jedoch nur, wenn sich die Art der Aktivitätsveränderung nicht auf der Grundlage angeborener Reaktionstendenzen, von Reifung oder von zeitweiligen organismischen Zuständen (z.B. Ermüdung, Drogen) erklären lässt. Aus Lernen muss nicht gleich ein Verhalten folgen! I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 7 Lernen = relativ überdauernde Verhaltensänderung aufgrund von Erfahrung minus Verhaltensänderung aufgrund von - angeborenen Reaktionstendenzen (Unbed. Reflexe, Tropismus, Automatismen, Instinkte) - Prägung - Reifung bzw. Alterung - vorübergehenden organismischen Zuständen (Ermüdung, sensorische Adaption, Änderung der Motivationslage, physiologische Einflüsse, z. B. Pharmaka, Verletzungen) Experiment zu Lernen als Verhaltensänderung: Tolman und Horitz (1930) 3 Versuchsgruppen (Ratten) -> durch Labyrinth laufen (17 Tage Versuchsdauer) Durchschnittliche Fehlerzahl 10 8 6 4 2 Tage 1 10 Gruppe 1: keine Futterbelohnung Gruppe 2: kontinuierliche Futterbelohnung Gruppe 3: Futterbelohnung ab Tag 11 Mehr Motivation für Gruppe 3 wegen Kontrast, erst nichts und dann etwas zu bekommen, alles richtig zu machen Ohne Verstärkung wird zwar gelernt, aber der Erfolg wird erst durch ausreichende Motivation sichtbar 17 1.2.2 Lernen als Wissenserwerb Heute: Mehr Interesse an Wissenserwerb / Wissensstrukturen, nicht mehr an Verhalten. Definition: Lernen (Lukesch) Lernen im Sinne des Wissenserwerbs ist ein bereichsspezifischer, komplexer und mehrstufiger Prozess, der die Teilprozesse des Verstehens, Speicherns und Abrufens einschließt und der unter der Voraussetzung, dass die drei genannten Prozesse erfolgreich verlaufen, auch zum Gebrauch (Transfer) des erworbenen Wissens führen kann. Theorie des kognitiven Lernens [siehe 4] Wissen: [siehe auch 4 und 5] Gedächtnis eines Menschen ist hauptsächlich bestimmt durch in ihm gespeichertes Wissen. Wissenselemente = im Gedächtnis gespeicherte und wieder abrufbare Informationen. Wissen = verbal (sprachlich) oder ikonisch (begrifflich o. bildlich) codierte Erfahrungsinhalte Man unterscheidet: • Deklaratives Wissen (Begriffe, Schemata, Regeln = Sachverhalte) • Prozedurales Wissen (psychomotorische, kognitive Fertigkeiten = Fertigkeiten) • (Bildhaftes Wissen) Transfer: (siehe auch Punkt 4) = Übertragung früher gelernter Reaktionen auf eine veränderte oder neue Situation. Bestimmte Vorgänge beim Lernen oder Denken (erworben) auf andere Situation übertragen! Transferbildung ist nur möglich, wenn Elemente von Situation mit denen einer anderen übereinstimmen, sie ist am stärksten zwischen sehr ähnlichen Situationen. 1.3 Gedächtnis Gedächtnis = die geistige Fähigkeit, Erfahrungen zu speichern und später zu reproduzieren oder wieder zu erkennen. Stoffliche Grundlage ist das menschliche Gehirn. Gedächtnis ist aktives kognitives System, das Informationen aufnimmt, enkodiert, modifiziert und wieder abruft. (Kognitionspsychologie) • • • Enkodierung: Übersetzung eintreffender Reizenergie in einzigart. Code, den das Gehirn verarbeiten kann. Speicherung: Aufbewahrung des enkodierten Materials über einen längeren Zeitraum. Abruf: Wiederauffinden der gespeicherten Informationen zu einem späteren Zeitpunkt. [siehe 5 und 6] I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens Übersicht: Ansätze des Lernens 8 I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 9 *2 Behavioristische Lerntheorien Definition: Behaviorismus (Zimbardo) Ein wissenschaftlicher Ansatz, der das Feld der Psychologie auf messbares, beobachtbares Verhalten reduziert. Der Behaviorismus ist eine Richtung der objektiven Psychologie: Die Lehre vom Verhalten, von Handlungen und Reaktionen. Definition: Behavioristische Perspektive (Zimbardo) Jene psychologische Perspektive, die sich hauptsächlich mit beobachtbarem Verhalten, dass objektiv aufgezeichnet werden kann, sowie mit der Beziehung zwischen beobachtbarem Verhalten und Umweltstimuli beschäftigt. • Zitat (Watson): „Bewusstseinszustände wie die sog. geistigen Phänomene sind nicht objektiv verifizierbar, und aus diesem Grund können daraus nie wissenschaftliche Daten werden“ Nur beobachtbares Verhalten entscheidend (deshalb Tierforschung möglich) • Einflüsse behavioristischer Sichtweise in neueren Theorien: o Lesenlernen (LaBerge& Samuels, 1974) o Schreibenlernen (Scardamalia et al., 1982) o Erwerb motorischer Fähigkeiten (Singly & Andersen, 1989) • Einfluss behavioristischer Lernforschung auf den Unterricht: o Hauptaufgabe der Lehrer = Veränderung von beobachtbarem Verhalten Konzentration auf beobachtbares Schülerverhalten (verhaltensorientierte Lehrziele) o Beachtung des untersch. Zeitbedarfs der Schüler zum Erlernen (vgl. Carrol, Ber. II) o Unterscheidung zwischen passiver und aktiver Beteiligung im Unterricht Ziel aus behavioristischer Sicht: möglichst hohes Maß an Aktivität o Angemessene Verhaltenskonsequenzen einhalten (Lehrerlob, -strafe) Behavioristische Lerntheorien sind nur ein Ausschnitt zur Erklärung menschlicher Verhaltensweisen. 2.1 Assoziatives Lernen (Verknüpfungslernen) „Lernen lässt sich durch Bildung von Assoziationen erklären. Der Menschliche Geist verknüpft Ereignisse, die in enger zeitlicher Abfolge auftreten.“ (Aristoteles) Assoziatives Lernen: Jede Reaktion (Response = R), die mit einem Reiz (Stimulus = S) wiederholt in Kontiguität stand, wird auch in Zukunft durch diesen Reiz ausgelöst. Kontiguität = direkte zeitliche Nachbarschaft (Grundlage für S-R-Theorien v. Thorndike, Hull, Guthrie) Guthrie (1886-1959): • Assoziatives Lernen = universelles Lernprinzip • Einziges Lerngesetz, auf das alle Prinzipien des Lernens zurückgeführt werden können: „Eine Kombination von Reizen, die mit einer Bewegung einhergeht, pflegt bei erneutem Auftreten diese Bewegung nach sich zu ziehen.“ (Hilgard & Brown, 1970) Klassisches und operantes Konditionieren, die im Folgenden behandelt werden, sind zwei spezielle Formen des assoziativen Lernens. I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 10 2.2 Klassisches Konditionieren Klassisches Konditionieren = Konditionierung des Antwortverhaltens (vorausgeh. Reiz) = eine Art des Lernens, bei der das Verhalten (konditionierte Reaktion = CR) durch einen Stimulus (konditionierter Stimulus = CS) hervorgerufen wird, der seine Wirkung durch eine Assoziation mit einem biologisch bedeutsamen Stimulus (unkonditionierter Stimulus = US) erlangte. • NS: Neutraler Stimulus = Reiz, der keine bestimmte Reaktion hervorruft (außer evtl. Aufmerksamkeit) • US: Unkonditionierter Stimulus = Reiz, der auf natürlichem Weg eine bestimmte Reaktion hervorruft • UR: Unkonditionierte Reaktion (Response) = Nicht gelernte, biologisch vorgeformte Reaktion, durch einen US hervorgerufen • CS: Konditionierter Stimulus = Ursprünglich neutraler Reiz, der durch kontingentes Auftreten mit einem US die (annähernd) gleiche Reaktion hervorruft wie US • CR: Konditionierte Reaktion (Response) = Reaktion, durch einen CS hervorgerufen (CR ≠ UR) 2.2.1 Klassisches Konditionieren- was ist das? Die Natur gibt uns eine Assoziation US - UR vor, klassisches Konditionieren produziert hingegen eine Assoziation CS - CR. Das funktioniert folgendermaßen: Ein NS (z. B. ein Lichtsignal oder Ton, die üblicherweise keine Reaktion hervorrufen), wird wiederholt mit dem US (z. B. Futter) gepaart. UR (z. B. Speichelfluss, jetzt = CR) folgt vorhersagbar dem NS (jetzt = CS). (Nach mehreren Durchgängen wird der CS (also ein Lichtsignal oder Ton) eine Reaktion auslösen, die als konditionierte Reaktion CR bezeichnet wird) Vor dem Experiment: US UR NS keine Reaktion Nach dem Experiment: US UR CS CR Motivation und Einsicht spielen beim klassischen Konditionieren keine Rolle. ! Beim klassischen Konditionieren wird keine neue Reaktion gelernt, es entsteht lediglich eine neue Reiz-Reaktions-Verbindung ! Einfluss auf die Konditionierung haben sowohl unabhängige als auch abhängige Variablen: Unabhängige Variablen (am besten erforschte Einflüsse des klassischen Konditionierens): • Anzahl der Durchgänge • Zeitlicher Abstand zwischen dem CS und dem US • Intensität oder Qualität eines oder beider Reize Abhängige Variablen: • Stärke der konditionierten Reaktion (Amplitude) • Zeitdauer der Darbietung des konditionierten Reizes und der konditionierten Reaktion • Verlauf des Konditionierungsprozesses (Erwerbsrate) • Dauerhaftigkeit der konditionierten Reaktion bei Ausbleiben der unkonditionierten Reize (d.h. Resistenz oder Persistenz gegenüber Löschung) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 11 2.2.2. Paradigma d. klass. Konditionierens: Der Pavlovsche Hund Nach dem Experiment von Pavlov (1849 – 1936) lässt sich das oben beschriebene Prinzip des klassischen Konditionierens bei einem Hund zeigen. Durchführung: 1. Kontrollphase: (vor Experiment) US: Futter UR: Speichel US UR NS: Glockenton Orientierungsreaktion: Aufmerksamkeit NS Keine bestimmte Reaktion 2. Erwerbsphase: US: Futter + NS: Glockenton UR: Speichel US + NS UR Nach einigen Durchgängen... ( Nach der Konditionierung): CS: Glockenton CR: Speichel CS CR Nach der Konditionierung setzte der Speichelfluss schon beim Glockenton ein. Nach Verbindung des US mit dem NS folgt tatsächlich eine konditionierte Reaktion (CR) auf den Glockenton (dann CS). Lernprinzip der Kontiguität: räumlich-zeitliche Nähe von US und NS I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 12 Beim klassischen Konditionieren, ebenso wie beim Erzählen eines Witzes ist das Timing das Entscheidende. CS und US müssen zeitlich eng beieinander liegen (Kontiguität = zeitlichräumliches gemeinsames Auftreten der Reize), damit der Organismus sie als zeitlich verbunden wahrnimmt (= Grundlage des Lernprozesses!). 2.2.3 Die Phasen des Konditionierens genauer betrachtet A) Erwerb stark Der Erwerb ist jene Phase in einem Experiment zum klassischen Konditionieren, in der die CR erstmalig auf den CS hin auftritt. Stärke der (1) CR Pause Erwerb schwach In ihrer Häufigkeit nehmen sie mit zunehmenden Wiederholungen zu. Im allgemeinen müssen CS und US mehrfach gepaart werden, bevor der CS zuverlässig eine CR hervorruft. Zeit Durchgänge Zeitliche Strukturen zwischen der Präsentation der beiden Stimuli nach Hearst (1988): o Verzögerte Konditionierung Verbreitetste Art der Konditionierung. CS wird vor dem US präsentiert und hält Mindestens bis der UR einsetzt. I. A. Konditionierung hier am stärksten mit kurzem Intervall zw. Start des CS und des US US CS o Spurenkonditionierung US CS o Der CS wird unterbrochen oder entfernt, bevor der US präsentiert wird. (Spur: bezieht sich auf Gedächtnis / die Erinnerung an den CS) Simultane Konditionierung CS und US werden gleichzeitig dargeboten. US CS o Rückwärtskonditionierung CS wird nach dem US präsentiert. US CS Rückwärts- und simultane Konditionierung funktionieren eher schlecht, da der CS nicht wirklich den Beginn eines US vorhersagt. I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 13 Weitere Einflüsse auf klassisches Konditionieren in der Erwerbsphase: Kontingenz = Vorhersagbarkeit des Auftretens des US auf den CS Nach Versuchen von Rescorla (1988) reicht die Kontiguität alleine nicht aus. Der CS (hier Ton) muss zudem zuverlässig das Auftreten des US (Futter) voraussagen (= Kontingenz), damit klassisches Konditionieren stattfindet. Informativität = deutliches Abheben des CS von der restlichen Umgebung Nach Versuchen von Kamin (1969) mit Ratten erfolgt Konditionierung dann am schnellsten, wenn der CS sich deutlich von anderen in der Umgebung vorhandenen Reizen hervorhebt. (1. Konditionierung auf Ton blockiert Konditionierung auf Licht (mit Ton) in 2. Phase) Blockierung: Organismus lernt neuen Stimulus nicht, der US signalisiert, da er gleichzeitig mit einem Stimulus präsentiert wird, der bereits als effektives Signal gilt. (= Erklärung dafür, dass Konditionierung dann am schnellsten erfolgt, wenn der CS sich deutlich von den anderen in der Umgebung vorhandenen Reizen hervorhebt) Fazit: Klassisches Konditionieren ist komplexer als Pavlov angenommen hatte: Ein NS wird nur dann ein effektiver CS, wenn er kontingent und informativ ist. B) Extinktion stark Stärke der (2) Extinktion CR Pause schwach Extinktion (= Löschung): Wird ein konditionierter Reiz (CS) nicht länger in Verbindung mit dem UCS dargeboten, so wird CR im Laufe der Zeit immer schwächer, bis sie schließlich ganz ausbleibt. Dieser Prozess heißt Extinktion. Zeit Durchgänge Weitere Begriffe zur Löschung: Spontane Remission: Gelöschte Reaktion ist verhaltentheoretisch aus den Augen, aber kognitiv nicht aus dem Sinn Der CR tritt nach einer Ruhepause in schwacher Form wieder auf, wenn wieder nur der CS dargeboten wird Ersparnis: Bei erneuten Konditionierungsdurchgängen wird weniger Zeit benötigt, eine Reaktion wiederzulernen als diese ursprünglich zu lernen. Fazit: Generell ist es schwieriger eine konditionierte Reaktion vollständig zu löschen als sie zu erwerben. ( Vgl. Anwendungsbereiche 2.2.5) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 14 2.2.4 Weitere Konditionierungsprozesse Reizgeneralisierung: = die automatische Erweiterung konditionierten Verhaltens auf ähnliche Stimuli, die niemals mit dem unkonditionierten Stimulus gepaart wurden. • • Je ähnlicher der neue Reiz dem ursprünglichen CS ist, desto stärker die Reaktion ( Generalisierungsgradient) Generalisierung ist in der Natur eine Art Sicherheitspolster: neue aber vergleichbare Ereignisse bekommen dieselbe Bedeutung gleiche Reaktion Beispiel: Raubtier gibt einen etwas anderen, aber ähnlichen Laut von sich gibt das Beutetier erkennt die Gefahr und reagiert schnell! Reizdiskrimination: Ein Konditionierungsprozess, in dem der Organismus lernt, unterschiedlich auf Reize zu reagieren, die sich von dem CS entlang einer Dimension (z.B. Unterschiede in Farbton oder Tonhöhe) unterscheiden. Diskrimination: Nur auf exakt diesen CS wird eine CR ausgelöst Garcia (1990): Klassisches Konditionieren stellt einen Mechanismus dar, effizient auf die Strukturen der Umwelt zu reagieren Schärfung der Diskriminationsfähigkeit durch Diskriminationstraining: Schaffung von Erfahrungen, bei denen nur einer dieser Töne mit dem US auftritt während die anderen wiederholt ohne dem US dargeboten werden. Konditionierung höherer Ordnung: Das Verfahren, innerhalb dessen ein NS zum CS wird, indem er mit einem bereits etablierten CS gepaart eingesetzt wird. (Dies ist für angenehme und unangenehme Reize möglich) Konditionierung höherer Ordnung: Ein CS wird mit einem neuen NS verknüpft, um auf den NS eine CR auszubilden Durch Konditionierung hat der CS einiges von der Macht des biologisch bedeutsamen US übernommen (da er nun die Reaktion CR auslösen kann) CS ist in gewissem Sinne zum Stellvertreter des US geworden. CS: Glockenton CR: Speichel I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens Nun können konditionierte Reize eingesetzt werden, um einen weiteren Reiz zur Auslösung der gleichen Reaktion zu konditionierten. 15 CS: Glockenton + NS: Licht CR: Speichel CS2: Licht CR: Speichel Es ist auch möglich, zwei Reize VOR der Konditionierung miteinander zu verknüpfen: Assoziative Konditionierung: (siehe 2.1: Assoziatives Lernen) späterer CS1 und CS2 werden nur vor dem Aufbau einer Konditionierung mitein. gekoppelt ( Konditionierung höherer Ordnung: Zuerst wird Konditionierung aufgebaut, dann Stimuli miteinander gekoppelt) NS1: Glockenton + NS2 (Licht) OR CS1: Glockenton CR: Furcht NS1: Glockenton + US: Schock UR: Furcht CS2: Licht CR: Furcht Einflüsse auf die Konditionierung 2. Ordnung: - Konditionierung 2. Ordnung ist nach Rescorla (1980) dann stärker, wenn Wahrnehmungsähnlichkeit zwischen den beiden konditionierten Reizen besteht (d. h. in beiden Fällen Schallreize, Lichtreize, Farben, oder Muster) - Schnellstes Gelingen, wenn der neue Reiz ein zuverlässiger Prädikator des urspr. CS ist - Im Rahmen von verzögerten und Spurenkonditionierungsplänen effektiver als bei simultanen oder Rückwärtskonditionierungsplänen. Insgesamt zum Konditionieren höherer Ordnung: Beträchtliche Erweiterung des Bereichs der klassischen Konditionierung: Nicht mehr daran gebunden, dass ein biologisch relevanter Reiz auftritt Verhaltensreaktionen sind durch ein unbegrenztes Repertoire von Reizen kontrollierbar Konditionieren umfasst nicht nur die Entwicklung einer Verhaltenreaktion, sondern auch Assoziationen zwischen Reizereignissen, die als Signale von Lust und Schmerz neu bewertet werden. Wichtiger Prozess für das Verständnis vieler Arten komplexen menschl. Verhaltens! I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 2.2.5 Anwendungsbereiche der klassischen Konditionierung Viele unserer Einstellungen und Emotionen sind durch Konditionierungsprozesse, die außerhalb unseres Bewusstseins stattfinden oder stattgefunden haben, entstanden. KONDITIONIERTE FURCHT: Versuch nach Watson & Rayner (1920) „Der kleine Albert“ Ziel: Nachweis, dass viele Furchtreaktionen als eine Paarung aus einem NS mit etwas natürlich Furchtauslösendem verstanden werden können. 1. Kontrollphase: US: Lautes Geräusch UR: Weinen US UR NS: Ratte Orientierungsreaktion (OR): Freude, Interesse NS OR 2. Erwerbsphase: NS: Ratte + US: Lautes Geräusch UR: Weinen NS + US UR Nach einigen Durchgängen... CS: Ratte CR: Weinen CS CR 16 I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 17 Generalisation: auch auf dem CS ähnliche Reize hin wird eine CR ausgelöst weißer Bart CR: Weinen Konditionierte Furchtreaktionen können über Jahre hinweg halten, auch wenn der ursprüngliche furchtauslösende US nie wieder auftritt. Kann nur sehr schwer wieder gelöscht werden. (z. B. Gefahrensignal bei Marineveteranen) Ist intensive Angst beteiligt, dann kann es sogar nach nur einmaliger Koppelung des NS mit US zur Konditionierung kommen. (z.B. Autounfall bei Regen Panik bei Regen im Auto) Behandlungstechniken für Patienten mit Angst- und Furchtstörungen: 1) Gegenkonditionierung nach Jones (1924): Peter (3 J.) hat Angst vor Kaninchen, Behandlung = Gegenkonditionierung mit Süßigkeiten: 1. Gebäck (US) angeboten angenehme Reaktion (UR) 2. gleichzeitig Kaninchen (CS) Furcht (CR), aber nur in Ecke des Raumes 3. Folgende Tage: immer wenn Peter Gebäck aß, Kaninchen etwas näher zu ihm 4. Freude an Keksen ersetzte Angst vor Kaninchen 2) Systematische Desensibilisierung nach Wolpe (1958) greift gleiche Idee wieder auf: Ausgangspunkt: Bestimmte Reaktionen sind unvereinbar Mensch kann sich nicht im Zustand der Entspannung befinden und zugleich Furchterlebnisse haben. Methode: Menschen durch geeignete Übungen zur völligen Entspannung bringen und in diesem Zustand mit dem furchtauslösenden Reiz konfrontieren Überwindung der Furcht (Methode hatte Erfolg!!!) 1. Erstellung einer Angsthierarchie, von der am wenigsten bis zur am stärksten Furcht einflößenden Situation. 2. Erlernen einer Entspannungstechnik 3. Durcharbeiten der Angsthierarchie auf rein mentaler Ebene, dabei Einsatz von Entspannungstechniken (wenn Angstgefühl einsetzt) 4. Durcharbeiten der Angsthierarchie auf realer Ebene I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 18 Schulbeispiele: Prüfungs- / Schulangst, Abneigung gegenüber Schulfächern / Lehrern… Klassenzimmer bietet viele Möglichkeiten für Schüler, Assoziationen zwischen bestimmten Ereignissen und emotionalen Reaktionen entstehen zu lassen: • Lehrer Diese NS erlebt der Schüler häufig mit Maßnahmen • Unterrichtsfach wie Lob und Tadel, die bei ihm Stolz, Freude, • Unterrichtsmaterialien Unzufriedenheit auslösen. • Schule als Institution bei mehrfacher Wiederholung werden NS zu CS Erklärung für Schulangst: 1) Klassisches Konditionieren: Angst vor einer Lehrkraft NS: Lehrer + US: Tadel UR: Furcht CS: Lehrer CR: Furcht 2) Konditionierung höherer Ordnung: Übertragung der Schulangst auf Fächer: CS1: Lehrer CR: Furcht CS1: Lehrer + NS2: Mathe-Unterricht CR: Furcht CS2: Mathe-Unterricht CR: Furcht Nachdem durch klassisches Konditionieren Angst vor dem Lehrer entstanden ist, kann sich diese Angst durch weitere Konditionierung auf Schulfächer und andere Lehrer übertragen. US: Tadel UR: Furcht I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 3) Generalisation: Übertragung der Schulangst auf andere LehrerInnen: CS: Lehrer CR: Furcht CS: Alle Lehrer CR: Furcht Prävention und Maßnahmen gegen Schulangst: Maßnahmen im Unterricht: Lehrer sollte stets Klassenzimmer mit positiven Gefühlen verbinden Positives Klassenklima Schüler dürfen Misserfolge nicht auf Schule allgemein, sondern nur auf konkrete Aufgabenstellungen beziehen Behandlungstechnik bei Schul- / Prüfungsangst: (analog zu oben: systematische Desensibilisierung) 1. Hierarchie von Angstauslösern aufschreiben: schwächste als 1. 2. Schüler soll sich völlig entspannen, und dann jeden Punkt durchgehen/vorstellen bis keine Angst mehr 3. Pausen mit Entspannungsübungen zwischen jeder Stufe Lediglich Vorstellungsebene, besser Realität KONDITIONIERTE GLÜCKS- ODER BEGEISTERUNGSREAKTIONEN: In der Werbebranche wird diese Art der Konditionierung genutzt Assoziationen zwischen Produkten und angenehmen Gefühlen und Vorstellungen (Bsp.: Nackte Frau auf Auto…) WEITERE BEISPIELE VON KLASS. KONDITIONIEREN: • Immunsystem durch Lernprozesse beeinflussbar wirkstofflose Pille (Placebo) • Drogenabhängigkeit und Tod durch Überdosis (Zimbardo S.217 lesen, um es zu verstehen, sehr interessant! Aber nicht dringend wichtig) 19 I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 20 2.3 Operantes Konditionieren Operantes (instrumentelles) Konditionieren = Lernen durch Konsequenzen von Verhalten = eine Lernform, bei der sich die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion aufgrund einer Veränderung ihrer Konsequenzen ändert. (Verhalten steht in Verbindung mit Ereignissen, die ihm nachfolgen.) Verhalten Konsequenz Kontingenz (Wenn-dann-Beziehung) Operant = jedes Verhalten, das von einem Organismus gezeigt wird, und anhand seiner beobachtbaren Effekte auf die Umwelt des Organismus beschrieben werden kann. (wörtlich: Operant = die Umwelt beeinflussend) 2.3.1 Operantes Konditionieren, was ist das? Versuch nach Thorndike (1898): Instrumentelles Konditionieren Beobachtung von Katzen, die versuchten, sich aus „Puzzlebox“ zu befreien. - Hungrige Katze wurden in Käfig gesperrt, vor dem Futter stand Käfig konnte durch Tritt auf Taste geöffnet werden Katze zeigte spontane Verhaltensweisen, um sich zu befreien (z. B. Kratzen an den Gitterstäben) trial & error Katze tritt zufällig auf Taste, Tür öffnet sich, sie gelangt an dasFutter das zum Futter führende, unmittelbar vorausgehende Verhalten wird verstärkt (= tritt in Zukunft häufiger auf) zufällige Reaktion wird durch Erfolg verstärkt law of effect = grundlegendes Lerngesetz: Die Kraft eines Stimulus, eine Reaktion hervorzurufen, wird verstärkt, wenn der Reaktion eine Belohnung folgt, und geschwächt, wenn keine Belohnung folgt. Konsequenzen als entscheidende Determinante des Verhaltens Ergebnis: Lernen ist keine Assoziation zwischen zwei Reizen, sonder zwischen Reizen (Stimuli) und einer Reaktion (R), gelernt wird durch eine S-R-Verbindung. Verhaltensweise wird so zum Instrument, eine angenehme Konsequenz herbeizuführen und eine unangenehme zu vermeiden. Instrumentelle Konditionierung I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 21 Versuch nach Skinner (1909 – 1990): Skinner box Unterschied zu Thordike: Nicht nur Beobachtung, sondern Kontrolle des Verhaltens mit Hilfe einer vorausgehenden Reizbedingung. Experiment (mit Tauben & Ratten durchgeführt): Tier in Käfig mit Pickscheibe (a), Futterautomat (b), Lichtquelle (c) und Wassertrog (d). Tier erhält nur dann Futter (S+), wenn die Lichtquelle (= diskriminativer vorausgehender Reiz (S)) eingeschaltet ist. Tier lernt, nur dann zu picken, wenn das Licht an ist Lernen durch Konsequenzen, das Verhalten (R) ist durch vorausgehenden Reiz kontrollierbar!! Licht an (S) Verhalten (R) Futter (S+) Schema: Vorausgehende Reizbedingung Nachfolgendes Reiz-Ereignis Verhalten S S+ (oder S-) R Unterscheide klassisches ↔ operantes Konditionieren: Klassisches Konditionieren Operantes Konditionieren Beide sind Mittel zur Verhaltensänderung Versuchsleiter kontrolliert Gabe des US Eigenkontrolle über Verstärker Reaktion: durch US bzw. CS hervorgerufen (elicit) von spezifischem Reiz ausgelöst (z. B. Futtersuche) Reaktion: vom Organismus selbst hervorgebracht (emit) nicht von spezifischem Reiz ausgelöst!! Konditionieren des Antwortverhaltens Verhaltensänderung aufgrund von Konsequenzen 2.3.2 Grundprinzipien des operanten Konditionierens Voraussetzungen für operantes Konditionieren – also dafür, dass man eine Reaktion über einen diskriminativen Reiz und der Konsequenz auf die Reaktion kontrollieren kann – sind, wie beim klassischen Konditionieren: - Kontiguität (zeitliche & räumliche Nachbarschaft S-R-S+/S-) Beispiel: Picken der Taube bei Licht zuverlässige Gabe von Futter - Kontingenz (zuverlässige Beziehung zw. Reaktion und Konsequenz) - Informativität (Abheben des diskriminativen Reizes vom Rest der Umwelt) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 22 2.3.2.1 Reaktions-Konsequenz-Konstellation PRINZIP DER VERSTÄRKUNG & BESTRAFUNG Verstärkung = Gabe eines Verstärkers in der Folge einer Reaktion Auftretenswahrscheinlichkeit der Reaktion wird erhöht. Bestrafung = Gabe eines Bestrafungsreizes in der Folge einer Reaktion Auftretenswahrscheinlichkeit der Reaktion wird gesenkt. Unterscheide die verschiedenen Arten der Verstärkung / Bestrafung: Positive Verstärkung = kontingente Verabreichung eines positiven Verstärkers Beispiel: Wenn Schüler brav Lob / „Gutpunkte“… Negative Verstärkung = die Vermeidung, Entfernung oder Reduktion eines negativen Verstärkers nach einer Reaktion Beispiel: Wenn Schüler brav Unangenehmes Entfernen, also keine Hausaufgaben aufgeben… Positive Bestrafung = die auf ein Verhalten folgende Verabreichung eines aversiven Reizes Beispiel: Wenn unerwünschtes Verhalten Tadel / Schimpfen / Verweis… Negative Bestrafung = der auf ein Verhalten folgende Wegfall eines angenehmen Reizes Beispiel: Wenn unerwünschtes Verhalten Privilegienentzug (Taschengeld weg, „Gutpunkte“ streichen…) Achtung: „positiv“ (hier: hinzugeben) bzw. „negativ“ (hier: wegnehmen) sind in diesem Zusammenhang nicht wertend! Übersicht: Angenehme Konsequenz (Reiz oder Zustand) z.B. Zuneigung, Fernsehen Unangenehme Konsequenz (Reiz oder Zustand) z.B. Ohrfeige, Verweis Keine Konsequenz z.B. keine Äußerung zu Verhalten Verhaltensaufbau Darbietung / positiv Positive Verstärkung Darbietung eines angenehmen Reizes z.B. Futter, Lob, Geld Positive Bestrafung Darbietung eines unangenehmen Reizes z.B. Bußgeld Löschung Entzug / negativ Negative Bestrafung Entzug eines angenehmen Reizes z.B. Fernsehverbot Negative Verstärkung Entzug eines negativen Reizes z.B. Hausaufgaben weg Löschung Verhaltensabbau (1) positive Verstärkung (3) Bestrafung (2) negative Verstärkung (4) Löschung Ignorieren führt auch zu Abbau!! I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 23 DISKRIMINATIVE REIZE UND GENERALISIERUNG Man will die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion nicht für alle Umstände ändern (Generalisierung), vielmehr will man sie nur in einem bestimmten Kontext ändern. Diskriminativer Reiz: Die Reize, die einer Situation vorangehen, erlangen durch Assoziation mit Verstärkung oder Bestrafung die Funktion, das Verhalten festzulegen. Organismen lernen, dass ihr Verhalten bei manchen Reizgegebenheiten, nicht jedoch bei anderen eine bestimmte Wirkung (Verstärkung / Bestrafung) hat. Beispiele: - Andere Reaktion bei roter als bei grüner Ampel - Schulbeispiel: Kind soll bim Unterricht ruhig sitzen, darf aber in den Pausen laut und rege sein Unter Laborbedingungen kann bei Vorliegen diskriminativer Reize durch die Manipulation der Verhaltenskonsequenzen das Verhalten eines Organismus weitgehend kontrolliert werden. Beispiel: Tauben können Körner nach dem Picken auf eine Scheibe nur gegeben werden, wenn grünes Licht scheint, und nicht bei rotem. grünes Licht = diskriminativer Hinweisreiz Ein Reiz, der Verstärkung signalisiert wird als positiver diskriminativer Reiz (SD) bezeichnet. δ Der Reiz, der kein Verstärker erhältlich signalisiert wird negativer diskriminativer Reiz (S ) δ Beispiel: Taube Grünes Licht = SD, rotes Licht = S Diskriminativer Reiz positiv SD negativ Sδ Generalisierung: Die Verhaltensweise, die ein Organismus als Reaktion auf diskriminatorische Reize zeigt, wird auf andere Reize, die dem diskriminativen Reiz ähneln, generalisiert. Schulbezug: Jede Frage / Aufforderung im Unterricht, die eine Antwort nach sich zieht, besitzt die Funktion eines diskriminativen Reizes. (wenn alle Schüler dieser Aufforderung nachkommen) Gründe für das Ignorieren der Klasse bei Fragen / Aufforderung: Lehrer hat nicht immer eine „differentielle Verstärkung“ durchgeführt. Differentielle Verstärkung: Nur dann Verstärkung geben, wenn auch wirklich auf den positiven diskriminativen Reiz reagiert wurde, nicht wenn Verhalten zufällig passiert ist!! Bsp. Experiment nach Tuckmann (1992): Hefte sollen auf Tisch gelegt werden - Schüler tut es Lob - Schüler schwätzt, legt aber Heft dennoch auf den Tisch nicht verstärken! Diskriminativer Reiz hebt sich nicht ausreichend von anderen Reizen ab. Für Unterscheidungslernen können diskriminative Hilfsreize (= prompts) eingesetzt werden Bsp.: Lehrerfrage nicht klar - Frage: Ist Wort „singen“ ein Verb? Keine Antwort. - Hilfsreiz: Beschreibt das Wort eine Tätigkeit? Richtige Antwort ( Verstärkung) - richtig Verstärkung: „richtig, singen ist ein Verb“ Hilfsreize sollten so schnell wie möglich wieder ausgeblendet (= fading) werden! Ziel: Gewünschte Reaktion direkt auf diskr. Reiz (Wort singen reicht, um es als Verb zu identifizieren) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 24 2.3.2.2 Allgemeine Möglichkeiten der Verstärkung ARTEN VON VERSTÄRKERN: Primäre Verstärker: Biologisch begründete Verstärker wie Nahrung und Wasser. Konditionierte (sekundäre) Verstärker: lm Rahmen des klassischen Konditionierens werden aus zuvor neutralen Stimuli (durch Assoziation mit primären Verstärkern) Verstärker. Menschl. Verhalten wird meist von konditionierten Verstärkern beeinflusst: Geld, Titel… Kond. Verstärker sind leichter zu verwenden als primäre (transportabel, leicht zu verteilen) Vorsicht: Sekundäre Verstärker setzen bestimmt Lerngeschichte voraus! Schulbezug: Im Unterricht werden viele konditionierte Verstärker verwendet: Zensuren, Lob… VERSTÄRKUNGSPLÄNE: Kontinuierliche Verstärkungsprogramme: Verhalten wird immer (Verhaltensaufbau) oder nie (Extinktion) verstärkt. Partielle Verstärkungsprogramme: (auch: gelegentliche oder intermittierende Verstärkung) Zu lernendes Verhalten wird nicht jedes Mal verstärkt. Je nach zeitlicher oder anzahlbedingter Verstärkung unterscheidet man verschiedene Verstärkungspläne (Muster der Gabe / Zurückhaltung von Verstärkern): Quotenplan: Verstärkung folgt nach gewisser Anzahl von Reaktionen. Fixierter Quotenplan Variabler Quotenplan Intervallplan Verstärkung erfolgt nach bestimmten Zeitintervallen (unabh. von Reaktion) Fixierter Intervallplan Variabler Intervallplan Verstärker für die erste Reaktion wird nach einer festen Anzahl von Reaktionen gegeben. Verstärker wird nach einer variablen Zahl von Reaktionen (durchschnittl. Anz. festgelegt) gegeben. Verstärker für die erste Reaktion wird nach einem bestimmten Zeitintervall gegeben. Verstärker für die erste Reaktion wird nach einer variablen Zeitspanne (Mittelwert fest) gegeben. Hohe Auftretenswahrscheinlichkeit von Reaktionen, wegen unmittelbarer Korrelation Reaktion-Verstärker Höchste Reaktionsrate und größter Löschungswiderstand Direkt nach Verstärkung nur wenige Reaktionen, wenn Zeit der Belohnung näher rückt Reaktionsrate steigt Mäßige, aber sehr stabile Verhaltensrate. Löschung langsamer als unter fixierten Intervallplänen. Beispiele: - Taube kann so viel Futter erhalten wie sie will, sie muss nur oft genug picken (z. B. 5x) - Schüler, der mit Arbeitsauftrag fertig ist, darf mit Hausaufgabe beginnen Beispiele: - Glücksspiel - Lehrer ruft Schüler auf, der sich mehrmals vergeblich gemeldet hat. Beispiel: - Vokabeltest immer am letzten Tag der Woche Gefahr: Schüler bereiten sich nur für diesen Tag vor Beispiel: - Schüler müssen jederzeit damit rechnen, einen Vokabeltest zu schreiben, oder aufgerufen zu werden. Gefahr: Prüfungsangst I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 25 Effekt nach Bittermann (1975): Reaktionen, die unter partieller Verstärkung erworben wurden sind löschungsresistenter als bei kontinuierlicher Verstärkung. Beispiel: Wenn Schüler sich sehr häufig meldet nicht jedes mal aufrufen, sondern partiell verstärken SHAPING UND CHAINING Shaping: = Verhaltensformung Veränderung des Verhaltens in aufeinander folgenden kleinen Schritten, wobei jeder eine weitere Annäherung an die erwünschte Leistung bedeutet. (Zunächst: Verstärkung jedes Elements der erwünschten Leistung, nach regelmäßigem Auftreten eines Elements: nur noch Verstärkung von zielnäheren Reaktionen) Bekannteste Anwendung: „programmierte Unterweisung“ (Skinner): Programm führt Lernenden durch sorgfältig geplante Lernschritte Chaining = Kettenbildung Operantes Verfahren, bei dem jeder Reaktion innerhalb einer Kette von Einzelreaktionen ein konditionierter Verstärker folgt, bis auf die letzte Reaktion ein unkonditionierter oder primärer Verstärker folgt. Jedes Glied der Kette ist ein diskriminativer Reiz für die nächste Reaktion und ein konditionierter Verstärker der unmittelbar vorausgehenden. 2.3.2.3 Möglichkeiten zum Verhaltensauf- und abbau Überblick über positive / negative Verstärkung / Bestrafung: Positive Verstärkung Darbietung eines angenehmen Reizes Negative Verstärkung Entzug eines negativen Reizes Positive Bestrafung Darbietung eines unangenehmen Reizes Negative Bestrafung Entzug eines angenehmen Reizes Soziale Verstärker Materieller Verstärker Aktivitäten als Verstärker Lob, Anerkennung, Zuwendung; Interesse zeigen, Freundlichkeit Kein Tadel Gutpunkte, Token, Striche Spielen, Rumtoben, Wandertag Keine Hausaufgabe, keine Strafaufgabe Keine Hausaufgabe, Keine Ex, Kein Nachsitzen Tadel Hausaufgabe, Strafaufgabe Hausaufgabe, Ex, Nachsitzen Keine Anerkennung, Keine Zuwendung, Sozialer Ausschluss Gutpunkte, Token wegnehmen, neg. Striche Spielen, Rumtoben, Wandertag streichen I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 26 VERHALTENSAUFBAU: = individuell angepasster Einsatz von negativen und positiven Verstärkern! Verschiedene Verstärkerklassen (Maßnahmen): • Soziale Verstärker: Menschen mit pos. sozialer Beziehung Lob, Zuwendung; Interesse zeigen, Freundlichkeit, gemeinsam Zeit verbringen, Tadel wegnehemen (Studie von Tharp & Wetzel, 1975)) • Materielle Verstärker: Gabe von Süßigkeiten, Geld, Weglassen von Hausaufgaben… Token-Economy: Gutpunkte, Striche etc. werden als systematische, symbolische Verstärker eingesetzt. ( können in reale Verstärker (= Bonbons, Aktivitäten…) eingetauscht werden) Bedingungen nach O’Leary & Drabman (1971): Verständliche Erklärung, strikte Regeleinhaltung, Einsichtigkeit der Regeln, einfache Möglichkeit der Verteilung, Punktestand leicht überprüfbar, keine Störung des Unterrichts durch Token-Vergabe Einsatzmöglichkeiten: Lese- & Rechtschreibtraining, Toilettenverhalten, Reduktion hyperaktiven Verhaltens, Intelligenz-Training (v. a. bei Kindern!) Vorteile nach Selg (1977): Universeller Verstärkereinsatz, kaum Sättigung, leicht anwendbar, keine Unterrichtsunterbrechung, kurze Zeit zw. Verhalten & Verstärkung, breiter Bereich des Umtausches Kritik am Tokensystem: Langfristige Folgen unbekannt, keine Vorbereitung auf reales Leben, Reduktion auf materielle Aspekte, nur mit Mitarbeit der Eltern möglich, gesteigertes Konkurrenzerhalten, Belohnung von Leistung nach Akkordsystem nur vorübergehend einsetzen, gleichzeitig soz. Verstärker aufbauen, Hinführung zur Selbstkontrolle • Aktivitäten als positive Verstärker: Spielen / Toben lassen, Nachsitzen / Hausarrest wegnehmen Premack-Prinzip (David Premack, 1965): Einsatz einer wahrscheinlicheren Aktivität (Verhalten mit einer unter normalen Bedingungen höheren Auftretenswahrscheinlichkeit) zur Verstärkung einer weniger wahrscheinlichen Reaktion Beispiel: „Wenn du deine Hausaufgaben fertig hast, darfst du mit deinem Videospiel spielen“ Homme et. al. (1963): Unbändige Schulklasse Ruhig sitzen, Belohnung = tobend herumlaufen Erfolg • Informative Verstärker: Verstärkung = Handeln / Erfolgserlebnis selbst (kein Verstärker von außen) - Studie über Neugier (Berlyne, 1974): Durchführung von Versuchen hat belohnenden Wert - Vgl. auch Skinners programmierte Unterweisung Belohnung durch Erreichen des Ziels • Kontingenzverstärker (Kontingenz-Vertrag): Übereinkommen zwischen zwei Vertragsparteien (schriftlich). (Inhalte: Wenn A bestimmtes Verhalten zeigt, bekommt er bestimmte Dinge etc.) Bedingungen nach Homme et al. (1971): Kleine Vertragsschritte, belohnende Kontingenz nach erwünschtem Verhalten, Klarheit des Vertrags, Fairness, Akzeptanz und Respekt beider Seiten, Änderungen müssen möglich sein Vorteile: zielt auf positive Verhaltensweisen, höhere Verbundenheit (da selbst ausgehandelt) Nachteil: „Bezahlung“ von Verhalten durch Verhalten Tauschcharakter Kontingenzverträge sind empfehlenswert bei sehr aversiven Interaktionen (z. B. Familienstreit) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 27 VERHALTENSABBAU: Kombination mit aufbauenden Verfahren für (alternatives, erwünschtes) Verhalten sinnvoll! Nie alleine einsetzen (sonst: negative Verhaltensbilanz) Notwendigkeit des Erlernens eines alternativen Verhaltens Verschiedene Maßnahmen: • Positive Bestrafung: Darbietung aversiver Reize wenig sinnvoll, muss aber manchmal eingesetzt werden (Unwirksamkeit anderer Methoden, Überschreitung vereinbarter Verhaltensregeln) Grundregeln: milde Strafe gleich anfangs (sofortige Verhaltensunterdrückung) und in angemessener Stärke, bei guter Lehrer-Schüler-Beziehung eher möglich (Drohung genügt), Begründung der Strafe / Erklärung des erwünschten Verhaltens, Variation der aversiven Reize (sonst: Gewöhnung), vorher Warnstimuli einbauen Problematik der Bestrafung im Unterricht: (gilt auch für negative Bestrafung) Nach Skinner (1989) Einsatz von aversiven Reizen in der Schule wegen künstlicher Umgebung zu vielen Schülern ABER: Probleme: Zitat Skinner (1989): „Ein Lehrer, der straft, bringt Schülern bei, dass Bestrafung ein Weg ist, Probleme zu lösen. Das eigentliche Ziel eine unerwünschte Verhaltensweise auszulöschen erreicht er dabei nicht. Stattdessen nimmt der Lehrer einige Nebeneffekte in Kauf, die seine Arbeit auf längere Sicht eher erschweren als erleichtern. UNERWÜNSCHTE NEBENEFFEKTE: Auslösen von Gegenaggression (Förderung von Gewaltbereitschaft), Angst, Verärgerung, Verletzung des Selbstbildes, ernsthafte Körperschäden [Gefahr des klass. Konditionierens: Negative Erfahrungen werden mit Schule assoziiert] Bestrafung ist mit Aufmerksamkeitszuwendung verbunden (kann zu Verstärker werden!) O’Leary (1970): S nur leise / alleine tadeln wirkungsvoller als vor der ganzen Klasse Bestrafung kann auch dann verstärkend wirken, wenn Strafe nicht konsequent jedes Mal (Bandura, 1977, 1986) Oft erfährt Bestrafter nicht, welches Verhalten erwünscht wäre (Skinner, 1953) Interesse an schulischer Arbeit kann sich nicht dadurch entwickeln, dass Desinteresse bestraft wird (Skinner) Bestrafung beeinflusst Beziehung zwischen Strafendem und Bestraftem ungünstig Wichtig: Nach Bestrafung sollte auch wieder verstärkt werden! • Negative Bestrafung: Entzug positiver Konsequenzen (= „humane“ Bestrafung) - Privilegienentzug (Response-Cost-Verfahren) - Entzug erworbener Tokens / Punkte nach festen Regeln - Entzug von Spielzeug, Aktivitäten etc. (siehe auch 2.3.2) Vorteile: Wirksamkeit, keine starken emotionalen Nebenwirkungen - Sozialer Ausschluss (Time-Out-Verfahren) - Sachliches Herausnehmen der Person aus sozial verstärkender Situation - kein Tadel, 5 – 15 min Auszeit Probleme: nur bei starken Störungen vertretbar, Finden eines geeigneten Raums (Aufsichtspflicht?), Ausschluss aus langweiligem Unterricht kann verstärkend wirken! I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens • 28 Operante Löschung: Verminderung der Auftretenswahrscheinlichkeit durch Extinktion ( auf zuvor verstärkte operante Verhaltensweise folgt keine Konsequenz mehr) Extinktion / Löschung = keine Verstärkung / Ignorieren Absenkung der Auftretenswahrscheinlichkeit Bei Beginn des Extinktionsprozesses kann eine vorübergehende Erhöhung des Verhaltens stattfinden (Ausbleiben des Verstärkers Frustration), Tempo der Löschung hängt von Lernvorgeschichte ab (kontinuierliche Verstärkung ist weniger löschresistent als partielle Verstärkung). Anwendung in der Schule: Auffälligen Schüler ignorieren (Ermahnung ist oft eher Verstärkung!) Vorteile: effektive Reduktion, langanhaltende Wirkung, vollständiger Abbau, Verzicht auf aversive Kontrolle (Abbau anstelle von Unterdrückung unerwünschten Verhaltens!) Probleme: Identifikation der bisherigen Verstärker, konsequentes Ausbleiben des Verstärkers nötig, Schulklassenproblem (Ignorieren nicht immer möglich Mitschüler reagieren auch auf Störverhalten) Vorsicht: Löschung sollte nicht bei aggressivem Verhalten oder Selbstgefährdung eingesetzt werden! Kombination mit Verstärkung von erwünschtem Verhalten sinnvoll! ( Nebenwirkungen vermeiden). • Verstärkung inkompatiblen Verhaltens: Förderung erwünschten Verhaltens Unvereinbarkeit mit unerwünschtem Verhalten nimmt zwangsweise ab Vorteile: positive Kontrollmethode, gut kombinierbar, langanhaltende Reduktion / häufig völliger Abbau, konstruktive Methode, keine schädigende / belastende Wirkung Nachteil: Bei längerem Vorhandensein des unerwünschten Verhaltens keine kurzfristigen Erfolge! • Stimuluskontrolle: Verhalten ist durch Hinweisreize steuerbar Reduzierung des Verhaltens durch - Vermeidung von Reizen, die zu störendem Verhalten geführt haben (Lehrermonolog…) - Schaffung von Reizen, die zu erwünschtem Verhalten führen Vorteile: keine negativen Nebenwirkungen, relativ einfach einsetzbar • Negative Praxis / Sättigung: (aus der verhaltenstherap.-klinischen Praxis) Aufzeigung der störenden Verhaltensweise, bis sie nicht mehr verstärkend wirkt Wiederholung Ermüdung / reaktive Hemmung Beendigung (Erleichterung!) Anwendung: Schüler stört durch Tierlaute in separatem Raum 10 min Tierlaute von sich geben lassen Beendigung des Verhaltens (nach Blackham & Silberman, 1975) • Verhaltensverhinderung: Verhinderung durch eine unvereinbare Reaktion • Verzögerung des Handlungsablaufs: Komplizierung und Hinauszögern des Handlungsablaufs (= Gegenteil von Unterbrechung der Verhaltenskette) • Gedankenstopp: Gedanken können Auslöser / Verstärker für unerw. Verhalten sein Möglichst frühzeitige Unterbrechung (energische Körperreaktion…) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 29 2.4 Gelernte Hilflosigkeit Erlernte Hilflosigkeit: Person geht davon aus, keine persönliche Kontrolle mehr über bedeutsame Lebensereignisse zu haben (vgl. Bereich II: Kausalattribution). Depression, Hilflosigkeit Experiment von Seligmann & Maier (1967) mit Hunden: a) Vortraining: Hunde werden in 2 Gruppen aufgeteilt und in Käfigen mit elektrifizierbarem Bodengitter fixiert. Beide Gruppen werden klassisch konditioniert: Ton (NS) + Schock (US) UR (Furcht) Ton (CS) Furcht (CR) Gruppe 1: Kann dem Schock (US) weder entgehen, noch ihn beenden. Lernen, dass Schock (US) unvermeidbar & unkontrollierbar ist. Gruppe 2: Kann Schock mit Hilfe einer Platte, die neben Kopf angebracht ist, beenden. Schock ist zwar auch unvermeidbar, aber kontrollierbar. b) gelernte Hilflosigkeit: Nach Vortraining: Beide Gruppen in Käfig, in dem eine Hälfte unter Strom gesetzt werden kann, die andere nicht. Diese Hälften sind voneinander durch eine (für die Hunde schulterhohe) Barriere getrennt. Die erste Käfighälfte wird unter Strom gesetzt, nachdem kurz zuvor der aus dem Vortraining bekannte Ton erklang. Die Hunde können dem Schock entgehen, indem sie über die Barriere springen (Fluchtverhalten beim Erklingen des CS (Ton)). Gruppe 1: Findet den Ausweg nicht und verhält sich untätig; auch nach mehreren Durchgängen lernen 2/3 dieser Gruppe des Fluchtverhalten nicht! GELERNTE HILFLOSIGKEIT Gruppe 2: Zeigt zunächst trial & error, springt dann über die Barriere (law of effect: Sprung erfolgt in zukünftigen Versuchsdurchgängen immer schneller). Operantes Konditionieren: SD (Ton) CR (Sprung) C (Beendigung d. Furcht) Kennzeichen erlernter Hilflosigkeit: 3 Defizite (nach Aloy & Seligmann 1979) 1. Motivationale Defizite (Hunde brauchen lange, um bek. Verhaltensweisen abzurufen) 2. Emotionale Defizite (sie reagieren versteinert, lustlos, verängstigt, und stresserfüllt) 3. Kognitive Defizite (wenig Lernerfolg in neuen Situationen) Gelernte Hilflosigkeit in der Schule: ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Motivation aufgrund von Hoffnungslosigkeit nicht mehr möglich Besonders gefährdet: Schüler, die Scheitern internal & stabil attribuieren (misserfolgsorient.) Wahrnehmungsverzerrung (nicht ohne weiteres zu beseitigen!) Idee: Nur noch Vermittlung von Erfolgen (werden aber nicht mehr wahrgenommen, Fehleinschätzungen!) ⇒ Hohe Anstrengung, um solche Schüler wieder aus dem „Brunnen der Hilflosigkeit“ zu holen! Maßnahmen gegen erlernte Hilflosigkeit: „Re-Attribuierungstraining“ (siehe Bereich II) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 30 *3. Sozial-kognitive Lerntheorie (Modelllernen) Definition: Beobachtungslernen nach Tausch & Tausch (1971): „Unter Beobachtungslernen (Modelllernen) ist zu Verstehen, dass sich das Verhalten eines Individuums auf Grund der Wahrnehmung von Verhaltensweisen anderer Personen (so genannte Modelle) oder auf Grund verbaler Darstellung über das Verhalten anderer Personen ändert, und zwar in Richtung größerer Ähnlichkeit mit der beobachteten oder auf Grund verbaler Übermittlung vorgestellten Verhalten.“ Definition nach Schermer: „Erwerb oder Veränderung von Verhaltenweisen durch Beobachtung eines Modells, das entweder real oder symbolisch gegeben sein kann.“ Soziale Lerntheorien und kognitive Theorien Verhalten wird von Umwelt beeinflusst. Theorien gehen noch ein Stück weiter: Betonung kognitiver Prozesse, denkender Geist Banduras sozial-kognitive Lerntheorie Bandura (1986, 1999): (= Begründer des sozial-kognitiven Ansatzes) Soziale Verhaltensweisen Kognitive Prozesse (Aufmerksamkeit, Interpretation, Verarbeitung…) - Kritik in den 60er Jahren an behavioristischen Theorien - Menschen ist aktiv am Lernprozess beteiligt, nimmt Informationen und Reize auf und verarbeitet diese gedanklich, bevor er reagiert - Komplexe Interaktion zwischen individuellen Faktoren, Verhaltensweisen & Umweltreizen Reziproker Determinismus Beispiele: - Aggressives Kind erwartet Feindseligkeit der anderen Kind aggressiver Andere tatsächlich aggressiver Erwartung bestätigt, möglich Verstärkung (nach Bell-Gredler, 1986) - Übergewichtiges Kind geht schwimmen gesellige Atmosphäre im Bad angenehme Umgebung (Reziprok. Determinismus zw. Person, Ort, Verhalten) - Verhalten wird auch von Einstellungen, Überzeugungen, bish. Lerngeschichte beeinflusst Person Umwelt Verhalten Unterschied zu behavioristischen Lerntheorien: Bandura (1986): „Lernen ist eine informationsverarbeitende Aktivität, durch die Informationen über die Struktur von Verhaltensweisen und über Umweltereignisse in symbolische Repräsentationen, die als Wegweiser für Handlungen dienen, umgewandelt werden.“ Modelllernen Skinner (1953): Hält es zwar für möglich, dass kognitive Prozesse Verhaltensänderungen begleiten, er schließt jedoch aus, dass sie auf solche Einfluss nehmen können. I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 31 Überblick: Modelllernen 66 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren zu 3 Gruppen zugeteilt Film von Rocky & bobo-doll wird angeschaut; unterschiedliches Ende Lernprinzip: Lernen durch Beobachtung 1. Phase: unterschiedliches Filmende Gruppe 1: Rocky C + Gruppe 2: Rocky C – Gruppe 3: Rocky / „Erwerb oder Veränderung von Verhaltensweisen durch Beobachtung eines Modells, das entweder real oder symbolisch gegeben sein kann.“ (Schermer) Prozesskomponenten Erlernen neuen Verhaltens Hemmung / Enthemmung bereits gelernter Reaktionen Reaktionserleichterung Veränderung des Erregungsniveaus Stimulusintensivierung Selbstregulation Selbstbeobachtung Selbstbewertung Selbstreaktion 2. Phase: spontane Reproduktion Gruppe 1: Verhaltensrate am höchsten Gruppe 2: Verhaltensrate am niedrigsten Jungen reagieren aggressiver 3. Phase: Belohnung für Reproduktion alle Gruppen zeigen ca. gleich hohe Verhaltensraten Geschlechtsunterschiede bleiben bestehen Definition klassischer Versuch: 1965 Modell-Lernen Effekte Albert Bandura Sonderformen selbstbezogene Aspekte Selbstwirksamkeit abstrakte Modellierung kreative Modellierung Anwendung Therapie Bewertung positiv: kognitive & motivationale Aspekte berücksichtigt Kompetenz vs. Performanz Forschung im Humanbereich hohe Alltagsrelevanz negativ: Bezug der Einzelkomponenten unklar keine Theorien berücksichtigt Schule nicht nur über Inhalte schreiben, sondern auch über Effekte, Prozesskomponenten und Selbstregulation stellvertretende systematische Desensibiliserung stellvertretendes operantes Konditionieren Rollenspiel coping models perfekte Modelle partizipierendes Modell-Lernen symbolisches ModellLernen I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 32 Nach Bandura lernt der Mensch nicht nur durch Auswertung von Verhaltenskonsequenzen, sondern auch durch Beobachtung (=Modelllernen) anderer, macht sich Erfahrungen, die andere gewonnen haben, zunutze. Modelle können auch nicht real oder Verhaltensabfolgen sein, z. B. Filme… Von was ist es abhängig, ob und wann ein Beobachter Verhalten anderer imitiert? 4 Prozesse bestimmen Umfang des Imitierens Aufmerksamkeit Erinnerung Wiedergabe Motivation 3.1 Stadien / Phasen des Beobachtungslernens Beim Beobachtungslernen findet zwischen dem Reiz (Einfluss des Modells auf den Beobachter) und der Reaktion eine Informationsverarbeitung statt. Dieser Verarbeitungsprozess wird nach Bandura (1969) in die A) Aneignungs-/ Lernphase (Akquisition), bestehend aus 1) Aufmerksamkeitsprozessen und 2) Gedächtnisprozessen und die B) Äußerungs-/Ausführungs-/ Verhaltensphase (Performanz), bestehend aus 3) motorischen Reproduktionsprozessen und 4) Verstärkungs- und Motivationsprozessen unterteilt. Je nachdem , wie diese Prozess verlaufen, wird nur die Kompetenz zu bestimmtem Verhalten erworben, die Nachbildungsleistung auf Verhaltensebene ausgeprägt oder es findet gar kein Lernprozess statt. Überblick über die Verarbeitungsprozesse des Modelllernens: Modellierte Ereignisse Aufmerksamkeitsprozesse Gedächtnisprozesse Motorische Reproduktionsprozesse Motivationsprozesse Modellierungsreize Differenziertheit Affektiver Wert, Komplexität, Funktioneller Wert Symbolische Kodierung Körperliche Fähigkeiten direkte Verstärkung Kognitive Organisation Verfügbarkeit der Teilreaktionen Stellvertretende Verstärkung Merkmale des Beobachters Sensorische Fähigkeiten, Niveau der Erregbarkeit, Motivation, Wahrnehmungs haltung Symbolische Wiederholung Selbstbeobachtung bei den Reproduktionen Motorische Wiederholung Feedback der Genauigkeit einer Handlungsausführung Kompetenz -erwerb Selbstverstärkung (Übereinstimmung mit perönlichen Wertsetzungen) Verhaltensaus -führung Nachbildungsleistung I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 33 1. Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit = Prozess, der aus dem gesamten Reizangebot der Umwelt eine Auswahl für die weitere Verarbeitung vornimmt. Selektion wird durch mehrere Faktoren bestimmt (Eigenschaften des Modells / wahrgenommene Relevanz des Verhaltens) Maximale Aufmerksamkeit, wenn das Modell kompetent, freundlich und mächtig ist. Beispiel: Lehrer: kompetent im Fachwissen, freundliche Beziehung zu Schülern, begeisterungsfähig (v. a. durch Augenkontakt, Gesten, Bewegungen…) 2. Gedächtnis (vgl. auch *5) Vor Nachahmung des beobachteten Verhaltens muss es ins Gedächtnis transferiert und dort gespeichert werden. ( In bildlicher und / oder sprachlicher Form) Um das erlernte Verhalten zu behalten ist Wiederholen erforderlich (auf Vorstellungsebene oder durch körperliche Nachahmung), Bewegungsabläufe sollten automatisiert werden. 3. Reproduktion In dieser Phase wird man durch Selbstbeobachtung oder objektive Rückmeldung (feedback) auf Fehler aufmerksam. Schule: Lehrer sollte in dieser Phase keine negativen Bewertungen vornehmen! (nur informative Rückmeldung!) In Schulalltag häufig keine korrekte Reproduktion, da Schüler ihre Aufmerksamkeit nicht auf alle Aspekte der Lehrerdemonstration richten 4. Motivation Ob ein beobachtetes Verhalten nachgeahmt wird, hängt von der Motivation des Lernenden in einer gegebenen sozialen Situation ab. 3 Formen der Verstärkung nach Bandura: Direkte Verstärkung Stellvertretende Verstärkung Selbstverstärkung Beobachter ahmt Verhalten nach und bekommt dafür direkten Verstärker (siehe oben) Beobachtung von Verhalten, das belohnt wurde Bereitschaft der Nachahmung steigt Beobachter verstärkt sich selbst. Ziel pädagogischer Einwirkung = Selbststeuerung des Lernenden I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 34 3.2 Wirkungen des Beobachtungslernens Experiment nach Bandura, Ross & Ross (1963): 4 Gruppen von Kindern, die beobachten • Wie eine Puppe real misshandelt wird • Das aggressive Verhalten einer Frau in Film • Eine aggressive Katze in einem Zeichentrickfilm • sah keine Aggression (= Kontrollgruppe) Ergebnis: Diese 3 Gruppen zeigten anschließend in einem Raum mit Spielsachen relativ gleich aggressives Verhalten Modelllernen Variation dieses Experiments (1965): 3 Gruppen beobachten, dass • auf aggressives Verhalten positive Konsequenzen folgen • aggressives Verhalten bestraft wird • aggressives Verhalten ohne Konsequenz bleibt Ergebnis: Erste Gruppe ahmt aggressives Modell häufiger und ausgepräger nach! Ergebnis: Beobachtungslernen, denn die gezeigten Handlungen können sich nicht vorher schon im Verhaltensrepertoire der Kinder befunden haben! Unterschiede Beobachtungslernen ↔ Verstärkungslernen (oper. Konditionieren) Es wird expliziter zwischen Lernen und Verhalten unterschieden: Lernen = Erwerb symbolischer Repräsentationen in sprachlicher oder bildlicher Form, die später als Leitlinien für Verhalten dienen können Es ist möglich, dass Lernprozesse stattfinden, die nicht direkt im Verhalten zum Ausdruck kommen. Beispiele: - Wenn bestimmter Anreiz geboten wurde, spielten auch Kinder der 2. und 3. Gruppe aggr. Verhalten nach! - In der Schule: Leistungen in Prüfungen müssen nicht unbedingt dem bisherigen Lernen entsprechen Es wird nicht nur aufgrund der Konsequenz eigenen Verhaltens, sondern auch durch stellvertretende Verstärkung gelernt (siehe oben Verstärkungsphase) Verstärkungen besitzen aus sozial-kognitiver Sicht andere Funktion als beim operanten Konditionieren: Sie informieren Beobachter über den Wert oder die Angemessenheit bestimmter Verhaltensweisen. Beispiel: - 1. Gruppe: Belohnung von Aggression Logischer Schluss: Solche Verhaltensweisen sind erwünscht 2. Gruppe: Bestrafung von Aggression Verhalten nicht erwünscht - Lob und Tadel vom Lehrer Schüler lernen durch Beobachten, was toleriert wird und was nicht Effekte des Modelllernens: - Erlernen neuen Verhaltens Hemmende / enthemmende Effekte Auslösende Effekte Nullwirkung Breite Palette des zu Erlernenden: Erlernen neuer Verhaltensweisen Veränderung von Hemmungsmechansimen Erregung von Emotionen I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 35 o Neuerwerb von Verhaltensweisen: (Modellierender Effekt) Modell führt Verhaltensweisen vor, die Beobachter noch nicht beherrscht, aber mehr oder minder identisch reproduziert (keine reine Imitation, sondern Prozess mit Kognitionen). Bsp: Motorische Fähigkeiten wie Autofahren, Werkzeuggebrauch, etc. sozial-kognitive Lerntheorie unterscheidet Modellieren Nachahmen Imitieren Durch Beobachtung wird meist keine exakte Kopie im Gedächtnis gespeichert, Modellieren geht über das Kopieren beobachteter Verhaltensweisen hinaus. Erwerben von allgemeinen Verhaltensstilen / Schemata Beispiel: Kind beobachtet aggressiven Erwachsenen Entwicklung eines Schemas (Allgemeine Vorstellung, welches die wesentlichen Merkmale der vorgeführten Aggressionen enthält) Beispiele für das Erlernen neuer Verhaltensweisen: Wichtige Funktion v. Modelllernen: Relevante Informationen mit Hilfe anderer gewinnen. Versuch der Nachahmung von spezifischen Verhaltensweisen (z. B. Austern-Essen Beobachtung anderer Information über Besteck, Bewährung gleichaltriger Vorbilder : „nicht mit Fremden mitgehen“…) Erlernen kognitiver Strategien: Modell kann genutzt werden, um bestimmte Vorgehensweisen bei der Lösung von Aufgaben zu demonstrieren. Beispiel: Kognitives Modellieren: Modell (Lehrer) gibt den Lernenden nicht nur Erklärungen, sondern verbalisiert zusätzlich seine Gedanken und nennt Gründe für seine eigene Vorgehensweise (Meichenbaum 1977) Selbstverbalisierung ist wichtig für Problemlösen (Lehrer spricht zu sich selbst…) o Hemmungseffekt: Reduktion der Häufigkeit früher erworbener Verhaltensweisen, abhängig von der Beobachtung aversiver Verhaltensfolgen einer Handlung (Bestrafung, etc). Bsp: Beobachtung der Bestrafung explorativen Verhaltens durch ungeduldige Mutter. o Enthemmungseffekt: Beim Beobachten werden vorher gehemmte Verhaltensweisen häufiger oder treten wieder auf, nachdem ein Modell beobachtet wurde, das vorher verbotene oder bedrohliche Handlungen ohne negative Folgen ausführt und/oder damit sogar Erfolg hat. Bsp: Dialekt in einer Umgebung sprechen, die diesen normalerweise negativ sanktioniert. o Auslöseeffekt: Modelle können Verhalten auslösen, das der Beobachter schon voll und ganz beherrscht. Bsp: Mitklatschen, wenn es andere tun (beim Konzert, etc.) o Nullwirkung: Verhaltensweisen, die ein Modell vorführt, sind bereits bekannt (keine Lernwirkung) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 36 3.3 Steuerung des eigenen Lernens Behavioristische Sichtweise: Verhalten des Schülers hängt ausschließlich von Bedingungen der Umwelt ab. Nach sozial-kognitiver Theorie: Person des Lernenden ist in Prozess eingebunden (Kontrolle muss ihm teilweise übertragen werden!) Selbstgesteuertes Lernen (nach Bandura, 1986) im Unterricht: o Mensch hat „selbstleitende“ Fähigkeit (Kontrolle über Gedanken, Gefühle & Handl.) o Schüler leistet aktiven Beitrag zur Erreichung der Lernziele o Selbststeuerung hängt vom Vertrauen in eigene Fähigkeiten ab Selbstwirksamkeitserwartungen (self-efficacy) betreffen die subjektive Einschätzung eines Menschen, über die zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabenart erforderlichen Vorraussetzungen (Fertigkeiten, Fähigkeiten,..) zu verfügen. Sozial-kognitives Modell selbstgesteuerten Lernens (nach Schunk, 1989): Überzeugungen des S • • Selbststeuernde Prozesse Selbstwirksamkeit Lernziele • • • Selbstbeobachtung Selbstbewertung Selbstreaktion Schüler wählen sich Lernziele aus, unterscheiden sich aber in der Einschätzung ihrer Selbstwirksamkeit (aufgabenspezifischer als Selbstkonzept / Selbstwertgefühl) Von der subjektiven Selbstwirksamkeit eines Menschen hängt es ab, o welchen besonderen Aufgabensituationen er sich zuwendet o welchen Anstrengungsgrad er einbringt o wie ausdauernd er sich bei Schwierigkeiten bemüht o wie gut es ihm geling, Angstgefühle zu kontrollieren wenn mehrere S gleiche Fähigkeiten besitzen, dann haben diese besseren Erfolg, die an die Bewältigung der Aufgabe glauben, während jene weniger leisten dürften, die an ihrem Erfolg subjektiv zweifeln (Bandura 1986) ERREICHUNG SELBSTGESTEUERTEN LERNENS: ⇒ Förderung von Selbstwirksamkeitserwartungen: Ob ein Mensch sich als wirksam erlebt, wird bestimmt, ob er meint, dass sich sein Potential nach erfolgreicher Lösung der Aufgabe verändert hat. Abhängig von: Bisheriger Erfolgsgeschichte (Erfahrungen mit ähnlichen Situationen), stellvertretenden Erfahrungen (Erfolg von Bezugspersonen), ermunterndem Zureden („Ich weiß, dass du es schaffen wirst“), physiologischem Erlebnisstand (Erregung bei Prüfungen) ⇒ Setzung von herausfordernden Zielen: Bestimmung von Lernzielen ist wichtige Aktivität bei selbstgesteuertem Lernen - Leistungsfördernd = leichte Überschätzung - Verbindlichkeit des Ziels ist wichtig - Ziele sollten nicht zu weit in der Zukunft liegen! ⇒ Kenntnis eigener Ergebnisse durch Selbstbeobachtung & -bewertung = wichtiger Bestandteil des selbstgesteuerten Lernens Kann Verhaltensänderung bewirken! ⇒ Bestimmung eigener Verhaltenskonsequenzen (z. B. Belohnung des eig. Verhaltens) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 37 3.4 Anwendungsbeispiele für Modelllernen Lehrer sind im Allgemeinen nicht wirklich als gute Modelle für Schüler zu sehen. Meistens findet sich Beobachtungslernen heutzutage o o o o unter Gleichaltrigen (Jugendliche) in Rollenspielen bei Prüfungsängstlichkeit durch Modelle in den Medien Beispiel: Lernen von Gewaltbereitschaft durch Medien Untersuchungen über Fernsehgewohnheiten und Aggressivität zeigen keine vollständig eindeutige Tendenz: „Während die Mehrzahl der Untersuchungen eine kausale Beziehung zwischen Gewalt im Fernsehen und aggressivem Verhalten nachweist, bleiben die – zahlenmäßig weit geringeren – Verfechter der Gegenposition bei ihrer Auffassung, dass keine Wirkungen nachgewiesen werden können.“(Television and Behavior (1982)) Verschiedene Thesen zur Wirkung medialer Gewalt: • Katharsisthese (= Reinigung, sich Befreien von Gewaltbereitschaft) • Inhibitionsthese(= Ausbleiben von Verstärkung, keine Reaktion auf gezeigtes Verhalten) • Stimulationsthese (= Anregung zur Gewalt) • Habitualisierungsthese (= es wird zur Gewohnheit, Gewöhnungseffekt) • Imitationsthese (= Nachmachen des gezeigten Verhaltens) • These der Wirkungslosigkeit Gewaltstimulation tritt unter anderem dann ein, wenn an Gewaltkonsum schrittweise herangeführt wird und das Anschauen von Gewaltfilmen subtil, z.B. durch Zustimmung in der Peergroup (= Gruppe von gleichaltrigen Kindern oder Jugendlichen), belohnt wird. Wenn keine solchen Vorbedingungen vorliegen, können Gewaltfilme auch Angst auslösen! Der Katharsiseffekt ist nicht wirklich nachweisbar. Die stellvertretende Verstärkung eines Modellverhaltens bezüglich Gewalt hat eine besondere und weitreichende Wirkung. Abbau des Aggressionsverhaltens der Schüler durch den Lehrer: • vorsichtig und wohlüberlegt bestimmte Fernsehsendungen empfehlen • Modell für nichtaggressives Verhalten abgeben • ehrliche Diskussionen im Unterricht, um Voraussetzung für Verarbeitung und Kontrolle von Aggression, Feindseligkeit, etc. zu schaffen • sozialem und emotionalen Klima, in dem der Schüler aufwächst, Aufmerksamkeit schenken I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 38 *4. Theorien des kognitiven Lernens 4.1. Wissenserwerb Im Mittelpunkt heutigen Interesses steht der Wissenserwerb (Aufbau von Wissen) und die Veränderung von Wissensstrukturen (fortlaufende Modifizierung) und nicht mehr so sehr das Verhalten. Überblick über die Wissensarten (nach Ryle, 1949 vgl. Ingrisch): ARTEN VON WISSEN DEKLARATIVES WISSEN PROZEDURALES WISSEN = Faktenwissen, Sachverhalte = Fertigkeiten, Handlungsweisen („Wissen, was...“) (Begriffe, Propositionen, Schemata) („Wissen, wie...“) (z.B. Lesen, Schreiben, Autofahren) Semantisches Wissen Psychomotorische Fertigkeiten (Radfahren) (Weltwissen) Episodisches Wissen (Wissen über Person) Kognitive Fertigkeiten (Lesen, Mathe) Wissenserwerb: Wissenserwerb: Netzwerktheorien (Wissen ist vernetzt) ACT–Theorie (Anderson, 1983) 1) Deklaratives Wissen 2) Wissenskompilierung 3) Wissensoptimierung Semantische Netzwerke Propositionale Netzwerke(Theorie von Anderson (1990)) „Automatisierung“ (z.B. Autofahren und Unterhalten) Elaboration (Verknüpfung von neuem mit altem Wissen) Darstellung von WENN–DANNProzeduren & Stufenmodell (Anderson) Lernstrategien Lernstrategien (Üben) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 39 Überblick Langzeitgedächtnis (nach Markowitsch, 1992): semantisch deklarativ episodisch LZG prozedural non-deklarativ Priming Konditionieren 4.1.1 Deklaratives Wissen Deklaratives Wissen = Faktenwissen + Wissen über komplexe Zusammenhänge („Wissen, was“) Gespeichert wird dieses Wissen in einem Teil des Langzeitgedächtnisses, und zwar dem deklarativen Gedächtnis, das unterteilt ist in o semantisches (= Wissen, des Menschen über die Welt haben ohne Erfahrungen) und o episodisches Gedächtnis (= Erinnerung an Ereignisse, persönlichen Erfahrung) Deklaratives Wissen ist das Wissen um Ereignisse und explizites Wissen von Informationen. Es bedarf bewusster Anstrengung um deklaratives Wissen abzurufen. 4.1.1.1 Speicherung und Repräsentation im Gedächtnis (Wissensstrukturen) Wissen wird nach seiner Bedeutung repräsentiert. Elementare Bausteine des Wissens und Denkens sind Begriffe, die miteinander vernetzt sind. Netzwerktheorien: o propositionale Vernetzung (Theorie von Anderson (1990)) o Schemata / Skripts o Semantische Vernetzung (nach Bedeutungsinhalt) - Größe der Speichereinheit: Begriff Proposition + Schema / Skript I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 40 BEGRIFFE: = Kategorie, in der sich Gegenstände, Vorstellungen und Ereignisse anordnen lassen, die gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen. • • • • Begriffe sind die elementaren Bausteine des Wissens und Denkens Überschaubare Einheiten, Ordnung Dewey (1933): Ein Begriff lässt sich am besten als eine Kategorie verstehen, die als ein kognitives Werkzeug in jeweils bestimmten alltäglichen Situationen verwendet werden kann. Man muss auch wissen, wie man es verwendet! Begriffe repräsentieren: Klassen von Objekten („Autos“), Aktivitäten („lesen“), Eigenschaften („groß“), Abstraktionen („Liebe“, „Wahrheit“), Beziehungen („klüger als“) Begriffslernen in der Schule: Schüler soll lernen, relevante Merkmale für z. B. ein Dreieck, ein Rechteck etc. zu erkennen ( Hypothesenprüfung) Empfohlen ist eine regelmäßige Wiederholung von Begriffen in möglichst vielen versch. Zusammenhängen Begriffsbildung: (nach Hoffmann) Hierarchische Struktur (Allgemeinere Begriffe umfassen spezifischere Begriffe): Pflanze Blume Tulpe Baum Rose Laubbaum Nadelbaum Kreuzklassifikation (Gleiches Objekt kann verschiedenen Begriffen zugeordnet sein) Herz Liebe Herzchirurgie Typikalität (Einige Objekte sind charakteristische Vertreter eines Begriffs) Hund Golden Retriever (z. B. auch: Rose typischere Blume als Crysantheme) Allgemeine Positionen zur Repräsentation & Speicherung von Begriffen: Mengenrepräsentation: Tiere Säugetiere Vögel Laufvögel Fische Schwimmvögel Pinguin Ente Sonstige I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 41 Prototypenansatz: (Rosch, 1978) (vgl. Typikalität) (Prototyp: - Bildet sich aus Menge von Beispielen heraus, entsteht aus Erfahrungen, ändert sich ständig) Vogel Amsel Pinguin Oder: Was ist eine typische Tasse, ein typischer Becher? Kritik an Prototypentheorie: Lässt situative Bedingungen unberücksichtigt (was ist in best. Umfeld typisch und was nicht?), bei abstrakten Begriffen (Gerechtigkeit) nicht anwendbar Merkmalsrepräsentation: Vogel fliegt Federn Pinguin Eier Schnabel Schnabel Eier Weiteres Beispiel: Junggeselle = ledig, erwachsen, männlich Theorien zur Repräsentation und Speicherung von Begriffen: Teachable Language Comprehender (TLC von Collins & Quillian, 1969): Hierarchisch organisiert, „IS A“- und „HAS A“-Beziehungen (Typikalitätseffekt fehlt!) Vogel hat Schnabel hat Flügel kann fliegen Huhn kann nur laufen HAS-Relationen: Ein Vogel hat Flügel. ISA-Relationen: Ein Huhn ist ein Vogel Aktivationsausbreitungsmodell (nach Collins & Loftus, 1975): (nicht hierarchisch, „IS A“- „NOT IS A“- und „HAS A“-Beziehungen) Haustier Nahrungsmittel Gans Huhn Eier legt fliegen kann Vogel Rotkehlchen ist ein frisst nistet Sperling Insekten Baum I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 42 PROPOSITION: = die kleinste Bedeutung, Sinn oder Eigenschaft zuweisende Informationseinheit, die ein Urteil darüber zulässt, ob eine Aussage richtig oder falsch ist. (Schunk, 1991). • • • • Grundlegende Bedeutungseinheit, aus denen sich Wissen strukturiert zusammensetzt Propositionen stellen Beziehungen zwischen Begriffen her Besteht aus mindestens 1 Argument (Begriff) und 1 Relation (Verb oder Adjektiv) Wörter/Sätze (vermitteln Konzepte) ≠Propositionen (repräsentieren Konzepte) Tom isst. = Argument = Relation kleinste als wahr oder falsch beurteilbare Einheit: Isst Tom gerade? – Ja / Nein. Bello = Argument gibt = Relation Susi = Argument den Knochen. = Argument Ermöglicht Reduktion von komplexen Informationen: Lincoln, Präsident der Vereinigten Staaten während eines bitteren Krieges, befreite die Sklaven. Lässt sich zerlegen in 3 Propositionen: Lincoln = Argument Lincoln = Argument befreite = Relation war = Relation Der Krieg = Argument die Sklaven. = Argument Präsident der Vereinigten Staaten = Argument war = Relation bitter = Argument (hier: Adjektiv) Speicherung von Propositionen: Nach Sachs (1967) wird die genaue Formulierung von Sätzen nur kurz nach Darbietung gespeichert, später nur noch die Bedeutung. Schule: Wiedergabe in veränderten Worten ist Anzeichen für den Grad der Verarbeitung! Nach Kintsch: Beste Leistungen der Wiedergabe bei Sätzen mit nur einer Proposition Propositionale Theorie (nach Anderson, 1990): Menschliches Gedächtnis besteht aus unzähligen Propositionen, die miteinander in Beziehung stehen, d.h. vernetzt sind. Problem: Mit Propositionen lassen sich keine größeren Wissenskomplexe speichern! I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 43 SCHEMATA: = „größere thematisch zusammenhängende Wissensbereiche, die als ein begrenzbarer Teil eines semantischen Netzwerks aufgefasst werden können, in dem typische Zusammenhänge eines Wirklichkeitsbereichs repräsentiert sind.“(Schermer) = allgemeines Wissen über ein Ereignis oder einen Gegenstand, das auf der Grundlage vorausgegangener Erfahrungen entstanden ist (Cohen, 1989) = abstrakte Struktur für eine Kategorie/Gruppe von Objekten oder Situationen Kognitive Psychologen sprechen von Schemata, wenn von geordneten Wissensstrukturen die Rede ist. • • • • • • • • • Größere Wissenseinheiten, die mehr als Begriffe oder Einzelinformationen umfassen ( zur Planung zukünftiger Handlung) Fassen thematisch zusammenhängende Informationen (z.B. Begriffe / Propositionen) zu begrifflichen Teilsystemen („gesonderte Wissensstruktur“) eines Netzwerks zusammen Reduzieren Komplexität der Umweltereignisse durch Bildung überschaubarer Einheiten (Unterscheide Schulschemata von Alltagsschemata), erlauben Schlussfolgerungen Erfahrungs- und kulturbedingt, kontextspezifisch (auch Gefühle enthalten!) Veränderung im Lauf des Lebens Schemata treten meist in Verbindung mit anderen Schemata auf sem. Netzwerk Default-Werte (Voreinstellungen) & slots (Leerstellen): Schema Auto Ε - default-Werte: 4 Räder, Motor, fährt, Kofferraum… - 1. Leerstelle: Motorart = Benzin, Diesel… - 2. Leerstelle: Farbe = blau, rot… - 3. Leerstelle: Typ = PKW, LKW… Nachteil: Schemata beeinflussen die Wahrnehmung: nur schema-konforme Reize werden wahrgenommen Zur Schemabildung vergleiche Begriffsbildung (Merkmals- & Prototypentheorie…) SKRIPT = Prototypische Struktur für eine Klasse von Ereignissen oder Abläufen (Ereignisschema) • • Reguläre Ereignisfolge in bestimmter Situation oder bestimmten Kontext Verschiedene Arten von Skripts: - situational (bestimmte soziale Situation wie z.B. Restaurantbesuch), - personal (Erwartungshaltung, z.B. wie Freundschaft abläuft), - instrumentell (gewisses Ziel, z.B. Schulweg nach Hause) Beispiel: Restaurant Der Gast setzt sich hin; der Kellner bringt die Karte Der Kellner serviert das Essen; der Gast isst Der Gast bestellt das Essen beim Kellner Der Gast bezahlt die Rechnung & gibt Trinkgeld I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 44 MENTALE MODELLE: ( Bildhafte Vorstellung) = umfassende, ganzheitliche Wissensstruktur mit verschiedenen Arten von Wissen mit unterschiedlichen Formaten (andere Modelle fließen mit ein). • • Nach Versuchen von Shepard (1967) werden Bilder (fast 100%) sehr viel besser wiedererkannt als Wörter (88%) oder Sätze (89%) Wörter werden verschlüsselt, Einzelheiten gehen verloren, Bilddarstellungen werden in bildhafter und sprachlicher Form kodiert ( höhere Wahrscheinlichkeit, sich an einen Code zu erinnern) Gespeicherte Bilder sind keine wirklichkeitsgetreuen Abbildungen wie Fotos, sie enthalten nur relevante Informationen (Form, Farbe, Anordnung…) Beispiel: zwei Möglichkeiten der Speicherung des Satzes „Das Buch ist auf dem Tisch“ ist auf R Buch R S S Buch A) bildhafte Vorstellung Tisch B) Propositionen SEMANTISCHES NETZWERK: Es wird nach Bedeutungsinhalt vernetzt. • • • Begriffe sind im semantischen (Weltwissen) Gedächtnis miteinander verbunden Wissensstrukturen Aktivierungsprozesse dienen zum Auffinden von begrifflichen Bezügen In einem semantischen Netzwerk gibt es: - kleinere Knoten: Propositionen, Skripts, mentale Modelle - größere Knoten: Schemata / Konzepte Beispiel: Netzwerkdarstellung einer Proposition: „Vitamin C bekämpft Erkältungen.“ Knoten = Proposition Vitamin C Arg. Arg. Erkältung Relation bekämpfen • • Knoten einer Netzwerkstruktur unterscheiden sich in Assoziationsstärke (je höher, desto häufiger erfolgreiche Verwendung der Wissenseinheit) und Aktivationsniveau (erfolgt entsprechende der Assoziationsstärke) Erregung geht von bestimmten Knoten aus und setzt sich entsprechend der Assoziationsstärke dieser Knoten fort I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 45 4.1.1.2 Aufnahme und Erwerb von deklarativem Wissen 1) ELABORATION: Verknüpfung neuer Wissensinhalte (Begriffe, Propositionen, Schemata, etc.) mit bereits bestehendem, d.h. im Gedächtnis repräsentiertem Wissen. Dadurch wird neuer Information mehr Sinn verliehen. Elaborative Prozesse: • Notwendige Elaboration: Vorwissen muss notwendigerweise aktiviert werden. (Ohne Vorwissen Verständnisschwierigkeiten). Beispiel: „Vitamin C fördert die Bildung weißer Blutkörperchen“ Lerner muss Infos, die darin enthalten sind, aktivieren (Was ist Vitamin C?) • Fakultative Elaboration: Anregung zu Gedanken / Assoziationen / Schlussfolgerungen, die nicht unbedingt zum Verstehen erforderlich sind, aber eine vielfältige Verknüpfung der Informationen mit der eigenen Wissensstruktur bewirken. Elaboration ist auch wichtig für das Behalten von Wissen über Sachverhalte. Enkodieren eines Sachverhaltes durch Zufügen vieler Propositionen zum Netzwerk bessere Erinnerung Rekonstruktion kann auf mehr Anhaltspunkte zurückgreifen (Anderson & Reder (1979)) 2) ORGANISATION: Eine gute Organisation ist vor allem beim Lernen größerer Informationen sehr wichtig. Organisationsprozesse: • Ordnen der Lerninhalte nach thematischen Kategorien (Clustering) Beispiel: Wortliste lernen in thematische Kategorien einordnen • • Reduktion der Lerninhalte auf das Wesentliche Überführen des Wissens in übliche Darstellungsformen Erwerb komplexer Texte/Vorträge: Aufbau von semantischen (Bedeutungsinhalt!) Makrostrukturen durch wiederholte Anwendung von Makrooperationen: Weglassen, Selektion, Generalisation, Konstruktion 3) SCHEMABILDUNG: Schemata wirken als Rahmen, welcher die Integration neuen Wissens in bereits bestehende Wissenselemente erleichtert. (Anpassung: Assimilation, Akkomodation) 4.1.1.3 Auswirkung des Vorwissens auf Informationsaufnahme & -verarbeitung Unterschiede im Vorwissen wirken sich auf die Aufnahme und die Verarbeitung von Informationen aus. (Examen Herbst 2005, A2) Empirische Befunde: Vorwissen bei der Informationsaufnahme: Ebbinghaus (1885) war der erste, der sich überhaupt mit dem Gedächtnis beschäftigt hat. • • • Hat alle Versuche an sich selbst ausprobiert Maß war bei ihm Ersparnisgrad: er lernte eine Liste völlig unsinniger Wörter und Sätze auswendig, bis er sie perfekt beherrschte und zählte die Durchgänge. Anschließend lernte er die Liste nach ein paar Tagen wieder. Falls er weniger Versuche benötigte Ersparnisgrad (hat also weniger Zeit gebraucht) Vorwissen führt zu Zeitersparnis bei der Informationsaufnahme I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 46 Vorwissen bei Informationsaufnahme und -verarbeitung: William Brewer & James Treyens (1981): • • Studenten in Arbeitszimmer, wurden gebeten dort 35 Sekunden Platz zu nehmen Neuer Raum und – völlig unerwartet – Erinnerungsaufgaben: alles aufschreiben, was sich in dem Arbeitszimmer befand ERGEBNIS: • • Studenten erinnerten sich an alles was typischerweise in einem Arbeitszimmer zu finden ist. Aber es waren auch untypische Objekte im Arbeitszimmer nur wenige Personen gaben an, diese gesehen zu haben. Aber: Studenten reproduzierten auch Gegenstände, die sie nicht gesehen hatten, z.B. Bücher ERKLÄRUNG: • • Studierende besaßen ein Schema darüber, wie typischerweise ein Arbeitszimmer auszusehen hat, das sie zur Reproduktion nutzten. Während der Erinnerungsphase erfolgt eine Aufarbeitung der gespeicherten Informationen. Sinnlos erscheinende Einzelheiten werden weggelassen, oder so verändert, dass sie verständlich erscheinen. Andere Einzelheiten wurden auch erfunden, um besser ins Schema zu passen. Jedes Schema enthält „freie Plätze“ oder „Öffnungen“, in die Besonderheiten einer vorliegenden Situation eingefügt werden können. Beispiel: Beim Schema Arbeitszimmer lässt sich einfügen, ob es dienstlich oder häuslich genutzt wird. Schemata ersparen es dem Lernenden für jede neue Reizgegebenheit einen gesonderten Speicherplatz zu reservieren erhebliche Unterstützung der Gedächtnisarbeit Vorwissen unterstützt zwar die Informationsaufnahme und –verarbeitung, beeinflusst aber die genaue Reproduktion der neu aufgenommenen Informationen (diese werden evtl. mit dem Vorwissen vermischt) Kognitive Psychologen (z.B. John Anderson (1990)): Theorie über Verbindung deklarativer Wissenseinheiten zu einem Netzwerk Deklaratives Wissen eines Menschen ist ein Netzwerk, das aus deklarativen Wissenseinheiten besteht. (siehe Mietzel S. 215ff, vor allem Grafik auf S. 216 + lesen!) Netzwerktheorie: Tatsache, dass im Lernprozess neue Informationen stets mit bereits vorhandenem Wissen verknüpft werden müssen. Je mehr Verknüpfungen der Lernende herstellt, desto schneller gelingt ihm später die Erinnerung. Vorwissen führt zu Zeitersparnis bei der Informationsreproduktion - Matthäus-Effekt: „Wer hat, dem wird gegeben“ Ellen Gagne mit Carol und Frank Yekovich (1993): Theorie über Erwerb neuer Propositionen Was passiert, wenn dem vorhandenen Netzwerk neue Informationen hinzugefügt werden sollen? Schritte des Lernprozesses: 1. 2. 3. 4. 5. Darstellung einer neuen Informationseinheit durch den Lehrer Lernende muss die Aussage des Lehrers zunächst in eine Proposition übersetzen Begriffe dieser Proposition aktivieren die Erinnerung an bereits gespeicherte Zusammenhänge mehrere bereits bekannte und eine neue Proposition sind im Arbeitsspeicher aktiv Ausgehend von den neuen Begriffen ( der bereits bekannten Propositionen) findet eine Aktivierungsausweitung statt, welche eine neue Proposition aktiviert Schlussfolgerndes Denken hat eine neue Proposition entstehen lassen. Sie ist als Ergebnis aufarbeitender Prozesse zustande gekommen Netzwerktheoretiker sprechen auch von einer erarbeiteten Proposition (elaborative Proposition nach Gagné 1993) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 47 4.1.2 Prozedurales Wissen Prozedurales Wissen = Wissen über Fertigkeiten, Operationen und Prozeduren („Wissen, wie“) Prozedurales Wissen • war schon beim primitiven Menschen vorhanden • wird in der Regel aus deklarativem Wissen gewonnen • wird durch Übung verbessert und automatisiert! (z.B. Sprechen, Fahrradfahren…) • ist ohne große Anstrengung abrufbar • ist oft schwieriger zu beschreiben als anzuwenden (z. B. Schuhebinden…) • kann auch nach Jahren (wenn gut geübt) wieder schnell erworben Unterscheidung: - Psychomotorische Fertigkeiten (Autofahren…) - Kognitive Fertigkeiten (Rechenaufgabe lösen…) Wie werden Fertigkeiten / prozedurales Wissen erworben? Die ACT-Theorie nach Anderson (1983): ACT: Adaptiv (Anpassung) Control of Thoughts Erklärung aller kognitiven Funktionen (Wahrnehmung, Sprache und Problemlösen) in einem einheitlichen Prozessmodell. Wissensstruktur für Fertigkeiten: Fertigkeiten lassen sich mit Hilfe von „Produktionssystemen“ beschreiben, die aus einer Reihe aufeinander bezogener Produktionsregeln bestehen. Eine Produktion besteht aus: Bedingungsteil/-komponente (WENN) (Eine oder mehrere Bedingungen) Aktionsteil (DANN) (ein oder mehrere Aktionen) Beispiele: - WENN Auto im ersten Gang und schneller als 20 km/h und es hat Schalthebel, Kupplung, etc. DANN drücke Kupplung, ziehe Schalhebel in zweiten Gang, etc. - WENN du Plural eines Wortes bilden willst, DANN füge ein „e“ an Umgekehrt ist dieser Handlungsablauf nicht unbedingt abrufbar!! Beispiel: Plural in Muttersprache gebildet Bedingungsteil (Bildung des Plurals?) oft nicht klar Unterscheidung von drei Gedächtnissystemen: (vgl. auch Punkt 5 - Gedächtnismodelle) 1) Deklaratives Gedächtnis: Speicherung von Wissen in Form von Netzwerken aus Propositionen (Wissen in abstrahierender Weise, also nach Sinngehalt) Reihenfolgen (Wissen über die Reihenfolge selbst, nicht voll ausformuliert) und räumlichen Bildern. 2) Prozedurales Gedächtnis: Hier sind Prozeduren (Fertigkeiten) als WENN–DANN–Verknüpfung (Produktion) gespeichert. Es finden sich auch unbewusste Selektionsmechanismen. 3) Arbeitsgedächtnis: (AG) Hier sind alle Informationen, die dem Bewusstsein im Moment zugänglich sind, aktiviert (z.B. Sinneseindrücke, die gerade enkodiert werden, etc.) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 48 Anwendung Deklaratives Gedächtnis Prozedurales Gedächtnis Speicherung Passung Abruf Ausführung Arbeitsgedächtnis Enkodierung Performance Prozess des Wissenserwerbs im deklarativen ↔ prozeduralen Gedächtnis Deklaratives Gedächtnis Lernvorgang Direkt und abrupt (kognitive Einheiten im Arbeitsgedächtnis werden zu Spuren in LZG) Abruf Auf vielfältige Weise möglich Prozedurales Gedächtnis Indirekt und über allmähliche Schwächung bzw. Stärkung neuer Prozeduren (z. B. Umlernen auf Schreibmaschine). Prozeduren können erst nach langem Üben erworben werden, es wird solange geübt, bis Fertigkeit automatisiert ist (z. B. Sprechen) Die Richtung ist hier vorgegeben: WENN DANN Wenn Information im Arbeitsgedächtnis dem Bedingungsteil (WENN) genügt, so wird Handlungswissen (Aktionsteil, DANN) abgerufen. Entscheidungsproblem, wenn Bedingungskomponente (WENN) erfüllt ist DANN? Mehrere mögliche Fertigkeiten Fünf verschiedene Prinzipien zur Entscheidung: 1) Spezialität: Diejenige von zwei konkurrierenden Prozeduren, deren Bedingungskomponente spezifischer ist, wird ausgewählt. 2) Grad der Passung: Es kommt eine Prozedur zur Anwendung, die eine größere Übereinstimmung mit dem bestehenden Sachverhalt besitzt. 3) Zieldominanz: Momentan verfolgtes Ziel stimmt mit Zielelement der Bedingungskomponente überein. 4) Datengebundenheit: Datenelement kann nicht gleichzeitig in zwei kognitive Muster eingepasst werden (vgl. funktionale Gebundenheit; z.B. Kerze – Streichholzschachtel – Reißnagel Wand/Streichhölzer und Schachtel) 5) Stärke der Prozedur: Jede erfolgte Anwendung führt zur Stärkung einer Prozedur, welche dann schwächeren Prozeduren vorgezogen wird. I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 49 Stufenmodell zum Fertigkeitserwerb nach Anderson (1983) Deklarative Stufe Deklarative Enkodierung von Informationen Wissenskompilierung Wissensoptimierung Überführung deklarativen Wissens in prozedurales Verbesserung der Fertigkeit Stufe 1: (Deklarative Stufe) Beschreibung der Prozedur Erlernen einer Fertigkeit beginnt auf kognitiver Stufe: Lerner erwirbt Wissen über den genauen Ablauf der Fertigkeit und deren Ausführung (= Produktionsregel). Regel ist dann als Wissen in deklarat. Form im Gedächtnis präsent. Beispiel: Autofahren: Wie legt man einen Gang ein? Stufe 2: (Wissenskompilierung) Ausbildung einer Prozedur für Fertigkeitsausführung Bei weiterer Übung wird eine spezielle Prozedur für die Fertigkeitsausführung ausgebildet, indem das deklarative Wissen (d.h. die Regel für die Fertigkeit, z.B. Position der Gänge) in eine prozedurale Form überführt wird (Vorgang der Wissenskompilierung). Man braucht sich die Regel nicht mehr ständig vergegenwärtigen (Entlastung des AG) Handlungsausführung wird immer flüssiger deklarat. Wissen bleibt verfügbar, aber prozed. Wissen bestimmt Handlungsausführung Beispiel: Lernen, Kupplung kommen mit Gas geben zu kombinieren, um ruckfrei anzufahren Stufe 3: (Wissensoptimierung) Automatisierung Automatisierung der Fertigkeit (Verfeinerung der Fertigkeitsausführung) schnellere und sichere Ausführung Hersagen der Regel verschwindet (keine kognitive Steuerung mehr! unbewusst Deklaratives Wissen tritt vollständig zurück (oft auch keine Verbalisierung mehr möglich!) Beispiel: Position der Gänge nur durch direkte Ausführung, unbewusstes Handeln Zusätzliche Vorgänge bei der Wissensoptimierung: • Generalisation = Erweiterung der Anwendungsbedingungen einer Produktion auf weitere Fälle (z.B. Kind: WENN Mantel mir gehört, DANN sage ich „mein Mantel“ WENN Ball mit gehört, DANN sage ich „mein Ball“ Generalisierung: WENN Objekt mir gehört, DANN sage ich „mein Objekt“) • Diskrimination: Anwendung von Produktionen wird durch Zusatzbedingungen spezifiziert und somit auf geeignete Umstände beschränkt! (Bsp. von oben: übermäßig allgemein, „Objekt“ an bestimmte Werte gebunden gesonderte Regel: WENN Objekt mir gehört und Objekt weiblich ist, DANN sage ich „meine Objekt“) • Verstärkung: Falsche Regeln werden eliminiert, erfolgreich angewandte bekräftigt! Besonderheiten beim Erlernen von Fertigkeiten: • „Reeminiszenseffekt“: Leistungssteigerung ohne Lernen! Ist man dabei eine Fertigkeit zu lernen, so beherrscht man diese nach einer Pause besser als vorher! (Irion, 1949) • Auch Fertigkeitserwerb ohne vorhergehendes deklaratives Regelwissen und ohne Erinnerung an die Lernepisode (z.B. Lautbildung bei Kleinkindern; Kontrolle des Muskelapparats, etc.) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 50 4.2. Problemlösen “Ein Individuum [steht] dann einem Problem gegenüber, wenn es sich in einem inneren oder äußeren Zustand befindet, den es aus irgendwelchen Gründen nicht für wünschenswert hält, aber im Moment nicht weiß, wie der unerwünschte Ausgangszustand in den wünschenswerten Zielzustand überführt werden kann.“ (Lukesch, 446) Rätsel: Morgens hat es 4 Beine, mittags 2 und in der Dämmerung 3 Beine. (Lösung: Mensch) Die 3 Kennzeichen einer Problemsituation: • unerwünschter Anfangszustand (= aktuelle (unbefriedigende) Situation) • erwünschter Endzustand (= angestrebte Situation/Ziel) • Barriere (verschlungene Wege, zulässige Operationen) Ausgangspunkt (= Ausgangszustand) Verschlungene Wege (=zulässige Operationen) Ziel (=Zielzustand) Zusammen definieren diese 3 Teile den Problemraum. Vorstellung der Lösung eines Problems wie die Suche nach dem richtigen Weg durch ein Labyrinth. (= der Problemraum) Unterscheide Probleme nach Klarheit der Ziele und Mittel: Bekanntheitsgrad der Mittel Klarheit der Zielkriterien hoch niedrig hoch Interpolationsbarriere niedrig Synthesebarriere (Ziel und Mittel klar; aber: richtige Kombination und zeitliche Abfolge fehlt; z.B. Schach) (Ziel nur vage bekannt, uneindeutig Mittel bekannt; z.B. Wohnung soll „schöner“ werden, was heißt „schöner“?) Dialektische Barriere Dialekt. & Synthesebarriere (Mittel nicht bekannt (herstellen), aber: Ziel klar; z.B. Blei in Gold verwandeln) (z.B. politische Entscheidung, komplexe Problemsituation in der Gesellschaft) Ein Problem unterscheidet sich von einer Aufgabe dadurch, dass für seine Bewältigung „etwas neues geschaffen werden muss“. Bei einer Aufgabe hingegen sind für die Bewältigung schon zielführende Methoden bekannt (Regeln, Wissen, etc.). Ob etwas ein Problem oder eine Aufgabe ist, hängt von der Vorerfahrung des jeweiligen Individuums ab! Möglichkeiten zum Problemlösen: Voraussetzungen: - Erfassung des Kerns eines Problems - Finden eines optimalen Ansatzes für die Bearbeitung eines Problems - Treffen guter Entscheidungen I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 51 Der Problemlöseprozess (allgemeines Modell) 1) Motivation, das Problem lösen zu wollen 2) Identifikation relevanter Elemente (Verständnis für Situation Skizzen…) 3) Produktion von Hypothesen (Entwicklung eines Plans) 4) Überprüfung von Hypothesen (mentales Probehandeln) 5) Bewertung von Hypothesen (v. a. bei multiplen Lösungen nötig) Arten des problemlösenden Denkens / Methoden: Man kann versuchen ein Problem zu lösen, durch: - Versuch und Irrtum: Thorndike: Katze im Käfig - Umstrukturieren und Erkennen von Ordnungsprinzipien:„Aha“–Erlebnis - Anwenden von Strategien: - Algorithmus (Schrittweises Verfahren, das bei best. Aufgabentypen immer zur richtigen Lösung führt eher bei wohldefinierten Problemen) - Heuristik (Daumenregel / kognitive Strategie, die bei komplizierten Schlussfolgerungsaufg. als Patentlösung verwendet wird schlecht def. Probleme) - - Kreativität: spontaner Einfall systematisches Denken: alle komplexen Bedingungsgefüge in Überlegungen mit einbeziehen Schlussfolgern: - Deduktives Schlussfolgern (Korrekte Anwendung logischen Schließens) - Induktives Schließen (nicht sichere Schlussfolgerung aufgrund von Erfahrung) Mittelzielanalyse: Maßnahmen, die den Abstand zwischen Situation und Ziel verkürzen sollen (Zerlegung in Unterprobleme / Fragen) Ver- / Behinderung von Problemlösen: - Problemraum sehr groß - Lösungen zu selten / über ganzen Raum verstreut - Funktionale Fixiertheit: Unfähigkeit, neuartige Verwendungsweise eines Objekts zu erkennen ( z. B. Wasserumfüllaufgaben: Behinderung aufgrund von Übung) - Situative Gebundenheit: Schwierigkeit, erfolgreiche Lösung auf neues Problem zu übertragen Förderung von Problemlösen im Unterricht: Allgemein: Problem und Struktur klar, deutlich, ohne Sonderfälle und Abschweifungen präsentieren Ausgangssituation und angestrebtes Ziel des Problems offen legen Konkret: - Förderung des Verstehens einer Problemsituation ist Voraussetzung - Schaffung von Problemsituationen in einem natürlichen Kontext: Situationen, mit denen sich Schüler in ihrem Leben wirklich auseinandersetzen müssen (Bsp: Zurechtfinden im Wald / fremder Stadt bei Klassenfahrten mit Karten-, Kompassgebr.) - Überprüfung des sprachlichen Verständnisses (z.B. Lerner muss Aufgaben sprachl. verstehen) - Konkretisierung von Textaufgaben (z.B. graphisch darstellen) - Darstellung vollständiger Beispiele: sämtliche Lösungsschritte bereits ausgearbeitet - Verbessern der Qualität von Verständnisfragen: Aktivierung des Vorwissens; sprachliche Instruktionen/ Fragen durch Lehrer - Schüler bei Materialanalyse, Zielanalyse unterstützen, (Lösungsstrategien) - An alltägliches Vorwissen und Interessen der Schüler anknüpfen - Automatisierungs- und Übungsphasen anschließen - Nur Anregungen, keine Lösung geben! I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 52 4.3 Transfer Transfer = Übertragung von gelerntem Wissen auf neue Lernsituationen. Definition nach Greeno et al. (1996): „Transfer ist der Prozess, durch den die Anwendung von Wissen auf neue Situationen erfolgt“ Transfer tritt dann auf, wenn Elemente einer Situation mit einer anderen Situation übereinstimmen. Transfer kann positiv oder negativ sein: Wird die Bewältigung der neuen Situation erleichtert, spricht man vom positiven Transfer. Hat das bereits Gelernte keinen Einfluss auf die neue Situation oder wird sie sogar erschwert, spricht man vom negativen Transfer. Beispiele: „2 + 3 kann ich.“ „20 + 30 kann ich.“ (positiv) „2 • 17 kann ich nicht.“ „2 • 7 kann ich nicht.“ (negativ) 4.3.1 Aspekte über Transfer Träges Wissen nach Whitehead (1929): Grundsätzliche Kenntnis, wie man Probleme lösen kann, aber keine Kenntnis, wie man Wissen spontan anwendet. kein Transfer (erst nach Anregung). Unter schulischen Bedingungen entsteht oft träges Wissen! Oft Schul-Schemata unabhängig von Alltags-Schemata VERMEIDEN! 3 Merkmale, die den Transfer bedingen (nach Marine & Generaux, 1995) o Lernender (bringt Wissen (deklarativ, prozedural) mit, Strategien, Verarbeitungskapazität des KZG, träges Wissen, Motivation, etc.) o Gestellte Aufgabe (tatsächliche, oder dem Anschein nach geringe Ähnlichkeit Schwierigkeit für Lernenden, bereits bekanntes zu entdecken) o Kontext (in den die Aufgaben eingebunden sind) Beispiel Taucher (Godden & Baddeley, 1975): 30 m unter Wasser Reihe von Wörtern lernen Erinnerung von mehr Wörtern unter Wasser als auf dem Festland Ähnlich: In der Schule Gelerntes auf außerschulische Situationen übertragen Schoenfeld: Schüler können Mathekenntnisse nicht auf außerschulischen Bereich übertragen Versagen der Lehrer! John Brown und Mitarbeiter (1989): Feststellung nach eingehender Analyse einschlägiger schulpädagogischen Theorien: „Viele Methoden der pädagogischen Didaktik gehen davon aus, dass sich Wissen und Tun voneinander trennen lassen. Man betrachtet Wissen, als sei es ein einheitliches, selbständiges Etwas, das theoretisch unabhängig von den Situationen ist, in welchen es erworben und angewandt wird. Das Hauptanliegen der Schulen scheint der Transfer dieses Etwas zu sein, das aus abstrakten und von jeglichem Kontext losgelösten formalen Begriffen besteht. Die Aktivitäten und der Kontext, in dem Lernen stattfindet, betrachtet man lediglich als dem Lernen dienlich – sicherlich als pädagogisch nützlich, aber grundsätzlich abtrennbar und sogar neutral in Hinblick darauf, was gelernt wird“. Schüler wird Wissen zugeschrieben, dass in bestimmten Situationen erworben wurde, sich aber vom Kontext gelöst hat und in anderen Situationen eingesetzt werden kann. ( ABER große Zweifel an dieser Theorie!) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 53 Thorndike betrachtet Elemente außerhalb des Individuums „Theorie der identischen Elemente“ (Thorndike & Woodworth, 1901) Transfer von Aufgabenmerkmalen abhängig (Ähnlichkeit entscheidend) später Korrektur dieser Ansicht: Nicht objektive Merkmal der Aufgaben, sondern Wahrnehmung der Ähnlichkeit durch den Lernenden entscheidend (Katona, 1940). Auch jüngere Psychologen heben Bedeutung des Kontexts für Transfer hervor (Collins et al., 1989, Rogoff, 1990) Wichtig bei Lerntransfer: Personale Aspekte wie emotionale Nähe und Lernmotivation Transfer findet ohne Unterstützung von außen nicht statt proximale Entwicklung Erhoffter Effekt (durch Lerntransfer): o Erhöhung der Leichtigkeit des Problemlösens o Reduktion des zeitlichen Aufwands Aber: erwarteter Transfer findet oft nicht statt (solide eingeübt kein Transfer) 4.3.2 Förderung von Transfer im Unterricht Intensives Üben von Grundfertigkeiten o Üben nicht zu früh abbrechen o Bilden von Routinen Beispiel: „Methode des wiederholten Lesens“ (Samuels, 1997; LaBerge & Samuels, 1974) Überlernen von Praktiken Spontaner, automatischer Transfer von hochgradig geübten Fertigkeiten ohne längeres Nachdenken (Salomon & Perkins, 1989) (z.B. wer gut Auto fährt, fährt auch neues Fahrzeug gut) Gelegenheit zur Anwendung auf neue Situationen geben - „Weniger ist oft mehr“ (Whitehead, 1929) - Einförmige Übungen schränken die Flexibilität des Denkens ein (Luchins, 1943) Beispiel: Wasserumfüllaufgabe funktionale Fixiertheit Systematisches Entkontextualisieren des Lernens Nach Singly & Anderson (1989): Notwendigkeit, das Wissen zu entkontextualisieren = Prozess, der es Lernendem gestattet, Verbindungen zu lösen, die zwischen bestimmtem Wissensinhalt und irrelevanten Aspekten der Situation bestehen Sinnvoller Kontext (Aber: Entkontextualisierung allein reicht nicht aus für Transfer „Gewusst, wann und wo“) Nach Phye (1990): Erinnerung fällt umso schwerer, je länger Bearbeitungszeit zurückliegt. Problemorientierter und anwendungsbezogener Unterricht - Theoretische Darstellungen müssen mit Anwendungsbezug aufgearbeitet werden, Lernender muss wissen, wann und wo Wissen anwendbar ist (Wiggins, 1993) - Veranstaltungsform von Michael (1993): Bezug zu authentischen Problemen herstellen - Auf problemorientierte Darstellung sollte Anwendungsphase folgen (Fallbesprechungen, Rollenspiele und Rückmeldung…) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 54 *5. Gedächtnis- und Wissenspsychologie Blütezeit Gedächtnispsychologie: 60er – 70er (Informationsverarbeitung beim Mensch ähnlich wie Computer) Orientierten sich entsprechend an einem passiven Menschenbild Unterschied zu radikalen Behavoristen: kognitive Prozesse im Menschen! Gedächtnis = Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, zu speichern (aufzubewahren) und bei Bedarf wieder abzurufen. Gedächtnis: • Gedächtnis ist kein passiver Informationsspeicher Behaltensleistung abhängig von der Aktivität des Lernens bei der Aneignung • höchste Aufnahmeschnelligkeit liegt im Schulalter • Die Qualität des Gedächtnisses und die Fähigkeit, sich zu erinnern, ist abhängig von: o o o o o o o o Anzahl der Wiederholungen Zeitabstand Konzentration Aufmerksamkeit Ermüdungsgrad äußeren und inneren Umständen Interesse am Lernstoff individuelle Einstellung zum Lernen. Unterscheide implizites ↔ explizites Gedächtnis: Implizites Gedächtnis Verfügbarkeit von Informationen durch Gedächtnisprozesse ohne bewusste Anstrengungen, die Informationen zu enkodieren oder wiederherzustellen. Explizites Gedächtnis Bewusste Anstrengungen zur Wiedergewinnung von Informationen durch Gedächtnisprozesse. Beispiel: Füchse sind nicht auf dem Küchentisch zu finden Beispiel: Welche Möbel fehlen in der Küche? In den meisten Fällen erfordert das Einspeichern oder Abrufen von Informationen eine Mischung aus implizitem und explizitem Gedächtnis 5.1 Gedächtnisprozesse Modellvorstellung: Menschliches Gedächtnis vergleichbar mit Bibliothek erwirbt Bücher (Informationen) Ziel: Bereitstellung (Speicherung) Ausleihe (Abruf) Information Enkodierung Speicherung Abruf bei Bedarf Um es einfach auszudrücken: Die Information kommt durch Enkodierung ins Gedächtnis hinein, durch Speicherung wird sie so lange aufbewahrt, bis man sie benötigt, und durch Abruf bekommt man sie wieder heraus. I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 55 Diese 3 mentale Prozesse sind nötig um Wissen zu einem späteren Zeitpunkt nutzen zu können, unabhängig von der Form des Gedächtnisses. 1. Enkodierung Der Prozess, der eine mentale Repräsentation im Gedächtnis aufbaut. Effekte bei der Enkodierung: - Enkodierspezifität (Abruf verbessert, wenn Hinweisreize bei Enkodierung mit denen bei Abruf übereinstimmen) - Serieller Positionseffekt (Anfang und Ende einer Liste werden bei Abruf besser erinnert) Primacy-Effekt = verbesserte Erinnerungsleistung für Items am Anfang einer Liste Recency-Effekt = verbesserte Erinnerungsleistung für Items am Ende einer Liste - Kontextuelle Unterscheidbarkeit (serieller Positionseffekt kann druch Kontext und Unterscheidbarkeit der abzurufenden Erfahrungen verändert werden) Beispiel: Forschung mit Trennung von langen Zahlen nach 2 / 4 Ziffern 2. Speicherung Das Behalten enkodierter Information über eine Zeitspanne hinweg. 3. Abruf („retrieval“) Wiedergewinnung gespeicherter Information zu einem späteren Zeitpunkt. Möglichkeiten beim Abruf: - Abruf = recall (Suche, bei der die Informationen reproduziert werden sollen) Beispiel: Identifizierung von Kriminellen möglichst genaue Beschreibung des Opfers - Wiedererkennen (Suche, bei der die Reize als zuvor gesehen beurteilt werden sollen) Beispiel: Opfer werden Karteikarten gezeigt Erkennen des Täters - Hinweisreize beim Abruf: (Intern oder extern generierte Reize, die Abruf erleichtern) Beispiele: extern: Frage bei einem Quiz, intern: bestimmte Zielsetzung haben Hinweisreize sind sowohl bei recall, als auch bei Wiedererkennen erforderlich. Die Leistung ist bei Wiedererkennen in der Regel höher als beim Abruf (Beispiel Multiple-Choice). Allgemein: Das Gedächtnis funktioniert am besten, wenn Enkodierungs- und Abrufprozesse gut zusammenpassen. Theorie der Verarbeitungstiefe (levels of processing, Craick & Lockhart, 1972): Bei größerer Tiefe ist Einprägung in Gedächtnis wahrscheinlicher. Oft muss man implizite Gedächtnisinhalte abrufen, die man explizit enkodiert hat. Implizite Inhalte sind stabil, wenn Enkodieren und Abruf sehr gut übereinstimmen (= transferadäquate Verarbeitung). Die 3 Gedächtnisprozesse vollziehen sich, so wird angenommen, in einem Gedächtnissystem Es gibt verschiedene Theorien über Aufbau des Gedächtnisses: I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 56 5.2 Gedächtnismodelle 5.2.1 Mehr-Speicher-Modell (Atkinson & Shiffrin (1968)) Siehe 5.2.2.3 (Zimbardo) Zwei Komponenten–Theorie des Gedächtnisses(= Mehrspeichermodell) • • Zentrum der Theorie: Unterschied zw. Kurzzeit (KZG)- und Langzeitgedächtnis (LZG) Theorie wird gestützt durch den seriellen Positionseffekt (siehe 5.2.3) Mechanismus: (siehe auch Abbildung) • Infos treffen auf menschliche Sinnesorgane bzw. Rezeptoren • dort werden sie verschlüsselt und ans Nervensystem übergeben, das sie ans Gehirn (Zentrale) weiterleitet • Sensorisches Register (UKZG) speichert diese für sehr kurze Zeit • kleine Auswahl an Infos (auf die Lernender Aufmerksamkeit richtet) wird dem KZG übergeben, andere Inhalte werden gelöscht • die für KZG gespeicherten Infos werden entweder sehr schnell wieder vergessen, oder weiterverarbeitet, bevor sie dem LZG übergeben werden • Inhalte des KZG werden mit Hilfe des prozeduralen Gedächtnisses weiterverarbeitet oder sprachlich weitergegeben • Infos, die das LZG erreicht haben, verbleiben auf unbestimmte Zeit in diesem Speicher • Lernender kann sie aus LZG abrufen und als Kopie ins KZG geben Informationen (in Form von physikalischer und chemischer Energie) treffen über die Außenwelt auf die menschlichen Sinnesorgane bzw. ihre Rezeptoren I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 57 Verschlüsselung Übergabe an das Nervensystem Weiterleitung and die „Zentrale“ (=Gehirn) Speicherung für sehr kurze Zeit durch das sensorische Register nur eine kleine Auswahl von Informationen, auf die der Lernende seine Aufmerksamkeit richtet, wird dem Kurzzeitgedächtnis übergeben, während die anderen Inhalte gelöscht werden. weiteren von den Rezeptoren stammenden Übermittlungen wird dadurch Platz gemacht. 5.2.2 Einspeichermodell (Craick & Lockhart (1972)) Kritik an obiger Zwei-Komponenten-Theorie (5.2.1) Theorie der Verarbeitungstiefe:(=Einspeichermodell) • bei größerer Tiefe der Informationsverarbeitung ist es wahrscheinlicher, dass die Infos im Gedächtnis eingeprägt sind • Ein Speicher, aber unterschiedliche Niveaus der Informationsverarbeitung • KZG = aktuell aktivierter Teil des LZG Drei Verarbeitungsebenen: • Strukturelle Ebene: visuell • Phonetische Ebene: akustisch • Semantische Ebene: semantisch (Bedeutung) Oberfläche Tiefe unterschiedliches Niveau der Verarbeitung Verarbeitung kontinuierlich von der oberflächlichen Analyse physikalischer Eigenschaften über die phonetische Analyse bis hin zur Interpretation des Bedeutungsgehalts eines bestimmten Items. Kritik an Einspeichermodell: • fehlende Überprüfbarkeit der Theorie • Widerspruch zu seriellem Positionseffekt KZG ist separater Speicher und nicht wie in dieser Theorie Teil vom LZG 5.2.3 Die ACT-Theorie nach Anderson [siehe 4.1.2 Prozedurales Wissen] 5.3 Gedächtnisarten Nach dem Mehrspeichermodell (5.2.1) besteht das menschliche Gedächtnis aus 3 Gedächtnisarten: Menschliches Gedächtnis: - Sensorisches Register - Kurzzeitzgedächtnis (KZG) - Langzeitgedächtnis (LZG) Im Folgenden werden diese 3 Gedächtnisarten genauer betrachtet. Zunächst ein Überblick: I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 58 Ultrakurzzeitgedächtnis (UKZG) (= Sensorisches Register) Kurzzeitgedächtnis (KZG) Langzeitgedächtnis (LZG) Kapazität sehr groß 7 ± 2 chunks (Ebbinghaus; Miller chunks: Chi, Chase & Simon) unbegrenzt Vorhaltezeit sehr kurz (< 1 sec) 30 sec oder solange maintenance rehearsal erfolgt (Peterson & Peterson) unbegrenzt (Zerfall = Findestörung, Verzerrung o.Ä.) Bewusstheit präattentiv bewusst deklarativ = bewusst, non-deklarativ = i.d. R. unbewusst Kodierungsform Annahme Sperlings: präkategorial, aber widerlegt akustisch-artikulatorisch (Conrad) weitgehend semantisch Funktion ermöglicht kontinuierliche Wahrnehmung trotz diskontinuierlicher Reizaufnahme Arbeitsgedächtnis Identifikation bekannter, Reproduktion gespeicherter und Produktion neuer Gedächtnisinhalte Aufbau ikonisches, echoisches, taktiles etc. Gedächtnis Verbindung mit anderen Speichern „Brücke“ zwischen Sinnesorganen und KZG Arbeitsgedächtnis (Baddeley & Hitch): central processor, phonologische Schleife (phonologischer Speicher & artikulatorischer Kontrollprozess) & bildhafträumlicher Notizblock Schaltstelle zwischen UKZG und LZG: Aufmerksamkeit nötig, um Reize vom UKZG zum KZG zu transportieren; Wiederholung nötig, um Inhalte ins LZG weiterzuleiten deklarativ: episodisches & semantisches Wissen; non-deklarativ: prozedurales Wissen; Priming; Habituation; Dispositionen Informationen werden bei Abruf zurück ins KZG geleitet empirische Befunde schulische Relevanz Sperling: Teilberichtsverfahren Ebbinghaus: recency-Effekt Miller: 7 ± 2 chunks (Chi; Chase & Simon: Schachexperten-Versuche) Conrad: akustisch-artikulatorische Kodierung Peterson & Peterson: Reproduktion von Trigrammen ( Baddeley & Hitch, 1974: Arbeitsgedächtnis) [ Craik & Lockhart, 1972: Levels of Processing] Ebbinghaus: primacy-Effekt Paivio: dual code theory Tulving: Modell der Kodierungsspezifität Anderson, 1983: active control of thought Aufmerksamkeit auf wichtige Inhalte ziehen Aktivierung des Vorwissens (chunks) bzw. Vorsicht vor kumulierten Defiziten ähnliche Leute im Fremdsprachenunterricht klar aussprechen & oft wiederholen Schüler nicht zu viele Dinge auf einmal tun lassen (z.B. schon reden, während Kinder noch schreiben) neue Inhalte oft wiederholen und üben; Eselsbrücken mit Kindern erstellen Gedächtnisstrategien und Metakognition direkt & indirekt vermitteln Lernstoff weitestgehend visualisieren (Paivio) abstrakte Begriffe möglichst vermeiden Prüfung an angestammtem Platz im Klassenzimmer durchführen (Tulving) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 59 5.3.1 Sensorisches Gedächtnis Sensorisches Register (Ultrakurzzeitgedächtnis) = die erste Instanz bei der Aufnahme von Reizen, es bewahrt eine genaue Repräsentation der physikalischen Eigenschaften sensorischer Reize für die Dauer von einigen Sekunden. Unterscheidung zwischen ikonischem und echoischem Gedächtnis im UKZG: ♦ Ikonisches Gedächtnis = sensorisches Gedächtnis im visuellen Bereich (Neisser, 1967) Möglichkeit der Speicherung sehr großer Informationsmengen für eine sehr kurze Zeit bleibt ca. ½ sec. Lang bestehen ermöglicht die Wahrnehmung von Bewegungen, obwohl vielleicht statt dessen mehrere aneinander gereihte Objekte gesehen werden, die unverbunden erscheinen. Alle dargebotenen Informationen müssen ins ikonische Gedächtnis gelangen Fazit: Der Extrablick auf die Welt der visuellen Eindrücke ist nur dann nützlich, wenn die Infos aus dem ikon. Gedächtnis schnell in einen beständigeren Speicher übermittelt werden. ♦ Echoisches Gedächtnis = sensorisches Gedächtnis in der auditiven Modalität speichert mehr Informationen als danach berichtet werden können (Erinnerung verblasst) Informationen bleiben etwa 5 – 10 sec länger bestehen als ikonische Hält Informationen solange fest, bis ein sehr kleiner Teil weiter verarbeitet wird Beispiel: Lesen von Sätzen: Wörter werden nicht einzeln ausgewählt, sondern nur „sinnvolle Einheiten“ werden ins KZG übertragen; Erlernen der richtigen Aussprache v. Fremdsprachen nur durch UKZG möglich Informationen werden leicht durch neue ersetzt, die sens. Erfahrung ähneln Wichtigste Eigenschaften des sensorischen Registers: Warum sind sensorische Erinnerungen kurzlebig und leicht ersetzbar? An Interaktion mit der Umwelt angepasst: ständig neue Erfahrungen mit visuellen und auditiven Stimuli, die verarbeitet werden müssen. In sensorisches Register treffen unzählige Informationen gleichzeitig ein gehen verloren, wenn sie nicht aufmerksam erfasst werden Muss man 2 Dingen auf einmal folgen (z. B. schreiben & zuhören), so liegt das Problem nicht in ikonischem / echoischen Gedächtnis, sondern in Verteilung der Aufmerksamkeit Damit „ultrakurz“-gespeicherte Infos wahrgenommen werden können, müssen sie mit Inhalten des LZG verglichen werden. Beispiel: orange Frucht Apfelsine, aber nur da im LZG Aussehen der Apfelsine genau gespeichert ist Was in das Kurzzeitgedächtnis übertragen wird, ist nicht die im sensorischen Gedächtnis gespeicherte Reizgegebenheit, sondern deren Interpretation! In der Schule: - Schüler müssen aufmerksam sein, um relevante Informationen aufzunehmen. Abwechslungsreicher motivierender Unterricht, Vermeidung von Monotonie! - Schüler muss lernen, irrelevante Informationen zu ignorieren Unterstützung durch Lehrer nötig - Junge Schüler brauchen ausreichend Zeit, um komplexe Informationen weiterzuverarbeiten - „Der Lehrer kann bis zu einem gewissen Grad feststellen, ob die Kinder in seiner Klasse aufmerksam sind“ (Grabe 1986) Innere Prozesse: Mimik, Gestik können täuschen - Begrenzte Verarbeitungskapazität Automatisierung grundlegender Prozesse Beispiel Leseschwäche: Keine Kapazität mehr, Gelesenes zu verstehen I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 60 5.3.2 Kurzzeitgedächtnis Kurzzeitgedächtnis = Gedächtnisprozesse, die kürzliche Erfahrungen aufrechterhalten und Informationen aus dem Langzeitgedächtnis abrufen. besitzt nur beschränkte Speicherkapazität G. Miller: Erwachsener kann etwa 7 ± 2 Informationseinheiten gleichzeitig präsent halten (3-jährige: nur 3 Ziffern, 7-jährige: 5 Ziffern, 11-jährige: wie Erwachsene) Speicherung etwa für 20 – 30 Sekunden speichert Informationen, nicht wiederholt werden, nur für kurze Dauer liefert erste Enkodierung für das explizite Einprägen von Erinnerungen speichert zeitweilig Informationen, die man bewusst und explizit erinnert Eingebauter Mechanismus, der kognitive Reserven auf eine kleine Zahl mentaler Repräsentationen konzentriert (Cowan, Shiffrin, 1993) reicht aus, um Informationen kurzfristig zu speichern (Bsp. Kopfrechnen) ist eine Art Zwischenstation für Informationen, die ins LZG und wieder hinaus kommen KZG funktioniert so effektiv, weil die Enkodierung von Informationen im KZG durch Rehearsal und Chunking verbessert werden und der Abruf aus dem KZG relativ schnell erfolgt! • Rehearsal = erhaltende Wiederholung [↔ aufarbeitende Wiederholung] Forschung bestätigt, dass ohne Rehearsal Gedächtnisinhalte im KZG verblassen. Peterson & Peterson: keine Gelegenheit zum Wiederholen Abruf im KZG mit zunehmender Zeit immer stärker beeinflusst. • Chunking = Prozess der Neuanordnung (Rekodierung) einzelner Gedächtnisitems Chunk = bedeutungstragende Informationseinheit (Anderson) Die Rekodierung kann durch Gruppierung auf der Basis von Ähnlichkeit (oder anderem Organisationsprinzip) erfolgen, aber auch durch Neukombination der Items zu größeren Mustern auf der Grundlage von Informationen im LZG. bedeutsamste Funktion des KZG: Verarbeitung von Informationen ( Arbeitsgedächtnis) Die Deutung des Kurzzeitgedächtnisses als Arbeitsgedächtnis sollte die Auffassung verstärken, dass das Kurzzeitgedächtnis kein Ort, sondern ein Prozess ist. Man kann das Arbeitsgedächtnis als eine kurzfristige, spezifische Fokussierung auf die benötigten Elemente verstehen ( koordiniert die notwendigen Aktivitäten) Arbeitsgedächtnis = eine Gedächtnisressource für Aufgaben wie Schlussfolgern und Sprachverstehen hilft, psychologische Gegenwart aufrechtzuerhalten setzt Kontext für neue Ereignisse verbindet getrennte Episoden zu zusammenhängender Geschichte ermöglicht, Repräsentationen in versch. Situationen aufrechtzuerhalten und zu aktualisieren ermöglicht, dem Verlauf eines Gesprächs zu folgen Daneman & Merikle (1996): Kapazität spiegelt sich in Arbeitsgedächtnisspanne wider I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 61 Arbeitsspeichermodell (nach Baddeley & Hitch, 1974) Überwindung von Schwachpunkten älterer Speichermodelle KZG nicht passiv, sondern aktiver Arbeisspeicher! 3 Module, die unabhängig voneinander arbeiten, aber parallel laufen können (z. B. gleichzeitig Matheaufgabe lösen und Items speichern, räumliche und verbale Aufgaben gleichzeitig): • Phonologische / artikulatorische Schleife: (innere Stimme) speichert & manipuliert sprachbasierte Informationen, zeitliche und serielle Organisation von Informationen Beispiel: Telefonnummern wiederholen, indem man sie im Kopf durchgeht • Visuell-räumlicher Notizblock: (inneres Auge) wacht über gespeicherte Informationen, hält visuelle und räumliche Informationen zum Abruf bereit Beispiel: Wie viele Tische sind in meinem Lieblingscafé mentales Bild vor Augen • Zentrale Exekutive: Kontrolle der Aufmerksamkeit und Koordination von Informationen aus der phonologischen Schleife und dem visuell-räumlichen Notizblock Beispiel: Immer wenn eine Aufgabe die Kombination mentaler Prozesse erfordert In der Schule: - Lehrer sollte Aufarbeitungsprozesse der Lernenden fördern, auf Wissen aufbauen! - Intensive Verarbeitung fördert Erinnerung Beispiele: Aufforderung des langsamen und sorgfältigen Lesens, mitgeteilte Inhalte mit eigenen Worten wiedergeben, Inhalte mit eigenen Erfahrungen in Beziehung bringen Selbstbezugseffekt 5.3.3 Langzeitgedächtnis Langzeitgedächtnis Bezeichnet Gedächtnisinhalte, die oft ein Leben lang überdauern. Gedächtnisprozesse zum Behalten von Informationen für den Abruf zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt. Das Langzeitgedächtnis ist der „Speicher“ für alle Erfahrungen, Informationen, Emotionen Fertigkeiten, Wörter, Begriffsklassen, Regeln und Urteile, die man sich aus dem sensorischen und dem Kurzzeitgedächtnis angeeignet hat. Das Langzeitgedächtnis macht das Gesamtwissen einer Person über die Welt und sich selbst aus. Zu Gedächtnisprozessen des Enkodierens und Abrufens siehe 5.1, zu deklarativem und prozeduralem Wissen siehe *4. [Einteilung des deklarativen Gedächtnisses in semantisch (eigene Erfahrungen) & episodisch (allgemeine kateg. Erinnerungen) nach Tulving (1972).] deklarativ semantisch LZG non-deklarativ episodisch u. A. prozedural I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 62 5.4 Vergessenstheorien Ein beachtlicher Teil von Gedächtnisinhalten wird im Verlauf der Zeit wieder vergessen. Was bedingt dieses Vergessen? Antwort: sog. Vergessenstheorien (jeweils aus verschiedenen theoretischen Ansätzen) Man muss zunächst sicherstellen, ob eine Information auch wirklich in das Kurzzeitgedächtnis zur weiteren Verarbeitung gelangt ist. THEORIE DES SPURENVERFALLS Vergleich des Vergessens mit Spuren, die ein Fußgänger im weichen Sand hinterlassen hat Verschwinden im Laufe der Zeit. • • Vorstellung im vorwissenschaftl. Denken: Zeit bewirkt etwas („Zeit heilt alle Wunden“) Wissenschaftl. Seite hält entgegen: Zeit kann nichts verursachen Beim Gedächtnis ist davon auszugehen, dass im Verlauf der Zeit Kräfte / Einflüsse wirksam werden können, die Wiedergabe zunehmend erschweren INTERFERENZTHEORIE Interferenz tritt auf, wenn die Hinweisreize nicht klar genug auf eine bestimmte Erinnerung verweisen. Je größer die Unsicherheit über die angemessen Reaktion auf eine Abrufhilfe ist, desto stärker wird die Erinnerungsleistung beeinträchtigt. Positiv gesagt: Informationen, die nicht durch neues Material gestört werden, werden am besten erinnert. Offenbar wirkt frühere Lernarbeit beeinträchtigend auf späteres Lernen Interferenz (Störung) = „proaktive Hemmung“ Proaktive Hemmung Erlernen von Liste 1 Erlernen von Liste 2 Gedächtnisverlust bei Wiedergabe der Liste 2 Beeinträchtigung kann auch in entgegengesetzter Richtung verlaufen retroaktive Hemmung Retroaktive Hemmung Erlernen von Liste 1 Erlernen von Liste 2 Gedächtnisverlust bei Wiedergabe der Liste 2 Verstärktes Auftreten von Interferenz, wenn sich neuere und frühere Lerninhalte hochgradig ähneln Beispiel: wiederholtes Lernen von sinnlosen Silben (Ebbinghaus) Interferenz tritt auch bei sinnvollem Material auf Interferenzen dürften beeinträchtigend auf das Behalten des S wirken I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 63 FEHLEN GEEIGNETER ABRUFREIZE Vergessen bzw. Beeinträchtigung des Behaltens bedeutet nicht gleichzeitig, dass die entsprechenden Gedächtnisinhalte ausgelöscht worden sind. Ashcraft (1989): Aus dem Langzeitgedächtnis geht nichts verloren, was diesem einmal übergeben worden ist Vergessen = Misslingen des Abrufs v. Inhalten aus diesem Speicher Vergleich mit Bibliothek: man findet Buch nicht, obwohl es da ist (steht thematisch falsch) Effekt des „auf der Zunge habens“ Förderung des Behaltens im Unterricht: Neue Informationen immer in Beziehung mit vorhandenem Wissen setzen! - Aufmerksamkeit der Schüler wichtig Inhalte gut geordnet darbieten Vorwissen integrieren, aktive Auseinandersetzung anregen Brown, Collins, Duguid (1989): Begriffe müssen wie Werkzeuge eingesetzt werden können, der Schüler muss die Erfahrung sammeln, dass man mit ihnen etwas anfangen kann I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 64 *6. Gedächtnis- und Lernhilfen, Lernstrategien Bedeutung von Lernstrategien: - Verbesserung von Aufnehmen, Verstehen, Behalten und Erinnern von Informationen - Lernstrategien als prozedurales Wissen zur Erreichung von Lernzielen - Lernstrategien als kognitive oder verhaltensbezogene Lernaktivität, die zu besseren Lernaktivitäten beitragen kann - Lernstrategien als „Plan für eine Handlungskonsequenz, die auf Erreichung eines Lehrzieles gerichtet ist“ (Klauer, 1996) 6.1 Unterscheidung von Lernstrategien Wild & Schiefele (1994) unterscheiden 3 Klassen von Lernstrategien: Lernstrategien • • • • Kognitive Lernstrategien Organisation Zusammenhänge – Elaboration Wiederholen Kritisches Prüfen • • • Metakognitive Lernstrategien Planung Selbstüberwachung Regulation Ressourcenbezogene Lernstrategien • • • Interne Ressourcen Anstrengung Aufmerksamkeit Zeitmanagement • • • Externe Ressourcen Lernumgebung Lernen m. Studienkollegen Literatur Kognitive Strategien (dienen der Infoaufnahme, Verarbeitung und Speicherung) • Organisation - Informationsreduzierende Vorgehensweisen - Auswahl von Informationsinnstiftende Gliederung - Gliederung anfertigen, Diagramm erstellen Beispiel: Giraffe, Otto, Kamel, Rettich,Oswald, Melone Merke einfacher: Giraffe, Kamel, Otto, Oswald, Rettich, Melone) • Elaboration - Herausarbeitung von Sinnstrukturen in zu lernender Information - Anreicherung der Information durch Herstellung von Assoziationen - Konstruktion (Stoff mit eigenen Worten wiedergeben) - Integration (Stoff mit gespeichertem Wissen vernetzen) - Transfer (Übertragung auf andere Kontexte) • Wiederholen - Gelerntes im Arbeitsspeicher behalten - Unterstützung des Übergang ins LZG • Kritisches Prüfen I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens Metakognitive Strategien (Selbstregulierende Vorgehensw., Kontrolle des Lernprozesses) • Planung: - Setzen von Lernzielen • (Selbst)Überwachung: - Kontrollfragen - Überprüfung, ob Gelesenes verstanden wurde • Regulation: - Anpassung des eigenen Lernens an Anforderungen Beispiel: langsameres Lesen bei schwierigeren Texten Ressourcenbezogene Strategien (Stützstrategien) • Interne Ressourcen (unterstützen eigentl. Lernen; schirmen von störenden Einflüssen ab) - Motivationale Maßnahmen Selbstmotivation - Kontrolle von Aufmerksamkeit und Anstrengung - Sinnvolle Zeitplanung • Externe Ressourcen - Optimale Nutzung institutioneller Ressourcen (z. B. Bibliothek) - Soziale Ressourcen (z. B. Arbeitsgruppe, Lerngruppe, Tutorien) - Gestaltung einer geeigneten Lernumgebung 6.2 Verschiedene kognitive Lernstrategien [Metakognition = Kognition über Kognition. Nach Flavell (1979): Spezieller Teil des Weltwissens eines Menschen, der sich auf seine Kognitionen und Anwendung des Wissens bezieht.] Zum Einprägen von Informationen können Mnemotechniken eine große Hilfe darstellen. Mnemotechniken (mneme = gr. Gedächtnis, Erinnerung) = alle Verfahren, mit deren Hilfe Information verarbeitet und organisiert wird, um später wieder leichter verfügbar zu sein. (= mögliche Inhalte des Metagedächtnisses, d. h. schematisierte Rekonstruktionspläne, aus denen die tatsächlich verwendeten Rekonstruktionspläne formuliert werden können). Vor allem hilfreich, wenn zu lernendes Material nicht sinnvoll erscheint, und man es in bestimmter Reihenfolge wiedergeben muss Nach Untersuchungen von Atkinson (1975) ist die Anwendung von Mnemotechniken in der Schule und in der Uni sinnvoll. Vgl. Loci-Methode, Schlüsselwort-Methode, Akronyme, Akrostichone, Kontextmethode BILDORIENTIERTE STRATEGIEN: Loci-Methode (mnemonische Technik): Verschiedene Gedächtnisinhalte werden mit bildhaften Vorstellungen verbunden. kann man anwenden, wenn Material nicht sinnvoll erscheint oder man es in einer bestimmten (willkürlich erscheinenden) Reihenfolge wiedergeben muss Beispiel: Einkaufsliste „Routen-Legen“: Vorgehensweise nach Adams (1976) Wirksamkeit beruht auf 2 Prinzipien: - Erzwingen von Organisation einer unorganisierten Liste - Herstellung von Verbindungen zwischen Orten und Items 65 I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 66 Bildhafte Vorstellungen: [siehe auch mentale Modelle, 4.1.1.1] Informationen werden in bildhafter und / oder sprachlicher Weise gespeichert. Bilder sind leichter zu erinnern (Kodierung in bildhafter + sprachlicher Form erhöht Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens ein Code erinnert wird), bildhaft Vorstellungen sind aber nicht wie Fotos (nur Merkmale gespeichert) SPRACHORIENTIERTE STRATEGIEN: Schlüsselwort-Methode: (Atkinson(1975)): Wort der eigenen Sprache (Schlüsselwort) finden, das gewisse Klangähnlichkeit mit dem zu merkenden Wort (aus Fremdsprache) hat. aus den beiden Worten ein Bild formen vor allem beim Vokabellernen einsetzbar: Reproduktion mit Bild Beispiel: window – Wind „Der Wind pfeift durch das Fenster“, Tower Am Turm hängt ein Tau Problem: Assoziationen werden zu etwas Falschem gebildet! Rhythmus und Reim: Reim aus den zu merkenden Zusammenhängen oder Wörtern bilden. gut für einfache Merkaufgaben Äußere Strukturen erleichtern die Rekonstruktion Bildung von Eselsbrücken! Beispiele: „Sieben, fünf, drei – Rom schlüpft aus dem Ei“, „Trenne nie st – denn es tut den beiden weh“ Merkwörter / Akronyme: Aus Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebildetes Merkwort Beispiele: EDEKA : Anfangsbuchstaben der fettlöslichen Vitamine; (für Mathematiker ;-) : ANIKANIK) Akrostichone: Merksätze, bei denen der Anfangsbuchstabe jedes Wortes den zu merkenden Inhalt bezeichnet. Beispiele: Dur-Tonarten: Geh Du Alter Esel Hole Fische, Reihenfolge der Planeten: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten Narrative Verknüpfung / Kontextmethode: Zu lernende Wörter in Geschichten einkleiden Verknüpfung Reihenfolge der Infos wird beibehalten Beispiele: Festlegung des Tagesplans, Einkaufsliste ORGANISATIONSPROZESSE / ORGANISATORISCHE STRATEGIEN: Hierarchisches Zusammenfassen, Rekonstruktion durch Lerner: Gliederung des Stoffes, Kategorien bilden, Struktur in Fülle von Informationen bringen. Beispiele: Text in Unterabschnitte gliedern, Überschriften bilden, immer wieder zusammenfassen Vorwegnahme zentraler Aussagen durch vorausgehende Übersicht Erstellung von Übersichten und Mind-Maps, die zentrale Aussagen enthalten. Nach Hartley & Davies (1976) führen vorausgehender Übersichten (Zusammenfassungen der nachfolgenden Lerneinheit in Prosaform, Fotos, Bilder…) in neues Material ein und machen mit der zentralen Aussage vertraut sehr wirkungsvoll! I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens 67 MEHRSCHICHTIGE LERNSTRATEGIEN: Schüler bringt das Gelernte hervor Selbstrezitationstechnik: Fragen an sich selbst stellen, Inhalte für sich selbst laut zusammenfassen Beispiele: Bei Lernen von Texten, Definitionen, Vokabeln, Rechtschreibung, etc. SQ3 – Methode: (nach Robinson (1961)) Überblick verschaffen, Fragen an den Stoff stellen, Lesen, Wiedergabe des Gelesenen, Rückschau (etwas vergessen?). zur Bewältigung umfangreicher, semantisch bedeutungsvoller Texte Gezieltes Unterstreichen, Markieren von Textteilen: Überblick, Absatz kurz lesen, unterstreichen, Wiederholung, Einprägen des Unterstrichenen. zentrale Aussagen herausschreiben, Unwichtiges weglassen Erstellen eigener Texte Anfertigen von Notizen Graphische Methode: Anfertigen von Mind Maps. Wissen wird in Form von Begriffen und Reaktionen zwischen Begriffen abgebildet. Begriffe als Knoten, Relationen als Pfeile. Reduktion: nur wesentliche Infos herausarbeiten (Aufbau einer Makrostruktur) Systematische Zusammenfassen verbaler Infos und graphische Darstellung der Info in einer Art Landkarte (MAP) Organisation des Wissens in semantischen Netzwerken =sehr effizient, wegen Visualisierung, aktiver Auseinandersetzung mit Informationen, Reduktion der Komplexität des Inhalts auf wesentliche Aspekte, Verbesserung der Rückmeldung über eigenes Wissen (vollständig? Anregung metakognitiver Prozesse) und der Verknüpfung der Begriffe. Vorangestellte Einordnungshilfen: Darstellung des Kontextes, in den sich das Lernmaterial einordnen lässt. Nach Mayer (1979, 1984) aktiviert eine gute Einordnungshilfe geeignete Schemata, die dem Lernenden helfen, neue Informationen zu assimilieren. (Analogien!) Beispiel nach Eggen: Ohmsches Gesetz lässt sich mit Jungen vergleichen, der eine Karre über schlammige Straße ziehen muss. 6.3 Förderung im Unterricht FÖRDERUNG ELABORATIVER PROZESSE: um verbale Infos zu verstehen, neue Infos in bestehende Wissensstruktur zu integrieren, das Behalten zu verbessern Förderung der Elaboration durch: - Erzeugung kognitiver Konflikte: Nach Berlyness (1960): Widersprüchliche Infos Neugierde Informationssuche (bis jetzt nur bei kleinen Kindern bestätigt) I. Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens - 68 Verwendung von Beispielen: Verdeutlichung der Sachverhalte ( Verknüpfung neues – altes Wissen), Einbettung in vernetzte Wissenstrukturen - Fragestellung / Lehrerfrage: Anregung tieferer Verständnisprozesse, aber: nur wenig Infovermittlung, emotionale Beeinträchtigung durch Nicht-Wissen, Kommunikation nur mit guten Schülern FÖRDERUNG ORGANISIERENDER PROZESSE: um große Informationsmengen zu reduzieren und zu strukturieren Nach Piaget: Ob es Menschen gelingt, ihr eigenes Wissen zu konstruieren, hängt davon ab, ob vorliegende Information ihnen sinnvoll erscheinen. Geordnete Darbietung stellt dabei nur eine – wenn auch bedeutsame – Voraussetzung für sinnvolles Lernen dar. Förderung von Organisation durch - Mapping-Techniken (siehe Mind-Maps, organisierende Strategien) - Textgestaltung: Ziel: durch zeitlich aufeinanderfolgende Informationen beim Lesen zusammenhängende Wissensstrukturen aufbauen. Nach Schnatz (1987): Textorganisation wirkt sich auf Verarbeitung beim Lerner aus, aber bei jedem Individuum unterschiedlich! Optimale Textgestaltung? PROBLEM bei der Förderung des Wissenserwerbs im Unterricht: Es gibt verschiedene Lerntypen Es gibt keinen für alle Lerner optimal organisierten Text bzw. gut aufgebauten Unterricht! 6.4 Gute und schlechte Strategienutzer Erfolgreiche Lerner nutzen zahlreiche, sowohl spezifische als auch generelle Lernstrategien aus, die sie flexibel und reflexiv einsetzen können. Gute Strategienutzer (nach Pressley, 1986) Überzeugung der Kontrollierbarkeit der Lernvorgangs Wertschätzung system. Vorgehens und Überzeugung vom Nutzen von Lernstrategien Gerichtetheit der motivationalen Dynamik (inhaltlich) Bewusste Kontrolle der Aufrechterhaltung der Motivation (bei schwacher Intention) Schlechte Strategienutzer Inaktive Lerner Produktions- und Anwendungsdefizit Überwachen ihr Lernen seltener, Bemerken deshalb Fehler seltener Vermeiden Anstrengung, auf Strategien zurückzugreifen Kennen weniger Strategien, die ihnen in Problemfällen weiterhelfen könnten Lehrer sollte Schüler auf Vorteile von Lernstrategien aufmerksam machen, bei konkreten Aufgaben darauf hinweisen!