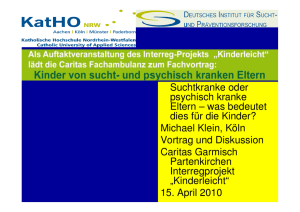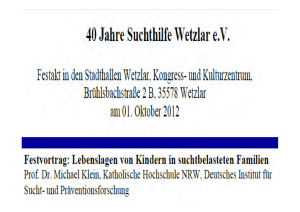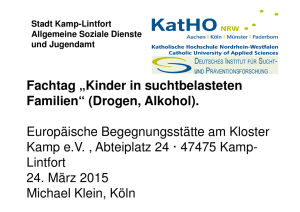Elterliche Komorbidität - Prof. Dr. Michael Klein
Werbung

Sucht, Gewalt und Familie – Zusammenhänge, Risiken, Konsequenzen Vortrag zur DO-Jahrestagung am 22. April 2015 in Düsseldorf Michael Klein, Köln Sucht, Gewalt und Familie – Zusammenhänge, Risiken, Konsequenzen (1) Einführung, Problemlage Kindeswohl als Leitmotiv („child protection and mental health mainstreaming“; „health in all policies“) Das Kindeswohl muss als prioritäres Leitmotiv in allen gesundheits- und sozialbezogenen Hilfebereichen verankert und umgesetzt werden. Dies betrifft Kinder- und Jugendhilfe ebenso wie Schule, Prävention, Psychiatrie, Psychotherapie und Suchthilfe. Ohne Kindeswohl langfristig keine gelingende Entwicklung und keine Reduktion der Zahl psychischer Störungen. Suchtstörungen spielen dabei eine zentrale Rolle, da süchtiges Verhalten meist zur Selbstmedikation von frühen Verhaltens- und Erlebensstörungen eingesetzt wird. Vorbemerkung: Suchtstörungen gehören zu den wichtigsten und häufigsten psychischen Störungen – Die Frage nach ihren Auswirkungen auf die Familie sollte Regel und nicht Ausnahme sein. Klassifikation von Gewaltformen sexuell psychisch, verbal physisch autoaggressiv strukturell 6 Welche Substanzen? Als besonders riskant für die Ausübung gewalttätigen Verhaltens können die folgenden Substanzen angesehen werden: Alkohol Kokain Amphetamine Opiate ggf. Halluzinogene 7 Welche Effekte? Akute, chronische und komorbide Effekte Neben den Effekten akuter Intoxikation auf das Sozial- und Interaktionsverhalten sind – besonders bei Suchterkrankungen – die chronischen Effekte (zB Entzugs“stimmungen“) sowie die komorbiden Effekte (zB Persönlichkeitsveränderungen, neuropsychologischer Abbau, prämorbide Störungen) zu beachten. 8 Kindesmisshandlung (WHO, 2006) USA: 35% der Täter(innen) hatten zum Tatzeitpunkt Alkohol oder Drogen konsumiert. Deutschland: 32% der Täter(inne) tödlicher Kindesmisshandlungen waren zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. 37% waren alkoholabhängig. Kanada: Alkohol- und Drogenkonsum wurde in 34% aller Fälle von „child welfare investigation“ berichtet. London: Elterlicher Substanzmissbrauch wurde in 52% aller Fälle von Familien des „child protection register“ berichtet, wobei Alkohol am häufigsten als Substanz benannt wurde. 1: http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/en/index.html 9 Partnergewalt (WHO, 2006) USA: Opfer berichten von Alkoholisierung des Täters in 55% aller Fälle. England/Wales: Opfer berichten von Alkoholisierung des Täters in 32% aller Fälle. Australien: In 36% aller Fälle von Todschlag der Partnerin stand der Täter unter Alkoholeinfluss. Deutschland: 55% aller Fälle von Gewalt gegen Frauen werden vom Täter unter Alkoholeinfluss begangen. 1: http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/en/index.html 10 12. Mai 2015 Epidemiologie von Suchtstörungen 11 Direkte und indirekte Effekte können Kinder Suchtkranker betreffen Direkte (substanzbezogene) Indirekte Effekte: Effekte: • Behinderungen und Retardierung durch FAS(D) •Neonatales Abstinenzsyndrom •Retardierung durch andere Substanzwirkung (z.B. Tabakrauchen) •Schädigung durch Alkoholvergiftungen in Kindheit und Jugend •Familiale Gewalt • Unfälle, Verletzungen • Broken home • Vernachlässiguung, Misshandlung, Missbrauch • Soziale Isolation, sozialer Abstieg • Familiale Disharmonie • Partnerprobleme • Negative Familienatmosphäre • Zahlreiche negative (kritische) Lebensereignisse • Leistungsprobleme in der Schule Sucht, Gewalt und Familie – Zusammenhänge, Risiken, Konsequenzen (2) Auswirkungen elterlichen Substanzkonsums auf exponierte Kinder: Stress, Volatilität, Rollenfixierungen, Coping(versuche), Entwicklungspsychopathologie Was einem Kind eines drogenabhängigen Elternteils passieren kann? (1) Direkte Folgen des elterlichen Drogenkonsums: Drogennotfall eines Elternteils, Unfälle/Vergiftungen des Kindes (2) Indirekte Folgen des Drogenkonsums auf das elterliche Verhalten: Suizidalität, Sedierung, Unberechenbarkeit, Unzuverlässigkeit, Unerreichbarkeit, Kindesvernachlässigung etc. (3) Folgen für die Familie: Verarmung, Marginalisierung, Stigmatisierung Kindliche Wahrnehmung und Verarbeitung des elterlichen Suchtverhaltens ist der Schlüssel zur psychischen Gesundheit der Kinder Historische Darstellung: Alkohol und Gewalt in der Familie, ca. 1880 Claudia Black, Sharon Wegscheider, Janet Woititz, ab ca. 1969 Elterliche Verhaltensstressoren für die (psychische) Gesundheit von Kindern in Familien: Risikotrias Psychische Krankheiten Suchtstörungen Gewaltverhalten (vgl. Cleaver et al., 1999) Risikoverstärker Lange und intensive Exposition des Kindes (Quantität, Qualität) Beide Elternteile betroffen > Mutter > Vater Einzelkind (?) Frühe > mittlere > späte Kindheit Alleinerziehendes Elternteil Hohe Zahl negativer Lebensereignisse im Krankheitsverlauf (Unfälle, Verletzungen, Suizidversuche, Inhaftierungen) Was beeinflusst das Transmissionsrisiko (erhöhend, abschwächend)? (1) Dauer und Intensität der Exposition (2) Schwere der elterlichen psychischen Störung und Komorbidität (3) Genetisches Risiko (Vulnerabilität) (4) Alter des Kindes (5) Stressbewältigungskompetenzen/Resilienzen (6) Kranke/gesunde Modellpersonen (vor allem Verwandte) im Umfeld (7) Intermittierende Lebensereignisse (z.B. Traumatisierung) (8) Mangel an elterlicher Kompetenz (z.B. Einfühlsamkeit, Wärme, sichere Bindung) Frequency of alcohol problems in parents (N = 2.427; Lifetime, %w; source: EDSP-study; Lieb et al., 2006) Either parent Both parents 22,5 3,1 One parent 19,5 Father only Mother only 0,0 15,0 4,4 10,0 20,0 Ausgangslage und Fakten In Deutschland leben: 2.65 Millionen Kinder, bei denen ein Elternteil eine alkoholbezogene Störung (Missbrauch oder Abhängigkeit) aufweist (Lachner & Wittchen, 1997; Klein, 2005) ca. 40.000 Kinder mit einem drogenabhängigen Elternteil d.h.: es geht insgesamt nicht um eine gesellschaftliche kleine Randgruppe, sondern um eine substantielle Gruppe von Kindern, die ein deutlich erhöhtes negatives Entwicklungsrisiko aufweisen. Die gesunde Entwicklung von Kindern suchtkranker Eltern ist ein prioritäres PublicHealth-Thema. Prävalenzen Jedes 7. Kind lebt zeitweise (jedes 12. dauerhaft) in einer Familie mit einem Elternteil, der eine alkoholbezogene Störung (Abhängigkeit oder Missbrauch) aufweist (Deutschland; Lachner & Wittchen, 1997) Jedes 3. Kind in einer alkoholbelasteten Familie erfährt regelmäßig physische Gewalt (als Opfer und/oder Zeuge) [Klein & Zobel, 2001] Suchtkranke Familien weisen gehäuft eine „family density“ für Sucht- und andere psychische Störungen auf Prävalenzen Von den Kindern alkoholabhängiger Eltern entwickeln ca. 33% bis 40% selbst eine substanzbezogene Abhängigkeitserkrankung (Sher, 1991; Windle & Searles, 1990; Klein, 2005; Zobel, 2006) Ein Drittel (teilweise überlappend mit dem erstgenannten Drittel) zeigt psychische Störungen (z.B. Ängste, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen) Relative Wahrscheinlichkeiten (OR) für Alkoholabhängigkeit bei Töchtern und Söhnen von Eltern mit Alkoholstörungen Elterliche Probleme mit Alkohol Männliche Probanden odds-ratio (OR) für Alkoholabhängigkeit Weibliche Probanden odds-ratio (OR) für Alkoholabhängigkeit Nur Vater 2.01 ** 8.69 *** Nur Mutter 3.29 *** 15.94 *** Beide Elternteile 18.77 *** 28.00 *** **: p<.01; ***: p<.001. aus: Lachner & Wittchen (1997, 69). Gesundheitliche Gefahren für Kinder aus suchtbelasteten Familien Die Zahl der Krankenhausaufenthalte liegt um 24.3 % höher. Die durchschnittliche Verweildauer bei stationären Behandlungen liegt um 61.7% höher (Woodside et al., 1993). Die behandlungsbezogenen Kosten liegen um 36.2 % höher (Woodside et al., 1993). Subjektive Gesundheit: 35.6% der Kinder aus suchtbelasteten Familien (Exp. > 4 Jahre) geben an, dass sie sich oft krank fühlen (vs. 15.9%) [Klein, 2003]. Risikosteigerung aufgrund psychischer Komorbidität: Wegen der hohen Komorbidität von Suchtstörungen und psychischen Störungen (40% bis 80%) sind kombinierte, abgestimmte Angebote für Kinder aus allen derartigen Familiensystemen besonders wichtig. Bindungsmuster bei psychisch kranken Müttern (Cicchetti et al., 1995) Erkrankung der Anteil unsicherer BinMutter dung bei Kindern schwere Depression 47% leichte Depression 24% bipolare Depression 79% Schwere Angster80% krankungen Alkoholmissbrauch 52% (davon 35% ambivalent) Drogenmissbrauch 85% (davon 75% ambivalent) In einer psychisch belasteten Familie zu leben, bedeutet vor allem psychischen Stress: Alltags- und Dauerstress Formen des Familienstresses und der Stressverarbeitung (Schneewind, 1991, 2006): (1) Duldungsstress („Ich kann dem Druck und Stress nicht ausweichen, halte ihn aber nicht aus“) (2) Katastrophenstress („Ich weiß nie, was passieren wird. Das macht mir so viel Angst, dass ich andauernd daran denken muss“) (3) Bewältigungsstress („Auch wenn es schwer ist, ich werde es schaffen und überleben“) Hauptsymptome alkoholbelasteter Partnerschaften und Familien: Stress und Volatilität Im Einzelnen: • Stabilität der Instabilität • Unberechenbares Verhalten des Suchtkranken wird durch übermäßige Verantwortungsübernahme der Partnerin kompensiert. In der Summe herrscht meist lange Homöostase • Kontrollzwang, Kontrolleskalation, Kontrollverlust • Übermäßige Frequenz emotionaler, physischer und sexueller Gewalt • Chronisch belastete Atmosphäre („schleichendes Gift“) • Verlusterlebnisse, Diskontinuitäten, Brüche Hauptproblem suchtkranker Eltern aus der Kindesperspektive: Verhaltensvolatilität Das Hauptproblem suchtkranker Eltern im Erleben ihrer Kinder ist ihre Unberechenbarkeit und Unzuverlässigkeit, bisweilen auch ihre Impulsivität, Aggressivität oder Depressivität. Je stabiler und funktionaler ihr Verhalten wird, desto besser ist dies für ihre Kinder. Hast Du manchmal Angst vor dem Vater? Elternteil mit Alkoholdiagnose ja nein gesamt Vater 75 (59.5%) 51 (40.5%) 126 Stiefvater 8 (66.7%) 4 (33.3%) 12 Kontrollgruppe 4 (6.6%) 57 (93.4%) 61 N= 251;11- bis 16-Jährige aus nicht klinischer, repräsentativer Schülerstichprobe Relative Erkrankungsrisiken (OR) für Jugendliche in alkoholbelasteten Familien [Lachner & Wittchen, 1997] Elternteil mit Alkoholdiagnose Diagnose Jugendliche Nur Vater Nur Mutter Beide Posttraumatische Belastungsstörung Depressive Episode Nur Vater Nur Mutter Beide Odds ratio 5.53 5.15 14.77 1.94 2.88 3.20 34 Töchter Töchter alkoholkranker Väter heirateten in mehr als 40% aller Fälle wieder einen alkoholkranken Partner und sind besonders anfällig für co-abhängige Verhaltensweisen (Schuckit & Smith, 1996). Söhne suchtkranker Väter Söhne: Sind gleichgültiger, weniger empathisch, oft impulsiv, betreiben häufiger Alkoholund Tabakmissbrauch als Söhne nicht suchtkranker Väter. (Klein, 2008) Töchter suchtkranker Mütter Töchter: Sind stark ängstlich, machen sich viele Sorgen, verurteilen sich selbst, halten sich für nicht normal und leiden unter starken Stimmungsschwankungen und depressiven Verstimmungen. Neigen mehr zum Alkoholkonsum und Rauschtrinken. (Klein, 2008) Konstellationen in dysfunktionalen Familien Die wichtigsten 9 ACEs sind: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Emotionaler Missbrauch Körperliche Misshandlung Sexueller Missbrauch Emotionale Vernachlässigung Körperlicher Vernachlässigung Geschlagene Mutter Elterliche Komorbidität Elterliche Trennung und Scheidung Elternteil im Strafvollzug Dube et al., 2001 38 Kategorien widriger Kindheitserfahrungen I (adverse childhood experiences; ACE; Dube et al., 2001) Kategorie widriger Kindheitserfahrungen Emotionaler Missbrauch Körperliche Misshandlung Sexueller Missbrauch Elterlicher Alkoholmissbrauch Kein Elternteil Nur Vater Nur Mutter Beide Elternteile Kein Elternteil Nur Vater Nur Mutter Beide Elternteile Kein Elternteil Nur Vater Nur Mutter Beide Elternteile Töchter Odds % Ratio 9.0 20.2 21.9 30.5 20.8 35.3 43.8 49.1 20.2 35.1 35.1 47.5 1.0 2.3 2.4 3.7 1.0 1.9 2.6 3.3 1.0 2.0 1.8 3.1 Söhne % Odds Ratio 5.9 14.7 11.4 21.6 24.7 38.6 43.0 52.2 15.8 21.7 29.1 19.8 1.0 2.5 1.8 3.9 1.0 1.8 2.1 3.1 1.0 1.5 2.2 1.3 39 Sucht, Gewalt und Familie – Zusammenhänge, Risiken, Konsequenzen (3) Konzepte zur Hilfe, Behandlung, Prävention Ziele in der Arbeit mit Kindern aus suchtbelasteten Familien Frühintervention Umfassender Kinderschutz Problem- und Ressourcenidentifikation Nachhaltigkeit Gewaltprävention, Traumatisierungsverhinderung Steigerung des Selbstwerts (Persönlichkeitsschutz) Altersgerechte Psychoedukation Förderung der psychischen Gesundheit Basisbedürfnisse, die für Kinder drogenabhängiger Eltern erfüllt sein müssen (nach A. Baller, KDO, Amsterdam) • Angemessenes Wohnen, inkl. Sauberkeit, Hygiene, Heizung, Wasser- und Stromversorgung • Ausreichende ausgewogene Ernährung • Adäquate Kleidung • Absicherung eines Mindestlebensunterhalts • Sicherung regelmäßiger ärztlicher Versorgung • Vorhandensein einer festen kontinuierlichen Bezugsperson („responsible caregiver“) Basisbedürfnisse, die für Kinder drogenabhängiger Eltern erfüllt sein müssen II • Gewährleistung der Aufsichtspflicht, Verhütung von Unfällen und Verletzungen • Gewaltfreie Erziehung • Strukturierter verlässlicher Alltag, incl. geregeltem TagNacht-Rhythmus • Gewährleistung einer ausreichenden pädagogischen Förderung und Erziehung • Teilnahme am sozialen Gleichaltrigenleben (peerGruppen) Sucht, Gewalt und Familie – Zusammenhänge, Risiken, Konsequenzen (4) Das Behandlungsmodell TAVIM für alkohol- und drogenabhängige, gewalttätige Männer und Väter 44 Behandlungsphilosophie bei TAVIM Die psychotherapeutische Behandlung suchtkranker, gewaltaffiner Personen ist ein relevanter Schutz der Angehörigen vor Gewalt und Traumatisierung. Insofern sollte jede Suchttherapie neben den Angeboten für Traumatisierte auch entsprechende Angebote für Gewalttäter umfassen. Dieses macht weitergehende präventive Bemühungen für betroffene Kinder und Jugendliche nicht überflüssig. 45 Intrapsychische Motivlagen für Gewaltverhalten bei alkohol- und drogenabhängigen Männern 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Subjektives Gefühl der Provokation Beherrschungs- und Dominanzmotive Impulsivität bei Unterkontrolliertheit Explosive Durchbrüche bei ansonsten Überkontrolliertheit Soziale „Fehlwahrnehmungen“ Störungen der Emotionsregulation Vermeidung von Ohnmachtsgefühlen Modelllerneffekte aus Herkunftsfamilie und Peergruppen; Mangel an Verhaltensalternativen Einsatzbereich des Manuals TAVIM: Hilfe für Männer mit Gewalt- und Alkoholproblemen TAVIM-TP unterstützt Ihre Klienten dabei, – sich besser zu beobachten (“Forscher werden”). – aggressives Verhalten unter Alkohol zu verstehen. – konkrete Copingstrategien anzuwenden, um alkoholbezogene häusliche Gewalt zu reduzieren (Rückfallprävention). – Erlerntes in den Alltag zu übertragen. TAVIM-TP besteht aus 10 Gruppensitzungen, 4 Einzelsitzungen und 2 Familiensitzungen (optional). TAVIM = Treatment of Alcoholic Violent Men (Klein et al., 2010) © Michael Klein, KatHO NRW, DISuP, 2014 47 Kognitiv-behaviorales Präventionsprogramm für alkoholabhängige Gewalttäter 1. Motivationsklärung und –förderung 2. Psychoedukation: Ärger – Alkohol – Aggression 3. Selbststeuerungs- und Selbstmanagementtechniken 4. Umgang mit Stress und Erregung 5. Veränderung der Aggressionstrigger 6. Veränderung alkoholspezifischer Erwartungen 7. Hochrisikosituationen 8. Problemlösetraining 9. Umgang mit schlechten Stimmungen 10. Synthese und Evaluation des Programms Wie ist das Manual aufgebaut? © Michael Klein, KatHO NRW, DISuP, 2014 49 Erklärungsmodell für alkoholbezogene häusliche Gewalt Bewertungen Einstellungen Ereignis/Trigger Internal & External Folge: Schaden für sich und für andere ALKOHOL Verhalten Aggression/Gewalt © Michael Klein, KatHO NRW, DISuP, 2014 Gefühle Erregung, Ärger 50 TAVIM-Programm (2. Gruppensitzung) © Michael Klein, KatHO NRW, DISuP, 2014 51 TAVIM-Programm (3. Gruppensitzung) © Michael Klein, KatHO NRW, DISuP, 2014 52 TAVIM-Programm (4. Gruppensitzung) © Michael Klein, KatHO NRW, DISuP, 2014 53 Kognitiv-behaviorales Präventionsprogramm für alkoholabhängige Gewalttäter Hinweise für Angehörige: 1. Reden Sie klar und deutlich mit Ihrem Partner, aber vermeiden Sie es, zu schreien oder zu schimpfen 2. Drohen Sie nicht, sondern handeln Sie! 3. Lassen Sie sich nicht provozieren 4. Sprechen Sie in Ich-Sätzen 5. Bieten Sie Ihrem Partner Alternativen zur Auswahl an (z.B. Gespräch oder Rückzug) 6. Wenn Sie die Situation als bedrohlich empfinden, holen Sie Hilfe (Nachbarn, Polizei) oder verlassen Sie die Situation (den Raum, die Wohnung, das Haus). Suchtspezifische Empathie (für pädagogisch-therapeutische Fachkräfte) (1) Zu wissen, was Kinder in suchtbelasteten Familien (mit hoher Wahrscheinlichkeit) erlebt haben, ist die Basis für suchtspezifische Empathie. (2) Was in suchtbelasteten Familien passiert, ist nicht normal im Sinne von Orthopädagogik, normgerechter Umwelt und Entwicklungspsychologie (Salutogenese). (3) (Suchtspezifische) Empathie ist die Basis für Beziehung und konkrete Hilfen für die betroffenen Kinder. (4) Kontinuierliche, akzeptierende, liebevolle Beziehung ist die Basis für Vertrauen und Veränderung. Hilfreiche Kompetenzen der Fachkräfte • Besondere Empathie für die Lebenserfahrungen und Verhaltensweisen von Kindern aus suchtbelasteten Familien („suchtspezifische Empathie“) • Förderung von Motivation, Kompetenzen und Resilienzen • Umgang mit Ambivalenzen und „Widerstand“ • Auflösung der bzw. Abkehr von nicht evidenzgesicherten Mythen (z.B. bezüglich Rückfall, „Co-Abhängigkeit“) Sucht und Familie – Zusammenhänge, Risiken, Konsequenzen (5) Handlungsstrategien und –maximen in der Arbeit mit suchtbelasteten Familien. Grundhaltungen, Veränderungsprozesse und vorläufige Ergebnissicherung Anforderungen an gelingende, effektive Prävention frühzeitig nachhaltig glaubwürdig verhaltens- und verhältnisorientiert informativ evidenzbasiert an ihrem eigenen Erfolg orientiert transgenerational, risikoorientiert selektiv „Keiner geht verloren“ inklusiv Elemente in Präventionsprogrammen (1)Förderung des Selbstwerts und der Selbstwirksamkeit (2)Verbesserung der Emotionskontrolle (3)Förderung der Resilienzen (4)Ausbau und Verbesserung des Sozialen Netzwerks (5)Förderung der Elternkompetenzen und der Eltern-Kind-Interaktion (6)Verbesserung der Eltern-Kind-Bindung Konsequenzen Für Kinder in suchtbelasteten Familien sind Maßnahmen notwendig, die … (1) früh einsetzen (Frühintervention) (2) das vorhandene Risiko adäquat wahrnehmen und bearbeiten (selektive Prävention) (3) mehrere Generationen überblicken (transgenerationale Prävention) (4) umfassend und dauerhaft sind (Case Management) (5) die ganze Familie einschließen (Familienberatung und/oder –therapie) (6) die Motivation zu guter Elternschaft und Suchtbewältigung verknüpfen (Motivational Interviewing) (7) die Resilienzen fördern bzw. entwickeln (Ressourcenorientierung) (8) regional und lebensweltorientiert sind (Verantwortungsgemeinschaft) „Schlucken und schlagen“ – Behandlung alkohol- und drogenabhängiger Männer und Väter Leitsätze: Gewaltverhalten bei suchtkranken Männern und Vätern … 1. … ist häufig und kein seltenes Phänomen. 2. … ist therapeutisch behandelbar. 3. … sollte im Rahmen einer (stationären od. ambulanten) Suchttherapie behandelt werden. 4. … ist eine mögliche Rückfallfolge wie auch ein möglicher Rückfallauslöser. 5. … Anlass für diagnostisches Routinescreening, biographische Gewaltanamese und komorbiditätsorientierte Kombi-Behandlung. 61 Relevante Internetadressen www.addiction.de www.disup.de www.kidkit.de www.nacoa.de www.encare.info bzw. www.encare.de bzw. www.encare.at Referent: Prof. Dr. Michael Klein Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (KatHO NRW) Deutsches Institut für Sucht- und Präventionsforschung (DISuP) Wörthstraße 10 D-50668 Köln Email: [email protected]