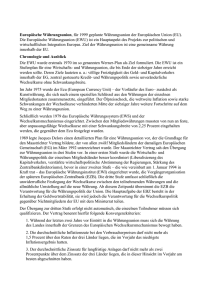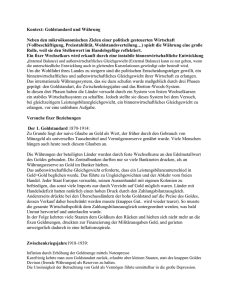"Die Vision eines europäischen Währungsraumes" in <i
Werbung

"Die Vision eines europäischen Währungsraumes" in Frankfurter Allgemeine Zeitung (28. Mai 1988) Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zeitung für Deutschland. 28.05.1988. Frankfurt/Main: FAZ Verlag GmbH. Urheberrecht: (c) Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH All rights reserved. Provided by Frankfurter Allgemeine archiv. URL: http://www.cvce.eu/obj/"die_vision_eines_europaischen_wahrungsraumes"_in_frankfurter_allgemeine_zeitung_28_mai _1988-de-376139a3-3ced-4a06-a871-65ba105dd0ab.html Publication date: 19/09/2012 1/6 19/09/2012 Die Vision eines europäischen Währungsraumes Von Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl Wir befinden uns gegenwärtig in einer Phase neuer Initiativen in der Europäischen Gemeinschaft. Im Vordergrund steht die Absicht, bis 1992 einen europäischen Binnenmarkt zu schaffen. Die insgesamt günstige Wirtschafts- und Währungslage bietet dafür gute Voraussetzungen. Geldwertstabilität ist nicht nur als vorrangiges Ziel der Wirtschaftspolitik weitgehend anerkannt, sondern mehr denn je in Europa verwirklicht; die Konvergenz der Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsentwicklung ist — ungeachtet noch bestehender Diskrepanzen etwa in der Finanzpolitik — groß. Bis 1992 werden wir also auf dem Weg zur Wirtschaftsunion in Europa hoffentlich ein gutes Stück vorangekommen sein. Hierfür einzutreten lohnt sich schon allein aus wirtschaftlichen Gründen. Von einem einheitlichen Binnenmarkt darf Europa beträchtliche Wachstumsimpulse erwarten. Darüber hinaus ist aber die Verwirklichung einer europäischen Währungsunion zweifellos ein politisches Ziel von großer Bedeutung. Mit gutem Grund gehen die Planungen für den europäischen Binnenmarkt über den Handelsverkehr weit hinaus. Unbedingt notwendig erscheint es, einen integrierten Finanzmarkt zu etablieren. Freier Kapitalverkehr und unbeschränkte Konvertibilität der europäischen Währungen untereinander sind wesentliche Bestandteile eines einheitlichen Binnenmarktes. Zugleich wäre damit ein Grundelement einer künftigen Währungsunion geschaffen. Ein weiteres und entscheidendes Kriterium für eine Währungsunion ist die endgültige, irreversible Fixierung der Wechselkurse. Der Werner-Bericht aus dem Jahre 1970 enthielt folgende Definition der Währungsunion, die auch heute noch gültig ist: „Eine Währungsunion erfordert im Innern die vollständige und irreversible Konvertibilität der Währungen, die Beseitigung der Bandbreiten der Wechselkurse, die unwiderrufliche Festsetzung der Paritätsverhältnisse und die völlige Liberalisierung des Kapitalverkehrs." Eine Währungsunion nach dieser Definition hätte weitreichende Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Sie wäre der monetäre Überbau einer Wirtschaftsunion mit weitestgehender Freizügigkeit für Güter, Dienstleistungen, Arbeitskräfte und Kapital. Dies setzt nicht unbedingt die Harmonisierung aller Politiken voraus; weiter bestehende Unterschiede im Steuersystem, in tarifvertraglichen Regelungen und auf anderen Gebieten würden zu Standortvorteilen beziehungsweise -nachteilen führen. Der Markt würde zwar ein gewisses Maß an Harmonisierung erzwingen. Notwendig wären jedoch ein ordnungspolitischer Grundkonsens, ein funktionierender Finanzausgleich und ein hohes Maß an Koordinierung der Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik, wenn wir zunehmende Ungleichgewichte in der Wirtschaftsentwicklung der Mitgliedsländer und letztlich einen Zusammenbruch des Systems vermeiden wollen. Von der Währungsunion zur einheitlichen Währung ist es nur noch ein kleiner Schritt. Zwar könnten die nationalen Währungen im Prinzip beibehalten werden, aber die Einführung eines einheitlichen Geldzeichens anstelle der nationalen Währungen würde vermutlich der Währungsunion eine „monetäre Identität" verleihen, das Restrisiko von Paritätsänderungen zwischen den nationalen Währungen beseitigen und damit ein Symbol für das Fortbestehen eines einheitlichen Währungsraumes schaffen. Die Ablösung nationaler Währungen durch eine Gemeinschaftswährung wäre die „Krönung" des monetären Integrationsprozesses. Aber bis zu diesem Endzustand ist es ein weiter Weg. Deshalb wird als Alternative zur schrittweisen Annäherung an eine europäische Währungsunion im Sinne der Definition des Werner-Berichts seit Mitte der siebziger Jahre das Konzept einer Parallelwährung diskutiert. Dahinter verbirgt sich die Idee, neben nationalem Geld als Vehikel der monetären Einigung zusätzlich eine EG-Währung in Umlauf zu bringen. Die Verfechter dieser Idee setzen darauf, dass diese Europawährung nach und nach Franc, Gulden, D-Mark und die anderen Währungen verdrängt und sich allmählich zu dem alleinigen allgemeinen Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel in Europa entwickelt. Verglichen mit der erfahrungsgemäß schwierigen politischen Aufgabe, nationale wirtschaftspolitische Kompetenzen auf die Gemeinschaft zu übertragen, mag das Parallelwährungskonzept auf den ersten Blick als durchaus „elegant" erscheinen. Bei genauer Betrachtung zeigt sich aber, dass auch bei diesem Konzept 2/6 19/09/2012 weitreichende institutionelle Anpassungsmaßnahmen erforderlich sind, wenn der in Gang gesetzte „Währungswettbewerb" in einer für alle Mitgliedstaaten akzeptablen Weise ablaufen soll. Man kann durch eine Parallelwährung nicht den politischen Entscheidungen ausweichen, die für die Schaffung einer Währungsunion essentiell sind. Die Vorstellung, man könne die Parallelwährung durch offizielle Präferierung gegenüber den nationalen Währungen verbreiten, ist wenig realistisch. Der Markt entscheidet nach Zins- und Wechselkurskalkül über die Akzeptanz einer Währung; Versuche, durch behördliche Maßnahmen den Markt auszuhebeln, sind wenig Erfolg versprechend, wie die Entwicklung der privaten und offiziellen Ecu zeigt, die dann an Attraktivität verlieren, wenn Kapitalverkehrsbeschränkungen, Devisenkontrollen und Einschränkungen der Konvertibilität abgebaut werden und die Wechselkurse stabiler sind. Die Ecu als Parallelwährung — wie auch als Währung überhaupt — einzusetzen, stößt unter anderem wegen ihrer besonderen Konstruktion auf Schwierigkeiten. Eine Korb-Ecu kann als gewogener Durchschnitt der nationalen Währungen keinen nachhaltigen und insbesondere keinen gleichmäßigen Verdrängungsdruck auf die nationalen Währungen ausüben und damit auch kein zusätzliches Integrationsinstrument sein. Die KorbEcu kann keine eigenständige Qualität entwickeln. Sie spiegelt — von geringen Indifferenzmargen abgesehen — den gewogenen Durchschnitt der Zinssätze und der Wechselkurse der im Korb enthaltenen Währungen wider. Eine eigenständige europäische Parallelwährung müsste einen gleich hohen Standard wie die beste der nationalen Währungen einhalten. Andernfalls müssten die EG-Notenbanken verpflichtet werden, den Wechselkurs dieser Parallelwährung durch unbeschränkte Ankäufe vor einer Abwertung zu bewahren. Derartige Interventionsverpflichtungen hätten erhebliche geldpolitische Konsequenzen; im Endeffekt liefe dies auf eine ständige Schöpfung der relativ stärkeren Währungen gegen Aufnahme der Europa-Währung hinaus. Eine Parallelwährungsstrategie setzt voraus, dass der marktwirtschaftliche Verdrängungsprozess funktioniert. Zu der erforderlichen gleichmäßigen Substitution aller EG-Währungen (also auch der D-Mark) durch die Parallelwährung könnte es nur kommen, wenn die Parallelwährung — binnenwirtschaftlich den gleiche Status erhält wie jede nationale EG-Währung; — als Anlagewährung unter Berücksichtigung der Zins- und Wechselkursentwicklung auch mit der stärksten EG-Währung konkurrieren kann und — wenn sie in der Funktion als Transaktionswährung mit möglichst geringen Kosten verbunden ist, was praktisch nur dann der Fall wäre, wenn sie durch hinreichend feste Wechselkurse zu den nationalen Währungen abgesichert ist. Damit ist aber weitgehend der Endzustand definiert, zu dem die Parallelwährung erst hinführen soll. Wozu also der kostspielige Umweg über die Parallelwährung? Europapolitisch wäre wenig gewonnen, stabilitätspolitisch aber viel aufs Spiel gesetzt, würde man das Parallelwährungskonzept realisieren. Die Schaffung einer Währungsunion setzt nicht unbedingt ein europäisches Notenbanksystem voraus. Man könnte sich auch eine erfolgreiche währungspolitische Zusammenarbeit der nationalen Notenbanken vorstellen, wenn gleichzeitig auch auf anderen Gebieten der Politik ein hohes Maß an Konvergenz erzielt wird. Verlässlicher aber wäre es wohl, wenn eine Währungsunion — und um so mehr eine einheitliche Währung — auch ein Minimum, an institutionellem Rahmen erhielte. Der Schritt in die institutionelle Phase der währungspolitischen Zusammenarbeit mit dem Ziel, ein europäisches Notenbanksystem zu schaffen, setzt die Beantwortung einer Reihe von Fragen voraus — je 3/6 19/09/2012 klarer, desto besser —, um Irrwege von Anfang an zu vermeiden. Zunächst gehört hierzu eine klar definierte Aufgabenstellung. Sie sollte inhaltlich mit dem Ziel des Bundesbankgesetzes übereinstimmen, „die Währung zu sichern", also für stabile Preise zu sorgen. Das scheint eine bare Selbstverständlichkeit für eine Notenbank zu sein, aber in der Praxis besteht immer die Tendenz, der Geldpolitik zusätzliche Aufgaben aufzubürden — etwa die Stabilisierung der Wechselkurse oder die Mithilfe bei der regionalen Strukturpolitik, Vollbeschäftigung oder andere Aufgaben —, die mit dem eigentlichen Ziel der Notenbankpolitik, den Geldwert zu sichern, in Konflikt geraten können. Priorität für Preisstabilität bedeutet nicht, dass eine europäische Notenbank von vornherein einen deflationären „Bias" hätte. Vielmehr hat die Erfahrung der siebziger Jahre nicht nur in der Bundesrepublik gezeigt, dass man nicht quasi für ein bisschen mehr Inflation ein bisschen weniger Arbeitslosigkeit kaufen kann. Im Gegenteil, Länder mit niedriger Inflationsrate hatten in der Regel niedrigere Arbeitslosigkeit und umgekehrt. Für die große Mehrheit der Bürger in der Bundesrepublik mit der traumatischen historischen Erinnerung an zwei Inflationen und dem Bewusstsein, was Preisstabilität für Wohlstand und soziale Gerechtigkeit bedeutet, wäre jedenfalls ein Notenbanksystem, das diesem Ziel einen geringeren Stellenwert einräumte als das Bundesbankgesetz, kaum akzeptabel. Die Aufgabe, für Preisstabilität zu sorgen, wird zumindest erleichtert, wenn nicht überhaupt erst ermöglicht, wenn ein europäisches Notenbanksystem unabhängig in seiner Willensbildung und in seiner Entscheidungsfindung ist; unabhängig nicht nur von nationalen Regierungen, sondern auch von den Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaft, also von der Kommission und vom Ministerrat. Dies würde in manchen Mitgliedsländern eine weitgehende Änderung der jetzigen Notenbankverfassung nötig machen, wahrscheinlich auch in der Bundesrepublik; denn bei ihrem gegenwärtigen, quasi zweistufigen System mit elf Landeszentralbanken und dem Direktorium in Frankfurt kann man bezweifeln, ob dieses System fortgeführt werden könnte. Unseren ordnungspolitischen Vorstellungen würde es entsprechen, wenn das geldpolitische Instrumentarium der europäischen Zentralbank so ausgestaltet würde, dass es eine effektive Steuerung der Geldmenge ohne Rückgriff auf quantitative Kontrollen (oder andere direkte Eingriffe in die Finanzmärkte) ermöglicht. Das Instrumentarium muss dementsprechend sowohl Mittel der Zins- als auch der Liquiditätspolitik vorsehen, die für die Grobsteuerung wie die Feinsteuerung des europäischen Geldmarktes ausreichen. Ein europäisches Notenbanksystem lässt sich wohl nur dezentralisiert, föderalistisch organisieren, also nach dem Subsidiaritätsprinzip, wonach nur das zentralisiert wird, was unbedingt nötig ist, und soviel wie möglich an nationalen Kompetenzen erhalten bleibt. Eine europäische Notenbank sollte also mehr dem Bundesbank-System oder dem Federal-Reserve-System in den Vereinigten Staaten ähneln als dem zentralistischen Aufbau der Notenbanken in den meisten europäischen Ländern. Schließlich sollte nach unserem Verständnis ein europäisches Notenbanksystem nicht berechtigt sein, Staatsdefizite über Geldschöpfung zu finanzieren. Das ist keineswegs in allen Ländern selbstverständlich. In der Bundesrepublik ist dies der Bundesbank laut Bundesbankgesetz nicht erlaubt. Beantwortet werden müsste auch die Frage, in welchem Umfang eine europäische Notenbank für die Wechselkurspolitik gegenüber Drittwährungen, also in erster Linie Dollar und Yen, verantwortlich sein sollte. Monetäre Stabilität bedarf der außenwirtschaftlichen Absicherung, wie wir im Bretton-WoodsSystem gesehen haben. Stabilisierung der Wechselkurse kann und darf deshalb nicht das primäre Ziel der Geldpolitik sein, vor allem nicht in einer inflationären Umwelt. In diesem Rahmen aber gibt es durchaus Spielraum für währungspolitische Kooperation mit Ländern außerhalb der Gemeinschaft, die auch Interventionen an den Devisenmärkten beinhalten kann. Eine europäische Notenbank, die dafür verantwortlich wäre, müsste deshalb zumindest einen Teil der jetzt noch nationalen Währungsreserven definitiv erwerben und verwalten. Dies war schon bei der Schaffung des Europäischen Währungssystems vorgesehen, scheiterte aber an der mangelnden Bereitschaft praktisch aller Länder (nicht etwa der Bundesbank, die nur auf einer gesetzlichen Regelung insistieren musste), einen Teil der Währungsreserven unwiderruflich auf eine supranationale Institution zu übertragen. 4/6 19/09/2012 Daneben gäbe es eine Reihe scheinbar nicht so prinzipieller Probleme, deren Relevanz man aber nicht unterschätzen sollte. Wo soll zum Beispiel eine europäische Zentralbank ihren Sitz haben, in Frankfurt, in Paris, in Brüssel oder in London? Die Liste der schwierigen Fragen, die im Zusammenhang mit der Schaffung einer europäischen Währung und eines europäischen Notenbanksystems beantwortet werden müssen, ließe sich beliebig verlängern. Eine davon ergibt sich schon aus der Tatsache, dass vier Mitgliedsländer der Gemeinschaft — Großbritannien, Spanien, Portugal und Griechenland — dem jetzigen Wechselkursverbund des Europäischen Währungssystems gar nicht und Italien nur mit erweiterter Bandbreite für die Lira angehören. Man muss unter diesen Umständen wohl kein europapolitischer Defätist sein, um gewisse Zweifel zu haben, ob das politische Umfeld für so weitreichende Entscheidungen und Souveränitätsverzichte, wie sie die Schaffung einer europäischen Notenbank und einer europäischen Währung erfordern, wirklich gegeben ist. In der Zwischenzeit bleibt die Entwicklung jedoch nicht stehen. Wir sind auf dem Weg zur währungspolitischen Integration in den letzten Jahren tatsächlich erheblich fortgeschritten: Die währungspolitische Zusammenarbeit in Europa ist seit Gründung des Europäischen Währungssystems intensiver geworden. Die Bundesbank hat dazu unter anderem mit ihrer Zustimmung zum zweimaligen Ausbau der EWS-Regeln, zuletzt mit den Vereinbarungen von Basel und Nyborg im September 1987, einen wesentlichen Beitrag geleistet. Die Wirtschaftsentwicklung in den Mitgliedsländern hat ein hohes Maß an Konvergenz erreicht, die Wechselkurse im Europäischen Währungssystem sind relativ stabil. Die Koordinierung von Interventionen gegenüber dem Dollar ist auch heute schon weit entwickelt, jedenfalls unter den am Wechselkursverbund des Europäischen Währungssystems teilnehmenden Ländern. Eine wichtige Rolle in diesem Prozess der währungspolitischen Zusammenarbeit spielt der Ausschuss der Notenbankgouverneure der Gemeinschaft. Er hat sich als eine nützliche Einrichtung für die Koordinierung der Geld- und Währungspolitik im Europäischen Währungssystem erwiesen. Meines Erachtens könnte man ihm durchaus weitergehende Vollmachten beim Management des Währungssystems geben, zumal das System auf einem Vertrag der Notenbanken aufgebaut ist. Zum Beispiel könnten notwendige Wechselkurskorrekturen von den EG-Notenbankgouverneuren professionell, rechtzeitig und ohne großes öffentliches Aufsehen vorgenommen werden. Dahin gehende Vorschläge sind allerdings von den Finanzministern abgelehnt worden. Dagegen eignet sich der Europäische Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit, der EFWZ, nicht als Nukleus für ein europäisches Notenbanksystem. Dem Fonds fehlt eine wichtige Eigenschaft, nämlich die Unabhängigkeit von Institutionen der Europäischen Gemeinschaft. Er ist eine Schöpfung des EGMinisterrats und wäre daher, jedenfalls im Prinzip, von Entscheidungen dieses Gremiums abhängig. Die Verpflichtung, das Europäische Währungssystem funktionsfähig zu halten, hat die Notwendigkeit für eine engere Kooperation vergrößert. Die Bundesbank hat in den neun Jahren seit Gründung des Währungssystems wesentliche Beiträge zum geräuschlosen und erfolgreichen Funktionieren dieses regionalen Währungsverbundes geleistet. Die D-Mark ist dabei — ungewollt — in die Rolle der wichtigsten Interventions- und Leitwährung hineingewachsen. Sie hat sich zum Stabilitätsstandard des Europäischen Währungssystems entwickelt und damit die entscheidende Grundlage für das erfolgreiche Funktionieren des Systems geliefert. Das Gewicht der Volkswirtschaft der Bundesrepublik im Europäischen Währungssystem hat ebenso dazu beigetragen wie die Tatsache, dass es der deutschen Wirtschafts- und Währungspolitik gelang, die Stabilität der D-Mark zu sichern und sie auch im europäischen Währungsverbund als stabilste Währung zu erhalten. Es wäre nicht nur für die Bundesrepublik, sondern gleichermaßen für die anderen europäischen Partner verhängnisvoll, würde man die stabile Verankerung des Europäischen Währungssystems lockern, ohne zu wissen, was an ihre Stelle treten soll. Einige unserer Partner verweisen auf den Verlust an wirtschafts- und währungspolitischer Handlungsfreiheit, den sie wegen der dominierenden Rolle der D-Mark im Währungsverbund hinnehmen müssen. In dem Maße, wie sie die Wechselkursbindung an die D-Mark akzeptiert haben, sehen sie sich in der Verfolgung eigenständiger Wachstums-, Beschäftigungs- und Stabilitätsziele gehindert. Sie fordern 5/6 19/09/2012 daher eine „symmetrischere" Lastenverteilung bei der Verteidigung der Wechselkurse im Währungsverbund. Diese Diskussion gibt es seit der Schaffung des Europäischen Währungssystems. Als Ergebnis langwieriger Verhandlungen sind seinerzeit in den Vereinbarungen der Notenbanken die Interventionsverpflichtungen eindeutig geregelt worden. Sowohl Länder, deren Währung den unteren Interventionspunkt, als auch Länder, deren Währung den oberen Interventionspunkt erreicht hat, sind zu Devisenverkäufen beziehungsweise zu Devisenankäufen verpflichtet. Insofern ist das System also durchaus „symmetrisch". Für so genannte intramarginale Interventionen, die den Wechselkurs innerhalb der Bandbreiten halten sollen, bestehen keine vertraglichen Verpflichtungen. Sie sind jedoch von der Zustimmung der Notenbank abhängig, deren Währung zu Interventionen eingesetzt wird. Die Bundesbank hat der Verwendung der D-Mark meist zugestimmt, wenn dies nicht mit ihren geldpolitischen Zielvorstellungen kollidierte. Durch die Basel/Nyborg-Vereinbarungen sind die ohnehin großzügigen Kreditfazilitäten teilweise — und unter gewissen Bedingungen auch auf intramarginale Interventionen — ausgedehnt worden. Es ist realistischerweise zu erwarten, dass die Bundesbank die Hauptlast dieser Finanzierungen zu tragen hat, wann immer es zu erheblichen intramarginalen Interventionen kommt. Daraus können sich erhebliche Belastungen für die Geldpolitik ergeben, zumal auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von der Bundesbank unter Umständen erhebliche Interventionen erwartet werden. Es ist deshalb kein Mangel an Kooperationsbereitschaft, wenn wir es ablehnen, über die vertraglich vereinbarten hinausgehenden Interventionsverpflichtungen zu übernehmen. Dafür gibt es aber noch andere schwerwiegende Gründe. Würde die Bundesbank beginnen, EWSWährungen in ihre Reserven aufzunehmen, wie es ihr nahegelegt wird, würde sie das Europäische Währungssystem nicht stärken, sondern schwächen, weil damit der Anpassungszwang für ein Land mit schwacher Währung entfiele. Auch die Bundesrepublik hat natürlich eine Verpflichtung, zum Gleichgewicht im Währungssystem beizutragen, also in der jetzigen Situation ihre Leistungsbilanzüberschüsse zu verringern. Dies sollte aber nicht über eine Aufweichung der geldpolitischen Disziplin geschehen, sondern durch eine Politik der Stärkung der Binnennachfrage, wie sie beispielsweise mit der jüngsten Steuersenkung betrieben worden ist. Und schließlich können Interventionen auch kein dauerhafter Ersatz für rechtzeitige Wechselkursanpassungen sein, solange die wirtschaftliche Entwicklung in den Mitgliedsländern stark unterschiedlich verläuft. Das ist zur Zeit erfreulicherweise nicht der Fall, kann aber nicht für immer ausgeschlossen werden. Die Anfang des Jahres vorgelegte Studie von Gros und Thygesen zum Funktionieren des Europäischen Währungssystems in den vergangenen Jahren unterstreicht die positive Führungsrolle der deutschen Geldpolitik und macht deutlich, dass die behauptete „Asymmetrie" den Zusammenhalt des Systems nicht behindert, sondern gesichert hat: „Die Vorteile der Führungsrolle der Bundesbank könnten verloren gehen, wenn das Europäische Währungssystem deutlicher symmetrisch und die Fähigkeit der Bundesbank verringert würde, die monetären Aggregate in der Bundesrepublik zu kontrollieren, ohne dafür gleichermaßen glaubwürdige Regeln für die gemeinsame Geldschöpfung zu etablieren." Eine europäische Währungsunion ist ein wünschenswertes politisches und wirtschaftliches Ziel. Einige große Schritte auf dem Weg dorthin sind bereits zurückgelegt worden. Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Richtlinie zur Liberalisierung des Kapitalverkehrs in der Gemeinschaft, die hoffentlich in naher Zukunft, möglicherweise bereits bei der nächsten Sitzung des Finanzministerrats am 13. Juni, verabschiedet werden wird, wäre ein Meilenstein in dieser Entwicklung. Die Beteiligung aller Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft am Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems wäre ein weiterer wichtiger Schritt. Ob darüber hinausgehende institutionelle Weichenstellungen in Richtung auf eine Währungsunion möglich sind, liegt in der Hand der Regierungen und Parlamente. Realismus und Augenmaß sind dabei nützlicher als Wunschdenken. 6/6 19/09/2012