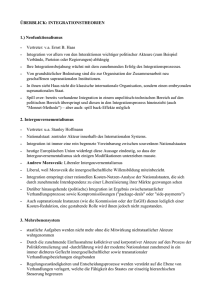Soziale Strukturen des Erfolgs Winner-take-all-Prozesse in
Werbung

MPIfG Discussion Paper 12/7 Soziale Strukturen des Erfolgs Winner-take-all-Prozesse in der Kreativwirtschaft Mark Lutter Mark Lutter Soziale Strukturen des Erfolgs: Winner-take-all-Prozesse in der Kreativwirtschaft MPIfG Discussion Paper 12/7 Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne October 2012 MPIfG Discussion Paper ISSN 0944-2073 (Print) ISSN 1864-4325 (Internet) © 2012 by the author Mark Lutter is a research fellow at the Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne. [email protected] Downloads www.mpifg.de Go to Publications / Discussion Papers Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Max Planck Institute for the Study of Societies Paulstr. 3 | 50676 Cologne | Germany Tel. +49 221 2767-0 Fax +49 221 2767-555 www.mpifg.de [email protected] Lutter: Soziale Strukturen des Erfolgs iii Abstract How does success accumulate? While the winner-take-all phenomenon has been viewed as a process of accumulating demand that results from a huge number of consumers making the same purchase decision, the conditions and interactions on the supply side have received scant attention in the literature. This paper investigates six ways sociology could contribute toward shedding light on the winner-take-all phenomenon, all of which seek to explain unequal success by examining the social structures of the labor market in which the actors are embedded. The author takes a preliminary, exploratory look from a sociological perspective at an aspect of inequality that is socially significant, yet poorly understood. The approaches presented open the way for future empirical study. Zusammenfassung Wie entstehen Erfolgskonzentrationen? Während das Winner-take-all-Phänomen bisher als Konzentrationsprozess auf der Nachfrageseite durch massenhaft gleichförmige Kaufentscheidungen der Konsumenten begriffen wurde, sind Bedingungen und Konstellationen auf der Anbieterseite wenig berücksichtigt worden. In diesem Beitrag werden sechs Ansätze diskutiert, die das Potenzial einer soziologischen Erklärung des Winner-take-all-Phänomens ausloten. Jeder der Ansätze versucht dabei, Erfolgsungleichheiten aus den sozialen Strukturen heraus zu erklären, in die die Akteure auf dem Arbeitsmarkt eingebettet sind. Der Beitrag versteht sich als erster Zugang zu einem in der Soziologie zwar noch wenig erforschten, doch wichtigen Phänomen sozialer Ungleichheit und soll den Raum für zukünftige empirische Studien öffnen. iv MPIfG Discussion Paper 12/7 Inhalt 1Einleitung 1 2Forschungsstand: Winner-take-all-Märkte als Nachfragekonzentration 5 3 8 Die Entstehung von Erfolg: Soziologische Ansätze Askriptive Ungleichheiten auf Kreativarbeitsmärkten 8 Kumulierte Vorteile oder „Matthäus-Effekte“ 10 Netzwerkeinbettung und die Stärke schwacher Beziehungen 12 Erfolg als Rollenausdehnung 14 Heterarchie oder: Organisierte Dissonanz 16 Status-Matching oder: Netzwerkspiralen des Erfolgs 17 Schluss20 Literatur21 Lutter: Soziale Strukturen des Erfolgs 1 Soziale Strukturen des Erfolgs: Winner-take-all-Prozesse in der Kreativwirtschaft 1Einleitung In den letzten Jahrzehnten haben soziale Ungleichheiten in den westlichen Industrienationen wieder zugenommen. Die Zunahme ist dabei allerdings weniger auf eine steigende allgemeine Einkommensungleichheit breiter Schichten zurückzuführen, sondern auf Konzentrationsprozesse im oberen 1-Prozent-Perzentil der Einkommen (McCall/ Percheski 2010: 333; Western et al. 2008: 905). Es handelt sich also um Zuwächse nach dem Winner-take-all-Prinzip: Heute befindet sich erheblich mehr Vermögen in den Händen einer kleineren Anzahl Privilegierter. Neben der Vererbung von Vermögen (Beckert 2004; Szydlik 1999, 2004; Szydlik/Schupp 2004), bildungs- und herkunftshomogamen Familienstrukturen (Blossfeld 2009; Western/Bloome/Percheski 2008), starken Einkommenszuwächsen in der Finanzwelt und den Unternehmensvorständen (DiPrete et al. 2010; Neckel 2010) sowie einschlägiger politischer Reformprozesse (Hacker/Pierson 2010: 168) gründet sich ein Teil der Zunahme auf Erfolgsungleichheiten in jenen flexiblen Arbeitsmärkten, die durch „Superstars“ dominiert sind. Superstarphänomene lassen sich in unterschiedlicher Ausprägung in verschiedenen Branchen beobachten: im Management, in der Wissenschaft, auf Arbeitsmärkten für Rechtsanwälte, Architekten, Journalisten, Politiker, Psychologen oder Mediziner (Frank/Cook 1995). Prävalent sind erfolgskonzentrierte Arbeitsmärkte aber vor allem in den Kultur-, Medien- und Kreativindustrien (Cowen 2000; Frank/Cook 1995; Menger 1999; Rosen 1981). Wie erklärt sich das Zustandekommen von Winner-take-all-Konzentrationen auf diesen Arbeitsmärkten? Verdeutlicht werden soll das Phänomen zunächst anhand eines Beispiels aus der Filmbranche: Die Gagen der erfolgreichsten Filmschauspieler betragen ein Vielfaches des durchschnittlichen Einkommens; zugleich hat die Mehrheit der Filmschaffenden mit sehr prekären Karrierebedingungen zu kämpfen. Eine Umfrage unter deutschen Schauspielern konkretisiert dies mit Zahlen: Knapp über 60 Prozent waren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren weniger als sechs Wochen beschäftigt; der jährliche Bruttoverdienst lag für die Hälfte aller befragten Schauspieler bei unter 20.000 Euro (Bührmann et al. 2010: 6–10). Diese Summe entspricht in etwa der Gage, die die Spitzenverdiener unter den deutschen Schauspielern für zwei Drehtage erhalten.1 Ich danke Birgit Apitzsch, Jens Beckert, Isabella Reichert und Frank Wehinger für hilfreiche Kommentare zu einer früheren Version. Ich danke außerdem den Mitgliedern der Forschungsgruppe „Soziologie der Märkte“ am MPIfG für nützliches Feedback. 1 So verlangt der deutsche Schauspieler Götz George 9.000 Euro pro Drehtag (Süddeutsche Zei­ tung vom 2. Juli 2009, <www.sueddeutsche.de/panorama/top-verdiener-in-der-deutschenfilmbranche-1.82643-8>). 2 MPIfG Discussion Paper 12/7 Nicht nur die Einkommen sind ungleich verteilt: Das Gros der Produktionen wird von einer erfolgreichen Minderheit dominiert. Faulkner und Anderson (1987: 894) zeigen, dass 7 Prozent der Regisseure in Hollywood 40 Prozent aller Spielfilme produzieren; nur einen einzigen Film produzieren dagegen fast zwei Drittel. Über 75 Prozent der Regisseure sind im Verlauf ihrer Karriere an nicht mehr als zwei Hollywoodfilmen beteiligt. Zu kennzeichnen sind Winner-take-all-Märkte durch zwei Grundelemente. Erstens vereinen relativ wenige Marktakteure die meisten Erfolgsanteile auf sich. Die Gewinne können derart konzentriert sein, dass die Summen einiger weniger praktisch dem gesamten Volumen des Marktes entsprechen. Zweitens herrscht ein permanentes Überangebot an Akteuren und Talenten, die in diese Märkte hineindrängen und zur Übersättigung der Nachfrage beitragen. Die Überlebenschancen sind damit gering. Die Mehrheit der Akteure ist mit prekärer Beschäftigung, Unterbeschäftigung, branchenferner Arbeit und Arbeitslosigkeit konfrontiert (Menger 1999: 545). Oft bleibt nach einiger Zeit der Erfolglosigkeit und dem Eingestehen derselben nur der Weg, auf alternative Berufswege auszuweichen. Das Zustandekommen solcher Verteilungen zu erklären stellt insbesondere für die ökonomische Standardtheorie eine Herausforderung dar, weil unter perfekten Marktbedingungen keine konzentrierten Erfolge zu erwarten wären (Borghans/Groot 1998: 569). Ganz im Gegenteil resultiert für Frank und Cook (1995: 125ff.) das Starsystem in der sozial ineffizienten Allokation von Talent. Die exorbitanten Gewinne der wenigen Topperformer locken ständig mehr junge Talente an, als die Nachfrage danach bedienen kann. Somit müssen viele nach Alternativen suchen, weil die lukrativen Positionen besetzt und unerreichbar sind. Da die meisten Akteure nach Jahren der Fokussierung für Berufswege zweiter Wahl kein marktrelevant zugeschnittenes Humankapital besitzen – und zudem denen unterlegen sind, die das haben –, stellt das Alles-oder-nichtsPrinzip dieser Arbeitsmärkte ein gesellschaftlich nichteffizientes Marktergebnis her: Es verschwendet Talent. Beispielsweise konkurrieren jedes Jahr Hunderte von Absolventen der Musikhochschulen um die wenigen Positionen in den Ensembles der Orchester. Die intensive musikalische Ausbildung erfordert ein hohes Maß der Spezialisierung an einem Instrument. Die meisten Musikschüler müssen ihr Instrument von der Kindheit an mehrere Stunden täglich spielen, um das für Hochschulen nötige Aufnahmeniveau zu erreichen. Gelingt eine Festanstellung nach dem Studium nicht, sind viele aufgrund mangelnder äquivalenter Alternativen gezwungen, ihre professionellen Musikerkarrie­ ren zu beenden, noch bevor sie überhaupt begonnen haben.2 Hätten sie ihr Talent dagegen von vornherein auf gesellschaftlich besser nachgefragte Arbeitsmärkte verlegt, bliebe ihr Humankapital nicht fehlgeleitet, sondern dem Bedarf optimal angepasst. 2 Vgl. kürzlich in der FAZ unter der Überschrift „Mit dem Instrument in die Sackgasse“ (FAZ vom 7. April 2012). Ein ähnliches Dossier veröffentlichte Die Zeit unter dem Titel: „Das Vorspiel. In Berlin treten junge Kontrabassisten aus der ganzen Welt gegeneinander an: Ein Wochenende lang spielen sie um die einzige freie Stelle des Konzerthausorchesters – und um ihre Zukunft“ (Die Zeit vom 17. Februar 2011). Lutter: Soziale Strukturen des Erfolgs 3 Das Starsystem bewirkt nicht nur die Fehlleitung von Talent, sondern verursacht darüber hinaus Kostenineffizienzen auf der Produktionsseite. Denn die exorbitanten Gehälter der Stars können zur Überschuldung oder Verlusten führen. Vereine wie FC Chelsea London können ihre hohen Spielergehälter zahlen, weil ein Ölmilliardär den Verein ohne ökonomische Gewinnabsichten führt und die verlustreichen Investitionen privat tätigt. In Hollywood zählen die Gagen der Stars mittlerweile zu den größten Kostenfaktoren einer Produktion und können häufig nicht mehr über Einnahmen an den Kinokassen amortisiert werden. Daher stellen die meisten Filme Verlustgeschäfte dar, die über Sekundärmärkte (zum Beispiel Merchandising, Lizenzierungen, Unterhaltungselektronik) ausgeglichen werden müssen. Der Film ist lediglich ein riesiger, kostenintensiver Werbeträger (siehe ausführlich: Leaver 2010; Meier 2008). Wie lassen sich die Bedingungen des Erfolgs auf diesen Arbeitsmärkten erklären? Wie kommt es zu den extremen Unterschieden? Bisherige Ansätze haben das Winner-takeall-Phänomen als Nachfragekonzentration verstanden (Adler 1985; Rosen 1981) und im Wesentlichen auf die Kaufpräferenzen rationaler Konsumenten oder Nachfragern nach Talenten zurückgeführt, die ihre Entscheidungen so stark auf einige wenige „Bestseller“ richten, dass extreme Erfolgskonzentrationen möglich werden (vgl. kürzlich dazu umfassend: Keuschnigg 2012a). Die Anbieterseite, und damit die Frage, welche Konstellationen Erfolg auf der Seite der Akteure des Arbeitsmarktes bedingen, ist bislang kaum Gegenstand dieser Forschung gewesen. Darüber hinaus sind die bisherigen Ansätze disziplinär nahezu ausschließlich im individualistischen Paradigma der ökonomischen Theorie angesiedelt. Obwohl einige der Ansätze durch Modellierung und Hinzunahme sozialer Ansteckungsprozesse gewissermaßen „soziologisiert“ worden sind (Keuschnigg 2012b), so entstehen Winner-takeall-Strukturen aus dieser Perspektive aus der Vielzahl individueller Entscheidungen rationaler Akteure. Die hierarchische Struktur des extrem konzentrierten Erfolgs auf diesen Arbeitsmärkten ist somit als emergentes Resultat der individuellen Präferenzen der Nachfrager sowie aus den Talenten und Qualitäten der angebotenen Produkte zu verstehen. Soziale Ungleichheit ist aus dieser Sicht das quasi natürliche Ergebnis mikromotivationaler Prozesse. Für strukturelle soziologische Ansätze dagegen bestehen die ungleichen Verteilungen nicht als emergentes, aufgekommenes Phänomen, sondern erklären sich aus den unterschiedlichen sozialen Positionen, die Akteure bekleiden, und den sozialen Strukturen, die sie umgeben (vgl. Gould 2002: 1144). Derartige Erklärungsansätze sind, auf das Winner-take-all-Phänomen bezogen, allerdings bislang rar.3 Beispielsweise sind soziale Netzwerkstrukturen noch nicht systematisch in die Erklärungsversuche eingeschlossen 3 Es gibt zwar in der Managementwissenschaft die sogenannte Erfolgsfaktorenforschung, die aber unter anderem deswegen umstritten ist, weil sie die sozialen Strukturen, in die Akteure eines Unternehmens oder einer Branche eingebettet sind, systematisch unbeachtet lässt (March/Sutton 1997; Nicolai/Kieser 2002). 4 MPIfG Discussion Paper 12/7 worden. Somit bleibt unklar, inwiefern soziale Strukturen, in die die individuellen Entscheidungen eingebettet sind, Unterschiede im Erfolg erklären können. Im vorliegenden Beitrag soll das Augenmerk daher primär auf diese soziologisch-strukturellen Erklärungsansätze gelegt und der Frage nachgegangen werden, welche geeignet sein könnten, Erfolgskonzentrationen auf der Seite der Anbieter zu erklären. Der Fokus soll dabei auf der Kreativbranche und dem Arbeitsmarkt für Künstler liegen (Becker 1982; Caves 2000; Florida 2002; Koppetsch 2006, 2008; Menger 1999, 2009). Diese Ausrichtung geschieht aus mehreren Gründen. Zum einen bietet sich die Kreativbranche als Musterbeispiel an, da sich das Phänomen dort häufig und in besonderer Schärfe beobachten lässt. Darüber hinaus knüpft der Beitrag an bestehende ökonomische Erklärungsansätze an, die primär anhand dieser Branche entwickelt wurden. Drittens erzeugt es analytische Kohärenz, wenn die hier diskutierten Ansätze an einem konkreten empirischen Fall orientiert bleiben. Es steht weiterer Forschung offen, diese auf weitere Felder zu übertragen.4 Ziel dieses Artikels ist es, soziologische Ansätze auszuleuchten, mit denen Erfolgsbedingungen und damit mögliche Konzentrationsprozesse aus den sozialen Strukturen heraus erklärt werden können, in die die Akteure des Arbeitsmarktes auf der Anbieterseite eingebettet sind. Ausgehend von einer Diskussion der wichtigsten wirtschaftswissenschaftlichen Erklärungsansätze schlussfolgert die Studie zunächst, dass sowohl Rosen (1981) als auch Adler (1985) sowie diffusionstheoretische Erweiterungen (unter anderen Banerjee 1992) keine ausreichende Erklärung dafür anbieten, welche anfänglichen Mechanismen die Entstehung von Erfolg bedingen (siehe auch Keuschnigg 2012a: 145ff.). Die Erklärungen setzen erst dann ein, wenn bereits eine hinreichende Masse an Nachfragern ihre Konsumentscheidung angeglichen hat. Diffusionstheoretische Ansätze modellieren die weitere Zunahme von Nachfragekonzentration. Welche ursächlichen Primärmechanismen jedoch den Erfolg bedingen, ist darin nicht zu erklären. Genau hier setzt der vorliegende Artikel an und versucht, soziologische Konstellationen und Bedingungen auf der Seite der Anbieter heranzuziehen, mit denen die Entstehungsbedingungen ungleichen Erfolgs erklärt werden können. Insgesamt werden sechs Ansätze aus der neueren Wirtschaftssoziologie und der soziologischen Ungleichheitsforschung dargestellt. Die Ansätze umfassen (1) Erfolgsbenach­ teiligungen aufgrund von askriptiven Ungleichheitsprozessen und allokativen Opportunitätsstrukturen für Diskriminierungen, (2) kumulierte Vorteile oder „Matthäus-Effekte“, (3) Netzwerkstrukturen und die „Stärke schwacher Beziehungen“, (4) Nischen­ abdeckung und Rollenausdehnung als Erfolgsfaktoren, (5) organisationale Heterarchie in kreativen Gruppenprozessen und schließlich (6) Statushomogamien bei der Zusammenstellung kreativer Teams. 4 Für soziologische Ansätze, die sich auf Erklärungen des Winner-take-all-Phänomens unter Managern beziehen, sei auf weitere interessante Forschung verwiesen: DiPrete/Eirich/Pittinsky (2010), Godechot (2008, 2012), Rost (2010). Lutter: Soziale Strukturen des Erfolgs 5 Der Aufsatz versteht sich als ein wirtschaftssoziologischer Beitrag zur sozialen Ungleich­ heitsforschung auf flexiblen Arbeitsmärkten, in denen hochgradig konzentrierte Ungleichverteilungen von Erfolg bestehen. Die Arbeit liefert eine erste Bestandsaufnahme, wie soziologische Ansätze zur Erklärung von Erfolg genutzt werden können. Sie bildet damit einen Ausgangspunkt für weitere empirische wie theoretische Analysen. Aufgebaut ist der Aufsatz wie folgt: Zunächst wird kurz der bisherige Forschungsstand zur Erklärung extremer Erfolgskonzentrationen referiert. Im Anschluss daran wird jeder der sechs soziologischen Ansätze vorgestellt. Dabei wird zuerst die allgemeine theoretische Logik des Ansatzes betrachtet, anschließend die bisherige relevante empirische Forschung diskutiert. Jeder Abschnitt schließt mit einer Hypothese, die die Erklärungen jeweils zusammenfasst. Im Schlussteil werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengetragen und ihre Implikationen für zukünftige (empirische) Forschung ausgelotet. Der Artikel endet mit dem kurzen Anriss einer Reihe weiterer Forschungsfragen, die dafür plädieren, für eine mikrofundierte Erklärung des Winner-take-all-Phänomens die Untersuchung der Karrieremotive der Akteure in den Vordergrund zu rücken. 2Forschungsstand: Winner-take-all-Märkte als Nachfragekonzentration Das Winner-take-all-Phänomen wurde erstmalig durch Sherwin Rosen (1981) einer systematischen Erklärung unterzogen und später wesentlich durch Adler (1985) erweitert. Beide Ansätze konzentrieren ihre Erklärungen des Phänomens auf die Nachfrageseite der Kultur- und Medienwirtschaft. Weitere Autoren haben diese Modelle modifiziert, aber in ihren Grundlagen nicht wesentlich verändert (Franck/Nüesch 2012; Lazear/Rosen 1981; MacDonald 1988; Rosen 1986). Es ist daher sinnvoll, die zwei grundlegenden Ansätze von Rosen und Adler näher zu betrachten. Unter der Annahme rationaler Konsumenten und vollständiger Informationen identifiziert Rosen zwei Ursachen für die Entstehung des Superstarphänomens auf Kulturgütermärkten (Rosen 1981: 846f.). Zum einen wird die Nachfragekonzentration auf Effekte unvollständiger Substitutionen der auf dem Markt angebotenen Güter zurückgeführt, zum anderen auf die kostengünstige massenhafte Vervielfältigung der kulturellen Güter, die im Zuge technischer Entwicklungen zunehmend möglich wird. Beide Sachverhalte wollen kurz erläutert werden. Die Grundannahme des Ansatzes ist, dass sich rationale Konsumenten bei ihrer Wahl zwischen Gütern der gleichen Kategorie für die Produkte oder Leistungen entscheiden, die mit der besten Qualität versehen sind. Ausschließlich diese wollen sie nachfragen und konsumieren. Die typischerweise in den Kultur- und Kreativindustrien hergestellten Güter besitzen die Eigenschaft, keine oder unvollständige Substitutionsmöglichkeiten im Hinblick auf ihre Qualität zu bieten. Mit anderen Worten, Produkte von minderer Qualität bilden nur sehr mäßigen 6 MPIfG Discussion Paper 12/7 Ersatz für Güter mit Spitzenqualität. Beispielsweise addiert sich das Lesen mehrerer schlechter Romane nicht auf ein hochwertiges Buch; die musikalische Darbietung vieler mittelmäßiger Orchester ersetzt nicht die Qualität des Spitzenensembles. Die unvollständige Substituierbarkeit allein reicht allerdings noch nicht aus, um die extremen Konzentrationen auf diesen Märkten hinreichend zu erklären. Es muss ein zweiter Aspekt hinzukommen: die technische Reproduzierbarkeit künstlerischer Werke. Diese sorgt für eine weltweite Verbreitung bei gleichbleibenden Kosten. Erst darüber wird der Zugang zur bestmöglichen Qualität über lokale Grenzen hinweg fast unbegrenzt ermöglicht. So sind Musikdarbietungen heutzutage nicht mehr an einen Konzertort gebunden. Auf Ton- und Bildträger gepresst, digital verarbeitet und angeboten, können sie weltweit ohne wesentliche Mehrkosten verbreitet und nachgefragt werden. Die Nachfrage konzentriert sich unter diesen Bedingungen vollständig auf die besten der am Markt verfügbaren Produkte, Talente und Darbietungen. Die Anbieter an der Spitze vereinen die gesamte Nachfrage auf sich und beginnen, den Marktabsatz zu dominieren. Sie können Premiumbeträge für ihre Güter und Dienstleistungen verlangen, für die die Nachfrager zu zahlen bereit sind. Eine wesentliche Voraussetzung dieses Erklärungsmodells ist neben der Präferenz der Nachfrager für die beste Qualität ihre vollständige Information darüber, welche Angebote tatsächlich Spitzenqualität besitzen. Während dies im Sport noch objektiv zu ermitteln ist,5 besitzen Güter aus künstlerischer Arbeit grundsätzlich streitbare Qualitäten. So erschließt sich die Qualität eines Kunstwerks nicht mehr, wie noch beim Handwerker-Künstler im Altertum und Mittelalter (Müller-Jentsch 2005: 162), anhand der handwerklichen Arbeitszeit oder den Kosten des Verwendung findenden Materials. Auch nicht die reine Seitenzahl oder die Feinstruktur des Papiers sind ausschlaggebend für die Qualität eines Romans, ebenso wenig Inhalt und Form der erzählten Geschichte. Anhand objektiver oder objektivierbarer Kriterien lässt sich ihre Qualität nur grob ermitteln. Aufgrund der Singularität der angebotenen Produkte entzieht sich Qualität vielmehr der Objektivierbarkeit (Karpik 2010). Stattdessen ist sie zuhöchst variabel, weil sie erst durch soziale Akteure im Feld der Kunst oder der Literatur auszuhandeln ist und erstritten, definiert und hergestellt werden muss (Beckert/Aspers 2011). Damit können Qualitätsurteile Moden, Meinungen und Marktmächten unterliegen, sind nie universell gültig, sondern abhängig von Kontext und Zeit. Entsprechend zeigt eine Studie über den Kunstmarkt, wie das, was als wertvoll gilt, durch Kritikerurteile im Feld der Kunst sozial konstruiert wird und als Qualitätsmarker die subjektiven Urteile der Nachfrager leitet (Beckert/Rössel 2004: 34). Künstlerische Güter sind zudem mit Lernkosten verbunden und offenbaren ihre Qualität erst nach einiger Zeit der Beschäftigung mit ihnen oder dem Genre, dem sie entstam5 So findet nach Keuschnigg (2012a: 88) das Modell von Rosen für Superstarphänomene im Sport die beste Anwendung. Lutter: Soziale Strukturen des Erfolgs 7 men. Ihre Qualität muss erst zu schätzen gelernt werden. Bücher sind beispiels­weise Erfahrungsgüter, deren Qualität sich für die Konsumenten nicht beim Kauf, sondern erst nach ihrem Konsum zeigt (Keuschnigg 2012b: 16). Die Qualität einer komplexen, frei atonalen Aufführung eines Ensembles im Bereich Neuer Musik erschließt sich dem Konsumenten nur durch ein entsprechend geschultes Ohr und das angelernte Wissen über die historische und musikalische Bedeutung der Zwölftonmusik. Kurz, es bedarf eines notwendigen Maßes an kulturellem Kapital, das die Qualitätsbeurteilung erst ermöglicht. Die individuelle Konsumentscheidung ist damit in hohem Maße sozial vorstrukturiert (Bourdieu 1985; Rössel 2009; Rössel/Bromberger 2009). Der Ansatz von Rosen ist also nur im theoretischen Modell rationaler und vollständig über Qualitätsmaßstäbe informierter Akteure zu verstehen. Empirisch ist dies eine sehr strikte Annahme. Tatsächlich zeigt sich sogar, dass oft jene Angebote Erfolg haben, die von anerkannten Experten nicht zur besten Qualität gezählt werden. So ist es regelmäßig zu beobachten, dass Romane, die von der Literaturkritik einhellig missbilligt werden, dennoch die Bestsellerlisten wochenlang anführen. Blockbusterfilme zählen in der Regel nicht zu den Werken, die mit den Preisen der Kritikerfestivals ausgezeichnet werden. Dennoch erzielen sie an den Kinokassen die meisten Kartenverkäufe. Für dieses Problem bietet sich das Erklärungsmodell nach Adler (1985) an. Es lässt explizit von der Annahme ab, Qualität sei für Konsumenten vollständig informativ verfügbar, objektiv gegeben oder im Konsens durch alle Akteure anerkannt. Im Gegenteil, so Adler, sei Erfolg gerade wegen der unklaren Qualitätszuordnungen möglich. Der Grund liegt darin, dass für Käufer hohe Lern- und Suchkosten entstehen, wenn Informationen zur Qualität unklar sind. Zudem erhöht sich der Lern- und Suchaufwand, wenn der Konsumnutzen eines künstlerischen Produktes mit der Erfahrung des Konsumenten über das Genre und das künstlerische Feld steigt. Um diese Kosten letztlich gering zu halten, richten rationale Konsumenten ihre Kaufentscheidung auf genau jene Genres oder Künstler, die bereits die größte Popularität besitzen. Sie passen ihre Kaufentscheidung damit den Präferenzen anderer an und kaufen die Angebote, deren Nachfrage bereits hoch ist. Dies lässt sich dann diffusionstheoretisch dergestalt fassen, dass durch herdenartige Ansteckungsprozesse und Informationskaskaden die Nachfrage bis ins Unermessliche gesteigert wird, sobald eine ausreichende Menge anderer Akteure das Gut bereits nachfragt oder für qualitativ hochwertig einschätzt und dies meinungsbildend kommuniziert (Banerjee 1992; Bikhchandani et al. 1992; Granovetter 1978; Keuschnigg 2012b; Lutter 2010b; Rossman 2012). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl Rosen als auch Adler sowie diffusionstheoretische Erweiterungen vor allem auf die Konsumentenseite bezogen sind und Erklärungen aus der Perspektive der Nachfrageseite bieten. Die Mechanismen auf dem Arbeitsmarkt der Künstler selbst sind daher bislang nicht einbezogen worden. Die Anbieterseite wird insofern berücksichtigt, als technische Entwicklungen die Voraussetzungen für extreme Nachfragekonzentration schaffen, nicht aber als direkte Erklärungen selbst herhalten. Auch liefern diese Ansätze keine Erklärung über die anfängli- 8 MPIfG Discussion Paper 12/7 che Entstehung von Erfolg. Die Erklärung nach Adler setzt erst dann ein, wenn bereits eine hinreichende Masse an Nachfragern ihre Konsumentscheidung angeglichen hat. Diffusionstheoretische Ansätze modellieren zwar den Ausbreitungsverlauf, liefern aber keine Erklärung dafür, wann und wodurch kritische Werte erreicht werden, die dann Nachfragekonzentrationen erzeugen. Es fehlen also die theoretischen Mechanismen, die anfängliche Erfolgsunterschiede bedingen und dann Potenzial für Erfolgskonzen­ trationen freisetzen. Im Folgenden soll daher die Anbieterseite betrachtet und der Frage nachgegangen werden, welche soziologischen Perspektiven die Entstehungsbedingungen für Erfolg und damit die Voraussetzungen für Konzentrationsprozesse in der Kreativbranche zu erklären imstande sind. 3 Die Entstehung von Erfolg: Soziologische Ansätze Askriptive Ungleichheiten auf Kreativarbeitsmärkten Bei dem Winner-take-all-Phänomen handelt es sich insbesondere deshalb im Kern um ein Problem sozialer Ungleichheit, weil sich das Verhältnis von Leistung und Erfolg stark auseinanderbewegt hat. Superstarphänomene weisen eine hochgradige Entkopplung von Leistung und Erfolg auf. So ist es nicht ungewöhnlich, dass die Erfolgreichsten gut das Hundertfache vom Durchschnitt verdienen, diese Summe allerdings nicht durch hundertfach größeres Talent gerechtfertigt ist. Sighard Neckel und Kai Dröge, die sich mit dem Winner-take-all-Phänomen beschäftigt haben (Neckel 2001, 2008; Neckel/Dröge 2003), fassen es daher zu Recht unter dem Begriff der „Gelegenheitsökonomien“ und betonen, dass nicht Leistung über Markterfolg entscheidet, sondern nonmeritokratische Faktoren wie günstige Gegebenheiten, Marktlage und „zur richtigen Zeit am richtigen Ort“ zu sein. Es ist daher sinnvoll, zur Erklärung des Phänomens zunächst die soziologische Ungleichheitsforschung heranzuziehen. Ohne Frage zählt innerhalb dieser Forschung die Untersuchung der Ursachen und Auswirkungen askriptiver Mechanismen auf Lebensverläufe und Arbeitsmarktchancen zu den wichtigsten Gegenstandsbereichen. Neben Benachteiligungen ethnischer Minoritäten oder aufgrund des Alters oder der sozialen Herkunft ist insbesondere geschlechtsspezifische Ungleichheit ein zentrales Thema (England 2005; Fernandez-Mateo 2009; Fernandez/Sosa 2005; Fernandez/Abraham 2011; Pager/Shepherd 2008). Petersen und Saporta (2004) liefern in ihrer grundlegenden Analyse einen ordnenden Überblick zum gegenwärtigen Forschungsstand und verweisen dabei insbesondere auf Mechanismen allokativer Diskriminierung als wesentliche Opportunitätsstruktur askriptiver Ungleichheitsprozesse auf Arbeitsmärkten. Diese Form ist besonders bedeutend auf Arbeitsmärkten in den Kreativbranchen (Lutter 2012a). Angehörige benach- Lutter: Soziale Strukturen des Erfolgs 9 teiligter Gruppen werden nach diesem Modell durch allokative Prozesse über Zeit von den relevanten Ressourcen zur Erzeugung von Erfolg systematisch ausgeschlossen. So führen Diskriminierungen, deren Existenz die Autoren als gegeben voraussetzen, bei Einstellungen, Beförderungen oder Kündigungen zur schrittweisen Verdrängung von Frauen oder Minoritäten aus den höheren Hierarchieebenen oder den erfolgreichen Positionen. Stattdessen werden sie in Bereiche gedrängt, die dauerhaft geringer entlohnt sind oder geringere Erfolgsmöglichkeiten bieten. In den Kreativindustrien ist diese Form zum einen wegen des Fehlens einklagbarer Gleichstellungsstandards verbreitet. Die Kreativbranchen sind in aller Regel keine internen, sondern extern strukturierte Arbeitsmärkte und bieten überwiegend zeitlich befristete Tätigkeiten, die in Projektteams realisiert werden. Dieser von Boltanski und Chiapello unter der „projektbasierten Polis“ (Boltanski/Chiapello 2003: 147ff.) gefasste oder als „adhocracy“ (Faulkner/Anderson 1987: 880; Mintzberg 1979) bezeichnete, hochgradig flexible Form der Arbeit fehlen Instanzen, die potenzieller Diskriminierung rechtlich entgegenwirken könnten. Zum anderen sorgt das sehr hohe Allokations- und Fluktuationsaufkommen dieser Märkte dafür, dass es strukturell viel mehr Gelegenheiten für Diskriminierungen gibt. Die Kreativbranche zeichnet sich durch ein sehr hohes Allokationsaufkommen aus, weil Projektteams permanent neu besetzt, zusammengestellt und aufgelöst werden (müssen). So dauern Engagements für Schauspieler in aller Regel zwischen wenigen Tagen und mehreren Monaten. Nach Abschluss der Dreharbeiten widmet sich das Ensemble neuen Projekten und alle Teammitglieder gehen ihre eigenen Wege. Projektarbeitsmärkte sind zudem häufig durch einen hohen Grad an informellen Prozessen bei der Rekrutierung von Personal gekennzeichnet (Eikhof/Haunschild 2007: 528). Über die rein fachlichen Qualitäten hinaus können dann partikulare statt meritokratische Beurteilungen relevant werden (Apitzsch 2010: 81). Sind die Entscheidungsträger dazu überwiegend männlich, so können sich derartige informelle Strukturen im Auswahlprozess negativ für Frauen auswirken. Die informelle Rekrutierungskultur der Kreativbranche gäbe somit strukturell größere Möglichkeiten zur systematischen geschlechts- oder minoritätenspezifischen Benachteiligung. Tatsächlich belegen Studien, dass askriptive Mechanismen sozialer Ungleichheit auf projektbasierten Arbeitsmärkten eine Rolle spielen. Filmproduzenten und Regisseure sind in der Filmbranche die wesentlichen Entscheidungsträger – und sie sind häufig männlich (Levy 1989: 36). Ähnliches konstatiert Apitzsch (2010: 73f.) für den Bereich Kamera. Auch Drehbuchautoren, also diejenigen, die die Rollen schaffen und mit ihrem Filmskript die Anzahl weiblicher Rollen festlegen, sind zu 80 bis 90 Prozent männlich (Bielby/Bielby 1996: 254). Bielby und Bielby (1996) zeigen auch, dass weibliche Autoren über ihre gesamte Karriere hinweg kontinuierlichen Benachteiligungen ausgesetzt sind und im Vergleich zu männlichen Autoren deutlich geringere Erfolgschancen aufweisen. Für Filmschauspieler bestätigt sich, dass Frauen – bei Gleichhaltung verschiedener re- 10 MPIfG Discussion Paper 12/7 levanter Faktoren wie Berufserfahrung und Erfolg – eine signifikant geringere Überlebenschance haben als ihre männlichen Kollegen (Lutter 2012a). Lincoln und Allen (2004) argumentieren in ihrer Studie, dass geschlechtsspezifische Ungleichheit mit weiteren askriptiven Faktoren eine Negativspirale in Gang setzen kann, die dann Benachteiligungen insgesamt verstärkt. Die Studie weist für die Filmbranche Interaktionen zwischen alters- und geschlechtsspezifischen Diskriminierungen nach und zeigt, dass sowohl Frauen als auch ältere Akteure Benachteiligungen in ihren Chancen auf Erfolg erfahren, die Benachteiligungen jedoch besonders hoch sind, wenn beide Merkmale zusammentreffen. Die Erfolgsunterschiede von Frauen verstärken sich somit im Alter, sodass die älteren Frauen die geringsten Chancen auf Erfolg haben und strukturelle Benachteiligungen erfahren. Daraus ergibt sich Hypothese H1: H1:Allokative Diskriminierungsprozesse führen zur systematischen Benachteiligung von Frauen und Angehörigen von Minoritäten und reduzieren die Chancen auf Erfolg, während nicht benachteiligte Gruppen dadurch höhere Chancen auf Erfolg besitzen. Allerdings lassen sich Beispiele finden, in denen Frauen mit zunehmender Karrieredauer immer größeren Erfolg ansammeln. So belegt die oben angeführte Studie zu den Karrieren von Filmschauspielern (Lutter 2012a), dass Benachteiligungen zwischen Geschlechtern sich auf ein statistisch nicht mehr von null zu unterscheidendes Niveau reduzieren, sofern Frauen in der Lage sind, sichtbare Erfolge in Form von Filmpreisen zu sammeln. Wenn also strukturelle Benachteiligungen durch diskriminierende Auswahlprozesse über andere Mechanismen ausgeglichen werden können, so muss die Erklärung ungleichen Erfolgs durch weitere Ansätze angereichert werden. Kumulierte Vorteile oder „Matthäus-Effekte“ Ein solcher Ansatz aus der soziologischen Ungleichheitsforschung ist die Theorie kumulierter Vorteile (DiPrete/Eirich 2006), welche einen Mechanismus beschreibt, mit dem es möglich wird, das Zustandekommen extremer Erfolgsverteilungen zu erklären. Der Ansatz ist als „Matthäus-Effekt“ bekannt und geht auf Robert K. Mertons Essay über den Erfolg von Wissenschaftlern und die Rolle von Zitationshäufigkeiten und Reputation zurück (Merton 1968; Neckel et al. 2010: 448ff.; Zuckerman 2010).6 In einer klassischen empirischen Studie zu diesem Thema zeigen Allison et al. (1982: 617), dass Publikationserfolge unter Wissenschaftlern im Karriereverlauf immer ungleicher werden. Bei jungen Kohorten bestehen noch keine großen Unterschiede, aber 6 Der Name versteht sich als Anlehnung an das Gleichnis von den anvertrauten Talenten aus dem Matthäus-Evangelium: „Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er hat“ (Mt 13:12). Lutter: Soziale Strukturen des Erfolgs 11 mit steigender Berufserfahrung konzentriert sich der Erfolg zunehmend. Ältere Kohorten zeichnen sich dann durch große Unterschiede aus: Während die Masse der etablierten Wissenschaftler relativ wenige Publikationserfolge aufweist, ist nur eine kleine Anzahl der Wissenschaftler sehr erfolgreich. Die Theorie kumulierter Vorteile nimmt an, dass gegenwärtige Erfolge durchschnittlich häufiger nicht durch aktuelle Leistungen, sondern durch früher bereits erlangte Gewinne erzielt werden. Der Grund liegt darin, dass Erfolg Aufmerksamkeit hervorruft, die wiederum neue Ressourcen ermöglicht, womit das Erzielen weiterer Erfolge wahrscheinlich wird. So werden bei Wissenschaftlern Publikationserfolge durch bessere Laborausstattung, mehr Mitarbeiter, weniger Lehre, mehr Forschungsfreisemester etc. belohnt, womit weitere Erfolge ermöglicht werden. Durch diese Rückkopplungseffekte stellt zukünftiger Erfolg eine Funktion des früher bereits erlangten dar. Unter den Bedingungen dieses Verlaufs nehmen die Erfolgsunterschiede zwischen Akteuren extreme Ausmaße an. Aus kleinen anfänglichen Vorteilen können im Zeitverlauf sehr große Unterschiede heranwachsen, obwohl sich Akteure in ihrem Talent, ihrer Produktivität oder Qualifizierung wenig unterscheiden. Die Anerkennungen, die den erfolgreichen Akteuren entgegengebracht werden, verstärken die Ungleichheit zusätzlich, weil Anerkennungen der erfolgreichen Akteure eine höhere soziale Akzeptanz und Aufmerksamkeit erfahren und damit den Erfolgreichen weiteren Status verleihen (Gould 2002: 1146). Der Matthäus-Mechanismus perpetuiert sich damit nicht nur auf der Ebene der Ressourcen- und Machtausstattung, sondern durch soziale Zuschreibungsprozesse auch auf der Ebene der Aufmerksamkeit. Während für die Erfolgreichen damit soziale Aufwärtsspiralen weiterer Anerkennung entstehen, stagniert die Zahl der Erfolge für die weniger Erfolgreichen, die ohne neue Erfolge keine weiteren erzielen können. Leistung und Erfolg driften infolgedessen auseinander. Es ergeben sich soziale Schließungsprozesse, die die Gewinne stabil auf die wenigen erfolgreichen Akteure konzentrieren. Auch hier wieder lässt sich annehmen, dass diese Mechanismen besonders virulent sind auf Arbeitsmärkten, in denen permanente „Kraftproben“ (Boltanski/Chiapello 2003: 361) Reputationsordnungen entstehen lassen, die Exklusivität und Qualität konstruieren und als Realität sui generis einen wesentlichen Einfluss auf Erfolg nehmen. So generiert sich in der Wissenschaft Reputation aus mit dem richtigen Impactfactor versehenen Publikationserfolgen und Zitationshäufigkeiten (Münch 2010); in der Filmbranche aus erfolgreich abgeschlossenen Filmprojekten und der Akkumulation von Filmpreisen (Lutter 2012a); in der Werbe- und Medienbranche über Ideenwettbewerbe und Preisvergaben (Koppetsch 2006, 2008). Allgemein lässt sich aus dieser Diskussion daher die folgende These aufstellen: H2:Früherer Erfolg bestimmt zukünftigen Erfolg. Akteure, die frühzeitig mehr Erfolg für sich akkumulieren können, haben unabhängig von ihrer aktuellen Leistung und Produktivität größere Aussicht auf zukünftige Erfolge. 12 MPIfG Discussion Paper 12/7 Netzwerkeinbettung und die Stärke schwacher Beziehungen Ein dritter soziologischer Ansatz zur Erklärung von Winner-take-all-Verteilungen lässt sich aus der sozialen Netzwerkforschung ableiten. Hier stellt insbesondere das von Mark Granovetter geprägte Konzept von der „Stärke schwacher Beziehungen“ (Granovetter 1973, 1974) sowie die Weiterführungen durch Ronald Burt im Konzept des „structural hole“ (Burt 1992, 2004, 2005) ein Modell zur Erklärung von Erfolgsungleichheiten dar. Das Konzept besagt, dass jene Akteure, die über ein breites Netzwerk loser, schwacher oder unregelmäßiger Beziehungen verfügen, bessere Ressourcenzugänge und damit potenziell größeren Erfolg haben, als Akteure, die in dichten Netzwerken mit regelmäßigen Kontakten eingebunden sind. Der Grund liegt darin, dass Akteure mit vielen schwachen Kontakten über einen breiteren Informationspool verfügen und einer größeren Variationsvielfalt unterschiedlichster Anschauungen, Traditionen, Ressourcen und Kontakten ausgesetzt sind, die für die Akquise neuer Projekte und Tätigkeiten genutzt werden können. Akteure in engen Netzen haben dagegen einen eingeschränkten Diversifikationsgrad. Die Erfolg mindernde Eigenschaft dichter Netzwerkeinbettung verschärft sich durch mehrere Aspekte. Zum einen monotonisieren Tendenzen sozialer Homophilie den ohnehin eingeschränkten Informations- und Ressourcenpool weiter. Soziale Homophilie ist die in der Netzwerkforschung thematisierte Eigenschaft, dass sich Personen, die einander bekannt sind und in häufigem Kontakt zueinander stehen, in ihren Meinungen, Einstellungen und im Verhalten angleichen und jedem einzelnen Mitglied ein geringeres Maß sozialer Abweichung gewähren (McPherson et al. 2001). Enge Netze sind durchschnittlich häufiger homogen und haben einen eingeschränkteren Zugang zu alternativen Meinungen, sanktionieren abweichende Meinungen stärker durch ein höheres Maß sozialer Kontrolle und sind folglich devianten Verhaltensweisen weniger häufig ausgesetzt. Versiegen die Ressourcen, sind Angehörige kohäsiver Kreise weniger gut abgesichert. Denn bricht ein Teil des Netzes weg, so bleiben nicht viele Alternativverbindungen, die für den Ressourcenzugang genutzt werden können. Für Akteure mit vielen, aber zwangsläufig schwächeren Beziehungen stellen im Fall des Wegbrechens genügend weitere Netze die Versorgung mit überlebenswichtigen und Erfolg bestimmenden Informationen sicher, mit denen neue Ressourcen und damit Überleben und Erfolg gesichert werden können. Die Ausbreitung des eigenen Netzwerkes bewirkt also die Diversifikation des Risikos – je breiter das Netzwerk, desto geringer das Ausfallrisiko. Gerade für projektförmig organisierte Arbeit hat die Forschung auf informelle Rekru­ tierungspraktiken und die Rolle von Netzwerken hingewiesen (vgl. Apitzsch 2010, 2012; Eikhoff/Haunschlid 2007; Gottschall 1999; Henninger/Gottschall 2007; Jones 1996; Mathieu 2012; McKinlay/Smith 2009). Das „unternehmerische Selbst“ (Bröckling 2007) – so eine Schlussfolgerung dieser Forschung – ist auf Netzwerkvielfalt angewiesen. Meh- Lutter: Soziale Strukturen des Erfolgs 13 rere empirische Studien haben diese Zusammenhänge quantitativ untersucht. Giuffre (1999) erfasst die professionellen Netzwerke zeitgenössischer Fotografen in New York über einen Zeitraum von elf Jahren und zeigt, dass jene den größten Erfolg entwickeln, die in größere Netzwerke mit losen Bindungen zu Galerien und Kunstvermittlern eingebunden sind. Diejenigen dagegen, die wiederkehrend mit den gleichen Galeristen zusammenarbeiten, die also in wenige engmaschige Netze eingebunden sind, weisen deutlich geringere Erfolgschancen und prekäre Daseinsbedingungen auf. Die Studie belegt damit empirisch, dass Künstlerkarrieren weniger vom individuellen Talent per se abhängig sind, sondern von der strukturellen Position im sozialen Gefüge. Wenn aber individuelle Karriereerfolge von der strukturellen Netzwerkposition abhängen, dann besagt dies, dass jede Änderung im Netzwerk auch veränderte Karrierebedingungen für jeden Einzelnen hervorruft. Fallen zentrale Knoten weg, so wandelt dies die Struktur des Netzes dahin gehend, dass das Beziehungsgeflecht aller Akteure betroffen oder berührt wird. Karriere ist dann mit Giuffre (1999) nicht atomistisch, als linear verlaufende Karriereleiter zu verstehen, vielmehr als Sandhaufen, auf dem der Karriereverlauf eines jeden Akteurs Veränderungen im Gesamtsystem verursacht, die wiederum Einfluss auf die Karrierechancen jedes einzelnen nehmen können. Erfolg hängt damit mehr von den sozialen Strukturen des gesamten Gewebes ab als von den individuellen Talenten (siehe dazu ähnlich für den Karriereerfolg von Malern: Accominotti 2009). Eine weitere paradigmatische Studie findet sich bei Uzzi und Spiro (2005), die die Künstler-Teams von Broadway-Musicals im Hinblick auf ihre Zusammensetzung und ihren Erfolg untersuchen. Zentrales Ergebnis dabei ist, dass der künstlerische Erfolg der Produktion eine umgekehrt u-förmige Funktion der Netzwerkdichte des Teams darstellt. Gemessen an der Anzahl früherer Gelegenheiten zur Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern steigen zunächst die Erfolgschancen auf ein Maximum an, um dann rapide abzusinken. Bei zu hoher Einbettung sinken damit die Vorteile enger Netzwerke, ihre positiven Wirkungen kehren sich ins Gegenteil. Dies stellt eine indirekte Bestätigung der These Granovetters dar: Um Erfolg zu erzielen, sind Akteure zwar einerseits auf den Informationsfluss durch frühere Kontakte angewiesen, jede Über-Einbettung aber verhindert die Chancen auf Erfolg. Ähnlich zeigt Rost (2011), dass der mittlere Einbettungsgrad den besten Einfluss auf kreative Innovationsfähigkeit hat. Teams benötigen eine relevante Mindestanzahl an starken Beziehungen und wiederholten Kollaborationen, zugleich eine hinreichende Menge schwacher Beziehungen. Nur dann, so das Argument der Studie, kann sich die positive, informationsfördernde Kraft schwacher Beziehungen überhaupt entfalten, weil starke Beziehungen ausreichend Stabilität vermitteln. Sofern also keine Unter- oder Über-Einbettung vorliegt, wirken beide Pole im Kreativitätsfluss komplementär zueinander und bestärken sich gegenseitig in ihren positiven Eigenschaften (vgl. auch: Cattani/Ferriani 2008; Ferriani et al. 2009). Daraus ergibt sich die folgende Annahme: 14 MPIfG Discussion Paper 12/7 H3:Bei hinreichender Zahl schwacher Beziehungen wachsen die Chancen auf Erfolg mit Zunahme kohäsiver Netzwerke auf ein Maximum und sinken dann mit jeder weiteren Steigerung in der Dichte der Einbettung. Erfolg als Rollenausdehnung Ein vierter Ansatz bezieht marktsoziologische Forschung aus dem Bereich der Organisationsökologie ein (vgl. grundlegend: Hannan/Carroll 1992; Hannan/Freeman 1977, 1993), die sich in zahlreichen Studien mit den Auswirkungen sozialer Positionen, Rollen- und Kategorienzugehörigkeiten auf Marktordnungen, Gründungs- und Mortalitätsraten sowie Markterfolg in Populationen unternehmerischer Organisationen oder Individuen beschäftigt. Ein gut bestätigter Befund dieser Forschungsrichtung ist, dass Generalisten, also Akteure mit breiter Nischenausdehnung Marktnachteile erfahren, während Akteure mit geringer Ausdehnung und fokussierter Identität (Spezialisten) bessere Chancen auf Erfolg und Überleben am Markt haben (Carroll et al. 2002; Carroll/Swaminathan 2000; Dobrev et al. 2001; Hsu 2006; Hsu et al. 2009). Erstens liegt ein Grund darin, dass mit steigender Ausdehnung der Durchdringungsgrad jeder einzelnen angesprochenen Kategorie notwendigerweise beschränkt sein muss. Jedes Genre hat unterschiedliche Anforderungen, Kulturtechniken, Traditionen und soziale Anhängerschaften, deren Ziele und Erwartungen über verschiedene Genres sogar entgegengesetzt sein können. Der Erwartungs- und Anforderungsdruck ist bei hoher Ausdehnung damit hoch. Zweitens ist die Legitimität beim Publikum gering, weil keine klaren Zuordnungen erkennbar sind. Marktakteure mit breiter Ausdehnung haben gegenüber Spezialisten den Nachteil, dass sie jede einzelne Kategorie nicht mit der gleichen Intensität und Ressourcenausstattung nutzen können. Damit bieten sie tendenziell geringere Qualität und Service an. Ein Musiker, der zugleich Klassik, Popmusik und Jazz produziert, wird in jedem einzelnen Genre weniger Legitimität und Erfolg erfahren, weil zwangsläufig nicht jede Kategorie mit der vollen Ausstattung und Energie bearbeitet werden kann. Zudem entstehen beim Genrepublikum Ungewissheiten und Zweifel über Qualität oder Eignung. Ein dritter Grund liegt darin, dass mit größerer Ausdehnung eine verschlechterte Position im Wettbewerb herrscht, weil Generalisten in jeder einzelnen Kategorie durch Konkurrenten mit besserer Durchdringung und Ressourcenallokation übervorteilt werden können. Mit jeder weiteren abgedeckten Kategorie nimmt die Zahl der Konkurrenten insgesamt zu – und die Erfolgswahrscheinlichkeit ab. Spezialisten hingegen beschränken sich auf eine Kategorie, füllen diese aber mit größter Intensität aus. Sie können sämtliche Ressourcen dem Ausbau dieser Nische zuwenden. Hierdurch stoßen sie bei den Nachfragern auf größere Legitimität und schaffen eine Lutter: Soziale Strukturen des Erfolgs 15 Identität, die ihren Erfolg steigern kann. Ebenso sind sie gegenüber Konkurrenten besser geschützt, da sie über Informations- und Erfahrungsvorteile verfügen, ihren Markt „kennen“, und aufgrund ihrer Spezialisierung bessere Qualität anbieten können. Sie durchdringen ihre Kategorie. Etablieren sie eine Marke, das heißt, füllen sie die Nische mit ihrem Produkt derart, dass die gesamte Nische ausschließlich mit dem Anbieter gleichgesetzt wird und das Markenprodukt zur „sozialen Tatsache“ reift (Hellmann 2003), dann kann die Marktnachfrage fast vollständig auf sich vereint, der Erfolg monopolisiert und maximale „Monopolrenten“ daraus gezogen werden. Tatsächlich bestätigen Untersuchungen auf Kreativmärkten diese Zusammenhänge. So schließen Zuckermann et al. (2003) aus einer Studie über Filmkarrieren von Schauspielern, dass Filmakteure ihre Chancen auf Erfolg erhöhen, wenn sie ihre Karriere mit einer eng fokussierten Identität beginnen, also eine bestimmte Nische ausfüllen und sich darin einen Namen machen. Allerdings, so zeigen die Autoren, birgt das die Gefahr, sich mit der eng ausgerichteten Identität zu sehr auf eine Kategorie zu verlassen. Besonders in der volatilen Filmbranche, in der sich Moden, Geschmack und Kategorien sehr schnell ändern können, besteht die Gefahr, mit einem zu engen Fokus abgehängt zu werden. Die erfolgreichsten Akteure verlassen daher ihre enge Fokussierung und dehnen ihre Ausrichtung auf weitere Genres aus. Dies ist konsistent mit Dobrev et al. (2001), die betonen, dass auf Märkten mit (noch) unklaren oder schnelllebigen Kategoriensystemen eine breite Kategorienausdehnung insofern vorteilhaft sein kann, als sie die Anpassungschancen in sich rasant verändernden Umwelten erhöht. Spezialisten können also dort Nachteile haben, wo Märkte wechselhafte Kategoriensysteme aufweisen oder diese sich erst noch ausbilden müssen. Um aber überhaupt erst Reputation aufzubauen, müssen Akteure zunächst mit einer fokussierten Identität auf hinreichend etablierten Märkten eine Nische besetzen, bevor sie ihr Spektrum, ohne Erfolgsverluste hinnehmen zu müssen, erweitern können. Park und Podolny (2000) argumentieren, dass die Nischenausdehnung insbesondere dann zu Erfolg führt, wenn Marktakteure in ihrem Kerngeschäft einen hohen Status etablieren. Anhand von Investmentbanken zeigen die Autoren, dass jene Banken ihren Erfolg maximieren, die zuerst in einer Nische über hohe Reputationsvorteile verfügen und dann auf weitere Nischen expandieren. Ähnlich zeigen Rao et al. (2003: 839) für die französische Gastronomie, dass Restaurantchefs mit größter Reputation in klassischer französischer Küche ihren Erfolg dann steigern, wenn sie Elemente der neu aufgekommenen nouvelle cuisine aufnehmen, also ihre Kategorienabdeckung rechtzeitig ausdehnen. Marktakteure werden also dann mit größtem Erfolg belohnt, wenn sie zuerst ihre Reputation innerhalb einer fokussierten Spezialisierung aufbauen – um Legitimität beim Publikum zu erzeugen –, um dann ihre Kategorienabdeckung zu erweitern, womit weiterer Erfolg aufgebaut wird. 16 MPIfG Discussion Paper 12/7 H4:Auf hinreichend etablierten Märkten haben Akteure dann größte Chancen auf Erfolg, wenn sie zunächst innerhalb einer fokussierten Nische Status aufbauen und anschließend ihre Nische ausdehnen und erweitern. Heterarchie oder: Organisierte Dissonanz Der fünfte Erklärungsansatz stellt eine Verbindung von Netzwerk- und Nischentheorie dar und geht im Wesentlichen auf die Arbeiten von David Stark und Kollegen zurück (Beunza/Stark 2004; Girard/Stark 2002; Stark 2009; Vaan et al. 2012; Vedres/Stark 2010). Stark untersucht teilweise mit ethnografischen, teilweise mit quantitativen Methoden in verschiedenen empirischen Kontexten wie New-Media-Firmen in New York’s Sillicon Alley, Börsenhändlern im New York der 2000er-Jahre oder Produktionsteams von Computer- und Videospielen die Bedingungen für Innovationen und Erfolg in kreativen Gruppenprozessen. Destillat seiner Forschungen ist das theoretische Konzept der „organisationalen Heterarchie“, mit dessen Hilfe eine soziologische Erklärung für den Erfolg von Innovationen möglich wird. Hiernach stellt die spezifisch heterogene Organisation von Kreativität eine wesentliche und entscheidende Quelle für die Innovationsfähigkeit und den Erfolg kreativer Gruppen dar. Ihr wesentliches Element ist die organisierte Herstellung von Dissonanz. Starks Studien zeigen, dass Teams, die aus unterschiedlichen kreativen Bereichen zusammengestellt und an der Schaffung neuer Produkte beteiligt werden, höhere Aussichten auf Innovationserfolg haben. Werden Teammitglieder aus verschiedenen kreativen Bereichen rekrutiert, dann hat die auf diese Weise „organisierte“ Dissonanz den Effekt, dass bei der Suche nach Innovationen permanente Konflikte entstehen, die den multiplen Bewertungsstandards und unterschiedlichen „Schulen“ oder Erfahrungshintergründen der zusammengebrachten Akteure geschuldet sind. Durch diesen Reibungsprozess ergeben sich Unsicherheiten darüber, welche Maßstäbe in welcher Art auf die zu erschaffende Innovation angesetzt werden sollen. Hierdurch werden Akteure gezwungen, bis dato als unhinterfragt geltende Gegebenheiten in einem neuen Licht zu betrachten. Manche Standards müssen so völlig neu ausgehandelt oder begründet werden. Auf diese Weise eröffnen die zusammengebrachten Dissonanzen einen Unsicherheitsraum, der es den Akteuren ermöglicht, bekannte Pfade zu verlassen und kreative Leistungen zu erbringen. Die Heterogenität der kreativen Köpfe schöpft damit den Raum für die Suche nach innovativen Lösungen optimal aus. Stark zeigt gemeinsam mit Daniel Beunza in einer Studie über Börsenhändler (Beunza/Stark 2004), wie Techniken der Dissonanzschaffung Gewohnheiten durchbrechen und als Folge kreative Innovationen hervorbringen. Eine solche Technik ist die zufällige Rotation der Sitzordnungen der Mitarbeiter in einem Büro. Durch die Veränderung der Sitzordnungen werden Gewohnheiten regelmäßig zerstört und der personelle Austausch der Kollegen untereinander maximiert. Mit Lutter: Soziale Strukturen des Erfolgs 17 dem Austausch von Mitarbeitern werden auch neue Horizonte, Erfahrungen und Maßstäbe untereinander ausgetauscht (vgl. auch Beunza/Stark 2003: 139), die den internen Informationsfluss erhöhen. Die organisierte Dissonanz stellt somit den maximal möglichen Grad an Vielfalt bei gleichzeitiger Einheit her. Eine weitere Studie zeigt, dass Unternehmen dann eine hohe Performanz aufweisen, wenn sie aus Gruppen bestehen, in denen ein Anteil ihrer Mitglieder zugleich mehreren externen Unternehmen angehört (Vedres/Stark 2010). Auch hierüber wird die Dissonanz durch die Verbindung unterschiedlicher Erfahrungen erhöht. In Analogie zu Ronald Burts netzwerktheoretischem Konzept des structural hole nennen Vedres und Stark die multiple Verbindung mehrerer Netzwerke structural fold, um das gleichzeitige Bestehen von Verbundenheit und Diversität zu unterstreichen. Im Unterschied zu Uzzi und Spiro (2005) argumentieren Vedreß und Stark auf einer weiteren Ebene: Nicht die kurvilineare Netzwerkkohäsion vorheriger Beziehungsaktivitäten entscheidet über den Erfolg in kreativen Teams, sondern die Existenz von Akteuren, die zugleich Mitglied in verschiedenen Teams aus unterschiedlichen Genres sind. Erst durch diesen gleichzeitigen Zusammenschluss von Heterogenität auf der einen und der nötigen Familiarität und Vertrauen auf der anderen Seite werden die Chancen auf erfolgversprechende Innovationsleistungen erhöht (vgl. zu Videospielproduktionen: Vaan/Vedres/Stark 2012).7 Hieraus ergibt sich die Annahme, dass diejenigen Gruppen den höchsten Innovationsgrad aufweisen und damit bei den Kritikern des Kunstfeldes auf die größte Anerkennung stoßen, die kreative Dissonanzen bestmöglich in ihrer Gruppe miteinander verbinden. Diese besondere Governancestruktur der organisierten Dissonanz müsste deswegen den größten Erfolg auf sich vereinen können, weil Kritiker des eigenen Kunstfeldes in der Regel diejenigen Produkte mit der größten Anerkennung und „praise value“ (Hutter 2011) versehen, die aus Sicht der Experten- und Kritikerhierarchie die größte Innovationskraft im Feld haben (Allen/Lincoln 2004). Es ergibt sich demgemäß die folgende Hypothese: H5:Akteure in heterarchisch organisierten kreativen Gruppen haben größte Chancen auf Erfolg. Status-Matching oder: Netzwerkspiralen des Erfolgs Ein letzter, und vielleicht der wichtigste dezidiert soziologische Mechanismus zur Erklärung von Erfolg auf Winner-take-all-Märkten ist die Tendenz vieler Künstlerarbeitsmärkte, die Zusammenstellung von Projektteams hochgradig nach Status zu ordnen. 7 Auch in der Managementliteratur finden sich Studien mit ganz ähnlichen Schlussfolgerungen. So zeigen Perretti und Negro (2007) anhand der Zusammenstellung von Filmteams, dass ein höherer Anteil an relativ unerfahrenen Neulingen die Innovationsfähigkeit, gemessen an der Etablierung neuer Genrekombinationen, positiv beeinflusst. 18 MPIfG Discussion Paper 12/7 Ganz ähnlich zu den Mechanismen, die aus der soziologischen Ungleichheitsforschung für bildungshomogame Eheschließungen bekannt sind (Blossfeld 2009; Blossfeld/ Timm 1997; Skopek et al. 2010), finden auch auf Künstlerarbeitsmärkten statushomogame Matching-Prozesse bei der Rekrutierung von Projektteams oder bei Kollaborationen zwischen Künstlern und Vermittlern statt. Status ergibt sich aus mehreren Dimensionen, einmal aus den zugeschriebenen Urteilen und Rangordnungen der Akteure und Experten im Markt, dann aus dem Status derjenigen, die die Urteile abgeben sowie aus den Statusordnungen der Personen, mit denen Akteure zusammenarbeiten oder in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben (Podolny 2005, 2001). Weil dies einen Einfluss auf die eigene Statusbeurteilung nehmen kann, besteht die Tendenz, mit anderen Akteuren des gleichen oder höherrangingen Status zu kollaborieren. So arbeitet ein renommierter Produzent ausschließlich mit ebenso angesehenen Regisseuren zusammen; ein gerade sich etablierender Schauspieler vermeidet die Zusammenarbeit mit Amateuren, um seinen noch nicht sehr gefestigten Ruf nicht zu gefährden. Projektteams „verklumpen“ so in nach Erfolg oder Status strukturierte Netzwerke. Es entstehen „Statusmärkte“ (Aspers 2007: 435f.) mit relativ abgegrenzten Verbindungen von sehr erfolgreichen, mittelmäßig erfolgreichen und vielen wenig erfolgreichen Akteuren. Diese Netzwerke des Erfolgs generieren dann unter den Bedingungen des Matthäus-Effekts weiteren Erfolg für ihre Angehörigen. Entsprechend stellt eine Studie über die Determinanten der Oscarnominierung in den USA heraus (Rossman et al. 2010: 46), dass nicht ausschließlich Leistungsfaktoren wie die berufliche Erfahrung oder die Budgethöhe des Films Chancen auf einen Oscar erhöhen, sondern auch die durchschnittliche Reputationshöhe der Mitglieder im Filmteam. Faulkner und Anderson (1987) zeigen anhand umfassender Kollaborationsdaten aus der Filmbranche, dass sich Teams hochgradig nach Status ordnen. Akteure aber, die es nicht schaffen, in diese Netze hineinzugelangen, fallen langfristig heraus und werden vom Erfolg abgehängt. Die Statushomogamien auf dem Arbeitsmarkt für Filmschaffende werden nach Faulk­ ner und Anderson (1987) im Wesentlichen durch zwei Bedingungen forciert: die Organisation der Arbeit in flexiblen Projektteams sowie die Unsicherheiten im Hinblick auf Qualität und voraussagbaren Erfolg und die Rolle von Reputation. Zum einen besteht ein Zwang zur permanenten Neurekrutierung der Teams. Damit ist das Fluktuationsaufkommen in projektbasierten Branchen ungleich höher als in klassischen Arbeitszusammenhängen. Teams formieren sich ständig neu; Angebot und Nachfrage treffen kontinuierlich aufeinander. Zum anderen operieren die Teams in einem Umfeld hochgradiger Unsicherheit. Jedes künstlerische Produkt ist einzigartig und sein Erfolg schwer vorherzusagen. Es gibt Ungewissheiten in Bezug auf die Kosten, vorgefasste Konditionen können sich im Laufe des Projekts ändern, Kapital- und Finanzierungsströme unvorhergesehen variieren. Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse sind wenig standardisiert; es gibt keine Routine. Viele Prozesse sind durch Experimentieren geprägt, durch Ausprobieren und Spontanität. Direktiven, Ziele und Vereinbarungen Lutter: Soziale Strukturen des Erfolgs 19 werden oft am Set neu ausgelegt, geändert, angepasst. Jedes Mitglied im Team muss imstande sein, darauf flexibel, kreativ und vielseitig zu reagieren. Der gegenseitige Interpretations- und Abstimmungsbedarf ist enorm hoch, Probleme „doppelter Kontingenz“ (Luhmann) bestehen verstärkt. Aufgrund dieser Unwägbarkeiten und des Fehlens objektiver Kriterien zur Beurteilung von Qualität müssen Akteure externe Signale heranziehen, die Auskunft über Qualität geben. Reputation, die aus früheren Projekten erworben wurde, spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung fachlicher Leistungen. Reputation kann allerdings nur durch frühere erfolgreiche Engagements aufgebaut werden (Faulkner/Anderson 1987: 881). Je prestigeträchtiger das Projekt, desto höher der eigene Reputationsgewinn daraus. An Engagements mit hohem Prestige gelangen Akteure allerdings nur mit bereits bestehender guter Reputation. Damit entsteht eine nur schwer zu durchbrechende Zirkularität: „[E]ach credit in this business increases a person’s chances for future work, and each money-earning production increases a person’s chances for future contracting with colleagues who themselves are associated with successful ventures“ (Faulkner/Anderson 1987: 907). Wie aber gelingt es Akteuren, diese Zirkularität zu durchbrechen? Wie können sie in statushöhere Teams gelangen, von deren Reputation sie profitieren können? Hier kann mit dem als „middle-status-conformity“ bekannten Ansatz (vgl. grundlegend: Phillips/ Zuckerman 2001) argumentiert werden, dass Konformität und damit soziale Schließung besonders in Teams mit mittleren Statuslagen hoch ausgeprägt sind. Empirisch bestätigen dies etwa Perretti und Negro (2006). Am Beispiel von Filmteams zeigen sie, dass sowohl Teams mit hohem als auch geringem Status es häufiger wagen, Newcomer ohne Reputation zu integrieren. Der Grund dafür liegt zum einen darin, dass etablierte Akteure mit hoher Reputation in ihrem Zwang zur Neuheitenproduktion immer höhere Innovationsgrade erreichen müssen, um ihren etablierten Status zu verteidigen. Deswegen suchen sie permanent nach Wegen, konventionelle Ordnungen zu durchbrechen. Zum anderen erlaubt ihnen ihr etablierter Status wesentlich mehr Freiheitsgrade in der Richtungsgestaltung ihrer künstlerischen Outputs, ohne die Unterstützung einer breiteren Anhängerschaft zu verlieren. Ebenso bringt höherer Status entsprechend ökonomische Absicherung mit sich, die es erlaubt, etwaige Risiken einzugehen, die mit der Verpflichtung junger Talente oder der Etablierung neuer Genres verbunden sein könnten. So ist auch die geringe Durchlässigkeit in den mittleren Lagen zu erklären, die mit der entsprechend größeren ökonomischen Unsicherheit sowie der noch wenig etablierten Reputation zusammenhängt. H6:Akteure haben dann die größte Chance auf Erfolg, wenn sie häufiger mit Teams zusammenarbeiten, deren Mitglieder einen hohen Status aufweisen und bereits erfolgreich sind. 20 MPIfG Discussion Paper 12/7 4Schluss Der Aufsatz hat das Potenzial soziologischer Ansätze zur Erklärung des Winner-takeall-Phänomens ausloten wollen. Auf Basis breiter Literatursichtung wurden sechs soziologisch-strukturelle Ansätze diskutiert, mit denen die Bedingungen von Erfolgsungleichheiten erklärt werden können. Der Beitrag versteht sich als eine soziologische Ergänzung der bestehenden dominanten Erklärungsansätze: Während bisherige Ansätze die Nachfrageseite betrachtet haben, stellt dieser Artikel Konditionen auf der Anbieterseite heraus. Das Hauptargument jedes der diskutierten Ansätze ist, dass Erfolgsbedingungen und -konzentrationen aus den sozialen Strukturen heraus erklärt werden müssen, in die die Akteure des Arbeitsmarktes eingebettet sind. Ziel dieser Studie war auch, zukünftiger empirischer Forschung einen Überblick zum Forschungsstand und zu Möglichkeiten einer soziologisch-strukturellen Analyse des Winner-take-all-Phänomens zu eröffnen. Allerdings bleibt hervorzuheben, dass die Ansätze nicht geeignet sind, Erfolge für den Einzelfall vorherzusagen, zum Beispiel der fulminante Erfolg der Beatles oder der Aufstieg von Bill Gates (Gladwell 2008). Jeder der vorgestellten Ansätze beschreibt Konstellationen und Bedingungen, die im statistischen Mittel – alle Akteure zusammengenommen – die Chancen auf Erfolgskonzentrationen wahrscheinlicher machen. Zudem reicht jeder der vorgestellten Ansätze für sich allein genommen nicht aus, um die Entstehung des Winner-take-all-Phänomens hinreichend zu erklären. Nur durch die Kombination und vollständige Betrachtung mehrerer Ansätze gelangt man zu einem genaueren Verständnis der relevanten kausalen Prozesse. Es bleibt weiterer theoretischer wie empirischer Forschung überlassen, herauszufinden, welche Kombination dieser Ansätze die beste Erklärungskraft erzielt. Es war die Absicht des vorliegenden Beitrags, die weitere empirische Überprüfung durch zukünftige Forschung anzuregen. Denkbar wären viele Bereiche, auf die sich die dargestellten Mechanismen übertragen ließen. Im Vordergrund stehen dabei vor allem konkrete Arbeitsmärkte in den Kultur- und Medienbranchen, etwa Erfolgsprozesse in den Karriereverläufen von Filmschaffenden, Erfolg und Marktbedingungen auf dem Buchmarkt, die Produktion von Musik und Formationsprozesse von Musikgruppen, der Erfolg von Musical-, Theater- oder Opernproduktionen. Über den rein künstlerischen Arbeitsmarkt hinaus wären Untersuchungsfelder in weiteren Bereichen denkbar, etwa die sozialstrukturellen Erfolgsbedingungen von Sportlern, die Erfolgsentwicklung von Architektenbüros, Karrieren und Kollaborationen von Wissenschaftlern oder Politikerlaufbahnen, Erfolg von Rechtsanwälten, Chirurgen oder Medizinern, Karrierebedingungen von Journalisten, Designern und Werbeleuten oder die Gehaltssteigerungen von Managern. Eine ganz anders angesiedelte, aber indirekt relevante Untersuchungsfrage wäre, wie es zu erklären ist, dass Akteure ihre Berufswahl überhaupt auf diese Märkte verlegen. Warum wollen sie Schauspieler werden? Warum Musiker? Was sind ihre Motive? Die Beantwortung dieser Fragen würde zum einen eine mikrofundierte Erklärung auch für Lutter: Soziale Strukturen des Erfolgs 21 die Frage des Zustandekommens der Winner-take-all-Verteilungen bieten. Denn nur wenn Menschen über Motive verfügen, ihre Arbeitskraft in diesen Branchen zu investieren, können die Konzentrationsprozesse überhaupt entstehen. Nur wenn ein permanentes Überangebot besteht, können die Prekarisierungstendenzen und das Alles-odernichts-Prinzip weiter fortbestehen. Neben Selbstverwirklichung und bohemischem Lebensstil als Motivation (Eikhoff/Haunschild 2006), wirken hier möglicherweise die Erfolgskonzentrationen des Marktes selbst als Motivator, weil die exorbitanten Gewinne Träume und Fantasievorstellungen eines „Was wäre wenn“ anregen – ähnlich wie der Lottospieler vom großen Geldgewinn träumt und dies ihn trotz Verluste wöchentlich weiterspielen lässt (vgl. Beckert/Lutter, 2007, 2012; Lutter 2010a, 2011, 2012b). Zum anderen wäre diese Frage aus einer theoretischen Perspektive der Wirtschaftssoziologie interessant. Denn rationale, vollständig über ihre Chancen informierte Akteure würden Winner-take-all-Märkte meiden. Ein homo oeconomicus würde kein Schauspieler werden. Wie aber erklärt sich, dass es beständig mehr Personen in diese Berufe drängt, als es Nachfrage nach ihnen gibt? Literatur Accominotti, Fabien, 2009: Creativity from Interaction: Artistic Movements and the Creativity Careers of Modern Painters. In: Poetics 37, 267–294. Adler, Moshe, 1985: Stardom and Talent. In: American Economic Review 75, 208–212. Allen, Michael Patrick/Anne E. Lincoln, 2004: Critical Discourse and the Cultural Consecration of American Films. In: Social Forces 82, 871–893. Allison, Paul D./J. Scott Long/Tad K. Krauze, 1982: Cumulative Advantage and Inequality in Science. In: American Sociological Review 47, 615–625. Apitzsch, Birgit, 2010: Flexible Beschäftigung, neue Abhängigkeiten. Projektarbeitsmärkte und ihre Auswirkungen auf Lebensverläufe. Frankfurt a.M.: Campus. Apitzsch, Birgit, 2012: Netzwerke in flexiblen Beschäftigungssystemen - lose Verbindungen oder eigene Logik? In: Alexandra Krause/Christoph Köhler (Hg.), Arbeit als Ware: Zur Theorie flexibler Arbeitsmärkte. Bielefeld: Transcript, 251–268. Aspers, Patrik, 2007: Wissen und Bewertung auf Märkten. In: Berliner Journal für Soziologie 17, 431–449. Banerjee, Abhijit V., 1992: A Simple Model of Herd Behavior. In: Quarterly Journal of Economics 107, 797–817. Becker, Howard S., 1982: Art Worlds. Berkeley: University of California Press. Beckert, Jens, 2004: Unverdientes Vermögen: Soziologie des Erbrechts. Frankfurt a.M.: Campus. Beckert, Jens/Patrik Aspers (Hg.), 2011: The Worth of Goods: Valuation and Pricing in the Economy. Oxford: Oxford University Press. Beckert, Jens/Mark Lutter, 2007: Wer spielt, hat schon verloren? Zur Erklärung des Nachfrageverhaltens auf dem Lottomarkt. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 59, 240–270. Beckert, Jens/Mark Lutter, 2012: Why the Poor Play the Lottery. Sociological Approaches to Explaining Classbased Lottery Play. In: Sociology, i. E., DOI: 10.1177/0038038512457854. Beckert, Jens/Jörg Rössel, 2004: Kunst und Preise: Reputation als Mechanismus der Reduktion von Ungewissheit am Kunstmarkt. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 56, 32–50. Beunza, Daniel/David Stark, 2003: The Organization of Responsiveness: Innovation and Recovery in the Trading Rooms of Lower Manhattan. In: Socio-Economic Review 1, 135–164. Beunza, Daniel/David Stark, 2004: Tools of the Trade: The Socio-technology of Arbitrage in a Wall Street Trading Room. In: Industrial and Corporate Change 13, 369–400. Bielby, Denise D./William T. Bielby, 1996: Women and Men in Film: Gender Inequality among Writers in a Culture Industry. In: Gender and Society 10, 248–270. Bikhchandani, Sushil/David Hirshleifer/Ivo Welch, 1992: A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades. In: Journal of Political Economy 100, 992–1026. Blossfeld, Hans-Peter, 2009: Educational Assortative Marriage in Comparative Perspective. In: Annual Review of Sociology 35, 513–530. Blossfeld, Hans-Peter/Andreas Timm, 1997: Das Bildungssystem als Heiratsmarkt. Eine Längsschnittanalyse der Wahl von Heiratspartnern im Lebenslauf. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 53, 440–476. Boltanski, Luc/Eve Chiapello, 2003: Der neue Geist des Kapitalismus. Konstanz: UVK. Borghans, Lex/Loek Groot, 1998: Superstardom and Monopolistic Power: Why Media Stars Earn More Than Their Marginal Contribution to Welfare. In: Journal of Institutional and Theoretical Economics 154, 546– 571. Bourdieu, Pierre, 1985: The Forms of Capital. In: John G. Richardson (Hg.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood, 241–258. Bröckling, Ulrich, 2007: Das unternehmerische Selbst: Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Bührmann, Andrea D./Nina Wild/Marko Heyse/Thomas Dierschke, 2010: Viel Ehre, aber kaum Verdienst: Erhebung zur Arbeits- und Lebenssituation von Schauspielerinnen und Schauspielern in Deutschland. Methodenbericht. Münster: Universität Münster. <http://bema.unimuenster.de/pdf/BFFS_Abschlussbericht.pdf> Burt, Ronald S., 1992: Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA: Harvard University Press. Burt, Ronald S., 2004: Structural Holes and Good Ideas. In: American Journal of Sociology 110, 349–399. Burt, Ronald S., 2005: Brokerage & Closure: An Introduction to Social Capital. Oxford: Oxford University Press. Carroll, Glenn R./Stanislav D. Dobrev/Anand Swaminathan, 2002: Organizational Processes of Resource Partitioning. In: Research in Organizational Behavior 24, 1–40. Carroll, Glenn R./Anand Swaminathan, 2000: Why the Microbrewery Movement? Organizational Dynamics of Resource Partitioning in the US Brewing Industry. In: American Journal Of Sociology 106, 715–762. Cattani, Gino/Simone Ferriani, 2008: A Core/Periphery Perspective on Individual Creative Performance: Social Networks and Cinematic Achievements in the Hollywood Film Industry. In: Organization Science 19, 824–844. Caves, Richard E., 2000: Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce. Cambridge, MA: Harvard University Press. Cowen, Tyler, 2000: What Price Fame. Cambridge, MA: Harvard University Press. DiPrete, Thomas A./Gregory M. Eirich, 2006: Cumulative Advantage as a Mechanism for Inequality: A Review of Theoretical and Empirical Developments. In: Annual Review of Sociology 32, 271–297. DiPrete, Thomas A/Gregory M Eirich/Matthew Pittinsky, 2010: Compensation Benchmarking, Leapfrogs, and the Surge in Executive Pay. In: American Journal of Sociology 115, 1671–1712. Dobrev, Stanislav D./Tai-Young Kim/Michael T. Hannan, 2001: Dynamics of Niche Width and Resource Partitioning. In: American Journal of Sociology 106, 1299–1337. Eikhof, Doris Ruth/Axel Haunschild, 2006: Lifestyle Meets Market: Bohemian Entrepreneurs in Creative Industries. In: Creativity and Innovation Management 15, 234–241. Eikhof, Doris Ruth/Axel Haunschild, 2007: For Art’s sake! Artistic and Economic Logics in Creative Production. In: Journal of Organizational Behavior 28, 523–538. England, Paula, 2005: Gender Inequality in Labor Markets: The Role of Motherhood and Segregation. In: Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 12, 264–288. Faulkner, Robert R./Andy B. Anderson, 1987: Short-Term Projects and Emergent Careers: Evidence from Hollywood. In: American Journal of Sociology 92, 879–909. Fernandez-Mateo, Isabel, 2009: Cumulative Gender Disadvantage in Contract Employment. In: American Journal of Sociology 114, 871–923. Fernandez, Roberto M./Mabel Abraham, 2011: Glass Ceilings and Glass Doors? Internal and External Hiring in an Organizational Hierarchy. MIT Sloan Research Paper No. 4895–11. <http://ssrn.com/abstract=1804896> Fernandez, Roberto/Lourdes Sosa, 2005: Gendering the Job: Networks and Recruitment at a Call Center. In: American Journal of Sociology 111, 859–904. Ferriani, Simone/Gino Cattani/Charles Baden-Fuller, 2009: The Relational Antecedents of Projectentrepreneurship: Network Centrality, Team Composition and Project Performance. In: Research Policy 38, 1545–1558. Florida, Richard, 2002: The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books. Franck, Egon/Stephan Nüesch, 2012: Talent and/or Popularity: What Does it Take to be a Superstar? In: Economic Inquiry 50, 202–216. Frank, Robert H./Philip J. Cook, 1995: The Winner-take-all Society: How More and More Americans Compete for Ever Fewer and Bigger Prizes, Encouraging Economic Waste, Income Inequality, and an Impoverished Cultural Life. New York: Free Press. Girard, Monique/David Stark, 2002: Distributing Intelligence and Organizing Diversity in New-Media Projects. In: Environment and Planning A 34, 1927–1949. Giuffre, Katherine, 1999: Sandpiles of Opportunity: Success in the Art World. In: Social Forces 77, 815–832. Gladwell, Malcolm, 2008: Outliers: The Story of Success. New York: Little, Brown and Company. Godechot, Olivier, 2008: „Hold-up“ in Finance: The Conditions of Possibility for High Bonuses in the Financial Industry In: Revue Francaise De Sociologie 49, 95–123. Godechot, Olivier, 2012: Is Finance Responsible for the Rise in Wage Inequality in France? In: Socio-Economic Review 10, 447–470. Gottschall, Karin, 1999: Freie Mitarbeit im Journalismus: Zur Entwicklung von Erwerbsformen zwischen selbständiger und abhängiger Beschäftigung. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 51, 635–654. Gould, Roger V., 2002: The Origins of Status Hierarchies: A Formal Theory and Empirical Test. In: American Journal of Sociology 107, 1143–1178. Granovetter, Mark S., 1973: The Strength of Weak Ties. In: American Journal of Sociology 78, 1360–1380. Granovetter, Mark S., 1974: Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Granovetter, Mark S., 1978: Threshold Models of Collective Behavior. In: American Journal Of Sociology 83, 1420–1443. Hacker, Jacob S./Paul Pierson, 2010: Winner-Take-All Politics: Public Policy, Political Organization, and the Precipitous Rise of Top Incomes in the United States. In: Politics and Society 38, 152–204. Hannan, Michael T./Glenn R. Carroll, 1992: Dynamics of Organizational Populations: Density, Legitimation, and Competition. Oxford: Oxford University Press. Hannan, Michael T./John Freeman, 1977: Population Ecology of Organizations. In: American Journal of Sociology 82, 929–964. Hannan, Michael T./John Freeman, 1993: Organizational Ecology. Cambridge, MA: Harvard University Press. Hellmann, Kai-Uwe, 2003: Soziologie der Marke. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Henninger, Annette/Karin Gottschall, 2007: Freelancers in Germany’s Old and New Media Industry: Beyond Standard Patterns of Work and Life? In: Critical Sociology 33, 43–71. Hsu, Greta, 2006: Jacks of All Trades and Masters of None: Audiences’ Reactions to Spanning Genres in Feature Film Production. In: Administrative Science Quarterly 51, 420–450. Hsu, Greta/Michael T. Hannan/Őzgecan Koçak, 2009: Multiple Category Memberships in Markets: An Integrated Theory and Two Empirical Tests. In: American Sociological Review 74, 150–169. Hutter, Michael 2011: Infinite Surprises: On the Stabilization of Value in the Creative Industries. In: Jens Beckert/Patrik Aspers (Hg.), The Worth of Goods: Valuation and Pricing in the Economy. Oxford: Oxford University Press, 201–220. Jones, Candace, 1996: Careers in Project Networks: The Case of the Film Industry. In: Michael B. Arthur/Denise M. Rousseau (Hg.), The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era Oxford: Oxford University Press, 58–75. Karpik, Lucien, 2010: Valuing the Unique: The Economics of Singularities. Princeton: Princeton University Press. Keuschnigg, Marc, 2012a: Das Bestseller-Phänomen: Die Entstehung von Nachfragekonzentration im Buchmarkt. Wiesbaden: Springer VS. Keuschnigg, Marc, 2012b: Konformität durch Herdenverhalten. Theorie und Empirie zur Entstehung von Bestsellern. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 64, 1–36. Koppetsch, Cornelia, 2006: Zwischen Disziplin und Expressivität. Zum Wandel beruflicher Identitäten im neuen Kapitalismus. In: Berliner Journal für Soziologie 16, 155–172. Koppetsch, Cornelia, 2008: Der Markt der Ideen: Neue Wege der Professionalisierung am Beispiel der Kulturund Medienindustrien. In: Soziale Welt 4, 327–350. Lazear, Edward P./Sherwin Rosen, 1981: Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts. In: Journal of Political Economy 89, 841–864. Leaver, Adam, 2010: A Different Take: Hollywood’s Unresolved Business Model. In: Review of International Political Economy 17, 454–480. Levy, Emanuel, 1989: The Democratic Elite: America’s Movie Stars. In: Qualitative Sociology 12, 29–54. Lincoln, Anne E./Michael Patrick Allen, 2004: Double Jeopardy in Hollywood: Age and Gender in the Careers of Film Actors, 1926–1999. In: Sociological Forum 19, 611–631. Lutter, Mark, 2010a: Märkte für Träume: Die Soziologie des Lottospiels. Frankfurt a.M., New York: Campus. Lutter, Mark, 2010b: Zur Erklärung von Diffusionsprozessen: Das Beispiel der Einführung staatlicher Lotterien in den USA. In: Zeitschrift für Soziologie 39, 363–381. Lutter, Mark, 2011: Konkurrenten auf dem Markt für Hoffnung: Religiöse Wurzeln der gesellschaftlichen Problematisierung von Glücksspielen. In: Soziale Probleme 22, 28–55. Lutter, Mark, 2012a: Anstieg oder Ausgleich? Die multiplikative Wirkung sozialer Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt für Filmschauspieler. In: Zeitschrift für Soziologie 41, 435-457. Lutter, Mark, 2012b: Tagträume und Konsum. Die imaginative Qualität von Gütern am Beispiel der Nachfrage für Lotterien. In: Soziale Welt 63, im Erscheinen. MacDonald, Glenn M., 1988: The Economics of Rising Stars. In: The American Economic Review 78, 155–166. March, James G./Robert I. Sutton, 1997: Crossroads: Organizational Performance as a Dependent Variable. In: Organization Science 8, 698–706. Mathieu, Chris (Hg.), 2012: Careers in Creative Industries. New York: Routledge. McCall, Leslie/Christine Percheski, 2010: Income Inequality: New Trends and Research Directions. In: Annual Review of Sociology 36, 329–347. McKinlay, Alan/Chris Smith (Hg.), 2009: Creative Labour: Working in the Creative Industries. Basingstoke: Palgrave Macmillan. McPherson, Miller/Lynn Smith-Lovin/James M. Cook, 2001: Birds of a Feather: Homophily in Social Networks. In: Annual Review of Sociology 27, 415–444. Meier, Henk Erik, 2008: Institutional Complementarities and Institutional Dynamics: Exploring Varieties in European Football Capitalism. In: Socio-Economic Review 6, 99–133. Menger, Pierre-Michel, 1999: Artistic Labor Markets And Careers. In: Annual Review of Sociology 25, 541–574. Menger, Pierre-Michel, 2009: Le travail créateur: S’accomplir dans l’incertain. Paris: Gallimard-Seuil-Éditions de l’EHESS. Merton, Robert King, 1968: The Matthew Effect in Science. In: Science 159, 56–63. Mintzberg, Henry, 1979: The Structuring of Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Müller-Jentsch, Walther, 2005: Künstler und Künstlergruppen: Soziologische Ansichten einer prekären Profession. In: Berliner Journal für Soziologie 15, 159–177. Münch, Richard, 2010: Der Monopolmechanismus in der Wissenschaft: Auf den Schultern von Robert K. Merton. In: Berliner Journal für Soziologie 20, 341–370. Neckel, Sighard, 2001: „Leistung“ und „Erfolg“: Die symbolische Ordnung der Marktgesellschaft. In: Hans Peter Müller Eva Barlösius/Steffen Sigmund (Hg.), Gesellschaftsbilder im Umbruch: Soziologische Perspektiven in Deutschland. Opladen: Leske + Budrich, 245–268. Neckel, Sighard, 2008: Flucht nach vorn: Die Erfolgskultur der Marktgesellschaft. Frankfurt a.M.: Campus. Neckel, Sighard, 2010: Refeudalisierung der Ökonomie: Zum Strukturwandel kapitalistischer Wirtschaft. MPIfG Working Paper 10/6. Köln: Max-Planck-Institut für Gesellschafstforschung. <www.mpifg.de/pu/workpap/wp10-6.pdf > Neckel, Sighard/Kai Dröge, 2003: Die Verdienste und ihr Preis: Leistung in der Marktgesellschaft. In: Axel Honneth (Hg.), Befreiung aus der Mündigkeit: Paradoxien des gegenwärtigen Kapitalismus. Frankfurt a.M.: Campus, 93–116. Neckel, Sighard/Ana Mijic/Christian von Scheve/Monica Tritton (Hg.), 2010: Sternstunden der Soziologie: Wegweisende Theoriemodelle des soziologischen Denkens. Frankfurt a.M.: Campus. Nicolai, Alexander/Alfred Kieser, 2002: Trotz eklatanter Erfolglosigkeit: Die Erfolgsfaktorenforschung weiter auf Erfolgskurs. In: Die Betriebswirtschaft 62, 579-596. Pager, Devah/Hana Shepherd, 2008: The Sociology of Discrimination: Racial Discrimination in Employment, Housing, Credit, and Consumer Markets. In: Annual Review of Sociology 34, 181–209. Park, Douglas Y./Joel M. Podolny, 2000: The Competitive Dynamics of Status and Niche Width: US Investment Banking, 1920–1949. In: Industrial and Corporate Change 9, 377–414. Perretti, Fabrizio/Giacomo Negro, 2006: Filling Empty Seats: How Status and Organizational Hierarchies Affect Exploration versus Exploitation in Team Design. In: The Academy of Management Journal 49, 759–777. Perretti, Fabrizio/Giacomo Negro, 2007: Mixing Genres and Matching People: A Study in Innovation and Team Composition in Hollywood. In: Journal of Organizational Behavior 28, 563–586. Petersen, Trond/Ishak Saporta, 2004: The Opportunity Structure for Discrimination. In: American Journal of Sociology 109, 852–901. Phillips, Damon J./Ezra W. Zuckerman, 2001: Middle-Status Conformity: Theoretical Restatement and Empirical Demonstration in Two Markets. In: American Journal of Sociology 107, 379–429. Podolny, Joel, 2005: Status Signals: A Sociological Study of Market Competition. Princeton: Princeton University Press. Podolny, Joel M., 2001: Networks as the Pipes and Prisms of the Market. In: American Journal of Sociology 107, 33–60. Rao, Hayagreeva/Philippe Monin/Rodolphe Durand, 2003: Institutional Change in Toque Ville: Nouvelle Cuisine as an Identity Movement in French Gastronomy. In: American Journal of Sociology 108, 795– 843. Rosen, Sherwin, 1981: The Economics of Superstars. In: American Economic Review 71, 845–858. Rosen, Sherwin, 1986: Prizes and Incentives in Elimination Tournaments. In: The American Economic Review 76, 701–715. Rössel, Jörg, 2009: Kulturelles Kapital und Musikrezeption: Eine empirische Überprüfung von Bourdieus Theorie der Kunstwahrnehmung. In: Soziale Welt 60, 239–255. Rössel, Jörg/Kathi Bromberger, 2009: Strukturiert kulturelles Kapital auch den Konsum von Populärkultur? In: Zeitschrift für Soziologie 38, 494–513. Rossman, Gabriel, 2012: Climbing the Charts: What Radio Airplay Tells Us about the Diffusion of Innovation. Princeton: Princeton University Press. Rossman, Gabriel/Nicole Esparza/Phillip Bonacich, 2010: I’d Like to Thank the Academy, Team Spillovers, and Network Centrality. In: American Sociological Review 75, 31–51. Rost, Katja, 2010: The Rise in Executive Compensation: Consequence of a ,War for Talents‘? Social Science Research Network Working paper. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1634799> Rost, Katja, 2011: The Strength of Strong Ties in the Creation of Innovation. In: Research Policy 40, 588–604. Skopek, Jan/Florian Schulz/Hans-Peter Blossfeld, 2011: Who Contacts Whom? Educational Homophily in Online Mate Selection. In: European Sociological Review 27, 180–195. Stark, David, 2009: The Sense of Dissonance: Accounts of Worth in Economic Life. Princeton: Princeton University Press. Szydlik, Marc, 1999: Erben in der Bundesrepublik Deutschland: Zum Verhältnis von familialer Solidarität und sozialer Ungleichheit. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 51, 80–104. Szydlik, Marc, 2004: Inheritance and Inequality: Theoretical Reasoning and Empirical Evidence. In: European Sociological Review 20, 31–45. Szydlik, Marc/Jürgen Schupp, 2004: Wer erbt mehr? Erbschaften, Sozialstruktur und Alterssicherung. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 56, 609–629. Uzzi, Brian/Jarrett Spiro, 2005: Collaboration and Creativity: The Small World Problem. In: American Journal of Sociology 111, 447–504. Vaan, Mathijs de/Balzazs Vedres/David Stark, 2012: Disruptive Diversity and Recurring Cohesion: Assembling Creative Teams in the Video Game Industry, 1979–2009. Center on Organizational Innovation Working Paper. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1954019>. Vedres, Balázs/David Stark, 2010: Structural Folds: Generative Disruption in Overlapping Groups. In: American Journal of Sociology 115, 1150–1190. Western, Bruce/Deirdre Bloome/Christine Percheski, 2008: Inequality among American Families with Children, 1975 to 2005. In: American Sociological Review 73, 903–920. Zuckerman, Ezra W./Tai-Young Kim/Kalinda Ukanwa/James von Rittmann, 2003: Robust Identities or Nonentities? Typecasting in the Feature-Film Labor Market. In: American Journal of Sociology 108, 1018–1074. Zuckerman, Harriet, 2010: Dynamik und Verbreitung des Matthäus-Effekts. In: Berliner Journal für Soziologie 20, 309–340.