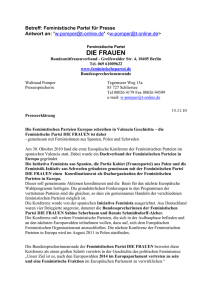Kritik der Kategorie >Geschlecht
Werbung

Kritik der Kategorie >Geschlecht< Streit um Begriffe, Streit um Orientierungen, Streit der Generationen ? Einleitung Die Debatten um die Auflösung der Kategorie Geschlecht oder um ihre Spezifizierung haben inzwischen längst die Seiten des Feuilletons erreicht. Anders als die bisherigen feministischen Debatten scheinen diese allerdings stärker von generationsspezifischen Differenzen mitbestimmt zu sein; es ist auffällig, daß hierin deutlich mehr >jüngere< Feministinnen engagiert sind als in denen über andere Problemfelder. Auffällig ist auch, daß die Problematisierung dieses Kernelements feministischer Theorie und Praxis dem Gros der >älteren< feministischen Generation weitgehend unverständlich zu sein scheint, besonders dann, wenn die biologische Zweigeschlechtlichkeit selbst als Produkt von sozialen und diskursiven Prozessen aufgefaßt wird. Handelt es sich hier >nur< um unüberbrückbar verschiedene theoretisch-politische Orientierungen? Bloß darum, daß bei den einen beispielsweise eher marxistisch und/oder psychoanalytisch orientierte, bei den anderen eher mit dem Etikett >poststrukturalistisch< versehene Autoren und Autorinnen Kredit haben und so die Frage, ob (und wenn ja in welchem Sinne) es ein Subjekt des Feminismus oder der Frauenbewegung geben könne (und ob es das überhaupt geben müsse), vorentschieden ist? Ergäben sich lediglich durch unterschiedliche Lektüren die Differenzen in der Sache, so müßten die jeweils verschiedenen Theoriesprachen wenigstens prinzipiell ineinander übersetzbar sein. Doch das beobachtete Kopfschüttteln scheint auszudrücken, daß gerade das nicht für möglich gehalten wird. Die wechselseitigen Irritationen werden vielleicht verständlicher, wenn genauer untersucht würde, ob nicht der Erfahrungshintergrund jüngerer Wissenschaftlerinnen und Studentinnen ein völlig anderer ist als in den Anfängen der Frauenbewegung, als die feministische Kritik an Theorie und Praxis der antiautoritären Studentenbewegung von vielen als eine Art Offenbarung empfunden wurde, in deren Licht sämtliche - auch die persönlichen - Verhältnisse neu interpretiert wurden. Die heutigen Studentinnen und Studenten dagegen kommen spätestens in der Schule mit feministischen Ideen und der entsprechenden Politik als einem Aspekt möglicher Orientierung in Berührung. Zur Universität als Institution, zu der sich diese Generation ins Verhältnis setzen muß, gehört bereits in Ansätzen feministische Forschung. Gegenüber einem etablierten Bestandteil des Wissenskanons nimmt man aber eher ein distanziertes Verhältnis ein als gegenüber solchen Feministische Studien 2/93 Unauthenticated Download Date | 10/31/17 3:02 AM 4 Einleitung Orientierungen und Erkenntnisinteressen, die sich aus den eigenen Handlungsfeldern aufdrängen und dann aus eigener Initiative in die Universität getragen werden. Aber nicht nur der Ort der feministischen Theorie hat sich geändert, der jetzt in starkem Maße die Universität selbst ist, sondern auch die realen Erfahrungen von Geschlechterverhältnissen: Geschlechterbeziehungen scheinen für die jetzige Generation nicht mehr in dem Sinne >Kampfverhältnisse< und auch nicht in jedem Fall so >zentral< zu sein, wie sie es für die älteren sind. Unter anderem als Folge der Frauenbewegung haben sich Lebensformen und ihre Interpretation, sexuelle Orientierungen und Perspektiven von Frauen verändert. Erst auf dem Boden dieser in Ansätzen realisierten Umstrukturierung der Geschlechterbeziehungen kann die Utopie einer Welt, in der es keine oder sehr viele Geschlechter gibt, an Boden gewinnen und Anlaß für Theoretisierung geben. Dies scheint uns eine der Bedingungen dafür zu sein, daß sich die langjährigen Debatten um Gleichheit oder Differenz verschoben haben auf die Kritik der Kategorie >GeschIecht< selbst und damit in der derzeitigen Konjunktur vorläufig zu einem (impliziten) >Sieg< der Egalitätsposition geführt haben. In diesen neuesten Auseinandersetzungen spielt Judith Butlers Buch »Gender Trouble« (dt.: »Das Unbehagen der Geschlechter«, Frankfurt 1991) eine dominante Rolle. Butler zielt darauf, die sex/gender-Unterscheidung in gender aufzulösen: »sex« selber sieht sie als gender-Konstrukt, hervorgebracht durch Diskurse. Auch die Körperlichkeit ist ihr demnach nichts, was Männer und Frauen materiell unterscheidet, sondern die »Fiktion« materieller Substanzen komme erst durch den bedeutungskonstituierenden, diskursiv gesteuerten und steuernden Blick in die Welt. Dies ist eine Position, die in den 70er und auch noch in der ersten Hälfte der 80er Jahre unter das Verdikt »idealistisch« gefallen und deshalb kaum zur Kenntnis genommen worden wäre. Heute aber wird sie als eine Variante des sozialen Konstruktivismus gelesen. Nachdem der Feminismus den Satz »Alles ist Biologie« überführt hatte in »Biologische Unterschiede werden kulturell überformt« heißt die (nicht so ganz) neue Devise: »Alles ist Kultur - inklusive der Biologie selbst«. Nun darf aber die triviale Feststellung, daß jeder Begriff von »Körper« und »Natur« symbolisch, also Deutung ist, nicht kurzgeschlossen werden zu der Annahme, daß diese Deutung damit auf nichts anderes verweist als auf sich selbst und andere diskursiv konstruierte Interpretationen. Der >Idealismus< dieser Position hat einen ihm selbst undurchsichtigen materiellem Hintergrund. Wir sehen ihn vor allem in den schon skizzierten generationenspezifischen Bedingungen. Deshalb ist damit zu rechnen, daß das, was an theoretischer Positionierung in breiterem Umfang erst mit Butler in die Welt gekommen ist, nicht allein durch eine Auseinandersetzung mit ihren Thesen aus der Welt zu schaffen ist, sondern daß es eines Wahr- und Ernstnehmens der theoriepolitischen Orientierungsinteressen der neuen feministischen Generation bedarf. Das schließt ein, die jeweiligen Theoriebedingungen (wer macht wo wem gegenüber die Kategorie Geschlecht relevant oder behauptet ihre Irrelevanz?) zur Kenntnis zu nehmen. Unauthenticated Download Date | 10/31/17 3:02 AM Kritik der Kategorie >Geschlecht< 5 Dazu gehört auch, daß die theoretisch-politische Utopie einer Welt mit mehr al s nur zwei Geschlechtern zumindest in der Variante der >Queer-Politik< (vgl. d azu den Beitrag von Sabine Hark in diesem Heft) zunächst noch gebunden ist an Erfahrungen in einigen wenigen euro-amerikanischen Metropolen. Nur hier gibt es bereits >Szenen< und Subkulturen, die eine (auch von Butler propagierte) Politik der »gender Performance« (des Inszenierens von Geschlechtsidentität, um deren Künstlichkeit deutlich zu machen) bewußt, öffentlich und dem Anspruch nach in subversiver Weise praktizieren. Aber wird damit, daß an diesen Orten einige kulturelle Selbstverständlichkeiten sichtbar werden können, die unsere Wahrnehmung von zwei und genau zwei Geschlechtern prägen, schon die Zweigeschlechtlichkeit selbst aufgehoben? Oder bestätigt sie sich nicht gerade hier? Mit der Debatte, die wir hier eröffnen, geht es uns sowohl darum, weitere empirische Forschungen zu motivieren, die ihre methodologischen Annahmen kritisch reflektieren, als auch um eine Schärfung und Präzisierung des begrifflichen Instrumentariums feministischer Theorie. Symptomatisch ist, daß diese Diskussion zunächst noch sehr stark um Butlers Thesen kreist. Isabell Lorey zeichnet die Entwicklung in Butlers Denken nach, das ursprünglich von einer theoretischen Nähe zu Simone de Beauvoir bestimmt war und »vorläufig« abschließt mit der bekannten distanzierenden Wende in »Gender Trouble«. Der Körper, die binäre Anatomie, ja das Subjekt selbst, erscheinen nun als Effekt einer historisch spezifischen Bezeichnungspraxis: Der Körper wird zum »Text«, und der Innenraum, die Seele, das Selbst zur Illusion. Gegen diese Vorstellung macht Lorey Foucaults Argumentation stark, die vom Innenraum nicht als ontologischer Substanz, wohl aber von seiner körperlich gespürten Wirklichkeit und Aktualität ausgeht. Hier schließt der Essay von Barbara Duden an, der Butlers »Gender Trouble« als Zeitdokument in den Zusammenhang der eigenen Forschungen zur Körpergeschichte stellt. Mit der Skepsis einer Historikerin beschreibt sie das Befremden gegenüber diesem »Dokument«, mit dem ein »stimmloser, stummer Diskurs, also reiner Text zur Grundlage des Wissens über Frauen gemacht wird.« Hier ist ein leibhaftiges Erschrecken spürbar angesichts der dekonstruktiv »entkörperten« Frau. Keine erlebbare Sinnfaser führe so mehr in die Vergangenheit, und total sei der Bruch mit einer Vorstellung von Natur als »Matrix«, als »Ur-Sprung«. Dudens leidenschaftliche Rede verweigert sich der Verführung, sich die eigene Leiblichkeit und (verborgene) Sinnlichkeit ausreden zu lassen. Stimme und Sprache ihres >Textes< lassen vergangene und gegenwärtige Körpererfahrungen >wirklich< werden. Ausgehend davon, daß Butlers diskurstheoretische Position zu eng am Modell der Sprache orientiert ist und leibliche Phänomene ebenso wie präsentative Symbolismen (Kunst und Mythen) vernachlässigt, modifiziert Hilge Landweer mit Hilfe von wahrnehmungs- und symboltheoretischen Überlegungen Butlers Kritik an der sex/gender-Unterscheidung. Sie argumentiert mit anthropologischen Befunden wie Natalität, Sterblichkeit und Generativität (die in der neueren feministischen Diskussion durch den allgemeinen Biologismus-Verdacht weitgehend tabuisiert sind) dafür, daß dem Hang zur Mythenbildung nicht durch Ausblendung dieser conditio humana zu entkommen sei. Unauthenticated Download Date | 10/31/17 3:02 AM 6 Einleitung Gesa Lindemann will anhand des »Krisenexperiments Transsexualität« zeigen, daß leibliche Evidenzen und Subjektivität nicht nur notwendige Bestandteile von Sozialität, sondern auch Bedingungen für das Funktionieren sozialer Kontrolle sind. Daß die Mikrosoziologie leibtheoretisch fundiert werden müßte, um die Zählebigkeit sozialer Ordnung wirklich erfassen zu können, macht Lindemann damit plausibel, daß die eigene Leiblichkeit unhintergehbar in der 1. Person erlebt und empfunden wird und Interaktionsnormen ohne diese Verankerung in der leiblichen Subjektivität ins Leere liefen. Ein anderer problematischer Aspekt wird deutlich, wenn Butlers ¡Rekonstruktion politisch diskutiert wird. Dabei wird die berechtigte Kritik an fundamentalistischen Politikbegründungen, etwa für eine Kollektividentität >Frau<, oft gleichgesetzt mit einer Verabschiedung des Projekts feministischer Politik insgesamt. Hier werden unterschiedliche analytische Ebenen vermischt. Nach den Ursachen für nivellierende Unterdrückung, Herrschaft, Zwang zu fragen, die Frauen qua Geschlecht treffen, und politische Handlungsmöglichkeiten gegen diese asymmetrische Geschlechterordnung zu formulieren, ist nicht gleichzusetzen mit der Annahme, daß alle Frauen auf die gleiche Weise diese Geschlechterordnung erfahren. Diese Problematik wird auch in dem Besprechungsessay von Anna Maria Stuby angesprochen. Sie beleuchtet den streitbaren Dialog anglo-amerikanischer Literaturwissenschaftlerinnen am Beispiel jüngerer Veröffentlichungen. In der Mehrzahl dieser Beiträge wird selbstverständlich eine Pluralität von »feminisms« vorausgesetzt, ganz im Gegensatz - und (nicht nur) hier wird Stubys Beitrag selbst streitbar - zum hierzulande hartnäckig verdoppelten Vorurteil, der Frauenforschung ginge es um die Frau, und Butlers Denken müsse deshalb wie ein heilsamer »Blitzschlag« wirken. Die Tendenz, jegliche Materialität zu negieren, ihr jede Wirklichkeit abzusprechen, kehrt wieder in manchen feministischen Theorien des Politischen, die Eva Senghaas-Knobloch in ihrem Rezensionsessay skizziert. Den Analysen von gesellschaftspolitischen Konfliktfeldern, dem Nachdenken über politische Interessen und Handlungsformen, dem Streit um Privatheit und Öffentlichkeit, der Suche nach einer neuen Theorie politischer Gemeinschaft und der Diskussion um Gleichheit und Differenz der Geschlechter in diesem Zusammenhang stehen zunehmend Realität ausgrenzende, postmoderne, ja »posthumanistische« Sichtweisen gegenüber. Trifft vielleicht die Metapher von der »dekonstruktiven Modenschau« (Duden) auch auf so manche feministische Rede zur Theorie des Politischen zu, die über den realen Existenzweisen von konkreten, ja auch leidenden Menschen schwebt? Wie entstehen solche Theoriekonjunkturen? Gerade weil Theoriebildung für Feministinnen unverzichtbar ist, muß die institutionelle Bewertung von Theorien reflektiert werden. Teresa de Lauretis betont in ihrem Beitrag, daß Theorien an der Universität ein Mittel des Prestigegewinns seien und daß die »unverdaute Übernahme« dessen, was wissenschaftlich gerade en vogue ist, zu leerlaufenden »Instanttheorien« führe. Sie erweitert das heterogene Spektrum der inzwischen breit diskutierten Differenzen zwischen Frauen (wie Ethnizität, sexuelle Orientierung und Klasse) um die Theorie-Praxis-Hierarchie. Unauthenticated Download Date | 10/31/17 3:02 AM Kritik der Kategorie >Geschlecht< 7 Sabine Hark stellt mit »Queer Interventionen« eine kulturelle und konzeptionelle Praxis vor, mit der problematisch gewordene Identitätspolitiken überwunden werden sollen. »Lesbian« und »Gay Studies« hätten bisher die Dichotomie von Hetero- und Homosexualität und damit implizit auch die Zweigeschlechtlichkeit zu ihrem Ausgangspunkt gehabt, die es jetzt aufzulösen gelte. Anhand eines als »Neil-Diamond-Revue« angekündigten Konzerts der lesbischen Musikerin Phranc beschreibt sie, wie mit inszenierten Ironisierungen der kulturellen Identitätscodes die übliche Personwahrnehmung über »Geschlecht« und »sexuelle Orientierung« erschüttert werden können. Dieser Beitrag dokumentiert so ein Beispiel für Butlers Konzeption von »gender Performance«. Mit diesem Heft wollen wir auch eine Diskussion um konstruktivistisch und ethnomethodologisch orientierte Ansätze anregen, die schon seit Jahren manche feministischen Konzeptionen von >Geschlecht< kritisieren, aber in der bundesrepublikanischen sozialwissenschaftlichen Frauenforschung bisher auf einige »Rezeptionssperren« (Gildemeister/Wetterer 1992) trafen. Daß die Soziologinnen die Gesellschaft, die sie beschreiben, kennen, und daß deshalb Verfremdungsstrategien zur distanzierten Beobachtung notwendig sind, ist ihr methodologischer Ausgangspunkt. Der Text von Gesa Lindemann gehört deshalb auch in diesen Zusammenhang. Ein breiter Konsens besteht bei den Autorinnen dieses Heftes vielleicht darin, von kulturellen Konstruktionen der Geschlechterdifferenz und asymmetrischen Geschlechterordnungen auszugehen - weniger jedoch in der Frage, wie und wo Geschlecht konkret »hergestellt« wird und daß Macht in diesem »Tun« ungleichgewichtig verortet ist. Stefan Hirschauer stellt die provokative These auf, daß nicht die soziale Ungleichheit der Geschlechter erklärungsbedürftig sei, da die Frage nach deren Ursachen in das zurücklaufe, was wir ohnehin schon wüßten: daß Männer und Frauen grundverschieden seien. Gerade für feministische Machtanalysen sieht er einen Gewinn darin, methodisch auf die Vorannahme der Geschlechterunterscheidung zu verzichten und empirisch zu untersuchen, wie (und nicht warum) sich welche Arten von Asymmetrien über interaktive Bezugnahmen auf Geschlecht alltäglich herstellen.1 Auch Carol Hagemann-White weist darauf hin, daß Geschlecht nicht etwas ist, »was wir >haben< und >sind<, sondern etwas, was wir tun«. Das »symbolische System der Zweigeschlechtlichkeit« würde durch Interaktionsarbeit - »doing gender« - immer wieder neu erzeugt, allerdings auch in seinen hierarchischen Dimensionen. Mit diesem Zwang wird der Unterschied nicht nur zu sozialisationstheoretischen und psychoanalytischen Ansätzen innerhalb der Frauenforschung markiert - der Beitrag läßt sich auch lesen als eine implizite Auseinandersetzung mit den Thesen Stefan Hirschauers. Hagemann-White zeigt am Beispiel der Untersuchungen von Carol Gilligan und anderen Forschungserfahrungen, wie jeweils hierarchische Geschlechterdifferenzen hergestellt werden. Darüberhinausgehend entwickelt sie eigene Überlegungen zu einer feministischen Methodologie. Helga Kotthoff verfolgt am Beispiel einzelner Szenen aus Fernsehdiskussionen, wie »situative Rangunterschiede ausgehandelt werden, die auch mit Geschlecht zu tun haben«. Ihre kommunikationssoziologische Studie geht ebenfalls Unauthenticated Download Date | 10/31/17 3:02 AM 8 Einleitung vom Gedanken der Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit aus, stärker aber als in manchen anderen Überlegungen wird nach dem Zusammenhang von kommunikativen Stilen und Macht gefragt. Kotthoff bezieht sich ausdrücklich auf Ansätze, die vom gesellschaftlichen Kontext nicht absehen. »Döing gender« bedeutet für sie deshalb nicht, isolierte Interaktionssituationen ins Zentrum zu rücken, sondern - bezogen auf das konkrete Untersuchungsfeld - auch den institutionellen Diskurs und die Verarbeitung der Medien als vorgelagerte Produzenten von Machtasymmetrien zu beachten. Der Diskussionsbeitrag von Monika Wohlrab-Sahr resümiert die feministische Diskussion um Methodologie mit Blick auf problematische Langzeitwirkungen der 1978 von Maria Mies formulierten »Methodischen Postúlate zur Frauenforschung«. Sie argumentiert gegen die in mancher feministischen Forschungspraxis nach wie vor feststellbare Ablehnung der spezifischen, >rollenförmigen< Seiten der Forschungsbeziehung. Mit ihrer Kritik an unreflektierten Annahmen von Gemeinsamkeit und Empathie hinterfragt sie auch die »soziale Schließung der Frauenforschung« gegenüber männlichen Eindringlingen. Insofern sie die Selbstdistanzierung der Forscherin von den eigenen Selbstverständlichkeiten als notwendig für das Fremdverstehen in der Forschung erachtet, weist ihr Methodologieverständnis Parallelen zu den von Hagemann-White und Hirschauer formulierten Forschungsperspektiven auf. Der Kampf um den Erklärungswert verschiedener theoretischer Perspektiven zeigt sich auch in jenem Feld, das in der öffentlichen Debatte von einer Atmosphäre enormer Hilflosigkeit gekennzeichnet ist: dem Rechtsextremismus. Im letzten Heft der Feministischen Studien haben wir mit enthnopsychoanalytischen Überlegungen von Maya Nadig zu »Ritualisierung von Haß und Gewalt im Rassismus« eine Diskussion über die Geschlechterdimension von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit eröffnet. Die Beiträge von Teresa Wobbe und Birgit Meyer im vorliegenden Heft setzen diesen Anfang mit anderen Perspektiven fort. Eine leibphänomenologische Sicht auf das Problem des Rechtsradikalismus eröffnet Theresa Wobbe. Ausgehend davon, daß »Rasse« und »Geschlecht« Ordnungsbegriffe mit einem hohen Naturalisierungsgrad sind, zeigt sie die Verschränkung von Rassismus und Sexismus am Phänomen der »Verletzungsoffenheit« bzw. »Verletzungsmächtigkeit« auf. Am Beispiel der versuchten Vergewaltigung von Vietnamesinnen durch Skins im Beisein deutscher Mädchen wird nicht nur deutlich, daß leibliche Evidenzen unhintergehbar sind, sondern auch, daß mit genau diesen Evidenzen die Grenze zwischen »Wir« und »Ihr« bzw. »Sie« gezogen wird. Birgit Meyer untersucht zunächst Studien der Rechtsextremismusforschung, wobei sie auf erhebliche theoretische und empirische Defizite aufmerksam macht, die sehr plastisch die »Geschlechtsblindheit« dieser Forschungsrichtung dokumentieren. Es bleiben vor allem Fragen nach den Ursachen der geringeren und anderen Beteiligung von Mädchen bzw. Frauen an rechtsradikalen Organisationen und Aktionsmustern, ja vor allem an Gewalt, offen. Diese Problematik versucht Meyer durch sozialpsychologische und politologische Hypothesen einzukreisen. Unauthenticated Download Date | 10/31/17 3:02 AM 9 Kritik der Kategorie >Geschlecht< Wir hoffen, daß nicht nur die Kontroverse zum Schwerpunktthema, sondern auch diese sich hier abzeichnende Debatte um Ursachen und >geschlechtsdifferente< Erscheinungsformen rechtsradikaler Orientierungen und Gewalt in den Feministischen Studien fortgesetzt wird. Hilge Landweer & Mechthild Rumpf Anmerkung 1 An dieser Stelle ein Hinweis zu unseren Publikationsentscheidungen: wir haben mit der Praxis, eingereichte Texte prinzipiell vor der Begutachtung zu anonymisieren, in das Prüfverfahren Distanznahmen eingebaut, die es erlauben, aufgrund des jeweiligen Beitrags zur feministischen Diskussion und nicht aufgrund des mit dem Namen konnotierten Bekanntheitsgrades oder Geschlechts über die Annahme eines Textes zu entscheiden. Unauthenticated Download Date | 10/31/17 3:02 AM