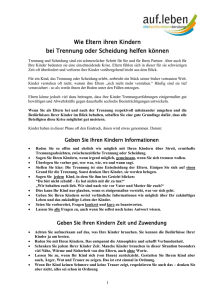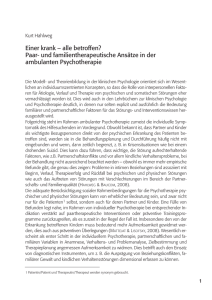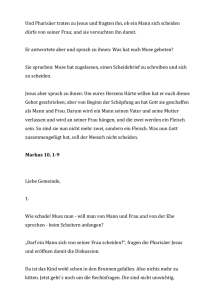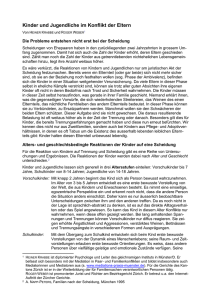Leseprobe
Werbung
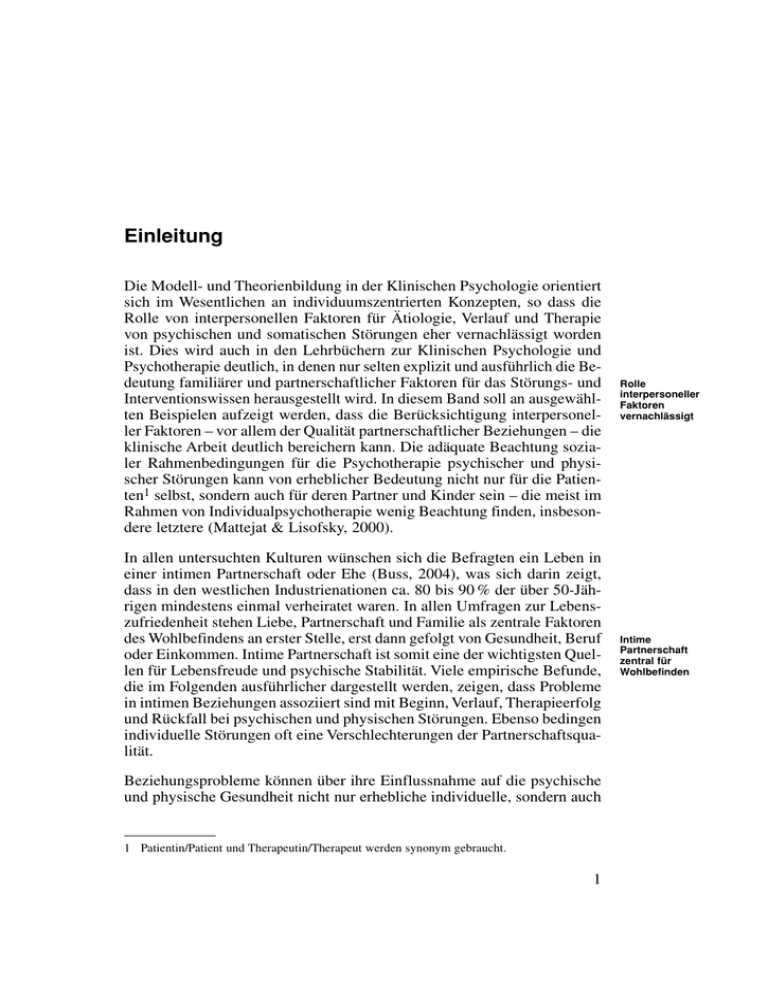
Einleitung Die Modell- und Theorienbildung in der Klinischen Psychologie orientiert sich im Wesentlichen an individuumszentrierten Konzepten, so dass die Rolle von interpersonellen Faktoren für Ätiologie, Verlauf und Therapie von psychischen und somatischen Störungen eher vernachlässigt worden ist. Dies wird auch in den Lehrbüchern zur Klinischen Psychologie und Psychotherapie deutlich, in denen nur selten explizit und ausführlich die Bedeutung familiärer und partnerschaftlicher Faktoren für das Störungs- und Interventionswissen herausgestellt wird. In diesem Band soll an ausgewählten Beispielen aufzeigt werden, dass die Berücksichtigung interpersoneller Faktoren – vor allem der Qualität partnerschaftlicher Beziehungen – die klinische Arbeit deutlich bereichern kann. Die adäquate Beachtung sozialer Rahmenbedingungen für die Psychotherapie psychischer und physischer Störungen kann von erheblicher Bedeutung nicht nur für die Patienten1 selbst, sondern auch für deren Partner und Kinder sein – die meist im Rahmen von Individualpsychotherapie wenig Beachtung finden, insbesondere letztere (Mattejat & Lisofsky, 2000). In allen untersuchten Kulturen wünschen sich die Befragten ein Leben in einer intimen Partnerschaft oder Ehe (Buss, 2004), was sich darin zeigt, dass in den westlichen Industrienationen ca. 80 bis 90 % der über 50-Jährigen mindestens einmal verheiratet waren. In allen Umfragen zur Lebenszufriedenheit stehen Liebe, Partnerschaft und Familie als zentrale Faktoren des Wohlbefindens an erster Stelle, erst dann gefolgt von Gesundheit, Beruf oder Einkommen. Intime Partnerschaft ist somit eine der wichtigsten Quellen für Lebensfreude und psychische Stabilität. Viele empirische Befunde, die im Folgenden ausführlicher dargestellt werden, zeigen, dass Probleme in intimen Beziehungen assoziiert sind mit Beginn, Verlauf, Therapieerfolg und Rückfall bei psychischen und physischen Störungen. Ebenso bedingen individuelle Störungen oft eine Verschlechterungen der Partnerschaftsqualität. Beziehungsprobleme können über ihre Einflussnahme auf die psychische und physische Gesundheit nicht nur erhebliche individuelle, sondern auch 1 Patientin/Patient und Therapeutin/Therapeut werden synonym gebraucht. 1 Rolle interpersoneller Faktoren vernachlässigt Intime Partnerschaft zentral für Wohlbefinden Paartherapeutische Interventionen oft notwendige Ergänzung bedeutsame gesellschaftliche Kosten nach sich ziehen. Diese Befunde legen bei entsprechender Indikation nahe, im Rahmen von individueller Psychotherapie in stärkerem Umfang auf paartherapeutische Interventionen oder präventive Trainingsprogramme zurückzugreifen als bisher. Insbesondere den beteiligten Kindern muss auch aus präventiven Überlegungen heraus deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Partnerschaftliche und familiäre Variablen sollten auch in der Diagnostik, d. h. in Anamnese, Verhaltens- und Problemanalyse, Zielbestimmung und Therapieplanung stärker berücksichtigt werden. Dies betrifft auch den Einsatz diagnostischer Instrumente, um die Ausprägung z. B. von Beziehungskonflikten, familiärer Gewalt und kindlichen Verhaltensstörungen dimensional erfassen zu können. Bevor ausführlich auf die Zusammenhänge von Partnerschaftsqualität und psychische Störungen eingegangen wird, sollen Befunde zu den Folgen von Beziehungskonflikten und Scheidung für die Familienmitglieder referiert werden, die relevant für die Planung und Durchführung von Psychotherapie sein können. Funktionen von Partnerschaft und Familie Binationale Partnerschaften 1 Partnerschaft, Ehe und Familie 1.1 Familien- und Lebensformen Partnerschaft2 und Familie erfüllen eine Reihe von Funktionen, wie Reproduktion (Zeugung von Kindern, Sexualität), Existenzsicherung (z. B. Ernährung, Schutz etc.), Erholung (z. B. gemeinsame Freizeitgestaltung), Sozialisation und Erziehung (z. B. Erwerb von Kompetenzen) und Platzierung (Verwirklichung von bildungs- und berufsbezogenen Interessen). Eine der Hauptfunktionen von Familie besteht in der Möglichkeit, Bindung aufzubauen und zu erleben. Partnerschaft und Familie beinhalten jedoch auch eine Reihe von Aufgaben, darunter die Übernahme von Verantwortung, die Pflicht zur Fürsorge und die Neuordnung von Prioritäten. Obgleich Partnerschaft und Familie in verschiedenen Kulturen unterschiedlich gelebt werden kann, unterscheiden sich die Aufgaben und Funktionen dieser Lebensformen wenig über verschiedene Länder hinweg (Buss, 2004). Kulturelle Aspekte von Partnerschaft und Familie kommen beispielsweise in Stereotypen zum Ausdruck. Hierbei werden bestimmte Standards ver2 Ehe und Partnerschaft werden synonym verwendet, ebenso wie Eheberatung und -therapie oder Paarberatung und -therapie. 2 mittelt, was eine gute Partnerschaft auszeichnet oder wie ein guter Partner oder eine gute Partnerin beschaffen sein sollte. Gerade bei binationalen Partnerschaften können solche Stereotype Anlass für Konflikte bieten. In Deutschland leben in familialen Lebensformen ca. 54 % der Bevölkerung, die restlichen als kinderlose Paare (29 %) oder Singles (18 %). Das mittlere Heiratsalter ist kontinuierlich gestiegen: Betrug es 1985 noch 30 Jahre für Männer und 27 für Frauen, so lag es 2001 bei 36 bzw. 33 Jahren. Dies führt zu einem Anstieg von nichtehelichen Lebensgemeinschaften („Lebensabschnittspartner“), deren Rate im Jahr 2000 in der Gruppe der 25- bis 34Jährigen bei 30 % lag, ca. 40 % waren verheiratet. Durch die ansteigende Scheidungsrate wächst die Anzahl von Alleinerziehenden (ca. 15 %) und Patchwork-Familien. Vor allem bei Alleinerziehenden kommt es häufig zu Überforderungsgefühlen, Ängsten und Depression, verbunden mit oft erheblichen finanziellen Einbußen und geringerer sozialer Unterstützung. 1.2 Familienstatus Definition Partnerschaftsqualität Das Leben von intimen Partnerschaften ist also ein universelles Vorkommen. Was zeichnet nun eine gelungene, was eine gestörte Partnerschaft aus? Die Bestimmung eines reliablen und validen Kriteriums für Partnerschaftsqualität ist schwierig, da es objektive Kriterien nicht gibt. In der Literatur wurden daher eine Vielzahl von Konzepten benutzt, z. B. Eheglück, -anpassung, -zufriedenheit oder -erfolg. Da die Tests zur Erfassung dieser subjektiven Konzepte hoch miteinander korrelieren, verwendet man in jüngster Zeit die Begriffe Partnerschafts-/Ehequalität und -erfolg synonym. Wie wird Partnerschaftsqualität definiert? Ein Prototyp zur Erfassung von Partnerschaftsqualität ist die „Dyadic Adjustment Scale“ (DAS, Spanier, 1976; dt.: Klann, Hahlweg & Heinrichs, 2003). Der international sehr häufig verwendete Fragebogen enthält 32 Items, z. B. „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Partnerschaft?“ „Wie oft streiten Sie mit Ihrem Partner?“ Die interne Konsistenz ist mit 0.96 sehr hoch. Werte von > 100 gelten als Kriterium für hohe, Werte darunter als Zeichen für geringe Partnerschaftsqualität. Dyadic Adjustment Scale DAS Im deutschen Sprachraum hat sich zur Erfassung der Partnerschaftsqualität der Partnerschaftsfragebogen (PFB) bewährt. Der PFB (Hahlweg, 1996; siehe Kapitel 3.1.1) besteht aus 30 Items, die sich 3 Skalen mit je 10 Items zuordnen lassen (Streitverhalten (S), Zärtlichkeit (Z) und Gemeinsamkeit/Kommunikation (G/K)). Ein PFB-Gesamtwert ≤ 53 Rohwertpunkten weist auf eine niedrige/gestörte Beziehungsqualität hin. Partnerschaftsfragebogen PFB 3 Einfacher als Ehequalität ist Ehestabilität zu definieren, da hierbei nur formale Aspekte (Scheidung, Trennung) eine Rolle spielen. Ehequalität und -stabilität sind miteinander korreliert, aber nicht identisch. Zwar sind die meisten Partner unglücklich, deren Ehe in Scheidung endet, aber längst nicht alle unglücklichen Ehen enden in Scheidung. 1.3 Prävalenz von niedriger Beziehungsqualität und Scheidung Repräsentative internationale Studien an frisch verheirateten Paaren zeigen, dass 80 bis 85 % sehr zufrieden mit ihrer aktuellen Beziehung sind. Allerdings tendieren zufriedene Paare dazu, das zukünftige Funktionieren ihrer Beziehung unrealistisch positiv zu beurteilen. So schätzte z. B. die Mehrheit der glücklich verheirateten Paare, allen Angaben über hohe Scheidungszahlen zum Trotz, die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung der eigenen Ehe mit Null ein (s. Hahlweg, 2003). Prävalenzraten Die Zufriedenheit mit der Beziehung nimmt in den ersten 10 Ehejahren dann kontinuierlich ab. In einer repräsentativen Umfrage in den alten Bundesländern an Frauen im Alter von 15 bis 45 Jahren (Döring et al., 1986) gaben 10 % der Befragten mit fester Partnerschaft an, mit ihrer Beziehung unglücklich zu sein, weitere 25 % waren „eher glücklich“. Man kann wohl vermuten, dass viele Frauen aus dieser letzteren Gruppe in Partnerschaften lebten, die noch als gerade erträglich empfunden werden, so dass die Prävalenz von „Risiko-Ehen“ bei ca. 25 bis 35 % liegen könnte. Etwa 26 % der Frauen in festen Partnerschaften haben schon einmal darüber nachgedacht, sich zu trennen bzw. sich scheiden zu lassen. Für Männer sind zuverlässige Zahlen nicht bekannt. Scheidung Steigende Scheidungsraten Die Scheidungsrate ist in der Bundesrepublik Deutschland seit den 60er Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2004 wurden in Deutschland 213.000 Ehen geschieden, was einer Verdoppelung zu 1970 (104.000) entspricht; prozentual werden die meisten Ehen im fünften Jahr geschieden. Man schätzt, dass ca. jede dritte, in Großstädten jede zweite der heute geschlossenen Ehen geschieden werden wird. Rund 56 % der Scheidungen betrafen Paare mit Kindern, so dass eine zunehmende Zahl von minderjährigen Kindern von Scheidung betroffen sind, im Jahre 2003 circa 170.000 Kinder. Von den Geschiedenen heiraten 75 % wieder, davon 3/4 innerhalb von drei Jahren. Leider scheinen Partner nichts zu lernen, ist doch die Scheidungsrate 4 bei diesen Paaren noch höher als die Rate bei Erstverheirateten. In den USA ist jede zweite Ehe für mindestens einen Partner eine Wiederheirat. Von soziologischer Seite werden Auflösungstendenzen der Ehen vor allem aus dem beobachtbaren Funktionswandel abgeleitet. Wurden im Verlauf der industriellen Revolution Ehen noch unter dem Gesichtspunkt der Produktionsgemeinschaft und der materiellen Existenzsicherung geschlossen, so werden Ehen heute vorrangig unter der Prämisse gegenseitiger emotionaler Unterstützung eingegangen, mit diesbezüglich hohen gegenseitigen Erwartungen, an deren Erfüllung viele Paare scheitern. Andere Umstände, z. B. die erhöhte Lebenserwartung der Partner mit der einhergehenden längeren Partnerschaftsdauer (eine Ehe dauerte 1850 durchschnittlich 20, heute könnte sie aufgrund der Lebenserwartung 50 Jahre andauern), veränderte Rollenverteilungen zwischen Männern und Frauen, die verstärkte Berufstätigkeit von Frauen, eine höhere Mobilität der Paare oder Veränderungen im Scheidungsrecht mit nachfolgend größerer gesellschaftlicher Akzeptanz von Scheidung, werden ebenfalls als Einflussfaktoren diskutiert (Halford, 2001). 1.4 Gründe für steigende Scheidungsraten Folgen von Beziehungsstörungen 1.4.1 Auswirkungen von Scheidung Ehescheidung ist eines der am meisten belastenden Ereignisse im menschlichen Leben. Neben einer höheren Rate an psychischer Symptomatik kommt es nach der Scheidung bei den Betroffenen zu einer deutlichen Zunahme von akuten und chronischen körperlichen Erkrankungen. Es gibt umfassende Belege dafür, dass elterliche Scheidung mit einer schlechten Anpassung der Kinder einhergeht. Kinder aus Scheidungsfamilien zeigen im Vergleich zu Kindern aus intakten Familien höhere Raten an externalisierenden und internalisierenden Verhaltensstörungen, schulischen Problemen, Disziplinschwierigkeiten, Beziehungsproblemen mit Gleichaltrigen und eine schlechtere körperliche Gesundheit. Scheidung hat nicht nur einen unmittelbaren Effekt auf die Kinder. Erwachsene, die als Kinder die Scheidung ihrer Eltern erlebt haben, berichten eine geringere Zufriedenheit mit Familie und Freunden, größere Angst, dass ihnen negative Dinge widerfahren und finden es schwieriger, mit Stressoren umzugehen. Eine Metaanalyse von Amato (2001) zur Auswirkung elterlicher Scheidung auf die erwachsenen Kinder kommt zu dem Schluss, dass Erwachsene aus geschiedenen Herkunftsfamilien im Vergleich zu Erwachsenen aus intakten Familien eine verminderte psychische Gesundheit haben, psychologische Behandlungseinrichtungen häufiger nutzen, schlechtere Schulleistungen und eine geringere Ehequalität und -stabilität aufweisen. 5 Auswirkung auf Kinder 1.4.2 Auswirkungen chronischer Partnerschaftskonflikte Chronische Paarkonflikte als Stressor Die Daten zu Scheidung und Scheidungsfolgen sind nicht so zu interpretieren, dass Scheidung generell vermieden werden sollte. Chronische Partnerschaftskonflikte können häufig sogar stärkere Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit der Familienmitglieder haben. So zeigt die Forschung übereinstimmend, dass nicht erst die Scheidung als solche, sondern die bereits längerfristig bestehenden Beziehungskonflikte und die familiäre Zerrüttung im Vorfeld der Trennung oder Scheidung positiv mit psychischen Störungen korreliert, und es Kindern, deren Eltern zu Hause starke Konflikte austragen, bereits vor der Scheidung schlechter geht als Kindern in intakten Familien. Eine Scheidung kann, wenn eine Beziehungsverbesserung nicht zu erreichen ist, ein „Ende des Schreckens“ bedeuten statt eines „Schreckens ohne Ende“ und somit auch Ziel einer Psychotherapie sein. 1.4.2.1 Ehequalität und psychische Störung Den engen Zusammenhang von Ehequalität und psychischen Störungen nach DSM belegt eine Studie von Whisman (1999), der die Daten von N = 2.538 verheirateten Personen im Alter von 15 bis 54 Jahren des „National Comorbidity Survey“ auswertete. Das Odds Ratio gibt an, um das Wievielfache das Risiko steigt, die jeweilige Störung aufzuweisen, wenn die Person in einer Beziehung mit geringer Qualität lebt, im Vergleich zu Partnern in einer Ehe mit hoher Qualität. Es zeigte sich zum einen, dass Partner mit niedriger Ehequalität wahrscheinlicher eine psychische Störung haben als Partner mit hoher Ehequalität, die entsprechenden Odds Ratios erhöhen sich um das 3.1-fache für affektive Störungen, das 2.5-fache für Angststörungen und das 2.0-fache für Abhängigkeiten und sind damit als hoch und klinisch relevant zu bewerten (vgl. Tab. 1). Zum anderen waren – bis auf biploare Störungen (wahrscheinlich auf Grund der geringen Prävalenz) – alle spezifischen Störungen signifikant mit Ehequalität korreliert. Die Befunde mögen in gewisser Weise tautologisch erscheinen, da ein Kriterium für die Bestimmung einer klinisch relevanten Störung ist, dass sie mit bedeutsamen Einschränkungen im sozialen und beruflichen Funktionsniveau einhergehen. Whisman, Sheldon und Goering (2000) untersuchten die Annahme, dass Ehequalität ein spezifischer Stressor ist, an einer Stichprobe von N = 4.933 kanadischen Ehepartnern und erfassten neben der Ehequalität auch das Ausmaß von Belastung im Kontakt mit Familienangehörigen und engen Freunden. Auch bei Auspartialisierung dieser Variablen blieben die signifikanten Zusammenhänge zwischen Ehequalität und psychischen Störungen bestehen. Wurde Ehequalität auspartialisiert, so zeigten sich keine Zusammenhänge zwischen Störung und Schwierigkei6 Tabelle 1: Zusammenhang von Ehequalität (NEQ = niedrige Ehequalität; HEQ = hohe Ehequalität) und psychischen Störungen nach DSM-IV. Reanalyse der Daten des „National Comorbidity Survey“ (nach Whisman, 1999) Störung NEQ % HEQ % Odds Ratio p 15.5 6.9 3.1 ** 14.5 6.2 3.2 ** Dysthymie 4.5 1.2 5.7 ** Bipolare Störung 1.4 0.9 2.0 ns Angststörungen 28.3 14.8 2.5 ** Panikstörung 3.9 1.5 3.5 ** Agoraphobie 4.3 2.0 2.1 * Sozialphobie 10.7 5.9 2.2 ** Spezifische Phobie 12.2 7.7 1.9 ** GAS 5.6 2.5 3.2 ** PTBS 7.4 2.1 3.8 ** 14.8 7.3 2.0 ** 11.8 6.4 1.8 ** 5.3 2.0 2.2 * Affektive Störungen Majore Depression Substanzabhängigkeit Alkohol Medikamente/Drogen Paarqualität und psychische Störung sind korreliert Anmerkungen: GAS = Generalisierte Angststörung, PTBS = Posttraumatische Belastungsstörung; * p < 0.005, ** p < 0.001 ten im Umgang mit anderen Sozialpartnern. Partnerschaftsqualität erscheint somit als relevanter, spezifischer Stressor für das Auftreten psychischer Störungen. 1.4.2.2 „Expressed Emotion“ und Verlauf psychischer Erkrankungen Beziehungsstörungen können nicht nur mit der akuten Krankheitsepisode korreliert sein, sondern spielen auch bei Rückfällen eine bedeutsame Rolle. Diese Befunde der „Expressed Emotion“-Forschung weisen nachdrücklich auf die Notwendigkeit hin, Ehepartner oder Familienangehörige in die ambulante Nachsorge mit einzubeziehen. Der wichtigste interpersonelle Faktor zur Vorhersage eines Rückfalls bei psychischen Störungen ist das Ausmaß der „Expressed Emotion (EE)“-Einstellungen, die Angehörige oder Partner dem Patienten gegenüber zum Ausdruck bringen. Unter dem EE-Konzept 7 versteht man die Art der familiären Umgebung, in der eine Person mit einer psychischen Störung lebt. Erfassung des Expressed Emotion Status (EE) Der EE-Status wird erfasst mit Hilfe des Camberwell Family Interviews. Das CFI ist ein standardisiertes Interview, das mit den wichtigsten Angehörigen des Patienten einzeln durchgeführt wird. Es dauert in der Regel 1 bis 2 Stunden und wird auf Tonband aufgezeichnet, um anschließend auf folgenden Dimensionen beurteilt werden zu können: 1. Kritik seitens des Angehörigen am Patienten (erfasst über die Anzahl kritischer Kommentare, die sich vor allem am Wechsel des Tonfalls deutlich machen). 2. Feindseligkeit des Angehörigen gegenüber dem Patienten. 3. Emotionales Überengagement (erfasst überbeschützende, selbstaufopfernde Verhaltensweisen oder Einstellungen, die der Angehörige schildert; Ratingskala von 0 bis 5). Camberwell Family Interview CFI Ein Angehöriger wird im Anschluss an die Auswertung entweder als hoch EE (HEE: > 6 kritische Äußerungen und/oder ein Rating von ≥ 3 auf der EOI-Ratingskala) oder niedrig EE (NEE) klassifiziert, wobei diese Klassifizierung am ehesten als Typisierung der familiären Umwelt zu verstehen ist, in die ein Patient (gewöhnlich nach einem stationären Aufenthalt) entlassen wird. Am besten ist das Interview zu Beginn einer Hospitalisierung durchzuführen. Kriterien für HEE Tabelle 2: Rückfall nach 9 Monaten bei hohem (HEE) und niedrigem (NEE) Expressed-Emotion-Status Störung HEE NEE Schizophrenie 48 % 22 % Depression 64 % 11 % Bipolar-manisch 91 % 47 % Bisher wurden international 27 Studien publiziert, die den Zusammenhang zwischen familiärer EE-Ausprägung und einem Rückfall bei schizophrenen Patienten untersuchten. Die Rezidivquote lag bei Patienten, die nach der Entlassung aus stationärer Behandlung zu HEE-Angehörigen zurückkehrten, nach 9 bis 12 Monaten bei durchschnittlich 48 %, in NEE-Familien ohne diese Merkmale dagegen nur bei 22 % (s. Hahlweg, Dürr, Dose & Müller, 2006). Eine Metaanalyse ergab eine Effektstärke von r = 0.31. Diese Effektstärke ist nicht trivial, wenn man sie mit Effektstärken aus dem medizinischen Bereich vergleicht: z. B. beruht die Empfehlung, zur Prävention von Herzinfarkten täglich Aspirin zu nehmen, auf 8 einer Effektstärke von r = 0.034! (Butzlaff & Hooley, 1998). Insgesamt kann der Zusammenhang zwischen emotionalem Familienklima und Krankheitsverlauf bei schizophrenen Psychosen als empirisch gesichert angenommen werden. Bei der EE-Variable handelt es sich im Übrigen nicht um ein schizophreniespezifisches Maß, da der signifikante Zusammenhang zwischen EE und Rückfall unter anderem auch bei depressiven und bipolar-manischen Patienten nachzuweisen ist (Miklowitz & Goldstein, 1997). Geäußerte Kritik von Partnern spielt also eine große Rolle für den Störungsverlauf eines psychisch kranken Menschen. EE und Rückfall 1.4.2.3 Gewalt gegen Partner und Kinder Niedrige Beziehungsqualität und häufige Partnerkonflikte sind korreliert mit einer erhöhten Rate an physischer Aggression gegenüber dem Partner und als Konsequenz mit einer höheren Rate an psychischen Störungen. Repräsentative Studien aus den USA ergaben eine jährliche Prävalenzrate ehelicher Gewalt in Höhe von 12.5 %; in Deutschland beträgt diese bei 20bis 45-Jährigen ca. 8.5 % (Wetzels et al., 1995). Familiäre körperliche Gewalt Definition von physischer Strafe bei Kindern und Jugendlichen Leichte physische Strafe wird meist definiert als „Klaps auf den Po“ und/oder „leichte Ohrfeige“, schwere Körperstrafe als „schallende Ohrfeige“, „kräftig den Po versohlen“ und/oder „Tracht Prügel“(BMFSFJ; 2003). Körperliche Kindesmisshandlung wird definiert als „direkte Gewalteinwirkung auf das Kind durch Schlagen, Verbrennen, Verätzen, Schütteln, aber auch die Schädigung durch Intoxikation“. Physische Gewalt gegen Kinder ist weit verbreitet. Umfragen an 3.000 Eltern und 2.000 Jugendlichen aus dem Jahr 2002 zeigen, dass mittlerweile 28 % der Eltern weitestgehend auf physische Strafen verzichten, aber noch 54 % leichtere und 17 % schwere Körperstrafen anwenden (BMFSFJ, 2003). Problematisch ist, dass Aggression sozial vererbt wird: Gewalterfahrene suchen sich häufiger einen gewaltbereiten Partner als Gewaltunerfahrene (Black et al., 2001). Besondere Beachtung sollte sexuellem Missbrauch zukommen, der überwiegend im engen familiären Umfeld geschieht. Die Häufigkeitsangaben hierzu schwanken stark (Mädchen 2 bis 50 %, Jungen: 1 bis 20 %), dies wohl aufgrund der divergierenden Definitionen von sexuellem Missbrauch und der untersuchten Stichprobe. Etwa 6 bis 7 % von Mädchen werden Opfer genitaler Manipulation bzw. Penetration (Egle, 2005). Sexuell missbrauchte Kinder erkranken mit größerer Wahrscheinlichkeit an einer psychischen Störung als Kinder, die nicht sexuell missbraucht wurden. Das Muster der 9 Sexueller Missbrauch