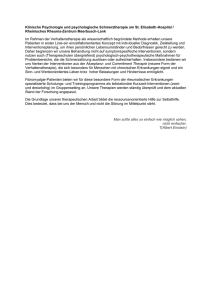Was wissen wir wirklich? - Ruhr
Werbung

Editorial Verhaltenstherapie Verhaltenstherapie 2005;15:136–137 DOI: 10.1159/000087950 Online publiziert: 10. September 2005 Was wissen wir wirklich? Jürgen Margraf Institut für Psychologie, Universität Basel, Schweiz Was wissen wir wirklich über die Ursachen psychischer Störungen? Genau besehen, wissen wir erstaunlich wenig. Die meisten unserer Befunde bleiben auf der Ebene von Korrelationen. Aber wir können dennoch einige wichtige, grundlegende Aussagen machen, die dann später für die mehreren Hundert Störungen aus ICD oder DSM ausdifferenziert werden müssen. Grundsätzlich entstehen psychische Störungen bei einer negativen Balance zwischen gesundheitsfördernden, schützenden, salutogenen Faktoren einerseits und pathogenen Faktoren andererseits. Bei den pathogenen Faktoren ist es zudem sinnvoll, zwischen Vulnerabilität, auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren zu unterscheiden. Abbildung 1 veranschaulicht dieses Beziehungsgeflecht. Auf der Seite der pathogenen Faktoren haben die verschiedenen Berufsgruppen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Während psychiatrische und biologische Theoretiker vor allem die Vulnerabilität betonten, konzentrierten sich Umwelttheoretiker stärker auf auslösende Bedingungen, insbesondere im sozialen Raum. Die Verhaltenstherapie betonte von jeher neben den auslösenden vor allem die aufrechterhaltenden Faktoren. Allgemein tendieren Kliniker dazu, die Rolle pathogener Bedingungen zu überschätzen und die Bedeutung salutogener und schützender Prozesse zu vernachlässigen. Mit Hilfe dieses Denkmodells wird deutlich, dass wir am besten über die aufrechterhaltenden Faktoren Bescheid wissen und am wenigsten über die Bestandteile und Mechanismen der Vulnerabilität. Natürlich sind die aufrechterhaltenden Faktoren als Ansatzpunkt für therapeutische Veränderungen von besonderer Bedeutung. Wir wollen ja die Zukunft verändern und nicht die Vergangenheit. Aber aus ätiologischer Perspektive ist es mehr als unbefriedigend, dass wir so wenig darüber wissen, wie pathogene Entwicklungen überhaupt in Gang kommen bzw. wie und warum die Balance zwischen salutogenen und pathogenen Einflüssen ins Negative umschlägt. © 2005 S. Karger GmbH, Freiburg Fax +49 761 4 52 07 14 E-mail [email protected] www.karger.com Accessible online at: www.karger.com/ver Unser schlechter Kenntnisstand hat zu einem erheblichen Teil forschungspraktische Gründe. Der weitaus größte Teil der Forschung geschieht an Menschen, die bereits eine Störung entwickelt haben. Diese suchen klinische Einrichtungen auf und stellen sich eher für Forschung zur Verfügung. Werden nun mehr oder minder spezifische Auffälligkeiten bei einer Gruppe von Patienten mit einem bestimmten Problem festgestellt, so bleibt die Frage nach der Kausalität immer offen [vgl. Barnow et al., 2005; Forstmeier und Rüddel, 2005; Hechler et al., 2005]. So wichtig derartige Befunde sind, stellen sie aus ätiologischer Perspektive doch nur einen ersten Schritt dar. Letzten Endes haben wir nur eine Korrelation zwischen dem Vorliegen der Störung und der wie auch immer erfassten «Auffälligkeit» gefunden. In Bezug auf die Störungsvariable bleibt dieser Ansatz korrelativ. Als Königsweg zu kausalen Aussagen gilt nach wie vor das Experiment. Ein echter experimenteller Ansatz stößt aber in unserem Feld auf enge ethische Grenzen: Wir können nicht einfach Menschen krank machen, um unsere Theorien zu überprüfen. Damit bleibt das Henne-Ei-Problem ungelöst. Was kam zuerst: die Depression oder die kognitive Verzerrung, der passive Rückzug, die Auffälligkeiten im serotonergen System, beim Cortisol oder bei der Stressverarbeitung? Wollen wir jedoch wirklich verstehen, wie psychische Gesundheit und Krankheit entstehen, so müssen wir über das rein korrelative Stadium der Forschung hinauskommen. Dazu müssen wir die von uns angenommenen ätiologischen Faktoren zunächst in dem dargestellten Schema einordnen. Dann müssen wir zeigen, dass die potentiellen Vulnerabilitätsfaktoren oder Auslöser wirklich der Störung vorausgehen und wie sie mit salutogenen und schützenden Faktoren interagieren. Das kann nur mit Hilfe prospektiver Längsschnittstudien erfolgen, deren hoher Aufwand ein wichtiger Grund für ihre Seltenheit ist. Im nächsten Schritt müssen wir untersuchen, ob sich derartige Faktoren verändern lassen und schließlich, ob Prof Dr. rer. soc. Jürgen Margraf Institut für Psychologie Universität Basel Missionsstr. 60–62, 4055 Basel, Schweiz Tel. +41 61 26706-60, Fax -48 E-mail [email protected] Abb. 1. Abb. 1. Klassen ätiologischer Faktoren in der Entstehung psychischer Störungen (modifiziert nach Margraf [2000]). ihre positive Veränderung tatsächlich das Neuauftreten der Störungen verhindert oder verringert. Dazu sind systematische Präventionsstudien erforderlich [vgl. Liberman und Robertson, 2005]. Diese stellen eine ethisch akzeptable Alternative zur Induktion pathogener Faktoren dar. Werden sie hinreichend exakt geplant und durchgeführt, so können sie als ein «gesund machendes» Experiment angesehen und ausgewertet werden. Natürlich sind Prävention und mehr noch Therapie so komplex, dass die einfache Rückführung der Ergebnisse auf einzelne Prozesse immer problematisch bleiben wird [vgl. Lutz et al., 2005]. Da die für die Ätiologie in Frage kommenden Faktoren und Prozesse die gesamte Bandbreite von Biologie und Genetik über Psychologie und Neurowissen- Was wissen wir wirklich? schaften bis hin zu Soziologie und Ökonomie umfassen, muss die Forschung vermehrt interdisziplinär angelegt sein. Dies darf nicht nur ein Wort für Sonntagsreden sein. Ohne die Überwindung der disziplinären Insularität, die den allergrößten Teil der Forschung kennzeichnet, wird kein echter Fortschritt möglich sein. Ohne ein tief greifendes Verständnis der Ätiologie sind jedoch die Chancen für bessere Therapie und vor allem Prävention minimal. Und warum brauchen wir das alles? Weil psychische Störungen die große Epidemie darstellen, die auf uns zurollt. Individuelles Leiden und gesellschaftliche Kosten psychischer Störungen sind weitaus höher, als die meisten Menschen vermuten. Diese Epidemie werden wir nicht mit rein kurativen Maßnahmen bewältigen können. – Aber ist es nicht eine der spannendsten Fragen, die Ursachen wirklich zu verstehen? Literatur Barnow S, Plock K, Spitzer D, Hamann N, Freyberger H-J: Trauma, Temperamentsund Charaktermerkmale bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und komplexer posttraumatischer Belastungsstörung. Verhaltenstherapie DOI: 10.1159/000087439. Forstmeier S, Rüddel H: Zur Überlegenheit von Selbstregulation über Selbstkontrolle in Psychotherapie und psychosomatischer Rehabilitation. Verhaltenstherapie DOI: 10.1159/000087450. Hechler T, Beumont P, Touyz S, Marks P, Vocks S: Die Bedeutung körperlicher Aktivität bei Anorexia nervosa: Dimensionen, Erfassung und Behandlungsstrategien aus Expertensicht.Verhaltenstherapie DOI: 10.1159/000087374. Liberman RP, Robertson MJ: A pilot, controlled skills training study of schizotypal high school students. Verhaltenstherapie DOI: 10.1159/000087775. Lutz W, Tholen S, Kosfelder J, Tschitsaz A, Schürch E, Stulz N: Evaluation und störungsspezifische Rückmeldung des therapeutischen Forschritts in der Psychotherapie. Verhaltenstherapie DOI: 10.1159/000087551. Margraf J: Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Bd 1, ed 2. Berlin, Springer, 2000. Verhaltenstherapie 2005;15:136–137 137