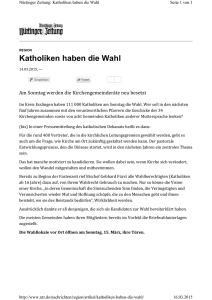Am Puls der Zeit
Werbung

Andreas Püttmann Am Puls der Zeit Aufschlußreiches aus neuen Allensbacher Studien Kein deutsches Meinungsforschungsinstitut hat einen so großen Fundus an Umfragen zum Denken, Glauben, Fühlen und Leben der Deutschen erarbeitet und veröffentlicht. Keines ist dabei so sehr zum Markennamen für die ganze Zunft geworden wie „Allensbach“, das in einem kleinen Ort am Bodensee gelegene „Institut für Demoskopie“ (IfD). Seine Jahrbücher – dessen erstes den Zeitraum 1947 bis 1955 umfaßt – dokumentieren mittlerweile mehr als sechs Jahrzehnte deutscher Geschichte. Der Band 11 (1998-2002) wurde unter dem Titel „Balkon des Jahrhunderts“ noch von der legendären „Pythia“, der Gründerin Elisabeth Noelle-Neumann, zusammen mit Co-Geschäftsführerin Renate Köcher herausgegeben. Band 12 (2003-2009) unter dem Titel: „Berliner Republik“ hat nur noch eine Herausgeberin und ist Elisabeth Noelle gewidmet, die am 25. März 2010 hochbetagt in Allensbach starb. 1916 unter Kaiser Wilhelm II. in einer großbürgerlichen Berliner Familie geboren, in der Weimarer Republik herangewachsen, hatte sie seit 1935 in Berlin, Königsberg und an der University of Missouri in den USA Philosophie, Geschichte, Zeitungswissenschaft und Amerikanistik studiert und 1940 bei Emil Dovifat mit einer Dissertation über „Amerikanische Massenbefragungen über Politik und Presse“ promoviert. Nach einem Volontariat bei der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ schrieb die den Nationalsozialisten zunächst nicht abgeneigte Protestantin für die von Joseph Goebbels herausgegebene Wochenzeitung „Das Reich“. Nach ihrer fristlosen Entlassung im November 1942 aufgrund eines den Nazis zu wenig negativen Roosevelt-Portraits ging sie zu der dem Regime distanziert gegenüberstehenden „Frankfurter Zeitung“, die allerdings im August 1943 auf Befehl Hitlers eingestellt wurde. Bis zum Kriegsende war sie für verschiedene andere im Frankfurter Verlag erscheinende Zeitschriften und dann für das vom Auswärtigen Amt initiierte, in schwedischer Sprache erscheinende Monatsblatt „Tele“ tätig, bei dem etliche bei den Nazis in Ungnade gefallene Spitzenjournalisten untergekommen waren. 1947 gründete Elisabeth Noelle dann mit ihrem Kollegen und ersten Ehemann Erich Peter Neumann das erste deutsche Meinungsforschungsinstitut. Seit 1965 baute sie zudem als Professorin das Mainzer „Institut für Publizistik“ auf, aus dem so renommierte Kommunikationswissenschaftler wie Hans Mathias Kepplinger, Wolfgang Donsbach, Klaus Schönbach, Winfried Schulz und Jürgen Wilke hervorgingen. International wirkte sie unter anderem von 1978 bis 1991 als Gastprofessorin an der Universität von Chicago und von 1978 bis 1980 als Präsidentin der „World Association for Public Opinion Research“ (WAPOR), für deren Fachzeitschrift sie seit 1989 als Mitherausgeberin verantwortlich war. Im 40 gleichen Jahr holte sie die Diplom-Volkswirtin Renate Köcher in die Geschäftsführung des IfD. Mit dieser Entscheidung sicherte sie nicht nur – was ja heute als wesentlich gilt – das weibliche Regiment in dem 1996 zur „Stiftung Demoskopie Allensbach“ übergeleiteten Privatunternehmen. Wichtiger ist, daß die 2003 vom Land Baden-Württemberg zur Professorin ernannte Renate Köcher wie ihre Vorgängerin ein weit über die Marktforschung hinaus reichendes, wissenschaftliches und gesellschaftspolitisches Interesse an der Institutsspitze gewährleistet. I. Behauptete und wahre Probleme von Familien mit Kindern Dies dokumentieren neben dem neuen Jahrbuch (hier: JB) auch wieder eindrucksvoll die im Jahr 2010 publizierten Studien „MDG-Trendmonitor Religiöse Kommunikation“ (hier: TM) und das von Allensbach-Mitarbeiter Wilhelm Haumann erarbeitete, vom Verein „Forum Familie Stark Machen“ herausgegebene „Generationenbarometer 2009“ (hier: GB). Darin berichten Eltern zwar insgesamt davon, daß sie viel Sorgfalt für die Erziehung und Förderung ihrer Kinder aufwenden, doch bekunden von den jüngeren Leuten heute nur noch 18 Prozent, daß ihre Eltern ihnen eine „feste religiöse Bindung“ mit auf den Weg gegeben hätten. Von den Menschen über 60 wurden noch 46 Prozent dezidiert im Glauben erzogen. Die „Hauskirche Familie“ hat an Gewicht verloren. Etwa die Hälfte der jungen Eltern denken heute noch, daß ihre Kinder Mitglied einer Kirche sein sollten; die religiöse Erziehung ihrer Kinder hält jedoch nur ein Drittel für wichtig. Zu den erfreulichen Befunden der Generationenstudie gehört, „daß in den religiös geprägten Familien in der Regel Werte und Einstellungen vorherrschen, die für einen guten Zusammenhalt der Familie sorgen und die Erziehung deshalb eher gelingen lassen“ (GB 43). Erfreulich zugenommen hat auch der Wohlstand: Jüngere Leute (<30) berichten ungleich häufiger als ältere (>60) darüber, daß ihre Eltern ihnen „viel geboten“ hätten (53 zu 18 Prozent). Ein eigenes Zimmer haben heute drei von vier Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren, bei den Älteren hatte dies nicht mal jeder Dritte. „Dieser Platzgewinn ergibt sich nur zum kleineren Teil durch eine Verringerung der Kinderzahlen in den Familien (...): Auch unter den Einzelkindern vergrößerte sich der Anteil der Zimmerbesitzer noch einmal, von 74 um 1960 auf inzwischen 99 Prozent der etwa Zehnjährigen. Von der Verbesserung der materiellen Lebensverhältnisse in der Mehrzahl der Familien zeugen zudem größere Mengen von Spielzeug in den Regalen und von Markenkleidung in den Schränken der Kinderzimmer“ (GB 17). Zwei Drittel der 14- bis 15-Jährigen verfügen sogar über einen eigenen Fernseher und einen eigenen Computer. Die 6- bis 13Jährigen können heute aus Geldgeschenken und Taschengeld bereits einen Geldbetrag von durchschnittlich über 1000 Euro ihr Eigen nennen. Diese Sparergebnisse sind möglich, obwohl regelmäßig auch ein beträchtlicher Teil der Einnahmen für Süßigkeiten, Comics, Spielzeug usw. ausgegeben wird. Zudem sorgte die demographische Entwicklung dafür, daß der Wohlstand der meisten Kinder sogar noch überproportional zur allgemeinen Wohlstandsentwicklung anwuchs. Durch die Verringerung der Kinderzahlen sowie durch die 41 längere Lebenserwartung der Großeltern und deren vergleichsweise hohe Renten ergaben sich „Kumulationseffekte“: Mehr Erwachsene, die über mehr Geld und mehr Zeit verfügen als die älteren Generationen vor ihnen, umsorgen weniger Kinder. 72 Prozent der jungen Eltern (25 bis 35-Jährige) bauen für den Fall finanzieller Schwierigkeiten auf Unterstützungsleistungen ihrer Familie. Trotz häufigerer Erwerbstätigkeit der Mütter berichten jüngere Leute (<30) viel häufiger als Ältere (>60) davon, daß ihre Eltern genügend Zeit für sie gehabt hätten. Im Blick auf solche Daten purzeln Klischees einer gewissen larmoyantkonservativen Familienlobby und materialistisch fixierten „Geburtenpolitik“ gleich reihenweise. Zwar bleibt die Situation einer Minderheit von „Problemfamilien“ herausfordernd für die Sozial-, Familien- und Bildungspolitik; doch ist die relative Armut von etwa 10 Prozent der Kinder in Deutschland angesichts veränderter Maßstäbe der reicher gewordenen Gesellschaft meist nur ein Übel, das üblichen Lebensverhältnissen der Kinder vor einer oder zwei Generationen entspricht (GB 45). Dennoch gibt es durchaus berechtigte Sorgen, die aber mehr auf der normativen Erziehungsebene liegen und teilweise durch den Wohlstandszuwachs verursacht oder begünstigt sind: Daß Kinder „zu viel Zeit vor dem Fernseher oder dem Computer verbringen“, beklagen 85 Prozent der Eltern von Kindern unter 16 Jahren; 75 Prozent finden, „daß sie zu früh mit Alkohol und Zigaretten in Berührung kommen“ und „zu wenig Bewegung haben“ und 68 Prozent, daß sie „häufig übergewichtig“ sind und sich ungesund ernähren. 63 Prozent meinen, Kinder bekämen heute „zu wenig Werte und Orientierungen vermittelt“, und eine große absolute Mehrheit sagt: „Sie kennen keine klaren Regeln und Vorgaben“ (60%) und „Sie können häufig nicht erkennen, was richtig und was falsch ist“ (59%, vgl. GB 65). Daß dies nicht einfach nur ein Vorurteil der Elterngeneration gegenüber einer von jeher skeptisch betrachteten „Jugend von heute“ ist, läßt die Selbsteinschätzung der 16- bis 29-Jährigen ahnen: Zu den typischen Eigenschaften ihrer eigenen Generation zählen nur 37 Prozent „klare Vorstellungen davon, was richtig und was falsch ist“, in der Generation „60+“ aber 68 Prozent. Bei der Charakterisierung: „Legt viel Wert darauf, Spaß zu haben, das Leben zu genießen“ beträgt die entsprechende Kluft zwischen Jung und Alt 76 zu 17 Prozent, bei dem Freiheitsindikator: „Man konnte oft machen, was man wollte“ 71 zu 20 Prozent (JB 684). „Prinzipientreue“ zählen nur 3 Prozent der Bevölkerung zu den typischen Eigenschaften heutiger junger Leute, 54 Prozent zu denen der älteren Generation. Diese wird auch als erheblich fleißiger, höflicher, hilfsbereiter und verantwortungsbewußter wahrgenommen; weit häufiger als älteren werden jüngeren Leuten Gleichgültigkeit (54:16%), Respektlosigkeit (53:5) und Egoismus (52:18) zugeordnet (JB 688). II. Abschied vom Prinzipiellen Die Schwäche normativer gegenüber hedonistischen Orientierungen dürfte einen Grund im zunehmenden Ausfall der religiösen Erziehung haben: Denn die Mei42 nung: „Es gibt völlig klare Maßstäbe, was gut und was böse ist. Die gelten immer für jeden Menschen, egal, unter welchen Umständen“ wurde in einer Allensbacher Befragung vom Mai 2005 (JB 190) von der Hälfte der regelmäßigen Gottesdienstbesucher geteilt, aber nur von einem Drittel der kirchenfernen Christen und Konfessionslosen. Die relativistische Gegenposition: „Es kann nie völlig klare Maßstäbe über Gut und Böse geben. Was gut und böse ist, wird von der jeweils herrschenden Kultur oder Religion bestimmt“, fand die Zustimmung von nur 18 Prozent der katholischen und 29 Prozent der evangelischen Christen mit starker Kirchenbindung; unter kirchenfernen Christen waren es jedoch 47, unter Konfessionslosen 49 Prozent.1 Hierzu paßt, daß vor allem die katholische Kirche und zuvörderst der Papst schon seit Jahren die Gefahren eines wachsenden Relativismus einschärfen. Daß prinzipiell-moralisches Denken gegenüber zweckrationalem Pragmatismus an Boden verloren hat, zeigt auch der Langzeittrend bei der Frage: „Wenn Politiker sich daranmachen, drängende Probleme in unserer Gesellschaft zu lösen, was ist für die Politiker Ihrer Ansicht nach dabei wichtiger: daß sie ihren politischen Überzeugungen und Prinzipien treu bleiben, oder daß sie möglichst rasch praktische Lösungen finden, auch wenn sie dabei einmal von ihren Prinzipien abweichen?“ 1992 fand noch jeder Zweite die Prinzipientreue wichtiger als „möglichst rasch praktische Lösungen zu finden“, im Jahr 2009 nicht einmal mehr jeder Vierte (23%); demgegenüber verdoppelte sich die Präferenz für pragmatische Lösungen von 33 auf 62 Prozent (JB 271). In tugendethischer Akzentuierung erreichten allerdings auch 2009 moralische Attribute im Anforderungsprofil Höchstwerte: „ehrlich, aufrichtig“ (88%), „glaubwürdig“ (88%), „menschlich“ (77%) und „anständig“ (66%) zu sein, fanden jeweils breite Mehrheiten „bei einem Spitzenpolitiker besonders wichtig“ (JB 272). Persönliche Untadeligkeit, Authentizität und Empathie bei „Geschmeidigkeit“ in der Sache scheint zum Idealtyp des geschätzten Staatsmannes von heute geworden zu sein. Geradlinige „Macher“-Typen von Helmut Schmidt bis Karl-Theodor zu Guttenberg sind entsprechend populär, auch wenn sie, wie der Altkanzler mit seiner Kritik am Friedensnobelpreis für den chinesischen Menschenrechtler Liu Xiaobo, moralische Prinzipien politisch-ökonomischen Interessen unterordnen, oder, wie der Verteidigungsminister beim politischen Dogma der Wehrpflicht, eine Kehrtwende um 180 Grad vollziehen. Und auch das paßt ins Bild: Unter den Parteien galt die Union im September 2009 mit deutlichem Abstand als diejenige, die „sich bei ihrer Politik am ehesten an festen Wertvorstellungen und Idealen orientiert“ (29%); auf Platz zwei landeten die Grünen mit 10, knapp vor der SPD mit 9 und der Linken mit 8 Prozent. Der FDP sprachen nur 5 Prozent eine klare Wertorientierung zu (JB 261). Unbeschadet dessen ging sie kurz darauf mit fast 15 Prozent der Zweitstimmen als strahlender Wahlsieger aus der Bundestagswahl hervor. Einen der bedenklichsten Befunde im Zeittrend liefert die Frage: „Glauben Sie, daß die Beamten in Deutschland im Allgemeinen unbeeinflußbar und unbestechlich sind?“ Die Antwort: „Nein, sind bestechlich“ sank in den zwanzig Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland zunächst von 59 auf 29 Pro43 zent, stieg aber zwischen 1964 und 2005 um mehr als das Doppelte auf 65 Prozent an, in Ostdeutschland seit 1992 (55%) sogar auf 70 Prozent (JB 188). Brisanz gewinnt dieses Ergebnis zusätzlich dadurch, daß die Verwaltung noch vergleichsweise wenig als Problemfeld der Korruption gilt; jeder Zweite vermutet korrupte Verhaltensweisen am ehesten in der Wirtschaft, knapp ein Drittel in der Politik, ein Zehntel im Sport (JB 189). Auch hat das seit 1949 gewachsene Vertrauen gegenüber anderen Menschen seit 2001 wieder abgenommen: Daß es „mehr gutwillige als böswillige Menschen“ gebe, meinte nach der Nazidiktatur nur jeder Dritte und seit 1962 stets eine starke absolute Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung; zwischen 2002 und 2007 sackte der Wert aber von 60 auf 46 Prozent ab, und fast ein Fünftel (im Westen 18, im Osten 21 Prozent) vermuten jetzt ausdrücklich, es gebe „mehr böswillige Menschen“ (JB 790). Auch hierfür könnte der religiöse Faktor eine gewisse Rolle spielen: Nicht nur frühere Allensbacher Umfragen2 zeigten, daß mit der Nähe zur Kirche auch das Grundvertrauen in die Mitmenschen wächst, sondern auch ein soziologisch-theologisches Forschungsprojekt um Dieter Hermann (Heidelberg), Norbert Mette (Dortmund), Klaus Kießling (Frankfurt), Albert Biesinger (Tübingen) und Reinhold Boschki (Bonn): Die Gruppe trat nach der ersten Phase ihrer Untersuchung zu „Religion und Gesellschaft“ am 22.11.2010 mit dem Befund an die Öffentlichkeit, daß eine christliche Werteerziehung zu größerem Vertrauen in Personen und Einrichtungen führe.3 III. Die Deutschen und der Islam Im letzten Teil (über „Einstellungen und Empfindungen“) des 914 Seiten starken Allensbacher Jahrbuches finden sich 33 Seiten über „Kirche und Glaubensfragen“, von denen inzwischen fast ein Drittel dem Islam gewidmet ist, darunter ein erstmals in der FAZ (17.5.2009) publizierter Artikel von Thomas Petersen unter dem Titel: „Eine fremde, bedrohliche Welt“. Demnach erwarteten 61 Prozent der Bevölkerung im Mai 2006 statt einer friedlichen Koexistenz von Christentum und Islam „immer wieder schwere Konflikte“ weil „diese Religionen zu verschieden“ seien; diese pessimistische Erwartung wuchs sogar zu einer Zweidrittelmehrheit, wenn die Frage auf die „westliche und islamische Welt“ und die „Verschiedenheit der Kulturen“ abhob; für 56 Prozent (2004: 46 Prozent) haben wir bereits einen „Kampf der Kulturen“ (JB 824). Jeweils die Hälfte der Bevölkerung fühlte sich durch den Karikaturenstreit „stark“ oder „sehr stark beunruhigt“, äußerte „kein Verständnis“ dafür, „daß sich viele Moslems durch die Karikaturen in ihren religiösen Gefühlen verletzt sehen“ (JB 825), gab der „Presseund Meinungsfreiheit“ Vorrang vor der „Rücksichtnahme auf religiöse Gefühle“ und lehnte ein Verbot von Karikaturen zu religiösen Themen ab; dafür sprachen sich 31 Prozent aus (JB 826). Einen behördlich genehmigten Bau einer Moschee gegen den Willen der Bevölkerung des Stadtviertels lehnte im März 2008 eine Zweidrittelmehrheit ab („Man sollte auf den Bau verzichten“), im Falle eines buddhistischen Tempels lag die Ablehnung bei 62, bei einer Synagoge nur bei 54 Prozent; dagegen sollte „ein 44 Jugendzentrum“ auch gegen den Willen der Anwohner gebaut werden; hier votierte nur ein Viertel der Befragten für den Verzicht (JB 829). Angesichts der ausgeprägten Skepsis gegenüber dem Islam mag es zunächst verwundern, daß die Bevölkerung (im März 2006) dem Christentum in Deutschland keineswegs mehrheitlich „gegenüber anderen Religionen eine bevorzugte Stellung“ einräumen will, weil es „zum Kern unserer Kultur“ gehöre: Nur 42 Prozent befürworten eine herausgehobene Rolle der christlichen Religion, weit weniger als der Anteil der Kirchenmitglieder. 43 Prozent pochen dagegen darauf, daß „alle Religionen in Deutschland gleichberechtigt sein“ müßten, und jeder Sechste erklärt sich unentschieden (JB 829). Führt man jedoch das Argument ein, daß es „in manchen Ländern verboten ist, Kirchen zu bauen“, dann will eine starke absolute Mehrheit (56%, Mai 2005) durchaus das Grundrecht der Religionsfreiheit für Muslime in Deutschland einschränken und ihnen im Gegenzug verbieten, Moscheen zu bauen, obwohl sie ja normalerweise keinerlei Verantwortung für die Unfreiheit von Christen in islamischen Ländern tragen (JB 828f). 40 Prozent stimmen sogar der Meinung zu: „Um zu verhindern, daß es zu viele radikale, gewaltbereite Moslems in Deutschland gibt, sollte man die Ausübung des islamischen Glaubens in Deutschland stark einschränken“ (JB 832). Gleichzeitig hält aber eine Zweidrittelmehrheit – politisch korrekt – ausdrücklich nicht „den Islam insgesamt für eine Bedrohung“, sondern „nur einzelne radikale Anhänger dieser Religion“ (JB 828). Um all dies unter einen Hut zu bringen, muß man sich wohl abgewöhnen, von der vox populi ein stets konsistentes und konsequent differenzierendes Denken zu erwarten. Dem Einzelmenschen als „Wesen im Widerspruch“ gleicht vielmehr auch ein politisch witterungsabhängiger, stimmungsanfälliger „Volkskörper“. Ihm sind das Prinzip der repräsentativen Demokratie und der Primat des Rechtsstaats vor der Volkssouveränität als Korsett erheblich notweniger, als die Befürworter von mehr direkter Volksherrschaft sich das in ihrer „basisdemokratischen“ Polit-Romantik gern ausmalen. IV. Wechselhafte päpstliche Popularitäten Die Wechselfälle des „Hosianna“ und „Kreuziget ihn“ der Massenstimmung hat auch speziell die katholische Kirche in den letzten Jahren zu spüren bekommen, zuvörderst in der Person ihrer Päpste. Dafür lohnt es sich, den Fundus früherer Allensbacher Jahrbücher mit heranzuziehen. Johannes Paul II. fuhr in der deutschen öffentlichen Meinung Deutschlands regelrecht Achterbahn: Seine anfänglich hohen Sympathiewerte als Inspirator und Schutzpatron der „Solidarnosc“ sackten parallel zur Entfaltung seiner moralischen Lehre und Kirchenregierung rasant ab. Daß der polnische Pontifex ihnen „ausgezeichnet“ gefalle, meinte laut Allensbach im November 1978 jeder fünfte Deutsche, im August 1989 nur noch jeder zwanzigste; der Anteil derer, denen Johannes Paul II. „gut“ gefiel, halbierte sich im selben Zeitraum von 51 auf 25 Prozent. Die positiven Bewertungen insgesamt sanken damit in einem Jahrzehnt von 70 auf 30 Prozent – notabene: unter das heutige Popularitätsniveau von Benedikt XVI. Dagegen wuchs der Anteil der Kritiker, denen Johannes Paul II. nur „einigermaßen“ oder „wenig/gar 45 nicht“ gefiel, von 10 auf 24 bzw. 2 auf 33 Prozent, zusammen also von einem Achtel der Bevölkerung auf eine absolute Mehrheit von 57 Prozent.4 Die Ursachen erhellt ein anderer Befund: Schätzten 1978 noch 60 Prozent Karol Wojtyla als „eher fortschrittlich“ ein, so waren es 1989 nur noch 24 Prozent, während die Einschätzung, daß er „konservativ“ sei, von 22 Prozent auf 55 Prozent stieg. Selbst der Hälfte der Katholiken gefiel der Papst 1989 nur „einigermaßen“ (26%) oder „wenig/gar nicht“ (24%); nur jeder dreizehnte deutsche Katholik fand Johannes Paul II. „ausgezeichnet“, von den Katholiken unter 30 Jahren sogar nur 2 Prozent. „Wenn Sie jetzt einmal an Papst Johannes Paul II. denken, und was Sie über ihn als Mensch wissen“, fragte Allensbach weitere sechs Jahre später im Dezember 1995, „Würden Sie sagen, Papst Johannes Paul II. ist für Sie persönlich in irgendeiner Hinsicht ein Vorbild, oder würden Sie das nicht sagen?“ 64 Prozent aller Deutschen und 51 Prozent der Katholiken meinten: „Würde ich nicht sagen“, obwohl die Formulierung „in irgendeiner Hinsicht“ ein breites Spektrum an vorbildlichen Attributen eröffnete. Nur 18 Prozent aller Deutschen und 33 Prozent der Katholiken sprachen dem Pontifex in diesem weiten Sinne Vorbildcharakter zu. Selbst unter den kirchennahen Katholiken, die regelmäßig den Sonntagsgottesdienst besuchen, fiel 41 Prozent gar nichts Vorbildliches an ihrem Kirchenoberhaupt ein.5 Als die Demoskopen im März 1999 die 18-24jährigen Deutschen fragten: „Hier sind einmal einige Personen aufgeschrieben. Bei welchen würden Sie sagen: Das sind echte Vorbilder, Leute, die man bewundern kann?“, landete Johannes Paul II. mit 11 Prozent der Nennungen auf Platz 26, knapp vor Verona Feldbusch und Michael Jackson, weit hinter Lady Di und Bill Gates (33%), Michael Schumacher (32%), Boris Becker (29%), dem Dalai Lama und Steven Spielberg (28%), Thomas Gottschalk (22%) und Madonna (19%). Selbst der eben abgewählte Helmut Kohl (21%) und Politiker wie Bill Clinton und Joschka Fischer (18%), Gerhard Schröder (17%) und Wolfgang Schäuble (13%) galten als bewunderungswürdiger.6 Nachdem der Papst kurz darauf ein feierliches Schuldbekenntnis für das von Katholiken und im Namen der Kirche begangene Unrecht abgelegt hatte, wählten in einer Umfrage unter drei vorformulierten Bewertungen 40 Prozent die kritischste: „Die Absicht ist gut, aber es hat überhaupt nicht ausgereicht, was der Papst gesagt hat. Er hätte deutlicher werden und klarer sagen müssen, wo die katholische Kirche Schuld auf sich geladen hat“; nur 23 Prozent stimmten der Meinung zu: „Man muß es dem Papst hoch anrechnen, daß er diesen Schritt getan hat. Er hat alles gesagt, was zu sagen war, und es war nötig das einmal auszusprechen“. Selbst unter Katholiken war nur jeder Dritte mit dem Schuldbekenntnis zufrieden (32%); für eine knappe Mehrheit (34%) ging der Papst nicht weit genug, für eine kritische Minderheit zu weit (15%).7 Wo es um selbstkritische Schulderklärungen der katholischen Kirche geht, kann es den Deutschen offenbar gar nicht zerknirscht und häufig genug sein, damals wie heute. Obwohl Rom seinen unpopulären Kirchenkurs hielt, wendete sich schließlich das Blatt: 2003 sahen die Sympathiewerte Johannes Pauls II. erheblich besser aus als in den beiden ersten Jahrzehnten seines Pontifikats: In einer Infratest dimap46 Umfrage für die Konrad-Adenauer-Stiftung nannten 54 Prozent den Papst nun „eine beeindruckende Persönlichkeit“. Bei Katholiken überwog die Bewunderung nun eindeutig mit 62 zu 35 Prozent, bei Protestanten knapp mit 51 zu 45 Prozent. Fast jeder fünfte Protestant konnte sich „vorstellen, daß in nicht allzu ferner Zukunft ein Papst als Oberhaupt von allen Christen, also auch der evangelischen, anerkannt wird“. Unter den regelmäßigen Kirchgängern nannte sogar eine Dreiviertelmehrheit Johannes Paul II. „eine beeindruckende Persönlichkeit“.8 Fast doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor erklärten ihn posthum in einer Allensbacher Umfrage vom Mai 2005 nun auch zu einem persönlichen Vorbild: die Hälfte der Katholiken und ein Drittel der Bevölkerung (JB 817). Zugleich bekundeten 42 Prozent der Bevölkerung und 63 Prozent der Katholiken Freude über die Wahl Kardinal Ratzingers zum neuen Papst; nur 7 bzw. 6 Prozent ärgerten sich eher, die Hälfte aller und ein Drittel der Katholiken erklärten sich „gleichgültig“ oder unentschieden (JB 817). Nur ein Viertel (26/27%) erwartete, „daß der neue Papst die katholische Kirche auf einen sehr konservativen Kurs führen wird“, die Mehrheit (49/63%) aber, „daß er in vielem an die Linie und das Wirken von Johannes Paul II. anknüpfen wird“. Jeder dritte Katholik meinte: „Viele Menschen hatten bisher ein ganz falsches Bild von ihm“ (JB 818). Obwohl eine absolute Mehrheit der Bevölkerung (60 Prozent der Katholiken) im Juni 2006 meinten, Benedikt XVI. stehe vor allem „für eine strikte Ablehnung von Abtreibungen“, „Festhalten am Zölibat“, „die aktive Verbreitung des katholischen Glaubens in der Welt“ und „eine selbstbewußte katholische Kirche, ein deutliches Bekenntnis zu ihren Werte und Traditionen“, sank zwischen Mai 2005 und Mai 2007 die Einschätzung, Joseph Ratzinger werde „ein eher konservativer Papst sein“, von 62 auf 50 Prozent; die Charakterisierung als „fortschrittlich“ verdoppelte sich von 11 auf 20 Prozent (JB 820). Eine Dreiviertelmehrheit der Bevölkerung nannte den Weltjugendtag in Köln im September 2005 „eine eindrucksvolle Veranstaltung“; 60 Prozent im Westen und 43 Prozent im Osten – also weit mehr als der dortige Anteil der Christen – meinten im Juni 2006, „daß der Papst der Jugend etwas zu sagen hat“, nur 18 Prozent dagegen, er habe „keine Antwort auf die Fragen, die die Jugend heute stellt“ (JB 820). Nach dem zweiten Papstbesuch im September 2006 in Bayern gefiel Benedikt XVI. nur einem Sechstel der Deutschen „wenig“ (10%) oder „gar nicht“ (6%). Zwei Drittel der Katholiken und 42 Prozent der Bevölkerung erklärten, er gefalle ihnen „gut“ (41/32%) oder sogar „ausgezeichnet“ (21/10%). Eine Dreiviertelmehrheit verteidigte seine Regensburger Rede gegen die Empörung in der islamischen Welt und meinte, man „sollte so etwas öffentlich äußern dürfen“, nur 14 Prozent waren „aus Rücksicht auf die religiösen Gefühle anderer“ gegenteiliger Meinung (JB 821). In der Wechselhaftigkeit der öffentlichen Meinung über Johannes Paul II., seinen Cheftheologen Josef Ratzinger und Nachfolger Benedikt XVI. spiegelt sich nicht nur das „Hosianna“ und „Kreuziget ihn“ über Jesus wieder, der denen, die ihm nachfolgten, nicht Popularität, sondern Verachtung, Haß, Denunziation und Verfolgung vorhersagte. Das deutsche Oszillieren zwischen Bewunderung und 47 Ablehnung der Päpste bestätigt auch ein Wort Konrad Adenauers, das Elisabeth Noelle-Neumann gerne zitierte: „Ich verstehe die Bevölkerung nicht. Erst sind sie gegen mich, dann sind sie für mich, und dabei mache ich doch immer die gleiche Politik“. Und nicht minder relativierte die große Demoskopin ihr eigenes Geschäft mit einem Satz aus Hegels „Grundlinien der Philosophie des Rechts“: „In der öffentlichen Meinung ist alles Falsche und Wahre; aber das Wahre zu finden, ist die Sache des großen Mannes“. V. Die Legende von den „religiösen Deutschen“ Kirchenpolitisch wird nicht nur die gerade entstehende Legende vom beliebten, „großen Papst“ Johannes Paul II. und seinem viel weniger geachteten Nachfolger durch die Langzeitperspektive des Allensbacher Datenfundus widerlegt. Auch das verbreitete Klischee, die christliche Glaubensvitalität leide hauptsächlich unter der „Amtskirche“, und die treibe eigentlich recht religiöse Menschen in die Kirchenabstinenz („Jesus ja, Kirche nein“), schmilzt im Lichte empirischer Analyse wie Schnee unter der Sonne. Dieses Klischee war durch den „Bertelsmann-Religionsmonitor“9 seit Ende 2007 mit großem Mediengetöse zum wissenschaftlich gesicherten Faktum hochgespielt worden. So titelte die „Welt am Sonntag“ am 16. Dezember zur Einstimmung auf Weihnachten: „Das Comeback des Jahres: Gott“. Die Studie belege: „Glauben hat in Deutschland eine große Bedeutung“. Für 70 Prozent aller Menschen spiele Religion „eine Rolle“; fast jeder Fünfte sei sogar „tief religiös“, besuche regelmäßig Gottesdienste, bete häufig und beschäftige „sich intensiv mit religiösen Fragen, die auch sein praktisches Leben beeinflussen“. Die Studie entlarve „populäre Irrtümer über eine angeblich gottlose Jugend oder eine verkümmerte Religiosität im Osten“. Nur wer „ins Kleingedruckte“ des Buches schaute, erfuhr, daß bereits eine Kirchgangsfrequenz von „einmal im Monat“ als „hohe Intensität“ öffentlicher religiöser Praxis gewertet wurde, daß unter „privater religiöser Praxis“ Gebet wie Meditation firmierten, welche aber auch Atheisten pflegen – hier kategoriell zwangsvereinigt mit frommen Schwestern von der ewigen Anbetung –, und daß die „religiöse Erfahrung“ an so unspezifischen Gefühlen wie „Geborgenheit“, „Freude“, „Schuld“, „Angst“ und „Liebe“ oder auch an dem Gefühl „mit allem eins zu sein“ abgelesen wurde. Kein Wunder, daß bei einem derart expansivdiffusen Religionsbegriff schließlich sogar ein Drittel der Konfessionslosen in die Kategorien „hochreligiös“ (2%) oder „religiös“ (31%) fällt. So gelangt man ins analytische Niemandsland „impliziter Religion“, in dem „Säkularisierung gewissermaßen per definitionem ausgeschlossen ist“ (Hans Joas). Allensbach dagegen sieht im „MDG-Trendmonitor Religiöse Kommunikation“ ausdrücklich „keine Anzeichen für eine nachhaltige Renaissance von Religiosität“: Weniger als die Hälfte der Deutschen bezeichnet sich selbst als „religiöser Mensch“; im Westen befindet sich deren Bevölkerungsanteil seit Jahrzehnten im Sinkflug: von 58 (1984) auf 52 Prozent (2010), im Osten, wo sich 1990 noch fast jeder Dritte religiös nannte, ist es heute nicht einmal mehr jeder Vierte (TM 35). Sich „sehr“ für religiöse Fragen zu interessieren, bekundeten im April 2006, also 48 während der „Renaissance“-Debatte nach dem Medien-Hype der „päpstlichen Ereignisse“, ganze 11 Prozent der Bevölkerung, „ziemlich“ weitere 21 Prozent – addiert übrigens 36 Prozent im Westen und 20 Prozent im Osten, womit der Unterschied doch weit mäßiger ausfällt als es die Quote der Kirchenmitglieder – hie 78, da 23 Prozent (2009) – glauben machen könnte (JB 801). Wenn aber nicht einmal jeder zweite nominelle Christ im Westen ein reges religiöses Interesse bekundet, dann ist nicht die Vielzahl von Kirchenaustritten, sondern eher ihre relativ geringe Zahl erklärungsbedürftig. Warum ein religiöses Desinteresse von fast 80 Prozent der Ostdeutschen („gar nicht“: 42, „etwas, aber nicht besonders“: 37 Prozent) nicht als „verkümmerte Religiosität im Osten“ verstanden werden soll, wird ebenso das Geheimnis der Bertelsmann-Lautsprecher bleiben wie ihre Relativierung der Generationenkluft: Bezeichnen sich doch bei Allensbach (2008) kaum ein Drittel der 16-29-jährigen Deutschen als religiös, aber 60 Prozent der über 60-jährigen (JB 801). „Im Elternhaus religiös erzogen worden“ zu sein, erklärten 2006 halb so viele jüngere wie ältere Deutsche (JB 809) und „oft“ zu beten ganze 8 Prozent der jungen Leute gegenüber 32 Prozent der „Generation 60+“. Wer trotzdem einen Tradierungsbruch leugnet, betreibt Augenwischerei. Die Bevölkerung selbst scheint ein besseres Gespür für den Trend zu haben als manche Trendforscher: Daß „Glaube und Religion in Zukunft für die Menschen in Deutschland wichtiger“ würden, prognostizierten 2009 nur 18 Prozent, „weniger wichtig“ immerhin 29 Prozent; 40 Prozent vermuteten, es werde sich „nichts ändern“ (JB 807). Übrigens lagen die Deutschen trotz ihrer finanziell bestens ausgestatteten „Volkskirchen“ laut einem EU-Report von 2005 (Eurobarometer Nr. 225) beim Glauben an Gott mit 47 Prozent klar unter dem europäischen Durchschnitt (52%) und weit hinter Malta (95%), Zypern und Rumänien (90%), Griechenland und Portugal (81%), Polen (80%), Italien (74%), Irland (73%) und Kroatien (67%) – allesamt katholisch oder orthodox geprägte Länder. VI. Kirchennähe, Lebensglück und Sinnerfahrung Wenn 64 Prozent aller „Personen, die in den letzten 12 Monaten wenigstens einen Gottesdienst besucht haben“, bekunden, dieser habe sie „angesprochen“ und nur 22 Prozent „eher nicht“, und wenn 41 Prozent sogar von „ergreifenden Momenten“ berichten (JB 813), dann scheint, entgegen landläufigen Klischees, nicht eine schlechte Qualität des „Gebotenen“ maßgeblich für den schwindenden Kirchenbesuch – der katholische sank seit 1950 von 50 auf 13 Prozent ab (TM 26) – zu sein. Daß ein Großteil der positiv „Angesprochenen“ nicht öfter wiederkommt, dürfte insofern eher mit Bequemlichkeit und Prioritätensetzung für konkurrierende Freizeitbeschäftigungen – schon mangels Glaubensintensität – zu tun haben. Dabei ist allerdings zu beachten, daß die Protestanten sich mit ihrem letzten Kirchgang nur zu 41 Prozent auf einen „normalen Gottesdienst“ und zu 59 Prozent auf einen mit „besonderem Anlaß wie Hochzeit, Beerdigung, Taufe, Konfirmation usw.“ beziehen; bei den Katholiken hingegen ist der Besuch „normaler 49 Gottesdienste“ mit 65 zu 35 Prozent vorherrschende Bezugsgröße. Ihre Kirchgangsquote laut Befragung (2009) ist denn auch im Westen – mit 8 Prozent an „jedem“ und 14 Prozent an „fast jedem Sonntag“ – erheblich höher als die der Evangelischen (1 bzw. 6 Prozent); „ab und zu“ oder „selten“ nehmen 68 Prozent der katholischen und 78 Prozent der evangelischen Christen am Gottesdienst teil; im Osten sind die Unterschiede noch ausgeprägter: Hier geben 29 Prozent der Katholiken und 4 Prozent der Protestanten an, regelmäßig teilzunehmen (JB 812). Auch ihre Kirchenbindung auf einer Skala von Null bis Zehn stufen Katholiken höher ein als Protestanten (TM 33, JB 815). „Schon einmal mit dem Gedanken gespielt, aus der Kirche auszutreten“, hatten 2006 allerdings fast ebenso viele katholische (24%) wie evangelische (26%) Christen (JB 814); so war es nicht überraschend, daß während des Mißbrauchsskandals vier Jahre später erstmals mehr Katholiken als Protestanten ihre Kirche verließen. Trost für die katholische Kirche hält jedoch der „Trendmonitor“ 2010 bereit: Neben der relativ stabilen Wertschätzung religiöser Erziehung – zuletzt fanden 69 Prozent der Katholiken sie „wichtig“ (TM 32) – und einer zwischen 1999 und 2009 wieder leicht gestiegenen Einschätzung, daß die Kirche „gut in unsere Zeit paßt“ – von 4.8 auf 5.4 auf einer Skala von 0 bis 10 (TM 31) – imponieren vor allem die Hinweise auf einen Zusammenhang von Kirchennähe und erfülltem Leben: „Gläubige Kirchennahe“, die ein Sechstel aller Katholiken ausmachen, fühlen sich häufiger (zu 45%) „sehr glücklich“ als die numerisch etwa doppelt so starken Typgruppen10 der „kritischen Kirchenverbundenen“ (37%) und „kirchlich distanzierten Christen“ (31%) und erst recht als die „Glaubensunsicheren“ (24%). Je näher Katholiken ihrer Kirche stehen, desto seltener berichten sie auch von dem Gefühl, „das einem das Leben oft so sinnlos vorkommt“ (TM 51): Derartige Sinnzweifel gar nicht zu kennen, bekunden 62 Prozent der „gläubigen Kirchennahen“, jeweils 51 Prozent der „kritischen Kirchenverbundenen“ und „kirchlich distanzierten Christen“ und 38 Prozent der „Glaubensunsicheren“ (38%). Diese beiden Befunde korrespondieren übrigens mit den Ergebnissen der neuesten amerikanischen Studie von Robert Putnam, wonach die „life satisfaction“ bei religiösen Menschen größer ist als bei anderen.11 VII. Interne Kritiker mit zweifelhaftem Profil Daß die innerkatholischen Kirchenkritiker weniger zum „Salz der Erde“ taugen als es ihr häufig erhobener – oder medial zugesprochener – „Reformer“Anspruch erwarten ließe, zeigt sowohl ihr geringerer Gottesdienstbesuch als unter „gläubigen Kirchennahen“ als auch ihre schwächere Ausrichtung auf „ein an christlichen Werten ausgerichtetes Leben“: Dieses halten 84 Prozent der „gläubigen Kirchennahen“ für „ganz besonders wichtig“, aber nur 58 Prozent der „kritischen Kirchenverbundenen“ und 23 Prozent der „kirchlich distanzierten Christen“ (TM 43). Nehmen 72 Prozent der „gläubigen Kirchennahen“ jeden (38%) oder fast jeden (34%) Sonntag am Gottesdienst teil, so sind es unter den „kritischen Kirchenverbundenen“ nur 31 (10/21) Prozent (TM 42). Zudem interessieren sich die „kriti50 schen Kirchenverbunden“ nur zu 43 Prozent „für Themen, die die Kirche betreffen“, „gläubige Kirchennahe“ aber zu 80 Prozent (TM 72) – und dies sowohl auf gemeindlicher als auch auf diözesaner und weltkirchlicher Ebene. Unter 14 Themen, die mit Kirche und Glauben zu tun haben, zeigen sich die „Kritischen“ nur an einer einzigen Themenkategorie etwas häufiger als die gläubigen Kirchennahen (31 zu 29 Prozent) „ganz besonders interessiert“: an „Themen, die in der Kirche umstritten sind, wie Abtreibung, Zölibat, Frauenpriestertum“; viel geringer ausgeprägt ist ihr Interesse hingegen an religiösen Büchern (21:7%), Predigt- und Bibeltexten (28:9%), aber auch daran, „welche Bedeutung die Kirche als Institution in der heutigen Gesellschaft hat“ (34:17%), „wie man in der heutigen Zeit seinen Glauben leben“ (29:18%) oder „Kindern Glaube und Kirche näher bringen kann“ (35:27%) (TM 121). Gegenüber dem „Trendmonitor“ 2002 sind die „gläubigen Kirchennahen“ um zwei Prozent (auf 17%) geschrumpft und die „kritischen Kirchenverbundenen“ um zwei Prozent (auf 37%) gewachsen (TM 39) – ein Indiz dafür, daß der „Reformdruck“ in der Kirche – ganz abgesehen vom säkularistischen Anpassungsdruck auf die Kirche – anhaltend stark ist und weiter wächst. Im Blick auf den Wortsinn des lateinischen „Reformatio“, das nicht nur als „Umgestaltung“ und „Erneuerung“, sondern auch als „Verbesserung“ übersetzt werden kann, geben die empirischen Daten allerdings wenig Grund, von den „kritischen Kirchenverbundenen“ kraftvolle Beiträge zur Revitalisierung christlicher Glaubenspraxis und Weltverantwortung zu erwarten. Daß alle zeitgeist-synchronen Forderungen der „kritischen Katholiken“ schon weitgehend in den evangelischen Kirchen verwirklicht sind, und daß diese trotzdem seit 1970 über 6,6 Millionen Mitglieder durch Austritt verloren – etwa 70 Prozent mehr als die römisch-katholische –, sollte endlich allseits zur Kenntnis genommen werden. Wer sich in den Allensbacher Datenfundus vertieft, der wird danach von den thematisch allzu vordergründigen, monotonen deutschen Mediendebatten und „Dialogprozessen“ über die Kirche der Zukunft jedenfalls wenig erwarten. Die damit vergeudete Zeit investierte man lieber in solide Katechese, geistliche Lektüre christlicher „Klassiker“ und die praktische Anschauung herausragender Biographien historischer wie zeitgenössischer Gestalten des Glaubens. Anmerkungen 1) Auszählung speziell für den Verfasser; dokumentiert und interpretiert in: Andreas Püttmann, Gesellschaft ohne Gott. Risiken und Nebenwirkungen der Entchristlichung Deutschlands, 2. Aufl., Asslar 2010, S. 147. 2) Vgl. Ders.: Ziviler Ungehorsam und christliche Bürgerloyalität. Konfession und Staatsgesinnung in der Demokratie des Grundgesetzes (= Politik- und Kommunikationswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, Bd. 9), Paderborn u.a. 1994, S. 300f. 3) Das im März 2010 gestartete Projekt ist auf der Internetseite http://www.frg.de.tf zu finden. 51 4) Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1984-1992, Bd. 9, hrsg. von Elisabeth NoelleNeumann und Renate Köcher, München/New York/London 1993, S. 208. Dort auch die folgenden Daten bis Anm. 5. 5) Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1993-1997, Bd. 10, hrsg. von Elisabeth Noelle-Neumann und Renate Köcher, München 1997, S. 285. 6) Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1998-2002, Bd. 11, hrsg. von Elisabeth Noelle-Neumann und Renate Köcher, München 2002, S. 143. 7) Ebd., S. 366. 8) Siehe Bernhard Vogel (Hg. im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung): Religion und Politik. Ergebnisse und Analyse einer Umfrage, Freiburg/Basel/Wien 2003, S. 297f. 9) Bertelsmann-Stiftung: Religionsmonitor 2008, Gütersloh 2007. 10) Die Typgruppen sind wie folgt definiert: „Gläubige Kirchennahe“ (17% der Katholiken) durch die Aussage: „Ich bin gläubiges Mitglied meiner Kirche, fühle mich der Kirche eng verbunden“, „Kritische Kirchenverbundene“ (37%) durch: „Ich fühle mich der Kirche verbunden, auch wenn ich ihr in vielen Dingen kritisch gegenüberstehe“, „kirchlich distanzierte Christen“ (32%) durch: „Ich fühle mich als Christ, aber die Kirche bedeutet mir nicht viel“; drei weitere kleine Gruppen meinen: „Ich bin religiös, fühle mich aber nicht als Christ“ (3%), „Ich fühle mich unsicher, ich weiß nicht, was ich glauben soll“ (5%) und „ich brauche keine Religion“ (6%). 11) Chaeyoon Lim/Robert D. Putnam: Religion, Social networks and Life Satisfaction, in: American Sociological Review vol. 75, no. 6, 2010, S. 914-933. Dr. phil. Andreas Püttmann, Bonn, ist Politikwissenschaftler, Publizist und Referent der Konrad-Adenauer-Stiftung (z.Zt.i.R.). 52