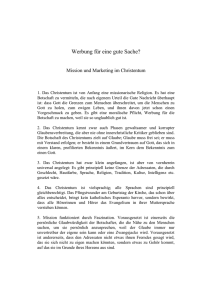Mariano Delgado - Schweizerischer Katholischer Missionsrat
Werbung

Wo stehen wir heute in der Missionstheologie auf dem Hintergrund von Vaticanum II?* Von Mariano Delgado / Universität Freiburg1 1. Das Christentum als missionarische Religion Der Begriff „Mission“ entstand im Umfeld der frühneuzeitlichen Tätigkeit der Gesellschaft Jesu in Übersee. Der Sache nach bezeichnet er aber die Sendung der Kirche zur Verkündigung des Evangeliums vom Reich Gottes auf der ganzen Welt. Daher beginnt das Missionsdekret des 2. Vatikanischen Konzils mit den Worten: „Zur Völkerwelt von Gott gesandt, soll die Kirche ‚das allumfassende Sakrament des Heils’ sein. So müht sie sich gemäss dem innersten Anspruch ihrer eigenen Katholizität und im Gehorsam gegen den Auftrag ihres Stifters, das Evangelium allen Menschen zu verkünden“ (Ad gentes 1). Für das Konzil ist die Kirche „ihrem Wesen nach ‚missionarisch’ (das heisst: als Gesandte unterwegs), da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der Sendung des Heiligen Geistes herleitet gemäss dem Plan Gottes des Vaters. Dieser Plan entspringt der ‚quellhaften Liebe’, dem Liebeswollen Gottes des Vaters“ (Ad gentes 2). Demnach wurzelt christliche Mission im innertrinitarischen Sendungsprozess, in der liebevollen Hinwendung des dreifaltigen Gottes zu seiner Schöpfung (Missio Dei oder Heil von Gott her): Im Willen des Vaters, “dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen” (1 Tim 2,4). In der Sendung des Sohnes, der vom Vater als als “das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet” (Joh 1,9), gesandt wurde, „damit die Welt durch ihn gerettet wird“ (Joh 3,17), bzw. damit alle „das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10,10), besonders die Armen und Bedrängte (Lk 4,18). In der Sendung der Jünger durch den gesandten Sohn, “zu allen Völkern” zu gehen und “alle Menschen” zu seinen Jüngern zu machen (Mt 28,19), bzw. “das Evangelium allen Geschöpfen” zu verkünden (Mk 16,15; ) oder seine Zeugen zu sein, “bis an die Grenzen der Erde” (Apg 1,8), womit die Kirche als „Sakrament des Heils“ in der Geschichte wirkt (Ad gentes 5). In der Herabkunft des Heiligen Geistes am Pfingsttage auf die Jünger, um auf immer bei ihnen zu bleiben, auf dass die Kirche den Mut hat, „das Evangelium vom Reich“ (Mt 24,14) auf der ganzen Welt zu verkünden, bevor der Herr wiederkommt. Wie das Konzil betont hat (Ad gentes 4), darf dabei nicht vergessen werden, dass der Heilige Geist schon in der Welt wirkte, ehe Christus verherrlicht wurde, und dass er bisweilen sogar sichtbar der apostolischen Tätigkeit vorangeht, „wie er sie auch auf verschiedene Weisen unablässig begleitet und lenkt“ (Ad gentes 4). Die Missionstheologie hat also vier Grundprinzipien miteinander zu denken und zusammen zu halten: den allgemeinen Heilswillen Gottes, die universale Mittlerschaft Christi, die Rolle der Kirche als Heilssakrament und schliesslich den pneumatologisch-eschatologischen Horizont.2 Ausdruck der kirchlichen Sendung ist der so genannte „Missionsbefehl“, der an verschiedenen Stellen im Neuen Testament vorkommt (vgl. Mt 28,19-20; Mk 16,15-16; Apg 1,8). Die markinische Variante wurde erst im 2. Jahrhundert angefügt und verbindet den Missionsauftrag mit der Betonung der Heilsnotwendigkeit der Taufe im Schatten der Christenverfolgungen, die als Zeichen für das nahende Ende der Welt betrachtet wurden: „Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden“. Die – von ihrem paränetischen Entstehungskontext isolierte – Rezeption dieser apodiktischen Stelle in der Missionsgeschichte entbehrt nicht einer gewissen Tragik: Sie ist für einen Heilsexklusivismus verantwortlich,3 der zu einem übertriebenen Missionseifer und zu Zwangstaufen führte, um Heiden vor der Verdammung zu bewahren; und sie stürzte auch Missionare in tiefe Konflikte: „Waren sie bei ausbleibenden Missionserfolg etwa an der 1 Diesem Text liegen folgende Publikationen des Verfassers zugrunde: Das Christentum in der Religionsgeschichte. Unterwegs zu einem aufgeklärten Inklusivismus , in: Mariano Delgado / Gregor Maria Hoff / Günter Risse (Hrsg.), Das Christentum in der Religionsgeschichte. Perspektiven für das 21. Jahrhundert. Festschrift für Hans Waldenfels (Studien zur christlichen Religions- und Kulturgeschichte 16), Fribourg/Stuttgart 2011, 15-31; Das Dekret „Über die Missionstätigkeit der Kirche Ad Gentes“ des Zweiten Vatikanischen Konzils. Einige Überlegungen zur Entstehung, zum Inhalt und zur Rezeption, in: Annuarium Historiae Conciliorum 43 (1/2011) 193-206; Mission / Missionsgeschichte / Missionstheologie: Lehrbrief Nr. 14 von Fernkurs Theologie (Würzburg: in Druck). 2 Deutlich werden diese vier Prinzipien in diesem Text betont: Internationale Theologenkommission, Das Christentum und die Religionen (30. September 1996) hg. von der Deutschen Bischofskonferenz (Stimmen der Weltkirche 136), Bonn 1996. 3 Vgl. dazu Joseph Ratzinger, Kein Heil ausserhalb der Kirche?, in: ders.: Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf 1969, 339–375. 1 Verdammung der Nichtgetauften mitschuldig? Waren die ungetauften Vorfahren, die als Ahnen besonders in Asien und Afrika verehrt wurden, zu den Verdammten zu zählen?“4 In vielen Missionskatechismen des Entdeckungszeitalters wird den Missionierten gesagt, dass ihre Vorfahren in der Hölle brennen. Im Alten Testament ist bereits eine Universalisierung des Heilswillens Gottes zu beobachten, aber im Rahmen einer Kommt-her-Denkform, die Israel als „Licht der Völker“ versteht und von diesen die Völkerwallfahrt zum Berg Zion (Jerusalem) erwartet (vgl. u.a. Jes 2). Mit der aktiven Sendung der Jünger zu den Völkern durch den Auferstandenen als „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ (Mt 5,13-14) macht das Neue Testament daraus eine missionarische „Geht-hin-Denkform“. 1.1 Grundmerkmale christlicher Mission in der Antike Das missionierende Christentum war von Anfang an mit drei Merkmalen ausgestattet, die seine Ausbreitung im Römischen Reich begünstigt haben. Dazu gehören der neue Volk-Gottes-Begriff, seine Translations- und Inkulturationsfähigkeit sowie schliesslich eine neue Moral. Das erste Merkmal unterscheidet das Christentum vom Judentum, das zweite vom Islam, während das dritte – zumindest tendenziell – ein gemeinsames Erkennungszeichen dieser drei Monotheismen sein dürfte. (1) Volk-Gottes-Begriff. Selbst die engsten Mitarbeiter Jesu scheinen Zeit gebraucht zu haben, um die logischen Konsequenzen aus der von ihm verkündeten Reich-Gottes-Botschaft zu ziehen. Petrus, z.B., versteht erst mit Hilfe eines Traumes im Vorfeld des Besuchs beim römischen Hauptmann Kornelius, dass der Gott Jesu Christi sich eine universale Glaubensgemeinschaft aus allen Völkern ohne Ansehen der Person wünscht: „Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist“ (Apg 10,34–35). Paulus ist dann die treibende Kraft, die christliche Botschaft der Heidenwelt zu verkünden und die Beschneidung als rituelles Symbol religiös-nationaler Identität aus dem Weg zu räumen. Es gibt keinen Satz in der paulinischen Theologie, der die durch die christliche Botschaft neu eingetretene Lage in den multikulturellen Städten der hellenistischen Umwelt besser ausdrücken würde als Gal 3,28: „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.“ Und Paulus schliesst folgerichtig daraus: „Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben kraft der Verheissung“ (Gal 3,29). Mit der Übertragung des Volkwerdungsprozesses des Alten Exodus auf die Christengemeinde aus der Heidenwelt wird der neutestamentliche Konsens bezüglich des Volk-Gottes-Begriffs im ersten Petrusbrief betont: „Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde […]. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk“ (1 Petr 2,9f). Aufgrund dieses Volk-Gottes-Begriffs, der den jüdischen Partikularismus überwindet und mit dem römischen Universalismus konvergiert, war das Christentum imstande, Menschen aus verschiedenen Völkern und Kulturen in eine neue Religion universaler Geschwisterlichkeit zusammenzuführen. (2) Translations- und Inkulturationsfähigkeit. Das Sich-Einlassen auf die Heidenwelt konnte das Christentum nur aufgrund seiner Fähigkeit zur Translation und Inkulturation wagen. Für das Christentum ist das „Wort“ (Logos) in Jesus „Mensch“, nicht „Schrift“ geworden. Weil Gott uns sein Antlitz im Geschick Jesu offenbart, sakralisiert/tabuisiert das Christentum nicht eine Sprache als Offenbarungsvehikel. Mit der Wahl des Griechischen für die meisten Schriften des Neuen Testamentes nimmt es das Gespräch mit der hellenistischen Welt dezidiert auf und inkulturiert sich darin, d.h. „hellenisiert“ sich: „Ohne die so genannte Hellenisierung des Evangeliums kein Heidenchristentum und wohl auch kein missionarisches Eindringen in andere und immer neue Kulturen“.5 (3) Kultur der Barmherzigkeit. Am meisten dürfte die antike Welt die neue Moral beeindruckt haben, die von der Würde eines jeden Menschen als Abbild Gottes geprägt war. Selbst Kaiser Julian (360-363), der nach der „Konstantinischen Wende“ die Christen wieder verfolgen wollte, bestätigt ihre moralische Anziehungskraft, wenn er von ihnen schreibt, dass es deren Menschenfreundlichkeit gegen die Fremden, die Vorsorge für die Bestattung der Toten und die vorgebliche Reinheit des Lebenswandels seien, die ihre „Sekte“ am meisten gefördert haben. Moderne Historiker schreiben, dass die christlichen Gemeinden sich umfassend um Kranke, Arme, Alte, Witwen, Waisen und Hungernde kümmerten, „also um jene marginalisierten Gestalten, die das Heidentum […] ‚ohne grosse Gewissensbisse […] ihrem Schicksal überlassen’ hatte“.6 1.2 Vielfalt von Missionstypen in der Geschichte Bereits in den Anfängen des Christentums und in der spätantiken Mission wurde eine Vielfalt von Missionstypen praktiziert. Wir können grundsätzlich drei Sektoren unterscheiden:7 4 Michael Sievernich, Die christliche Mission. Geschichte und Gegenwart, Darmstadt 2009, 21. Wolfhart Pannenberg, Notwendigkeit und Grenzen der Inkulturation des Evangeliums, in: G. Müller-Fahrenholz (Hg.): Christentum in Lateinamerika, Regensburg 1992, 140-154 6 Andreas Merkt, Die Profilierung des antiken Christentums angesichts von Polemik und Verfolgung, in: Christentum I: Von den Anfängen bis zur Konstantinischen Wende, hg. von Dieter Zeller (Die Religionen der Menschheit 28), Stuttgart 2002, 409–433, hier 432. 7 Vgl. Sievernich, Die christliche Mission (Anm. 4), 11-38. 5 2 im „sozio-kulturellen Sektor“ geht es vor allem um den „kapillaren Typ“, d. h. um die Verbreitung des Christentums durch das Lebensbeispiel in der Familie, der Nachbarschaft oder im Berufsleben; im „professionellen Sektor“ geht es um die Personen (Apostel, Wanderprediger, Mönche, freie Lehrer), die ihr Leben der missionarischen Ausbreitung des Christentums widmen; als Typen im „institutionellen Sektor“ werden schliesslich jene Missionsformen verstanden, die ausgehend von einer starken institutionellen Basis mit Mitteln der Überzeugung, der Argumentation, aber auch der Macht agieren. Das Wirken klösterlicher Zentren oder die christliche Schulbildung stünden für den argumentativ-persuasiven Typ des institutionellen Sektors, während die machtförmige, zum Zwang neigende Variante durch den Typ imperialer Mission, die Religionsverbreitung als Herrschaftserweiterung bzw. -festigung versteht, verkörpert wird. Mischtypen entstehen zum Beispiel, wenn die professionellen Missionare ihre Tätigkeit im Auftrag oder im Schutz päpstlicher, bischöflicher oder weltlicher Autorität ausüben. Diese grundlegenden Typen erfuhren in Mittelalter, Neuzeit und Moderne gewisse Veränderungen, sofern der professionelle und der institutionelle Sektor ausgebaut wurden (neue Orden und Missionsgesellschaften, Verquickung von Mission und kolonialer Expansion, interkonfessionelle Konkurrenz, Beteiligung der Frauen an den Missionsaktivitäten …) – unter Vernachlässigung der kapillaren Verbreitung, die heute wieder gefragt ist. Paul VI. betonte, dass die überzeugend gelebte Einheit von Gottes- und Nächstenliebe in der Nachbarschaft der erste Weg der Evangelisierung ist, da der heutige Mensch „lieber auf Zeugen als auf Gelehrte“ hört, „und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind“ (Evangelii nuntiandi 41). 1.3 Licht- und Schattenseiten Als historisches Ereignis ist die missionarische Ausbreitung des Christentums ein ambivalenter Prozess mit Lichtund Schattenseiten. Er verlangt wissenschaftlich weder nach einer Apologie noch nach einer Hermeneutik des Verdachts, sondern nach einer „differenzierten Wahrnehmung“. Während im säkularen Sprachgebrauch der Begriff „Mission“ heute eher mit einem positivem Klang verwendet wird, so z.B. wenn von einer „diplomatischen Mission“ oder einer „Friedensmission“ der Vereinten Nationen die Rede ist, steht oft die Geschichte „christlicher Mission“ unter Verdacht. Sie wird mit Indoktrinierung verbunden, mit Religions- und Kulturvernichtung, mit mangelndem Respekt vor Andersdenkenden und Andersglaubenden, mit monotheistischer Gewalt und Intoleranz, mit Kolonialismus. Auch wenn dieser Rundumschlag nicht sachlich ist, lassen sich die Schattenseiten christlicher Mission nicht leugnen. Aus diesem Grund liess Papst Johannes Paul II. während der Bussfeier zum Aschermittwoch des Jahres 2000 dem japanischen Bischof Hamao folgendes sagen: „Manchmal haben sich Christen leiten lassen von Hass und vom Willen andere zu beherrschen, von Feindschaft gegen Anhänger anderer Religionen …“. Wozu der Papst betete: „Christen haben die Rechte von Stämmen und Völkern verletzt, ihre Kulturen und religiöse Traditionen verachtet. Sie haben so das Evangelium verleugnet und der Gewalt nachgegeben“.8 Andererseits werden die zivilisatorischen Errungenschaften der Missionare als Vermittler von Kulturtechniken, Erbauer von Spitälern und Schulen bewundert, ebenso wie ihre „wissenschaftlichen“ Leistungen als Naturforscher, Völkerkundler und Linguisten. Bis Ende des 2. Weltkriegs fand die aussereuropäische Ausbreitung des Christentums in der „Dialektik von Mission und Kolonialismus“ statt, d.h. in der Dialektik zwischen Imperialismus einerseits und den revolutionären, modernisierenden und emanzipatorischen Wirkungen westlich-abendländischer, christlicher Kultur andererseits. Die meisten Missionare waren keine Befürworter der politischen Emanzipation der kolonisierten Völker. Aber es ist bestimmt kein Zufall, dass viele Anführer der Unabhängigkeitsbewegungen aus den Missionsschulen kamen. Durch Schulen aller Art und Druckereien, Armenhäuser und Spitäler, durch die Einführung neuer Kulturtechniken oder die zahlreichen sozialen und sozialreformerischen Aktivitäten im Geiste der Nächstenliebe förderten Missionare die menschliche Entwicklung, oft ungeachtet der Religionszugehörigkeit der Adressaten. Man kann bekanntlich auf die Dauer nicht das Evangelium predigen und den Kolonialismus rechtfertigen. Denn das Evangelium ist im Grunde „eine Botschaft der Freiheit und der Befreiung“ (Libertatis nuntius 1) für alle Menschen. Daher gehört auch die Prophetie, die Anklage von Unterdrückung und Sklaverei sowie das Eintreten für Gerechtigkeit und Recht (auch für das Recht der Anderen) zur Wirkung christlicher Mission. Unter Rückgriff auf das Evangelium und an die Person Jesu Christi konnten prophetische Missionare die Fehlentwicklungen und Deviationen zur Anklage bringen, Selbstkorrekturen vornehmen und Partei für die Armen und Bedrängte ergreifen. Ihre Spiritualität war allgemein von der Überzeugung getragen, dass die anderen Menschen „unsere Brüder, für die Christus sein Leben hingegeben hat“, wie Bartolomé de Las Casas sagte.9 Das von den Missionaren eingeklagte Menschenbild, wonach alle Menschen im Prinzip von Gott mit Verstand und freiem Willen ausgestattet wurden und daher glaubens- und zivilisationsfähig sind, hat zur „Einheit der Menschheitsfamilie“ wesentlich beigetragen und ist die Bedingung der Möglichkeit einer partnerschaftlichen Weltordnung, wie sie heute intendiert wird. 8 Internationale Theologische Kommission: Erinnern und Versöhnen. Die Kirche und die Verfehlungen in ihrer Vergangenheit. Ins Deutsche übertr. und hg. v. G. L. Müller, Einsiedeln/Freiburg i. Br. 22000. 9 Bartolomé de Las Casas, Apologia, ed. Angel Losada (Obras completas Bd. 9), Madrid 1988, 664. 3 2. Missionarisches Christentum heute Die Krise des Eurozentrismus im Windschatten der Entkolonisierung konvergierte nach dem 2. Weltkrieg mit einer weltweiten Identitäts- und Relevanzkrise des Christentums. Angesichts der erwähnten Verdachtshermeneutik gegenüber der christlichen Missionsgeschichte im Allgemeinen sowie gegenüber der neuzeitlichen, eurozentrischen Verquickung mit dem Kolonialismus im Besonderen klagten Christen aus Asien und Afrika über die mangelnde „Akkomodationsbereitschaft“ der europäischen Missionare; andere stellten zudem den Sinn von „Mission“ überhaupt in Frage, was missionarischen Defätismus zur Folge hatte, zumal sich in Europa die traditionellen kirchlichen Milieus, aus denen die Missionare kamen, auflösten. Auf diese Stimmung am Vorabend des 2. Vatikanischen Konzils reagierte der junge Theologe Joseph Ratzinger 1960 mit einer bemerkenswerten Klarstellung: „Wir müssen uns endlich eingestehen, dass das Christentum in der seit Jahrhunderten konservierten Form bei uns im Grunde nicht besser verstanden wird als in Asien und Afrika. Es ist nicht nur dort fremd, sondern auch bei uns, weil ein Schritt ausgefallen ist: der vom Mittelalter zur Neuzeit. Das Christentum lebt gerade auch bei uns selber nicht in unserer eigenen, sondern in einer uns weitgehend fremden Gestalt, der Gestalt des Mittelalters“. Und er fügte hinzu: „So ist die primäre Aufgabe, die sich Theologie im Hinblick auf die Mission stellt, nicht die ‘Akkomodation’ an östliche oder afrikanische Kulturen, sondern die ‘Akkomodation’ an unseren eigenen, gegenwärtigen Geist“.10 Ratzinger brachte damit zur Sprache, was die vorkonziliare Aufbruchbewegung dachte: Das katholische Christentum muss weltweit aufhören, die Gestalt des Mittelalters zu konservieren; es muss vielmehr seine moderne Gestalt finden und ein doppeltes Aggiornamento leisten, d.h. eine „Erneuerung aus dem inneren des Glaubens [...] besonders aus der Heiligen Schrift“ und eine Erneuerung im Sinne der „Verträglichkeit des Christentums in der modernen Welt“.11 Was bedeutet dieses Aggiornamento für den Missionsauftrag der Kirche? Das soll nun an einigen Aufgaben verdeutlicht werden. 2.1 Mission und Ökumene Die neuzeitliche Missionsgeschichte hat die „Konfessionalisierung“ des Christentums in die aussereuropäische Welt verpflanzt, dies jedoch vielfach nicht in einem ökumenischen Geist, sondern im Geist einer „Kontroverstheologie“, die der jeweils anderen Konfession absprach, eine „wahre“ Kirche Christi zu sein. Das Christentum erschien den aussereuropäischen Völkern als eine heillose Vielfalt von miteinander konkurrierenden Kirchen. Durch die binnenchristlichen Querelen haben die Christen zum „Relevanzverlust“ des Christlichen in der modernen Welt beigetragen. Andererseits ist nicht zu leugnen, dass die Wahrnehmung dieser Situation eine entscheidende Wurzel der ökumenischen Bewegung gewesen ist. Die jungen Kirchen spornen uns dazu an, die europäischen Christentümer enger zusammenzuführen und gemeinsam nach dem zu suchen, was zwischen uns und der Offenbarung Gottes in Jesus Christus „trennend und verbindend, verdunkelnd und erhellend, belastend und bereichernd“ steht.12 Diese Einsicht des evangelischen Theologen Gerhard Ebeling trifft sich mit der vom Papst Johannes Paul II. in den letzten Jahren eindringlich angemahnten „Reinigung des historischen Gedächtnisses“ als ökumenische Aufgabe.13 Es geht darum, wie Karl Barth sagte, „im Kleinen und im Grossen gründlich vor unseren eigenen Türen zu wischen“14. Wenn ein jeder sich an seinem Ort in seiner Kirche zum Glauben an den einen Herrn in seinen Dienst rufen lässt, so werden wir die historisch gewachsene Vielfalt des Christseins bewahren und dennoch der Welt ein gemeinsames christliches Zeugnis geben können. Mission kann heute nur in einem ökumenischen Geist stattfinden, der die anderen Konfessionen nicht als Konkurrenten, sondern als Schwesterkirchen betrachtet und darüber hinaus um eine möglichst sichtbare „Einheit in Vielfalt“ aller Kirchen bemüht ist. Mission im ökumenischen Geist bedeutet auch, dass sie als „renovatio ecclesiae in der Dynamik des Heiligen Geistes“ und als „Selbstevangelisierung“ zu verstehen ist. In allen Konfessionen muss eine missionierende Kirche zuerst „Hörerin des Wortes“ sein, die sich durch eine beständige Bekehrung und Erneuerung selbst evangelisiert, „um die Welt glaubwürdig zu evangelisieren“ (Evangelii nuntiandi 15). 2.2 Mission, Inkulturation und Option für die Armen Inkulturationsprozesse und Option für die Arme müssten für eine Religion wie das Christentum selbstverständlich sein. Am Anfang der Missionsgeschichte steht der Missionsbefehl (Mt 28,19), aber auch die Aufforderung des Weltenrichters (vgl. Mt 25, 32.40) in den Armen und Leidenden, das Bild dessen zu erkennen, der die Kirche 10 Joseph Ratzinger, Theologia perennis? Über Zeitgemässheit und Zeitlosigkeit in der Theologie, in: Wort und Weisheit 15 (1960) S. 179188, hier 187f. 11 Joseph Ratzinger, Konzilsaussagen über die Mission ausserhalb des Missionsdekrets, in: Johannes Schütte (Hg.), Mission nach dem Konzil, Mainz 1967, 21-27, hier 39f. 12 Gerhard Ebeling, Kirchengeschichte als Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift, in: ders., Wort Gottes und Tradition. Studien zu einer Hermeneutik der Konfessionen. Göttingen 1964, 25. 13 Vgl. u.a. Papst Johannes Paul II., Enzyklika Ut unum sint. Hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz . (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 121), Bonn 1995, Nr. 2, 52. 14 Karl Barth, Ad limina Apostolorum. Zürich 1967, 17f. 4 gegründet hat „und selbst ein Armer und Leidender war“ (Lumen gentium 8). Beides gilt auch für die Mission heute: auf dem Weg zu den Völkern ist die Kirche aufgerufen, das Evangelium in den verschiedenen kulturellen und religiösen Kontexten zu verkündigen und die Realpräsenz Christi in den Armen und Leidenden zu entdecken. Mit der Inkulturation sind Fragen grundsätzlicher Art verbunden, etwa die nach der Überwindung des Bruchs zwischen Evangelium und moderner Kultur, den Paul VI. als „das Drama unserer Zeitepoche“ bezeichnete, wie es auch das anderer Epochen gewesen ist“ (Evangelii nuntiandi, 20), nach dem Pluralismus in der Kirche, nach der Erkennbarkeit des einen Christentums „in Lehre, Leben und Kult“ (Dei Verbum 8) in den verschiedenen kulturellen Kontexten (also der Frage nach der Übereinstimmung mit der Tradition der Kirche und dem Recht der Ortskirchen auf Sonderwege in manchen Bereichen); ebenso die Frage nach einem asiatischen bzw. afrikanischen Weg zum Christentum und ob dieser ganz vom abendländischen Weg verschieden sein kann, als ob es einen nackten Glauben ohne seine historische Ursprungsprägung in der jüdischen und hellenistischen Kultur gäbe. Die Inkulturationsfrage ist eine der offenen Baustellen heutiger Theologie. Manche Entscheidungen des katholischen Lehramtes im Zusammenhang mit der Entstehung einer lateinamerikanischen, afrikanischen oder asiatischen Theologie deuten darauf hin, dass für Rom die Kompatibilität mit dem Evangelium und die Kommunion mit dem Glauben der Universalkirche darin nicht immer klar erkennbar sind. Vor dem Hintergrund des Ritenstreits wäre allerdings ein wenig mehr Sensibilität und Kommunikationstalent in der Auseinandersetzung Roms mit den aussereuropäischen Theologien gefragt: Wir brauchen beim Lehramt eine gute Verbindung von petrinischer Einheitsverantwortung und paulinischer Inkulturationskühnheit. Im Zusammenhang mit der Inkulturation warnt das Lehramt immer wieder vor jedem Anschein „von Synkretismus und falschem Partikularismus“ (so etwa Ad gentes 22). Das einschlägige Dokument der Internationalen Theologenkommission über Glaube und Inkulturation aus dem Jahre 1988 hält auch mit Nachdruck fest: „Die Inkulturation, die sich der Stimme des Dialogs unter den Religionen bedient, darf auf gar keinem Fall dem Synkretismus Tür und Tor öffnen“.15 Synkretismus ist in der Sprache des Lehramtes und der meisten Theologen ein Synonym für eine falsche Inkulturation, in der „heidnische“, d.h. nicht christuskonforme Werte einer Kultur die Oberhand gewinnen. Diese negative Sicht des Synkretismus kann aber dazu führen, dass das Lehramt – wie etwa im Fall des chinesischen Ritenstreits – Inkulturationsprozesse autoritär abblockt, weil sie in der ersten Phase für abendländische Ohren „synkretistisch“ anmuten, wo sie eher gewagte Inkulturationsprozesse darstellen. Auf der anderen Seite stehen Theologen wie Leonardo Boff, die, anstatt vor dem Synkretismus zurückzuschrecken, ihn „zum Prozess der Entstehung von Katholizität“ erklären.16 Mit Synkretismus bezeichnet Boff einfach die Begegnung des Christentums mit den Kulturen, in deren Verlauf jede Kultur durch die Konfrontation der eigenen Werte mit den Werten des Evangeliums die ihr angemessene christliche Synthese, ihren Synkretismus, vollzieht. Dazu hat er ein Minimalkriterium aufgestellt: Alles, was der Freiheit und dem Leben dient, „stellt einen wahren Synkretismus dar und verkörpert die befreiende Botschaft Gottes in der Geschichte“.17 Eine solche Sicht kann zu einer Reduzierung des Inkulturationsprozesses auf eine „Regno-Zentrik“ führen, also die praxiologische Zentrierung auf den Aufbau des Reiches als die gemeinsame Aufgabe aller Religionen, und macht schliesslich die Mission obsolet – genauso wie die „pluralistische Theologie der Religionen“. Dass der globale ökumenische Einsatz für eine „Kultur des Lebens“ (Weltethos) höchstens nur die erste Stufe eines Inkulturationsprozesses sein kann und dass die Fragen nach dem Gottesbild, der Bedeutung Jesu Christi als Erlöser der Welt und dem sakramentalen Wesen der Kirche ebenso unverzichtbar dazu gehören, wird dann nicht mehr bedacht.18 Inkulturation ist immer auch ein Mittelweg zwischen Dogmatismus und Synkretismus. Beim Inkulturationsprozess droht nämlich die reale Gefahr der zu leichten Anpassung an Kulturelemente, die sich letztlich negativ auf die Identität des Christentums selbst auswirken können. Bei der Unterscheidung der Geister könnte eine aus ihrer Jahrtausende alten Erfahrung lernende europäische Theologie die anderen Theologien geschwisterlich auf solche Gefahren hinweisen, wie Karl Rahner vorgeschlagen hat.19 Viele Konflikte in der Katholischen Kirche im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Inkulturationsprozessen in Asien haben nicht zuletzt damit zu tun, dass die Selbstreinigungskraft der Theologie nicht funktioniert und die petrinische Wachsamkeit allein dem Lehramt überlässen wird. Der Pluralismus hat in der Katholischen Kirche seine Daseinsberechtigung, solange in den einzelnen Ortskirchen die eine katholische Kirche „in Lehre, Leben und Kult“ (Dei Verbum 8) erkennbar bleibt.20 Mehr Eigenverantwortung der Ortskirchen in Theologie, Kirchenrecht und Liturgie nach dem Prinzip von Einheit in 15 Commissione Teologica Internazionale, Fede e inculturazione (Anm. 13), 173. Leonardo Boff, Kirche: Charisma und Macht. Studien zu einer streitbaren Ekklesiologie, Düsseldorf 21985, 164. 17 Ebd. 189. An dieser Stelle spricht Boff ausdrücklich von den theologalen Tugenden Liebe, Glaube und Hoffnung, aber in den letzten Publikationen nur noch von dem, was dem „Leben“ dient. Vgl. ders., Christentum mit dunklem Antlitz. Wege in die Zukunft aus der Erfahrung Lateinamerikas. Freiburg i. Br. 1993; ders., Eine neue Erde in einer neuen Zeit. Plädoyer für eine planetarische Kultur. Düsseldorf 1994. 18 Vgl. Joseph Ratzinger, Der christliche Glaube vor der Herausforderung der Kulturen. In: Paulus Gordan (Hg.), Evangelium und Inkulturation (1492–1992), Salzburg 1995, 9–26, 21. Vgl. dazu Mariano Delgado, Die Zukunft des Christentums angesichts der „Wiederkehr von Religion“. Versuch einer Auseinandersetzung mit Leonardo Boff und Johann Baptist Metz. In: ders., (Hg.), Markierungen. Theologie in den Zeichen der Zeit, Berlin 1995, 37–68. 19 Vgl. Karl Rahner, Aspekte europäischer Theologie, in: ders., Schriften zur Theologie. Bd. 15. Zürich 1983, 84–103. 20 Vgl. Papst Paul VI., Apostolisches Schreiben „Über die Versöhnung in der Kirche“. In: ders., Wort und Weisung im Jahr 1974. VatikanStadt 1974, 512–528, 519ff. 16 5 Vielfalt wäre wünschenswert und würde auch der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils durchaus entsprechen. Aber der Pluralismus darf nicht anarchisch werden. Seine Grenzen sind dort gegeben, wie Karl Rahner festgehalten hat, wo Glaubensdogmen frontal angegriffen werden und somit die Einheit des Bekenntnisses in der Kirche gefährdet ist.21 Nur wenn Theologie und Lehramt paulinische Kühnheit mit petrinischer Verantwortung für die Einheit der Kirche verbinden, werden wir die gegenwärtigen Inkulturationsprozesse sinnvoll begleiten können, damit sie „zur Bereicherung sowohl der Kirche wie der verschiedenen Kulturen“ (Gaudium et spes 58, vgl. auch Lumen Gentium 13, Redemptoris missio 85) beitragen. Die Option für die Armen und die Verkündigung einer „ganzheitlichen“ Befreiung (von der Macht der Sünde und von den unmenschlichen Lebensbedingungen) ist nicht neu, hat aber mit Johannes’ XXIII. Traum von einer „Kirche der Armen und für die Armen“, den Dokumenten des Konzils und des Lateinamerikanischen Episkopats, und nicht zuletzt mit Papst Franziskus eine besondere Aktualität gewonnen. Wenn etwas den Katholizismus der letzten vierzig Jahre wirklich kennzeichnet, so ist das vor allem der Versuch, die theologische Dignität der Armen und Leidenden anzuerkennen, die ja die Mehrheit der Christen wie der Weltbevölkerung darstellen. Der brasilianische Bischof Dom Hélder Câmara hat dieses neue Bewusstsein in einem kleinen Gedicht auf den Punkt gebracht: Er wusste, dass der Herr ihn ständig trieb, „hinzugehen und zu verkünden, / dass es notwendig ist, ja dringend, / von Deiner Gegenwart im Sakrament / überzugehen / zu Deiner anderen Gegenwart / einer ebenso realen, / im Abendmahl des Armen“.22 Bemühung um Gerechtigkeit und absichtslose Solidarität mit den Bedürftigen gehören auch zum Missionsauftrag, „weil eben Gottes- und Nächstenliebe im Christentum eine unaufhebbare Einheit bilden“,23 und weil Christen eine Kultur der Barmherzigkeit bzw. eine „Zivilisation der Liebe“ aufbauen sollten. 2.3 Mission und (interreligiöser) Dialog Wie die Schriften des Neuen Testaments und der ersten Theologen zeigen, haben sich Christen von Anfang den Fragen der philosophischen Vernunft und der Anhänger anderer Religionen gestellt (1 Petr 3,15-16); dabei haben sie ihren Glauben argumentativ zu begründen und mit dem Leben zu bezeugen versucht. Diese dialogische, kommuniktive Grundverfassung des Christentums war im Rahmen der christlichen Mission immer klar, auch wenn im Windschatten des imperialen Typs von Mission Zwangselemente gegeben waren. Die genannte Grundverfassung ist schliesslich die logische Konsequenz aus der christlichen Anthropologie, wonach der Mensch mit Verstand und freiem Willen ausgestattet ist. Seit dem 2. Vatikanischen Konzil erinnert das katholische Lehramt an die Dringlichkeit des Dialogs und an den inneren Zusammenhang von Mission und Dialog. Das Dokument Dialog und Verkündigung (19.05.1991) vom Päpstlichen Rat für den interreligiösen Dialog und der Kongregation für die Evangelisierung der Völker unterscheidet vier Arten des Dialogs: im „Dialog des Lebens“ geht es um das Zusammenleben in einer offenen und nachbarschaftlichen Atmosphäre und um das Miteinanderteilen von Freud und Leid sowie den menschlichen Problemen und Beschwernissen; im „Dialog des Handelns“ setzen sich Christen und Nichtchristen für eine bessere Welt gemeinsam ein; im „Dialog des theologischen Austausches“ vertiefen die Spezialisten ihr Verständnis des jeweiligen religiösen Erbes und lernen die gegenseitigen Werte zu schätze; schliesslich im „Dialog der religiösen Erfahrung“ teilen Menschen, „die in ihrer eigenen religiösen Tradition verwurzelt sind“, ihren spirituellen Reichtum (Dialog und Verkündigung 42). Von diesen Grundformen des interreligiösen Dialogs ausgehend sollten wir heute über eine „Hermeneutik des Dialogs“ nachdenken, d.h. über die Dialogfähigkeit der Partner, über Dialogziele und Bedingungen, über den Zusammenhang von Dialog und Wahrheit, von Dialog und Mission, über den offenen Ausgang des Dialogs, der auch mit der Bekehrung zur Position des Anderen enden kann. Daher ist „Religionsfreiheit“ die unverzichtbare Bedingung für den interreligiösen Dialog.24 Hilfreich sind die Worte von Papst Benedikt XVI. im Nachsynodalen Apostolischen Schreiben Ecclesia in Medio Oriente vom 14. september 2012 über Toleranz, Religionsfreiheit und dialogale Suche nach der Wahrheit: „Die religiöse Toleranz existiert in vielen Ländern, doch sie ist wenig verpflichtend, denn sie bleibt auf ihren Aktionsradius beschränkt. Es ist notwendig, von der religiösen Toleranz zur Religionsfreiheit zu gelangen. Dieser Schritt öffnet keineswegs dem Relativismus die Tür, wie einige behaupten. Dieser Schritt, der getan werden muss, ist nicht ein offener Riss im Glauben, sondern eine erneute Berücksichtigung der anthropologischen Beziehung zur Religion und zu Gott. Er ist keine Verletzung der ‚Grundwahrheiten’ des Glaubens, denn ungeachtet der menschlichen und religiösen Divergenzen erleuchtet ein Strahl der Wahrheit alle Menschen (Vgl. Nostra aetate 2). Wir wissen sehr wohl, dass ausserhalb Gottes die Wahrheit ‚in sich selbst’ nicht existiert. Dann wäre sie ein Götze. Die Wahrheit kann sich nur in der Beziehung zum anderen entwickeln, die auf Gott hin öffnet, der seine eigene Andersheit durch meine Mitmenschen und in ihnen zu erkennen geben will. So ist es unangebracht, in ausschliessender Weise zu behaupten: ‚Ich besitze die Wahrheit’. Die Wahrheit ist niemals Besitz eines Menschen. Sie ist immer Geschenk, das uns auf einen Weg ruft, sie immer tiefer uns anzueignen. 21 Karl Rahner, Ritenstreit – Neue Aufgaben für die Kirche, in: ders., Schriften zur Theologie. Bd. 16. Zürich 1984, 178–184, 183. Hélder Câmara, Der Traum von einer anderen Welt, München 1987, 139. 23 Michael Sievernich, Mission – mit welchem Recht?, in: Rainer Kampling / Bruno Schlegelberger (Hrsg.), Wahrnehmung des Fremden. Christentum und andere Religionen, Berlin 1996, 263. 24 Vgl. Mariano Delgado, Vierzig Jahre „Dignitatis humanae“ oder Die Religionsfreiheit als Bedingung für Mission und interreligiösen Dialog, in: ZMR 89 (2005) 297-310. 22 6 Die Wahrheit kann nur in der Freiheit erkannt und gelebt werden; denn wir können dem anderen die Wahrheit nicht aufzwingen. Nur wenn wir einander in Liebe begegnen, enthüllt sich die Wahrheit.“ (Ecclesia in Medio Oriente 27). Interreligiöse Dialoge können gewiss zu einer Reinigung der Religionspathologien (Gewalt, Intoleranz) und zu einem friedlichen und versöhnten Miteinander der Religionen beitragen, aber sie ersetzen nicht den christlichen Missionsauftrag, „sondern ergänzen ihn durch eine eigene Dynamik der Gemeinsamkeit und der Wahrheitssuche“.25 Bei aller Wertschätzung des interreligiösen Dialogs, betont die Kirche daher ihre Christozentrik: „Der interreligiöse Dialog begründet sich theologisch folgendermassen: mit dem gemeinsamen Ursprung aller Menschen, die als Gottes Ebenbild geschaffen wurden, mit dem gemeinsamen Ziel, das die Lebensfülle in Gott ist, mit dem einzigen göttlichen Heilsplan in Jesus Christus und mit der wirkmächtigen Gegenwart des Heiligen Geistes unter den Anhängern anderer religiöser Traditionen (DiaVer, 28). Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist aber nicht gleichermassen in der biblischen Tradition und in den anderen Religionen gegeben, denn Jesus Christus ist die Fülle der Offenbarung. Doch verschiedene Erfahrungen und Wahrnehmungen, Äusserungen und Verständnisse, die vielleicht alle vom selben ‚transzendentalen Ereignis’ herrühren, lassen dem interrueligiösen Dialog eine hohe Bedeutung zuwachsen. Gerade durch ihn kann sich der eigene Prozess von Interpretation und Verstehen des Heilshandelns Gottes entwickeln.“26 2.4 Mission und Religionstheologie Neben der Dialogfähigkeit war auch das Nachdenken über die angemessene Theologie der Religionen ein Begleitphänomen der christlichen Mission. Die Kirchengeschichte kennt dazu die Grundtypologien von Exklusivismus und Inklusivismus. Mit Theologumena wie „Vorbereitung auf das Evangelium“, „Ecclesia ab Abel“ oder „Samen des Wortes“ haben sich die Kirchenväter bemüht, die Religionsgeschichte „vor Christus“ positiv zu deuten und zu integrieren. Aber in der Missionsgeschichte ist es bekanntlich nicht bei diesem Ansatz geblieben, obwohl – wie Joseph Ratzinger aufgezeigt hat – die „Heilsausschliesslichkeit der Kirche“ im Neuen Testament „nirgends“ ausgesprochen wird.27. Ausgehend von Texten wie Mk 16,16 („Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.“) und Apg 4,12 („Und in keinem anderen ist das Heil zu finden.“) haben Ignatius von Antiochien und Irenäus über die „Heilsausschliesslichkeit der Kirche“ nachgedacht, bevor im 3. Jahrhundert „fast gleichzeitig in Ost und West“ bei Origenes und Cyprian das Axiom „Kein Heil ausserhalb der Kirche“ deutlich formuliert wurde. Doch der Kontext bei Origenes ist eine „Paränese an die Juden, denen er zuruft: Täuscht euch nicht, ihr glaubt, ihr hättet das Alte Testament und das genüge. In Wirklichkeit braucht auch ihr das Blut Christi“.28 Auch bei Cyprian handelt es sich um eine Paränese, diesmal an diejenigen gerichtet, die innerhalb der Kirche für Spaltungen und Schismen sorgen. Der erwähnte Aufsatz Ratzingers ist voller klugen Überlegungen über den weiteren Verlauf der Rezeptionsgeschichte dieses Axioms. Er suggeriert, dass es sich bei der Dogmatisierung durch das Konzil von Florenz (1442) um eine verhängnisvolle Blickverengung handelt, weil der erwähnte paränetische Kontext vergessen wurde. Ebenso vergessen wurde in der Missionsgeschichte die neutestamentliche Spannung zwischen dem Tun der Liebe (vgl. u.a. Mt 22,35–40, Mt 25,31–46, Mt 7,21) als Weg zum Heil und der Heilsnotwendigkeit der Taufe (vgl. u.a. Mk 16,16), eine Spannung, die nicht einseitig zugunsten des Letzteren aufgelöst werden sollte.29 Heute ist der theologische Hauptstrom durch den christozentrischen Inklusivismus (extra Christum nulla salus) geprägt.30 Das 2. Vatikanische Konzil hat diesen Inklusivismus mit dem Missionsauftrag und der heilsnotwendigen Rolle der Kirche verknüpft: „Wenngleich Gott Menschen, die das Evangelium ohne ihre Schuld nicht kennen, auf Wegen, die er weiss, zum Glauben führen kann, ohne den es unmöglich ist, ihm zu gefallen, so liegt also doch auf der Kirche die Notwendigkeit und zugleich das heilige Recht der Evangeliumsverkündigung. Deshalb behält heute und immer die missionarische Tätigkeit ihre ungeschmälerte Bedeutung und Notwendigkeit“ (Ad gentes 7). Ähnlich wird in der Enzyklika Redemptoris missio (7.12.1990) festgehalten, „dass das Heil und die Fülle der Offenbarung von Christus kommt und der Dialog nicht von der Verkündigung des Evangeliums enthebt“; die Tatsache, „dass die Anhänger anderer Religionen auch ausserhalb der normalen Wege, die Christus festgelegt hat, die Gnade Gottes empfangen und durch Christus erlöst werden können, nimmt den Aufruf zum Glauben und zur Taufe“ nicht zurück, „die Gott für alle Völker will“. Denn Christus selbst habe mit der ausdrücklichen Lehre „der Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe ... zugleich auch die Notwendigkeit der Kirche bekräftigt, in die die Menschen durch die Taufe wie durch eine Tür 25 Sievernich, Die christliche Mission (Anm. 4), 240. Internationale Theologenkommission, Das Christentum und die Religionen (Anm. 2), Nr. 25). 27 Ratzinger, Kein Heil ausserhalb der Kirche? (Anm. 3), 341. 28 Ebd., 343. 29 Vgl. ebd. 354f. 30 Vgl. u.a. die Betonung der einzigartige Mittlerschaft Jesu in: Internationale Theologenkommission, Das Christentum und die Religionen (Anm. 2), Nr. 32-49). 26 7 eintreten“. So muss der Dialog in der Überzeugung geführt und realisiert werden, „dass die Kirche der eigentliche Weg des Heiles ist und dass sie allein im Besitz der Fülle der Heilsmittel ist“ (Redemptoris missio 55). Jenseits des ekklesiozentrischen Exklusivismus und des christozentrischen Inklusivismus wird in der heutigen Theologie auch das Modell des Pluralismus vertreten. Es betont die Gleichrangigkeit der Religionen und deren „Heilswege“, und untersucht ihre Geltungsansprüche vergleichend. Nicht klar ist, wie ein solches Modell die „Einzigartigkeit“ bzw. die universale Mittlerschaft Christi und die christliche Mission begründen kann. Die Mission, so sagt man, sei obsolet geworden, denn sie Ziele nur auf Bekehrung aus und übersehe, dass die anderen Religionen auch legitime Heilswege seien, auf denen die Menschen Gott begegnen und ihr Heil gewinnen können. Wichtig sei daher nicht die Bekehrung, sondern dass ein jeder zutiefst seinen eigenen Glauben, den seiner Kultur entsprechenden Glauben lebt. Diese moderne Mentalität, die auch im Hause der Theologie weit verbreitet ist und zu „falschen“ Weichenstellungen geführt hat, stellt eine „interne Schwierigkeit“ für die Wahrnehmung der Missionsaufgabe dar. Gewiss, die Pluralistische Theologie der Religionen hat auch ein edles wissenschaftliches Motiv: sie möchte allen Religionen gleichermassen gerecht werden. Aber abgesehen davon, ob das wissenschaftlich überhaupt möglich ist, ohne auf den eigenen theologischen Standort zu verzichten, hat diese Art von Theologie damit den Abschied von der Theologie als offenbarungsgebundener Glaubenswissenschaft bekundet und den Übergang zur vergleichenden Religionswissenschaft vollzogen. Der pluralistische Ansatz ist im Grunde nichts anderes als ein „asiatischer Inklusivismus“: Er lädt uns ein, in’s Pantheon östlicher Religiosität miteinzutreten. Der Titel des Buches von John Hick kann hier als programmatisch angesehen werden: God Has Many Names.31 Dahinter steht ein vergleichbares Denkmodell, wie es uns in den neuen universalen Entwürfen der östlichen Religionen begegnet. Es ist die Vorstellung von einem namenlosen Alleinen, von einem Absoluten, Göttlichen. Kulturspezifisch und geschichtsbedingt offenbart es sich in den verschiedenen Religionen auf unterschiedliche, aber auf gleich gültige Weise. Zu ihnen gehört auch die christliche Offenbarung. Auch sie hat nur einen bestimmten Namen für das Unbenennbare, denn die Offenbarung musste naturgemäss in den unterschiedlichen Zentren der menschlichen Kultur pluralistisch und getrennt erfolgen. Und Jesus Christus? Er wird zu einem mehr der mancherlei Namensträger dieses sich kulturspezifisch offenbarenden Alleinen, Göttlichen.32 3. Unterwegs zu einem aufgeklärten Inklusivismus Sinn macht m. E. ein „aufgeklärter Inklusivismus“, der von folgenden Merkmalen geprägt ist: (1) Grundsätzlich positive Wertung der anderen Religionen als Ausdruck der semina verbi unter gleichzeitiger Zulassung gewisser Fragen, ohne sie dogmatisch stillzulegen: Warum haben viele Völker Jahrhunderte lang keine Kenntnis von der Offenbarungsgeschichte im Alten und im Neuen Testament gehabt? Warum entstehen auch „nach Christus“ neue Religionen, nicht zuletzt als Folge der christlichen Missionsgeschichte selbst? Gibt es nur in den anderen Religionen „Ambiguität“, während im Christentum alles klar ist? Warum ist die Religionsgeschichte des Christentums von vielen Pervertierungen und Depravationen nicht frei, die in der allgemeinen Religionsgeschichte vorkommen – wenn es auch wahr ist, dass Christen unter Rückbesinnung auf die normative Kraft des Evangeliums jene immer wieder in Frage stellten und überwanden? (2) Differenzierte Typologie der Religionen: Das rabbinische Judentum kann als Weiterleben des alten Israels verstanden werden, aber auch als eine nebenchristliche Religion, sofern es mit dem Christentum um die Interpretation der Tora und der Propheten konkurriert. Der Islam – als Paradigma einer nachchristlichen Religion mit einem Beerbungsanspruch gegenüber dem Christentum – stellt die Letztgültigkeit der christlichen Offenbarung und ihres Gottesverständnisses radikal in Frage, verhält sich also deutlich „divergent“ zum Christentum. Aber er weist auch in seiner Theozentrik, Eschatologie und Ethik wichtige Konvergenzen auf. Wie alle nachchristlichen Religionen betreibt er eine Christentumskritik, die als Fremdprophetie zu verstehen ist. Die ursprüngliche Wahrnehmung des Islam als „christliche Häresie“ muss heute der nachdenklichen Frage nach dem weichen, was uns Gott mit dem Islam sagen möchte. Ähnliches gilt für die Bahai-Religion und andere Formen nachchristlicher Religiosität (etwa für die indianischen und afroamerikanischen Synkretismen sowie die CargoKulte), die als indirekte Folge christlicher Mission entstanden sind. Asiatische, afrikanische oder indianische Religionen sind als ausserchristliche Religionen zu verstehen, die erst durch das missionierende Christentum mit der biblischen Offenbarungstradition in Berührung kamen, auch wenn sie zeitlich „vor Christus“ entstanden sind. Sie machen uns darauf aufmerksam, dass es für weite Teile der Menschheit „ponderable“ Alternativen zum Christentum gibt, die ihre Faszination nicht verloren haben.33 (3) Pneumatologische Ausrichtung: Wenn wir das Gespräch mit den Religionen Asiens ernsthaft suchen, werden wir schliesslich in der Missionstheologie stärker pneumatologisch denken müssen im Sinne jener Sätze in der Schrift, „die den allgemeinen Heilswillen Gottes rühmen, den Geist durch alle Propheten reden lassen und 31 1. Aufl.: Philadelphia 1982, deutsch: Gott und seine vielen Namen, 2. Aufl.: Frankfurt am Main 2002. Vgl. dazu u.a. Charles Morerod, La philosophie des religions de John Hick. La continuité des principes la période « chrétienne orthodoxe » à la période « pluraliste », Paris 2006. 32 Vgl. dazu Horst Bürkle, Die Pluralität der Religionen und die Sendung der Kirche. (Typoskript), Bonn 1995, S. 10f. 33 Vgl. dazu Carsten Colpe, Theologie, Ideologie, Religionswissenschaft. Demonstrationen ihrer Unterscheidung, München 1980 (darin: Die Zukunft der Kirche und die Zukunft der Welt, 54-66; Drängt die Religionsgeschichte nach einer Summe?, 251-277; Nicht „Theologie der Religionsgeschichte“, sondern „Formalisierung religionsgeschichtlicher Kategorien zur Verwendung für theologische Aussagen“, 278-288); ders., Das Phänomen nachchristlicher Religion in Mythos und Messianismus, in: Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Religionsphilosophie 9 (1967) 42-87. 8 ihn ausgegossen wissen über alles Fleisch“.34 Eingangs sagten wir ja mit dem Missionsdekret, dass der Heilige Geist schon in der Welt wirkte, ehe Christus verherrlicht wurde, und dass er bisweilen sogar sichtbar der apostolischen Tätigkeit vorangeht. Eine konsequent pneumatologisch geprägte Missionstheologie wäre an der Zeit. 4. Warum heute noch Mission? Inklusivistische Ansätze standen immer im Verdacht, missionarischen Defätismus hervorzurufen. Auf einen solchen infolge der ersten Rezeption des Konzils ging Paul VI. in Evangelii nuntiandi (8.12.1975) ein, nicht zufällig am 10. Jahrestag des feierlichen Abschlusses des Konzils: „Im übrigen, so fügt man hinzu, wozu überhaupt das Evangelium verkünden, wo doch die Menschen durch die Rechtschaffenheit des Herzens zum Heil gelangen können. Ausserdem weiss man doch, dass die Welt und die Geschichte erfüllt sind von ‚semina Verbi‘: wäre es da nicht eine Illusion zu behaupten, das Evangelium dorthin zu bringen, wo es schon immer in diesen Samenkörnern anwesend ist, die der Herr selbst dort gesät hat? Wer sich einmal die Mühe macht, in den Konzilsdokumenten den Fragen auf den Grund zu gehen, welche diese ‚Alibis‘ hier allzu oberflächlich verwerten, der findet dort eine völlig andere Sicht der Dinge“. Paul VI. bekräftigt dann die Pflicht zur Mission auf der Grundlage des Konzils, d.h. eingedenk der Religionsfreiheit „und in absolutem Respekt vor den freien Entscheidungen, die das Gewissen trifft“ (vgl. Dignitatis humanae 4). Gewiss könne Gott das Heil bei wem er will auf ausserordentlichen Wegen, „die er weiss“ (Ad gentes 7), wirken. Doch sein Sohn sei gerade dazu gekommen, „um uns durch sein Wort und sein Leben die ordentlichen Heilswege zu offenbaren“, wie es dem christozentrischen Inklusivismus entspricht. Anschliessend gibt Paul VI. zu verstehen, dass die Evangelisierung nicht so sehr zum Heil der anderen unerlässlich ist, sondern zu unserer eigenen Rettung: „Die Menschen können durch die Barmherzigkeit Gottes auf anderen Wegen gerettet werden, auch wenn wir ihnen das Evangelium nicht verkünden; wie aber können wir uns retten, wenn wir aus Nachlässigkeit, Angst, Scham – was der hl. Paulus ‚sich des Evangeliums schämen‘ (Röm 1,16) nennt – oder infolge falscher Ideen es unterlassen, dieses zu verkünden? Denn das heisst, Gottes Anruf zu verraten, der durch die Stimme der Diener des Evangeliums den Samen wachsen lassen will; es hängt von uns ab, ob dieser zu einem Baum heranwachsen und reiche Frucht bringen kann“ (Evangelii nuntiandi 80) Hier bekommt das paulinische „Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde!“ (1 Kor 9,16), eine Pointe, die im Sinne des aufgeklärten Inklusivismus wäre. Denn zur christlichen Sendung gehört auch ihre inkarnatorische Dynamik: Genauso wie „das Heil von den Juden kommt“ (Joh 4,22) will Gott, dass wir als Diener des Evangeliums und Mitarbeiter an seinem Weinberg zum Wachsen des Samens seines Reiches beitragen. Aber ein aufgeklärter Inklusivismus muss in der Begründung der Mission ein wenig weiter gehen. Die in vielen lehramtlichen Texten vorhandene Dialektik zwischen der Fülle des Heils, der Gnade und der Wahrheit in der Kirche einerseits und der defizitären Lage in anderen Religionen andererseits, so dass die Evangelisierung nötig sei, um die dortigen Schattenseiten mit dem Licht des Glaubens zu erhellen und die Menschen zur Taufe einzuladen, sollte um folgende Perspektive erweitert werden: dass uns unser Glaube und unsere Hoffnung nur im Angesicht der Anfechtungen und Standpunkte, ja, der „Fremdprophetie“ der anderen richtig bewusst werden können (vgl. z.B. Gaudium et spes 44). Das gehört auch zum kenotischen, inkarnatorischen Weg der Kirche durch die Geschichte. Joseph Ratzinger selbst hat 1967 die Notwendigkeit des interreligiösen Dialogs ähnlich begründet: weil der Glaube sich besser versteht, „in dem er den anderen verstehen lernt“.35 Angesichts des immer deutlichen Verschwindens der soziologischen Gestalt des Christentums, die seit der Konfessionalisierung der Normalfall war, wird immer klarer, dass im 21. Jahrhunderts eine missionarische Pastoral unbedingt nötig ist. Gefragt ist heute nicht die Konservierung des Bestandes oder die bequeme Verwaltung der kleinen Herde, „sondern missionarische Existenz“,36 wie in der Antike: „Wir treten jetzt in eine Zeit ein, in der christlicher Glaube missionarisch-evangelisierend in der Generationenabfolge weitergegeben werden muss. Damit nähern wir uns – freilich in einem völlig anderen gesellschaftlichen Umfeld – in bemerkenswerter Weise wieder der Situation des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten seines Bestehens an. Dort trafen die Menschen, die sich einer christlichen Gemeinde anschlossen, in der Regel die Entscheidung für Taufe und Nachfolge Christi eigenständig. Selbst wenn schon sehr früh auch Kleinstkinder (im Rahmen der antiken Grossfamilie) getauft wurden, so war der Anschluss an die christliche Kirche für den Einzelnen eben doch nicht selbstverständlich. Angesichts der ‚Fremdheit’ des Christlichen in einer religionsgesättigten Welt der Spätantike – übrigens eine interessante Parallele zum heutigen ‚Religionsboom’ in einer nachchristlichen Gesellschaft – waren die Interessierten immer wieder neu herausgefordert, sich bewusst für den ‚Mehrwert’ des Christlichen zu entscheiden“.37. Wenn das so ist, dann ist es auch Zeit, dass wir uns im 21. Jahrhundert wieder auf die Stärken des Christentums in den Anfängen zurückbesinnen: auf den neuen Volk-Gottes-Begriff (die Migrationsgemeinden 34 Rahner, Aspekte europäischer Theologie (Anm. 18), 102f. Ratzinger, Konzilsaussagen über die Mission ausserhalb des Missionsdekrets (Anm. 10), 47. 36 Joseph Ratzinger, Weltoffene Kirche?, in: ders., Volk Gottes (Anm. 3), 282–301, hier 300. 37 „Zeit zur Aussaat“. Missionarisch Kirche sein (vom 26.11.2000), hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Die deutschen Bischöfe 68), Bonn 2000, 34. 35 9 und die Migrationspriester bei uns stellen auch eine Chance dar, „lebendige Katholizität“ und Austausch der Gaben in der Ortskirche zu gestalten),38 auf die Translations- und Inkulturationsfähigkeit, auf die neue Moral bzw. auf die Kultur der Barmherzigkeit und nicht zuletzt auch auf eine missionarische Spiritualität, die, wie das 2. Vatikanische Konzil betont hat, von Bemühen um die „Christusförmigkeit“ und der Suche nach dem Antlitz Christi in den Armen und Leidenden geprägt ist (Lumen gentium 8); eine Spiritualität, die „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art“, als „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi“ (Gaudium et spes 1) betrachtet; eine Spiritualität schliesslich, die mit der mystischen Theologie weiss, dass Gott der Haupthandelnde ist, der alle Menschen zu sich führen möchte und zu seinem Bild und Gleichnis innerlich bearbeitet (Johannes vom Kreuz, Gaudium et spes 22), während wir nur Mitarbeiter an seinem Acker sind. Wir haben im Bewusstsein der Schattenseiten der Missionsgeschichte demütig und gelassen zu säen, und für eine gute Ernte zu beten, aber auch dafür zu sorgen, dass wir Gott mit unserem Gegenzeugnis nicht im Wege stehen: „Das Wachsen und Gedeihen besorgt Gott selbst“.39 38 Vgl. Mariano Delgado, Lebendige Katholizität Gestalten. Auf dem Weg zu einem Miteinander von einheimischen und zugewanderten Katholiken, in: Stimmen der Zeit 218 (2000) 595-608. 39 Ebd., 14. 10