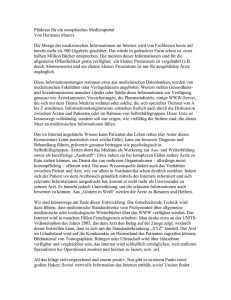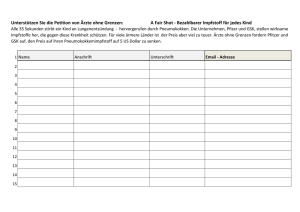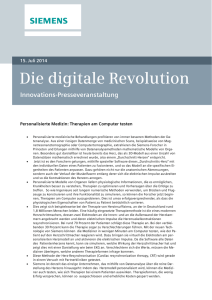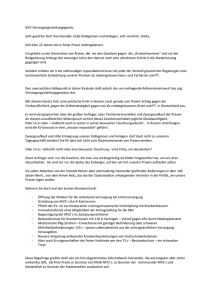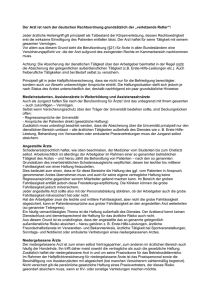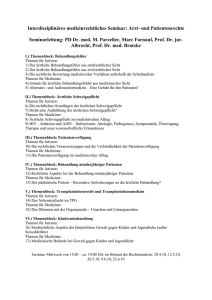Kenntnisse und Einstellungen klinisch tätiger Ärzte zum Patienten
Werbung
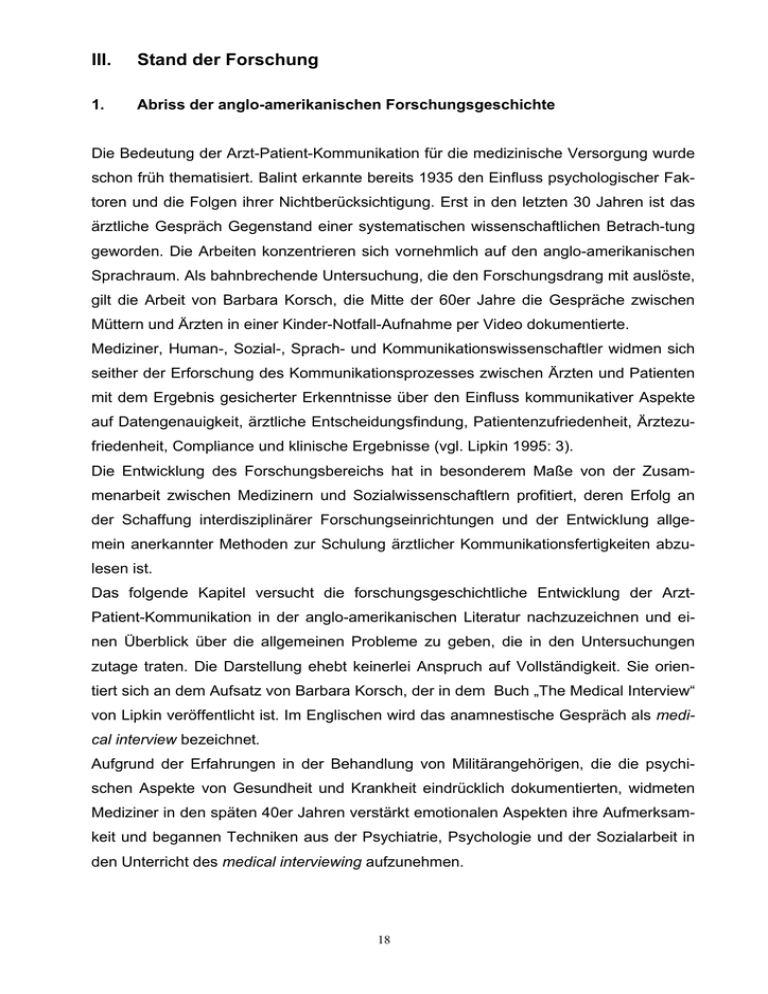
III. Stand der Forschung 1. Abriss der anglo-amerikanischen Forschungsgeschichte Die Bedeutung der Arzt-Patient-Kommunikation für die medizinische Versorgung wurde schon früh thematisiert. Balint erkannte bereits 1935 den Einfluss psychologischer Faktoren und die Folgen ihrer Nichtberücksichtigung. Erst in den letzten 30 Jahren ist das ärztliche Gespräch Gegenstand einer systematischen wissenschaftlichen Betrach-tung geworden. Die Arbeiten konzentrieren sich vornehmlich auf den anglo-amerikanischen Sprachraum. Als bahnbrechende Untersuchung, die den Forschungsdrang mit auslöste, gilt die Arbeit von Barbara Korsch, die Mitte der 60er Jahre die Gespräche zwischen Müttern und Ärzten in einer Kinder-Notfall-Aufnahme per Video dokumentierte. Mediziner, Human-, Sozial-, Sprach- und Kommunikationswissenschaftler widmen sich seither der Erforschung des Kommunikationsprozesses zwischen Ärzten und Patienten mit dem Ergebnis gesicherter Erkenntnisse über den Einfluss kommunikativer Aspekte auf Datengenauigkeit, ärztliche Entscheidungsfindung, Patientenzufriedenheit, Ärztezufriedenheit, Compliance und klinische Ergebnisse (vgl. Lipkin 1995: 3). Die Entwicklung des Forschungsbereichs hat in besonderem Maße von der Zusammenarbeit zwischen Medizinern und Sozialwissenschaftlern profitiert, deren Erfolg an der Schaffung interdisziplinärer Forschungseinrichtungen und der Entwicklung allgemein anerkannter Methoden zur Schulung ärztlicher Kommunikationsfertigkeiten abzulesen ist. Das folgende Kapitel versucht die forschungsgeschichtliche Entwicklung der ArztPatient-Kommunikation in der anglo-amerikanischen Literatur nachzuzeichnen und einen Überblick über die allgemeinen Probleme zu geben, die in den Untersuchungen zutage traten. Die Darstellung ehebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Sie orientiert sich an dem Aufsatz von Barbara Korsch, der in dem Buch „The Medical Interview“ von Lipkin veröffentlicht ist. Im Englischen wird das anamnestische Gespräch als medical interview bezeichnet. Aufgrund der Erfahrungen in der Behandlung von Militärangehörigen, die die psychischen Aspekte von Gesundheit und Krankheit eindrücklich dokumentierten, widmeten Mediziner in den späten 40er Jahren verstärkt emotionalen Aspekten ihre Aufmerksamkeit und begannen Techniken aus der Psychiatrie, Psychologie und der Sozialarbeit in den Unterricht des medical interviewing aufzunehmen. 18 Die wachsende Bedeutung psychologischer Aspekte und ihre Berücksichtigung im Gespräch Der Mediziner und Psychotherapeut Michael Balint untersuchte zu Beginn der 50er Jahre in England als einer der ersten den Einfluss psychologischer Faktoren und die Folgen ihrer Nichtberücksichtigung und erkannte die Bedeutung des Gesprächs für Diagnose und Therapie. Bereits 1935 hatte der aus Ungarn stammende Arzt psychoanalytische Aspekte in die Ausbildung praktischer Ärzte aufgenommen. In den 50er Jahren wurde Balint durch die Arbeit mit Gruppen an der Tavistock Clinic in London bekannt. Er hatte die revolutionäre Erkenntnis, dass nicht die Arznei, sondern "der Arzt das am häufigsten verwendete Heilmittel sei". Zu den von ihm gegründeten Balint-Gruppen treffen sich jährlich 13. 000 Ärzte in der ganzen Welt (vgl. Luban-Plozza 1989: 3). Der gemeinsame Austausch von Erfahrungen im Gespräch soll den Teilnehmern helfen, den Patienten besser zu verstehen und Lücken in der Kommunikation zu schließen. Unter Anleitung eines geschulten Therapeuten sollten die Ärzte Erfahrungen im Umgang mit Patienten austauschen, um so die Kommunikation im Arzt-Patient-Verhältnis zu verbessern und die Wirksamkeit der "Droge Arzt" zu erhöhen. Das Modell der Balint-Gruppen erwies sich als sehr erfolgreich. Heute gibt es weltweit Hunderte von Gruppen für Ärzte, Studenten, Pflegepersonal und Therapeuten. Engel (1976) förderte das Interesse an psychologischen Aspekten von medizinischen Krankheiten durch die Etablierung eines einheitlichen Krankheitskonzepts, das besagt, dass jede Krankheit eine emotionale, eine soziale und eine biologische Komponente besitzt. Engels Einfluss führte viele lehrende Mediziner und praktizierende Ärzte zu der Einsicht, dass ein umfassenderer Ansatz in der Befragung von Patienten notwendig sei. Mit der konzeptionellen Entwicklung fand parallel eine technische Entwicklung statt, die Ton- und Bildaufzeichnungen und später Videoaufnahmen ermöglichte. Forscher in Großbritannien (Byrne und Long, 1976) und den Vereinigten Staaten entwickelten Kodierungsschemata für die Arzt-Patient-Interaktion, die eine systematische, wissenschaftliche Analyse erlaubten. Davies (1971) modifizierte ein von Bales (1950) zur Erforschung von Gruppeninteraktionen entwickeltes Kodierschema, um die Beziehung zwischen verbalen Interaktionen im Gespräch, Patientenzufriedenheit und Compliance zu analysieren. Korsch veränderte und erweiterte diese Arbeit in ihrer bahnbrechenden Untersuchung von Behandlungen in einer Kinder-Notfall-Aufnahme (Francis et al., 1969; Korsch et al., 1971; Korsch und Negrete, 1972). Ihre Studie, die als eine der umfangreichsten und am meisten zitierten Untersuchungen in diesem Bereich gilt, löste 19 den Forschungsdrang in der Gesundheitskommunikation aus, der heute zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen hervorbringt. Roter (1977) modifizierte das Schema von Bales weiter und demonstrierte in einer Studie, dass veränderte Gesprächsstile die Gesundheitsergebnisse verändern. Sie veränderte nicht das Verhalten der Ärzte, sondern stärkte die Patienten, die in Studien oft als passiv und unbeholfen charakterisiert werden, indem sie sie ermutigte, Fragen zu stellen und eine aktivere Rolle im Gespräch einzunehmen. Diese Strategie deckte sich mit der aufkeimenden Verbraucherhaltung in den USA, die die traditionelle Vorherr-schaft der Ärzte herausforderte. Die Wahl geeigneter Untersuchungsparameter Ein wichtiger Aspekt der Arzt-Patient-Kommunikation ist die Wahl geeigneter Untersuchungsparameter bei der Ergebnisforschung. Am häufigsten untersucht werden Patientenzufriedenheit und Compliance. Diese Parameter sind jedoch nicht ohne Probleme. Da die Patienten im Allgemeinen zufrieden sind, ist die Variabilität gering. Es ist schwierig zu beweisen, dass Gesprächstechniken eine Wirkung haben. Eine Messung der Patientenzufriedenheit erweist sich als ungeeignet, wenn sie unmittelbar nach dem Arztbesuch erfolgt, bevor der Patient Zeit zum Nachdenken über das Gespräch hatte. Die Compliance ist ebenfalls schwer zu messen. „Das Pillenzählen“ (pill counts) ist am verlässlichsten, aber teuer und nicht anwendbar bei Patienten, die Diätvorschriften zur Kontrolle von Blutzucker und Serumcholesterol einhalten müssen. Inui und seine Kollegen (1976) beschäftigten sich eingehender mit der Frage, wie die Gesundheitsergebnisse durch die Art der Anamneerhebung beeinflusst werden. Sein Ansatz ging über Fragetechniken hinaus und beinhaltete die Bestimmung von Krankheitsauffassungen und deren Einfluss auf die Motivation von Patienten, vorgeschriebene ärztliche Anweisungen einzuhalten. Er fand heraus, dass Lösungen gefunden werden konnten und sich positive medizinische Ergebnisse einstellten, wenn Ärzte Compliance-Probleme offen ansprachen. In einer der besten Besprechungen, die laut Korsch jemals auf diesem Gebiet veröffentlicht worden sind, bewiesen Mumford et al. (1982), dass das Gesprächsverhalten und verwandte Fertigkeiten einen signifikanten Einfluss auf eine Reihe klinischer Ergebnisse haben. Dies spornte zu weiteren Bemühungen an, die Begegnung zwischen Arzt und Patient zu charakterisieren und spezifische Gesprächsstile mit Behandlungsergebnissen zu verbinden. Die Forscher konnten erfolgreich nachweisen, dass quantitative Ansätze zur Kodierung des Gesprächs statistisch reliabel und valide sind. 20 Die Ergebnisse waren jedoch enttäuschend im Hinblick auf die Verbindung von Frageund Gesprächsstilen mit Unterschieden in den Behandlungsergebnissen. Dies gelang Kaplan et al. 1989. Sie konnten erfolgreich Veränderungen biologischer Ergebnisse (z.B. Veränderungen des Blutzuckerspiegels, des Blutdrucks und Veränderungen bei Magengeschwür-Symptomen) als Folge unterschiedlicher Gesprächs- und Frageinterventionen nachweisen. Diese Studie verlieh der Ergebnisforschung (outcomes research) eine wichtige Dimension, denn sie erweiterte die bisherige Betonung von Patientenzufriedenheit und Compliance in der Forschung um die Komponenten biologische Funktionen und Lebensqualität. Neue Methoden zur Ergebnisforschung (outcome research), die mit physikalischen Untersuchungseinheiten korrelieren, sind Quality- of- Life Parameter, die die Patientenwahrnehmung von physischem und psychischem Wohlbefinden messen (Sherbourne und Stewart, 1991). Die Wirksamkeit von Kommunikationstrainings Parallel zum Aufkommen von Kodiersystemen und der Ergebnisforschung untersuchten in der klinischen Ausbildung tätige Mediziner die Wirksamkeit von Übungen für Medizinstudenten. Verschiedene Studien belegten, dass die Kommunikationsfähigkeit bei Studenten mit fortschreitender Ausbildung abnimmt und sich ihre Empfindungsfähigkeit gegenüber menschlichem Leiden verringert (Helfer, 1970; Maguire und Rutter, 1976; Mizrahi, 1986; Platt et al., 1979). Unterschiedliche klinische Ausbilder waren jedoch in der Lage, kommunikative Fertigkeiten zu vermitteln, die eine anhaltende Wirkung auf das ärztliche Gesprächs- und Frageverhalten hatten. Maguire konnte z.B. nachweisen, dass fünf Jahre nach dem Studienende praktische Ärzte, die im ersten Studienjahr ein Training erhalten hatten, bessere Leistungen erbrachten als nicht-trainierte Ärzte in der Kontrollgruppe (Maguire et al., 1986). Obwohl sich die Wirkung von Schulungen auf klinische Ergebnisse nur mit Einschränkungen darstellen lässt, so haben doch verschiedene Autoren gezeigt, dass ein Training kommunikativer Fertigkeiten, das ärztliche Aufdecken emotionaler Schwierigkeiten und Sorgen eindeutig verbessert. Die Wirksamkeit klientenzentrierter Therapieansätze und deren Langzeiteffekt sind auch in der Gesprächspsychotherapie nachgewiesen worden (vgl. Biermann-Ratjen et al. 1997: 77). Roter und Hall bewiesen 1991, dass in Kommunikation geschulte Ärzte diese Fertigkeiten in ihre tägliche Praxis aufnahmen und die Patienten berichteten über eine signifikante Verringerung emotionaler Schwierigkeiten, auch noch nach sechs Wochen des Arztbesuches. 21 Kommunikationstrainings sind nicht immer erfolgreich. Bisher gibt es aber nur wenige Ansätze, die die Wirkung solcher Interventionen auf die Patientenzufriedenheit evaluieren. Brown et al. untersuchten 1999, ob Krankenhausärzte verschiedener Fachrichtungen, die ein Kommunikationstrainingsprogramm absolviert hatten, das unter Ärzten als allgemein anerkannt gilt, die Zufriedenheit von Patienten mit der ambulanten Behandlung steigern würden. Die Team von Brown fand heraus, dass das aus zwei 4-stündigen Workshops bestehende Trainingsprogramm von Kaiser Permanente, einer Health Maintenance Organization in Oregon, die Patientenzufriedenheit nicht wesentlich verbesserte. Obwohl die teilnehmenden Ärzte nach eigenen Angaben über eine moderate Verbesserung ihrer Kommunikationsfertigkeiten berichteten, blieb der Einfluss auf die allgemeine Patientenzufriedenheit unbedeutend. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass zur Verbesserung der Zufriedenheit von Patienten der Kommunikationsunterricht nicht nur länger und intensiver sein sollte, sondern auch eine größere Bandbreite an Kommunikationstechniken sowie ein kontinuierliches Feedback der Leistungen bieten muss (vgl. Brown et al. 1999). Levinson und Roter fanden 1993 heraus, dass die Unterrichtsstrategie und -philosophie eines Ausbildungsprogramms Einfluss auf dessen Wirkung haben und ein schülerorientierter Ansatz einem traditionellen lehrerorientierten, didaktischen Ansatz bei der Übernahme spezifischer Fertigkeiten in die tägliche Praxis vorzuziehen ist. Aspegren (1999: 563 ff.) unterzog die zahlreichen Veröffentlichungen zur Vermittlung und zum Erwerb von Kommunikationsfertigkeiten einer Qualitätsprüfung mit dem Ergebnis: Kommunikationsfertigkeiten sind lehr- und lernbar. Studenten sollten ein Kommunikationstraining erhalten, da der Erwerb kommunikativer Kompetenz sie zu besseren Diagnostikern macht und die Compliance zukünftiger Patienten erhöht. Nach einer kurzen Trainingsperiode können Ärzte die erworbenen Fertigkeiten effektiv als Lehrer weitergeben. Sozialwissenschaftler erreichen im Vergleich zu Medizinern bessere Ergebnisse als Lehrer. Kursinhalte, die auf Erfahrungen beruhen und problemorientiert sind, erzielen die besten Lernergebnisse. Studenten und Ärzte, die vor Trainingsbeginn eine geringe kommunikative Kompetenz aufweisen, zeigen nach dem Absolvieren einer Kurseinheit den größten Lernerfolg. Männer erlernen kommunikative Fertigkeiten erheblich langsamer als Frauen. Da ein Kommunikationstraining zeit- und kostenintensiv ist, ist die Evaluierung verschiedener Unterrichtsmethoden ein wichtiges Aufgabengebiet der Forschung, um Lehrern und Lehrplan-Verantwortlichen erfolgversprechende Informationen an die Hand zu geben. 22 Der Einsatz standardisierter Patienten Einige Forscher untersuchen derzeit den Einsatz standardisierter Patienten, weil sie einen Kontrollfall mit bekannten Dimensionen darstellen, der Rückschlüsse auf die Tüchtigkeit des Arztes erlaubt. Logistisch gesehen, bietet der Einsatz standardisierter Patienten viele Vorteile. Simulationspatienten lernen, die Symptome einer Krankheit, unter der sie selbst nicht leiden, zu präsentieren. Für ihre Dienste werden sie eigens entlohnt. Sie spielen also die Rolle von Versuchspersonen für angehende Mediziner, die an ihnen ihre praktischen Fertigkeiten einüben können. Dadurch können den Patienten schmerzhafte Untersuchungen erspart werden. Des Weiteren lindern sie den Mangel an Patienten. Und schließlich lassen sich mit Hilfe der Simulation Prüfungen für Ärzte besser standardisieren, denn die Versuchspersonen sind so trainiert, dass sie die Symptome stets gleich präsentieren. Reale Patienten dagegen präsentieren ihr Leiden stets anders. Das erschwert die Diagnosestellung für den Arzt und sorgt für ungleiche Bedingungen bei ärztlichen Prüfungen. Da die Zahl der Patienten in den Universitätskliniken die Zahl der Studienplätze in der Medizin begrenzt, kann man sich die immense Bedeutung der Simulation ausmalen. Obgleich simulierte Patienten dazu neigen, allzu hilfsbereit zu sein, und sie mitunter keine spontanen Reaktionen zeigen, hat sich doch in Studien gezeigt, dass ihre Antworten valide und reproduzierbar sind. Die Wahl geeigneter Forschungsmethoden Es gibt eine lange Tradition ethnographischer und teilnehmender Beobachtungen bei Untersuchungen mit medizinischem Hintergrund. Die Forscher nutzen zunehmend für ihre Untersuchungen des Arzt-Patient-Gesprächs audiovisuelle Aufnahmemethoden als Hauptquelle für ihre Daten. Diese Methoden ermöglichen eine sehr genaue Analyse einzelner Sequenzen sowie deren Beziehung zu größeren Einheiten oder Ergebnissen des Gesprächs. Beckman und Frankel untersuchten 1984 in einer allgemeinmedizinischen Praxis die Eröffnungssequenzen von 74 Gesprächen. Im Durchschnitt sprachen die Patienten über ihre Sorgen 18 Sekunden lang, bevor sie von ihrem Arzt unterbrochen wurden. Eine Analyse dieser Art erlaubte es den Forschern, eine Verbindung der Unterbrechungen mit dem Ergebnisverlauf des Gesprächs, versteckten Tagesordnungspunkten oder von Patienten am Ende des Gesprächs eingebrachten Bedenken herzustellen. Der Vorteil eines qualitativen Ansatzes zur Analyse ärztlicher Gespräche besteht darin, dass er eine Identifizierung kritischer Momente oder Zeitpunkte erlaubt, die Verlauf, Richtung und Ergebnis der Interaktion beeinflussen. 23 In traditionell quantitativen Studien bemühen sich die Forscher, relative Häufigkeiten von Codes zu korrelieren, indem sie jedem Ereignis eine gleiche Gewichtung ohne Bewertung von Kontext und Lokalisation geben. Die Diskussion unter Forschern über die Überlegenheit quantitativer Methoden gegenüber qualitativen Methoden zur Untersuchung von Arzt-Patient Gesprächen bringt keine sinnvollen Ergebnisse, da jede Methode auf einem anderen Paradigma basiert. Roter und Frankel haben dargelegt, dass beide Methoden einander komplementieren und so zu einem besseren Verständnis der Komplexitäten der Arzt-Patient-Kommunikation beitragen (vgl. Korsch 1995). Obwohl die Forschung auf dem Gebiet der Kommunikation beachtlich ist, gibt es Korsch zufolge bislang keine integrierte Theorie menschlichen Sozialverhaltens, die zur Erklärung der Arzt-Patient-Beziehung herangezogen werden kann. Theorien, abgeleitet aus anderen Bereichen menschlicher Interaktionen, können nicht auf die speziellen Beziehungen zwischen Patienten und ihren Ärzten angewendet werden, insbesondere nicht auf jene, die sich entwickeln, wenn Patienten lebensbedrohliche Krankheiten haben, Entscheidungen auf der Basis nicht übereinstimmender medizinischer Informationen erfolgen müssen oder eine Auswahl getroffen werden muss, wenn die Ressourcen knapp sind. Das Konzept des biopsychosozialen Modells nach Engel ist ansprechend, basiert aber auf verschiedenen Lehren aus der Biologie, Psychologie und Soziologie, die nicht vollständig integriert wurden. Laut Korsch ist es die Aufgabe der Grundlagenforschung, einen Rahmen zur Aufstellung von Aussagen zu schaffen, die sich sowohl innerhalb als auch zwischen verschiedenen Forschungsbereichen verallgemeinern lassen. Aufgrund der kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen klinisch tätigen Medizinern und Sozialwissenschaftlern in den USA hat die Forschung auf dem Gebiet der ArztPatient-Kommunikation mittlerweile einen fundierten Entwicklungstand erreicht (vgl. Inui et al. 1995: 487 und 478). Die Curricula der Medical Schools, an denen ärztliche Kommunikationstrainings zu einem festen Bestandteil der Ausbildung geworden sind, dokumentieren die erfolgreiche Umsetzung der Forschungsergebnisse in praxisrelevante Unterrichtskonzepte zur Vermittlung kommunikativer Fertigkeiten. Fortschritt, Wachstum und Entwicklung auf dem Gebiet der Arzt-Patient-Kommunikation können nur durch die Bündelung aller wissenschaftlichen Bemühungen auf diesem Gebiet und die Einbindung multipler Forschungsergebnisse in einen interdisziplinären Forschungsprozess erreicht werden (vgl. ebenda 488). 24 2. Die Forschungslage im deutschsprachigen Raum Die Interdisziplinarität der Arzt-Patient-Kommunikation zeigt sich sowohl in der wissenschaftlichen Behandlung des Untersuchungsgegenstandes als auch in der Herkunft der Autoren. Die medizinische und therapeutische Kommunikation ist zum Forschungsobjekt von Psychologen, Psychotherapeuten, Kommunikationsforschern, Linguisten, Medizinern, Soziologen und Medizinsoziologen geworden. Die Kommunikationsforschung hat mit den Arbeiten von Bühler, Watzlawik und Schulz von Thun den Weg für eine kommunikationspsychologisch orientierte Betrachtung unter Einbeziehung verbaler und nonverbaler Aspekte bereitet. Im Bereich der Linguistik kann die Arzt-Patient-Kommunikationsforschung bereits auf eine relativ lange Forschungstradition zurückblicken. Den theoretischen Rahmen bilden in der angewandten Linguistik vor allem die Theorie des sprachlichen Handelns mit Konzepten der Sprechakttheorie und der Konversationsanalyse sowie die Soziolinguistik, die nachgewiesen hat, dass soziologische Variablen wie Schichtzugehörigkeit, Geschlecht, Alter, Ausbildung und psychologische Variablen wie Erfahrung und Routine bei der Textproduktion eine wichtige Rolle spielen und bei der Analyse von sprachlichen Daten nicht vernachlässigt werden dürfen. Beide Richtungen beschäftigen sich zunehmend mehr mit Kommunikation in Institutionen. Aufgrund der Entwicklung in der Diskursanalyse hat die Linguistik methodische Grundlagen für Gesprächsanalysen geschaffen (vgl. Menz 1991: 8 f.) In Deutschland beschäftigt sich die Sprachforscherin Els Oksaar seit vielen Jahren mit der Problematik der Verständigung zwischen Arzt und Patient. Der von ihr entwickelte „Kommunikative Akt“ erfasst den gesamten Aktionsrahmen der Arzt-Patient-Kommunikation. Die Probleme, die sich aus der fachsprachlichen Natur dieses Kommunikationstyps ergeben, analysiert Löning in ihrer linguistisch orientierten Arbeit unter pragmatischen Gesichtspunkten. Der Mediziner und Sozialwissenschaftler Dirk Dürholtz hat 1993 Unterschiede in Klassifikation und Kognition von Krankheitsbegriffen als Ursache von Verständigungsschwierigkeiten zwischen Arzt und Patient untersucht. Mittels einer von amerikanischen Wissenschaftlern entwickelten Methode, der multidimensionalen Skalierung, gelang es Dürholtz, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Ordnungsdimensionen über Krankheitsbegriffe und damit verknüpfte Krankheitsvorstellungen zwischen Laien und Ärzten empirisch nachzuweisen. Während Ärzte entsprechend ihrer Ausbildung Krankheiten primär nach ätiologisch-funktionellen und sekundär nach topographischen Gesichtspunkten ordnen, ordnen Laien Krankheiten primär nach topogra25 phischen Gesichtspunkten. Unterschiedliche Klassifikationsmuster sind ein Hauptgrund für Verständigungsschwierigkeiten in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Seit dem Beginn der 80 er Jahre wird auch in Österreich zunehmendes Interesse für die Problematik dieses Kommunikationstyps gezeigt. In Österreich geht die Erforschung der Arzt-Patient-Kommunikation vor allem auf das Ludwig-Boltzmann-Institut für Medizinsoziologie und das Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien zurück. Wimmer konnte 1989 nachweisen, dass eine strukturierte ausführliche Aufklärung von Patienten vor Operationen deren Aufenthalt im Krankenhaus signifikant verkürzt. Menz, ebenfalls tätig am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien, hat 1991 erstmals die Verschleierung der Ausbildungssituation im Krankenhaus sprachwissenschaftlich analysiert. Zur Aufrechterhaltung des Status quo mit seinen Machtverhältnissen wird die medizinische Ausbildung vor den Patienten latent gehalten. Menz ging der Frage nach, wie sich die Ausbildungsfunktion in der Institution Krankenhaus auf die Sozialisation in den Arztberuf auswirkt und welche Folgerungen sich hieraus für die Kommunikation zwischen Arzt und Patient ergeben. Die Analyse hat gezeigt, dass eine fundierte Gesprächsausbildung im Krankenhaus tatsächlich nirgends stattfindet, obwohl Gespräche mit Patienten einen Großteil des ärztlichen Alltags ausmachen. Bereits 1987 versuchten Nowak und Wimmer in einem Modellversuch, linguistische Analyseergebnisse in einem Kommunikationstraining für Ärzte umzusetzen. Die Soziologie hat besonders auf die asymmetrische Struktur des Arzt-PatientGesprächs hingewiesen. Die Medizinsoziologie wurde 1971 in die Approbationsordnung für Ärzte aufgenommen. Sie behandelt ärztliches Handeln als Kommunikation und beschäftigt sich u.a. mit der Arzt-Patient-Rolle. Trotz der Aufnahme sozialwissenschaftlich orientierter Fächer wie Medizinsoziologie, Medizinische Psychologie, Psychosomatik sowie Sozial- und Arbeitsmedizin in den Fächerkanon der Medizin bleiben psychologisches Verstehen, eine Sensibilisierung für eigene Gefühle im Umgang mit Patienten und die Befähigung zur Aufnahme einer therapeutischen Beziehung unerreichte Lernziele. Denn zusammen machen diese Disziplinen nur 14% des Unterrichtsangebotes aus (vgl. Schmeling- Kludas 1988: 23). Bemühungen von ärztlicher Seite Die Erkenntnis, dass in Bezug auf die Kompetenz des Redens ein eindeutiges Defizit besteht und dass Gesprächsführungskompetenz weder in der Ausbildung vermittelt wird noch ihre Erlangung einen Stellenwert in der bisherigen Praxis hat, wird auch von ärztlicher Seite formuliert (vgl. Ripke 1994, Haferlach 1994, Dahmer und Dahmer 1992). 26 Mediziner in Klinik und Praxis haben erkannt, dass das ärztliche Gespräch neben der Untersuchung und Behandlung die Basis der Arzt-Patient-Beziehung darstellt. Unbehagen über die mangelnde Kommunikation zwischen Arzt und Patient und die Vernachlässigung wichtiger Aspekte der Arzt-Patient-Beziehung in der Ausbildung haben engagierte Mediziner veranlasst, sich für eine patientenorientierte Gesprächsmedizin einzusetzen. "Mit der Idee, den Patienten mit seiner einmalig individuellen Eigenart und seiner unwiederholbaren Lebensgeschichte ins Zentrum der Heilkunde zu stellen", hat Balint das Tor zur Psychosomatik geöffnet (Sedlak und Gerber: 1992: 21). Thure von Uexküll, der Begründer der Psychosomatik, hat dessen Ideen weiterentwickelt und im Ulmer Modell, einer internistisch-psychosomatischen Krankenstation, umgesetzt. Uexkülls Anliegen ist die Abkehr von einer Medizin, die „seelenlose Körper und körperlose Seelen“ behandelt, hin zu einer Medizin, die den Kranken und seine Krankheit als Einheit wahrnimmt. In Deutschland gibt es mittlerweile eine Vielzahl psychosomatischer Einrichtungen wie z.B. in den Praxen niedergelassener Ärzte, in Ambulanzen, Kliniken und Abteilungen. Jedes größere Krankenhaus unterhält heute eine eigene psychosomatische Abteilung. Eine Reihe von Medizinern verfügt über eine Zusatzausbildung in Psychosomatik. Einige Behandlungsansätze müssen konsequenterweise als „additiv“ bezeichnet werden, da sie als zusätzliche psychotherapeutische Leistung zur traditionell somatischen Therapie angeboten werden (vgl. Bertram 1993: 3). Ein Bemühen von medizinischer Seite aus, Ergebnisse der Sprach- und Kommunikationsforschung für die ärztliche Praxis fruchtbar zu machen, dokumentieren die Arbeiten von Dahmer (1982), Speierer (1985), Geisler (1987), Ripke (1994) und Haferlach (1994). Der Mediziner und Psychologe Dahmer stellt in seinem Buch die auxiliäre Gesprächsführung anhand praxisrelevanter Beispiele und Übungen vor und liefert damit eine praktische Anleitung zur Gesprächsführung. Sowohl Speierer als auch Geisler erweisen sich als exzellente Kenner der anglo-amerikanischen Forschungsliteratur zur Arzt-Patient-Kommunikation, insbesondere der zur Compliance, sowie der Literatur auf dem Gebiet der Kommunikationsforschung. Geisler beschreibt die vielschichtigen Aspekte des Arzt-Patienten-Gesprächs in verschiedenen Situationen, während Speierer das patientenorientierte Gespräch aus einer kommunikationstheoretischen Sicht darstellt. Die Arbeit von Speierer ist sehr praxisorientiert, am Ende seines Buches finden sich Übungen zum Erlernen des patientenorientierten Gesprächs. Ripke gibt Kollegen und angehenden Ärzten mit seinem Buch ein praxiserprobtes Konzept für den gesamten Bereich der Beziehung zwischen Arzt und Patient in der Allgemeinpraxis an die Hand. Der Allgemeinmediziner mit einer Zusatzausbildung in klien27 tenzentrierter Gesprächsführung und Gesprächsspychologie nach Carl Rogers zeichnet den gesamten Gesprächsprozess anhand transkribierter Tonbandaufzeichnungen von Sprechstundengesprächen einfühlsam nach und belegt mit Beispielen aus der eigenen Praxis, dass eine patientenorientierte Gesprächsmedizin ohne zusätzlichen Zeitaufwand möglich ist. Kurz und übersichtlich ist das Buch des Mediziners und Geisteswissenschaftlers Haferlach, das sich primär an Ärzte richtet, aber dennoch für den Laien interessant und verständlich bleibt, während sich Holzhütter primär an die Patienten wendet und versucht deren Blick auf das zu lenken, was hinter den Kulissen des heutigen Medizinbetriebs geschieht. Er prangert die Schwachstellen des Gesundheitssystems wie Überdiagnostik, eine praxisferne Medizinbürokratie und ein erstarrtes Versicherungssystem an. Laut Holzhütter soll der Arzt als Anwalt des Patienten fungieren und den Patienten zur Verfechtung seiner Rechte motivieren. Mangel interdisziplinärer Zusammenarbeit Ein Rückblick auf die Arbeiten zur Kommunikation zwischen Arzt und Patient zeigt, dass das Forschungsinteresse Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre besonders groß war. Linguistisch orientierte Arbeiten zeichnen sich durch eine theoretische Vorgehensweise aus und analysieren das Arzt-Patient-Gespräch primär zur Untermauerung einer linguistischen Theorie. Aus den Ergebnissen werden in der Regel keine praxis-relevanten Ratschläge abgeleitet (vgl. Haferlach 1994: 6). Eine fächerübergreifende Zusammenarbeit, wie sie an der Universität Wien praktiziert wird, fehlt. Im Vergleich zu den vielen Veröffentlichungen aus der Soziologie und Linguistik haben sich bisher nur wenige Mediziner ausführlich der Arzt-Patient-Kommunikation gewidmet. Abgesehen von den Verdiensten Uexkülls, eine psychosomatische Grundversorgung in der Medizin zu etablieren, handelt es sich bei der Mehrzahl der von Medizinern zu diesem Thema verfaßten Arbeiten in der Regel um Einzelleistungen, die primär aus einem persönlichen und nicht einem wissenschaftlichen Interesse heraus entstanden sind. Es handelt sich also nicht um eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von mehreren Wissenschaftlern oder um Forschungsprojekte mit dem Ziel, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Da die mit der Kommunikationsproblematik befassten Mediziner und Sozialwissenschaftler die Arbeit der jeweils anderen Fachrichtungen nur sehr rudimentär wahrnehmen und rezipieren, fehlt hierzulande eine fächerübergreifende und integrative Zusammenarbeit zwischen Medizinern und Wissenschaftlern aus anderen Disziplinen, wie sie in den USA praktiziert wird (vgl. Lang 1994: 13). 28 Dass sozialwissenschaftliche Erkenntnisse das Problembewusstsein für die Bedeutung kommunikativer Prozesse in der medizinischen Versorgung erhöhen, ist an dem Ausbildungsprofil der auf diesem Gebiet tätigen Mediziner zu erkennen. Der Einfluss kommunikativer Aspekte auf Diagnose und Therapie wird in der Mehrzahl von Ärzten thematisiert, die über eine sozialwissenschaftliche Doppel- oder Zusatzqualifikation verfügen (vgl. Haferlach, Holzhütter, Schneider, Lüth, Dahmer, Ripke, Dürholtz, Grönemeyer, Dörner). Eine Verbesserung der kommunikativen Situation zwischen Arzt und Patient lässt sich demzufolge nur durch die Einbindung sozial- und kommunikationswissenschaftlicher Erkenntnisse in die Ausbildung erzielen. Quasthoff-Hartmann beschreibt den möglichen Zugang zur Verbesserung der Situation aus linguistischer Sicht: „Wir haben relativ wenig Einwirkungsmöglichkeiten auf die psychischen, kognitiven, medizinischen und leider auch auf die organisations-strukturellen Komponenten des Problems. Den einzigen Zugriff auf die gegenwärtige Praxis, den wir langfristig erhoffen können, ist über eine Verbesserung der Ausbildung der Ärzte. In diese Ausbildung ließe sich - entsprechende Erkenntnisse vorausgesetzt – eine erhöhte Sensibilisierung des Arztes gegenüber diskursstrukturellen und konversationstechnischen Phänomenen m.E. relativ leicht erzielen.“ (Quasthoff-Hartmann 1982: 72) Eine Verbesserung der Gesprächssituation zwischen Arzt und Patient setzt einen interdisziplinärer Wissenstransfer sowie die Einbindung entsprechender Erkenntnisse in die ärztliche Ausbildung voraus. An der Charité der Humboldt-Universität zu Berlin wird in einem Modellprojekt seit 1999 versucht, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient als einen wesentlichen Bestandteil in die medizinische Ausbildung zu integrieren (Burger et al.: 2003). Ein internationaler Vergleich zeigt, dass das Thema der Arzt-Patient Kommunikation hierzulande zwar durch eine interdisziplinäre Behandlung gekennzeichnet ist, eine integrative fächerübergreifende Zusammenarbeit, wie sie in Amerika und Großbritannien praktiziert wird, findet jedoch nur vereinzelt statt. 29