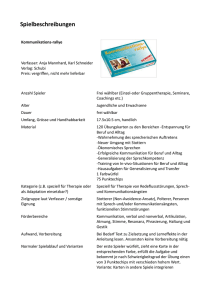Sprecher 2
Werbung

SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Essay Mut zur Lücke? Gedanken zur musikalischen Artikulation Von Andreas Fervers Sendung: Montag, 3. Februar 2014, 22.03 Uhr Redaktion: Lydia Jeschke Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Ein Mitschnitt auf CD Ist beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden für € 12,50 erhältlich. Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de Mut zur Lücke? Gedanken zur musikalischen Artikulation Sprecher 2: Legato heißt "gebunden". Der Bogen, der eine kleine oder größere Gruppe von Noten zusammenhält, bindet sie zusammen, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Auch das Wort Religion bedeutet ja "Bindung" des Menschen an das göttliche Gesetz, und daher ist ein legato-Vortrag vor allem für jede kultische Musik angebracht, darüber hinaus für alle gedankliche, reflektierende Musik. Wenn Melodie "strömende Kraft" ist, so ist legato ihr vollkommenster Ausdruck. Im staccato wird dieser Fluss unterbrochen: die Einzeltöne stellen sich gegen ihn, statt einer durchgezogenen Linie entsteht eine "punktierte", und der Ausdruck des staccatos ist daher "Ungebundenheit" in jedem Sinne. Da sich dem einen Begriff der Gebundenheit viele Arten der Ungebundenheit entgegenstellen lassen, so ist der Ausdrucksbereich des staccatos ungleich größer als der des legatos: Kraftgefühl, Übermut (etwa in den Scherzi von Beethoven), Humor, Leichtigkeit, Grazie, aber auch Angst, Zittern, Beben und anderes mehr kann durch staccato ausgedrückt werden. Hierbei spielen die Intervallbeziehungen eine große Rolle. Für Tonleiterschritte ist das legato der natürliche Ausdruck, für große Intervalle, die nur durch einen "Sprung", wie wir anschaulich sagen, überbrückt werden können, ist das staccato die gegebene Artikulation, für mittlere Intervalle … ist es das betonte, geringe Absetzen im Portato. Hermann Keller, Von der musikalischen Artikulation, Zeitschrift für Hausmusik 1952 Sprecher 1: Wie eng bindet sich eine Artikulation an bestimmte Ausdruckscharaktere? Gibt es nahe liegende, möglicherweise sogar natürliche Zusammenhänge? Zunächst versteht man unter Artikulation in der Musik ja nur die Art und Weise, wie Töne miteinander verbunden sind, manchmal auch noch die Art der Tonbildung. Hermann Kellers Ausführungen bringen durch den unmittelbaren Bezug auf ein musikalisches Weltbild natürlich - anders als eine trockene Definition - Anschaulichkeit und Plastizität mit sich als, führen aber gerade dadurch auch zu erheblichen Verkürzungen. Schon sein Verweis auf die Religion ist symptomatisch: Er bleibt nicht bei der Übersetzung – nämlich Rückbindung; er spricht vom göttlichen Gesetz, eine Assoziation, die eine ganz erhebliche kulturelle Prägung besitzt - für einen Alttestamentariker wohl nachvollziehbar, für einen Buddhisten aber wenig verständlich. ‚Melodie‟ als strömende Kraft; ‚Legato‟ für 2 kultische, reflektierende Kontexte; eine Art natürlicher Verwandtschaft gewisser Intervallfolgen mit bestimmten Artikulationen – all das mag es geben. Es bleibt aber trotzdem immer ein ungutes Gefühl zurück, der Impuls, Einspruch zu erheben: Binden sich artikulatorische Details zwangsläufig und so direkt an so klar umrissene assoziative Kontexte? Musikbsp. 1: Claudio Monteverdi: Madrigal “Hor che'l ciel e la terra” (Anfang) La Venexiana Glossa Music GCD 920928 1‟30“ Sprecher 2: Der ordnende Geist setzt also beim einzelnen Ton an, das heißt, er ordnet Töne einer einheitlichen Gesamtvorstellung unter, indem er Töne aus der Idee hervorgehen läßt. Töne existieren demnach in einer ‚totalen‟ Musik als notwendige Folge des immanenten Ordnungsprinzips, das aus der Idee abgeleitet ist. Ordnungsprinzipien traditionellen Handwerks sind daraufhin zu prüfen, inwieweit sie heute noch brauchbar sind. … Es lässt sich weitgehend denken, dass die vollkommene Vorstellung einer Tonordnung in der Idee für ein Werk eine ihr allein zugeordnete Organisation der Töne (als einzelne, und untereinander) hervorruft, die nur hier und nirgendwo anders ihren Sinn erfüllt. Karlheinz Stockhausen, Situation des Handwerks, Paris 1952 Sprecher 1: Wo bleiben hier Kult, Grazie und Übermut? Im gleichen Jahr wie Hermann Keller schreibt Karlheinz Stockhausen seinen Aufsatz, der den Untertitel ‚Kriterien der punktuellen Musik‟ trägt. Hier lebt der Ton nicht mehr in und durch die Beziehung zu seinen direkten Nachbarn, sondern kraft des übergeordneten Ordnungsprinzips. Die Berührung der Töne untereinander entzieht sich völlig dem Fokus des Komponisten, dessen Aufmerksamkeit der Integration in die Struktur gilt. Rhythmus und Artikulation verkommen zum keimfreien, quasi ansteckungslosen Nebeneinander der Töne, Widerspruchsfreiheit ersetzt die Empfindung von Nähe und Distanz. Für einen integralen kompositorischen Ansatz wie den des frühen Stockhausen macht eine Eigendynamik musikalischer Parameter wenig Sinn. Der Weg zur vollkommenen Organisation verbietet nicht nur solche Fremdkörper, sondern auch und allemal jegliche assoziativen Kontexte wie die, von denen Hermann Keller spricht. 3 Sprecher 2: So dass man beim Anhören als Sprungbrett den ersten Klang nimmt, der vorkommt; das erste Etwas schnellt uns ins Nichts und aus diesem Nichts steigt das nächste Etwas; usw. wie ein Wechselstrom. Kein einziger Klang fürchtet die Stille, die ihn auslöscht. Aber wenn Sie ihn vermeiden, ist das schade, denn er ist dem Leben sehr ähnlich & wie das Leben ist er im wesentlichen ein Grund sich zu freuen. Sagen die Leute, manchmal, ängstlich. John Cage, 45’ für einen Sprecher. Oktober 1954 Sprecher 1: Wieder Anfang der 50er Jahre. Worauf genau bezieht Cage das Bild des Wechselstroms für die Verbindung von Klang und Stille, von Etwas und Nichts? Hat das mit Artikulation zu tun? Positivistisch gesehen – und sozusagen unter einem enormen Vergrößerungsglas - ist es das gleiche Phänomen: Die Verbindung der Töne oder Klänge, ihre mögliche Trennung durch Pausen oder Stille. Aber auch dieses Verständnis lebt vom Bezug auf ein Weltbild: Cage bricht komplett mit abendländischen Vorstellungen, sein Verständnis von Musik - und damit auch von musikalischen Details wie Artikulation – ist untrennbar verbunden mit seinen philosophischen Vorstellungen, die ihre Wurzeln in der ostasiatischen Philosophie haben. Zwei Dinge sind bemerkenswert an diesen drei Texten, die fast zur gleichen Zeit verfasst wurden, aber inhaltlich einander so fern sind: Erstens, dass das Verständnis für dieses Detail – die Verbindung der Töne - bei allen nur über das Verständnis der ästhetischen, quasi ideologischen Grundorientierung funktioniert. Es stellt sich die Frage, wie weit diese Abhängigkeit notwendig ist, ob es nicht möglich ist, dem Phänomen musikimmanenter auf die Spur zu kommen. Und der zweite Punkt ist: Das Verständnis von Artikulation, ihrer musikalischen Bedeutung als klingendes, aber auch als textliches Phänomen, hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder stark gewandelt. Vor allem in den letzten Jahrzehnten hat sich ein klares Bewusstsein für die historische Dimension des Notentextes gebildet, Staccato-Punkte und Legato-Bögen in der Partitur eines Barockkomponisten interpretiert man heute völlig selbstverständlich anders als in einer romantischen Komposition. Sinnvolle Artikulation setzt immer auch eine gewisse Kenntnis der Konventionen und Eigentümlichkeit der Schreibweisen voraus, sowohl was den einzelnen Komponisten als auch, was den historischen Kontext angeht. In diesen drei Texten kommen nun aber praktisch zeitgleich völlig unterschiedliche Auffassungen zum Tragen. Das zeigt, wie schillernd das Phänomen vor dem Hintergrund unterschiedlicher Musik und 4 Musikauffassungen wird; und es zeigt natürlich auch, wie wenig die Dinge sich musikhistorisch manchmal im geordneten Nacheinander entwickeln. Musikbsp. 2: Marin Marais: Fantaisie aus der Suite a-moll für Gambe und Cembalo Jay Bernfeld, viola da gamba. Accord 206082 42” Sprecher 3: Unter Artikulation in der Musik ist erstens die Art und Weise zu verstehen, wie der einzelne Ton stimmlich oder instrumental erzeugt und gebildet wird; zweitens, wie aufeinander folgende Töne ‚gelenkig‟ miteinander verbunden werden (lat. articulus, das Gelenk). Diese Verbindung kann eng oder locker, der Zeitraum zwischen den Tönen also klangerfüllt oder durch sogenanntes Absetzen stumm sein. Wikipedia, Eintrag ‚Artikulation’. Sprecher 1: ‚Klangerfüllt, oder durch sogenanntes Absetzen stumm‟ - um im Bild zu bleiben könnte man sagen: Wenig gelenkig, eher etwas zu geschraubt für eine Beschreibung des Artikulationsvorganges. Mit der Ungeschicklichkeit dieser Formulierung wird hier aber wohl eher versehentlich - eine wichtige Frage aufgeworfen: Wenn ein Ton abgesetzt wird, heißt das dann automatisch, dass der Zeitraum danach stumm, im Sinne von leer, ist? Oder können Töne, die de facto nicht verbunden sind, genauso ungebrochene Linien in der Vorstellung des Hörers entstehen lassen wie tatsächlich sich berührende Töne? Wenn man Fußspuren im Schnee betrachtet, verbindet man sie auch in Gedanken, man würde wohl kaum auf die Idee kommen, dass sie nicht zusammen gehören und nicht Resultat und Abdruck der Bewegung eines einzelnen Menschen sein könnten. Wann, und warum erlebt man eine akustisch tatsächlich hörbare Trennung von Tönen wirklich auch als solche, und wann hört man quasi darüber hinweg, denkt sich die Töne dennoch verbunden zu einer Kette zusammenhängender Klänge? Hängt das von der Distanz ab, die man zu der jeweiligen Stelle einnimmt? Von der mentalen Einstellung? Gibt es da Spielräume, die ganz unterschiedliche Sichtweisen zulassen? Sprecher 3: Ich sah das Gedicht verschoben aus dem Sagen in das Stimmliche. Ich sah das Stimmliche anders da sein als das Sprachliche. Ich sah die Stimme etwas nicht sprechen können. Ich sah die Stimme in das Flüssige gebracht sein. Ich sah die Stimme in das Grün des Flüssigen 5 gebracht sein. Ich sah die Stimme ins Unfasslichste gebracht sein. Ich sah die Stimme als liquid, geschmolzen, durchsichtig. Ich sah das Gedicht die Stimmen ins Bild des Wassers übersetzen. Ich sah die Stimmen in ihrem Ausdruck die Ufer, die Grenzen, die Definitionen, die Namen, die Sprache in Unfasslichkeit verwandeln. Ich sah die Stimmen das andere Bild zur Erscheinung bringen. Peter Waterhouse, Sprache Tod Nacht Aussen Sprecher 1: Aneinander gereihte Hauptsätze, parataktische Konstruktionen, aber auch kein ‚und‟, kein ‚oder‟: Peter Waterhouse spricht hier über Paul Celans Gedicht ‚Stimmen‟, dem ersten des Bandes Sprachgitter. Die lineare Verknüpfung der einzelnen Sätze wird immer über die Stille gestiftet, so gut wie nie über Konjunktionen; gleichzeitig entsteht hier durch die große Ähnlichkeit der Sätze eine Berührungswirkung, der unablässig nahe gelegte Vergleich provoziert so etwas wie eine fortwährende Resonanz, ein immer wieder neu stattfindendes Anschlagen eines Tones. Die Themen in diesem Buch wechseln - Bäume, Regen, der Himmel, Zeitungslektüre, der Tod des Großvaters - die Beobachtung profaner Alltäglichkeiten steht neben tiefsinnigen poetologischen Reflexionen. Der serielle Duktus dagegen bleibt bis auf wenige heraus stechende Ausnahmen erhalten. Für das Leseerlebnis entsteht eine seltsame Mischung aus konstruktiv-rationalem Kalkül und meditativ-surrealer Ekstase, damit aber auch eine große Nähe zur Musik. Das Innehalten, die Zäsur wird zum integralen Bestandteil der Vergegenwärtigung der Welt. In einem durchaus musikalischen Sinn erfasst deshalb der Gehörssinn das Verhältnis der Dinge zueinander. Die starke Betonung des Satzes – musikalisch würde man sagen: der Phrase – mutet einerseits äußerst streng und konzeptuell an, andererseits hat sie aber einen sehr sinnlichen Aspekt, wie ein Lauschen auf den Atem, der der Erkenntnis innewohnt. Fast scheint es so, als setze Waterhouse dem Erleben der Welt, ihren vielschichtigen, rätselhaften Erscheinungen, die Monotonie der gereihten Hauptsätze entgegen. Angesichts so subtiler Rhythmen, wie sie die Lyrik Celans mitbringt, erscheint diese konzeptuell bedingte Setzung gleichzeitig wie ein Sicherheitsnetz und wie ein Katalysator, ein ‚gerade noch Mögliches‟ als produktive Reaktion auf den Reichtum des Hochdifferenzierten. Auch dieser sehr persönliche, sehr ehrliche Reflex auf Celans Gedicht nimmt eine seltsame Zwischenstellung ein, zwischen größter Nähe und extremem Kontrapunkt. 6 Sprecher 3: Stimmen, ins Grün der Wasserfläche geritzt. Wenn der Eisvogel taucht, sirrt die Sekunde: Was zu dir stand an jedem der Ufer, es tritt gemäht in ein anderes Bild. * Stimmen vom Nesselweg her: Komm auf den Händen zu uns. Wer mit der Lampe allein ist, hat nur die Hand, draus zu lesen. * Stimmen, nachtdurchwachsen, Stränge, an die du die Glocke hängst. Wölbe dich, Welt: Wenn die Totenmuschel heranschwimmt, will es hier läuten. * Stimmen, kehlig, im Grus, darin auch Unendliches schaufelt, (herz-) schleimiges Rinnsal. Setz hier die Boote aus, Kind, die ich bemannte: 7 Wenn mittschiffs die Bö sich ins Recht setzt, treten die Klammern zusammen. * Jakobsstimme: Die Tränen. Die Tränen im Bruderaug. Eine blieb hängen, wuchs. Wir wohnen darin. Atme, daß sie sich löse. * Stimmen im Innern der Arche: Es sind nur die Münder geborgen. Ihr Sinkenden, hört auch uns. * Keine Stimme - ein Spätgeräusch, stundenfremd, deinen Gedanken geschenkt, hier, endlich herbeigewacht: ein Fruchtblatt, augengroß, tief geritzt; es harzt, will nicht vernarben. Paul Celan, Stimmen 8 Sprecher 1: Das Gedicht – dasjenige, auf das sich Peter Waterhouse in seinem Roman bezieht – entfaltet sein Profil auch über parallele Formulierungen und Konstruktionen: Sieben Mal hebt es an mit dem Wort ‚Stimmen‟, beim achten Mal mit ‚Keine Stimme‟; die Abschnitte des Gedichtes sind meist zweigeteilt, in eine Art initiales Bild und einen Kommentar, der darauf Bezug nimmt; viele syntaktische Konstruktionen weisen Parallelismen auf. Zwischen den beiden Texten, die sich in einem weiteren Sinn der Entwicklung eines ‚Ich‟ und den Bedingungen des Sprechens für dieses ‚Ich‟ widmen, gibt es auch inhaltliche Berührungspunkte. Ganz erhebliche Unterschiede zeigt aber die Binnenstruktur: Celans Gedicht artikuliert sich völlig anders, Vers, Atem, Satz und Gedanke gehen ein ganz anderes Verhältnis zueinander ein, das rhythmische Schwingen der Sprache und Sprachklänge entsteht quasi aus sich selbst heraus, nicht aus einer Setzung von außen. In dieser Differenz der Binnenstruktur manifestiert sich ein fundamentaler Unterschied in der ästhetischen Grundorientierung: Peter Waterhouse ist der Spaziergänger – eine Assoziation, die sich durch sein ganzes Oeuvre zieht. Er erwandert sich die Welt, in ihrem ganzen Reichtum, wobei er sich mit Vorliebe den kleinen, unscheinbaren Dingen widmet und diesen – vor allem im Umgang mit Texten - umso mehr Sorgfalt angedeihen lässt. Sein Roman entfaltet sich nach und nach, Schritt für Schritt, über die klar erkennbare und benennbare Grundeinheit der einfachen Phrase. Celan dagegen geht es immer um das ‚Du‟, den Gesprächspartner. In seinem Gedicht sind solche Setzungen nicht auszumachen, der Reichtum des Bildes und die Vielschichtigkeit des Beziehungsgeflechtes kann auf keiner erkennbaren Ebene ohne Weiteres auf so etwas wie einen Hauptnenner gebracht werden. Bei aller Rätselhaftigkeit und Vieldeutigkeit des Textes bleibt dem Leser damit auch immer eine große Freiheit: Es ist sein Ohr, das bestimmt, auf welcher Ebene, auf welcher Dimension er sich angesprochen fühlt und mit welcher Faser seines sprachlichen und emotionalen Erlebens er auf die höchst subtil sich artikulierende Stimme Celans reagiert. Musikbsp. 3: Johann Sebastian Bach: Menuett aus der Partita D-Dur für Klavier, (einblenden) ca. 45“ Glenn Gould Sony Music Entertainment, 88691961142-08. CD 8, MS 6498 In der Musik ist der große Gegenbegriff zur Artikulation, der oftmals im gleichen Atemzug genannt wird, der der Phrasierung. Bei beiden geht es um Verbindung und Trennung von 9 Klängen. Meist wird dabei dem Begriff der Phrasierung der der sinnvollen Gliederung zugeordnet, Artikulation wird dagegen eher mit dem Bereich des Bildhaften, weniger Fassbaren assoziiert. Sprecher 2: Es gibt also (wenige Grenzfälle ausgenommen) fast stets nur eine richtige und eine oder mehrere falsche Phrasierungen, richtig im Sinne von verstandesmäßig beweisbar, also in verbindlicherem Sinn, als man, bei älterer Musik, von richtigem Tempo, richtiger Dynamik sprechen kann. Und damit habe ich nun vielleicht den Gegensatz von Phrasierung und Artikulation klar hingestellt: Artikulation ist, wo sie nicht vorgezeichnet ist, stets Auffassungssache, ist fast nie verstandesmäßig beweisbar. Phrasierung versteht sich für einen begabten Musiker von selbst, um Artikulation kann man sich leidenschaftlich streiten, und wenn einer den andern fragt: „wie phrasieren Sie dieses Thema?" so meint er immer: „wie artikulieren Sie es?“ Hermann Keller, Artikulation und Phrasierung, Deutsche Tonkünstlerzeitung 1929 Sprecher 1: Theoretisch scheint diese Unterscheidung zunächst verständlich. Sowohl für die Analyse als auch für die Darstellung der Musik ist es von erheblicher Bedeutung, ob es um die Frage der gedanklichen Logik geht oder um den Charakter und die Transparenz des Bildes. Für beide Bereiche ist der Aspekt von Bindung und Trennung fundamental, der musikalischsemantische Wert, der einer gliedernden Trennung zukommt, ist aber ein ganz anderer als der der Artikulation, die eher der Intensität des Striches in einer Zeichnung vergleichbar wäre. In der Praxis lassen sich diese beiden Aspekte allerdings oftmals nicht scharf gegeneinander absetzen, und der von Hermann Keller formulierten Frage „wie artikulieren Sie dieses Thema?“ gehen in Wirklichkeit die eigentlichen Fragen voraus: Welches sind die Teile des Themas, wie verhalten sie sich zueinander, welche Verbindungen sollen fundamentalen, gliedernden Charakter haben, und welche bleiben diesen quasi nachgeordnet, betreffen die Kohäsion der Linien und Klänge und den daraus möglicherweise resultierenden Charakter des Bildes. Sowohl für den Spieler als auch für den Hörer können dabei Pausen zwischen Tönen ambivalenten Charakter behalten, teils gliedernd, und teils artikulatorisch. Für die Harmonik der abendländischen Musik ist ihre Vieldeutigkeit eine unabdingbare Voraussetzung, für die Wertigkeit von Pausen gilt – wenn auch in einem etwas anderen Sinn – Ähnliches. Oftmals ist es gerade die große Kunst einer Interpretation, dass der innere Gehalt der Pausen in der Schwebe bleibt und sich nicht zum Sklaven akademischer Begrifflichkeiten macht. Hinzu 10 kommt, dass Phrasierung und Artikulation sich auf vielschichtige Weise mit anderen Parametern verflechten - sowohl solchen der Komposition als auch solchen der darstellenden Gestaltung; ihre Sinnhaftigkeit entscheidet sich erst im Zusammenspiel vielfältiger Aspekte und kann in den seltensten Fällen ausschließlich aus sich heraus begründet werden. Auch hier gründet sich Hermann Kellers Darstellung wieder auf stillschweigende Voraussetzungen: Selbst wenn man seine Unterscheidung von ihrer theoretischen Systematik her akzeptiert, so macht sie doch in erster Linie Sinn für Musik, die einen deutlichen Hang zur Sprache hat. Für die Wiener Klassik, das romantische Lied, mag diese Sichtweise eine gewisse Stringenz besitzen, trotz ihres wenig praxisnahen Ansatzes. Für sehr viele Musik Chopin, Debussy, Skrjabin, zeitgenössische oder gar außereuropäische Musik - hat sie wenig Erkenntnischarakter. In dem Moment, in dem Aspekte der Bewegung, des Raumes und des Bildes wichtiger werden als das Formulieren von Themen und musikalischen Gedanken, greift Kellers Unterscheidung nicht mehr wirklich, obwohl auch hier Artikulation und Phrasierung eine genauso wichtige Rolle spielen. Ebenso wie Dichtung weist aber auch jede Musik, die man intuitiv als ‚sprachnah‟ bezeichnen würde, über ihre sprachliche Struktur hinaus. Die Imagination musikalischer Charaktere lässt sich nicht auf ihre strukturellen Aspekte reduzieren - sei es im Fall der kompositorischen Formulierung des Textes, sei es im Fall der Darstellung durch den Interpreten. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Grammatik, die allgemein formuliert, und Handwerk, das sich in der Ausarbeitung des Details, angesichts eines vorliegenden Materials entfaltet. Musikbeispiel 4: Franz Schubert: Winterreise Nr. 16, Letzte Hoffnung Christoph Prégardien, Tenor Andreas Staier, Klavier Teldec 0630-18824-2 2‟17“ Sprecher 2: Das Gedicht handelt vom Stehenbleiben in Gedanken, das „oftmals“ stattfindet, immer dann, wenn der Blick des Wanderers auf Bäume fällt, an denen noch einzelne Blätter hängen. Es entsteht die Vorstellung einer Bewegung, die immer wieder durch meditative Momente gebremst oder unterbrochen wird. … Dass das Schicksal der Hoffnung dem Zufall des vielleicht fallenden Blattes überlassen wird, ist der Verzicht, aus der Unsicherheit, in der das Leben suspendiert ist, aus eigener Kraft herauszukommen. Daher auch der unentschiedene Wechsel von Gehen und Stehen. Die 11 Gedanken des Nachdenkenden sind nicht klärend und erschließen kein Ziel, auf das hin er sich bewegen möchte. Vorwärtsgehen und Stillestehen verschwimmen beinahe ineinander. Hans-Jost Frey, Vier Veränderungen über Rhythmus Sprecher 1: Wenn die Musik so dezidiert wie hier das Verbleiben in der Schwebe ausdrückt– wie weit machen kategorische Unterscheidungen dann Sinn? Vor allem im Klavierpart schreibt Schubert alle Artikulationen peinlich genau und hoch differenziert auf, die Notation lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Aber nur Hand in Hand mit dieser Vielschichtigkeit kann es gelingen, das Unentschiedene, das abwartende Zögern und eher nachdenkliche, ziellose Vorwärtsgehen angemessen darzustellen. Gerade erst der Reichtum der Artikulation ermöglicht den Schwebezustand, der die Frage nach dem Unterschied von Artikulation und Phrasierung ins allzu Didaktische verweist: Der Sinn geht mit allen Aspekten der Darstellung vollständig im Bild auf. Sprecher 3: Cinoc, der damals etwa fünfzig Jahre alt war, übte einen merkwürdigen Beruf aus. Er war, wie er selber sagte, „Wörtertöter“; er half mit, das Wörterbuch Larousse auf den neuesten Stand zu bringen. Doch während andere Redakteure auf der Suche nach neuen Wörtern und neuen Bedeutungen waren, musste er, um ihnen Platz zu schaffen, alle Wörter und alle Bedeutungen eliminieren, die veraltet waren. Als er neunzehnhundertfünfundsechzig nach dreiundfünfzig Jahren gewissenhaften Dienstes in Pension ging, hatte er Hunderte und Tausende von Werkzeugen, Techniken, Sitten und Gebräuchen, Überzeugungen, sprichwörtlichen Redensarten, Gerichte, Spiele, Spitznamen, Gewichte und Maße verschwinden lassen; er hatte Dutzende von Inseln, Hunderte von Städten und Flüssen, Tausende von Bezirkshauptorten von der Karte ausradiert; er hatte Hunderte von Kuhrassen, von Vogel-, Insekten- und Schlangenarten, etwas spezielle Fische, Spielarten von Muscheln, Pflanzen, die nicht ganz gleichwertig bzw. ähnlich waren, besondere Arten von Gemüsen und Früchten in ihre taxonomische Anonymität zurückgeschickt; er hatte ganze Scharen von Geographen, Missionaren, Entomologen, Kirchenvätern, Schriftstellern, Generälen, Göttern und Dämonen in der Versenkung verschwinden lassen. Georges Perec, Das Leben - Gebrauchsanweisung 12 Sprecher 1: Lässt sich die Wirklichkeit als Text abbilden, oder wenigstens in Teilen als Text erfassen? Seit es die Schrift gibt, ist dies ein alter Traum der Menschheit, und die Entstehung der großen Enzyklopädien ist ein Versuch der möglichen Antworten auf diese Frage. Symbolhaft präsentiert die ‚Editions Larousse‟ eine Frau, die die Samen einer Pusteblume wegbläst, versehen mit dem Motto „Je sème à tout vent“ – ich säe aus in alle Winde: Das Erfassen der Welt wird weniger als katalogisierender Vorgang denn als schöpferischer gesehen. Perec konfrontiert diese gigantische geistige Unternehmung mit der seltsamen Figur des Cinoc: Seine Aufgabe ist Symbol dafür, dass auch die umfang- und detailreichste, die sorgfältigste und liebevollste Herangehensweise niemals auf die Erkenntnis wird verzichten können, dass die Leerstelle unabdingbar ist. Wichtiges wird von Unwichtigem getrennt, Veraltetes oder Unrichtiges aussortiert. Aber Cinoc begehrt auf gegen die Stigmatisierung des vermeintlich Überflüssigen, entwirft seine eigene Welt des angeblich Bedeutungslosen, das dem Verstummen überantwortet werden sollte. Sprecher 3: Cinoc las langsam, notierte sich seltene Wörter und allmählich nahm sein Plan Gestalt an und er beschloss, ein großes Wörterbuch der vergessenen Wörter zusammenzustellen, nicht um das Andenken an die Akkas, ein Zwergnegervolk in Zentralafrika, oder an Jean Gigoux, einen Historienmaler oder an Henri Romagnesi, einen Komponisten von Romanzen, 1781-1851, fortbestehen zu lassen, auch nicht um den Skolekobrotus, einen Tetramera- oder Vierzeherkäfer aus der Familie der Bockkäfer, eine Tribus der Cerambyni, zu verewigen, sondern um einfache Wörter zu retten, die ihm weiterhin noch etwas zu sagen hatten. Georges Perec, Das Leben - Gebrauchsanweisung Sprecher 1: Auf den großflächig exponierten Reichtum der Welt antwortet Cinoc mit dem Blick für Zwischenräume, für Nischen, in denen das angeblich Unbedeutende zu Hause ist. Er hält der schier unfassbaren Überfülle quasi ihr Negativ vor: Das Stumme beginnt zu sprechen, Verdunkeltes wird ausgeleuchtet, das Verblasste blüht auf in neuer Farbigkeit. Seine eigentliche Tätigkeit, das Eliminieren von Worten, das der ‚Unternehmung Larousse‟ Relief und Kontur verleihen soll, kehrt er um in ihr Gegenteil. Damit artikuliert er die sich vor ihm ausbreitende Wirklichkeit – die Fülle des Wissens - auf eine seltsam ähnliche Weise wie ein Zeichner. Mit der Linie hebt dieser ja auch das hervor, was eigentlich in einem dinghaften 13 Sinne nicht existent ist: Die Grenze zwischen den Dingen, an der sie einander berühren. Bis ins Unermessliche könnte die Enzyklopädie Wissen anhäufen; ohne das Gefühl für das, was trotzdem noch zu sagen bleibt, für das, was schon einmal war, aber inzwischen verschwunden ist, bliebe eine solche Unternehmung eher starr und ungelenk. Die Dinge, die sind, die man sieht und erlebt, leben von und mit dem Raum zwischen ihnen, ohne den ihnen ihre innere Verbindung fehlen würde. Das Geheimnis des guten Textes ist auch das Geheimnis dessen, was er – hörbar bis ins Detail- verschweigt. Sprecher 3: Ich bin der Welt abhanden gekommen, Mit der ich sonst viele Zeit verdorben; Sie hat so lange nichts von mir vernommen, Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben! Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, Ob sie mich für gestorben hält. Ich kann auch nichts sagen dagegen, Denn wirklich bin ich gestorben der Welt. Ich bin gestorben dem Weltgetümmel Und ruh in einem stillen Gebiet. Ich leb allein in meinem Himmel, In meinem Lieben, meinem Lied. Friedrich Rückert, Ich bin der Welt abhanden gekommen Musikbsp.5: Gustav Mahler: ‚Ich bin der Welt abhanden gekommen‟ (1. Strophe) Text: Friedrich Rückert Berliner Philharmoniker Leitung: Claudio Abbado Sony Classical SK 53360 2‟30“ Sprecher 2: Abhanden. Phraseologisch festgelegtes Adverb, seit dem 14. Jahrhundert. Nur noch in der Wendung abhanden kommen. Wie zuhanden, vorhanden Zusammenrückung von ab und dem 14 alten, umlautlosen Plural von Hand. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache Sprecher 1: Plural von Hand, also: Den Händen entgleiten, oder zwischen zwei Händen zerrinnen, nicht aber: sich dem Griff einer einzelnen Hand entziehen. Bei dem Ausdruck ‚Abhanden kommen‟ schwingt ein Entfernen – oder Sich-Entfernen - aus einem Dazwischen mit: Mit dem Plural vergegenwärtigt sich die Assoziation des Raumes zwischen zwei Händen. Wenn es dann nicht nur zwei, sondern viele Elemente sind, wird auch die räumliche Struktur komplexer, man braucht funktionierende Verknüpfungen, damit das System als Ganzes funktioniert: Artus, das Gelenk, Articulus, das kleine Gelenk. Artikulation bedeutet laut dem ‚Digitalen Wörterbuch der Deutschen Sprache‟: In der Musik „Abgrenzung der Töne gegeneinander‟, in der Zahnmedizin „Stellung der Zahnreihen zueinander‟. Möglicherweise ein unangenehmes Aufeinandertreffen. Kann man in der Musik, ähnlich wie in der Sprache, den Verbindungen die Härte nehmen, vielleicht wenn ein Pianist zwei Töne überlappen lässt, um eine sehr weiche, gesangliche Verbindung zu schaffen? Setzt eine gelingende Artikulation nicht ein Gefühl für Qualitäten voraus, jenseits von Abständen, Zahlen und Messbarkeit? Sprecher 2: "Das heißt Essenmarken und nicht Essensmarken", bellt der Unteroffizier den Rekruten an, "es heißt ja auch nicht Bratskartoffeln und Spiegelsei!" Diesen Spruch wiederholt er am Tag mindestens zwanzig Mal, und es bereitet ihm immer wieder Genuss, einem unbedarften Brenner eine laute Lektion in Sachen Amtsdeutsch erteilen zu können. Das gibt ihm ein Gefühl von Überlegenheit und Macht. Zum Glück kommen jedes Quartal neue Wehrpflichtige, die ihn garantiert fragen werden, ob sie bei ihm "Essensmarken" bekommen können. So wird der Unteroffizier noch viel zu bellen haben und sich immer wieder der Illusion von Überlegenheit und Macht hingeben können. Wenn ihm einer frech kommt, kann er sich auf die Dienstvorschriften berufen, denn da steht "Essenmarken". Und Vorschrift ist Vorschrift, wie jeder weiß, dagegen kann selbst ein Literaturnobelpreisträger nichts ausrichten. Außerhalb seiner Kaserne gilt diese Vorschrift allerdings nicht. Außerhalb seiner Kaserne sagen die meisten Menschen "Essensmarken", mit so genanntem Fugen-s, und das mit Fug und Recht. Dort herrscht Freiheit der Sprache, und Freiheit bedeutet Vielfalt und nicht selten Verunsicherung. Warum heißt es Mordsspaß, aber Mordopfer? Warum sagen wir Rindsleder, aber Rindfleisch? 15 Warum haben Schiffstaufe und Schiffsschraube ein Fugen-s, Schifffahrt und Schiffbruch aber nicht? Wer legt fest, ob und womit die Nahtstelle zwischen zwei zusammengeschweißten Wörtern verfugt wird? Die Antwort auf diese Fragen liegt irgendwo im Nebel der Sprachgeschichte. Spiegel-Online Kultur: Bratskartoffeln und Spiegelsei Sprecher 1: Bei allem akribischen Umgang mit musikalischen Texten und Partituren ist Artikulation immer ein sehr unmittelbarer, körperlicher Vorgang. Als solcher ist er letztlich eher die Domäne des Spielers als die des Komponisten. Die menschlichen Hände - 4 Finger, ein Daumen, 27 Knochen, 36 Gelenke, 39 Muskeln und über 17.000 Druckrezeptoren - die Hände sind es, die in der Musik sprechen, für die deutliche Aussprache sorgen, oder aber der Bogen der Streicher, Atem und Lippen der Bläser. Nicht zufällig gibt es in Gesangspartien viel weniger Artikulationsvorschriften als für Instrumente, hier ist die Sprache - und damit die Notwendigkeit klarer und verständlicher Aussprache - ohnehin gegenwärtig. Artikulation ist also zuallererst Handlungsanweisung für Instrumentalisten. Gleiche Zeichen bedeuten dabei oftmals nicht das Gleiche, und umgekehrt gilt genauso: Der Eindruck derselben Artikulation wird meist von verschiedenen Instrumenten ganz unterschiedlich herbeigeführt. Das Legato eines Streichers, der seinen Ton beliebig beleben und mit dessen Nachfolger verbinden kann, ist akustisch gesehen etwas völlig Anderes als dasjenige eines Pianisten, der immer mit dem Verklingen jeden Tones zu kämpfen hat. Betrachtet man die Artikulationsvorgänge verschiedener Instrumente quasi unter dem Vergrößerungsglas, so erkennt man schnell, dass der Text mit seinen Artikulationszeichen nur eine unvollkommene, dürre und kompromisshafte Projektion der klingenden Wirklichkeit ist. Nicht umsonst gilt die Bewunderung des Publikums dem Anschlag des Pianisten, der Leichtigkeit der Bogenführung der Streicher, der Präzision des Ansatzes und der Lebendigkeit des Atems der Bläser, nicht aber deren Staccato oder Legato. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Notentext letztlich immer den Zugriff eines Spielers braucht, der die Zeichen in lebendigen Klang zu übertragen versteht. Sprecher 3: Ohne zu wissen, was ich tun soll, fange ich an, die ersten Wörter irgendwie auszusprechen. Jedes Wort steht mir im Weg. Wenn es bloß kein Wort mehr im Text gäbe, denke ich mir, dann könnte ich fließend vorlesen. Die Mauer der Buchstaben hindert meine Sicht. Einige Sätze enden wie abgehackt, so dass ich fast ins Loch des Punktes stürze. Kaum ist diese 16 Gefahr vorbei, steht schon der nächste Satz vor meinen Augen, auch er hat keine Eingangstür. Wie soll ich mit dem Satz beginnen? Die Wörter werden immer eckiger und sperriger. Bald wachsen die einzelnen Buchstaben aus ihnen heraus. Wo beginnt ein Wort? Wo endet es? Mein Mut, der aus einer einzigen Zunge besteht, schrumpft, bis er kleiner wird als ein Komma. Mit winzigen Füßen muss ich jeden Buchstaben hochklettern, ohne sehen zu können, was hinter ihm steckt. Jeder Laut ein Sturz. Die Stimme wird immer leiser, während die Schriftzeichen immer lauter werden. Yoko Tawada, Zungentanz, in: Überseezungen Sprecher 1: Es ist durchaus möglich, die Frage der Artikulation in einem Stück von anderen Mitteln der Gestaltung unabhängig zu betrachten. Es gehört zur Professionalität des Handwerks eines Interpreten, dass er verschiedene Varianten bei ansonsten unverändertem Kontext ausprobiert, um sich dem stimmigsten Bild versuchsweise und Schritt für Schritt anzunähern. Letztlich entscheidet aber das Zusammenspiel aller Faktoren darüber, welche Wahl das intendierte Klangbild am sinnfälligsten herausarbeiten kann. Tempo, Rhythmus, Betonung, Lautstärke, Spielstil, Tongebung, bestimmte Eigenschaften des Instrumentes, die Größe und Beschaffenheit des Saales, selbst die Interaktion mit dem Publikum - es gibt kaum einen Aspekt, der in der Praxis auf der Bühne die Stimmigkeit der Artikulation nicht mit beeinflussen kann. Nicht umsonst haben große Virtuosen wie Vladimir Horowitz oftmals darauf hingewiesen, dass sie ein Stück nie zweimal genau gleich spielen, ein Phänomen, das die Artikulation nicht weniger betrifft als andere Aspekte der Gestaltung. Diese Unvorhersehbarkeit macht letztlich die Lebendigkeit des Spielens aus. Die spezifische Beziehung, die die Artikulation mit anderen Parametern eingeht, hängt vom einzelnen Stück und dem Spieler bzw. dessen Interpretation ab. Nichtsdestoweniger bilden die Instrumente aber auch von sich her schon eine eigene Idiomatik aus, die mit der Art ihrer Tonerzeugung zusammenhängt und jeweils ein eigenes Mischungsverhältnis der Parameter untereinander nahelegt. Beim Klavier besteht die unmittelbarste Bindung vielleicht an die Dynamik, die hier schon im Einzelton gegeben ist. Ein Pianist hat nur zwei Möglichkeiten diesen zu beeinflussen - und bei beiden hat er dafür nur Bruchteile von Sekunden: Am Beginn des Tones über die Dynamik und die Geschwindigkeit des Anschlages, an seinem Ende über das, was am Klavier die Artikulation ausmacht, nämlich Zeitpunkt und Art der Wegnahme des Tones. Während des Verklingens ist eine direkte Einflussnahme nicht mehr möglich, es sei denn durch Hinzu17 oder Wegtreten anderer akustischer Ereignisse. Artikulation als Verbindung der Töne untereinander ist am Klavier also quasi die andere Seite der Dynamik, mit der sie im permanenten Wechselspiel verbunden ist. Vielleicht ist es nicht nur der Erkenntnis geschuldet, dass Tasteninstrumente in der Barockmusik praktisch keine Möglichkeit der dynamischen Gestaltung hatten, wenn ein Pianist wie Glenn Gould die Lautstärke deutlich auf Mittelwerte beschränkt, wenn er Bach spielt: Erst die Reduktion der dynamischen Bandbreite bringt den Reichtum seiner Artikulation voll zur Entfaltung. Streichinstrumente und Bläser sind in der Gestaltung des Tones viel flexibler, da er durchgängig veränderbar ist. Dadurch entfällt hier die direkte Abhängigkeit der Artikulation von der Dynamik, die Tongebung als Ganze mit Klangfarbe und dynamischer Entwicklung geht das jeweils besondere Verhältnis zur Artikulation ein. Diese Bindung integriert die Artikulation hier in einen viel vielschichtigeren Vorgang, der dem Malen ähnlich ist, beim Klavier dominiert dagegen die Kontur und damit eher die Nähe zur Zeichnung. Musikbsp.6: Edgar Varèse: Octandre Ensemble InterContemporain Leitung: Pierre Boulez Sony Classical SMK 45844 Beginn Blende (evtl. kürzer), ca. 1‟10” Sprecher 1: Die historische Entwicklung der abendländischen Musik hat nicht nur die Auflösung der Tonalität mit sich gebracht, die Balance zwischen den musikalischen Parametern hat auch ein anderes Gesicht angenommen: Hierarchien haben sich aufgelöst, prinzipiell setzt jedes Stück seine Gewichte individuell, je nach Bedarf und Vorliebe des Komponisten. Mit der Bedeutungsverschiebung im Verhältnis der Parameter zueinander hat sich die Idiomatik der Instrumente zwar nicht aufgelöst, aber erheblich erweitert. Neue Spieltechniken, veränderte und erweiterte Tonerzeugung, komplexere Rhythmik berühren sich mit der Artikulation in einem ganz anderen Sinn als in der klassischen Instrumentalbehandlung. Trotzdem beruht Instrumentalspiel aber wie eh und je auf instrumentalen Vorgaben, anders als die elektronische Musik, die mit jedem Stück quasi beim Nullpunkt beginnt, es sei denn, sie nutzt Aufnahmen oder schon vorher bestehendes Tonmaterial. Rhythmus, Farbe, Intensität, Artikulation – wenn es beliebt, untersteht jedes Klangereignis, jeder Nachhall, jede Raumcharakteristik bis in die mikroskopischsten Verästelungen dem Diktat der Hüllkurve. ADSR, Abkürzung für Attack, Decay, Sustain, Release - also Anstieg, Abfall, Halten, Freigeben - regelt und moduliert alles, was klingt, in jeder beliebigen Größenordnung und 18 Dimension der Musik. Mit der Digitalisierung löst Artikulation sich auf in binäre Codes, wie alle anderen traditionellen Parameter. Vor allem die Option, am instrumentalen Nullpunkt zu beginnen, macht den artifiziellen und fiktionalen Charakter der synthetischen elektronischen Musik aus. Es ist kaum vorstellbar, dass sich die Artikulation in all ihren Feinheiten so hätte entwickeln können, wenn nicht - sozusagen auf der anderen Seite der Kommunikation - das menschliche Ohr fähig wäre, diesen hoch differenzierten Vorgängen zu folgen und sie entsprechend zu interpretieren. Wir können minimale Verschiebungen im Hörpanorama wahrnehmen, in einer günstigen Lage über 300 verschiedene Stärkegrade eines Tones unterscheiden. Die Nähe eines Geräusches erkennen wir über den Anteil an tiefen Frequenzen, deshalb erscheint uns ein Flüstern im Film sehr nah, wenn diese verstärkt sind. Und wir können am Geräusch des Ausgießens von Kaffe unterscheiden, ob er heiß oder kalt ist. Was von der Natur wohl gedacht ist als Überlebensstrategie, ist in der Musik Voraussetzung für das Verstehen. Genauso wenig wie die Geräusche des Alltags werden die Feinheiten der Differenzierung eines guten Instrumentalisten wohl bewusst wahrgenommen; unbewusst werden sie aber als Ausdruckswerte erlebt und in emotionale Qualitäten übersetzt. Viel mehr als gemeinhin angenommen ist Artikulation also nicht nur eine Sache des Spielers, sondern auch eine des mit vollziehenden Hörers - wenn er sich denn in diesen musikalischen Mikrokosmos begeben will und die Bedingungen es ihm erlauben. Musikbsp. 7: Helmut Lachenmann: Zwei Gefühle Klangforum Wien Leitung: Hans Zender. Accord 204852 (Dauer nach Bedarf) ca. 1‟15“ 19