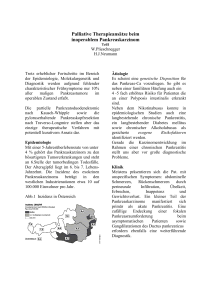Präkanzerosen im Gastrointestinaltrakt
Werbung

Abstracts Präkanzerosen im Gastrointestinaltrakt Kiel 5. Juli 2008 Gießen Samstag, 17. Mai 2008 9.00 – 16.00 Uhr Veranstaltungsort: Stadthallen Gießen Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. E. Roeb, Gießen Prof. Dr. T. Gress, Marburg Osnabrück 12. April 2008 Essen 1. März 2008 Berlin 28. Juni 2008 Jena Gießen 27. September 2008 17. Mai 2008 Bamberg 21. Juni 2008 Freiburg 11. Oktober 2008 Programm 9.00 Uhr Begrüßung Prof. Dr. E. Roeb, Gießen Pankreas und Alkohol Vorsitz: Prof. Dr. T. Grees, Marburg Prof. Dr. E. Roeb, Gießen 9.00 Uhr Risikofaktoren des Pankreaskarzinoms Prof. Dr. J. Mayerle, Greifswald 9.25 Uhr Familiäres Pankreaskarzinom: Ergebnisse aus nationalen und internationalen Screening-Programmen (ohne Abstract) Prof. Dr. D. Bartsch, Bielefeld 9.50 Uhr Alkoholinduzierte Schäden in der Leber Dr. S.V. Siegmund, Mannheim 10.15–10.45 Uhr Kaffeepause Gallenwege und Leber Vorsitz: Prof. Dr. E. Roeb, Gießen Prof. Dr. M.P. Manns, Hannover 10.45 Uhr Telomer Dysfunktion und DNA-Schädigung: Molekulare Ursachen von Stammzellenalterung und Karzinogenese (ohne Abstract) Prof. Dr. K.L. Rudolph, Ulm 11.10 Uhr Hepatitis B, HCC und Transplantation (ohne Abstract) Prof. Dr. M.P. Manns, Hannover 11.35 Uhr Hepatitis C heute und morgen Prof. Dr. S. Zeuzem, Frankfurt 12.00–13.00 Uhr Mittagspause mit Imbiss 1 Darm und Qualitätsmanagement Vorsitz: Prof. Dr. E. Roeb, Gießen Prof. Dr. A. Tannapfel, Bochum 13.00 Uhr Colitis ulcerosa PD Dr. M. Holtmann, Mainz 13.25 Uhr Darmzentren – aus Sicht der Pathologie Prof. Dr. A. Tannapfel, Bochum 13.50 Uhr Qualitätsmanagement bei gastrointestinalen Tumoren PD Dr. J. Graf, Marburg 14.15–14.45 Uhr Kaffeepause Magen und (Tumor)-Marker Vorsitz: Prof. Dr. T. Gress, Marburg Prof. Dr. C. Prinz, München 14.45 Uhr Karzinomentstehung durch die chronische Entzündung im Magen Prof. Dr. C. Prinz, München 15.10 Uhr Barrett-Ösophagus – Wie gefährlich ist er wirklich? Prof. Dr. G. Seitz, Bamberg 15.35 Uhr M2PK – ein neuer Tumormarker?! PD Dr. P.D. Hardt, Gießen 16.00 Uhr Schlusswort Prof. Dr. T. Gress, Marburg Anschriften der Referenten und Vorsitzenden siehe Seiten 35–36 2 Risikofaktoren des Pankreaskarzinoms J. Mayerle Klinik für Innere Medizin A, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Das Pankreaskarzinom ist die fünfthäufigste Krebstodesursache in westlichen Ländern, und die Inzidenz ist steigend. Die 5-Jahres-Überlebensrate nach Resektion beträgt 25%, das mediane Überleben aller Krankheitsfälle liegt bei 6 Monaten, die Resektionsrate bei 14–20%. Insgesamt entspricht die Inzidenz des Pankreaskarzinoms der Prävalenz. Die Risikofaktoren für ein Pankreaskarzinom sind vielfältig, und bereits 1913 bemerkte James B. Deaver, dass „sich ein Pankreaskarzinom aus einer chronischen Pankreatitis entwickeln kann“. Albert Lowenfels belegte 80 Jahre später diese Hypothese in einer historischen Kohortenstudie an 2015 Patienten mit chronischer Pankreatitis. Das Risiko von Patienten mit chronischer Pankreatitis, an einem Pankreaskarzinom zu erkranken, ist 16,5-fach erhöht im Vergleich zu einer Kontrollkohorte. Als zusätzlicher Risikofaktor wurde das Rauchen identifiziert. Raucher haben ein 25-fach höheres Risiko, an einem Pankreaskarzinom zu erkranken als Nichtraucher mit chronischer Pankreatitis. Obwohl der Alkoholmissbrauch ein Risikofaktor für die Entstehung einer chronischen Pankreatitis ist, konnte bisher keine direkte Assoziation mit einem erhöhten Pankreaskarzinomrisiko gezeigt werden. Fettreiche Ernährung, wie wir sie häufig in den Industrienationen finden, verdoppelt das Risiko, an einem Pankreaskarzinom zu erkranken. Gleiches gilt für den Diabetes mellitus Typ 2. In einigen Familien treten gehäuft Pankreaskarzinome auf, ohne dass Keimbahnmutationen oder familiäre Syndrome identifiziert werden können. Die Risikoabschätzung und mögliche Vorsorgeuntersuchungen sind dann im Beratungsgespräch mit den Betroffenen von wesentlicher Bedeutung. In einer prospektiven Kohortenstudie zur Bestimmung des Pankreaskarzinomrisikos bei familiärer Belastung wurde an einem Studienkollektiv mit 5179 Patienten aus 370 Familien mit familiärer Belastung und aus 468 Familien mit sporadischem Pankreaskarzinom über einem Beobachtungszeitraum von 10.538 Patientenjahren ein 9-fach erhöhtes Risiko bei Vorliegen einer familiären Belastung berechnet. Bei 3 erkrankten Familienmitgliedern 1. Grades muss von einem 32-fach erhöhten Risiko ausgegangen werden, bei 2 erkrankten Mitgliedern von einem 6,4-fach, erhöhten bei 1 Familienmitglied ist das Risiko 4,6-fach erhöht. 3 Die hereditäre chronische Pankreatitis gilt seit ihrer Erstbeschreibung 1952 durch Komfort und Steinberg als genetischer Risikofaktor für ein Pankreaskarzinom. Die hereditäre chronische Pankreatitis ist durch rezidivierende Pankreatitisschübe, die bereits in der frühen Kindheit beginnen können, durch eine positive Familienanamnese, sowie in der Regel auch durch das Fehlen anderer krankheitsassoziierter Risikofaktoren charakterisiert. 1996 gelang die Identifizierung des ersten mit der hereditären chronischen Pankreatitis assoziierten Gendefekts im kationischen Trypsinogen-Gen auf dem langen Arm des Chromosoms 7 (7q35). Die sogenannte R122H-Mutation (die häufigste von bisher 24 beschriebenen Mutationen im kationischen Trypsinogen) verursacht mit einer Penetranz von 80% in einem autosomal dominanten Erbgang die Entstehung einer chronischen Pankreatitis, deren klinische Symptome in 80% bis zum 18. Lebensjahr auftreten. Das Risiko für Patienten mit einer chronisch hereditären Pankreatitis, an einem Karzinom zu erkranken, wird mit einem kumulativen Lebenszeitrisiko von 40% bis zum 70. Lebensjahr angegeben. Ein zusätzlicher Nikotinabusus erhöht das bestehende Risiko signifikant. Nach der Identifizierung von Mutationen im Trypsinogen-Gen bei chronischer Pankreatitis, wurden Veränderungen in weiteren Genen insbesondere mit der klinisch idiopathischen Form in Verbindung gebracht. Jedoch konnte bisher für keinen dieser anderen Faktoren ein erhöhtes Risiko für ein Pankreaskarzinom gezeigt werden. Zu den vererbbaren Tumorsyndromen, die mit einem erhöhten Risiko für ein Pankreaskarzinom einhergehen, gehört das FAMMM-PC (Familial atypical multiple mole melanoma syndrome), das Peutz-Jeghers-Syndrom, das HNPCC (Lynch II), sowie das hereditäre Brust- und Ovarialkarzinom-Syndrom. 25% der Patienten mit einem FAMMM-PC erkranken an einem Pankreaskarzinom. Als zugrunde liegender Gendefekt wurden Mutationen im CDKN2A-Gen (Cyclin-abhängige Kinase 2a = p16ink) beschrieben. Die Vererbung dieser Erkrankung ist autosomal dominant, jedoch kann die Penetranz erheblich variieren. Carrier einer CDKN2A-Mutation haben ein 13- bis 22-fach erhöhtes Risiko für die Ausbildung eines Pankreaskarzinoms, das kumulative Risiko bis zum 75. Lebensjahr wird auf 17% geschätzt. Das Peutz-Jeghers-Syndrom wird ebenfalls autosomal dominant vererbt, und seine Inzidenz wird mit 1:25.000 angegeben. Charakterisiert ist das Syndrom durch multiple hamartöse Polypen sowie eine Haut- und Schleimhautpigmentierung. Als Gendefekt wurden Mutationen in der Serin/Threonin-Kinase 11 (STK11) identifiziert, die zur Genfamilie der DNA-Reparaturgene zählt. Patienten mit einem Peutz4 Jeghers-Syndrom haben ein 132-fach erhöhtes Risiko für ein Pankreaskarzinom, und das kumulative Lebenszeitrisiko beträgt 36% bis zum 75. Lebensjahr. Das hereditäre non-polypöse kolorektale Karzinomsyndrom (HNPCC) prädestiniert in seltenen Fällen für ein Pankreaskarzinom. 1% der Träger einer Mutation in den Mismatchrepair-Genen (MMR) hMLH1 oder hMSH2 entwickeln ein Pankreaskarzinom. Die genaue Inzidenz ist nicht bekannt. Das Risiko für ein Pankreaskarzinom bei Patienten mit einer BRCA1-Mutation wird nach einer Analyse an 11.847 Personen aus 699 Familien als um das 2,3-Fache erhöht angegeben. Allerdings haben 10% der Fälle mit sporadischem Pankreaskarzinom bei Ashkenazim eine 6174delTMutation im BRCA1-Gen. Die Inzidenz bei allen Ashkenazim-Juden ist 1%. Die Inzidenz für BRCA2-Mutationen bei amerikanischen Patienten mit einem duktalen Adenokarzinom liegt bei 17,2%. In Europa wird die Inzidenz mit 19% bei Patienten mit einem familiären Pankreaskarzinom angegeben. Damit ist die BRCA2-Mutation die häufigste bisher mit einem familiären Pankreaskarzinom assoziierte Mutation. Eine familiäre Belastung kann ein bis auf das 9-Fache erhöhte Pankreaskarzinomrisiko nach sich ziehen. Somatische Mutationen von Proteinen, die die Tumorprogression beeinflussen, sind mit dem Auftreten eines Pankreaskarzinoms assoziiert (p53, k-ras, p16ink, DPC-4). Die hereditäre Pankreatitis mit einem autosomal dominanten Erbgang ist mit einem kumulativen Pankreaskarzinomrisiko von 40% assoziiert. Familiäre Pankreaskarzinomsyndrome werden durch Keimbahnmutationen in genregulatorischen Proteinen verursacht und haben ein signifikant erhöhtes Risiko zur Entwicklung eines Pankreaskarzinoms. Weiterführende Literatur: 1. McFaul CD, Greenhalf W, Earl J, Howes N, Neoptolemos JP, Kress R, Sina-Frey M, Rieder H, Hahn S, Bartsch DK; European Registry of Hereditary Pancreatitis and Familial Pancreatic Cancer (EUROPAC); German National Case Collection for Familial Pancreatic Cancer (FaPaCa). Anticipation in familial pancreatic cancer. Gut. 2006; 55: 252–258. 2. Howes N, Lerch MM, Greenhalf W, Stocken DD, Ellis I, Simon P, Truninger K, Ammann R, Cavallini G, Charnley RM, Uomo G, Delhaye M, Spicak J, Drumm B, Jansen J, Mountford R, Whitcomb DC, Neoptolemos JP; European Registry of Hereditary Pancreatitis and Pancreatic Cancer (EUROPAC). Clinical and genetic characteristics of hereditary pancreatitis in Europe. Clin Gastroenterol Hepatol. 2004; 2: 252–261. 5 3. Lowenfels AB, Maisonneuve P, Whitcomb DC, Lerch MM, DiMagno EP. Cigarette smoking as a risk factor for pancreatic cancer in patients with hereditary pancreatitis. JAMA. 2001; 286: 169–170. 4. Whitcomb DC, Ulrich CD, Lerch MM, Durie P, Neoptolemos JP, Maisonneuve P, Lowenfels AB. Third International Symposium on Inherited Diseases of the Pancreas. Pancreatology. 2001; 1: 423–431. 5. Klein AP, Brune KA, Petersen GM, Goggins M, Tersmette AC, Offerhaus GJ, Griffin C, Cameron JL, Yeo CJ, Kern S, Hruban RH. Prospective risk of pancreatic cancer in familial pancreatic cancer kindreds. Cancer Res. 2004 1; 64: 2634–2638. 6. Lowenfels AB, Maisonneuve P, Cavallini G, Ammann RW, Lankisch PG, Andersen JR, Dimagno EP, Andrén-Sandberg A, Domellöf L. Pancreatitis and the risk of pancreatic cancer. International Pancreatitis Study Group. N Engl J Med. 1993; 328: 1433–1437. 7. Brand RE, Lerch MM, Rubinstein WS, Neoptolemos JP, Whitcomb DC, Hruban RH, Brentnall TA, Lynch HT, Canto MI; Participants of the Fourth International Symposium of Inherited Diseases of the Pancreas. Advances in counselling and surveillance of patients at risk for pancreatic cancer. Gut. 2007; 56: 1460–1469. Korrespondenzadresse: Prof. Dr. Julia Mayerle Klinik für Innere Medizin A Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Friedrich-Löffler-Str. 23a 17475 Greifswald E-Mail: [email protected] 6 Alkoholinduzierte Schäden in der Leber S.V. Siegmund II. Medizinische Klinik, Universitätsklinikum Mannheim Die wichtigste Ursache für die Entwicklung einer Leberzirrhose in den westlichen Industriestaaten ist eine anhaltende Leberschädigung durch chronischen Alkoholmissbrauch (Siegmund und Brenner, 2005). Heutzutage kann Alkoholabusus für mehr als 50% aller Leberzirrhosen verantwortlich gemacht werden. Die chronische alkoholische Schädigung der Leber kann über eine Leberverfettung und Steatohepatitis zur Leberfibrose führen (Abb. 1). Die Leberfibrose wird durch eine überschießende Akkumulation von extrazellulärer Matrix bedingt und führt mit einer einhergehenden Bildung von hepatozellulären Regeneratknoten zur Zerstörung der Leberarchitektur und letztlich zur Entstehung einer Zirrhose. Ein zirrhotischer Leberumbau führt zur hepatozellulären Dysfunktion sowie zum gesteigerten intrahepatischen Gefäßwiderstand, was eine Leberinsuffizienz mit portaler Hypertension zur Folge hat (Bataller und Brenner, 2005). Außerdem liegt in der Zirrhose eine gesteigerte hepatozelluläre Proliferation mit einem erhöhten Risiko für die Entstehung eines hepatozellulären Karzinoms (HCC) vor (Bataller und Brenner, 2005; Siegmund und Brenner, 2005). Das Risiko für die Entwicklung eines HCC bei männlichen Alkoholikern ist ca. 8-fach erhöht (Prior, 1988). Somit ist eine alkoholinduzierte Leberzirrhose als fakultative Präkanzerose anzusehen (Abb. 1). Normalerweise muss eine alkoholinduzierte Leberschädigung jahrelang bestehen, bevor es zu einer Vernarbung des Organs kommt. Vor der Manifestation einer alkoholischen Leberfibrose durchläuft die Leber verschiedene Stadien der alkoholischen Lebererkrankung, darunter Steatose und Steatohepatitis (Abb. 2). Anhaltende Entzündungsvorgänge in der Leber tragen maßgeblich zur Leberfibrosierung und auch zur Förderung einer hepatischen Karzinogenese bei. Das Frühstadium der Leberfibrose kann noch reversibel sein, wohingegen die Zirrhose, die letztendliche Folge der Fibrose, in der Regel irreversibel ist. Die Ursachen für die Entstehung eines HCC in der alkoholbedingten Leberzirrhose sind vielschichtig. Einerseits bewirkt chronischer Alkoholkonsum in Hepatozyten eine Induktion des mikrosomalen Ethanol-oxidierenden Systems (MEOS), welches mittels Cytochrom P450 2E1 (CYP2E1) einen erhöhten Umsatz von Karzinogenen, die 7 teilweise als Begleitstoffe in alkoholischen Getränken vorkommen, bewirkt. Ferner entsteht beim Ethanolmetabolismus der äußerst toxische Acetaldehyd, welcher an Proteine und DNA binden kann, was zu Metaplasien, Inhibition von DNAReparaturvorgängen, verstärktem Zelluntergang und vermehrter Hyperregeneration führen kann. Im Ethanolabbau kommt es außerdem zu einer gesteigerten Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS), welche zu einer Lipidperoxidation, DNASchädigung und somit zur Krebsentstehung beitragen können (Stickel et al., 2002). Zudem verursacht chronischer Alkoholkonsum eine verstärkte hepatische Expression des Protoonkogen-Proteins c-myc sowie eine DNA-Hypomethylierung (Tsukamoto und Lu, 2001). Die Hypomethylierung der DNA entsteht durch die alkoholbedingte Verringerung von hepatischem S-Adenosylmethionin (SAM), einem wichtigen Methylgruppendonator, sowie den Eingriff in den Folatstoffwechsel. Insbesondere wird eine Hypomethylierung des oben genannten Protoonkogens c-myc oder auch cN-ras mit deren Aktivierung und folglicher hepatozellulärer Dedifferenzierung und vermehrter Proliferation in Verbindung gebracht (Stickel et al., 2002). Gerade auch aufgrund des deutlich erhöhten Risikos für die Entwicklung eines HCC konzentrieren sich die Bemühungen in der Leberfibroseforschung in erster Linie auf therapeutische Mechanismen, welche das Fortschreiten der überschießenden Narbenbildung verhindern bzw. die Fibrosierung bis zu einem gewissen Grad sogar wieder rückgängig machen können. Ferner sollen das inflammatorische Milieu, der oxidative Stress und die gesteigerte hepatozelluläre Proliferation vermindert werden. Die wichtigste therapeutische Maßnahme beim Vorliegen von alkoholinduzierten Leberschäden ist die Einhaltung einer strikten Alkoholkarenz. 8 Abb. 1: Natürlicher Verlauf der alkoholischen Lebererkrankung (ALE). Bei chronischem gesundheitsschädlichem Alkoholkonsum (> 20–60 g Ethanol/Tag, i. d. R. über einen längeren Zeitraum > 5 Jahre) kommt es bei bis zu 8% der Patienten zu keiner Leberveränderung, bei der überwiegenden Mehrzahl jedoch mindestens zur Leberverfettung, welche sich über eine Steatohepatitis zur Leberfibrose und -zirrhose entwickeln kann. Ca. 1% der Patienten mit gesundheitsschädlichem Alkoholkonsum entwickelt ein hepatozelluläres Karzinom (HCC). 9 Abb. 2: Schematische Darstellung der Veränderungen in der Leber während der Ethanol-induzierten Leberschädigung. Chronische Alkoholschädigung der Leber bewirkt eine makrovesikuläre Akkumulation von Fett in Hepatozyten. Die zuvor ruhenden Vitamin-A-speichernden HSCs werden aktiviert, z. B. durch eine parakrine Stimulation von aktivierten Kupffer-Zellen/Makrophagen. Sie verwandeln sich in Myofibroblasten-artige Zellen, die exzessive Mengen an ECM, hauptsächlich fibrilläres Kollagen, im Dissé-Raum produzieren. Dies führt zu einer Defenestrierung des sinusoidalen Endothels und der Bildung von Basalmembranen. Außerdem trägt ROS-induzierter Zelltod von Hepatozyten zur HSC-Aktivierung bei. HSCs proliferieren und wandern hin zu den Orten der hepatozellulären Schädigung. Die letztendlich resultierende Ethanol-induzierte Leberzirrhose weist eine meist mikronodulärer Regeneration von Hepatozyten mit gesteigertem Risiko der hepatozellulären Entartung und Entstehung eines hepatozellulären ECM = extrazelluläre Matrix; HSCs = hepatische Sternzellen 10 Karzinoms. Literatur: Bataller R, Brenner DA. Liver fibrosis. J Clin Invest. 2005; 115: 209-218. Prior P. Long-term cancer risk in alcoholism. Alcohol Alcohol. 1988; 23: 163–171. Siegmund SV, Brenner DA. Molecular pathogenesis of alcohol-induced hepatic fibrosis. Alcohol Clin Exp Res. 2005; 29: 102S–109S. Stickel F, Schuppan D, Hahn EG, Seitz HG. Cocarcinogenic effects of alcohol in hepatocarcinogenesis. Gut. 2002; 51: 132–139. Tsukamoto H, Lu SC. Current concepts in the pathogenesis of alcoholic liver injury. FASEB J. 2001; 15: 1335–1349. Korrespondenzadresse: Dr. Sören V. Siegmund II. Medizinische Klinik (Gastroenterologie, Hepatologie & Infektionskrankheiten) Universitätsklinikum Mannheim Theodor-Kutzer-Ufer 1–3 68167 Mannheim E-Mail: [email protected] 11 Hepatitis C heute und morgen S. Zeuzem Medizinische Klinik I, Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt Als primäres Ziel einer antiviralen Therapie bei Patienten mit chronischer Hepatitis C gilt ein dauerhaftes virologisches Ansprechen, definiert als fehlender Nachweis Hepatitis-C-spezifischer RNA im Serum 6 Monate nach Therapieende (< 50 IU/ml). Wird dieses Ziel erreicht, kommt es im weiteren Verlauf nur sehr selten (1–2%) zu einem späten Rückfall mit erneutem Nachweis von HCV RNA im Serum. Zur Beurteilung eines fehlenden Therapieansprechens nach Beginn der Behandlung, sollte bei Patienten mit einer HCV-Genotyp-1-Infektion eine Bestimmung der HCV RNA im Blut zu Woche 12 und 24 herangezogen werden. Bei einem fehlenden Abfall der Viruslast um 2 log-Stufen im Vergleich zur Viruslast vor Therapiebeginn bzw. bei einer absoluten HCV-RNA-Konzentration über 30.000 IU/ml nach 12 Behandlungswochen sowie einem qualitativen HCV-Nachweis nach 24 Behandlungswochen (HCV RNA ≥ 10–50 IU/ml), wird ein Absetzen der Therapie empfohlen, da ein dauerhaftes virologisches Ansprechen mit max. 1–2% praktisch nicht mehr möglich ist (negativer prädiktiver Wert 98–100%). Zusätzlich kann unter besonderen Voraussetzungen anhand einer Bestimmung der HCV RNA zu Therapiewoche 4 eine Verkürzung der Therapiedauer vorgenommen werden (siehe unten). Therapie der chronischen Hepatitis C bei nicht vorbehandelten Patienten HCV-Genotyp 1 Die Standardtherapie der chronischen Hepatitis C erfolgt mit einem pegylierten Interferon (PEG-IFN) in Kombination mit Ribavirin. Patienten mit einer HCVGenotyp-1-Infektion sollten über 48 Wochen behandelt werden. PEG-IFN wird einmal wöchentlich subcutan injiziert. Die Gabe des Ribavirins erfolgt verteilt auf 2 Dosen pro Tag per os mit einer Tagesgesamtdosis je nach Körpergewicht zwischen 800 mg und 1400 mg. Die dauerhaften virologischen Ansprechraten für Genotyp-1-infizierte Patienten betragen dabei 42–51%. Patienten mit einer Kontraindikation für Ribavirin, bei der auch geringste Dosen an Ribavirin nicht vertragen werden, sollten eine Monotherapie mit PEG-IFN erhalten. Eine Therapieverkürzung auf 24 Wochen ist seit Kurzem für Patienten mit niedriger Ausgangsviruslast 12 (≤ 600.000 IU/ml) zugelassen, wenn zusätzlich unter der Kombinationstherapie mit PEG-IFN-α2b und Ribavirin bereits zu Woche 4 keine HCV RNA mehr im Serum nachweisbar ist (HCV RNA < 30 IU/ml). Neben der möglichen Therapieverkürzung wird in prospektiven Studien untersucht, ob insbesondere Patienten mit langsamem Abfall der HCV RNA von einer Verlängerung der Therapiedauer profitieren. Erste Ergebnisse zeigten, dass Patienten mit einem verzögerten virologischen Ansprechen (Abfall der HCV RNA zu Woche 12 um 2 log-Stufen, aber noch HCV-RNA-positiv und Negativierung der HCV RNA [< 50 IU/ml] im Verlauf zu Woche 24) nach einer 72-wöchigen Behandlung signifikant höhere dauerhafte Ansprechraten aufwiesen als nach einer 48-wöchigen Therapie. HCV-Genotyp 2, 3 Die virologischen Ansprechraten mit einer PEG-IFN/Ribavirin-Kombinationstherapie über 48 Wochen sind bei Patienten mit einer HCV-Genotyp-2- oder -3-Infektion annähernd doppelt so hoch wie bei HCV-Genotyp 1 (76–82% vs. 42–52%). Studien haben gezeigt, dass eine Verkürzung der Therapiedauer von 48 auf 24 Wochen für Patienten mit einer Genotyp-2- oder -3-Infektion ohne Beeinträchtigung der dauerhaften virologischen Ansprechraten möglich ist. Basierend auf diesen Ergebnissen wurde die 24-wöchige Therapie der Genotyp-2- und -3-Infektion als Standard etabliert. Ebenfalls konnten mit der Kombinationstherapie aus PEG-IFN-α mit einer fixen Ribavirin-Dosis von 800 mg/Tag ähnlich hohe dauerhafte Ansprechraten im Vergleich zu einer körpergewichtsadaptierten Dosierung nachgewiesen werden. Basierend auf Subanalysen wurden in einzelnen Studien unterschiedliche virologische Ansprechraten für Patienten mit Genotyp-2- und -3-Infektion nachgewiesen (93% vs. 79%). Insbesondere Patienten mit Genotyp-3-Infektion und hoher HCV-RNA-Konzentration vor Therapiebeginn (> 600.000 IU/ml) zeigen signifikant häufiger einen Rückfall nach Therapieende auf als Patienten mit Genotyp-2-Infektion oder Genotyp-3-Infektion mit niedriger Ausgangsviruslast. In ersten Studien wurde die Möglichkeit einer weiteren Reduktion der Therapiedauer von 24 auf 16, 14 bzw. 12 Wochen mit der Gabe von PEG-IFN-α2a bzw. -α2b und körpergewichtsadaptiertem Ribavirin untersucht. Patienten mit einem raschen initialen Abfall der HCV-Viruskonzentration (HCV RNA zu Woche 4 < 50–600 IU/ml) wiesen insgesamt hohe dauerhafte virologische Ansprechraten von 87–95% (Genotyp 2) und 75–89% (Genotyp 3) unter der verkürzten Therapiedauer auf, sodass bei diesen Patientengruppen eine Reduktion der Therapiedauer ohne 13 Verschlechterung der dauerhaften virologischen Ansprechenraten möglich scheint. Patienten mit noch nachweisbarer HCV RNA zu Woche 4 zeigten deutlich niedrigere dauerhafte virologische Ansprechraten auch unter der 24-wöchigen Therapie, sodass in dieser Subgruppe in zukünftigen Studien sogar eine Verlängerung der gegenwärtigen 24-wöchigen Standardtherapiedauer geprüft werden muss. Allerdings war in der größten bislang durchgeführten multizentrischen Studie (insgesamt 1463 Patienten) eine 24-wöchige Kombinationstherapie mit PEG-IFN-α2a und einer fixen Ribavirin-Dosis von 800 mg einer 16-wöchigen Therapie signifikant überlegen. In Subgruppen-Analysen galt dies sowohl für Patienten mit einer Genotyp-2- als auch -3-Infektion und unabhängig von einem frühen virologischen Ansprechen zu Woche 4 der Therapie (HCV RNA < 50 IU/ml). Korrespondenzadresse: Prof. Dr. med. Stefan Zeuzem Direktor der Medizinische Klinik I Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M. 14 Colitis ulcerosa M. Holtmann I. Medizinische Klinik und Poliklinik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz Die Colitis ulcerosa (CU) ist eine der Hauptmanifestationen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED). Die CU geht mit einem deutlich erhöhten Kolonkarzinomrisiko (KRK) einher. Dieses Risiko ist proportional zum Ausbreitungsgrad und zur Dauer der Erkrankung. Im Gegensatz zum sporadischen KRK folgt das KRK bei CU nicht der Adenom-Karzinom-Sequenz, sondern entsteht aus intraepithelialen Neoplasien (IEN), die sich in flachen Läsionen (DALMs) bilden. Aus diesen Merkmalen ergeben sich 2 wichtige Fragen: 1. Wie ist der Zusammenhang zwischen Entzündung und Karzinogenese? 2. Welche Vorsorgemaßnahmen gibt es? Die Abhängigkeit des KRK von Ausmaß und Dauer der chronischen Entzündung lässt es offensichtlich erscheinen, dass die chronische Entzündung ein prädisponierender Faktor oder sogar eine Präkanzerose darstellt. In den letzten Jahren wurden einige interessante Mausmodelle entwickelt, die zur Aufklärung dieser Zusammenhänge beitragen konnten. So konnte in der IL-10-Knock-out-Maus, die ein klassisches Modell der chronischen Kolitis darstellt, eine erhöhte Prävalenz von Kolonkarzinomen im Langzeitverlauf festgestellt werden. Interessanterweise kommt es bei der Chronifizierung der Entzündung in diesem Mausmodell zu einem Shift von einer Th1-Dominanz zu einer Th2-Dominanz, wie sie auch bei der CU gefunden wird. Ein sehr interessantes Kolitiskarzinom-Modell ist das DSS-AOM-Modell. Die zyklische Behandlung von Mäusen mit Dextransodiumsulfat führt zur Entstehung einer chronischen Kolitis. Wird initial gleichzeitig mit AOM behandelt, kommt es nach 20 Tagen zur Entstehung von aberranten Kryptenfoci, dann zu flachen Läsionen mit IEN und nach 40–60 Tagen zu flachen Karzinomen. Diese Entwicklung lässt sich in vivo endoskopisch verfolgen, nach Färbung mit Methylenblau stellen sich außerdem die typischen Veränderungen der Mukosaoberfläche nach der Pit-pattern- Klassifikation dar. Mithilfe von geeigneten transgenen Knock-out-Modellen konnte gezeigt werden, dass die Karzinogenese durch die Signaltransduktion des eher anti15 inflammatorisch wirkenden Zytokins TGF-β in T-Zellen aktiv supprimiert wird. Die sehr starke Karzinomentstehung in Mäusen, deren TGF-β-Signaltransduktion ausgeschaltet war, konnte durch die Blockade des proinflammatorischen Zytokins IL-6 mithilfe von Antikörpern gegen den IL-6-Rezeptor unterdrückt werden. Diese Untersuchungen belegen den direkten pathomechanistischen Zusammenhang zwischen Entzündung und Karzinogenese. Die klinische Relevanz dieser Ergebnisse liegt in den vielen Merkmalen begründet, die dieses Modell mit der CU und dem Kolitis-assoziierten Kolonkarzinom hat. Die bislang effektivste Methode der Karzinomprävention bei CU ist die jährliche Vorsorgekoloskopie. Sie wird bei linksseitiger Kolitis nach 15 Jahren, bei Pankolitis schon nach 8 Jahren empfohlen. Die derzeitigen Empfehlungen sehen vor, dass schon bei Nachweis einer einzigen hochgradigen IEN nach Bestätigung des Befunds durch einen Referenzpathologen eine Proktokolektomie erwogen werden sollte. Die dadurch erforderliche Sensitivität des endoskopischen Screenings wird dadurch erschwert, dass das Kolitiskarzinom unter Umgehung der Adenom-KarzinomSequenz direkt aus zumeist flachen Läsionen entsteht, die auch dem erfahrenden Endoskopiker häufig entgegen. Bei der häufigen Pseudopolyposis infolge chronischer Entzündung ist die Detektion flacher Läsionen häufig unmöglich. Die Magnifikations- und Chromoendoskopie kann die Aussagekraft der Vorsorgekoloskopie deutlich erhöhen. So konnten wir selber in einer randomisierten, prospektiven Studie an 165 Patienten mit langjähriger CU in Remission zeigen, dass sich durch die Chromoendoskopie die Gesamtzahl der detektierten IEN um das über 3-Fache erhöhte und die Gesamtzahl der IEN in flachen Läsionen sogar um das 6-Fache bei unwesentlichem zeitlichem Mehraufwand für die zusätzliche Einfärbung des Kolons mit Methylenblau. Diese und andere Studien haben dazu geführt, dass die Chromoendoskopie in die Amerikanischen Leitlinien als „SURFACE Guidelines“ zur Krebsvorsorge bei CU aufgenommen wurden (SURFACE = Strict patient selection/Unmask the mucosal surface/Reduce peristaltic waves/Full-length staining of the colon/Augmented detection with dyes/Crypt architecture analysis/Endomicroscopic and endoscopic targeted biopsies). Völlig neue Dimensionen in der in-vivo-Analyse der Darmschleimhaut hat die konfokale Laserendomikroskopie (CLE) eröffnet. Bei der CLE ist es neben der 16 konventionellen Videoendoskopie möglich, mittels konfokalem Laser bis zu 250 µm in die Tiefe der Schleimhaut einzudringen und in vivo Schnittbilder der Transversalebene mit 1000-facher Vergrößerung zu generieren. Damit reicht die Auflösung in den Bereich der konventionellen Lichtmikroskopie und ermöglicht die Darstellung subzellulärer Strukturen. Die Visualisierung erfolgt mithilfe von Fluorescein. Die in-vivo-Beurteilung auf subzellulärer Ebene erlaubt die Detektion von Neoplasien, die dann gezielt biopsiert werden können. Das Potenzial dieser Methode konnte in einer randomisierten Studie an 153 Patienten gezeigt werden, die entweder konventionell videokoloskopiert wurden mit zufälligen Biopsien alle 10 cm oder panchromoendoskopiert und dann endomikroskopiert wurden mit gezielter Biopsieentnahme. Es konnten in der endomikroskopisch untersuchten Gruppe 19 versus 4 IEN detektiert werden mit einer Sensitivität von 94,7%, einer Spezifität von 98,3% und einer Genauigkeit von 97,8%. Die Anzahl der Biopsien konnte dabei von 42,2 Biopsien pro Patient auf 21,2 Biopsien reduziert werden. Das diagnostische Potenzial der CLE wird an Beispielen wie die in-vivo-Nachweisbarkeit von Helicobacter pylori im Magen oder von Bakterien in der Darmmukosa deutlich. Die CLE eröffnet ebenfalls neue Möglichkeiten der molekularen Bildgebung. Vor dem Hintergrund der pathomechanistischen Zusammenhänge zwischen Inflammation und Karzinogenese könnte eine effektive anti-entzündliche Therapie einen neuen Stellenwert für die Prävention des KRK bei CU bekommen. Eine chemoprotektive Wirkung konnte bislang nur in einer einzelnen retrospektiven Studie für Mesalazin gezeigt werden. Therapeutisches Ziel der Behandlung von CED war bislang die klinische Remission. Es ist bekannt, dass trotz subjektiver Beschwerdefreiheit häufig noch endoskopisch und histopathologisch eine signifikante Entzündungsaktivität vorlag. Unter dem Einsatz von Biologicals kam es zu der Beobachtung, dass die klinische Remission mit einer Abheilung der Darmschleimhaut einhergeht. Hieraus wurde das Konzept der „mukosalen Heilung“ entwickelt. Die klinische Bedeutung dieses Phänomens ist bislang noch unklar. Es ist denkbar, dass die mukosale Heilung ein prädiktiver Faktor für die Dauer der Remission ist. Dies würde eine Umkehr der bisher praktizierten Stufentherapie („Bottom-up“) zu einer „Top-down“-Strategie mit einer aggressiven Behandlung der CED von Anfang an rechtfertigen, ähnlich wie bei der rheumatoiden Arthritis. Im Kontext der Karzinogenese bei CU könnte eine „Top-down“-Strategie mit 17 dem unabhängigen Therapieziel der „mukosalen Heilung“ zu einer Verringerung des Karzinomrisikos führen. Die bisherigen experimentellen und klinischen Daten können derzeit jedoch allenfalls der Hypothesenbildung dienen. In Anbetracht der Risiken, der Belastungen und auch der Kosten dieser Behandlungsstrategien müssen prospektive kontrollierte Langzeitstudien an großen Patientenzahlen diese Konzepte auf ihre klinische Relevanz prüfen. 18 Darmzentren – aus Sicht der Pathologie A. Tannapfel Pathologie, Ruhr-Universität Bochum Darmkrebs gehört in Deutschland mit einer jährlichen Inzidenz von 70.000 Neuerkrankungen und einer Mortalitätsrate von 30.000 Menschen zu den häufigsten Tumorerkrankungen. Die Mortalität des Darmkrebses hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Neben Präventionsmaßnahmen wie der Vorsorgekoloskopie und der Erforschung hereditärer Darmkrebserkrankungen muss für die neu mit Darmkrebs diagnostizierten Patienten eine optimale, evidenzbasierte und leitlinienadaptierte Versorgung gewährleistet werden. Untersuchungen aus Deutschland legen nahe, dass einem nicht unerheblichen Anteil von Patienten eine leitliniengerechte Therapie vorenthalten wird. So erhalten lediglich etwa zwei Drittel der Patienten mit einem Kolonkarzinom im Stadium III eine adjuvante Chemotherapie. Gleichzeitig konnte eine Studie aus München zeigen, dass es zwischen einzelnen Krankenhäusern große Qualitätsunterschiede zu geben scheint. So schwankte die Lokalrezidivrate bei Patienten mit Rektumkarzinom zwischen 7% und 26%, der Anteil von Patienten im Stadium II/III, die eine adjuvante Therapie erhalten, hatten zwischen 23% und 71%. Die Gründung von Darmzentren wurde von der Deutschen Krebsgesellschaft als eine Möglichkeit gesehen, die Versorgungsqualität von Darmkrebspatienten in Deutschland zu verbessern. Ziel von Organzentren ist es, eine umfassende evidenzbasierte standardisierte Diagnostik und Therapie sicherzustellen. Ein Darmzentrum ist interdisziplinär aufgebaut und umfasst klinische und ambulante Kernleistungserbringer: Gastroenterologen, Viszeralchirurgen, Onkologen, Strahlentherapeuten, Pathologen und Radiologen. Auch wenn Mindestmengen nicht unumstritten sind, spiegeln sie zumindest eine gewisse Erfahrung wider. So wurde festgelegt, dass pro Zentrum mindestens 400 Koloskopien pro Jahr und 100 Polypektomien (inkl. Mukosektomien) vorgenommen werden müssen. Für jeden operativen Standort wurde als Mindestzahl die Operation von 50 kolorektalen Karzinomen inkl. mindestens 20 Rektumkarzinomen definiert. Auch pro Operateur wurden Mindestmengen definiert (Primäroperateur oder erste Assistenz): 25 kolorektale Karzinomoperationen inkl. mindestens 10 Rektumkarzinomeingriffen. Die Pathologie im Darmzentrum muss sich ebenfalls bestimmten Qualtitätsindikatoren unterwerfen 19 und sich damit einem Benchmarking unterziehen. Für die Beurteilung einer Institution ist eine Zusammenstellung mehrerer Qualitätsindikatoren in Form von sogenannten Indikatorprofilen anzustreben (ÄZQ 2001). Von den zahlreichen im Schrifttum angegebenen Indikatoren der Prozess- und Ergebnisqualität der pathologischen Diagnostik (DKG 1995, Hermanek 1996) wurden für das Indikatorprofil im Hinblick auf Therapiewahl und Outcome die Zahl histologisch untersuchter Lymphknoten bei radikaler Chirurgie und der Anteil lymphknotenpositiver Patienten unter allen Patienten mit radikaler Chirurgie ausgewählt. Ausmaß und Qualität der Mesorektumexzision, Häufigkeit von R0Resektionen und CRM-Status werden als Surrogat-Indikatoren der Ergebnisqualität später behandelt. Die geforderten Angaben des pathohistologischen Gutachtens liegen heute insbesondere seit Publikation der diesbezüglichen Empfehlungen des Berufsverbands Deutscher Pathologen und der Deutschen Gesellschaft für Pathologie (2005) nahezu immer vor, sodass die Aufnahme dieses Indikators in das Indikatorprofil nicht erforderlich erscheint. Für die Erstellung einer pN-Klassifikation ist nach UICC 2002 üblicherweise die histologische Untersuchung von 12 oder mehr regionären Lymphknoten erforderlich. Diese Empfehlung wurde auch vom Internationalen Dokumentationssystem für kolorektale Karzinome übernommen und fußt auf Daten von Scott und Grace 1989, sowie jenen der Studiengruppe kolorektales Karzinom, publiziert im UICC TNM Supplement 1993. Durch Untersuchung von mehr als 12 Lymphknoten ergibt sich eine nur geringfügige Verringerung der pN0-Fälle. Mehrfach wurde in den letzten Jahren die histologische Untersuchung von mehr Lymphknoten gefordert, so von mindestens 14 bzw. 17 Lymphknoten. Dennoch sollte vorerst am wohlbegründeten Standard der UICC festgehalten werden. Nach vorangegangener neoadjuvanter Radiotherapie ist die Zahl der aufzufindenden Lymphknoten verringert und zwar in Abhängigkeit von der Zeit zwischen Ende der Bestrahlung und der Operation. Nach der in Deutschland überwiegend angewandten neoadjuvanten Langzeitradiochemotherapie mit 6-wöchigem Intervall zur Operation wird die Zahl von 12 Lymphknoten in etwa 25% der Resektate nicht erreicht. Die angeführten Zahlen histologisch zu untersuchender Lymphknoten geben ausschließlich Hinweise zur Verlässlichkeit der pN-Klassifikation, erlauben jedoch keine Aussagen über das Ausmaß der Lymphknotendissektion. Hierzu müsste die 20 histologische Untersuchung wesentlich intensiver erfolgen. Dann werden bei Standardresektionen im Rektum median 29 Lymphknoten untersucht (unpublizierte Zahlen der Chirurgischen Universitätsklinik Erlangen 1995–2002). 21 Qualitätsmanagement bei gastrointestinalen Tumoren J. Graf Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie und Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie, Marburg Gastrointestinale Tumore und insbesondere das kolorektale Karzinom stellen die bei Männern und Frauen häufigsten Tumorerkrankungen in den industrialisierten Ländern dar. Im Gegensatz zu allen anderen Tumorerkrankungen existiert für das kolorektale Karzinom mit der Vorsorgekoloskopie eine Möglichkeit zur Prävention. Der tatsächliche Nutzen dieser Präventionsmaßnahme, aber auch die Wertigkeit aller anderen diagnostischen und therapeutischen Interventionen im Hinblick auf die Gesamtheit der gastrointestinalen Tumore ist abhängig von der Güte – sprich Qualität – der durchgeführten Maßnahmen. Gegenwärtig entsteht der Eindruck, Qualitätssicherung bzw. Qualitätsmanagement seien moderne industrielle Errungenschaften. Hierbei wird übersehen, dass es bereits im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Bostoner Chirurgen Earnest A. Codman Entwicklungen hin zur Qualitätssicherung in der Medizin gegeben hat. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden diese Initiativen unter anderem vom Arzt und Soziologen Prof. Avedis Donabedian strukturell und auch inhaltlich weitergeführt. Qualität selbst stellt jedoch keinen absoluten Wert dar, sondern ist immer relativ, d. h. Qualität ist der Vergleich zwischen einem Ist- und einem Soll-Zustand. Der IstZustand muss hierbei erfasst bzw. gemessen und mit einem festgelegten Standard – dem Soll – verglichen werden. Zwei wesentliche Gedanken sollten hierbei unbedingt Berücksichtigung finden: 1. Was nicht gemessen werden kann, kann auch nicht verbessert warden, und 2. Qualitätsmanagement ohne Maßnahmen zur Verbesserung der Prozessqualität ist nutzlos. Qualitätsmanagement Als „Qualitätsmanagement“ wird die Gesamtheit der Maßnahmen zur Planung, Steuerung und Überwachung der Qualität eines betrieblichen Leistungsprozesses – hier der Diagnose und Therapie gastrointestinaler Tumore – bezeichnet. 22 Um der Vielschichtigkeit des Gesundheitssystems bei der Qualitätsbeurteilung Rechnung zu tragen, unterteilte Donabedian die einzelnen Bereiche anhand ihrer Hauptcharakteristika in 3 Komponenten – Strukturen, Prozesse und Ergebnisse (Abbildung 1, Tabelle 1) (1). Struktur QUALITÄT Prozess Ergebnis Abbildung 1: Interdependenz von Struktur, Prozess und Ergebnis. Der jeweilige Einfluss einer einzelnen Komponente auf die Qualität lässt sich eher als Wahrscheinlichkeit, denn als lineare Beziehung darstellen. Strukturen, Prozesse und Ergebnisse sind jedoch keine Attribute der Qualität per se. Diese Einteilung weist lediglich die komplexen Interaktionen des Gesundheitswesens einzelnen Aufgabenbereichen zu. Direkte Rückschlüsse auf die Qualität einer Komponente dieses Dreikomponentenmodells durch die Kenntnis der Qualität einer anderen Komponente sind nicht ohne Weiteres möglich: Die Vorstellung der linearen Beziehung mit Beeinflussung der Prozesse durch die Strukturen und der Ergebnisse durch die Prozesse ist simplifiziert und idealisiert. Die Querverbindungen untereinander sind wesentlich komplexer, und eine willkürliche Trennung zwischen Strukturen und Prozessen, Prozessen und Ergebnissen und Strukturen und Ergebnissen ist oft weder möglich noch sinnvoll. Wesentlicher als eine klare Trennung der Komponenten voneinander ist die Fähigkeit, das Miteinander der einzelnen Bestandteile – d. h. Ursachen und Wirkungen – strukturiert zu erfassen. 23 Tabelle 1: Strukturen, Prozesse, Ergebnisse – Konzeptionalisierung der Qualität (1). Strukturen Die Strukturen kennzeichnen die organisatorischen Rahmenbedingungen der Patientenversorgung. Hierzu gehören das Budget, die räumliche und medizinisch-technische Ausstattung, die Anzahl und Ausbildung der Mitarbeiter, Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung, allgemeine Organisationsaspekte wie z. B. die Umsetzung von Standards, Supervision, Risiko- und Qualitätsmanagement etc. Es wird im Allgemeinen von einer positiven Korrelation zwischen der Strukturqualität, den Prozessen und den Ergebnissen ausgegangen Prozesse Prozesse beschreiben die Aktivitäten der Patientenversorgung und sind im Wesentlichen durch den direkten Patientenbezug charakterisiert. Hierzu gehören die Diagnosestellung, Therapie, Rehabilitation, Prävention, Patientenschulung und anderes mehr. Zeitgerechtes Handeln und Kommunikation sind Schlüsselelemente der Prozessqualität. Hohe Prozessqualität ist idealerweise mit einer hohen Ergebnisqualität assoziiert. Ergebnisse Ergebnisse sind erwünschte oder auch unerwünschte Veränderungen infolge von therapeutischen Interventionen. Sie stellen den primären Beurteilungsmaßstab für den Erfolg oder Misserfolg einer medizinischen Intervention (oder des Verzichts darauf) dar. Ergebnisse sind mitunter schwierig zu erfassen, da in Abhängigkeit von der Erkrankung und der Behandlung sehr unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe zu berücksichtigen sind. Ein einzelner Surrogatparameter, der mit hinreichender Sensitivität und Spezifität in diesem Kontext Aussagen über die Qualität von Strukturen, Prozessen und Ergebnissen erlaubt, existiert nicht. Dafür sind auch die Anforderungen der einzelnen Kategorien zu unterschiedlich, weshalb für eine umfassende Qualitätssicherung in der Regel die Kombination verschiedener Parameter sinnvoll und notwendig ist. 24 Steuerungsinstrumente der Qualitätssicherung Auch bei den Steuerungsinstrumenten der Qualitätssicherung erweist sich die Unterteilung in Strukturen, Prozesse und Ergebnisse als sinnvoll, da – konkordant zu den Surrogatparametern – nicht alle Instrumente gleichermaßen gut für die Steuerung der Qualität der einzelnen Komponenten geeignet sind (Tabelle 2) (2). Tabelle 2: Qualitätsbereiche und die geeigneten Steuerungsinstrumente. Standards Richtlinien Indikatoren Strukturen !!! ! ! Prozesse !! !!! !! Ergebnisse ! !! !!! !!! = sehr gut geeignet; !! = gut geeignet; ! = geeignet Standards wie z. B. Vorgaben hinsichtlich der räumlich apparativen Ausstattung der Endoskopie oder der Qualifikation des medizinischen Personals, sind geeignet, die Strukturen der jeweiligen Einrichtung zu bewerten. Da es sich bei Strukturen häufig um ressourcenintensive (d. h. teure) Bereiche handelt, sind nur verbindliche Standards sinnvoll. Einfache Empfehlungen reichen hier in der Regel für eine Umsetzung nicht aus. Im Bereich der Onkologie haben sich hier zusehends organspezifische Tumorzentren, die multidisziplinär Patienten mit Tumorerkrankungen betreuen und gleichzeitig Qualitätssicherung zur Verbesserung der onkologischen Versorgung betreiben, etabliert. An universitären Einrichtungen finden sich oft auch sogenannte „Comprehensive Cancer Centres (CCC)“, die neben den Aufgaben eines Tumorzentrums auch noch wissenschaftliche Aktivitäten umfassen. Richtlinien, häufig im klinischen Kontext als SOP (standard operating procedure) bezeichnet, stellen die Methode der Wahl zur Bewertung der verschiedenen Prozesse bei Patienten mit gastrointestinalen Tumoren dar. Die Qualität der Prozesse kann hierbei an 2 wesentlichen Merkmalen festgemacht werden: 1. dem Vorhandensein von entsprechenden, aktuellen SOPs, 2. der Beachtung dieser Richtlinien in der alltäglichen Patientenbetreuung (3). Die Akzeptanz solcher SOPs kann durch die spezifische, gemeinsame Entwicklung für den eigenen Arbeitsbereich (Ambulanz, Endoskopie, OP, Pathologie, etc.), die 25 regelmäßige Schulung aller Beteiligten und die gemeinsame Darstellung der Datenanalyse (Ist-Soll-Vergleich) verbessert werden. Ergebnisse lassen sich am ehesten mittels Indikatoren abbilden, die ebenso zur Prozessevaluation eingesetzt werden können. Indikatoren können entweder einfache, dichotome Variablen, wie z. B. komplette versus inkomplette Koloskopie sein, oder aber aus patientenzentrierten Aspekten, wie z. B. der allgemeinen Überlebenszeit oder der Lebensqualität während und nach der entsprechenden Therapie bestehen. Ziele des Qualitätsmanagements Bei den gastrointestinalen Tumorerkrankungen sind als wesentliche Ziele zu nennen: − Prävention durch Vorsorgemaßnahmen und hier insbesondere die Vorsorgekoloskopie zur Verhinderung kolorektaler Karzinome. − Frühzeitige Diagnosestellung bei den übrigen gastrointestinalen Tumorerkrankungen. − Leitliniengerechte Diagnostik und Therapie ohne redundante Interventionen. − Vermeiden von Wartezeiten und Versorgungsunsicherheit auf Seiten der Patienten. − Bündelung der Expertise im Rahmen strukturierter und regelmäßiger multidisziplinärer Fallkonferenzen. Im Bereich der gastrointestinalen Tumore haben sich zur Erreichung dieser Ziele bereits eine ganze Reihe von universitären, aber auch außeruniversitären Darmzentren gebildet, die sich oftmals einer Zertifizierung unterzogen haben, um auch einer externen Überprüfung (Audit) der gestellten Zielanforderungen zu unterliegen. Ob extern zertifiziert oder intern auditiert – der wesentlichste Aspekt des Qualitätsmanagements ist die kontinuierliche Kontrolle der Strukturen und vor allem der Prozesse. Hierzu eignen sich Werkzeuge, wie der Qualitätszirkel (Abbildung 2). Entscheidend ist hier, dass der Kreis tatsächlich auch geschlossen wird. Werden nur Daten erhoben, ohne inhaltliche Veränderungen hin zu Struktur- und Prozessverbesserungen vorzunehmen, Betriebsamkeit. 26 enden alle Aktivitäten lediglich in inhaltsloser Abbildung 2: Qualitätszirkel als Instrument zur kontinuierlichen Analyse der Prozess- und Ergebnisqualität (siehe auch Frutiger [4] und Graf [5]). Literatur: 1. Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. Milbank Mem Fund Q. 1966; 44 (3 Suppl): 166–206. 2. Gebert AJ. Konzeptionelle Ansätze in der Qualitätsbeurteilung, Qualitätsforderung und Qualitätssicherung. Swiss Surg. 1995; 1: 8–14. 3. Berenholtz SM, Pronovost PJ, Lipsett PA, Hobson D, Earsing K, Farley JE et al. Eliminating catheter-related bloodstream infections in the intensive care unit. Crit Care Med. 2004; 32: 2014–2020. 4. Frutiger A. Driving improvements: Quality management in the intensive care unit. In: Sibbald WJ, Bion JF, editors. Evaluating critical care. Using health services research to improve quality. New York, Berlin, Heidelberg: Springer, 2001: 321–335. 5. Graf J. Do you know the frequency of errors in your intensive care unit? Crit Care Med. 2003; 31 (4): 1277–1278. Korrespondenzadresse: PD Dr. Jürgen Graf Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie und Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie Philipps-Universität Marburg Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH Standort Marburg Baldingerstraße 35043 Marburg 27 Karzinomentstehung durch die chronische Entzündung im Magen C. Prinz Klinikum rechts der Isar der TU München Die jahrzehntelange Entzündung durch die Infektion mit Helicobacter pylori ist der entscheidende Faktor für die Induktion präkanzeröser Veränderungen im Magen und führt in einem Teil der Infizierten zur Entstehung der distalen Adenokarzinome. Wichtige Kofaktoren in diesem Zusammenhang sind der Gehalt an Vitamin C und Antioxidanzien in der Nahrung und im Magen (protektiv), sowie der Gehalt an Nitraten und Nitrosaminen (schädigend). Eine Metaanalyse über den Zusammenhang zwischen der H. pylori-Infektion und der Mortalität durch distale Magenkarzinome wurde Anfang der 90er-Jahre publiziert. Es wurde die Seroprävalenz von H. pylori-Antikörpern an insgesamt 3194 randomisiert ausgewählten Patienten bestimmt, dabei wurden 17 Zentren in 13 Ländern beobachtet und eine Regressionsanalyse durchgeführt. Es fand sich eine signifikante Korrelation zwischen der Prävalenz von H. pylori-Antikörpern und der Inzidenz sowie der Mortalität distaler Magenkarzinome. 3 große prospektive Studien haben den Zusammenhang zwischen der Infektion mit H. pylori und der Entstehung von Magenkarzinomen eindeutig nachgewiesen. Dabei wurden Fallkontrollstudien oder Kohortenstudien durchgeführt. Die H. pylori-Infektion wurde durch Antikörpernachweis in großen Blutbanken in den USA und in England bestimmt. Im Mittel zeigte sich eine H. pylori-Seropositivität etwa 13 Jahre vor der Diagnose des Magenkarzinoms. Es fand sich in allen Studien eine Assoziation von H. pylori mit intestinalem und diffusem Typ. Das relative Risiko für die Entwicklung von distalen Magenkarzinomen liegt zwischen 2 und 8, wenn eine H. pylori-Infektion vorausging. In einer Metaanalyse von Forman wurden die Patienten in einer Gesamtgruppe zusammengefasst und die relativen Risiken verglichen. Dabei zeigte sich, dass das relative Risiko ansteigt, je länger die Seroprävalenz der H. pylori-Infektion zurückliegt. Ein wesentlicher Faktor für die Kanzerogenese dieser Karzinome ist also die lange Entwicklungsdauer (Tabelle 1). Auch in den asiatischen Ländern zeigt sich ein eindeutiger epidemiologischer Zusammenhang zwischen der H. pylori-Infektion und der Entstehung von distalen Magenkarzinomen sowie Magenfrühkarzinomen. 28 Intervall Probenentnahme - Diagnose (J) Magen-Ca % H. p.+ (n) Kontr. % H. p.+ (n) O.R. 95% CI <5 5–9 10–14 > 15 20 (25) 37 (46) 70 (78) 88 (98) 34 (58) 46 (85) 58 (93) 65 (98) 2,1 2,3 4,4 8,7 0,6–8,7 0,9–6,5 1,8–13,0 2,7–44,7 Tabelle 1: Metaanalyse von Forman über den zeitlichen Zusammenhang zwischen H. pylori-Infektion, Entstehung von Magenkarzinomen und Vergleich der relativen Risiken. Tiermodelle. Neben den epidemiologischen Zusammenhängen hat man in den letzten Jahren auch geeignete Tiermodelle gefunden, in denen die Inokulation mit H. pylori zur Krebsentstehung führt. Damit erfüllt die H. pylori-Infektion auch ein entscheidendes Koch’sches Postulat. In den Mongolischen Wüstenrennmäusen, sogenannten Gerbils, führt die H. pylori-Infektion nach etwa 6 Monaten zur Entstehung von Atrophie, Metaplasie, schließlich auch zur Entstehung distaler Magenkarzinome. Dabei wurde als pathogenetischer Mechanismus diskutiert, dass es durch die Achlorhydrie zu einer veränderten Mikroflora kommt, welche die Entstehung von Nitrosoverbindungen ermöglicht und damit zur Kanzerogenese beiträgt. Kosten-Nutzen-Analyse bei der H. pylori-Eradikation im Sinne einer Karzinomprophylaxe. Durch die eindeutigen experimentellen und statistischen Zusammenhänge wurde Helicobacter von der WHO als ein Typ-1-Karzinogen eingestuft. Trotzdem ist es nicht sinnvoll, eine generelle Eradikation dieses Keims in der Weltbevölkerung anzustreben. Ein generelles H. pylori-Screening mit nachfolgender Eradikation zur Karzinomprophylaxe ist weder kosteneffektiv noch praktikabel. Daher sollte die Eradikation auf Risikogruppen beschränkt bleiben. Dazu zählen Patienten, die Magenkarzinome in der Familienanamnese haben, sowie Patienten, die schwere histologische Veränderungen wie Atrophie, intestinale Metaplasie und insbesondere Dysplasie aufweisen. Dies wurde in den Empfehlungen der europäischen und kanadischen Gesellschaften berücksichtigt. 29 Tabelle 2: Therapieempfehlungen der European Helicobacter Pylori Study 2002 Group zur Eradikation von H. pylori bei Patienten mit chronischer Gastritis („Maastricht Guidelines“) 1. Schwere histologische Veränderungen - atrophische Gastritis, intestinale Metaplasie, Dysplasie, Adenome 2. Magenkarzinome in der Familienanamnese 3. Zustand nach Resektion eines Magenfrühkarzinoms sehr selten: Morbus Ménétrier, lymphozytäre Gastritis Zusammenfassung. Chronische Entzündungen im Magen werden durch eine Autoimmunreaktion gegen Parietalzellen, durch die H. pylori-Infektion oder durch Gallereflux bzw. durch regelmäßige Einnahme bestimmter Medikamente ausgelöst. Histopathologisch findet sich bei jeder dieser Gastritis-Typen eine charakteristische Morphologie. Insbesondere die chronische H. pylori-Infektion ist nach jahrzehntelanger Exposition mit der Kanzerogenese im Magen assoziiert. Daher empfiehlt die „European Helicobacter Pylori Study Group (EHPSG)“ die Eradikation von Patienten mit schweren histologischen Veränderungen im Magen, z. B. mit atrophischer Gastritis oder intestinaler Metaplasie. Auch Patienten mit einer Familienanamnese von Magenkarzinomen sollten von H. pylori eradiziert werden, da möglicherweise besonders virulente Stämme in der Familie übertragen wurden. Vor Kurzem wurde eine genetische Suszeptibilität für Magenkarzinome identifiziert, die besonders in Zusammenhang mit der Helicobacter-Infektion endoskopischer Kontrollen bedarf. 30 besonderer Behandlung und Barrett-Ösophagus – Wie gefährlich ist er wirklich? G. Seitz Institut für Pathologie, Klinikum der Sozialstiftung Bamberg Seit Mitte der 70er-Jahre finden sich Hinweise auf das erhöhte Adenokarzinomrisiko bei Barrett-Ösophagus, die heute immer noch fälschlicherweise in der „Zehnerregel“ zusammengefasst werden: 10% (bis 15%) aller Refluxkranken leiden an einer endoskopisch diagnostizierbaren Reflux-Ösophagitis und von diesen entwickeln wiederum 10% der Patienten einen Barrett-Ösophagus. In der Folgezeit erkranken bis zu 10% der Patienten mit Barrett-Ösophagus an einem Adenokarzinom des unteren Ösophagus. Es liegen zahlreiche retrospektive und prospektive Studien zum Karzinomrisiko beim Barrett-Ösophagus vor. In der Summe erkrankt in den retrospektiven Studien 1 Patient auf 161 Patientenjahre (Risikoerhöhung um Faktor 36) und in den prospektiven Studien 1 Patient auf 104 Patientenjahre (Risikoerhöhung um Faktor 66). Aktuell geht man von einem Erkrankungsrisiko von 0,4–1,0% im Jahr aus. Aktuelle Zahlen zur Barrett-Karzinom-Sequenz Bei einer Auswertung von nahezu 30.000 Ösophagusbiopsien des eigenen Instituts wird offensichtlich, dass die lange hochgehaltene „Zehnerregel“ keinen Bestand hat (vgl. Tab. 1). Häufigkeit des Barrett-Ösophagus und Barrett-Karzinoms – Pathologie Bamberg (n = 28.719 Ösophagusbiopsate) Barrett-Ösophagus Absolut % 1476 5,1% Mikroskopischer Barrett-Ösophagus 133 9,5% Short-segment-Barrett-Ösophagus 974 69,6% Long-segment-Barrett-Ösophagus 292 20,9% Barrett-Karzinom 77 5,2% Tabelle 1 31 In dieser Auswertung liegt die Rate der Barrett-Karzinome mit 5% nur halb so hoch wie erwartet, auch liegt in dieser Auswertung die Zahl der nachgewiesenen intraepithelialen Neoplasien (früher Dysplasien) nur bei einem Zehntel der invasiven Karzinome (vgl. Tab. 2). Barrett-Ösophagus – Häufigkeit der intraepithelialen Neoplasien Barrett-Ösophagus Bamberg Grunewald et al. 93,8% 88,1% Mikroskopischer Barrett-Ösophagus 0,5% 1,6% Short-segment-Barrett-Ösophagus 0,5% 1,0% Long-segment-Barrett-Ösophagus 5,2% 9,3% Tabelle 2 Das starke Überwiegen der invasiven Karzinome gegenüber der intraepithelialen Neoplasie als vermeintlichem Vorläufer des Barrett-Karzinoms wurde bereits von der Bayreuther Arbeitsgruppe (Grunewald et al., 1997) beschrieben. Auch in den letzten Jahren waren in den beiden Instituten invasive Karzinome weitaus häufiger als intraepitheliale Neoplasien. Diese Ergebnisse stehen den Zahlen amerikanischer Kollegen (Schnell et al., 2001; Gopal et al., 2003) entgegen, die durchweg hohe Prozentsätze an intraepithelialen Neoplasien publizierten. Diese Diskrepanz zwischen anglo-amerikanischen und europäischen Pathologen und die Tatsache, dass ca. 75% der Barrett-Karzinome bei der Indexendoskopie (Vieth et al., 2006) diagnostiziert werden, gibt berechtigten Zweifel am Erfolg von endoskopischbioptischen Kontrollen bei Barrett-Ösophagus. Mit anderen Worten, es besteht die Frage, ob man nicht ein falsches Dogma festhält. 32 M2PK – ein neuer Tumormarker?! P.D. Hardt Medizinische Klinik und Poliklinik III, Universitätsklinikum Gießen und Marburg Die Pyruvatkinase M2 (M2PK) ist ein Isoenzym der Pyruvatkinase, welches sich normalerweise in embryonalen und adulten Stammzellen, aber auch in Tumorzellen findet. Im Tumorstoffwechsel kommt es nun charakteristischerweise zu einer Veränderung der Struktur von der metabolisch aktiven tetrameren Form zu einer dimeren, metabolisch inaktiven Form, welche als Tumor-M2PK bezeichnet wird. Mittels spezifischer Antikörper wurde die Tumor-M2PK in unterschiedlichsten Tumorgeweben nachgewiesen, unter anderem in Bronchialkarzinomen, gastrointestinalen Karzinomen, Urothelkarzinomen und Mammakarzinomen. Bereits vor etlichen Jahren wurde daher darüber diskutiert, ob sich der Nachweis dieses besonderen Isoenzyms als Tumormarker eignen könnte. In zahlreichen Publikationen wurde zunächst über den Einsatz eines spezifischen ELISA zur Detektion der Tumor-M2PK im EDTA-Plasma berichtet. Hierbei konnte gezeigt werden, dass der Marker bei einigen Karzinomen, für die bisher keine Standardmarker existieren, eingesetzt werden könnte. So wurde beispielsweise für das Ösophaguskarzinom eine Sensitivität von 48–60% (1, 2) und für das Nierenzellkarzinom 27,5–66,7% beobachtet (3). Bei anderen Tumorentitäten (Kolon, Magen) zeigte sich eine den Standardmarkern vergleichbare oder sogar deutlich bessere Sensitivität, beim Pankreaskarzinom war CA 19-9 etwas überlegen (1, 2). Im Rahmen der Untersuchungen zum EDTA-Plasma fiel allerdings sehr früh auf, dass eine Erhöhung dieses Markers offenbar nicht karzinomspezifisch ist, da auch Patienten mit entzündlichen Erkrankungen erhöhte Werte aufweisen können (4). Dies trifft aber auch für die meisten anderen etablierten Tumormarker zu, sodass gefolgert werden kann, dass die Bestimmung der Tumor-M2PK im EDTA-Plasma sowohl bei Karzinomen ohne etablierte Tumormarker als auch bei Erkrankungen mit bereits etablierten Markern eine Bereicherung im Sinne eines weiteren klassischen Tumormarkers darstellt. Aufgrund der geringen Spezifität ist dieser Test (wie die meisten anderen Marker) allerdings nicht zum Screening von Tumorerkrankungen, sondern im Rahmen der Primärdiagnostik und im Follow-up einzusetzen. Grundlegend anders verhält es sich dagegen bei der Bestimmung der Tumor-M2PK im Stuhl: Auch hier sind zwar „falsch positive“ Befunde beschrieben, etwa bei 33 chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Divertikulitis oder akuten Enteritiden. Wenn man diese Erkrankungen, die ja in aller Regel klinisch bekannt sind und ohnehin einer endoskopischen Diagnostik unterliegen, nicht einbezieht, sondern den Test in asymptomatischen Screeningkollektiven einsetzt (5, 6), so ergibt sich durchaus die Möglichkeit eines Einsatzes im Sinne eines Screeningmarkers. Da sich das kolorektale Karzinom aus verschiedenen Gründen besonders gut für eine frühe Diagnostik und Therapie anbietet, die beste diesbezügliche Maßnahme, nämlich die Screeningkoloskopie, aber trotz intensiver Aufklärungsarbeit bisher lediglich von ca. 10% der Vorsorgeberechtigten in Anspruch genommen wird, werden ergänzende Verfahren dringend benötigt. Die Tumor-M2PK ist in den bisherigen Studien mit einer Sensitivität von ca. 85% und einer Spezifität von ca. 79% (5, 6) dem FOBT deutlich überlegen, und die Bestimmung von charakteristischen Mutationen im Stuhl eignet sich für den klinischen Einsatz bis heute nicht. Wenn also ein ergänzender Screeningmarker für das kolorektale Karzinom erforderlich ist, so erscheint die Bestimmung der Tumor-M2PK im Stuhl diesbezüglich als besonders geeignet. Literatur: 1. Hardt PD, Ngoumou BK, Rupp J, Schnell-Kretschmer H, Kloer HU. Tumor M2pyruvate kinase: a promising tumor marker in the diagnosis of gastro-intestinal cancer. Anticancer Res. 2000; 20 (6D): 4965–4068. 2. Schulze G. The tumor marker tumor M2-PK: an application in the diagnosis of gastrointestinal cancer. Anticancer Res. 2000; 20 (6D): 4961–4964. 3. Roigas J, Schulze G, Raytarowski S, Jung K, Schnorr D, Loening SA. Tumor M2 pyruvate kinase in plasma of patients with urological tumors. Tumour Biol. 2001; 22 (5): 282–285. 4. Oremek GM, Müller R, Sapoutzis N, Wigand R. Pyruvate kinase type tumor M2 plasma levels in patients afflicted with rheumatic diseases. Anticancer Res. 2003; 23 (2A): 1131–1134. 5. Hardt PD, Mazurek S, Toepler M, Schlierbach P, Bretzel RG, Eigenbrodt E, Kloer HU. Faecal tumour M2 pyruvate kinase: a new, sensitive screening tool for colorectal cancer. Br J Cancer. 2004; 91 (5): 980–984. 6. Haug U, Rothenbacher D, Wente MN, Seiler CM, Stegmaier C, Brenner H. Tumour M2-PK as a stool marker for colorectal cancer: comparative analysis in a large sample of unselected older adults vs. colorectal cancer patients. Br J Cancer. 2007; 96 (9): 1329–1334. 34 Anschriften der Referenten und Vorsitzenden Prof. Dr. D. Bartsch Allgemein- und Viszeralchirurgie Städtische Kliniken Bielefeld Klinikum Mitte Teutoburger Str. 50 33604 Bielefeld Prof. Dr. J. Mayerle Klinik für Innere Medizin A Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Friedrich-Loeffler-Str. 23a 17475 Greifswald PD Dr. J. Graf Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie und Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie Philipps-Universität Marburg Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Marburg Baldingerstraße 35043 Marburg Prof. Dr. C. Prinz Innere Medizin II Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität Ismaninger Str. 22 81675 München Prof. Dr. T. Gress Gastroenterologie Universitätsklinikum Gießen und Marburg Baldingerstr. 35043 Marburg PD Dr. P.D. Hardt Medizinische Klinik und Poliklinik III Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH Rodthohl 6 35385 Gießen PD Dr. M. Holtmann I. Medizinische Klinik und Poliklinik Johannes Gutenberg-Universität Langenbeckstr. 1 55131 Mainz Prof. Dr. M.P. Manns Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie Medizinische Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover Prof. Dr. E. Roeb Gastroenterologie Universitätsklinikum Gießen und Marburg Paul-Meimberg-Str. 5 35392 Gießen Prof. Dr. K.L. Rudolph Institut für Molekulare Medizin und Max-Planck-Forschungsgruppe Stammzellalterung Universität Ulm Albert-Einstein-Allee 11 89081 Ulm Prof. Dr. G. Seitz Institut für Pathologie Klinikum der Sozialstiftung Bamberg Buger Str. 80 96049 Bamberg Dr. S.V. Siegmund II. Medizinische Klinik (Gastroenterologie, Hepatologie & Infektionskrankheiten) Universitätsklinikum Mannheim Theodor-Kutzer-Ufer 1–3 68167 Mannheim 35 Prof. Dr. A. Tannapfel Pathologie Ruhr-Universität Bochum Bürkle-de-la-Camp-Platz 1 44789 Bochum Prof. Dr. S. Zeuzem Medizinische Klinik I Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt Theodor-Stern-Kai 7 60590 Frankfurt 36